 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
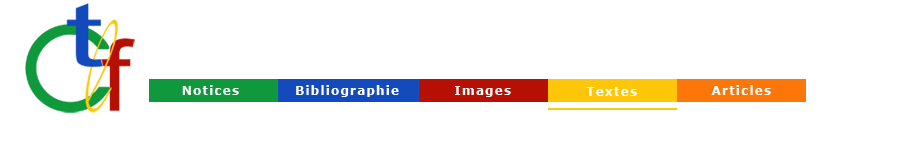
Zur Chronologie
der
indogermanischen Sprachforschung
von
Georg Curtius.
[Introduction]
Neuerdings ist die Streitfrage vielfach erörtert, ob die Sprachwissenschaft
zu den Naturwissenschaften oder in ein andres grosses Wissensgebiet
gehöre. Mehrere Forscher von Bedeutung, namentlich
Schleicher und Max Müller haben sich für die erstere, Steinthal dagegen
für die letztere Ansicht ausgesprochen. Bei solchen ganz in's allgemeine
gehenden Eintheilungen und Fachbestimmungen ist das Ergebniss in der
Regel ein unbefriedigendes. Wer kann leugnen, dass die Methode, welcher
sich die heutige Sprachwissenschaft bedient, eine der naturwissenschaftlichen
ähnliche ist? Naturforscher fühlen sich angeheimelt wenn
wir ihnen Gelegenheit bieten einen Blick in die Werkstätte der Sprachwissenschaft
zu thun. Andererseits aber gibt es Seiten des Sprachlebens,
welche solcher Behandlung spotten. Das ganze Gebiet der Syntax gehört
dahin, die Entstehung, Fixirung und Verzweigung der Wortbedeutungen
ebenfalls. Bei allem Streben nach Genauigkeit und Schärfe
wird hier ein tastend synthetisches Verfahren unerlässlich sein, wie es
eher an das des Historikers erinnert. Und doch gehören diese Seiten
ebenso wesentlich zur Sprache wie jene andern. Es kann nicht damit
abgethan sein, dass man sie mit dem Worte ‚Function‘ aussondert oder
gar einer andern Disciplin zuweist. In ähnlichem Sinne spricht sich auch
neuerdings Bréal in seiner anziehenden kleinen Schrift sur la forme et la
fonction des mots aus.
Bei keiner Betrachtung der Sprache, selbst bei der Analyse der
Formen, ja bei der Feststellung von Lautgesetzen kann man des Begriffs
der Analogie entrathen, die etwas rein geistiges und, so weit ich sehe,
dem Naturleben fremdes ist. Der Acc. Pl. πόλεις wird sich aus den
187Grundformen πολι-νς oder πολι-ας schwerlich, sondern nur aus der trägen
Gewohnheit erklären lassen den Accus. Pl. dem Nom. Pl. gleich zu
bilden. Gleich geistig ist der Trieb der Differenzirung, der sich ebenfalls
deutlich wahrnehmen lässt. Ihm verdanken wir es, dass aus der gemeinsamen
W. ar im Griechischen drei nach Laut und Bedeutung
geschiedene ἀρ ἐρ ὀρ hervorgingen. So blickt hier überall aus dem
scheinbar rein sinnlichen ein geistiges hervor und nur die gemeinsame
Berücksichtigung von beidem führt zur vollen Einsicht. Auch insoweit
jene Gemeinschaft der Sprach- mit der Naturwissenschaft eine wirklich
berechtigte ist, findet sie doch wohl besonders mit denjenigen Naturwissenschaften
statt, die wie die Geologie und Paläontologie sich mit
veränderlichen, im Laufe der Zeiten sehr verschiedenartigen Objecten
befassen. Wenn Max Müller die Anwendung des Wortes Geschichte auf
die Sprache ablehnt, so bequemt er sich da wohl mehr einem engen
specifisch englischen Gebrauche des Wortes history an. Wir sind, und
gewiss mit Recht, gewohnt der Sprache Geschichte zuzusprechen. Denn
wo ein Werden ist, da ist Geschichte. So gut es von andern Objecten,
die dem Einfluss menschlichen Willens mehr oder weniger entzogen
sind, wie von dem Recht, der Religion, der Sitte, ja selbst den Trachten
eine Geschichte gibt, so gut kommt sie der Sprache zu. Ist doch die
genetische Auffassung des Sprachlebens gerade das unterscheidende der
neuern Sprachwissenschaft von der älteren, die sich entweder auf blosse
Statistik, oder auf den Versuch einer Systematik der Spracherscheinungen
beschränkte. Der Grundzug der Sprachwissenschaft ist überall, mag
sich diese in den engeren Kreisen einer einzelnen auf Grund von Urkunden
zu erforschenden Sprache, oder in weiteren Bahnen bewegen,
ein historischer.
Aus dieser historischen Richtung folgt nun aber ein weiteres. Bei
jeder geschichtlichen Betrachtung handelt es sich um eine Reihenfolge,
um das früher und später wie im einzelnen, so auch im ganzen.
Geschichte ist nichts ohne Chronologie und eine aus chronologischen
Daten hervorgehende Periodisirung. Gibt es also eine Sprachgeschichte,
so muss auch eine Chronologie dieser Geschichte erstrebt, muss eine
gewissermassen neue Wissenschaft, oder sagen wir bescheidener, wissenschaftliche
Aufgabe aufgestellt werden, die wir Sprachchronologie
oder chronologische Sprachbetrachtung nennen können. Freilich
bestimmte Ueberlieferungen, Aeren, Notizen irgend welcher Art, wie
188sie die Grundlage einer Chronologie der s. g. Weltgeschichte bilden,
liegen für die Sprachwissenschaft nur in verhältnissmässig kurzen und
späten Perioden vor. Sie sind z. B. für die Geschichte der älteren lateinischen
Sprache mit bewundernswürdigem Scharfsinn ausgebeutet.
Jenseits aber der literarisch oder monumental bezeugten Sprachperiode,
das heisst für den unendlich viel umfassenderen Theil der Sprachgeschichte
fehlt es an solchen äusseren Anhaltepunkten gänzlich. Wir sind
ausschliesslich auf innere Kriterien angewiesen. Aber gerade weil uns,
so zu sagen, greifbare Merkmale der Zeit abgehen, wie sie bei der Geschichte
andrer Objecte meist sofort zur Hand sind, ist hier die Aufgabe,
die Folge der geschichtlichen Vorgänge zu bestimmen, trotz der
grösseren Schwierigkeit, doch auch eine um so notwendigere. Ohne
Chronologie bliebe die Sprachgeschichte ein Aggregat einzelner Thatsachen
und selbst diese Thatsachen haben keine Sicherheit, so lange sie
nicht an anderen Halt und in dem gesammten Entwicklungsgang ihre
feste Stelle gewinnen.
Erwägen wir nun in Bezug auf die indogermanischen Sprachen,
mit denen wir es hier ausschliesslich zu thun haben, die Ausführbarkeit
einer chronologisch geordneten Geschichte, so begreift sich diese am
leichtesten in Bezug auf die Laute. Es ist eine allgemein anerkannte
Thatsache, dass die Laute der Sprache mit der Zeit verwittern, das
heisst, an Kraft der Articulation und Fülle des Klanges einbüssen. Wo
wir also in der einen Sprache den volleren, in der andern den schwächeren
Laut finden, ist die eine Form unbedingt die ältere, die andere
die jüngere, wir haben hier also eine chronologische Reihenfolge und
können von den Formen der einzelnen Sprachen, also z. B. vom gr.
ἵππο-ς und Skt. açva-s zu akva-s als der gemeinsamen, beiden chronologisch
vorausgehenden Grundform aufsteigen, auch in vielen Fällen
die Stufen welche das Wort durchlief mit ziemlicher Sicherheit nachweisen.
Nachdem die vergleichende Grammatik anfangs, wie es kaum
anders sein konnte, mehr mit dem Verzeichnen dessen beschäftigt war,
was sich als den verwandten Sprachen gemeinsam ergab, ist gerade in
neuerer Zeit das Bestreben, die Reihen solcher Thatsachen zu erkennen
immer mehr in den Vordergrund getreten.
Bahnbrechend war nach dieser Richtung hin schon Jacob Grimm.
Die Entdeckung der Lautverschiebung hat eine wesentlich chronologische
Seite. Erkannte er doch, dass zweimal in sehr verschiedenen Zeiten
189der Sprachgeschichte dieselben oder doch ahnliche Verschiebungen der
Laute eintraten, und zeigte in grossartigster Weise die Bedeutung solcher
Wahrnehmungen für die Sprach- und Völkergeschichte. Dennoch
nahm er für die ganze Erscheinung einen willkürlich gewählten Ausgangspunkt
an, und erst spater ist es gelungen, theils diesen zu berichtigen,
theils den Zwischenstufen zwischen den einzelnen Hauptperioden
näher nachzuspüren, und danach, wie ich glaube, jene Erscheinungen
in eine richtigere chronologische Ordnung zu bringen. Auch anderswo
liegt der Fortschritt der Wissenschaft in Bezug auf die Behandlung
der Laute wesentlich in der verschärften Beachtung des Stufenganges.
Dass einem sanskritischen j mehrfach griechisches ζ entspricht erkannten
schon Bopp und Pott. Wie, durch welche Mittelstufen hindurch j zu
ζ wurde, zeigte erst Schleicher durch die umfassendste Zusammenstellung
ähnlicher Vorgänge in den verschiedensten Sprachen. Die
alte Grammatik begnügte sich damit Verwechselungen oder Vertauschungen
der Laute anzunehmen, also z. B. zwischen gr. σ und spir. asp.: σῦς
und ὗς, lat. semi und gr. ἡμι. Welcher dieser Laute der ältere war, fragte
sie entweder gar nicht, oder sie beantwortete diese Frage ungenügend,
sie brachte es wesentlich nur zu der Formel: a wechelt mit b. Die vergleichende
Grammatik führte sofort zu festeren Aufstellungen, also z. B.
s wird wohl zu h, aber nicht umgekehrt, oder in Formeln ausgedrückt:
a wird zu b, aber b nie zu a, a ist, wo es mit b im Austausch steht,
früher als b. Damit darf sie sich aber nicht begnügen. So werden
wir namentlich auch die verschiedenen lautlichen Processe unter einander
chronologisch zu bestimmen, wir werden Formeln wie a ward eher
zu b als zu c, oder a ward eher zu b als c zu d zu gewinnen suchen
müssen. Die Griechen haben anlautendes s vor Vocalen, j und v in den
blossen Hauch aufgehen lassen. Traten diese Lautverdünnungen auf einen
Schlag, oder nach einander, und dann in welcher Reihenfolge ein? Auch
zur Stellung und Beantwortung solcher Fragen gibt der Nachweis der
Lautverschiebung den Antrieb. Denn dieser Vorgang zeigt durch seine
weite Verzweigung, dass die Bewegungen verschiedener Laute nicht
ausser Zusammenhang mit einander stehn. Das volle Licht wird auch
hier wieder erst vom ganzen ausgehn.
Noch weniger abzuweisen ist die chronologische Betrachtung in
Bezug auf die Bildung der Sprachformen. Hier finden sich selbst
in der vulgären, aus dem Alterthum überlieferten Grammatik Anknüpfungspunkte.
190Schon die alten Grammatiker unterschieden einen ersten
und zweiten Aorist durch die drei Genera Verbi. Es lag ihnen zwar
gänzlich fern mit diesen Zahlen eine zeitliche Reihenfolge zu bezeichnen,
wie ja denn dem gesammten Alterthum jede geschichtliche Betrachtung
der Sprache völlig abgeht, aber sie ordneten doch zwei Tempusformen
paarweise und gaben dadurch indem man ähnliche Unterschiede für die
Bildung des Perfects und des Futurums, wenn auch keineswegs ohne
störende Irrthümer aufstellte, doch den ersten Antrieb zu einer übersichtlichen
Anordnung des Verbums, zu der es z. B. die lateinischen
Grammatiker auf ihrem Sprachgebiet nie gebracht haben. Der Schritt
war also kein allzuweiter, den aber doch erst Jahrtausende später Buttmann 1)1
that, indem er von jedem Paare die eine Form als die ältere,
die andre als die jüngere hinstellte. Wir können es zwar jetzt nicht
ohne Lächeln lesen, wenn Buttmann Ausf. Gr. I 368 sagt: ‚der Aorist
in dem Sinn, welchen er im Griechischen im Indicativ hat, und zwar
insbesondere die dritte Person desselben, ist gewissermassen der
Naturlaut der Verbi‘. Wir glauben Herder und Rousseau in dieser
Bezeichnung wiederklingen zu hören. Und die Bevorzugung der dritten
Person hat offenbar im Bau des hebräischen Verbums seinen Grund.
Aber die folgenden Zeilen enthalten die durchaus richtige und weit
greifende Beobachtung ‚dass der griechische Aoristus secundus die
ältere Form des Aorists ist‘. Die chronologische Anordnung dieser Tempuspaare
war damit angebahnt und der Fortschritt der Sprachbetrachtung
vorbereitet, den Jacob Grimm schuf, als er im weiten Gebiet
der deutschen Sprache für die Bildung des Präteritums denselben Unterschied
erkannte und wesentlich darauf die Unterscheidung der starken
Verba mit altertümlichem d. i. einfach gebildetem und der schwachen
mit jüngerem d. i. zusammengesetztem Präteritum gründete (D.
Gr. I S. 1041). Das stimmte durchaus zu dem was Bopp bereits im
Conjugationssystem (S. 151) gefunden hatte. Ebenso ergaben sich nun
die schon von den Vorgängern als älter erkannten Aoriste als die einfachen,
die als jünger erkannten als zusammengesetztere Bildungen,
191wahrend allerdings für das Perfect und Futurum die alteren Einordnungen
fast ganz aufgegeben werden mussten. Und so fand auch der
Bau des lateinischen Verbums mit seiner scheinbar so willkürlichen und
launenhaften Perfectbildung ein annäherndes Verständniss, und selbst
in die auf den ersten Blick äusserst bunte Tempusbildung des Sanskrit
fiel durch die Vergleichung helleres Licht. Aber schon in der Erfassung
jenes chronologischen Unterschiedes lag ein ausserordentlich wichtiges
Moment. Die grosse Fülle von Formen, das lag darin, ist schichtweise
entstanden. Wie auf der Erdoberfläche ältere und jüngere Geschiebe
der Gesteine über und neben einander liegen, so bietet auch die
Sprache in irgend einer Zeit ihres Bestandes einen ähnlichen Anblick.
Jede Betrachtung also, die alles neben einander bestehende ans einem
einzigen Grundgedanken aprioristisch erklären will, ist verwerflich,
die Aufgabe muss zunächst die sein, die verschiedenen über und neben
einander gelagerten Schichten von Formen von einander zu sondern 1)2.
Nur so kann es uns gelingen dem ursprünglichen Bestände nahe zu
kommen und, von diesem ausgehend, sowohl die ersten in der Sprachformung
erkennbaren Intentionen, als das weitere Anwachsen jüngerer
Gebilde und das schliessliche Zusammenfassen aller nach und nach entstandener
Bildungen zu einem in sich geschlossenen System als etwas
vernünftiges und zweckmässiges zu erkennen.
Die Wahrnehmung dieses Geschiebes von Formenschichten führt
nun freilich sehr viel weiter als es auf den ersten Blick scheinen mochte.
Als Buttmann das für seine Zeit kühne Wort aussprach, der Aoristus
secundus sei die ältere, der Aoristus primus die jüngere Form dieses
Tempus glaubte er nur eine Bemerkung über die Geschichte der griechischen
Sprache zu machen. Aber da nun seitdem ganz dieselben Unterschiede
in allen andern indogermanischen Sprachen erkannt sind, so
unterliegt es keinem Zweifel, dass diese uralt, dass sie älter sind als die
Trennung der indogermanischen Sprachen von einander. Eine relativ
jung genannte Bildungsweise wie die des s. g. Aoristus primus war
factisch schon vorhanden, ehe die Vorfahren der Griechen, Römer,
Deutschen und Inder als getrennte Völker aus der gemeinsamen Heimath
auswanderten. Insofern nun aber hier doch von älteren und
192jüngeren Formen und zwar mit bestem Grunde die Rede ist, involvirt
jene Sonderung eine chronologische Behauptung für diese sehr frühe
Zeit, und wenigstens in diesem einen Falle ergibt sich die Möglichkeit
eines chronologischen Masstabes selbst dem entschiedensten Skeptiker
schon aus den angeführten Thatsachen.
Die Sprachwissenschaft steckt sich aber noch höhere Ziele als die
bisher berührten. Sie kann sich weder damit begnügen die Uebereinstimmungen
nachzuweisen, welche zwischen den urverwandten Sprachen
stattfinden, noch damit altere und jüngere Gebilde innerhalb dieser zu
unterscheiden. Sie strebt danach die vorhandenen Formen in ihre ursprünglichen
Bestandtheile zu zerlegen und die unbewussten Ziele des
schaffenden Sprachgeistes nachzudenken. Und da hat die Analyse der
Formen zu dem Ergebniss geführt, dass das weit verzweigte System
der Verbal-, der Casusformen im Grunde mit erstaunlich einfachen Mitteln
von der Sprache erreicht wird. Einige wenige einsylbige Pronominalstämme
dem Stamme selten vorgesetzt, in der Regel ihm bald einzeln,
bald zu zweien und dreien angefügt, sind die Hauptmittel, und überall
kehren dieselben Elemente wieder. Ein s, das auf den Pronominalstamm
sa zurückgeht, bezeichnet den Nominativ Singularis, dasselbe, vielleicht
ursprünglich doppelt gesetzt, den Nominativ Pluralis, dasselbe begegnet
uns aber auch im Genitiv Singularis. Vergleicht man den Nominativ ὁδό-ς
und den Genitiv ποδός, so stecken in beiden Formen genau dieselben Elemente.
Man kann die Gleichung ansetzen: ὁδός: ἑδ = ποδός: πέδ. Es
wäre schlechterdings unbegreiflich, wie dennoch die erste Form als
Nominativ, die zweite als Genitiv fungirte, wenn wir nicht annähmen,
dass diese Formen Producte durchaus verschiedener Zeiten wären, dass
die Sprache dieselben Mittel zu verschiedenen Zeiten in
ganz verschiedener Weise verwendete.
Ausser jenen einfachen und nicht sehr zahlreichen Bildungssylben,
die wir Endungen oder Suffixe zu nennen pflegen, zeigen sich noch
einige wenige innere Umwandlungen der Wurzeln und Wortstämme.
Eine der deutlichsten ist die Reduplication. Aber auch diese fungirt in
sehr verschiedener Weise. In δι-δά-σκ-ω ist der Präsensstamm, in δέ-δα-α
der Perfectstamm, in δέ-δα-ο-ν der Aoriststamm dadurch gekennzeichnet.
Ist es denkbar dass dasselbe Mittel gleich von Anfang an so verschiedenen
Zwecken diente? Gewiss nicht. Offenbar war die Intention
der Sprache bei der Verwendung der Reduplication von Anfang an nur
193auf Hervorhebung der betreffenden Sylbe gerichtet. Die besondre Art
dieser Hervorhebung befestigte sich erst später durch das Geschiebe der
mannichfaltigen Formen zu einem vielgegliederten System. Denn noch in
weit höherem Grade als die einzelnen Seiten des Lautsystems auf einander
Einflussüben, wirken die verschiedenen Formen der Sprache auf einander
ein, begränzen und bestimmen sie sich wechselseitig durch ihren Gebrauch.
Selbst in der Syntax ist eine sorgfältige Unterscheidung des früher
und später ganz unerlässlich. Niemand müht sich heute mehr ab, wie
vor fünfzig Jahren allgemein geschah, den Gebrauch eines Casus oder
Modus aus einem Grundbegriff abzuleiten, den man als von vorn herein
fertig voraussetzte, und zum Theil auf philosophischem Wege durch
Anwendung von Kategorien zu erschliessen suchte. Jetzt entgeht es
wohl niemand, dass solche Grundbegriffe nur Formeln sind, die man aus
der ganzen Fülle des zu feinster Verwendung ausgeprägten Gebrauches
abstrahirt hat. Wer heutzutage dem Wesen des griechischen Accusativs
cum infinitivo nachspürt, wird nicht unterlassen auf die allmähliche
Entwicklung dieser bei Homer noch in beschränkterem Umfang auftretenden
und aus der Prolepsis nach griechischen syntaktischen Gewohnheiten
nicht schwer erklärbaren Construction einzugehn. Er wird
in den ähnlichen Erscheinungen anderer Sprachen, z. B. der deutschen,
die einfacheren Anfänge derartiger Satzfügungen deutlich erkennen, aus
denen sich erst allmählich eine kühnere und feinere Anwendung herausbildete.
Denn auch hier bedarf die urkundliche Ueberlieferung der
einzelnen Sprache ihrer Ergänzung durch andre verwandte. Der Unterschied
zwischen dem Conjunctiv und dem Optativ hat sich noch nicht
einmal bei Homer zu der Schärfe ausgebildet, die wir im Atticismus
wahrnehmen. Gehen wir über die griechische Sprache hinaus, so hört
vollends ein solcher Unterschied auf, fassbar zu sein. Wenn wir auch
keineswegs der Ansicht sind, dass die Sprachformen je einem andern
Zwecke gedient haben als dem der Bezeichnung bestimmt empfundener
Differenzen des Sinnes, so ist doch die präcisere logische Ausprägung
und Differenzirung, die genaue Umgränzung des Usus unleugbar etwas
unendlich viel späteres als die Formenschöpfung. Ausser der eigenthümlichen
sprachlichen Begabung der einzelnen Völker haben die mannichfaltigsten
äussern Umstände z. B. der Verlust einzelner Formen in
Folge lautlichen Verfalls und das Bedürfniss nach Ersatz des verlorenen
darauf eingewirkt. Der eine Umstand, dass den beiden classischen
194Sprachen in frühester Zeit der Instrumentalis abhanden kam ist von der
höchsten Bedeutung für das Verständniss des Casusgebrauchs, der
Verlust des Augments in den italischen Sprachen erklärt mehrere der
wesentlichsten Unterschiede des lateinischen Tempusgebrauchs vom
Griechischen. Wenn die Räthsel des Formengebrauchs dessen ungeachtet
vielfach noch schwerer zu lösen sind als die der Formenentstehung,
so liegt das daran, dass es uns dafür weit mehr an vorgeschichtlichen,
das ist vorurkundlichen Zeugnissen fehlt.
Ich habe hier nur anzudeuten versucht, wie die chronologische Behandlung
auf die verschiedensten Seiten der Sprache anwendbar ist. Es
kann aber nicht genügen überall im einzelnen uns dieser Methode zu
bedienen, es muss auch der weitere und kühnere Versuch gemacht werden,
die Geschichte der indogermanischen Sprachen als ganzes chronologisch
zu ordnen, sie in Perioden zu gliedern. Eine Eintheilung der
indogermanischen Sprachgeschichte ist namentlich von zwei Gesichtspunkten
aus möglich, zunächst vom ethnographischen aus. Diese Art von
Gliederung hat man am häufigsten versucht. Von diesem Standpunkt
aus ergeben sich zwei Hauptperioden, die erste die der ungetheilten
Einheit, die zweite die der aus ihr allmählich sich entwickelnden Vielheit.
Für die erste dieser Hauptperioden hat Sonne (Kuhn's Zeitschr.
XII 290) meines Wissens zuerst den Namen ‚proethnisch‘ in Vorschlag
gebracht. Der Ausdruck ist nicht übel erfunden, insofern ja wirklich für
diese Zeit vor der Sprach- und Völkertrennung die später für sich existirenden
ἔθνη noch nicht vorhanden waren. Freilich aber bildete die ungetheilte
Masse der Indogermanen doch auch schon im Unterschied von
den übrigen grossen Völkerstämmen ein Volk, ein ἔθνος von bestimmt ausgeprägter
Eigentümlichkeit. Der Name proethnisch erscheint darum
doch nicht ganz zutreffend. Die Sprache dieser frühesten Zeit nennt
Schleicher, und auch ich schliesse mich ihm darin an, die indogermanische
oder genauer die indogermanische Ursprache. Die Bezeichnung ‚Periode
der Vielheit und der Einheit‘ wird bei einer periodisirenden Uebersicht
immer die einfachste und deutlichste bleiben. Die Periode der Einheit
ist von diesem ethnographischen Gesichtspunkt aus einer Gliederung unfähig,
die der Vielheit aber derselben nicht bloss fähig, sondern auch im
höchsten Grade bedürftig. Dass sich die Scheidung der Völker allmählich
vollzog, wird wohl allgemein anerkannt, auch über die meisten Gruppen
herrscht Einverständniss. Es ist hier nicht meine Absicht auf diese Frage
195naher einzugehn, die, wie ich glaube, erst nach Ausführung einer Reihe
von Specialuntersuchungen über ihren gegenwärtigen Charakter vorläufiger
und mehr hypothetischer Aufstellungen wird hinausgeführt werden
können. In meiner Abhandlung,über die Spaltung des A-Laut's (Berichte
d. königl. sächs. G. 1864 S. 9 ff.) habe ich einen Beitrag zur
Lösung dieser Frage zu geben gesucht. Als Ergebniss, das ich jedoch
selbst nur als ein vorläufiges, anderweitiger Bestätigung bedürftiges
bezeichne, stellte sich mir heraus, dass die indogermanischen Sprachen
sich zunächst in zwei grosse Hälften getheilt hatten, die asiatische
und europäische. Ohne darauf zurückzukommen, will ich hier nur
anführen, dass diese Auffassung sich sehr gut den Ergebnissen anschliesst,
zu welchen Müllenhoff in seiner schönen Untersuchung über
die pontischen Skythen Monatsber. der Berl. Akad. August 1866 gelangt
ist. Er zeigt dort auf das evidenteste, dass jene Skythen, obwohl
in Europa wohnend, doch der persischen oder eranischen Familie angehören.
Und in der That theilen die skythischen Sprachreste auch
den Vocalismus dieser Familie wenigstens insofern, als sie von der Vertheilung
der Laute a e/i o/u, wie sie in den europäischen Zweigen dieses
Sprachstammes hervortritt, wesentlich abweichen und auf eine längere
Bewahrung des ungetheilten a hinweisen. Man vergleiche nur das dort
S. 551 erklärte ἐ-νάρ-εες = ἄν-ανδρ-οι mit gr. ἀ-νερ, sabin. ner-o, und
das negative Präfix ἐ in diesem Worte mit dem gr. ἀν das auch uritalisch
so lautete, so wie ahd. un, das S. 563 aus Ἀρδ-άβδα ἑπτάθεος erschlossene
ἄβδα = skt. saptan mit gr. ἑπτά lat. septem goth. sibun lit.
septyni ksl. sedmĭ, die zahlreichen Wörter auf — ασπος Pferd gegenüber
von ἵππος, equos, alth. ehu, freilich lit. aszwá.
Ein zweites Eintheilungsprincip ist das, so zu sagen, rein sprachwissenschaftliche.
Man könnte es auch ein genetisches nennen. W. v.
Humboldt unterscheidet in Bezug auf alle Sprachen zwei Hauptperioden
ihrer Geschichte. Die erste, in welcher der Bau der Sprache seine wesentliche
Gestalt gewinnt, nennt er, z. B. in der Abhandlung über das
vergleichende Sprachstudium Gesammelte Werke III S.246, die Periode
der Organisation, die zweite, in der nach Vollendung dieses Baues,
nachdem für ihn ein Congelationspunkt oder eine ‚Krystallisaüon‘ (Ueb. d.
Verschiedenh. des menschl. Sprachbaues S. 191) eingetreten war, die
feinere Durchbildung des Charakters zugleich mit der Abnahme des
196Lautbestandes sich erkennen lasst, die Periode der Ausbildung,
öeber diese Zweiheit der Hauptperioden werden wir nicht hinauskommen.
Diese Zweiheit durchdringt alle einzelnen sprachlichen Untersuchungen.
Wir haben eigentlich bei jeder einzelnen etymologischen
oder grammatischen eine einzelne Sprache betreffenden Frage eine
doppelte Aufgabe, erstens von der gegebenen Form zur indogermanischen
Grundform aufzusteigen, wobei wir uns also in der zweiten Periode
bewegen, und zweitens den Ursprung der so gewonnenen Grundform
zu erklären, was ganz der ersten angehört. Eine vollständige Ausschliessung
der zweiten Operation wird bei einzelnen lautgeschichtlichen
Untersuchungen möglich sein, insofern es sich nur darum handelt
die allmählichen Veränderungen einer klar vorliegenden Grundform
nachzuweisen. Aber jeder Schritt weiter führt schon auf das andre Gebiet,
nöthigt zu Aufstellungen über die Entstehung und ursprüngliche
Geltung dessen was in jener ersten Periode geschaffen ist. Die Benennung
der beiden Perioden welche Humboldt erfand, ohne sie jedoch
selbst überall festzuhalten, hat wenigstens den Vorzug leicht verständlich
und im allgemeinen treffend zu sein. Insofern wir ein viel gegliedertes
und doch von einer festen Einheit zusammen gehaltenes, einen
Zweck erfüllendes ganze Organismus nennen, und ein solches in der
ersten dieser beiden Perioden das wesentliche seiner Gestalt gewinnt,
dürfte sich gegen den Ausdruck Organisationsperiode nicht viel einwenden
lassen. Die Typen aller wesentlichen Sprachformen müssen in dieser
Zeit geschaffen sein, denn sie sind in allen verwandten Sprachen
dieselben. Die spätere Periode lieferte noch neue Abdrücke dieser Typen
mit kleinen Abweichungen und zu eigentümlicher Verwendung,
aber nichts unbedingt neues yon Grundformen. Mit einem andern Bilde
könnte man diese Periode auch die des Wachsthums nennen. Am
Schlüsse derselben hat der Sprachkörper seine feste Umgränzung erreicht,
er verändert sich jetzt nur innerhalb dieser Gränzen, er ist ausgewachsen.
Für die zweite Periode ist ein hauptsächliches Merkmal
die allmähliche Abnahme des äussern Lautbestandes. Dennoch wäre es
entschieden falsch sie im Gegensatz zu der des Wachsthums die Periode
des Verfalls zu nennen. Denn so wenig nach Beendigung des Wachsthums
das Greisenalter, so wenig tritt hier sogleich eine wirkliche Zerstörung
des Organismus ein. Die Anfänge der Lautverwitterung sind
mit der regsten Verwendung des früher geschaffenen verbunden. Die
197eigenthümlichen Vorzüge, durch die sich z. B. das Griechische vom Sanskrit
unterscheidet, gehören dieser Periode an. Die Ausprägung des Infinitivs
z. B., den jede der verwandten Sprachen auf verschiedene Weise
gewonnen und von andern Nominalbildungen zu unterscheiden gewusst
hat, gehört hierher. Ebenso die Regelung des Satzbaues, so weit es
sich um etwas anderes als die allereinfachsten Formen handelt. Es wäre
eine grosse Einseitigkeit dies alles für nichts zu achten und die erste
Periode gewissermassen wie ein verlorenes Paradies zu betrachten. Ist
doch nicht zu verkennen, dass diejenigen Grundformen, welche für den
Bau der indogermanischen Sprachen wesentlich sind, schon lautliche
Schwächungen zeigen und dass diese, weit entfernt die Bestimmung
der einzelnen Formen zu beeinträchtigen, vielmehr derselben förderlich
sind. Dass da-dâ-mi irgendwie weniger organisch wäre als da-dâ-ma,
woraus es entstanden, wird sich nicht behaupten lassen, und doch ist es
lautlich schwächer. Den Zweck aller Sprache zum Ausdruck der Gedanken
zu dienen erfüllen die Sprachen in der zweiten Periode sicherlich
besser, als jene Grundsprache der ersten. Wollte man nach andern
Bildern suchen, so Hesse sich an den Ausdruck Abschleifung denken,
der die beiden hier wesentlichen Momente der stofflichen Abnahme und
der grösseren Glätte und Feinheit in sich vereinigt, freilich aber dem
Missverständniss Nahrung gäbe, als ob eine von aussen an die Sprache
herantretende Gewalt die Veränderung bewirkt hätte. Insofern nun
Ausbildung von Bildung unterschieden und vorzugsweise auf Vervollkommnung
schon vorhandener Bildung bezogen zu werden pflegt, ist
der Name ‚Periode der Ausbildung‘ so ziemlich geeignet das wesentliche
dieser Periode zu bezeichnen.
Es fragt sich nun, wie sich diese zweite Eintheilung zu der ersten,
der ethnographischen, verhält. Und da ist so viel klar, dass die Periode
der Organisation wesentlich mit der der Einheit, die der Ausbildung
mit der der Vielheit zusammenfällt. Völlig aber decken sich beide Perioden
doch nicht. Dass die Organisation mit der ersten vollendet war,
dürfte keinem Zweifel unterliegen. Aber dass die Periode der Ausbildung
erst mit der Vielheit beginnt, darf nicht für so ausgemacht gelten.
Wenn wir erwägen mit welcher Festigkeit alle wesentlichen Formen
bei den verschiedenen Zweigen unsers Sprachstammes haften oder
doch unverkennbare Spuren hinterlassen haben, mit welcher Sicherheit
eine jede ihrer Sphäre getreu bleibt, wie gross die Uebereinstimmungen
198nichl. bloss in den Wurzeln, sondern auch in den aus ihnen entstandenen
oft in den Endungen wie in der individuellen Anwendung auf das
feinste ausgeprägten Wörtern sind, so werden wir zu dem Schlüsse gedrängt,
dass das indogermanische Urvolk längere Zeit zur Verfügung
halte, um sich seine Formen und Wörter einzuüben, ehe durch die Zersplitterung
die Gefahr mannichfaltiger Zerstörung hereinbrach. Manches
gemeinsame sämmtlicher Sprachen hat einen conventioneilen Charakter,
wie z. B. die Zahlwörter, deren Grundformen wir zu ermitteln vermögen
ohne dass es uns gelingt ihren ursprünglichen Sinn zu erkennen.
Vielleicht war den Indogermanen schon ehe sie sich in ihre einzelnen
Familien spalteten das Wort katvar, die Grundform für die Vierzahl, ebenso
räthselhaft wie uns. Hier treten nirgends deutliche Beziehungen auf
geläufige Wurzeln und Suffixe hervor. Da nun aber solche Anknüpfungen
an anderweitiges Sprachgut nothwendigerweise einmal vorhanden
gewesen sein müssen, so lässt die Existenz eines solchen gleichsam aus
der Bahn gewichenen Wortes schon auf mehrfache Trübung und auf Verluste
des Sprachgutes schliessen. Solche Trübungen aber sind schon ein
Kriterium der zweiten Periode. Das gleiche bemerken wir z. B. an den
Personal-, an den Casusendungen. Der ursprüngliche Lautbestand kann
hier vielfach kaum errathen werden. Für die 1. Pl. kommen wir z. B.
nicht über eine Form wie da-dâ-ma-si als indogermanische Grundform
hinaus, die aber selbst schon wahrscheinlich aus da-dâ-ma-tva
geschwächt ist. Die letztere, oder etwa da-dâ-ma-lvi würde die der Organisationsperiode
sein. Auch wird es einiger Zeit bedurft haben um
aus der organischen Grundform wie varka-sa die indogermanische
Grundform varka-s hervorgehen zu lassen. Vielleicht hat es hier sogar
Mittelstufen, wie etwa varka-si gegeben. Dergleichen Lautschwächungen
und Lautverluste die von der viel stärkeren und mannichfaltigeren späterer
Zeiten wohl zu unterscheiden sind, beeinträchtigten nicht, sondern
förderten nur die Zwecke der Sprache. Sie entspringen weniger der
Trägheit und Bequemlichkeit der Sprachorgane, als dem Streben die
frisch entstandenen Formen nicht all zu vielsylbig und schwerwuchtig
werden zu lassen, und dienen dem Principe der Worteinheit. Die längere
Dauer eines einheitlichen Beisammenseins des indogermanischen Urvolks
bestätigt sich doch auch durch die mancherlei Züge gemeinsamen
Glaubens, mythischen Dichtens, der Sitte u. s. w., von denen z. B.
Pictet in seinen reichhaltigen Origines Indoeuropéennes handelt. Selbst
199ein indogermanisches Grundmetrum kann nach Westphal's schrägendem
Nachweis kaum bezweifelt werden. Kurz, wir werden nicht irren, wenn
wir behaupten, dass die Periode der Ausbildung schon in der Einheitszeit
begann, dass also jene beiden wesentlichen Eintheilungen sich wenigstens
in dieser Beziehung durchkreuzen.
Hier sehen wir nun von der ethnographischen Theilung völlig ab
und fassen ausschliesslich die rein sprachwissenschaftliche in's Auge.
Die beiden grossen Hauptperioden erfordern natürlich für ihre Ausführung
im einzelnen eine durchaus verschiedene Behandlung. Die zweite,
die der Ausbildung, insofern sie wenigstens zum bei weitem grössten
Theile mit der Spaltung der Sprachen zusammenfällt, umfasst ein ungemein
reichliches Material. Die Forschung muss hier nothwendig sich
theilen, denn ein einzelner vermag es nicht die ungeheure Masse der
Thatsachen zu umspannen. Es gilt hier die Kluft auszufüllen zwischen
der Urzeit und der historisch bezeugten Existenz der einzelnen Sprache
oder Sprachfamilie. Wir, die wir schliesslich immer zunächst das
Griechische im Auge haben, würden uns also für diese Periode die Aufgabe
stellen, durch welche verschiedenen Stufen hindurch die indogermanischen
Laute und Formen nach und nach zu griechischen geworden
sind, eine Aufgabe, die wenigstens insofern lösbar sein dürfte, als sich
eine Anzahl von Reihen bestimmt erkennbarer Thatsachen aufstellen
lässt. Schwieriger schon ist es, diese Reihen unter sich zu verbinden.
Aber, wenn wir die wesentlichsten lautgeschichtlichen Thatsachen zu
Grunde legen, wird es, denke ich, doch mehrfach gelingen ein früher
und später mit Sicherheit zu ermitteln. Die Untersuchungen gehen für
diese zweite Periode notwendigerweise etwas in die Breite. Ich verschiebe
es auf eine andre Gelegenheit darauf einzugehn.
Für die Periode der Organisation dagegen kann es, vorerst wenigstens,
nur darauf ankommen, eine Skizze zu entwerfen, bestimmte
Gesichtspunkte in Betreff der Reihenfolge der wesentlichsten
Spracherscheinungen aufzustellen, die, auch bei dem ernstesten Bemühen
nichts unbegründetes zu behaupten, doch einen mehr hypothetischen Charakter
haben müssen. Solche Hypothesen sind aber für unsere Wissenschaft
schlechterdings unentbehrlich. Nachdem mehr als fünfzig Jahre
lang die Analyse der einzelnen Formen eifrig betrieben ist, wird es unerlässlich
den Versuch zu machen diese nicht bloss für die historisch bezeugten
Zeiten des Sprachlebens zusammenzufassen und zusammenzudenken,
200sondern auch ein gleiches in Bezug auf jene Urzeit zu wagen.
In solchem Sinne stellt sich schon Steinthal in seiner Charakteristik der
hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues S. 277 die Aufgabe, das
Werden des sanskritischen Sprachbaues von der Wurzelschöpfung bis zur
völlig entwickelten Wortform,nicht blos als ein theoretisches Geschehen,
sondern als ein zeitliches Wachsen' darzustellen und entwirft selbst eine
Skizze der indogermanischen Sprachentwicklung, an die wir mehrfach
anknüpfen können.
Man hüte sich solche Versuche zusammenfassender Gesammtbetrachtung
für überflüssig zu halten. Denn schliesslich hat doch jede
einzelne Behauptung erst dann ihre Probe bestanden, wenn sie sich einer
grossen Reihe unter sich zusammenhängender Wahrheiten anschliesst,
eine historische Behauptung — und jede sprachwissenschaftliche ist in
gewissem Sinne eine solche — wenn sie in einem befriedigenden Gesammtbilde
der Entwicklung des betreffenden Objects ihren rechten Platz
findet. Versuchen wir es also mit dieser Skizze einer Entwicklung, die
jedenfalls in eine sehr frühe Zeit des Völkerlebens hinaufreicht.
1. Wurzelperiode.
Wenn wir die letzten unzerlegbaren oder, wie Max Müller sie nennt,
die constituirenden Elemente der Sprache mit dem Namen Wurzeln bezeichnen,
so müssen wir annehmen, dass aller Sprachbau mit der Schöpfung
der Wurzeln begann. In dieser Annahme stimmen fast alle neuern
Sprachforscher überein 1)3. Wenn wir ferner die Wurzeln nicht als blosse
201Abstractionen oder Hülfsfiguren für das wissenschaftliche Verfahren,
sondern als reale Wesen oder als ‚UrwÖrter‘ betrachten, die in der Schöpfungsperiode
202der Sprache für sich existirten (Grundzüge der gr. Et. 2 S. 44),
so befinde ich mich auch darin im Einklang mit Forschern wie Bopp, Max
Müller, Heyse, Schleicher u. a. Gibt es Sprachen, welche, wie die chinesische,
mit einsylbigen keiner Modifikation fähigen Wörtern auskommen, so
hindert uns nichts einen solchen Zustand für die hier in Betracht kommenden
Sprachen vorauszusetzen und diese Voraussetzung scheint mir immer
noch sehr viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, als anderweitige
Theorien. Es musste, sagt Heyse System der Sprachw. S. 144, der
203grammatischen Gestaltung der Sprache nothwendig ein Zustand vorausgehen,
in welchem sie nur aus Wurzeln bestand. »These germinal forms would
have-answered every purpose in an early stage of languages« sagt Max Müller
Lect. II 84 im Gegensatz zu anderweitigen Ansichten, wie sie von Pott
Etymol. Forsch. II 2 95 vorgebracht werden. Warum ‚Wurzeln als solche
des Stempels von Wörtern und damit der reellen sprachlichen Gültigkeit
im Redeverfluss entbehren‘ sollen, vermag ich nicht einzusehn. Was einst
primitives Wort war, erscheint eben nur als Wurzel vom Standpunkt
der vorgeschrittenen sprachlichen Entwicklung aus. Der Inder, der
Grieche redete freilich nicht in Wurzeln, aber ihre gemeinsamen Vorfahren
thaten es zu einer Zeit, die weit jenseits der Ausbreitung des
kunstvollen Sprachbaues liegt wie wir ihn vor uns sehen. Fassen wir
die Wurzeln so auf, so sind sie des mystischen und mythischen Charakters
entkleidet, mit dem man sie mehrfach umgeben hat.
Auch darin finde ich mich im Einklang mit den meisten Sprachforschern,
dass ich den Wurzeln Einsylbigkeit beilege. Blitzartig, hat
man gesagt, bricht die einheitliche Vorstellung in einem Lautcomplexe
durch, der in einem Moment vernehmbar sein müsse. Ebenso unerlässlich
ist die Eintheilung der Wurzeln in zwei Classen, die wir Verbalwurzeln
oder Wurzeln im engeren Sinne und Pronominalwurzeln oder Pronominalstämme
zu nennen pflegen. Doch gehen hier schon die Meinungen mehr
aus einander. Erstens in Bezug auf die Bezeichnung. Heyse (System
S. 153) nennt die erstem Stoffwurzeln, die andern Formwurzeln. Aber
da Form ohne Stoff nicht bestehen kann, die Pronominalstämme aber
auch ohne die andern eine sehr reale Existenz haben, so passt dieser
Ausdruck nicht. Passender sagt Steinthal (Typen S. 278) dafür qualitativ
und demonstrativ, nicht sehr abweichend Max Müller I 239
predicative und demonstrative, womit sicherlich das Wesen der Pronominalstämme
getroffen ist. Sind die Pronomina wie auch Schoemann
(Redetheile S. 96) sie bezeichnet, Deute Wörter, so können ihre Wurzeln
Deutewurzeln genannt werden. Schleicher Comp. 2 314 unterscheidet
Begriffs- und Beziehungswurzeln. Wie aber der Begriff erst aus
der sinnlicheren Vorstellung, so entwickelt sich die Beziehung doch wohl
erst aus der Hinweisung. Dem ursprünglichen Wesen beider Gattungen
kommen wir daher, denke ich, näher wenn wir jene nennende, diese
deutende Wurzeln nennen. Freilich besteht nun auch darüber eine
Meinungsverschiedenheit, ob diese Zweitheilung von Anfang an da war,
204oder nicht. Während Bopp's Analyse des indogermanischen Sprachbaues
über diese Zweiheit nicht hinausgeht und auch Heyse, Steinthal
u. a. dabei stehen bleiben, ist neuerdings mehrfach die ursprüngliche
Identität beider Arten von Wurzeln behauptet worden, zuerst meines
Wissens von Jacob Grimm,Ueber Etymologie und Sprachvergleichung'
Kl. Schriften I 312, dann später von Schleicher Compend. 2 642 und noch
entschiedener ‚Ueber Nomen und Verbum‘ S. 509 und von Benfey in
den oben erwähnten Aufsätzen. Eine Entscheidung dieser Frage dürfte
ausserordentlich schwierig sein. Ueberzeugend hat bisher niemand den
Ursprung eines Pronomens aus einer Verbalwurzel nachgewiesen. Für die
Personalpronomina sind noch am ehesten ansprechende Vermuthungen
vorgebracht, weniger möchte dies in Bezug auf die übrigen gelingen.
Sprachen, die den Unterschied von Nomen und Verbum nicht kennen
sind zahlreich, gibt es aber wohl Sprachen ohne Pronomina? Hier darf
diese Frage um so mehr bei Seite bleiben, da das vollkommen fest steht,
dass die Zweiheit schon in der allerfrühesten Zeit indogermanischen
Sprachlebens, dass sie vor aller Formenschöpfung vorhanden sein musste,
da der gesammte Bau unsers Sprachstammes auf der mannichfaltigen Verbindung
nennender und deutender Elemente ruht. Erst durch diese
Zweiheit kommt Licht und Schatten in die Sprache, erst durch sie ist
eine sinnvolle Aneinanderreihung von Wörtern ermöglicht, die nothwendige
Voraussetzung aller weiteren Entwicklung.
Dagegen kann von einem Unterschied zwischen Nomen und Verbum
natürlich auf dieser Stufe gar keine Rede sein. Ob eine Wurzel
der ersten Classe bloss nennt oder etwas aussagt, denn darauf läuft
doch der Unterschied zwischen Nomen und Verbum hinaus, wird in
diesem ältesten Sprachzustande an ihr selbst nicht bezeichnet. Die
Wurzel da kann den Geber, das gegebene, das Geben, aber als solche
niemals mit-Bestimmtheit,er gibt' bedeuten. Solche Aussage beruht immer
auf einer Synthesis, die der nackten Wurzel abgeht. Damit fehlte
aber überhaupt der Unterschied zwischen der, so zu sagen noch flüssigen
und der erstarrten Handlung. Formlose Sprachen zeigen auf das
evidenteste, dass es sich so verhält.
Die Zahl der ursprünglichen Wurzeln oder ältesten Wörter kann in
unserm Sprachstamme keine übermässig grosse gewesen sein. Es waren,
so scheint es, lauter Sylben mit kurzen Vocalen. Denn auch in
Bezug auf die vocalisch auslautenden Wurzeln auf a hat Schleicher in
205den Beitr. z. vergl. Sprachf. II 92 ff. es wahrscheinlich gemacht, dass
nicht nach Art der indischen Grammatiker dâ dhâ pâ u. s. w., sondern
da dha pa als die echten Wurzeln zu betrachten seien. Erst bei dieser
Annahme kommt Einheit und Gleichmass in die primäre Verbal- und
Nominalbildung. Wer für skt ģa-ģân-a nicht von ģân sondern von ģan,
für λήθ-η nicht von ληθ sondern von λαθ ausgeht, darf auch für δό-σι-ς
nur δο, mithin auch für skt. dâ-na-m nur da zum Grunde legen. Auch
aus der Weiterbildung der Wurzeln in der zweiten Periode wird dies
Vorhandensein eines kurzen auslautenden Vocals der Urwurzel wahrscheinlich.
Ausser diesen vocalisch auslautenden sind aber mit völliger
Sicherheit auch consonantisch schliessende anzunehmen wie ad (essen),
ak (scharf sein), ag (treiben), an (wehen), ar (gehen, streben), av (wehen),
und zugleich consonantisch beginnende und schliessende wie pat (fliegen),
sad (sitzen), div (glänzen), lar (überschreiten), dar (zerreissen),
gar (aufreiben), bhar (tragen).
2. Determinativperiode.
Wenn unsre Analyse gegebener Sprachformen vielfach bis zu
einem Punkte gelangt, bei dem wir unbedingt stehen bleiben, zu Grundformen,
an deren Ursprünglichkeit zu zweifeln wir keinen Grund haben,
so fordert in andern Fällen die in gleicher Weise gewonnene Grundform
zu der neuen Frage auf, wie sich diese zu einer andern kürzeren und,
so scheint es, elementareren verhalte. Unzweifelhaft liegt die W. gan,
gräcoit, gen dem skt. ģanâ-mi oder ģa-ģan-mi, den Nominalformen
ģanas = γένος, lat. genus, ģan-i-tar = γεν-ε-τήρ gen-i-tor u. s. w. ebenso
zu Grunde wie etwa die W. an der Verbalform an-i-mi, den Nominalformen
an-a-s Hauch, gr. ἄν-ε-μο-ς, lat. an-i-mu-s und an-i-ma. Aber
während es bei der letzteren Grundform nicht leicht jemand einfallen
wird, sie weiter zu zerlegen, stellt sich neben gan die Form ga im skt.
ģâ-ti-s Geburt, ģâ-j-ê werde geboren, gr. γέ-γα-μεν, und es fragt sich,
wie sich die kürzere zu der längeren verhalte. Die Consequenz fordert
die kürzere, die wir die primäre Wurzel zu nennen pflegen, als die
ältere, die längere als die daraus entstandene jüngere zu betrachten.
Für diejenigen Zusätze, um welche die jüngeren Formen länger sind als
die älteren habe ich den Ausdruck Wurzeldeterminativ in Vorschlag gebracht
und in diesem Sinne mich über den ganzen Vorgang Grundz. 2
206S. 58 ff. ausführlich ausgesprochen. Es wird daher überflüssig sein weitläuftiger
auf diese Frage einzugehn. Doch mögen mit wenigen Worten
einige dort nicht berührte Punkte hier erörtert werden. Die meisten
Sprachforscher behandeln diese Erweiterung der Wurzeln als eine verhältnissmässig
junge Erscheinung und zwar in einer zwiefachen, sehr verschiedenen
Weise. Einige nämlich erkennen darin Zusammensetzungen
einer unflectirten Wurzel mit einer flectirten. Setzte das in δά-π-τ-ω,
δαπ-άνη vorliegende dap, wie Benfey will, wirklich ein Verbum nach
Art des sanskritischen Causativs dâpajâ-mi voraus, so würde dies p erst
in der Periode lebendigster Verbalflexion entstanden sein, pajâ-mi deutet
Benfey durch eine allerdings ziemlich kühne Hypothese als facio, das
ganze also wäre ein junges Gebilde, eine zusammengesetzte Verbalform
von der Art des lateinischen cale-fαcio. Allein in allen Sprachen unsers
Stammes zeigt sich nach Ausbildung der Verbalflexion eine Abneigung
gegen unmittelbare Verbindung von Verbalwurzeln mit flectirten Verbalformen.
Es kann nicht Zufall sein, dass die Zusammensetzung, bei
Nominalformen so ungemein häufig, bei Verben — abgesehen von der
losen Vorfügung von Präfixen — im allgemeinen gemieden wird. Ausnahmen
finden nur statt bei einigen wenigen Verbalstämmen, deren
Bedeutung zu Hülfsverben erblasst ist, wie bei den Wurzeln as, ja, dha.
Die Verwendung solcher Wurzeln in der Tempusbildung ist unverkennbar.
Aber auch bei dieser liegen ungleich primitivere Formen vor als
jenes, alle Spuren einer Ableitung aus einem Nominalstamme an sich
tragende, specifisch sanskritische dâ-pajâ-mi, und ein so festes Verwachsen
mit diesen Elementen findet nicht statt, vielmehr gehen jene Hülfsverben
nur losere Verbindungen für einzelne Tempusstämme ein. Ausserdem ist
fast für keinen einzigen der hier in Betracht kommenden Zusätze eine
Verbalwurzel nachweisbar.
Durchaus verschieden ist die Auffassung derer, welche dieselben Elemente
mit den wortbildenden Suffixen der Nomina identificiren 1)4. Hiernach
wäre z. B. das k, um welches ὀλε-κ (ὀλέκ-ω, ὀλ ώλεκ-α), stärker ist als ὀλε,
ὀλ, identisch mit dem k im Nominalstamme φυλα-κ oder mit dem aus dem
Pronominalstamme ka entstandenen Suffix ka, gr. ko z. B. skt. dhâ-ka-s
Behälter von der W. dhâ setzen (vgl. gr. θή-κη), das n von ģanâ-mi
207wäre nicht verschieden von dem n des Suffixes -na in svap-na-s,
Schlaf = ὕπ-νο-ς, von der W. svap schlafen, das t von W. djut glänzen
gegenüber von div oder dju in gleicher Bedeutung nicht verschieden von
dem t im skt. sthi-ta-s stehend = στα-τό-ς. Nun leuchtet aber ein, wie
grundverschieden die Function derselben Elemente in den Nominal- und
in den Verbalformen ist. Jene Pronominalstämme haben in den Nominalstämmen
den Zweck auf den Begriff des Stammes als einen factisch
vorliegenden, als einen gegenständlichen hinzuweisen, sie dienen daher
nur dazu die nominale Bedeutung des Stammes bestimmter hervorzukehren.
Wir werden allerdings sehen, wie nominale Themata auch verbal
verwendet werden. Allein das geschieht, wie sich zeigen wird, zu
einem ganz bestimmten Zweck bei der Präsensbildung. Das p, k, n, t,
durchdringt die ganze Flexion des Verbums ebenso gut wie die primitive
Nominalbildung: ģa-ģân-a = γέγον-α, ģa-ģan-ti, ģan-as = γένος, djôt-a-tê,
di-djut-ê, djôt-a-s, djôt-is. Die Grundformen gan, djut werden in
jeder Beziehung, namentlich auch in Bezug auf innere Lautsteigerung
vollkommen wie die ersten, durch keine Analyse weiter zu zerlegenden
Wurzeln wie z. B. an, kan, pat behandelt. Geht daraus nicht hervor,
dass diese Formen, welche sich für das Sprachgefühl von den primitiven
Wurzeln gar nicht unterscheiden, schon vordem Aufkommen der
Flexion und der primären Wortbildung in der Sprache vorhanden
waren? Für die Denominative späterer Perioden haben sich ja ganz
andre Bildungsgesetze festgestellt. Mit wirklich üblichen Nominalsuffixen
hat überdies ein grosser Theil der Zusätze die wir Determinative nennen,
gar keine Aehnlichkeit und es hat der willkürlichsten Annahmen bedurft
um sie dennoch darauf zurückzuführen 1)5.
Die Determinative bestimmen die Wurzeln innerlich, sie verengern
die Sphäre einer Wurzel, die Nominalsuffixe äusserlich, indem sie der
Wurzel eine begränztere Anwendung auf bestimmte Objecte geben.
Aus der W. ju gehen jug und judh hervor. Der Grundbegriff verbinden
verknüpft sich mit allen drei Lautcomplexen, aber während ju
z. B. auch mischen, anrühren vom Teig bedeutet, knüpft sich an jug
208mehr die Bedeutung absichtlicher Verbindung, Knüpfung, besonders auch
des Anschirrens der Rosse an den Wagen, an judh ausschliesslich die
der feindlichen Verbindung, des Zusammentreffens. Aber wie ganz anders
wirken die wortbildenden Suffixe: jug-a-m das verbindende Joch, jôktar
der verbindende, jôk-ti die Verbindung! Die primäre Wurzel tar
(tar-ala-s zuckend, zitternd) oder tra mit dem Grundbegriff der Bewegung
glaubte ich Grundz. 2 201, 203 in den Weiterbildungen tra-s und
tra-m, tra-k (lat. torqu-eo = τρέπ-ω), tra-p (lat. trep-idu-s), die von tra
nur durch Vocalschwächung verschiedenen tri und tru in trup (gr.
τρύπ-ανο-ν), trib (gr. τρίβω) wieder zu erkennen. Jede dieser Weiterbildungen
hat sich zu eigentümlichem Gebrauch identificirt. Wo finden
wir im Gebiete unverkennbar denominativer Verba etwas ähnliches?
jactare, mutare, ναιετᾶν, φορεῖν entfernen sich nur unbedeutend von der
Gebrauchsweise ihrer Primitiva jacere, movere, ναίειν, φέρειν. Eher bietet
die Bedeutungsdifferenz, welche in jüngeren Perioden des Sprachlebens
durch den Vortritt von Präpositionen bewirkt wird, Vergleichungspunkte.
Die Stammbildung der Verba ist überhaupt augenscheinlich viel früher
geschlossen und darum einer unübersehlichen Weiterbildung entzogen
als die der Nomina, bei denen der Trieb nach individueller Ausprägung
bis tief in die Periode des Sonderlebens der Sprachen hinein lebendig
blieb, und so die Möglichkeit gewährte, für die unübersehbare Menge
der Dinge, die bei fortschreitender Cultur der Bezeichnung harrten, verschiedene
Namen zu gewinnen. Wir werden nicht, irren, wenn wir vermuthen,
dass dieser länger dauernde Trieb auch später erwacht ist. In
den Determinativen dagegen haben wir allen Grund sehr alte Anfügungen
an die Wurzeln zu erkennen, die eben deshalb auf das festeste mit ihnen
verwachsen sind und in Bezug auf die Behandlung bei der Flexion nicht
die geringste Verschiedenheit zwischen den erweiterten und den primären
Wurzeln wahrnehmen lassen. Es ist möglich, ja wahrscheinlich,
dass, nachdem einmal eine Reihe von Typen sich festgesetzt halte, nach
ihrer Analogie sich andere bildeten. Aber die Typen selbst gehen jedenfalls
in eine frühe Zeit zurück.
Die Frage nach dem Ursprung der Determinative glaube ich auch
jetzt noch unbeantwortet lassen zu müssen. Wenn, was aus vielen
Gründen wenigstens für mehrere dieser Zusätze das wahrscheinlichste
ist, Verbalwurzeln in ihnen stecken, so haben wir hier das Beispiel einer
Zusammensetzung, die von der vorhin abgelehnten flectirter Verbalformen
209mit Verbalstämmen sehr verschieden ist. Die Wurzeln selbst sind weder
Nomina noch Verba, gesetzt also ju-dh wäre ein altes ju-dha binden
thun 1)6, so hätten wir hier keineswegs eine mit einer undenkbaren Bildung
wie ὀνοματιθημι zu vergleichendes, sondern eher ein an ὀνοματοθέτης
erinnerndes Compositum. Denn gerade das was die Composition mit
entwickelten Verbalformen hinderte, Vielsylbigkeit und Verschiedenheit
der nach Bedürfniss wechselnden Formen, war hier nicht vorhanden.
Ebenso, wenn in den Determinativen Pronominalstämme stecken sollten,
würde ihre Verwendung eine ganz andere sein als in den durch Suffixe
charakterisirten Nominalformen. Gesetzt das k, um das die W. tark, trak
länger ist als W. tar, tra wäre dasselbe, das den Stamm λιθακ von λιθο
unterscheidet, so würde doch die Anwendung eine ganz verschiedene
sein. Im Nomen weist das k auf einen einzelnen Gegenstand hin, den
es aus andern hervorhebt, im Verbalstamm wird die gesammte in ihm
liegende Vorstellung wesentlich modificirt. Der Unterschied ist kaum
geringer als der zwischen dem Suffix as, wenn es, wortbildend angewendet,
aus Verbalwurzeln Nomina abstracter Bedeutung ausprägt, und
demselben Suffix as, wenn es den Nominativ Pluralis oder den Genitiv
Singularis eines Nominalstammes ausdrückt. Also selbst für den Fall,
dass das k in beiden Fällen auf dieselbe Quelle zurückginge, wären doch
beide Verwendungen nicht auf eine und dieselbe Analogie zurückzuführen,
gehörten sie muthmasslich durchaus verschiedenen Zeiten der Sprachgeschichte,
verschiedenen Trieben des Sprachinstincts an.
Principiell scheint es mir sehr wohl denkbar, dass ein Theil dieser
Zusätze aus Verbal wurzeln, ein anderer aus Pronominalstämmen hervorging,
bei jenem Nasal, um den gan stärker ist als ga, ist selbst ein rein
phonetischer Ursprung nicht unbedingt abzulehnen. Der Name Determinativ
bietet wenigstens den Vortheil, diese Zusätze bestimmt von andern
zu unterscheiden.
Mit Hülfe der durch Determinative erweiterten Wurzeln muss es
nun schon möglich gewesen sein eine viel grössere Zahl von Begriffen
210zu bezeichnen. Vielleicht hat hier auch schon die Zweisylbigkeit der
Wörter begonnen, sodass jetzt ju-dha, tar-ka neben ju, tar üblich wurden.
Setzen wir eine längere Dauer dieses flexionslosen Zustandes voraus, so
würde man auch begreifen, dass der in dieser Periode schutzlose Endvocal
abfallen und nur der Consonant allein als Zusatz übrig bleiben
konnte.
3. Primäre Verbalperiode.
Als den ersten Schritt zur eigentlichen Formenbildung dürfen wir
die Bildung primärer Verbalformen betrachten 1)7. Das Wesen des Verbums
liegt in der Aussage. Diese kommt dadurch zu Stande, dass an
Wurzeln von nennender Kraft die Personalpronomina als Zeichen des
Subjects unzertrennlich angefügt werden, z. B. dâ-ma Geben ich, dâ-ta
Geben der. Die Verbindung beider Elemente ist hier also eine prädicative.
Es entsteht auf diese Weise ein kleiner Satz, das Urbild aller
reicher bekleideten Sätze, deren spätere allmählich sich vermann ich faltigende
Entstehung verglichen mit der Schöpfung dieses Ursatzes ein
verhältnissmässig leichtes Ding war. Schleicher hat in seiner Abhandlung ‚Ueber
Nomen und Verbum in seiner lautlichen Form‘ (Abhdll. der
philol.-histor. Cl. IV. S. 501 ff.) gezeigt, wie wenig es allen andern
Sprachen ausser den indogermanischen gelingt, beide Kategorien scharf
und mit völliger Sicherheit von einander zu unterscheiden. Das eigenthümliche
des indogermanischen Verbalbaues beruht gerade auf der präcisen
Auffassung des prädicativen Verhältnisses. Formlose Sprachen
pflegen vielfach durch feste Wortstellung die Beziehungen der Wörter
unter einander zu bezeichnen. So dürfen wir vermuthen, dass der prädicativen
Anfügung eine Zeit vorausging, da der Pronominalstamm, sobald
er als Subject fungirte, seine feste Stellung hinter der Verbalwurzel
hatte. Die entscheidende That war aber doch die feste Verbindung
beider. Es ist wahrscheinlich, dass diese gleich beim Beginne der Formenschöpfung
gelang, und mit solcher Klarheit in das Sprachbewusstsein
eintrat, dass eine Vermischung mit andern Anfügungen fortan zu
den Unmöglichkeiten gehörte. Die vorausgesetzte Grundform der 3.
Sing, dâ-ta enthält ganz dieselben Elemente wie der Stamm des Verbaladjectivs
211dâ-ta, aus dem der Nominativ dâ-ta-s = δο-τό-ς, da-tu-s hervorging.
Eine gleichzeitige Entstehung beider Formen ist kaum möglich.
Sie beruhen auf einem ganz verschiedenen Zuge der Sprachbildung.
In der letztern Form ist ta attributiv dem dâ hinzugefügt: Geben
da, d. i. die Gabe, das gegebene da. Keine Spur führt darauf hin, dass
je eine Zeit existirte, wo dâ-ta gleichzeitig er gibt und gegeben bedeutete.
Nehmen wir aber an, dass in einer sehr frühen Sprachperiode die Suffigirung
ausschliesslich im prädicativen Sinne statt fand, dass aus den so
entstandenen immer noch ziemlich ungefügen Gebilden durch Kürzungen
und Erweichungen der Endungen einerseits und andrerseits durch Kräftigungen
der Wurzel gefügigere Formen sich gebildet hatten, so wird es
leicht begreiflich, dass, nachdem das aus dâ-ta entstandene dâ-ti oder
das aus dem reduplicirten Stamm hervorgegangene dadâ-ti gar nicht
mehr in seiner Entstehung empfunden wurde, in einer späteren, aber
immer noch entschieden schöpferischen Periode die Wurzel, wie wir
sehen werden, als Nomen gefasst, auf's neue sich mit demselben Element
verbinden konnte, nur eben in durchaus anderm Sinne.
Für die Priorität der ältesten Verbalformen vor den gegliederten
Nominalformen sprechen in der That die mannichfalligsten Gründe. Ich
möchte namentlich folgende hervorheben:
1) Die primären Verbalformen, von denen zunächst nur die activen
entstanden sein werden, sind wenig zahlreich. Da die Dualformen wahrscheinlich
erst aus den Pluralformen entstanden sind, handelt es sich
nur um sechs Formen, von denen wieder je drei sich zu einem Numerus
zusammenordnen. Die Pluralformen enthalten ganz deutlich dieselben,
nur zu zweien verbundenen Elemente wie die singularischen. Eine völlig
neue Schöpfung also war nur für diese drei nöthig. Ja im Grunde gilt
auch hier das Wort πλέον ἥμισυ παντός. Sobald einer der drei Pronominalstämme
mit einer Wurzel durch die Kraft des Wortaccents zu einer
Einheit verbunden war, war im Grunde der Typus geschaffen, der in
den übrigen Formen sich nur erneuerte. Die Durchsichtigkeit und bestimmte
Bedeutung dieser Formen macht ihren frühen Ursprung besonders
begreiflich.
Gegenüber dieser Einfachheit und Sicherheit hat das, was wir im
Unterschied von der Flexion Wortbildung nennen, den Charakter bunter
Mannichfaltigkeit. Schon den alten Grammatikern entging dieser Unterschied
212nicht. Die Flexion erschien ihnen als eine declinatio naturalis,
die Wortbildung als voluntaria, in jener herrsche constantia, in dieser
inconstantia (Varro de ling. lat. IX, 34). Die Sprachen unsers Stammes
würden nicht viel an ihrem Charakter einbüssen, wenn es statt der fast
unübersehbaren Masse wortbildender Suffixe nur einige wenige gäbe.
Aber ohne Verbalflexion wären sie nicht entfernt das, was sie sind. Die
reiche Wortbildung ist ein anmuthiger und zu feinstem Gebrauch verwendeter
Luxus der Sprache, die Verbalflexion die erste Bedingung ihres
eigenthümlichen Lebens. Luxusartikel pflegen aber später zu entstehen
als die Befriedigung des dringendsten Hausbedarfes.
2) Wäre die mannichfaltige Ausprägung der Nomina älter als die
primären Verbalformen, wären diese letzteren, wie man behauptet hat,
schon denominativ, so miisste man in ihnen überall deutliche Spuren
von Nominalformen erwarten. Gibt es doch eine Schicht von deutlich
denominativen Verben, die unverkennbar mit Nominalstämmen zusammengesetzt
sind, und andere Verbalformen, in denen wir weiter unten
ebenfalls Nominalthemen erkennen werden. Von beiden aber unterscheiden
sich auf das schärfste andere, die nichts der Art an der Stirn tragen.
Wir bedürften der schlagendsten Beweise, um in so einfachen und klaren
Gebilden wie ai-mi = gr. εἶμι, i-mas = gr. ἴ-μες schon starke Verstümmelungen
der Stammsylbe anzunehmen. Solche Formen tragen durchaus
das Gepräge hoher Alterthümlichkeit.
3) Die primären Verbalformen haften von allen Formen in den Sprachen
unsers Stammes am festesten. Eben darum bildeten sie den Ausgangspunkt
für die Entdeckung der Sprachgemeinschaft in Bopp's Conjugationssystem.
Bei der Casusbildung finden wir doch schon eine gewisse
Mannichfaltigkeit, das heisst hie und da verschiedene Versuche
dasselbe Verhältniss auszudrücken, z. B. beim Genitiv Singularis, beim
Instrumentalis. In den Personalendungen sind die Spuren ähnlichen
Schwankens äusserst gering. Mit völliger Sicherheit wird ein bestimmtes
Mittel und nur dies für einen Zweck verwendet, dem es durchaus entspricht.
Jene sechs ältesten Personalendungen sind recht eigentlich ein
character indelebilis aller indogermanischen Sprachen. Auch dies wird
am verständlichsten, wenn wir ihre Schöpfung als die erste That der
specifisch indogermanischen Sprachbildnerei betrachten.
4) Eine mannichfaltige Nominalbildung vor der primären Verbalbildung
ist nicht wahrscheinlich, ganz undenkbar aber ist in so früher
213Zeit die Casusbildung 1)8. Das Bedürfniss nach Casus konnte erst im
Satze entspringen, und ohne Verbum gibt es keinen Satz im eigentlichen
Sinne, sondern nur Wortconglomerate oder Wortgruppen. Ueberdies
setzen die Casus ausgeprägte Nominalstämme voraus, deren Vorhandensein
vor den hier in Betracht kommenden Verbalformen uns unwahrscheinlich
dünkte. In éinem Punkte trifft das Verbum finitum mit
der Casusbildung zusammen, nämlich im Numerus, der im Verbum wie
im Nomen Bezeichnung fordert. Aber völlig verschieden ist die Bezeichnung
der Numeri auf beiden Gebieten. Hätte es vor der Ausprägung
der Endungen -masi, -tvasi, -(a)nti ein Pluralsuffix gegeben, so
müssten wir dies gleichmässig hier und im Nomen erwarten. Denn was
die Sprache einmal gelernt hat vergisst sie nicht. Wie wenig aber etwa
in dem i ein solches zu finden ist, zeigt der Singular -mi, -si, -ti. Das
wir, ihr, sie im Verbum ist von dem im selbständigen Pronomen total
verschieden. Der Nominativ Pluralis mit seinem s oder as hat sich offenbar
ganz selbständig und, wie wir voraussetzen dürfen, zu einer Zeit
gebildet, da die Personalendungen längst als solche bestanden. Auch
die Medialendungen, in denen ich jetzt mit Bopp und Schleicher doppelte
in verschiedener Beziehung zur Handlung stehende Pronominalstämme
erkenne, z. B. dâ-ta-i = dâ-ta-ti, können nur zu einer Zeit entstanden
sein, da es noch keine Casus gab. Sonst würde das im Sinne von sich
zu nehmende eine ta ein Casuszeichen an sich tragen.
Auf die Entstehung der einzelnen Formen einzugehn ist hier nicht
unsre Aufgabe. In chronologischer Beziehung können wir aber deutlich
innerhalb dieser Periode verschiedene Unterabteilungen erkennen. Zunächst
lautlich. Pluralendungen wie ma-si d. i. ma-tvi, tha-si d. i. tva-tvi,
Medialendungen wie ma-i d. i. ma-mi, ta-i d. i. ta-ti, enthalten die
Suffixe -ma, -tva, -ta mit unverdünntem Vocal. Die Schwächung zu i also
ist ein jüngerer Vorgang. Dann aber ist es augenscheinlich, dass das
Medium erst nach dem Activ entstanden, das es überall voraussetzt und
dein es sich eng anschliesst. In der zweiten Person Sing, des Mediums,
deren Endung -sai wir mit Schleicher wohl auf tva-tvi zurückführen
dürfen, steckt dasselbe Pronomen zweimal so gut wie im Pluralsuffix
214tha-s d. i. tva-tvi. Im Plural ist die Verbindung copulativ: du und du, im
Medium ist sie constructiv geworden: du dich oder du dir. Doppelsetzung
des Pronomens begegnet uns dann wieder in der dritten Person des Imperativs,
dort mit einer Dehnung verbunden, die zur intensiven Wirkung
gut passt: dâ-tâ-t(a) = δό-τω-(τ). Diese verschiedene Zusammensetzung
derselben Elemente gehört wahrscheinlich verschiedenen Zeiten innerhalb
dieser Periode an.
Nachdem in solchen Formen gleichsam der Rahmen der primären
Verben geschaffen und durch die Abwechslung einer Reihe im Stamme
gleicher, in der Endung verschiedener Formen das Bewusstsein der
Flexion erwacht war, trat nun, so dürfen wir muthmassen, eine mehrfache
Umwandlung des geschaffenen ein. Es galt zwischen Stamm und
Endung durch wechselseitige Anbequemung ein festes Verhältniss und
damit jene Beweglichkeit der Formen zu begründen, welche ein unterscheidendes
Merkmal der wahren Flexion ist. Als Mittel dienten die
Kräftigung des Stammes und die Abschwächung der Endungen. Die
Kräftigung des Stammes war aber nicht unabhängig von der Stärke der
Endungen, sie trat nur vor den leichteren Endungen des Singulars ein.
Man sieht, dass es der Sprache hier im Unterschied von späteren Erscheinungen
auf ein gewisses Gleichgewicht ankam, nicht auf durchgreifende
Hervorhebung des Stammes. Daher 1 S. ai-ma (später ai-mi)
aber 1 Pl. i-ma-tva (später i-ma-si, imas), 3 S. ai-ta (später ai-ti), 3 Pl.
i-an-ta (später i-an-ti). Dieser Quantitätswechsel haftet von nun an
trotz aller weiteren Abschwächungen und Erleichterungen fest an den
meisten Formen dieser primitiven Bildung, z. B. im griechischen φη-μί,
φᾰ-μέν.
Auch die Schwächung der Endvocale dient der Gefügigkeit des
Wortes, man kann sie durchaus nicht auf éine Linie stellen mit den viel
stärkeren Entstellungen späterer Perioden. Der Stamm ist um so mehr
Stamm, je weniger er der Endung gleicht, die Endung erfüllt ihren
Zweck um so besser, je weniger schwer sie ist, je geschmeidiger sie
sich dem Stamme in einer nicht allzu schwerfälligen Form anschliesst.
Bei der Bildung der Medialendungen ist allerdings schon eine erhebliche
lautliche Umgestaltung unverkennbar, aber auch diese diente dem Zwecke
gefügigere Wortgebilde zu schaffen. Uebrigens ist hier über manches
einzelne das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.
Neben den beweglichen, das heisst nur einen Theil der Formen
215durchdringenden Verstärkungen des Stammes, scheint aber doch auch
schon eine feste, das heisst alle Formen durchdringende, in dieser Periode
vorhanden gewesen zu sein: die Reduplication. Dieses kindlichste
Mittel zur Hervorhebung eines Wortes oder einer Sylbe dürfen
wir nach dem, was Pott in seiner ‚Doppelung‘ über sein Vorkommen in
den verschiedensten Sprachen gezeigt hat, in frühen Sprachperioden am
ehesten erwarten.
Da die Reduplication mit dem specifischen Wesen der Flexion eigentlich
nichts zu thun hat, so konnte sie sich schon in einer der beiden vorhergehenden
Perioden einfinden. War aber neben da ein dada, neben sta ein stasta
vorhanden, so lag es sehr nahe, auch diesen verdoppelten Stamm in
derselben Weise wie den einsylbigen mit den Personalendungen zu versehen.
So entstand da-dâ-ma neben dâ-ma, da-da-ma-tva neben da-ma-tva,
und so durch die übrigen Personen. Natürlich soll nicht behauptet
werden, dass von jeder Wurzel diese Doppelformen gebildet wurden.
Es hing gewiss von der Bedeutung der einzelnen Wurzel ab, ob sie vorzugsweise,
oder vielleicht ausschliesslich, oder gar nicht verdoppelt ward.
Aber sobald einmal der Trieb erwacht war, auch die reduplicirte Wurzel
zu flectiren, mussten wenigstens vielfach beide Formen, die einfache und
die reduplicirte, neben einander in Gebrauch kommen. Denn hier tritt
uns ein Zug des Sprachlebens entgegen, der für das Verständniss des
Sprachbaues von höchster Wichtigkeit ist. Es ist das echt conservative
Streben, neben den jüngeren Bildungen die älteren zu bewahren. Die
Sprache gibt selten etwas, was sie einmal gehabt hat, völlig auf; wie
das neue immer an das alte anknüpft, so kommt auch das alte nicht
leicht, so zu sagen, ganz aus der Mode. Es hält sich irgendwie, bisweilen
freilich nur in einem verborgenen Winkel. Das Aufspüren alter
Bildungen zwischen jüngeren wird daher immer eine Hauptaufgabe des
Sprachforschers sein. Dieser sich überall geltend machenden Eigentümlichkeit
verdankt die Sprache den Reichthum der Formen, das Anhäufen
der verschiedenen Schichten übereinander. Die Mannichfaltigkeit der
Formen reizt nun aber überall zur Unterscheidung, fordert einen andern
Trieb der Sprache, den nach Differenzirung heraus. In jenem dadâ-ma
neben dâ-ma haben wir das erste Beispiel jenes Unterschiedes zwischen
dem stärkeren und schwächeren Stamme, der schon nicht bedeutungslos
blieb. Keine Frage, dass der reduplicirte Stamm schon von
Anfang an die Handlung mehr hervorheben sollte, dass ihm gegenüber
216die Formen aus dem un verstärkten Stamme der schlichteren Aussage dienlen.
Aber freilich kann in dieser Periode der Unterschied zwischen da-dâma
und dâ-ma oder dadâ-mi und dâ-mi erst ein sehr unbestimmter gewesen
sein. Wir kamen schon oben S. 193 auf die sehr verschiedenartige Verwendung
der reduplicirten Formen zu sprechen und sahen, wie erst
durch das Hinzutreten anderer im Laufe der Zeit sich bildender Unterscheidungsmittel
die besondere Stellung der einzelnen reduplicirten Form
zu andern sich präcisirte und befestigte.
Höchst wahrscheinlich gehört aber in diese Periode auch schon die
Entstehung des Augments. Das Augment zeigt sich vor den verschiedensten,
darunter auch vor den primären Verbalformen a-dâ-m,
a-dadâ-m. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht schon in dieser Periode
entstanden sein sollte. Ein in die Ferne weisender Pronominalstamm
ist, wie ich mit den meisten Mitforschern annehme, die Quelle
des Augments. Vielleicht hatte sich dieser Pronominalstamm a schon
früher als Partikel der Vergangenheit fixirt, wie wir ja dergleichen Partikeln
in solchen Sprachen antreffen, die eine eigentliche Flexion nicht
erzeugt haben, und der Usus hatte sich schon vor der Verbindung dieses
a mit der Verbalform dahin entschieden, im Unterschied von den das
Subject bezeichnenden Pronominalstämmen diesen zu so ganz anderm
Zwecke dienenden der Wurzel vorauszuschicken. Der entscheidende
Schritt war die Zusammenfassung dieses a mit den folgenden Sylben
unter einen Hauptton. Sind diese Combinationen richtig, so dürfen wir
freilich nicht mit Schleicher Gomp. 752 das Augment für eine Casusform
des Pronominalstammes a halten. Denn Casusformen sind dieser
wie den folgenden Perioden noch völlig fremd. Ich sehe aber auch in
dem Laute des Augments keinen zwingenden Grund zu solcher Annahme.
So wenig die Endungen ma tva ta, so wenig zeigt das Augment a irgend
etwas von einer Casusbildung. Nur das wird durch die von Schleicher
angeführten Thatsachen wahrscheinlich, dass das a ursprünglich lang
war. Aber warum sollte nicht das Bestreben nach Hervorhebung ebenso
gut bei Pronominalstämmen wie in Verbalwurzeln sich in der Dehnung
des Vocals geltend gemacht haben? Solche kleine bedeutungsvolle
Wandlungen dürfen wir nach dem, was wir von W. v. Humboldt, Sleinthal
und andern über das Gebahren formloser Sprachen wissen, diesen
frühesten Perioden gewiss am ehesten zutrauen.
Der Hauptgrund für unsre Datirung des Augments liegt darin, dass
217eine andere, augenscheinlich sehr alte Erscheinung, nämlich die völlige
Abwerfung des Endvocals der Personalendungen sich am leichtesten
aus der Wirkung des Augments erklärt, a-dâ-m a-dadâ-m setzt wohl ein
schon aus a-dâ-ma a-dadâ-ma geschwächtes a-dâ-mi a-dadâ-mi voraus.
Sehr begreiflich, dass die Vermehrung des Anlauts um eine Sylbe eine
noch stärkere Verkürzung des Auslauts hervorbrachte. Es kann unmöglich
Zufall sein, dass die sogenannten secundären Endungen im Präteritum
ihren eigentlichen und festesten Silz haben. Die secundären Formen
müssen aber, wie die gleichmässige Durchführung im Activ und
Medium beweist, schon recht früh den primären zur Seite gestanden
haben. Möglich bleibt es, dass auch die Betonung auf diese Kürzung
des Wortendes eingewirkt hat. Das Augment zieht im Sanskrit den
Hochton an sich, auch im Griechischen, so weit es dort das beschränkende
Dreisylbengesetz gestattet. Mit solcher Sicherheit freilich, wie
Benfey überall von den Accenten des Sanskrit auf die Betonung vor der
Sprachtrennung und vollends auf die der ältesten Sprachgestaltung zurückschliesst,
werden wir kaum über die Betonung urtheilen dürfen.
Nach dieser Auffassung würde also diese Periode für das Verbum
doch schon eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Formen hervorgebracht
haben, nämlich
1) ein doppeltes, d. i.
a) unverstärktes,
b) verstärktes Präsens;
2) beide Formen ausser im Activ auch im Medium;
3) Präterita von beiden Formen im Activ und Medium.
Ob das Perfect sich schon damals als besonderes Tempus ausgesondert
hatte, ist mir zweifelhaft, gewiss aber fehlte noch jede Bezeichnung
des Modus.
Neben dieser schon ziemlich reichen Gestaltung des Verbums haben
wir uns in dieser Periode das Nomen vermuthlich ganz unentwickelt
zu denken. Selbst in späteren Perioden der Sprachgeschichte
gibt es vermöge des die Sprache durchdringenden Erhaltungstriebes eine
Anzahl von Nominalstämmen, welche, der Wurzel entweder völlig gleich
oder von ihr nur durch die Quantität der Vocale verschieden, uns zeigen
können, dass zur Ausprägung eines Nomens ein besonderes Suffix, wenn
auch in späterer Zeit sehr beliebt, doch nach der ursprünglichen Anlage
misrei Sprachen keineswegs nolhwendig ist. Eine nicht ganz geringe
218Anzahl von Nominibus dieser Art liegt uns im Sanskrit, Eranischen, Griechischen
und Lateinischen vor (Schleicher Comp. 374). Dergleichen,
wie man behauptet hat, für verstümmelt zu halten, sehe ich keinen
Grund. Dadurch, dass solchen kurzen Nominalstämmen vielfach andere
von wenig oder gar nicht verschiedener Bedeutung zur Seite stehen,
die sich eines Suffixes bedienen, folgt wahrlich nicht, dass die letzteren
die Quelle der ersteren sind. Es scheint mir vielmehr unverständig
zu sein, Formen der einfachsten Art, in denen jeder bei unbefangener
Betrachtung etwas besonders altertümliches erkennen wird,
ohne zwingende Beweise der Verstümmelung zu verdächtigen. Solche
primitive Nominalstämme haben wir uns ganz ausserhalb der später entwickelten
Kategorien der nomina actoris, agenlis u. s. w. zu denken.
Viç (d. i. vik) bedeutet in den Veden eintretender, Ansiedler, Mensch,
das nur quantitativ davon verschiedene zendische viç Eintritt, daher Haus,
Familie. Die Bedeutung solcher altertümlichen Nomina hielt, so scheint
es, die Mitte zwischen einem Infinitiv und Particip, etwa wie die englischen
Formen auf -ing beides sind. Auch von einem Geschlechtsunterschied,
der bei solchen Nominalstämmen in keiner Weise bezeichnet
werden konnte, kann hier gar nicht die Rede sein. Wenn ich nun annehme,
dass diese wurzelartigen Nomina längere Zeit die einzigen waren,
so bestimmen mich dazu namentlich folgende Erwägungen.
Wir besprachen schon oben S. 212 die Thatsache, dass dieselben
Pronominalstämme einerseits zur Bildung der dritten Person im Verbum,
andrerseits zur Ausprägung von Nominalstämmen verwandt werden, und
entwickelten die Gründe, warum, da beides unmöglich gleichzeitig geschehen
konnte ohne die Deutlichkeit zu gefährden, die erste Anwendung
für älter als die zweite zu halten sei. Bei schärferer Betrachtung ergibt
sich nun aber in Bezug auf die Nominalsuffixe ein weiteres. Fragen wir,
was eigentlich die Bedeutung eines wortbildenden Suffixes ist, so kann
darauf kaum eine andre Antwort gegeben werden, als die Hinweisung.
Diese Suffixe sind ja sämmtlich, etwa mit Ausnahme der wenigen,
die in späteren Sprachperioden aus Verbalwurzeln hervorgegangen
sein mögen, Pronomina, denen keine andre, als jene deiktische Kraft
innewohnt. Dadurch, dass man auf etwas hinzeigt, wird dies Ding
durchaus nicht verändert. Mithin kann man im strengsten Sinne gar
nicht sagen, dass die wortbildenden Suffixe die Kraft haben ans der
Wurzel ein Nomen auszuprägen. Die Wurzel hatte vielmehr schon
219an sich auch nominale Funclion, und diese wird durch das angehängte
Pronomen nur gleichsam herausgekehrt. Bhâr musste schon Nomen
sein, ehe das Pronomen a, da ehe ta, gnâ ehe man in den Stammen bhâr-a
(Last, W. bhar tragen), da-ta (gegebenes), gnâ-man (Erkennung, Name)
hinzutrat. Das angefügte Pronomen gleicht gewissermassen einem Artikel.
So gut wie dieser das Substantiv nicht etwa schafft, sondern
voraussetzt, setzt das pronominale Suffix das Nomen voraus. In die
Sprache der alten Grammatiker übersetzt heisst das ungefähr so viel,
wie: die ganze primäre Wortbildung beruht nicht auf Paragoge, sondern
auf Paraschematismus (vgl. Lobeck Proleg. Pathol. p. S), denn Paiasehematismus
ist ‚ea vocabulorum declinatio, qua intellectus non mutatur‘.
Verhält sich dies aber so, so muss aller reicheren Ausprägung
der Nominalstämme eine Zeit vorausgegangen sein, wo die Kategorie
des Nomens im Unterschied vom Verbum sich schon im Sprachbewusstsein
festgesetzt hatte, ohne die Hülfe jener artikelartig deutenden Elemente.
Suffixlose Nomina sind, meineich, eine nothwendige Vorstufe
der mit Suffixen versehenen. Es scheint, dass das Nomen zuerst rein
negativ, das heisst dadurch bezeichnet ward, dass der Wurzel nicht,
wie im Verbum, Pronomina hinzugefügt wurden, ja dass der Unterschied
zwischen Nomen und Verbum dem Sprachbewusstsein durch diesen
Gegensatz überhaupt erst aufging. Die Wurzel war'an sich weder nominal,
noch verbal. Dann folgte eine Zeil, wo sie in Verbindung mit
Pronominibus stets verbal, in nacktem Zustande nominal war, später erst
durch einen neuen Trieb des Sprachgeistes entstand eine neue Vermählung
der jetzt zum Nomen gewordenen Wurzel mit deutenden, individualisirenden
Suffixen. Auch ein lautlicher Umstand kommt unsrer
Chronologie zu Statten. Ein grosser Theil der einfachsten wortbildenden
Suffixe ist uns allem Anschein nach im Sanskrit in ganz ungeschWächter
Form erhalten, z. B. die Suffixe a an na ma ta as ra, während keine
einzige Personalendung ungeschwächt geblieben ist. Nun pflegt das
älteste Sprachgut auch am meisten abgeschliffen zu sein, und der Schluss
ist erlaubt, dass die minder abgeschliffenen Formen der Suffixe jünger
sind als die stärker entstellten der Personalendungen.220
4. Periode der Themenbildung.
Der Zustand der Sprache, welchen wir für die vorige Periode vermutheten,
liess eine gewisse Ungleichheit bestehen zwischen dem Verbum
und dem Nomen. Jenes durch mannichfaltige Endungen zu vielsylbigen
Wörtern gegliedert, dies einsylbig und weiterer Modification
unfähig. Ein solcher Zustand konnte kaum lange bestehn. Durchdringt
selbst das Lautsystem der Sprache ein Streben nach wechselseitigem
Ausgleich, nach Gleichgewicht (Grundz. d. Etym. 2 378), wie viel mehr
das Formensystem. Wir glaubten bestimmt behaupten zu dürfen, dass
die Suffigirung in attributivem Sinne jünger sei als die prädicative. Ob
aber nicht mit der weiteren Verzweigung der Verbalformen, z. B. mit
der Ausbildung des Mediums, gleichzeitig schon Ansätze zu der zweiten
Weise gemacht wurden, ist nicht zu entscheiden. Die Sprache wird auch
hier mit dem einfachsten, mit der Anfügung von blossen Vocalen: a i u,
die ja sämmtlich als Pronominalstämme vorliegen, begonnen haben und
von da ans weiter vorgeschritten sein zur Suffigirung von Sylben wie
an, as 1)9, la, ma. Da nichts in der Sprache völlig bedeutungslos ist, so
hatten natürlich auch diese Pronominalstämme jeder etwas eigentümliches,
dienten zu einer besonderen Art von Hinweisung. Es handelte
sich um so feine Unterschiede, wie wir sie etwa zwischen unserm er
und der, zwischen dies und das empfinden. Hatte, wie wir S. 220
sahen, diese attributive Suffigirung im allgemeinen die Wirkung, die nominale
Bedeutung des Stammes hervorzukehren, so wurden durch die
Anwendung verschiedener Suffixe sofort Unterscheidungen möglich, aber
Unterscheidungen von sehr individueller Art. Denn an eine Unterscheidung
solcher Kategorien, wie sie sich in späteren Perioden ausbildete, isl,
wie wir sahen, für die Entstehungszeit der primären Themenbildung gar
nicht zu denken. Dasselbe a(o), das in skt. aģ-â-s Treiber = ἀγό-ς die
handelnde Person bezeichnet, dient in bhâr-a-s Bürde = φόρο-ς Beitrag
zur Kennzeichnung einer Sache, an der sich die Handlung vollzieht. Ja
ein und dasselbe Wort hat beide Bedeutungen, aģâ-s heisst Treiber und
Treiben, Zug (vgl. ag-men = skt. aģ-man), bhâ-ras so gut wie φόρο-ς
221bedeutet in Zusammensetzungen den Träger. Aus derselben W. ag wird
im Sanskrit durch das Suffix i, im Griechischen durch -ων der Begriff
des Wettlaufs, Wettkampfs entwickelt: âģ-i-s = ἀγ-ών. Helfend traten
dabei zwei Mittel hinzu, die schon aus der vorigen Periode stammende
Lautsteigerung und der Accent. Durch beides wurde eine noch weit
grössere Fülle verschiedener Formen möglich. Der Unterscheidungstrieb
fand hier die reichste Nahrung, aber es wird schwerlich je gelingen, für
die im einzelnen Falle getroffene Entscheidung einen besondern Grund
zu errathen. Das Band, welches zwischen der Wortbedeutung und dem
wortbildenden Suffix unzweifelhaft besteht, ist ein sehr geheimnissvolles.
Wir können kaum umhin anzunehmen, dass die Nominalstämme schon in
früher Zeit in einer üppigen Fülle hervorkeimten, die gegen die geschlossene
Zahl und Einfachheit der Verbalflexionen in entschiedenstem Gegensatz
steht. So gab es eine Menge von Synonymen, die sich erst bei
fortgesetztem Gebrauche schärfer gegen einander abgränzten. Oft geschah
dies sogar erst in der Zeit nach der Sprachtrennung, weshalb hier
auch keineswegs eine so vollständige Uebereinstimmung zwischen den
verwandten Sprachen stattfindet, wie bei der Flexion. In dieser Periode
muss auch der Begriff des grammatischen Geschlechts dem Sprachgefühl
aufgegangen sein, zunächst aber nur der zwischen Masculinis und Femininis.
Bei Wörtern ohne Suffix ist ein Geschlechtsunterschied gar nicht
auszudrücken. Aber bei den Vocalen a i u bildete sich nun der Unterschied
heraus, das Femininum durch Dehnung zu charakterisiren, ein
Trieb der aber nur bei a vollständig durchgedrungen ist, hier jedoch so,
dass ihm dann alle auf a auslautenden Suffixe sich anschlössen, und der
um dieselbe Zeit auch die meisten Pronominalstämme ergriffen haben
muss. Auch in diesem Umstände liegt ein chronologisches Moment.
Wäre der Trieb nach Geschlechtsunterscheidung schon erwacht gewesen,
ehe die prädicative Suffigirung in den Verbalformen stattfand, so miissten
wir in letzteren, wie im semitischen Verbum, Genusunterschiede erwarten.
Zu einer Zeit da man zwischen ta er und tâ sie bereits unterschied,
konnte daraus kaum das geschlechtlich indifferente ta, später ti hervorgehen.
Der gänzliche Mangel an Geschlechtsunterscheidung im Verbum
finitum dürfte neben der verschiedenen Bildung des Plurals (S. 214) eins
der deutlichsten Anzeichen für die Priorität entwickelter Verbal- vor den
Nominalformen sein. Nachdem die einfachen Pronominalstämme ihren
Dienst als attributive Suffixe geleistet hatten, blieb noch das Mittel der
222Zusammensetzung mehrerer, indem also statt eines der und er ein der
da, er da, statt dies und das dies da, das da verwendet ward. So
entstanden zweisylbige Suffixe wie an-a, ma-na, ta-va, ta-ra, auch diese
durch Dehnungen, durch verschiedene Betonung und durch Geschlechtsunterscheidung
variabel. Vielleicht dürfen wir schon für diese Periode
eine neue Art von Vervielfältigung durch Verkürzung der früher geschaffenen
zusammengesetzten Suffixe annehmen. Sahen wir schon in der
vorhergehenden Periode besonders vielsylbige und an Wortkörper stark
beschwerte Verbalendungen durch Schwächung und Abstumpfung sich
erleichtern, so hat die gleiche Annahme für Nominalstämme nichts auffallendes.
Zwei der häufigsten Nominalsuffixe, beide entschieden älter
als die Sprachtrennung, die Suffixe ant und tar, finden nur so eine Erklärung
aus Pronominalstämmen, ant dürfen wir auf älteres an-ta zurückführen,
wobei dann das zweite Element sein a einbüsste, tar mit
Schleicher (Comp. 2 442) auf ta-ra. Ist diese Erklärung richtig, und sie
wird sich wenigstens durch ihre Einfachheit empfehlen, so enthält sie
wieder ein wichtiges chronologisches Element. Zu einer Zeit, da bereits
die Casusformen existirten, wäre eine derartige Abwertung der Schlussvocale
kaum begreiflich. Die Casusendung bildet eine Schutzmauer gegen
Entstellungen und Abschleifungen des Stammes. Im Nominativ Hesse
sich eine Verkürzung von bharanta-s in bharant-s, von dâ-tara-s in dâtar-s
noch allenfalls nach der Analogie ähnlicher Umgestaltungen in späteren
Sprachperioden verstehen. In den übrigen Casus aber ist zwischen einem
bharanta-sja und bharant-as (Gen.); zwischen dâtara-i (Loc.) und dâtar-i
wenig Gemeinschaft. Die Sache wird aber leicht verständlich, sobald
wir eine Periode annehmen, in der zwar mannichfaltige Stammbildung
aber noch keine Casusbildung statt fand. Die Stämme bharanta dâtara
waren, so lange sie endungslos dastanden, ebenso der Schwächung ausgesetzt
wie die Verbal formen bhar-ta oder ba-bhar-ta, dâ-ta oder da-dâ-ta,
wie sich letztere zu bhar-ti, bi-bhar-ti und bei dem Vortritt des
Augments zu bhar-t, bi-bhar-t, dâ-t verkürzten, so konnte damals, aber
auch nur damals, den Nominalstämmen leicht das gleiche widerfahren.
Die Einbusse, die sie am Schlüsse erlitten, ist die Marke, an der wir die
einstige Wortgränze in derselben Weise erkennen können, wie an den
Rändern eines Gebirgssees der einstige Wasserstand auch längst nach
dem Sinken der Gewässer deutliche Spuren hinterlassen hat. Dasselbe
Princip wird sich dann auch auf andre Formen anwenden lassen, so auf
223das blosse t in Formen wie skt. -ģi-t gr. ἀ-γνω-τ auf -mant, das in ma-na-ta
zu zerlegen sein wird, auf -k in griechischen Wörtern wie φύλαξ,
lateinischen wie senex. Kurz, es beantwortet sich uns auf diese Weise
eine ganze Reihe von Fragen der Wortbildungslehre, auf die wir sonst
die Antwort schuldig bleiben müssten.
Die auf solche Weise gebildeten Nominalstämme haben nun aber
auch noch ihre Wichtigkeit für ein andres Gebiet, für das der Verbalbildung.
Um begreifen zu können, wie Nominalstämme als Verbalstämme
fungiren, also gewissermassen in das Gebiet der Wurzeln übergreifen
können, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Nomina und Verba sich
auf dieser Stufe der Sprachgeschichte noch keineswegs in der durchgreifenden
Weise unterschieden, wie in der späteren Sprache. In dem
uns durch Denkmäler überlieferten Sprachzustande ist das Nomen nicht
bloss durch seine Form, sondern — mit Ausnahme der Participien und
Infinitive, die wir Verbalnomina nennen können — auch durch seine
Rection vom Verbum geschieden, das Nomen nimmt als ergänzender
Casus den Genitiv, das Verbum meist den Accusativ zu sich 1)10, das Nomen
Substantivum wird durch Adjectiva näher bestimmt, das Verbum durch
Adverbia, das Nomen wird durch eine Reihe von Casusformen durchgeführt,
die von den Formen des Verbums absolut verschieden sind. Von
allen diesen Unterschieden kann in dieser, der Casusbildung vorausgehenden
Zeit, gar nicht die Rede sein. Die ältesten Nomina unterschieden
sich, wie wir oben (S. 218) sahen, von den Verbalstämmen in keiner
Weise. So musste sich das Gefühl ausbilden, dass das Nomen gewissermassen
nur ein Verbalstamm ohne Subjectszeichen sei, und wird
es begreiflich, dass nach Analogie jener ältesten Nomina wie sad, bhar
nun auch andre jüngeren Gepräges, wie sada, bhara, mit specifischer
Nominalbildung die prädicative Verbindung mit den Personalendungen
eingingen und dadurch zu Verben wurden. So kamen zu den thematischen
Nominalstämmen die thematischen Verbalformen.
Den Vocal, durch welchen eine Form wie bhar-a-ti sich von einer
wie bhar-ti, durch welchen sich ed-i-t von es-t unterscheidet, habe ich
früher im Anschluss an eine ältere Darstellungsweise als Bindevocal gefasst,
hauptsächlich deshalb, weil alle damals vorliegenden andern Erklärungen
224dieses Vocals mir verfehlt schienen und überhaupt für die
Einfügung eines A-Lauts mitten in den Körper einer auch ohne ihn
lebensfähigen Verbalform ein Erklärungsgrund unfindbar war. Bei wiederholter
Erwägung des indogermanischen Formenbaues als eines ganzen
sind für mich aber doch die Gründe, welche gegen die Auffassung
jenes Vocals als rein lautliches, das Zusammentreffen von Consonanten
hinderndes Einschiebsel sprechen, überwiegend geworden. Wesentliche
Gründe sind folgende:
1) In andern Verbal- und in Nominalformen werden die Consonantengruppen,
welche mit Beiseitesetzung der Bindevocale entstehen würden,
keineswegs gemieden. Wenn ἦγ-μαι, ἦξαι, ἦκται, ἀκτό-ς, ag-men,
ac-tio möglich war, warum nicht ag-mi, ak-si, ak-ti? Die Einschiebung
eines Hülfsvocals, die sich für spätere Sprachperioden nicht ableugnen
lässt, beruht im Grunde so gut wie die vielen Abschwächungnn und Ausstossungen,
durch welche sich jüngere Gebilde von älteren unterscheiden,
auf einer Schwächung der Articulationskraft. Wenn wir also für die
Organisationsperiode alles was Schwächung heisst nur mit äusserster
Vorsicht zulassen, so ist es von vorn herein nicht wahrscheinlich, dass
sie einen Bindevocal kannte.
2) Der s. g. Bindevocal tritt namentlich dadurch ganz in die Analogie
stammhafter Endvocale, dass er wie diese in der 1 S. gedehnt
wird: tudâ-mi, bôdhâ-mi wie φη-μί, ti-shthâ-mi = ἵ-στη-μι, âpnô-mi
vgl. δείκνῡ-μι.
3) Im Conjunctiv der bindevocalischen Flexion wird der Bindevocal
verlängert und die Optativbildung nimmt ihn mit in sich auf: skt. aģâ-ti
= ἄγη-σι, skt. aģet = ἄγοι(τ), er gehört also zu den in einem gewissen
Bereich fest bleibenden Elementen, deren Vereinigung wir Stamm
nennen. Das gleiche gilt vom griechischen Infinitiv: ἀγ-έ-μεναι im Unterschied
von ἔδ-μεναι und Part. M. ἀγ-ό-μενος.
4) Dieser Vocal ist in einigen Fällen unverkennbar Stammauslaut,
so namentlich in der 4ten oder I-Classe. Mögen wir hier für das specifische
Bedürfniss der griechischen Grammatik, das allerdings für den in
so ausgedehntem Masse zur Regel gewordenen Vocal einen Namen fordert,
ἰδ-ί-ο-μεν abtheilen, das indische svid-jâ-mas zeigt, dass eigentlich nicht
i, sondern ja an den Verbalstamm antrat, dass also hier auf jeden Fall
das o nicht Bindevocal ist. Das gleiche gilt von Formen wie lat. si-sti-mus,
das auf einer Linie mit ἵ-στα-μες (für σί-στα-μες) steht. Nicht
225anders steht es mit dem -sjâ-mi = σίω, lat. ero des Futurums, wo auch
der Vocal nach dem j oder i, wie wir sehen werden, ein inlegrirender
Bestandtheil der Form ist.
5) Durchschlagend aber ist für mich ein letzter Grund. Der Bindevocal
ist lautlich identisch mit dem Conjunctivvocal der bindevocallosen
Conjugation.
Bhar-a-ti ist Conjunctiv zu bhar-ti und Indicativ zur 1 S. bhar-â-mi,
ἴ-ο-μεν: ἴ-μεν = δεικνύ-ο-μεν: δείκ-νυ-μεν. Daraus folgt allerdings noch
nicht, dass beide Vocale ursprünglich eins sein müssen. Aber da sie
lautlich eins sind, wird ihre ursprüngliche Identität in hohem Grade
wahrscheinlich, sobald gezeigt wird, dass sie ursprünglich identisch sein
können. Und das hoffe ich zeigen zu können.
Auf dies Thema komme ich später zurück. Zunächst werden wir
diejenigen Verbalformen in's Auge zu fassen haben, welche wir als thematische
glauben bezeichnen zu können. Betrachten wir mit Schleicher
Comp. 2 763 den A-laut, um den es sich handelt, als Endvocal des
Stammes, so stellt sich lautlich die vollständigste Parallele heraus zwischen
Verbalstämmen wie bhara, tuda einerseits, woraus die Präsensformen
bharâ-mi, tuda-ti, und den gleichlautenden Nominalstämmen,
woraus die Casusformen bhara-s (tragend in Zusammensetzungen), tuda-m
(Acc. stossend, tuda-s auch EN.) hervorgehen, andrerseits aber zwischen
den Formen mit verstärkter Stammsylbe wie bôdhâ-mi ich weiss, d. i.
baudhâ-mi, und Nominalformen wie bôdha-s Wissen, tôda-s Stösser. Die
Lautsteigerung ist für die betreffenden Verbalformen ebenso wenig unerlässlich,
wie für die Nominalformen. Da nun alle gleichlautenden Formen
zunächst das Präjudiz für sich haben ursprünglich gleich zu sein,
so ist es doch auch hier der Mühe werth zu fragen, ob nicht ursprüngliche
Identität anzunehmen sei. Diese Annahme ist nicht neu. Steinthal
in seiner ‚Charakteristik‘ S. 291 hat sie ausgesprochen. Er erklärt sich
das Eintreten von Nominalstämmen wie bhara, tuda statt der Wurzeln
bhar, tud aus dem Bestreben die Dauer der Handlung entschiedner hervorzuheben.
Im Unterschied von einem bhar-ti, tud-ti er trägt, er stösst.
würde dann bhara-ti, tuda-ti Träger er, Stösser er, oder, mit andern
Worten, er ist Träger, ist Stösser bedeuten. Man denke an Wendungen
wie die ‚seid Thäter des Worts und nicht Hörer allein‘. Und welch ein
Unterschied zwischen er führt das Wort und er ist Wortführer! Auch
englische Umschreibungen wie he is writing neben he writes sind in gewissem
226Sinne vergleichbar. Von der Kategorie der beharrenden Handlung,
die dem Sprachsinne eben am Nomen aufgegangen war, würde
hier gleich auch im Verbum Gehrauch gemacht sein. Wir hätten hier
dann das Vorspiel zu einer viel späteren Weise der Sprache den Präsensstamm
aus einem Nomen abzuleiten, z. B. in μηκά-ο-μαι neben μέμηκα,
lat. sona-re neben son-ui, nur dass es auf dieser frühen Stufe keiner ableitenden
Endung oder, richtiger aufgefasst, keines Hülfsverbums bedurfte
um den Nominalstamm zum Verbal-, beziehungsweise Präsensstamm
zu machen. Von den eigentlich denominativen Verbalformen
müssen diese thematischen doch immer wohl unterschieden werden. Ich
gestehe, dass mir diese Erklärung in hohem Grade ansprechend und über
eine Reihe andrer Bildungen Licht zu verbreiten scheint. Zunächst wird
auf diese Weise vollkommen verständlich, warum es so viele Präsensstämme
ohne Stammerweiterung gibt, wie bharâ-mi = φέρω, aģâ-mi =
ἄγω u. s. w., die dennoch ebenso durative Bedeutung haben, wie die
erweiterten. Das durative Element lag eben schon in dem Vocal, der
an die Wurzel antrat. Sodann eröffnet sich uns der Blick auf andre
Arten der Präsensbildung, in denen man schon früher von verschiedenen
Seiten Nominalstämme vermuthet hat. Die Sylbe nu = νυ, durch welche
sich skt. ṛ-nu gr. ὀρ-νυ von der W. ar, ὀρ, die Sylbe na (nâ, nî): gr. να
(νη), durch die sich ju-nâ von der W. ju, gr. σκιδ-να von der W. σκιδ
unterscheidet, hält Benfey (Allg. Monatsschr. 1854 S. 739) für identisch
mit den Nominalsuffixen -nu und -na, und dem entsprechend finden auch
andre nasale Präsenserweiterungen, wie namentlich das zu griechischen
Präsensformen auf -ανω sich stellende skt. -ana (Schleicher Comp. 2 770)
oder -âna (Bopp Vgl. Gr. II 350) eine einfache Erklärung, wie denn
auch Schleicher bei diesen Erweiterungen auf Nominalformen verweist.
Ueber die Existenz solcher Nominalstämme wie su-nu, svap-na in der
Zeit der Spracheinheit kann nach dem was z. B. von Schleicher Comp. 2
428, 434 beigebracht ist, kein Zweifel sein. Manches hieher gehörige
ist auch von Kuhn Ztschr. II S. 392 ff. besprochen. Die Auseinandersetzungen
Benfey's dagegen im ‚Orient und Occident‘ I 423, III 217, wonach
so alterthümliche Formen durch unmotivirte Lautschwächungen
aus Verben mit ableitendem ja verstümmelt sein sollen, haben für mich
durchaus nichts überzeugendes. Aber freilich glaube ich auch die in
meinen ‚Tempora und Modi‘ gegebene Darstellung nicht mehr halten zu
können. Dort suchte ich sämmtliche Präsenserweiterungen, welche
227Sylben mit n enthalten, aus der Nasalirung, d. h. aus dem Streben zu
erklären, dem Stamme durch Einfügung eines Nasals eine grössere Fülle
zu geben. Allein diese Erklärung reicht offenbar nicht aus. Es ist schwer
begreiflich, wie die Sprache das Bedürfniss fühlen sollte, eine W. ar durch
n zu verstärken und noch weniger lässt sich der rein lautliche Zusatz
eines a und vollends eines u begreifen. Meine damalige Ansicht beruhte
auf der Annahme einer ausgedehnten Anwendung von Binde- und Hülfsvocalen,
wie sie mir jetzt namentlich für eine so frühe Periode des
Sprachlebens aus den eben entwickelten Gründen unzulässig scheint.
Wie weit dennoch in einem viel beschränkteren Umfang die Nasalirung
ihr Recht behaupten darf, z. B. in skt. lumpâmi von der W. lup, lat.
rumpo von der W. rup, kann hier unerörtert bleiben, wo es nur darauf
ankommt die Wahrscheinlichkeit zu erweisen, dass eine Anzahl von
Verbalstämmen und Nominalstämmen identisch ist.
Solche unmittelbar als Verbalthemata verwendete Nominalstämme
mussten übrigens wenigstens einer lautlichen Verwandlung sich unterziehen,
nämlich jenem Wechsel zwischen gedehntem Stammauslaut in
einigen und kurzem in andern Formen. Wie dâ-mi Plur. da-tha[s], da-dâ-mi
dada-tha[s], so hiess es tudâ-mi tuda-thas, ar-nau-mi arnu-mas.
Indess ist bei diesen zweisylbigen Verbalstämmen die Länge auf einen
kleineren Kreis von Formen beschränkt. So heisst es tuda-si gegenüber
von dadâ-si. Eine, wenn auch geringe, Modifikation des Stammes in
seiner Verbindung mit den Personalendungen scheint durchaus mit zur
älteren Verbalbildung gehört zu haben. Was die Bedeutung betrifft, so
liegt es zwar, wie wir sahen, am nächsten, den zum Verbalstamm gewordenen
Nominalstamm als Nomen agentis zu fassen, wobei es freilich
an kleinen Verschiedenheiten nicht gefehlt haben wird. Ausser der Möglichkeit
liegt es freilich nicht, dass nach und nach auch andre Combinationen
sich bildeten, dass das Verbum gelegentlich auch die Beschäftigung
mit der im Nomen liegenden Handlung und ähnliches ausdrückte.
Ueberblicken wir nun auf Grund der eben erörterten Vermuthungen
den Bestand der Sprache an Verbalformen von wesentlich gleicher
Function, so tritt uns eine ziemlich beträchtliche Fülle heraus. Schon
in der früheren Periode hatte die Sprache den Unterschied des reduplicirten
und des nicht reduplicirten Stammes benutzt um die markirtere
Handlung von der einfachen zu unterscheiden. Dazu kamen jetzt wenigstens
vier neue Mittel einer volleren Bildung, nämlich die Anwendung
228eines A-Stammes, entweder ohne oder mit Steigerung des Wurzelvocals,
die Anwendung eines Stammes auf nu und die eines Stammes auf na.
Denken wir uns alle diese Formen an einer und derselben Wurzel ausgeführt 1)11,
z. B. an der W. lip, so boten sich folgende Formen für die 3 S.
tableau lip-ti | li-lip-ti | lipa-ti | laipa-li | lip-nau-ti | lip-nâ-ti.
Gegenüber der ersten Form sind sämmtliche fünf andere verstärkt. Es
musste sich daher nothwendig im Sprachgefühl der Unterschied zwischen
dem reinen und dem verstärkten Stamme ausbilden. Was ursprünglich
mehr aus dem Triebe nach Hervorhebung, die für den einzelnen Fall
eine individuelle war, sich herausgebildet hatte, lernte man jetzt unter
eine generelle Einheit subsumiren. Den einzelnen Act, der wie ein Punkt
der Ausdehnung entbehrt, zu bezeichnen, war vorzugsweise die kürzeste
Form geeignet, sämmtliche übrigen vereinigten sich ihr gegenüber in der
Function, die in ihrer Breite gefasste, die dauernde Handlung auszudrücken.
So stellte sich jene Doppelheit des Stammes, jener Unterschied zwischen
dem reinen Ferbalstamm einerseits und dem Präsensstamm andrerseits
heraus, auf welchem der gesammte Bau des indogermanischen
Verbums ruht. Die weitere Verzweigung und Ausprägung der einzelnen
Formen zu verfolgen, die namentlich bei der reduplicirten eine mannichfaltige
war, liegt nicht in unsrer Aufgabe. Ueber diese Verhältnisse der
Tempusstämme hat die Wissenschaft es schon zu einiger Klarheit gebracht.
Aber auf demselben Grunde erwuchs, wie ich glaube, auch der
erste modale Unterschied. Und hierauf müssen wir, da diese Ansicht
eine neue ist, nothwendigerweise etwas genauer eingehen.
Es handelt sich zunächst um den Conjunctiv. Die früher von
mir im Anschluss an W. v. Humboldt gebilligte Erklärung, die langen
Vocale des Conjunctivs als Symbole der zögernden und darum bedingten
Aussage zu betrachten, erkenne ich jetzt als unhaltbar. Denn erstens
229dürfen wir die bedingte Aussage keineswegs an die Spitze des Conjunctivgebrauchs
stellen. Zum Ausdruck der Bedingung dient der Conjunctiv
nur in abhängigen Sätzen. Unstreitig hat sich aber der Gebrauch
eines Modus durchweg zuerst in selbständigen Sätzen entfaltet, die ohne
alle Frage lange Zeit die einzig möglichen waren. Es wäre also ein
chronologischer Schnitzer von jenen statt von diesen auszugehen. In
unabhängigen Sätzen drückt der Conjunctiv nach dem unverwerflichen
Zeugniss der griechischen Sprache wesentlich eine Aufforderung aus:
ἄγωμεν im Unterschied von ἄγομεν, φέρωμεν von φέρομεν, und wie eine
Aufforderung aus einer zögernden Aussage entstehen könne, sieht man
nicht. Ferner passt die ganze Erklärung, auch formell betrachtet, nur
für den Conjunctiv der Conjugation mit Bindevocal, oder, wie wir jetzt
lieber sagen, mit thematischem Vocal. Dass in einer Form wie ἄγωμεν
die Tendenz der Sprache dahin ging die Aussage zu einer zögernden zu
machen, war an sich denkbar. Aber dass die Sprache um ein Zögern
auszudrücken — das übrigens, wie wir sahen, dem Gebrauche gar nicht
entspricht — sich selbst ein Hinderniss in der Gestalt eines A-Lauts in
den Weg würfe, wie es geschehen sein müsste, wenn ἴ-ο-μεν auf diese
Weise aus ἴ-μεν hervorgegangen wäre, ist doch eine kaum zulässige Annahme.
Dagegen bietet sich uns, denkeich, auf Grund der Steinthalschen
Hypothese eine befriedigendere Lösung des Problems. Die dauernde
und die geforderte Handlung haben manches gemeinsam, vor allem den
Gegensatz zur raschen Ausführung. Keine Anwendung der durativen
Formen ist bekannter als die conative. Er geht damit um zu tragen und
er soll tragen sind synonyme Vorstellungen. Ferner, so gut wie die
dauernde kann die geforderte Handlung aus der Verbindung eines Nomen
agentis mit Personalendungen hervorgehen: bhara-ti ‚Träger (ist) er‘
kann im Gegensatz zu bhar-ti ‚Tragen er‘ ebenso gut durch einen prägnanten
Gebrauch den Gedanken er ist zum Tragen berufen, er soll tragen
enthalten, wie den: er beschäftigt sich mit dem Tragen, ist im Tragen
begriffen, er sucht zu tragen. Der Conjunctiv ist in mehreren seiner primitivsten
Anwendungen, wie die Sprache der Veden und der homerischen
Gedichte zeigt, dem Futurum verwandt: οὐκ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
οὔπω ἴδον οὐδὲ ἴδωμαι. Und das Futurum entsteht ja in einer viel weiter
fortgeschrittenen Periode unter anderm auch durch Anwendung eines
Nomen agentis: skt. dâtâ Geber d. i. er wird geben, daturu-s est. Wenn
sich auf diese Weise der Ursprung des Conjunctivs aus der durativen
230Präsensform begrifflich rechtfertigt, so bleiben freilich, was die Form
betrifft, auf den ersten Blick noch manche Schwierigkeiten übrig, die
sich indess, wie ich glaube, überwinden lassen.
Ein erster Einwand wäre folgender. Wenn die durativen Formen
zugleich jene conjunctivische Kraft in sich trugen, so ist es auffallend,
dass dieselbe Form in diesem Verbum rein durativ, in jenem rein conjunctivisch
verwendet wird. Warum ist skt. vaha-ti = lat. vehit Indicativ,
das gleichgebildete skt. hana-ti (er schlage) Conjunctiv? Man kann
darauf antworten: aus demselben Grunde, aus welchem gr. νέμε-τε Imperativ
Präsentis, τέμε-τε Imperativ Aoristi, aus welchem δίδο-ται Präsens,
δέδο-ται Perfect ist. Die Bedeutung einer einzelnen Form lässt sich
niemals ausschliesslich aus den Elementen erklären, in die wir sie zu
zerlegen vermögen, sondern es kommt als zweiter Factor überall die
Analogie, oder mit andern Worten die Stelle in Betracht, welche die
einzelne Form im Vergleich mit andern Formen einnimmt. In diesem
Sinne kann immer nur von einer relativen Fähigkeit gewisser Formen zu
gewissen Bedeutungen die Rede sein. Wo die kürzeste, jeder Verstärkung
entbehrende Form für den Indicativ Präsentis erhalten blieb, gewann
im Gegensatz zu ihr die thematische nach und nach modale Bedeutung,
da zu einer temporalen kein Anlass war. So ward hana-ti
Conjunctiv zu han-ti. Hier setzte sich der Unterschied fest, der die Quelle
des Modusgebrauchs war. Bei andern Verben dagegen starb die kürzere
Form ab, auch das wohl nicht durch reinen Zufall, sondern weil die
Bedeutung der Wurzel kräftigere Formen forderte, oder weil die Lautverbindung
eine zu schwierige war. So fixirte sich die vollere Form
als Indicativ Präsentis.
Ein zweiter Einwand Hesse sich etwa so formuliren. Enthält die
Kategorie des Durativs die der erstrebten, geforderten Handlung in sich,
so wäre zu erwarten, dass sämmtliche Präsensverstärkungen gelegentlich
conjunctivisch verwandt würden. Warum also ist zwar lipa-ti, aber
nicht lî-lip-ti, lip-nâ-ti Conjunctiv zu lip-ti? Um eine Antwort auf diese
Frage zu finden, müssen wir uns erinnern, dass die verschiedenen Präsenserweiterungen
sich zwar in dem Zwecke vereinigen die dauernde
Handlung im Unterschied von der momentanen zu bezeichnen, dessen
ungeachtet aber keineswegs völlig gleichbedeutend waren. Nur so begreift
es sich, dass von einer Wurzel mehrere Präsensstämme neben
einander gebraucht werden konnten. In Folge der individuellen Färbung,
231welche die durative Handlung in den verschiedenen Präsensbildungen
annahm, konnte die eine dem modalen Gebrauche näher stehen als die
andre. Wahrscheinlich war die reduplicirende Bildung dazu am wenigsten
geeignet, denn an sie knüpfte sich doch wohl von Anfang die Vorstellung
einer mehr intensiven Handlung. Der intensive Gebrauch bildet
aber innerhalb des Gebietes der durativen Handlung gewissermassen den
entgegengesetzten Pol zur conativen, und nur aus letzterer glaubten wir
den Conjunctivgebrauch erklären zu können. So würde sich also begreifen,
warum li-lip-ti nie Conjunctiv ward. Die Präsensbildungen
mit den Sylben -na und -nu sind vielleicht etwas jüngeren Ursprungs.
Nachdem sich aus denen mit blossem A-Laut die Kategorie des Conjunctivs
entwickelt hatte, war für letzteren, so zu sagen, schon gesorgt.
Die neueren Bildungen charakterisirten die dauernde Handlung wieder in
etwas anderm Sinne, folgten jenen nicht in allen Modifikationen. Sehen
wir doch auch sonst, wie der Sprachgebrauch aus einer Reihe wesentlich
gleichartiger Gebilde ein einzelnes, so zu sagen, herausgreift und zu einer
Besonderheit entwickelt. Wir werden darauf namentlich bei der Entstehung
der Casusendungen zurückkommen.
Bedenklicher ist auf den ersten Blick ein dritter Einwand. Wie erklären
sich denn Formen mit gedehnten Vocalen? Wie ist nach der
vorgetragenen Ansicht das Verhältniss von bharâ-ti = φέρη-σι neben
bhara-ti = φερε-τι, φέρει zu verstehen? Wir glauben jenen A-Laut seinem
Ursprünge nach nicht als Bindevocal fassen zu können. Damit ist
aber keineswegs die Meinung ausgeschlossen, dass das Ueberwuchern
dieses ursprünglich bedeutungsvollen Vocals mit in der lautlichen Bequemlichkeit
seinen Grund hatte. Diese musste namentlich vor den Endungen
des Präteritums sich sehr dringend geltend machen, wo Formen
wie a-lip-m, a-lip-s, a-lip-t nur schwer sprechbar waren. Aber auch im
Präsens wird die Schwierigkeit mancher Consonantengruppen, sobald
Doppelformen vorhanden waren wie lipa-ti neben lip-ti, tuda-ti neben
tud-ti, entschieden dazu beigetragen haben, die zweite Form beliebter zu
machen und die erste in den Hintergrund zu drängen. Jene alten Conjunctive
wie hana-ti, ἴο-μεν im Gegensatz zu han-ti, ἴ-μεν weckten nun
den Trieb zu einer Neubildung. Auch hier konnte die Sprache nicht
vergessen, was sie einmal gelernt, ein Bedürfniss nicht los werden, das
einmal in ihr erwacht war. Das Wesen des Conjunctivs schien in einer
Einschiebung zwischen Stamm und Endung zu bestehen. In stricler
232Analogie bildete man nun bharâ-ti neben bhara-ti, wie hana-ti neben
han-ti. Dadurch löste sich aber die Modusbildung vollständig von der
Tempusbildung ab. Die Verdoppelung, die innerliche Verstärkung und
der Zusatz nasaler Sylben blieb der letzteren überlassen, als Zeichen des
Conjunctivs setzte sich die Dehnung fest. Wie sehr noch in einer späteren
Periode der Sprache der Modus der Forderung Dehnungen, sei es
des Stammes, sei es der Personalendung, liebt, zeigt ja einerseits das
Griechische durch Formen wie δώο-μεν, στήο-μεν, δώω-σι, andrerseits
das Sanskrit durch die Dehnung der Diphthonge in den medialen Personalendungen,
z. B.jaģâ-tâi neben jaģ-â-tê 1)12.
Indem so ein Theil der schwereren, ursprünglich zur Bezeichnung
der dauernden Handlung geschaffenen Formen sich für einen besondern
Zweck aussonderte, musste zwischen den übrig bleibenden Formen sich
ein mehrfach andres Verhältniss ausbilden. Jede Indicativform forderte
nun ihren Conjunctiv:
lip-ti lipa-ti, lipa-ti lipâ-ti,
lilip-ti lilipa-ti, laipa-ti laipâ-ti u. s. w.
Auf diese Weise bildete sich eine neue Species der Präsensbildung. Der
Unterschied zwischen lipa-ti und laipa-ti scheint ursprünglich zu einer
temporalen Differenz nicht benutzt worden zu sein. Eine Form wie
tuda-ti ist ja ebenso Präsensform wie bôdha-ti d. i. baudha-ti, griechisch
ἄγει so gut wie τήκει, (W. τᾰκ). Lipa-ti also und laipa-ti waren anfangs
coordinirt. Die Sprache mochte sich entweder für die eine, oder für die
andre Form entscheiden, vielleicht je nachdem die Handlung mehr oder
weniger energisch ausgedrückt werden sollte. Indem sich nun aber
neben lipa-ti der Conjunctiv lipâ-ti, neben laipa-ti laipâ-ti schob und für
die letzteren Formen der Begriff der geforderten Handlung entwickelte,
musste sich der Trieb nach Difl'erenzirung herausstellen. Je mehr die
A-Stämrne zunahmen, desto wichtiger wurde es an ihnen ein vollständigeres
System von Formen sowohl für die durative, wie für die momentane
Handlung zu entwickeln. An die Formen mit unverändertem
Wurzelvocal lipa-ti, lipâ-ti knüpfte sich jetzt, wo sie einem laipa-ti,
laipâ-ti gegenüberstanden, die Vorstellung der momentanen, an die mit
233gesteigertem die der dauernden Handlung. War doch die letztere Form eine
relativ schwerere, und musstesich die ursprüngliche Bedeutung des kurzen
a von lipa-ti, da wo es kein lip-ti gab, vollständig verwischen. Auch hier
kommen wir wieder auf die Wahrnehmung zurück, dass sich die Bedeutung
einer Form wesentlich aus ihrem Verhältniss zu andern bestimmt.
Im Indicativ Präsentis musste nun jene kürzere Form lipa-ti, da wo sie
sich neben laipa-ti fand, bald überflüssig werden. Denn bei der schlichten
Aussage von etwas gegenwärtigem hat der Ausdruck der momentanen
Handlung keine rechte Stätte. Wer etwas für die Gegenwart einfach
aussagt, gibt damit der Handlung von selbst eine gewisse Breite. So
verschwand lipa-ti, wo es daneben ein laipa-ti gab, allmählich aus dem
Gebrauche. Aber im Conjunctiv konnten sich lipâ-ti und laipâ-ti sehr
wohl neben einander halten. Die geforderte Handlung kann ebensowohl
eine momentane, wie eine dauernde sein, und es macht einen
Unterschied, wie sie gefasst wird. Im Imperativ, der inzwischen sich
auch ausgebildet haben muss, fand dasselbe Verhältniss statt: lipa-tât
neben laipa-tât. Noch wichtiger wurde diese Unterscheidung im Präteritum:
a-lip-at neben a laip-at. So erklärt es sich wohl, dass es neben
den Wurzelaoristen wie a-bhû-t = ἔ-φυ, a-stâ-t (skt. a-sthâ-t) = ἔ-στη
auch thematische von der Art der oben besprochenen gibt. Formen wie
skt. a-lipa-t, a-sada-t (er sass), a-vida-t (gr. ἔ-ϝιδε, εἶδε), sind ihrer ursprünglichen
Anlage nach eigentlich Imperfecta, die dazu gehörigen Modusformen
Präsensformen, die sich aber durch das Aufkommen noch stärkerer
Präsensformen und durch das Verschwinden solcher Indicative wie
lipâ-mi, sadâ-mi, vidâ-mi zu Aoristformen verschoben haben. Die griechische
Sprache hat beim Conjunctiv das ursprüngliche Verhältniss viel
reiner bewahrt als das Sanskrit und Zend, insofern sie dem Conjunctiv
durchweg die primären Personalendungen zutheilt. In den beiden andern
genannten Sprachen findet hier ein Schwanken statt, das den Schein
erzeugt, als ob es in Wirklichkeit einen Conjunctiv des Imperfects und
des Aorists gäbe. In Wahrheit gibt es nur einen Modus jeder Art von
der dauernden Handlung, den wir einen Modus des Präsens nennen, und
einen der momentanen, den wir einen Modus des Aorists nennen. Von
einem Wegfall des Augments in einem solchen Modus kann gar nicht die
Rede sein, da das Augment als Zeichen des Präteritums mit der Modusbildung
unverträglich ist.
Wir hatten uns vorgenommen zu untersuchen, ob es möglich sei
234den Conjunctivvocal bei seiner lautlichen Identität mit dem thematischen
Vocal auch begrifflich als diesem identisch zu fassen. Diese Möglichkeit
glaube ich erwiesen zu haben, und du es oberster Grundsatz der
Sprachwissenschaft ist, dasjenige was innerhalb einer Sprache lautlich
gleich ist und begrifflich gleich sein kann für identisch zu halten, so bin
ich allerdings der Meinung, dass beide Vocale ihrem Ursprünge nach
zusammenfallen. Da wir aber guten Grund zu der Annahme hatten, dass
jener A-Laut früher der Tempus- als der Modusbildung diente, so würde
sich daraus die nicht unwichtige Wahrnehmung ergeben, dass die Modusbildung
— bei der wir jetzt vom Imperativ absehen — aus der Tempusbildung
sich erst allmählich entwickelt hat.
5. Periode der zusammengesetzten Verbalformen.
Wir wiesen schon im Eingange auf die Doppelformen des Aorists
als auf eine der Thatsachen hin, welche am klarsten die schichtweise
Entstehung des Verbalsystems beweisen. Es ist längst allgemein anerkannt,
dass die jüngeren sigmatischen Aoriste auf einer Zusammensetzung
beruhen 1)13. Hier ist das chronologische Moment am greifbarsten. Die
Zusammensetzung besteht in der Verbindung eines bedeutungsvollen
Stammes mit einem Hülfsverbum. Hülfsverben können aber nie ursprünglich
diese Function gehabt haben. Das Hülfsverbum verhält sich
zum selbständigen Verbum ungefähr wie der Artikel zum Pronomen.
Der Artikel ist gleichsam ein erblasstes Pronomen, das Hülfsverbum ein
erblasstes Verbum von selbständiger Bedeutung. Wie lange Zeiträume
mögen vergangen sein, ehe es die Sprache zu einem Verbum substantivum
brachte, das heisst, ehe die ursprüngliche sinnliche Grundbedeutung
der W. as, wahrscheinlich (Grundz. 337) die des Athmens, sich so
ganz verflüchtigt hatte, dass der reine Begriff der Existenz hervorbrach !
Mit Nothwendigkeit ist anzunehmen, dass ein langer verbaler Gebrauch
der Wurzel vorherging. Und wieder ein langer Weg war von dieser
rein abstracten Bedeutung sein bis zu der Gewohnheit das Verbum sein
235als blosse Gopula zu verwenden. Die ältere Sprache wusste nichts von
dem Bedürfniss die Verbindung eines Subjects mit einem Prädicat durch
etwas andres als Nebeneinanderstellung auszudrücken. Das zeigen ja
Verbalformen wie ad-mi, auch noch solche wie bhara-ti, laipa-ti. Indem
sich nun aber zahlreiche Nominalformen, durch mannichfaltige Suffixe
charakterisirt, herausbildeten, an denen nach und nach auch der Unterschied
zwischen Substantiv und Adjectiv hervortreten musste, mochte
für die Satzbildung der Unterschied des Attributs vom Prädicat erwünscht
werden. Die Nebeneinanderstellung verblieb für den Ausdruck der attributiven
Verbindung, die prädicative ward durch Hinzufügung des Verbums
der Existenz ausgedrückt, das damit zur Copula ward. Ein derartiger
Gebrauch der W. as muss nun wieder schon lange vorhanden
gewesen sein, ehe die zusammengesetzten Verbal formen aufkamen. Denn
Zusammensetzung setzt immer ein längeres Beisammensein der verbundenen
Theile in durchaus geläufigem Gebrauch voraus, Welche Perspective
also eröffnet sich uns von jenen Aoristformen aus, die wie
a-dik-sa-t = ἔ-δεικ-σε eben jene Momente in sich zusammen fassen!
a-dik-sa-t verhält sich zu einer Form wie a-dâ-t ungefähr wie tum dicens
erat zu tum dicens. Mochte also schon in der vorigen Periode der Gebrauch
des Verbum substantivum und, wie wir sehen werden, eines andern
Hülfsverbums häufiger werden, so trat nun in dem Verwachsen
mannich faltiger Stämme mit diesen Hulfsverben ein ganz neues, fruchtbares
Bildungsmoment auf, wodurch sich das Verbalsystem nicht unwesentlich
vervollständigte. Hier können wir aber, und daran erkennen
wir die vorgeschrittenere Sprachperiode, schon mit viel grösserer Sicherheit
als in den früheren Zeiten die einzelnen Stufen unterscheiden und
chronologische Momente sowohl nach rückwärts wie nach vorwärts gewinnen.
Die zusammengesetzten Verbalformen lassen sich in zwei wesentlich
von einander verschiedene Classen sondern, nämlich erstens
diejenigen, welche ungeformte Nominalstämme mit Hulfsverben verbunden
enthalten, wie eben dieses aus dem wurzelhaften Nomen dik
entstandene a-dik-sa-t, und zweitens solche, in denen sich ein bereits
geformter, d. h. mit einer Endung versehener Nominalstamm wie kâma
(Liebe) zu einer Verbalform wie kâma-jâ-mi verbindet. Auf der ersten
Stufe bringt die Sprache nur einzelne Tempusstämme hervor, die zur
Ergänzung der einfachen dienen, auf der zweiten haftet die ZusammenSetzung
236fester, sie durchdringt zuletzt das ganze Verbum. Das eigentlich
denominative Verbum entsteht nur auf die zweite Weise.
A. Zusammengesetzte Tempusstämme aus ungeformten
Nominalstämmen.
Dass eine Form wie a-dik-sa-t einen Nominalstamm in sich enthält,
ist zwar an sich einleuchtend, denn ein Satz mit einem Verbum substantivum
muss ein Nomen enthalten, dennoch aber eine für die Geschichte
der Sprachentwicklung äusserst wichtige Thatsache. Denn diese Thatsache
beweist, dass es in dieser zwar relativ nicht mehr ganz alten,
dennoch aber der Sprachtrennung weit vorausgehenden Zeit Nominalstämme,
und zwar unflectirte, in dieser primitiven Form gab. Es dient
dies also zur Bestätigung dessen, was wir oben über die Alterthümlichkeit
solcher wurzelartigen Nominalstämme erörterten und zu weiterer
Widerlegung der Hypothesen derer, die solche Nominalstämme von primitivster
Art bereits der Verstümmelung verdächtigen. Denn dass auch
etwa in a-dik-sa-t die Sylbe dik bereits aus einer volleren Form entstellt
sei, wird niemand glaubhaft machen können.
Die Sylbe jâ (ja), welche das eigentümliche der 4ten Sanskritclasse
und der ungemein zahlreichen Bildungen gleicher Art in den verwandten
Sprachen ist, aus der W. ja gehen herzuleiten, wie es Bopp Vergl. Gr.
II 357 thut (vgl. ‚Temp. u. Modi‘ S. 88) empfiehlt sich durch die Einfachheit
der Erklärung, die sich auf diese Weise darbietet. Das Verbum
des Gehens, in verschiedenen Sprachen, namentlich auch im Lateinischen
zur Umschreibung verwendet (vénum ire, amatum iri) enthält in sich ein
duratives und dadurch für die Bildung von Präsensstämmen besonders
geeignetes Moment, da gehen eine dauernde Bewegung bezeichnet 1)14.
Da ausserdem der Begriff der Passivität sich leicht dabei einstellt, so empfiehlt
es sich, auch das ja des sanskritischen Passivs, wozu auch das Zend
Analogien bietet, auf dieselbe Quelle zurückzuführen, wie denn auch schon
lange darauf hingewiesen ist, dass viele Verben der entsprechenden 4ten
Sanskritclasse intransitive Bedeutung haben. Ist diese Erklärung richtig,
237und ich wüsste nicht, dass man etwas beigebracht hätte sie zu widerlegen,
so müssen wir auch hier voraussetzen, dass die Sprache, ehe sie
zur Zusammensetzung der W. ja mit vorhergehenden Stämmen schritt,
sich oft der Umschreibung durch W. ja bedient, z. B. kupja svid ja.
Man fasst dabei das erste Wort am natürlichsten als nomen actionis:
Wallung, Schwitzen, ohne dass jedoch auch andre Verbindungen ausgeschlossen
wären, z. B. für ἀγγέλλω d. i. ἀγγελ(ο)-ιω Bote gehen d. i.
als Bote gehn. Wie in jeder Composition etwas unbestimmtes und vieldeutiges
liegt, so auch in dieser. Aber gerade darauf beruht die Mannichfaltigkeit
der Anwendung und die Fähigkeit der angefügten Elemente
mit Aufgabe der ursprünglichen mehr sinnlichen Bedeutung in bloss formale
Sylben überzugehen. Nach und nach also ward der Unterschied
zwischen der angefügten Sylbe ja von andern, sei es rein lautlichen oder
thematischen Anfügungen ganz verwischt. Diese Sylbe wurde eben eine
jener Präsenserweiterungen, die alle dem gemeinsamen Zwecke dienen,
die dauernde Handlung zu bezeichnen.
Wie die durativen Formen durch die Zusammensetzung mit W. ja,
so wurden die aus der Wurzel selbst hervorgehenden, dem Ausdruck
des momentanen dienenden, wie allgemein anerkannt ist, durch die W.
as ergänzt. Auf den ersten Blick ist es befremdlich eine Wurzel von
dieser, wie es scheint, durativen Bedeutung solche Function übernehmen
zu sehn. Denn sein ist ja, so scheint es, recht eigentlich ein Bleiben,
ein Beharren bei etwas. Wir möchten danach die W. as eher in Präsensformen
erwarten, wie das lat. possum, als in Aoristformen. Dennoch aber
gibt es eine Auffassung des Seins, die etwas aoristisches hat, diejenige,
nach welcher das Sein dem Werden, das erreichte Resultat den verschiedenen
zu seiner Erreichung erforderlichen Momenten entgegengestellt
wird. Und diese Auffassung wird sich in Bezug auf die Vergangenheit
am leichtesten einstellen. So mochte hier zuerst eine Umschreibung
mit dem Präteritum von as sich einstellen, durch die dann
allmählich Formen wie a-dik-sa-m = ἔ-δειξα erwuchsen. Da der Unterschied
zwischen der aoristischen und durativen Handlung der Sprache
schon in der vorigen Periode aufgegangen war, so schoben sich diese
mit W. as componirten Formen in das System des Verbums ganz natürlich
als Parallelen der einfachen Aoristformen ein. Es liegt uns hier fern,
dies und die verschiedene Bildungsweise dieser zusammengesetzten
Aoriste weiter zu verfolgen. Nur auf ein chronologisches Moment mag
238hier hergewiesen werden. Eine der Aoristbildungen dieser Art und zwar
gerade diejenige, welche im Griechischen herrschend geworden ist, beruht
auf der Einfügung der Sylbe sa, die aus asa verkürzt ist. Das a am
Schlüsse dieser Sylbe wird niemand für etwas andres halten als das von
tuda, baudha und jenen andern zweisylbigen Stammen, deren Aufkommen
wir in die vorige Periode glaubten verlegen zu können. Es ergibt sich
daraus mit Sicherheit die Existenz eines Präsens asâ-mi neben as-mi,
eines Präteritums âsa-t neben âs-t, zu einer Zeit, die der Bildung der
zusammengesetzten Form vorausging, es bestätigt sich uns also die Priorität
der thematischen Formen vor den zusammengesetzten.
Würde auf diese Weise das Tempussystem wesentlich ergänzt
und vermannichfaltigt, so geschah nun auch etwas ähnliches in Bezug
auf die erst in der vorigen Periode unterschiedenen Modi. Vergleichen
wir die Formen des Optativs oder, wie er im Sanskrit heisst, Potentialis
der indogermanischen Grundsprache, wie sie Schleicher Comp. 2 707,
712 aus den einzelnen Sprachen für die W. as erschliesst, mit denen des
Conjunctivs, z. B.
3 S. Conj. as-a-t(i) Opt. as-jâ-t
3 Pl. as-a-nt(i) as-ja-n(t)
so findet hier, abgesehen von den Endungen, die überdies im sanskritischen
Conjunctiv unstät und nur im Optativ consequent die secundären
sind, und abgesehen von der Quantität des a, dasselbe Verhältniss statt
wie zwischen einem Ind. Präs. der thematischen Form (Cl. 1 im Skt.)
und einem mit -ja zusammengesetzten (Cl. 4),
as-a-nt(i): as-ja-n(t) = bhara-nti: svid-janti.
Ist aber das ja der betreffenden Conjugationsclasse mit Recht auf die
W. ja gehen zurückgeführt, so liegt es nahe das optativische ja aus derselben
Quelle herzuleiten. Dass der Optativ nichts andres ist als ein
durch ja erweiterter Präsensstamm erweist sich auch aus einer andern
Zusammenstellung als wahrscheinlich. Schon Bopp entging nicht die
ausserordentliche Aehnlichkeit zwischen der Endung des zusammengesetzten
Futurums (a)sjâ-mi, sja-si, sja-ti und dem Optativ des Verbum
substantivum (a)sjâ-m, sjâ-s, sjâ-t (II 541). Dies sjâ-mi aus sjâm abzuleiten,
ist wohl unmöglich. Es wäre dies wohl der einzige Fall, in welchem
die Sprache was schon verloren war, wieder hergestellt hätte
Vielmehr tritt (a)sjâmi offenbar, wie Benfey Kurze Sktgr. S. 186 und
Schleicher Comp. 818 erkannt haben, in die Analogie der mit ja
239gebildeten Präsensstämme, as-jâ-mi hiess also nach unsrer Analyse, die
hier mit der Benfey's zusammentrifft, ich gehe sein. Dies as-jâ-mi, welches
in der Endung des Futurums z. B. dâ-sjâ-mi = dor. δω-σίω erhalten
ist, halte ich nun für identisch mit dem im getrennten Gebrauche
erhaltenen Optativ (a)s-jâ-m = ε-ἴη-ν. Es haben sich nur die primären
Endungen in die secundären verwandelt. Diese Auffassung bestätigt
sich auch durch das Lateinische. Die Identität des lat. ero für esjo mit
jenem (a)sjâmi ist längst erkannt und erwiesen, während dem Optativ
(a)sjâm in getrenntem Gebräuche lat. siem entspricht. Aber in der Zusammensetzung
mit dem Perfectstamme ist zwischen rĭmus (dede-rĭmus)
als 1 Pl. zu ero und rĭmus als 1 Pl. = sîmus, jenes im Fut. ex., dies im
Perf. Conj., gar kein Unterschied. Beide sind eben aus dem nämlichen
esîmus (aus es-iê-mus) = skt. s-jâ-ma gr. ε-ἴη-μεν, εἶ-μεν geflossen.
Schleicher erörtert den Ursprung der Sylbe ja nicht weiter, obwohl er
beim Optativ S. 712 auf den Pronominalstamm ja hinweist. Es möchte
aber in der That schwer zu zeigen sein, wie der Begriff des Optativs
oder Potentialis durch ein zwischen Stamm und Endung eingeschobenes
hinweisendes Pronomen entspringen konnte. Es ist dies einer der Fälle
wo die Analyse der Formen ohne Rücksicht auf ihre Function nicht zum
Abschluss kommen kann. Bopp denkt II 560 bei dem Moduselement
des Optativs und des Futurums an die W. î wünschen, die allerdings zur
Bedeutung vortrefflich passt. Aber dies î steht nur in den Wurzelverzeichnissen
und wird ohne Zweifel mit Recht von Westergaard und im
Petersb. Wörterb. mit der W. i gehen identificirt, die selbst in mancherlei
Anwendungen nach etwas gehen, streben bedeutet und mehrere secundäre
Wurzeln aus sich hervorgehn lässt, die wie ish (iḱh) jat ausschliesslich
in diesem mehr geistigen Sinne verwendet werden. Zwischen i und
ja ist aber der Zusammenhang unverkennbar. Mithin läuft Bopp's Erklärung
wesentlich auf dasselbe hinaus mit dem was wir hier vermutheten.
Freilich besteht nun immer noch ein doppelter Unterschied zwischen
zusammengesetzten Indicativen des Präsens wie svid-jâ-mi, svid-ja-si,
svid-ja-ti und Optativen wie bhû-jâ-m, bhû-jâ-s, bhû-jâ-t. Der Optativ
hat auch ausserhalb der ersten Personen mit Ausnahme der 3 Pl.
langes â, der Indicativ kurzes. Allein dieser Unterschied reicht schwerlich
aus eine Trennung dieser Formen zu begründen, zumal da bei den
Präsensstämmen auf a in der 1 S. im Sanskrit statt des langen kurzes a
erscheint: tudê-ja-m und in andern Formen das a sogar völlig verschwindet.
240Allerdings müssen wir für das a nach dem S. 206 bemerkten wie für
alle auslautenden Vocale der Wurzeln die Kürze als das ursprüngliche
annehmen. Aber auch in wurzelhaften Aoristen wie a-sthâ-m, a-sthâ-s,
2 Pl. a-shtâ-ta = ἔ-στη-ν, ἐ-στη-ς, ἔ-στη-τε zeigt sich die Länge, die in
solchen Bildungen, wie ἔ-θε-τε neben skt. a-dhâ-ta und ἔ-γνω-τε zeigt,
nicht eben stetig ist. Was aber die secundären Personalendungen des
Optativs gegenüber den primären des Indicativs betrifft, so fragt es sich,
ob dieser Unterschied von Anfang an ein fester gewesen ist. Die Endung
-μι in griechischen Formen wie φέρο-ι-μι, pflegt man als missbräuchlich
zu bezeichnen gegenüber skt. bharê-ja-m und dem sporadisch
erhaltenen φέροιν. Aber diese Auffassung hat ihre Schwierigkeiten.
Derartige Afterbildungen sind nur glaublich, wenn sie sich aus einer weit
verbreiteten Analogie erklären lassen. Dies Mittel aber lässt uns hier
völlig im Stich. In allen andern Formen des Optativs sind die Endungen
bei den Griechen die secundären, durch Activ und Medium wird die
Analogie zwischen dem Optativ und dem Präteritum von den Griechen
mit strenger Consequenz durchgeführt und die Verwendung dieses Modus
namentlich in zusammengesetzten Sätzen stimmt ganz dazu. Indicativformen
auf μι, die eine besondere Aehnlichkeit hätten, existiren gar
nicht, ebenso wenig haben diese Modusformen der Conjugation auf ω
irgend eine besondre Gemeinschaft mit den Verben auf μι. Diese eine
Ausweichung erscheint nur auf eine Weise begreiflich, wenn sie nämlich
von unvordenklichen Zeiten sich erhielt. Denn was von der herrschenden
Regel vollständig abweicht hat überall eher das Präjudiz für sich eine
ältere Regel zu bewahren. Gleichmachung, nicht Ungleichmachung ist
es was in der Sprachgeschichte mehr und mehr zur Geltung gelangt.
Ich glaube daher, dass sich in diesem μι von φέροιμι ein Ueberrest aus
jener Zeit erhielt, da auch dem Optativ die primären Personalendungen
noch nicht zu schwer waren, da also die Uebereinstimmung zwischen
dem Optativ und dem lndicativ der mit ja zusammengesetzten Präsensform
eine vollständigere war. Von φέρο-ι-μι würde also auf ein bhara-jâ-mi
zurückzuschliessen sein. Hat sich doch auch sonst in vereinzelten griechischen
Verbalformen bisweilen das allerursprünglichste erhalten, z. B.
in der 2 S. ἔσ-σι, in den homerischen dritten Personen des Conjunctivs
auf -η-σι, in dem dorischen Futurum.
Sind diese unsre Schlüsse richtig, so liegt kein Grund zu der von
Benfey (Allg. Monatsschr. 1854 S. 749) aufgestellten Behauptung vor,
241der Optativ sei mit dem Präteritum der W. ja zusammengesetzt.
Denn das alleinige Zeichen des Präteritums, das Augment, ist dem Optativ
völlig fremd und auch begrifflich wäre die Anwendung des Präteritums
schwer zu verstehn, während die Abstumpfung der primären Endungen
zu den secundären ein häufiger, in keiner Beziehung verwunderlicher
Vorgang ist. Diese alten Zusammensetzungen waren vieldeutig.
Aus dem Begriffe des Gehens ergab sich einerseits der des Umgehens
mit etwas, andrerseits der des Gerathens in etwas, endlich der des
Strebens nach etwas. Die erste Bedeutung fixirte sich in den durativen
Präsensformen, die zweite in den Passivformen, die wir oben (S. 237)
erwähnten, die dritte im Optativ. Man denke nur an die doppelte Anwendung
unsers Hülfsverbums werden im Passiv und Futurum. Der
Optativ mochte sich anfangs mehr vereinzelt als Ersatzmann des Conjunctivs
in derselben Weise einfinden, wie die Präsensstämme auf ja
neben den wurzelhaften und thematischen. Bald aber löste sich diese
Bildung ab, sie ward ähnlich wie die specifisch sanskritische Verwendung
der Sylbe ja im Passiv zum allgemeinen Bedürfniss. Man bildete
nun auch von wurzelhaften und thematischen Formen nicht bloss den
Conjunctiv, sondern auch den Optativ, eine Form wie bhara-jâm(i), ja
selbst svid-ja-jâ-m(i) stellte sich ein, aus dem reduplicirten Stamme, aus
den einfachen wie aus den zusammengesetzten Aoriststämmen entsprangen
Optative und so wurde die Aehnlichkeit mit der Mutterform
völlig verwischt. Sicherlich geschah dies dadurch, dass sich früh eine
kleine Bedeutungsdifferenz zwischen diesem zusammengesetzten und
dem einfachen Modus herausstellte. Durch die allmählich sich einstellende
Gewohnheit dem jüngeren Modus die secundären Personalendungen zukommen
zu lassen, musste die Scheidung eine noch vollständigere werden.
In wie weit dies mit dem Gebrauche des Optativs im Zusammenhang
stand, mag hier unerörtert bleiben.
Wir glaubten vorhin den Optativ aus dem Futurum deutlicher machen
zu können. Jetzt werden wir umgekehrt von unsrer Auffassung
des Optativs aus die Futurbildung beleuchten können. Bopp betonte bei
seiner Erörterung des Futurums auf -sjâmi, wie wir sahen, gar sehr den
Zusammenhang mit dem Optativ, und dieser Zusammenhang ist namentlich
für das lateinische Futurum von Bedeutung, insofern Formen wie
ferês, ferêt ja in der That Optative sind, die Futurbedeutung erlangt
haben. Ich hielt es daher in den ‚Tempora und Modi‘ S. 317 für möglich,
242ein Optativ mit secundären Endungen sei die Quelle der Futurbildung
mit primären gewesen. In dem Streben ‚das Tempus der Zukunft von
dem Modus der Möglichkeit‘ zu unterscheiden, hätten sich in dem erstem
die primären Endungen wieder eingestellt. Aber solche ‚Rückbildung‘,
wie man es wohl genannt hat, ist mir längst nicht mehr glaublich. Schon
in den ‚Erläuterungen zu meiner Schulgr.‘ S. 99 trat ich vielmehr Schleicher's
Ansicht bei, wonach das zusammengesetzte Futurum aus dem
Verbalstamme und dem Futurum der W. as besteht, letzteres aber selbst
nichts andres ist als eine Präsensbildung von besonders significanter
Anwendung. Insofern uns nun klar geworden ist, dass auch der Optativ
selbst eigentlich ein zusammengesetzter Indicativ Präsentis ist, vereinigen
sich beide Ansichten. Ein Futurum wie dâ-sjâ-mi ist zusammengesetzt
aus der W. da und der Präsensbildung von as as-jâ-mi, die selbst ihrerseits
ebenso gut die Fähigkeit als Futurum wie als Optativ verwendet
zu werden in sich trägt und in Wahrheit sowohl für lat. ero = es-io,
wie für skt. sjâ-m gr. ἐ(σ)-ιη-ν lat. (e)s-ie-m die Quelle geworden ist.
Das Futurum zeichnet sich vor den meisten Formen des Optativs durch
die volleren Endungen aus. Wir dürfen daraus wohl den chronologischen
Schluss ziehen, dass das zusammengesetzte Futurum sich zu einer
Zeil gebildet hat, da jenes as-jâ-mi seine Personalendungen noch in ungeschwächtem
Zustand bewahrte.
Der Trieb nach zusammengesetzter Tempusbildung muss längere
Zeit lebendig geblieben sein. Im Sanskrit bietet der Conditionalis und
Precativ Beispiele davon, im Griechischen die Passivaoriste, im Lateinischen
die zusammengesetzten Imperfecta, Perfecta und was dazu gehört,
im Deutschen das s. g. schwache Präteritum. Ob alle diese jüngeren
Gebilde wirklich erst nach der Sprachtrennung aufgekommen sind, dürfte
zweifelhaft sein. Es wäre sehr wohl denkbar, dass die Ansätze zu allen
diesen Bildungen schon dieser frühen Zeit angehörten, während allerdings
das Ueberwuchern derselben und die bestimmtere Ausprägung
ihres Gebrauchs offenbar viel späteren Datums und, zum Theil wenigstens,
dem Bedürfniss nach Ersatz ungefügig gewordener einfacher Bildungen
entsprungen ist. Das Zusammenlreffen des deutschen schwachen
Präteritums mit griechischen Präteritis auf -θο-ν ist dafür besonders instructiv.243
B. Zusammensetzung mit geformten Nominalstämmen.
Ueber die abgeleiteten Verba gehen zwar die Ansichten der Forscher
noch in manchen Punkten auseinander und es kann hier nicht
unsre Aufgabe sein uns in Einzelfragen einzulassen. Aber in Bezug auf
die zahlreichste Classe derselben, diejenigen welche im Skt. in der 1 S.
Präs. auf -a-jâ-mi ausgehen, scheint mir doch in dem Zusammenhange,
den wir hier erwägen, über den Ursprung kaum ein Zweifel übrig bleiben
zu können. Vergleichen wir ein Verbum wie kâma-jâ-mi oder bhâra-jâ-mi
= φορε-jω-μι mit svid-jâ-mi, so haben wir genau denselben Unterschied,
wie er zwischen dem thematischen bharâ-mi und dem primären as-mi
stattfindet. Dieser Unterschied erklärte sich uns in der Weise, dass bhara
ein Nominalstamm sei, der hier als Verbalstamm eintrete. Dieselbe Erklärung
stellen wir hier auf. Der erste Bestandtheil von svid-jâ-mi ist
ein der Wurzel gleichlautender Nominalstamm primitivster Art. Daraus
begreift es sich, dass diese Art von Präsensbildungen auch aus wirklich
üblichen Nominalstämmen hervorgehen kann, z. B. κηρύσσω d. i. κηρυκ-jω-μι.
Dagegen der erste Bestandtheil von bhâra-jâ-mi ist der durch a
gebildete Nominalstamm bhâra= gr. φορο. Dass ein solcher Nominalstamm
nicht bei allen Verben wirklich in getrenntem Gebrauche vorliegt,
ist kein Einwand. Da ein sehr grosser Theil der primitiven Nomina ein
auf A-Laut schliessendes Suffix hatte — man denke nur ausser an a und
â an die Suffixe nă, tă, mă, tră, ană — so setzte sich das a, wie ich mit
Schleicher Comp. 2 353 und Grassmann Ztschr. XI, 94 annahm, gleichsam
als allgemeiner Nominalauslaut fest und diese Art der Denomination
überwucherte alle andern. In Betreff der Sylbe ja aber werden wir,
denke ich, dasselbe Verfahren einschlagen dürfen, wie bei der Erörterung
der thematischen Formen und ihres Verhältnisses zum Conjunctiv. Wenn
das was lautlich gleich ist auch der Bedeutung nach zusammengebracht
werden kann, so haben wir alle Ursache es für identisch zu halten. An
diese Denominative knüpft sich zwar durchaus nicht ausschliesslich, aber
doch, namentlich im Sanskrit, besonders oft die causative Bedeutung,
eine Bedeutung, die freilich von der des Gehens weit abzuliegen scheint.
Allein schon an einem andern Orte (Erläuter. 120, 137) habe ich darauf
hingewiesen, wie manche Verba von unzweifelhaft intransitivem Gebrauche
aus gleichsam gelegentlich und ganz unerwartet in die causative
ausbiegen, so namentlich die durchaus vergleichbare W. βα in der inchoativen
244Präsensform βάσκω, ἐπιβάσκω, W. στα nicht bloss im reduplicirten
ἵστη-μι, sondern auch in στήσω, ἔστησα. Ausserdem fragt es sich
noch, ob diese Bedeutung wirklich in jedem Falle durch die Sylbe ja
bewirkt wird. Ein unmittelbar aus der Wurzel hervorgehendes Nomen
hat ebenso oft active wie passive oder neutrale Bedeutung. So geht aus
der skt. W. naç (für nak) verschwinden das Substantiv nâça hervor, das
nicht bloss das Hinschwinden, den Tod, sondern auch die Vernichtung
bedeutet. Die transitive oder causative Bedeutung also stellt sich hier
schon in dem primitiven Nomen ein, und wenn nun das daraus abgeleitete
Causativum nâça-jâ-mi vorzugsweise vernichten, verderben bedeutet, so
bleibt da für die Sylbe ja eigentlich nur die Function übrig hier so gut wie
in den Verben der 4ten Classe das Umgehen mit etwas zu bezeichnen.
Vielleicht hiess eben nâça-ja-ti ursprünglich auch nur ergeht Vernichtung,
geht mit Vernichtung um. Da diesem nâca-ja-ti das lateinische noc-e-t
gleich kommt, so sieht man auch daraus, dass nicht von Anfang an die
ausschliesslich causative Bedeutung an jener Form haftete. Es wäre
überhaupt verkehrt eine solche begriffliche Kategorie wie die des Causativs
schon für so frühe Perioden des Sprachlebens vorauszusetzen.
Solche Kategorien gehen ja durchweg erst allmählich aus viel unbestimmteren
und vieldeutigeren Gebrauchsweisen hervor. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass der streng causative Gebrauch erst in einer Periode
sich festgesetzt haben wird, da es Casusformen gab. Denn die
causative Bedeutung beruht doch wesentlich auf der geläufigen Verbindung
eines Verbums mit dem Accusativ des äusseren Objects. Erst als
dieser Begriff der Sprache aufging war überhaupt eine scharfe Scheidung
zwischen Transitivum und Intransitivum, folglich auch zwischen Causativum
und Immediativum möglich. Dass aber die Casusperiode derjenigen
Periode des Sprachlebens, um die es sich hier handelt, nachfolgte,
wird, sollte ich meinen, kaum bezweifelt werden können.
Für die Identität der Sylbe ja, welche als Charakter der skt. 10ten
Classe an den ausgeprägten Nominalstamm und derjenigen, die als
Zeichen der skt. 4ten Classe unmittelbar an die Wurzel antritt, spricht
noch ein andrer Umstand. Der ursprünglichen Anlage nach gehört offenbar
auch dies ja der 10ten Classe nur dem Präsensstamme an. Das
Sanskrit hat nur von den Causativen alte reduplicirte Aoriste erhalten,
z. B. a-ḱi-kar-a-t er Hess machen zum Präsens kâra-ja-ti, das Perfect
wird durchweg umschreibend gebildet, auch sonst fehlt es nicht an
245so genannten Ausstossungen der Sylben aja. Man sieht daraus, denke
ich, dass die ältere Weise die war alle Formen mit Ausnahme der durativen
auf andre Weise zu bilden Auch in griechischen Verben wie
γοάω Ao. ἐγοον, μηκάομαι Perf. μέμηκα, in lateinischen wie sonare neben
son-ui sind uns deutliche Spuren dieser Flexionsweise aufbewahrt. Solche
Verba haben die vollständigste Aehnlichkeil mit indischen Verben
wie kam, lieben, das das Perfect ḱa-kam-ê, das Futurum und den Aorist
direct aus der Wurzel, das Präsens kâma-jâ-mi aber durch Vermittlung
des Nominalstamms kâma bildete. Dass später zu einer Zeit, da sich (Jas
Gefühl für den Ursprung der Sylbe ja verwischt hatte und vollends noch
später, da wie im Griechischen und Lateinischen, durch Lautverlust und
Contraction die Form dieser Verba wesentlich umgewandelt war, der
Präsensstamm durchaus als Verbalstamm behandelt ward, dass also an
einen schon mit ja zusammengesetzten Stamm auf's neue ein as, ja im
Futurum (ḱhôra-j-ishjâ-mi) sogar as und ja antrat, ist wenig verwunderlich
und bestätigt sich durch zahlreiche Analogien. Bei denjenigen denominativen
Verben, deren Stamm stärkere derivative Elemente an sich
trug, wie z. B. τι-μα die Sylbe -μα, war ohnehin ein Zurückgehen auf
die Wurzel schwierig. Durch die Mannichfaltigkeil der Nominalsuffixe
stellten sich überdies in den abgeleiteten Verben eine Menge specieller
Bedeutungsmodificationen ein, welche die Kluft zwischen der Wurzel
und dem abgeleiteten Verbalstamme immer grösser werden lassen musste.
Gerade aber dem Bestreben die vielfachen neuen Vorstellungen und Begriffe,
welche durch die Nominalbildung erwachsen waren, in Verbalformen
gleichsam wieder flüssig zu machen verdanken die abgeleiteten
Verba ihren Ursprung. Lagen die Keime dazu schon in dieser Periode,
so mochten sie zum grossen Theile erst in den nachfolgenden Perioden
aufgehen.
In chronologischer Beziehung ist am Schlüsse dieses Abschnitts
namentlich eins von entscheidender Wichtigkeit. Auch die zweite Schicht
der zusammengesetzten Verba muss entstanden sein, ehe es Casusformen
gab. Sobald das Bewusstsein des Casus auch nur in den allerersten
Anfangen vorhanden war, gehörte eine Verbindung wie nâka jâ-mi,
kâma jâ-mi zu den Unmöglichkeiten. Das Verhältniss, in welchem der
Begriff des Nomens zu dem des Verbums stand, forderte von da an seinen
Ausdruck. Wenn der Begriff des Nomens Inhalt oder Ziel des Verbums
war, musste dies an der Nominalform bezeichnet werden. Denn im
246Unterschied von der überall mehr facultativen Verwendung der wortbildenden
Suffixe (declinatio voluntaria) macht sich wie im Verbum die
Personalendung, so im Nomen die Casusendung mit Nothwendigkeit geltend.
Es musste also, standen damals nâka und jâmi, kâma und jâmi
noch ungetrennt neben einander, in dem hier geforderten Sinne nâkam
jâmi, kâmam jâmi heissen, ebenso gut wie das Sanskrit seine umschreibenden
Perfecte der s. g. 10ten Classe durch Verbindung des Hülfsverbums
mit dem Accusativ ausdrückt: ḱhôrajâm ḱakâra, babhüva oder
âsa, und wie das Lateinische sein umschreibendes ire, iri mit der Accusativform
datum verbindet. Nun würden allerdings diejenigen Gelehrten,
die überall geneigt sind in den überlieferten Formen ein so grosses Mass
von Laut Verstümmelung oder Entstellung zu vermuthen, als irgendwie
denkbar ist, wahrscheinlich keine Schwierigkeit in der Annahme finden,
dass auch hier das m des Accusativs verloren sei. Allein Analogien dafür
dürften doch keineswegs so leicht gefunden werden. Wir bedürfen
auch in der That keiner solchen, indem wir die Entstehung dieser Formen
einer Zeit beimessen, der jenes m unbekannt war. Sobald aber
einmal die beiden Bestandtheile zu einem untrennbaren ganzen zusammengewachsen
waren, gingen sie in dieser Vereinigung in die folgende
Periode über und gaben nun den Typus zu zahlreichen andern Verbindungen
der Art ab. Denn das ist ja überall das Wesen sprachlicher
Entwicklung, dass der Gewinn jeder älteren Periode die Grundlage abgibt,
auf der die folgende weiter baut, ohne dass sie im Stande wäre
diese Grundlage selbst zu schaffen oder wesentlich umzugestalten.
Noch deutlicher lässt sich zeigen, dass die Zusammensetzungen mit
ungeformten Nominalstämmen die Casusbildung ausschliesst. Ein Aorist
wie a-dik-sa-t, d. i. damals zeigend war er, kann nur zu einer Zeit entstanden
sein da zwischen dem Singular und dem Plural nicht unterschieden
ward. Sobald man sich an die Bezeichnung des Plurals im
Nomen gewöhnt hatte, hätte die Verbindung des pluralischen (a)san-t mit
dem Stamme auch in letzterem ein Pluralsuffix gefordert also etwa
a-dik-as-sant damals zeigende waren sie. So geben uns diese Formen,
nach ihrer Entstehungszeit befragt, die deutlichste, wie ich glaube, in
keiner Weise misszuverstehende Antwort. Insofern sind sie für die gesammte
Chronologie der Sprachgeschichte von entscheidender Bedeutung.
Denn da die relative Jugend dieser Verbalformen sowohl im Vergleich
mit den thematischen, wie mit den primären von niemand bezweifelt
247werden kann, so ist damit der Gang der Sprachentwicklung im
grossen und ganzen und die wichtige Thatsache, dass die Casusbildung
als solche eine der Entstehung selbst der jüngsten
Verbalschicht, folglich der Ausprägung des gesammten
Verbalbaues nachfolgende Erscheinung ist, sollte ich meinen,
erwiesen.
Es könnte auf den ersten Blick auffallend erscheinen, dass die
Sprache zu einer Zeit, da sie nach mehr als öiner Richtung hin schon so
mannichfallig entwickelt war, noch eines nach unsern Vorstellungen so
unentbehrlichen Mittels wie die Casusformen, einschliessslich die Unterscheidung
zwischen Einheit und Mehrheit am Nomen entbehrt haben
sollte. Allein unvollkommener organisirte Sprachen zeigen uns ja, wie
vieles was vom Standpunkte späterer Durchbildung aus unentbehrlich
erscheint, dennoch entbehrt oder vielmehr durch andre, wenn auch viel
weniger deutliche Mittel ersetzt werden kann. Man denke nur an die
Wortstellung, an die Betonung, an die Verwendung von partikelartig
eingestreuten Pronominalstämmen, die wir bald als die Vorläufer der
Casusbildung kennen lernen werden. Dazu kam nun die schon ziemlich
reich entfaltete Bildung der Nominalstämme. Ausserdem aber stand der
Sprache noch ein andres und, wie ich glaube, wesentliches Mittel zu
Gebote, die Zusammensetzung. Wenn die noch unflectirten Nominalstämme
sich mit Pronominalstämmen zu mannichfaltigen charakteristischen
nominalen Neubildungen und mit einzelnen Verben zu zusammengesetzten
Verbalformen verbanden, wie sollten sie da die Verbindung
unter einander gemieden haben ? Bis in die spätesten Zeiten hinein hat
sich für die indogermanische Nominalcomposition das Gesetz gebildet, dass
nicht eine Casusform — eine solche erscheint nur ausnahmsweise —
sondern der Wortstamm gleichsam nackt in die Composition aufgenommen
wird. Composita wie skt. nara-sįha-s Mannlöwe, griech. λογο-γράφο-ς,
lat. locu-ple-s sind vom Standpunkte der späteren Sprache aus
eigentlich gar nicht zu begreifen, die Stämme nara λογο locu oder loco
sind für diese Zeit ein Anachronismus. Das Bewusstsein des Nominalstammes
ging ja nach Ausbildung der Nominalflexion völlig verloren,
darum finden wir z. B. bei den griechischen und lateinischen Grammatikern
auch nicht die leiseste Spur eines solchen Bewusstseins. Gewiss
sind auch die Inder dazu erst später wieder und zwar auf rein wissenschaftlichem
Wege gelangt, und ihr Scharfsinn würde gewiss nicht zum
248wenigsten durch die im Sanskrit besonders zahlreichen und mannichfaltigen
Composita unterstützt. Die griechischen Grammatiker scheinen
diese Bildungen so gut wie ganz verabsäumt zu haben, von ihrem Standpunkt
aus hätten sie im innern der Composita überall abgestumpfte Casusformen
vermuthen müssen. In der That liegt aber hier ein älterer
casusloser Sprachzustand gleichsam offen zu Tage. An einem Compositum
kann man den Begriff des Wortstammes einem jeden Schüler auch
ohne alle Hülfe verwandter Sprachen klar machen. Dass sich hier noch
Nominalstämme so vielfach ohne Casuszeichen erhielten, wird nur begreiflich,
wenn wir annehmen, es habe vor der Casusperiode zahlreiche
Composita gegeben, die dann die Muster für alle späteren Bildungen der
Art abgaben. Wie mannichfaltige Verbindungen der Wörter unter einander
auf diesem Wege in äusserster Prägnanz, und bei aller Vieldeutigkeit
doch im einzelnen Falle vollkommen verständlich vorgenommen
werden können, lehrt der flüchtigste Blick auf das was Inder, Griechen,
Deutsche, Slawen nach dieser Richtung hin uns erhalten haben. Wie
viele Casusendungen ersparen und ersetzen darum Wörter wie χρυςότοξος,
ῥοδοδάκτυλος, ἠεροφοῖτις, γλαυκῶπις! An dem zweiten und vierten
Compositum kann man auch sehen, wie die Bezeichnung des Numerus
entbehrt werden kann. Man muss sich nur solche Verbindungen
für diese frühe Periode viel weiter und darum loser denken 1)15, als für
die späteren, insofern sie eben damals die freie Satzfügung bis zu einem
gewissen Grade ersetzten. Später ward die letztere durchaus die Regel.
Wer statt eines Satzes ein Wort bildete, wich damit von dem damals
alltäglichen Gebrauche ab. So kam es, dass ein Compositum aus zwei
Nominalstämmen — in scharfem Unterschied von Partikeln — später
mehr den Eindruck einer Namengebung, eines Beiwortes machte
und darum bis auf verhältnissmässig wenige in den allgemeinen Gebrauch
aufgenommene Wörter wesentlich auf die Dichtersprache beschränkt
blieb. In unsre gegenwärtige Untersuchung gehörte diese Betrachtung
249nur insofern, als sie uns zeigte, wie eine über die äusserste
Dürftigkeit hinausgehende Rede auch ohne Casus möglich war.
6. Periode der Casusbildung.
Die Entstehung der Casus ist wohl das allerdunkelste im weiten
Bereich des indogermanischen Formensystems. Während in Bezug auf
die Verbalflexion eine Reihe von Analysen allgemein anerkannt ist, über
andre wenigstens mehrere eingehender erörterte Meinungen sich gegenüberstehen,
ist für manche Casusformen noch nicht einmal der Versuch
einer Erklärung gemacht, und nur die allgemeinsten Fragen haben bisher
eine Erörterung gefunden. Es kann auch durchaus nicht meine Absicht
sein hier in diese schwierigste aller Fragen mich tiefer einzulassen, zumal
da ich bei einer andern Gelegenheit vor einigen Jahren einige Hauptpunkte
zur Sprache gebracht habe (Verhandl. der Meissner Philologenvers.
[1863] S. 45 ff.). Hier, wo uns ja nur die Reihenfolge der Formen
angeht, werden, da wir schon im allgemeinen die Zeit, in welcher die
Casus aufgekommen, zu bestimmen suchten, wenige Bemerkungen genügen.
Zunächst sondern sich die Casus, wie ich eben in dem erwähnten
Vortrage zu zeigen gesucht habe, in zwei Schichten. Die eine Schicht
umfasst den Vocativ, Nominativ und Accusativ. Die engere Gemeinschaft
dieser Casus gibt sich schon dadurch zu erkennen, dass sie im Neutrum
durchaus zusammenfallen, ihre Verschiedenheit von den übrigen dadurch,
dass sie mit diesen nie in Austausch treten. Der Ablativ fällt im Sanskrit
vielfach mit dem Genitiv, der Locativ im sanskritischen Dual ebenfalls
mit dem Genitiv, in den classischen Sprachen aber mit dem Dativ zusammen,
der Instrumentalis wird im Griechischen durch den Dativ, im
Lateinischen durch den Ablativ ersetzt. Dativ und Ablativ decken sich
im Plural des Sanskrit und Lateinischen, Dativ und Genitiv fallen im
griechischen Dualis zusammen. Aber keine Spur von einem ähnlichen
Verhältniss des Accusativs zu den übrigen Casus obliqui. Wir dürfen
daraus vielleicht schliessen, dass der Accusativ im Gegensatz zum Nominativ
und Vocativ schon seinen geschlossenen Gebrauch hatte, ehe
die andern Casus aufkamen.
Gab es eine Periode der Sprache, in welcher nur die erste Casusschicht
vorhanden war, so sind auch zunächst für diese allein die Anknüpfungspunkte
an frühere Sprachschöpfungen zu suchen. Der Vocativ
250ragt hier aus der casuslosen Periode herüber, indem er den reinen
Stamm im Rufe unverändert lässt. Er gleicht in dieser Beziehung den
eben besprochenen unveränderten Stammformen in der Zusammensetzung.
πρέσβυ als Vocativ und als erster Bestandtheil von πρεσβυγενής sind ehrwürdige
Alterthümer der Sprache, die nur durch Zurückgehen in die
Organisationsperiode des gesammten Sprachstammes begriffen werden
können. Die Bildung aber des Nominativs und Accusativs lehnt sich
durchaus an die Themenbildung an. Wir besprachen oben S. 223 das
Streben der Sprache die Nomina durch stets neu hinzutretende Suffixe
zu charakterisiren. So glaubten wir Formen wie die auf -ana, ma-na,
ta-ra, an-ta auffassen zu müssen. Der überwuchernde Formentrieb Hess
nicht blos zwei, nein auch wohl drei und mehr solche pronominale Elemente
zusammen kommen. Es war also nur ein Fortwirken des älteren
Bildungstriebes, wenn sich aus einem Thema wie bhâra einerseits bhâra-ma
andrerseits bhâra-sa 1)16 entwickelte. Der entscheidende Schritt zur
Casusbildung geschah erst in dem Augenblick, da man sich gewöhnte
das zuletzt hinzutretende Suffix als ein bewegliches zu betrachten, demselben
Stamme bei unverändertem Umfange des Begriffes bald die eine,
bald die andre Endung, bald gar keine Endung hinzuzufügen. Das Suffix
wirkte auch jetzt immer noch attributiv oder artikelartig, es legte nur,
so zu sagen, einen Ictus mehr auf das betreffende Wort, der in der angegebenen
Hinsicht eben ein verschiedener war. So können wir bei
dieser ersten Gasusschicht deutlich sehen, dass die Casusbildung sich in
ähnlicher Weise aus der Themenbildung entwickelt, wie die Modusbildung
aus der Tempusbildung. Auch der Gebrauch der beiden Suffixe,
die wir der Kürze wegen das M- und das S-Suffix nennen können, hat
sich offenbar erst allmählich fixirt. In der Declination des Pronomens
z. B. im skt. aha-m, tva-m, i-da-m, a-ja-m kommt das m dem Nominativ
zu. Man möchte fast vermuthen, es habe eine Zeit gegeben, da man sogar
nur zwei Casus hatte 2)17, den durch kein bewegliches Suffix charakterisirten
251Vocativ und den Casus mit dem M-Suffix, dem dann erst später
der Casus mit dem S-Suffix, zu noch schärferer Hinweisung auf das zunächst
liegende nachgewachsen sei. Die Flexion der unpersönlichen
Pronomina zeigt ausserdem noch einen andern Ansatz, indem im Neutrum
t (oder d) sich einstellt, dessen Beziehung zum Pronominalstamm ta unverkennbar
ist. Wie sehr in diesen ersten Anfängen der Casusbildung
die Declination noch mit der Stammbildung zusammenhängt zeigt besonders
deutlich die Thatsache. dass der Wechsel zwischen dem M- und
S-Suffix nicht bloss die Stellung im Satze, sondern auch, so zu sagen,
die innere Beschaffenheit des Wortes angeht, indem die Verschiedenheit
zwischen Neutrum und Masculinum darauf beruht. Die letztere, mehr
wortbildende, Kraft dieser Zusätze mag allerdings, wie mir gegenüber
Steinthal in der erwähnten Philologenversammlung (Verhandl. S. 59)
geltend machte, die frühere, die eigentlich casuelle die spätere gewesen
sein. Denn wenn es mit Recht als das eigenthümliche wortbildender
Suffixe betrachtet wird ein Wort in Bezug auf sich selbst näher zu bestimmen,
als das der Casussuffixe dies in Bezug auf andre zu thun, so
zeigt sich eben in der Anwendung des m im Neutrum eine wortbildende
Verwendung, und insofern die Casusbildung erst eine Frucht der Wortbildung
ist, darf jene auf Priorität Anspruch machen. Nachdem sich die
Sprache gewöhnt hatte das Wort, wenn der Begriff desselben als ein lebendiger
hervortreten sollte, durch das S-Suffix, wenn das Gegentheil
der Fall war gar nicht oder durch das M-Suffix zu charakterisiren, war
von da zur Unterscheidung zwischen demSubject als dem hervortretenden
und dem Object im weitesten Sinne als dem zurücktretenden Satztheil
kein weiter Schritt. Den Formen des Singulars mochten die des
Plurals, in welchen fast ganz dieselben Elemente unter einander verbunden
erscheinen, wohl bald, die des Dualis erst später nachfolgen.
Dass sich die Sprache längere Zeit mit diesen bescheidnen Anfangen begnügte,
scheint mir auch aus dem weiten Gebrauche des Accusativs gefolgert
werden zu können. Irre ich nicht, so leuchtet in der grossen
Ausdehnung, die der Gebrauch dieses Casus namentlich im Griechischen
gefunden hat, noch etwas von jener sehr frühen Anwendung durch, nach
welcher er der allgemeine Casus obliquus war.
Dieser altern Schicht folgte dann, wie ich vermuthe, nach und nach
die zweite, sämmtliche andre Casus umfassende. Bei der Dunkelheit
vieler unter diesen Casusformen mag es genügen nur auf zwei Punkte
252hinzuweisen. Einigermassen erkennbar ist zunächst die Bildung des
Genitiv Singularis. Die vollste Endung des Gen. Sing., welche im Skt.
sja lautet ist schon von mehreren Seiten, namentlich neuerdings von
Max Müller Lectures I, 103 und von Kuhn Ztschr. XV, 424 mit einem
wortbildenden Suffix verglichen, das wir z. B. in griechischen Bildungen
wie δημόσιο-ς vor uns sehen, und das möglicherweise aus älterem, in
dieser Funclion im Sanskrit erhaltenen tja entstanden ist. Selbst vom
Standpunkte der ausgebildeten Sprache aus begreift man, dass οἶκος
πατρός und οἶκος πάτριος synonyme Ausdrucksweisen sind. Max Müller
bringt noch manche Analogien aus Sprachen niederen Grades zur Erhärtung
dieses Satzes bei. Wir können uns daraus klar machen, auf
welchem Wege die Sprache sich half, ehe die Form des Genitivs geschaffen
wurde. Es liegt nahe nun auch von der Genitivendung -as, die
bei den consonantischen, bei den I- und A-Stämmen die herrschende
ist, eine ähnliche Deutung zu versuchen, die ich allerdings nur als eine
hypothetische hinstellen will. Eine unmittelbar zu vergleichende Nominalableitung
steht uns hier freilich nicht zu Gebote. Aber wenn wir eine
Analyse dieser Form unternehmen, so wird es zunächst wahrscheinlich,
dass wie die Nominativform so auch diese Genitivform hinter dem s einen
Vocal eingebüsst hat. Wir dürfen wie vom Nom. svana-s (= sonu-s) zu
svana-sa, so vom Gen. vâk-as (skt. vâḱ-as, lat. vôc-is) zu vâk-asa aufsteigen.
Dass die Endsylbe dieser Form denselben Pronominalstamm sa
enthält, aus dem das Nominativzeichen hervorging, vermuthet schon
Bopp Vergl. Gr. 2 I 393, ohne sich über die Frage, wie es möglich sei,
dass Nominativ und Genitiv, so durchaus verschiedene Casus, durch
dasselbe Mittel bezeichnet würden, näher auszusprechen. Dies wird
sich nun, glaube ich, allerdings erklären lassen. Das Compositum vâk-a-sa,
so scheint es, verhält sich zu svana-sa wie ein s. g. Tatpurusha
oder Abhängigkeitscompositum zum Karmadhâraja oder determinativen
Compositum, vâka-sa wäre danach ὁ (τῆς) ὀπός, swana-sa ὁ φθόγγος,
vâk-a-sa svana-sa demnach gleichsam ὀπός ὁ | φθόγγο-ς oder in unflectirten
Wörtern ausgedrückt: Stimme der Laut der. Der artikelartig suffigirte
Pronominalstamm wäre im ersten Falle regierend oder constructiv,
im zweiten rein attributiv angefügt. Sehen wir doch in Wörtern,
die aus zwei Nominalstämmen bestehen — und wir glaubten ja S. 248
annehmen zu dürfen, dass die Nominalcomposition schon in der vorhergehenden
Periode aufgekommen sei — dieselbe Doppelheit, z. B. in
253μητροπάτωρ im Gegensatz zu αἰνοπατήρ. So würde sich nun das oben
S. 193 berührte Verhältniss von ποδός zu ὁδός begreifen. Obgleich
beide lautlich in gleichem Verhältniss zu der betreffenden Wurzel stehen,
ist dies Nominativ, weil das ς attributiv fungirt, jenes Genitiv, weil constructiv.
Dass zwischen beiden Bildungen, ehe sie neben einander bestanden,
Zeit verstrich, ist durchaus wahrscheinlich. Wie gleichzeitig
aus den gleichen Lauten so verschiedenes entstand, wäre unbegreiflich.
Dabei wollen wir freilich zwei Schwierigkeiten nicht verschweigen, die
bei diesem Deutungsversuche noch übrig bleiben. Die eine besteht in
dem a, das hier zwischen vâk und sa sich einfindet. Wir werden darin
wohl den Pronominalstamm a in ähnlicher Verwendung erkennen dürfen,
wie sie den Stämmen an, ja und andren — zu neuem Zeugniss
dessen, dass Casus- und Stammbildung von ähnlichen Trieben beherrscht
werden — bisweilen zu Theil wird. Wie der skt. Stamm bhâra im Gen.
Pl. bhârâ-n-âm erst ein an hinzunimmt, ehe er sich mit der Endung âm
verbindet, wie derselbe Stamm im Loc. Pl. bhâra-i-su (skt. bhârêshu) sich
durch ein i (= ja) erweitert, so scheint hier a an den Stamm getreten
zu sein. In dieser Beziehung kann auf Schleicher's Aufsatz ‚über Einschiebungen
vor den Casusendungen‘ Ztschr. IV, 54 verwiesen werden.
Schwieriger löst sich ein andres Bedenken. Ist das sa von vâk-a-sa seinem
Ursprung nach identisch mit dem von svana-sa, so scheint jene
Form so gut wie diese eigentlich nur in Begleitung eines Nom. Sing.
Masc. berechtigt, vâk-a-sa svana-sa (d. i. vocis sonus) wäre begreiflich,
vâk-a-sa svana-ma (d. i. vocis sonum) schon nicht. In Verbindung mit
einem Femininum, einem Neutrum, mit einem Plural wären ganz andre
Formen zu erwarten, etwa vâk-a-sâ, vâk-a-ta oder vâk-a-ma und dergleichen.
Eine in jeder Hinsicht befriedigende Erledigung dieses Einwandes
weiss ich nicht zu geben. Doch zeigt sich ein Ausweg, auf dem
ich zu meiner Freude mit Vermuthungen Kuhn's (Ztschr. XV, 426) zusammentreffe.
Kuhn vermuthet auch für den Genitiv der A-Stämme den
ursprünglichen Ausgang des Nominativs: ‚Es ist danach der Genitiv ursprünglich
ein Adjectiv, dem ursprünglich die Flexion des Nominativs
zugestanden haben muss, çivasja putras muss ursprünglich çivasjas
putras der zum Çiva gehörige Sohn, çivajâs patis der zur Çiva gehörige
Gatte bedeutet haben; auch das Neutrum bediente sich wohl zuerst der
Form des Masculini, doch könnte ihm auch das neutrale m zugestanden
haben. Sobald der Ursprung der Bildung sich aber verdunkelte,
254fiel das Nominativzeichen im Masculinum und Neutrum ab
und blieb nur im Femininum, wo das Sanskrit das s auch, zwar nicht
bei den Femininslämmen auf a, wohl aber mehrfach bei denen auf i und
û im Nom. Sing, bewahrt hat‘. Einige Doppelformen des Sanskrit und
Zend so wie das häufige Zusammenfallen von Genitiv- und Dativformen
im Sanskrit werden dann benutzt, um diese Vermuthung weiter zu bekräftigen.
Auf diese Einzelheiten, in Bezug worauf mir hier und da
namentlich lautgeschichtliche Zweifel bleiben, gehe ich hier nicht ein,
da sie unserer Aufgabe fern liegen. Aber das wesentliche dieser Auffassung
scheint mir ansprechend. Die ältesten Genitive hätten hiernach
die grösste Aehnlichkeit mit dem lateinischen cujus (für quo-jus). Diese
Form hat ja noch rein adjectivische Flexion: cujus puer, cuja filia, cujum
pecus. Man begreift es sehr wohl, wie dies mit der Zeit der Sprache zu
umständlich wird, und wie nach Verwischung des Ursprungs die eine
Form, hier also cujus, für alle drei Genera bleiben konnte. Freilich aber
doch nur unter einer Bedingung, die aber zu unsern Ergebnissen sehr
wohl stimmt, nämlich unter der, dass eine grössere Anzahl von Casus,
die durch die verschiedenen Numeri durchgeführt wurden, damals noch
nicht existirte. Denn wie sich jenes -asjas oder -asjâs auch an die Stelle
von -asjâns (Acc. Pl.), -asjasâm (Gen. Pl. nach Schleicher), -asja-sva
(Loc. Pl.) schieben konnte, wäre schwer begreiflich. Mit einem Worte, der
Genitiv Singularis scheint danach einer der ältesten, vielleicht der dem
Nominativ und Accusativ zunächst nachfolgende Casus zu sein. Natürlich
müssten wir nun auch die Formen auf -as auf dieselbe Weise erklären.
Und vielleicht bietet sich uns auch hier eine Bestätigung durch
eine wirklich erhaltene Form. War -a-sa ursprünglich eine Masculin
form, so könnte man als Neutrum dazu nach der pronominalen Declination
-a-ta erwarten, wie -a-sa sich später zu -a-s, so müsste sich -a-ta
zu -a-t verkürzen, -a-t ist aber die Endung des Ablativs. Wie wenn
sich der Genitiv vâk-a-s zum Ablativ vâk-a-t (Schleicher Comp. 551)
verhielte wie etwa ja-s welcher zum Neutrum ja-t, wie lateinisch aliu-s
zu aliu-d? Dass das t des Ablativs auf den Pronominalstamm ta zurückginge,
hat man ohnehin längst vermuthet, ohne diesen Ursprung zu erklären.
Der Ablativ fallt bekanntlich im Sanskrit vielfach mit dem Genitiv
zusammen. Auch syntaktisch Hesse sich der Ablativ sehr wohl aus
einer Adjectivform erklären. Himmlische Hülfe und Hülfe vom Himmel,
östlicher Wind und Wind aus Osten sind synonym. Bestimmt bezeichnet
255wäre dann das woher im Ablativ ebenso wenig als etwa in Gompositis
wie Ostwind, δρυπετής. Zwischen den beiden ursprünglich generell verschiedenen
Formen hätte die Sprache zu einer Zeit, da dieser Unterschied
überflüssig und dunkel wurde, einen innerlichen Unterschied zu
machen angefangen. Aehnliche Verschiebungen glaubten wir ja vorhin
bei der Besprechung des Conjunctivs und neue syntaktische Unterschiede
bei der des Optativs wahrzunehmen.
Sollten sich die hier gegebenen Aufstellungen bestätigen, so würde
damit für den gesammten Genitiv, wenigstens des Singulars, der Ursprung
aus einem Adjectiv und somit, wie schon von andrer Seite 1)18
bemerkt ist, der adnominale Gebrauch dieser Casus als der ursprüngliche
im entschiedensten Gegensatz zu einem localen Richtungsverhältniss
auch in syntaktischer Beziehung als Grundlage gewonnen sein. Der
Genitiv verhielte sich dann seiner Entstehung nach zum Nominativ und
Accusativ ganz so wie die eigentliche Ableitung oder secundäre Wortbildung
zur primären 2)19. Denn auch in dieser sind doch jene pronominalen
Elemente, die an den Stamm antreten, die regierenden, während
der Begriff des Stammes in syntaktischer Abhängigkeit erscheint, div-ja-s
bhâ-ma-s hiess doch eigentlich Himmel das Licht das, οὐρανοῦ τὸ φῶς,
d. i. Licht das des Himmels, νόστι-μο-ν ἦμαρ Tag, der der Rückkehr,
πολί-τη-ς ὁ τῆς πόλεως. Auf der Vieldeutigkeit des zwischen dem primären
Stamme und dem ihm angefügten Pronomen möglichen Verhältnisses
beruht die mannichfaltige Anwendung solcher ableitenden Endungen.
Wesentlich dieselbe Ansicht über diese Ableitungen findet sich
schon bei Ad. Regnier Traité de la formation des mots p. 97 ausgesprochen.
In Bezug auf die weitere Casusbildung mag hier nur noch eins hervorgehoben
werden. Eine besondre Gruppe bilden diejenigen Casus, in
denen die Sylbe -bhi verwendet wird. Die ganze Gruppe ist von Bopp
Vergl. Gr. I 2 420 ff. im Zusammenhang behandelt, ohne dass von ihm
oder meines Wissens sonst von jemand eine befriedigende Erklärung
256dieser Bildungen gegeben wäre. Die an ältere Aufstellungen sich anschliessende
Vermulhung Grassmann's, Ztschr. XII, 258, dass die Quelle
aller dieser Formen in der Präposition abhi zu, gegen, um = gr. ἀμφί
zu suchen sei, kann ich nicht dafür halten. Denn abgesehn von andern
Bedenken, wäre gar nicht abzusehn, was hinter einer solchen Präposition
jene mannichfaltigen Zusätze sollten, durch die sich bhj-am, bhj-âm,
bhi-s, bhj-as von einander unterscheiden. Insofern derartige unterscheidende,
oder, wie Grassmann sagt, deutende Elemente hier namentlich
auch zur Unterscheidung der Numeri dienen — worüber Schleicher
viele scharfsinnige Analysen bietet — würde man diese deutenden Zusätze,
falls bhi eine aus abhi verstümmelte Prä- oder richtiger Postposition
wäre, unbedingt vor, nicht hinter dieser erwarten. Gesetzt die
Sylbe -bhi wäre eine Präposition, die nach Art der lateinischen -cum
hinten angefügt wurde, so wäre vâg-bhj-as eine Bildung wie etwa lateinisch
vo-cum-bis statt vo-bis-cum. Insofern nun aber dasjenige was hier
an die Sylbe bhi antritt mit den Casuszeichen des Accusativs und des
Genitivs eine merkwürdige Aehnlichkeit hat, scheint die berührte Erscheinung
eher einer umschreibenden Casusbildung ähnlich zu sehen.
Aus einem Nominalstamme wird zunächst ein secundäres, so zu sagen,
Flexionsthema, z. B. aus vâk vâg-bhi wie für den Gen. Pl. aus skt. dêva
dêvan gebildet und diesem dann die eigentlichen Casusendungen angefügt.
So begreift es sich auch, dass z. B. dem griechischen ἶφι, scheinbar
einem Instrumentalis aus dem Stamme ϝι der Plural ἴφια μῆλα, auch der
EN. Ἶφις zur Seite steht (vgl. I. Bekker ‚Homerische Blätter‘ S. 160).
Das Suffix bhi reiht sich offenbar andern mit demselben Consonanten beginnenden
Suffixen an, z. B. kaku-bh, kaku-bha-s (kaku-ha-s), ṛsha-ba-s
(Grundz. 307), kara-bha-s, gr. ἔλα-φο-ς (Grundz. 323) neben ἐλλό-ς, κορυ-φή,
στέρι-φο-ς, über deren mannich faltige Verzweigungen ich in
Jahn's Jahrb. 60 S. 95 gehandelt habe. Man hat bei diesen Formen
wohl an die W. bha = gr. φα scheinen gedacht, die zu der namentlich
im gr. -αφιο-ν hervortretenden Deminutivbedeutung gut passt. Damit
würde aber die Sylbe bhi in der Casusbildung mit ihrer sehr abweichenden
Anwendung und dem constanten I-Laut keineswegs erklärt
sein. Wer kühne Vermuthungen nicht scheut, wird vielleicht an die W.
bhu werden, sein denken, woraus eine Nominalform bhu-ja, verkürzt
bhja, weiter bhi entstehen könnte. Die Bedeutung eines solchen Nomens,
etwa Wesen, wäre zur Zusammensetzung mit einem Nominalstamme
257ebenso geeignet, wie die mit Verbalformen aus der W. bhu zur
Bildung jüngerer Verbalformen. Wie dem sein mag, dass wir es hier
mit einem secundären Thema, mit einer Zusammensetzung ähnlich der
in den zusammengesetzten Verbalformen zu thun haben, halte ich für unzweifelhaft.
Möglicherweise verhält es sich ähnlich mit den casusartigen
Suffixen θα (θε) θι θεν die auf ein gemeinsames dha zurückgehen (vgl.
μισ-θό-ς, W. μεδ (Grundz. 2 235). So hätten wir in chronologischer Beziehung
hier einen ähnlichen Gang wie beim Verbum.
7. Adverbialperiode.
Wir haben hiermit alle Seiten des Formenbaues in unserm Sprachstamme
berührt und es versucht ihre allmähliche Entstehung zu ermitteln.
Dennoch ist ein wesentliches Mittel des sprachlichen Ausdrucks
noch gar nicht erwähnt worden, das ganze Gebiet der Partikeln. Diejenigen
Wörter zwar, welche in den classischen wie in den Sprachen
jüngeren Gepräges Adverbien heissen, jene für Richtungs- und Modalitätsverhältnisse
verwendeten, theils aus Pronominal-, theils aus Nominalstämmen
hervorgehenden indeclinabeln Wörter gehören einer viel späteren
Periode an. Eigentliche Adverbia, aus Adjectiven abgeleitet, in
festem Gebrauche hat es augenscheinlich in der Periode der Einheit noch
gar nicht gegeben. Wohl aber finden wir schon vor der Sprachtrennung
Ansätze zu dem Gebrauch, aus welchem sich nach und nach die Adverbien
der einzelnen Sprachen entwickeln. Das Sanskrit lehrt am deutlichsten,
dass Adverbien nichts andres sind als erstarrte, das heisst aus
der Gemeinschaft mit den übrigen mehr oder weniger ausgeschiedene
Casusformen. Aber auch für die verwandten Sprachen ist dies ja längst
nachgewiesen. Diese Richtung des Sprachgeisles scheint namentlich in
einer Reihe an sich nicht sehr inhaltreicher und darum mehr zum Ausdruck
räumlicher, zeitlicher und innerlicherer Beziehungen verwendeter
Wörter schon verhältnissmässig früh sich geltend gemacht zu haben.
Ganz ohne Partikeln lässt sich ebenso wenig eine Sprache, wie eine lebendige
Rede ohne Gesticulation denken. Eine kleine Anzahl von Partikeln
kürzester Form mag möglicherweise schon bald nach der Wurzelperiode
sich festgesetzt haben. Es scheint wenigstens, dass einzelne in
nackten Pronominalstämmen bestehen. Partikeln wie an (skt. an-, gr. ἀν,
ἀ- lat. in d. un), na (lat. ne), gha (skt. gha [vgl. hi], gr. γε ksl. že), nu
258(skt. nu, gr. νυ), ka (skt. ḱa gr. τε lat. que), die sich durch ihr Vorkommen
in den verschiedensten Zweigen unsers Sprachstammes als indogermanisch
erweisen, mögen dahin gehören, obwohl selbst bei einigen von
ihnen sich Dehnungen (gr. νη, skt. nû) und Anfügungen (lat. nu-m, gr.
νῦ-ν) finden, die an Flexion erinnern. Aber weit grösser ist die Zahl
der Präpositionen, welche wir schon der Periode der Einheit zuschreiben
dürfen. Da wir in vielen von diesen deutlich Casusendungen
erkennen können, so dürfen wir annehmen, dass die Erstarrung mancher
Casusformen zu adverbialem Gebrauch auf diesem Gebiete schon vor der
Sprachtrennung begonnen hat. Dies ist der Grund, warum wir eine Adverbialperiode
als die letzte der grossen Bildungsperioden ansetzen zu
müssen glauben.
Auf die Thatsache, dass die Präpositionen ebenso gut wie andre
Adverbien, von denen sie sich erst nach und nach durch Besonderheiten
des Gebrauchs ablösen, Casusendungen enthalten und auf das Licht,
das dieser Umstand auf die Entstehungszeit derselben wirft, habe ich
wiederholt, namentlich in meinen Grundz. 2 S. 35 ff. hingewiesen. Bei
einigen hat sich noch eine ganze Reihe von Casus erhalten, die meisten
wohl bei skt. parâ und seinen Verwandten, parâ selbst ist so gut wie
parêṇa Instrumentalis, parê (= Zend parê) Locativ, para-tas Ablativ,
para-m Accusativ (Grundz. No. 346). Dem Instrumentalis vergleichen
wir am besten das griech. παρά, dem Locativ stellt sich παραί
dem Accusativ osk. perum zur Seite. Griechisch πάρος = skt. puras
gleicht einem Genitiv aus dem kürzern Stamme par. Von dem Pronominalstamm
an, wovon der Comparativ skt. antar (antara-s, Adv. antarâ)
= inter lautet, erscheint an-i = skt. zd. ni gr. ἐν-ι, ἐν, lat. goth. in
(S. 277) als Locativ, ἀν-ά = osk. umbr. an, goth. ana, ksl. na (S. 275)
wahrscheinlich als Instrumentalis. Nehmen wir einen Stamm ap an, so
ergibt sich ap-i = gr. ἐπ-ί als Locativ, ap-a (zd. apâ neben apa) als Instrumentalis,
ap-as = gr. ἄψ lat. ab-s als Genitiv, lat. ap-ud als Ablativ
im locativischen Sinne. Die von Kuhn Ztschr. XV, 407 besprochene
Form ἀπαί ist zu spät bezeugt (Stephan. Thesaur. s. v.) um irgend in's
Gewicht zu fallen. Sie ist offenbar dem besser bewährten ὑπαί, παραί,
μεταί, καταί nachgebildet, gemäss der Lehre der alten Grammatiker (Herodian
zu B 824) dass Präpositionen ihre Endsylben zu αι dehnen könnten.
Vollends die kürzeren Formen aus den längeren herzuleiten, wie
Kuhn will, sehe ich keinen Grund. Wir sehen ja schon bei para ganz
259deutlich, wie mehrere Casus eines Stammes neben einander in präpositionalem
Gebrauch sein können, so dass wir kein Recht haben kürzere
Formen als Verstümmelungen längerer zu betrachten. Ebenso stehen
ἀντί = skt. anti als Locativ, ἄντα als Instrumentalis, lateinisch anted als
Ablativ, skt. prâ und pra = πρό neben zend. frô d. i. fra-s für pra-s und
dem entschiedenen lateinischen Ablativ prôd. Skt. adh-i vgl. adh-as (Petersb.
Wortb. I 141), abh-i = ἀμφί, par-i = περ-ί, upar-i (zd. upair-i)
= gr. ὑπείρ, ὑπέρ, sind unverkennbar Locative, u-t oder u-d konnte man
für einen Ablativ vom Pronominalstamm u halten. Die Zahl der Präpositionen,
in denen keine Casusform zu Tage liegt, z. B. das von pra
abgeleitete pra-ti = προ-τί, anu, (d)vi ist ausserordentlich klein. Durch
diese Thatsachen wird die Chronologie der Präpositionen, denke ich,
hinreichend festgestellt. Diese Wörter setzen als Adverbien, das heisst
als erstarrte Casusformen, den lebendigen Casusgebrauch unbedingt
voraus. Sie haben selbst in litterarisch bezeugten Zeiten des Sprachlebens,
z. B. in der homerischen Sprache, noch so entschieden adverbialen
Gebrauch, dass wir diesen vollends für jene Zeit der Einheit ihnen
wohl als den ausschliesslichen zusprechen dürfen. Allmählich erst gewöhnte
man sich sie in eine nähere Verbindung mit Verben und Nominibus
zu bringen, wodurch sie theilweise die Natur von Präfixen annahmen.
Derjenige Gebrauch, an den wir bei den Präpositionen zuerst
zu denken pflegen, die Verbindung mit gewissen Casus, ist offenbar erst
das letzte Entwicklungsstadium, und auch hier lässt sich die grösserc
Mannichfaltigkeit des Casusgebrauchs, wie wir sie im Sanskrit, im Zend
und theilweise noch im Griechischen vor uns sehen, mit Bestimmtheit
als die ältere Weise gegenüber der Einförmigkeit bezeichnen, die namentlich
dem Lateinischen eigen ist. Erst auf dieser letzten Stufe werden
diese Wörter auch wohl postposiliv den mit ihnen zusammen gehörenden
Nominalformen nachgesetzt, mit denen sie dann bisweilen gar
zu einem Worte verwachsen. Dergleichen für die Periode der Einheit
vorauszusetzen und vollends die Anfügung von Präpositionen an das
Ende unflectirter Stämme zu vermuthen, ist, wie ich schon anderswo
behauptet und, wie ich glaube, begründet habe, ein chronologischer
Fehler.
Dies Erstarren einzelner Casusformen führt in der Sprachgeschichte
noch zu einer andern wichtigen Form, dem Infinitiv. In ihm hat die
Wissenschaft längst vereinzelte Casusformen von nominibus actionis
260nachgewiesen. Allein die grosse Mannichfaltigkeit verschiedener Bildungen
der Art, die namentlich im Sanskrit vorliegt, und die grossen
Verschiedenheiten der einzelnen Sprachen in der Wahl der zu diesem
Zwecke verwendeten Suffixe machen es fast zur Gewissheit, dass der
Infinitiv als solcher sich erst nach der Sprachtrennung bei den einzelnen
Völkern selbständig gebildet hat. Höchstens könnte man verschiedene
Ansätze und gleichsam Versuche dazu schon für die Periode der Einheit
vermuthen. Auch in der feineren Ausprägung und mehr oder weniger
vollständigen Durchführung des Formensystems, in der Art, wie Lücken,
die sich in diesem bilden, ergänzt und dadurch die Verhältnisse der
einzelnen Formen zu einander vielfach verschoben werden, zeigt jede
einzelne Sprachfamilie ihre Eigentümlichkeit. Eben das ist es ja was
wir mit W. v. Humboldt Ausbildung nennen zu können glaubten. Die
eigentliche Organisation, die Schöpfung aller wesentlichen, vielfach freilich
variabeln Typen ist innerhalb der hier beschriebenen Perioden
vollendet.
So sind wir am Schlüsse unsrer Aufgabe angelangt, die, ich wiederhole
es, uns vielfach Fragen stellte, auf die die Antwort nur eine hypothetische
sein konnte. Aber selbst für die Auffassung und Darstellung
einer einzigen Sprache ist es unmöglich von solchen Fragen ganz abzusehn,
und vollends führt jede tiefer dringende Untersuchung auf dem
weiteren Gebiete des gesammlen Sprachstammes fast mit Nothwendigkeit
auf sie zurück. Es sind Fragen bei deren Behandlung ein kühneres
construetives Verfahren unumgänglich ist. Aber davon abzusehn und
die Stufen der Sprachgestaltung zu ignoriren, ist im Grunde noch
kühner. Möchte es mir gelungen sein, für die Reihenfolge der Hauptentwicklungsstadien,
wie sie hier aufgestellt ist, wenigstens eine grosse
Wahrscheinlichkeit erwiesen zu haben! Das eine wird man einräumen
müssen, dass diese Reihenfolge ohne alle Gewaltsamkeit, namentlich ohne
die Annahme starker Lautentstellungen aufgestellt ist, wie sie von andern
Seiten, wie mir scheint in unberechtigter Weise, selbst für die
allerfrühesten Perioden des Sprachlebens behauptet sind.261
11) Die holländischen Grammatiker waren dieser Erkenntniss zwar nahe, aber
sie erreichten sie dennoch nicht, wie aus Lennep's Praelectiones academicae de analogia
linguae Graecae ed. Everardus Scheidius p.75 der zweiten Ausgabe (Traj. 1805)
zu ersehen ist.
21) »Distinguer les différentes couches« sagt Bréal Mythe d'Oedipe p. 14 in Bezug
auf die verwandte Mythenforschung.
31) Ein namhafter Gelehrter ist allerdings, was ich nicht unerwähnt lassen will,
andrer Ansicht. Benfey hat, nachdem er früher selbst ein ‚griechisches Wurzellexikon‘
verfasst, spater in seiner ‚Skizze des Organismus der indogermanischen Sprachen‘
(Allg. Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur, Jahrgang 1854) und noch entschiedener
in Kuhn's Zeitschr. IX, 81 die ganze Wurzeltheorie bestritten und dieser
gegenüber zunächst (Ztschr. IX, 96) die Ansicht gellend gemacht, dass der indogermanische
Sprachschatz — mit Ausnahme der auf Pronominibus, Partikeln
und Interjectionen beruhenden Bildungen — sich auf Verben
reduciren lässt. Was wir unter Verben in diesem Sinne eigentlich zu verstehen
haben, wird nun freilich nirgends deutlich gesagt. Da ein grosser Theil der zur Erhärtung
jener Ansicht aufgewendeten Bemühungen darauf gerichtet ist, Substantiv-
und Adjectivstämme auf Participialstämme, diese letzteren aber auf die dritte Person
Pluralis Indicativi Activi zurückzuführen, so gewinnt es anfangs den Schein,
als ob Verbum hier so viel als Verbum finitum, oder Form des Verbum finitum bedeute.
Der Begriff ‚Verbum‘ verwandelt sich aber im Laufe jener Darstellung in etwas
völlig verschiedenes. Denn von S. 120 an bemüht sich der Verf. zu zeigen, dass
auch die Pronomina, denen S. 96 vorläufig eine besondre Existenz eingeräumt ward,
aus Verben entstanden seien. Da eine jede Form des Verbum finitum, wie auch
Benfey annimmt, in ihrer Endung ein Pronomen enthält und seine Meinung nicht
etwa die ist, dass das Pronomen früher Endung als selbständiges Wort gewesen sei,
so bedeutet Verbum hier also so viel als Verbalstamm oder, welchen Ausdruck der
Verf. auch gelegentlich dafür gebraucht, Verbalthema. Dem gemäss wird denn
auch S. 125 eingeräumt, ‚dass bei eintretendem Bedürfniss Verbalthemata auch zur
Darstellung von Gegenständen brauchbar gemacht‘, das heisst mit andern
Worten auch nominal verwandt werden konnten, und nur durch die Durchgangsstufe
eines Nomens glaubt B. die Pronomina aus solchen Verbalthemen ableiten zu
können. Auch ‚Orient und Occident‘ II 744 kommt er auf ähnliche Resultate, deutet
sogar an, dass hinter der ‚Verbalperiode‘ noch eine andre ‚Phase‘ gelegen habe.
Was sind nun aber solche Verbalthemata, die auch nominal gebraucht werden können,
anderes als jene Wurzeln, mit deren Verwerfung Benfey seinen Aufsatz beginnt?
Es ist nur ein anderer Name für dieselbe Sache. Gab es aber solche primäre
Einheiten, fähig zu verbaler und nominaler Function, gab es — gleich viel, ob von
Anfang an, oder erst später aus ihnen erzeugt — Pronominalstämme, warum konnten
sich letztere mit ersteren nicht ebenso gut zu ausgeprägteren Nominal- wie zu
Verbalformen verbinden? Wozu uns für eine unvordenkliche Zeit des Sprachlebens
zumuthen, zu glauben — denn wahrlich es fordert starken Glauben — dass die
kaum geschaffene dritte Person Pluralis die Metamorphose in ein Particip erfährt und
dass dies Particip wieder erst die Quelle zahlloser anderer Nominalbildungen ist? —
Auch in dem ersten der erwähnten Aufsätze verwickelt sich Benfey in eigenthümliche
Widersprüche z. B. S. 719, wo er die Pluralendungen des Verbums aus dem Plural
der Personalpronomina zu erklären sucht, also offenbar Casusbildung, das ist doch
nominale Flexion vor der primitivsten Verbalbildung voraussetzt, während doch gerade
die Priorität des Verbums vor dem Nomen die Hauptthesis ist, die er überall
vertheidigt. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein jene Untersuchungen des scharfsinnigen
und um die Kenntniss des Sanskrit gewiss sehr verdienten Gelehrten eingehender
zu prüfen, aber da jene beiden Aufsätze fast der einzige weiter ausgeführte
Versuch einer chronologischen Sprachbetrachtung sind, so wollte ich wenigstens in
der Kürze andeuten, warum mich dieser Versuch durchaus nicht befriedigt.
Die Bevorzugung der Verbalformen vor den Nominalformen hat ihr Gegenstück
gefunden in der schnurstracks entgegengesetzten Hypothese welche Ascoli namentlich
in seinen Studj Ariosemitici Articolo secondo, letto alla Classe di lettere etc. [del R.
Istituto Lombardo] nella tornata del 6 Juglio 1865 ausführt. Auch er will nichts von
Wurzeln (radici lessicali) wissen, freilich ohne auch seinerseits die Annahme von
‚monosillabi primordiali‘ (p. 33) entbehren zu können. Von entwickelteren Formen
aber ist ihm das Nomen früher als das Verbum. Lange Zeil, so meint er, versuchte
sich der Sprachgeist an der Bildung der raannichfaltigsten Formen für das nomen
agentis, ehe das Verbum finitum aufkam. Während Benfey einen Participialstamm wie
bharant als Verstümmelung der dritten Person Pl. bharanti betrachtet, hält umgekehrt
Ascoli bharanti für den Plural des Nominalstammes bharant. Wie sich dann aber
bharanti zum Singular bharati, wie sich dies zu bhara-si, bhard-mi verhält, wird
uns nicht gesagt. Viel näher liegt es doch das ti von bhara-ti für dasselbe mit dem
von bhara-n-ti zu halten. Das pluralische liegt dann in dem n, das wie j-an-ti wahrscheinlich
macht, aus an entstanden sein wird. Zwei copulativ verbundene Pronomina
bezeichnen den Plural, eins von diesen den Singular. Warum konnten nicht
dieselben beiden Pronomina sich völlig unabhängig von jener Verbalform in einem
Nomen wiederfinden? Oder sollen wir etwa auch das Suffix der 1 Pl. mas mit dem
des Nom. Sing. eines Nominalstammes wie bhâ-ma-s identificiren? Seit wann gilt
denn der blosse Gleichklang trotz der verschiedensten Function für einen Beweis ursprünglicher
Identität? Auch Schweizer-Sidler, der in Kuhn's Zeitschr. XVI, 142 über
Ascoli's Versuch berichtet, findet die Mittel, die zur Begründung desselben angewandt
werden, zum Theil sehr gewaltsam. Verbalformen die bisher für die primitivsten galten
z. B. ad-mi, as-ti haben z. B. nach Ascoli schon einen Vocal eingebüsst, damit auf diese
Weise ein Nominalthema ada, asa herauskomme, i-mas soll aus ai-mas verstümmelt,
überhaupt jedes schliessende i und u aus a-ja, a-va entstanden sein. Im Hintergrunde
steht immer die Tendenz die zweisylbigen semitischen Wurzeln mit den indogermanischen
Nominalformen zusammen zu bringen. Ich glaube, die entgegengesetzten
Versuche der beiden scharfsinnigen Männer sind sehr geeignet, sich einander
wechselseitig aufzuheben. Benfey und Ascoli, obgleich in den Zielen weit auseinander
gehend, treffen in den Mitteln vielfach zusammen. Für beide besieht kein Zweifel
darüber, dass ähnliche starke Lautentstellungen, Trübungen des Sprachgefühls, Missbildungen
u. s. w. wie sie in späteren Sprachperioden zum Theil erweislich sind,
ebenso gut auch schon den frühesten eigen waren. Sie suchen beide die als indogermanisch
erwiesenen Formen durch Annahme erheblicher Zerstörungen und Verstümmelungen
zu deuten, während doch mancher bezweifeln möchte, ob solche Annahme
für diese Jugendzeit der Sprache mehr Wahrscheinlichkeit hat, als etwa das Ergrauen
eines Knaben, oder die Zahnlosigkeit eines Jünglings. Jedenfalls aber wird man folgendes
zugeben. Lässt sich ein Weg finden die successive Entstehung des indogermanischen
Sprachbaues ohne solche Gewallmassregeln zu erklären, so verdient er
den Vorzug.
41) Am weitesten geht nach dieser Richtung Ascoli in den S. 203 erwähnten Studj
Ario-Semitici.
51) So setzt Ascoli (S. 20) um das Determinativ p zu erklären ein Pronomen pa
voraus, das im Gebiet der indogermanischen Sprachen nirgends vorkommt. Denn
skt. pa-ra-s (der andere), das er anführt, wird man auch wohl anders erklären können.
Jenes pa soll sogar gelegentlich auch in bha umspringen um so accessorisches bh
zu erklären.
61) Möglicherweise beruht die Anwendung der W. dha in einzelnen Tempusstämmen,
z. B. in griechischen Formen wie πλή-θω, ἠγερ-έ-θοντο, und namentlich
im Passivaorist und ebenso die Bildung des deutschen schwachen Präteritums auf
einer viel jüngeren Verschmelzung dieser Wurzel mit anderen als die ist, von der wir
hier handeln.
71) Ebenso urtheilt Steinthal Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des
Sprachbaues S. 285.
81) Auch Misteli kommt in seinem viel beachtenswertes enthaltenden Aufsatz
über Medialendungen in Kuhn's Zeitschr. XV, 296 zu dem Ergebniss, dass uns nichts
berechtigt die Flexion der Substantiva früher vollendet zu denken als die des Verbums.
91) Sonne nimmt Ztschr. XII, 342 an, dass das Suffix as die W. as sein enthalte.
Sollte diese Annahme richtig sein, was indess kaum für erwiesen gelten kann, so
würde dies éine Suffix völlig aus der Analogie der übrigen primären Suffixe heraustreten.
101) Im Vedadialekt haben noch manche Substantiva nach Analogie des Verbums
den Accusativ bei sich.
111) In Wirklichkeit liegen diese nicht vor. Die skt. W. lip hat nur die Präsensform
limpa-ti. Doch finden sich von andern Verben im Sanskrit nicht selten zwei,
ja drei verschiedene Präsensbildungen neben einander, z. B. W. ar (ṛ) 3 Sing. Pr.
Ind. ij-ar-ti (reduplicirt), ṛ-nó-ti (für ar-nau-ti), ṛ-nâ-ti (für ar-nâ-ti) W. bhar bhar-ti
bi-bhar-ti bhar-a-ti. Danach wird es erlaubt sein der Deutlichkeit wegen jene fünf
Formen an éiner Wurzel zur Anschauung zu bringen.
121) Reiche Beispiele liefert Kuhn Ztschr. XV, 412 ff., wo freilich die Hypothese
aufgestellt wird, dass der schwerere Diphthong âi in allen Medialendungen der ursprüngliche
sei.
131) Der paradoxe Versuch Ascoli's (Studj Ario-Semitici p. 26) auch hier aus dem diks
einer Form wie a-diksa-t ein Nomen agentis herauszupressen, wird wohl wenig Nachfolge
finden. Die sanskritischen Aoriste auf -si-sha-m zeigen zur Evidenz, dass hier
eine Composition vorhanden ist.
141) Ueber die mannichfaltigen Begriffsmodificationen, die durch gehen ausgedrückt
werden können vgl. W. v. Humboldt üb. d. Verschiedenh. d. menschl. Sprachbaues
S. 257.
151) Als Beispiel alterthümlicher Composition kann das merkwürdige πατροφονῆα
(α, 299, γ 197, 307) dienen: ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα Αἴγισθον δολομῆτιν, ὅ οἱ πατέρα
κλυτὸν ἔκτα, sicherlich ein aus älterer Poesie überliefertes Wort, das doch auch
dem Eustathius auffiel in seiner von aller griechischen Composition abweichenden
Weise. Und wer würde im Deutschen den einen Vatermörder nennen, der den Vater
eines andern erschlug?
161) Ueber die von Bopp entdeckte Entstehung des nominativischen s mit dem
Pronominalstamme sa s. dessen Vergl. Gr. I 2 277, über die des accusativischen m
mit dem Pronominalstamme ama Schleicher Gomp. 2 540 und Grassmann's gleich zu
erwähnenden Aufsatz.
172) Manches hierher gehörige erörtert Grassmann Ztschr. XII, 241 ff., diesen M-Casus
als Nominativ benutzt Ascoli ‚del nesso Ario-Semitic‘ lettera al prof. A. Kuhn
Milano 1864 zu einer Parallele zwischen dem Indogermanischen und Semitischen.
181) Steinthal ‚Charakteristik‘ S. 301.
192) Lehrreich für die Entstehung des Genitivs aus der ableitenden Wortbildung
ist der Gen. Pl. der Personalpronomina im Sanskrit asmâ-ka-m, jushmâ-ka-m, eigentlich
(vgl. Schleicher Comp. 2 651) ein Nom. Acc. Neutr. eines aus asma, jushma abgeleiteten
possessiven Stammes, der der Bedeutung nach einem lateinischen nostrum,
vestrum entspricht.