 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
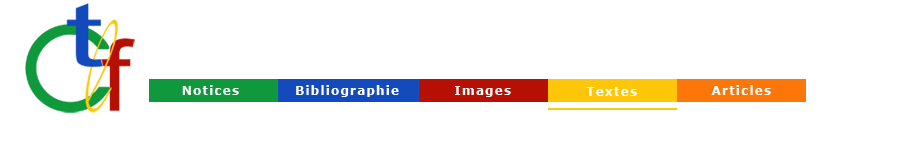
Ueber die Verschiedenheit des Menschlichen
Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige
Entwicklung des Menschengeschlechts
Wohnplätze und Culturverhältnisse der
Malayischen Völkerstamme
1. Die Völkerschaften des Malayischen Stammes 1 befinden sich, wenn
man ihre Wohnsitze, ihre Verfassung, ihre Geschichte, vor allem aber
ihre Sprache betrachtet, in einem sonderbareren Zusammenhange mit
Stämmen verschiedenartiger Cultur, als leicht irgend ein anderes Volk
des Erdbodens. Sie bewohnen bloss Inseln und Inselgruppen, aber in
einer Ausdehnung und Entfernung von einander, welche ein unverwerfliches
Zeugniss ihrer frühen Schiffahrtskunde abgiebt. Ihre continentale
Niederlassung auf der Halbinsel Malacca verdient hier kaum besonders
erwähnt zu werden, da sie eine spätere ist und sich aus Sumatra
herschreibt, und noch weniger kommt hier die noch jüngere an den
Küsten des Chinesischen Meeres und des Meerbusens von Siam, in
Champa, 2 in Betrachtung. Ausserdem aber können wir nirgends, auch
nicht in dem frühesten Alterthume, mit irgend einiger Sicherheit Malayen
auf dem Festlande nachweisen. Wenn man nun von diesen Stämmen
diejenigen zusammennimmt, welche in engerem Verstande Malayische
zu heissen verdienen, da sie, nach untrüglicher grammatischer Untersuchung,
eng mit einander verwandte und durch einander erklärbare
Sprachen reden, so finden wir dieselben, um nur diejenigen Punkte zu
nennen, wo die Sprachforschung hinreichend vorbereiteten Stoff antrifft,
auf den Philippinen und zwar dort in dem zur formenreichsten
Entfaltung gediehenen und eigenthümlichsten Zustande der Sprache,
auf Java, Sumatra, Malacca und Madagascar. Eine grosse Anzahl von
unbestreitbaren Wortverwandtschaften und schon die Namen einer bedeutenden
Anzahl von Inseln beweisen aber, dass auch die jenen Punkten
nahe gelegenen Eilande gleiche Bevölkerung haben, und dass der
engere Malayische Sprachkreis sich wohl über den ganzen Theil des
Süd-Asiatischen Oceans ausdehnt, welcher von den Philippinen südwärts
an den Westküsten von Neu-Guinea herunter und dann westwärts
um die Inselkette herum, die sich an die Ostspitze von Java anschliesst,
in den Gewässern von Java und Sumatra bis zur Strasse von
279Malacca geht. Es ist nur zu bedauern, dass sich die Sprachen der grossen
Inseln Borneo und Celebes, von welchen jedoch wahrscheinlich das
eben Gesagte gleichfalls gilt, noch nicht gehörig grammatisch beurtheilen
lassen.
Oestlich von dem hier gezogenen engeren Malayischen Kreise, von
Neu-Seeland bis zur Oster-Insel, von da nordwärts bis zu den Sandwich-Inseln
und wieder westlich bis zu den Philippinen heran, wohnt
eine Inselbevölkerung, welche die unverkennbarsten Spuren alter
Stammverwandtschaft mit den Malayischen Stämmen an sich trägt. Die
Sprachen, von welchen wir die Neu-Seeländische, Tahitische, Sandwichische
und Tongische auch grammatisch genau kennen, beweisen
dieselbe durch eine grosse Zahl von gleichen Wörtern und wesentliche
Uebereinstimmungen im organischen Baue. Gleiche Aehnlichkeit findet
sich in Sitten und Gebräuchen, besonders insofern sich die Malayischen
rein und unverändert durch Indische Gewohnheiten erkennen lassen.
Inwiefern die in diesem Theil des Oceans nordwestlich wohnenden'
Stämme sich mehr oder ganz zu den übrigen dieser Abtheilung oder zu
den Malayischen im engeren Verstande hinneigen oder ein verbindendes
Mittelglied zwischen beiden bilden, lässt sich, nach den jetzt vorhandenen
Hülfsmitteln, noch nicht beurtheilen, da auch die über die
Sprache der Marianen-Inseln angestellten Untersuchungen noch nicht
öffentlich bekannt gemacht sind. Alle diese Völkerstämme nun besitzen
solche gesellschaftlichen Einrichtungen, dass man sie mit Unrecht von
dem Kreise civilisirter Nationen gänzlich ausschliessen würde. Sie haben
eine fest gegründete, und gar nicht durchaus einfache, politische
Verfassung, religiöse Satzungen und Gebräuche, zum Theil sogar eine
Art geistlichen Regiments, zeigen Geschicklichkeit in mannigfaltigen
Arbeiten, und sind kühne und gewandte Seefahrer. Man findet bei ihnen,
an mehreren Orten, jetzt ihnen selbst unverständliche Bruchstücke
einer heiligen Sprache, und der Gebrauch, veraltete Ausdrücke bei gewissen
Gelegenheiten feierlich ins Leben zurückzurufen, zeugt nicht
bloss von Reichthum, Alter und Tiefe der Sprache, sondern auch von
der Aufmerksamkeit auf die im Laufe der Zeit wechselnde Bezeichnung
der Gegenstände. Dabei aber duldeten sie, und dulden zum Theil noch
unter sich barbarische und mit menschlicher Gesittung nicht zu vereinigende
Gebräuche, scheinen nie zum Besitze der Schrift gelangt zu seyn,
und entbehren daher alle von dieser abhängige Bildung, ob es ihnen
gleich nicht an sinnreichen Sagen, eindringender Beredsamkeit und
Dichtung in bestimmt geschiedenen Tonweisen fehlt. Ihre Sprachen
sind auf keine Weise aus Verderbung und Umwandlung der Malayischen
des engeren Kreises entstanden, man kann viel eher glauben, in
ihnen einen formloseren und ursprünglicheren Zustand dieser wahrzunehmen.280
Zugleich mit den hier genannten Völkerstämmen in den beiden eben
bezeichneten Abtheilungen des grossen südlichen Archipels trifft man
auf einigen Inseln desselben Menschen an, welche, dem Anscheine
nach, zu einer ganz anderen Race gerechnet werden müssen. Sowohl
die Malayen im engeren Verstande, als die mehr östlichen Bewohner
der Südsee gehören, ohne allen Zweifel, zu derselben Menschenrace,
und bilden, wenn man genauer in die Unterscheidung der Farben eingeht,
die mehr oder weniger lichtbraune in der allgemeinen weissen.
Die Stämme, von denen jetzt die Rede ist, nähern sich dagegen durch
Schwärze der Haut, zum Theil wollige Krausheit der Haare und ganz
eigenthümliche Gesichtszüge und Körpergestalt den Afrikanischen Negern,
obgleich sie, den glaubwürdigsten Zeugnissen nach, doch wieder
wesentlich und gänzlich von diesen verschieden sind, und durchaus
nicht zu Einer Race mit ihnen gerechnet werden können. 3 Sie werden
bei den Schriftstellern über diese Gegenden, zum Unterschiede von den
Afrikanischen Negern, bald Negritos, bald Austral-Neger genannt, und
sind wenig zahlreich. Auf zugleich von Malayischen Stämmen bewohnten
Inseln, wie auf den Philippinen, halten sie sich gewöhnlich in der
Mitte der Eilande, auf schwer zugänglichen Gebirgen auf, wohin sie von
der zahlreicheren und hauptsächlichen weissen Bevölkerung nach und
nach zurückgedrängt scheinen. In dieser Lage muss man sie aber sorgfältig
von den Haraforas 4 oder Alfuris, Turajas 5 in Celebes, unterscheiden,
die sich in Borneo, Celebes, den Molukken, Mindanao und einigen
andren Inseln finden. Diese scheinen gleichfalls von ihren Mitbewohnern
zurückgedrängt, gehören aber zu den lichtbraunen Stämmen, und
Marsden schreibt ihre Vertreibung von den Küsten sogar erst Mahomedanischer
Verfolgung zu. In Verwilderung kommen sie der schwarzen
Race nahe, und sind immer eine auf verschiedener Culturstufe stehende
Bevölkerung. Andere, zum Theil grosse Inseln, wie Neu-Guinea, NeuBritannien
und Irland, und einige der Hebriden, haben diese negerartigen
Stämme allein inne, und die Bewohner des grossen Continents von
Neu-Holland und Van Diemens Land, welche man bisher Gelegenheit
gehabt hat kennen zu lernen, gehören zu der gleichen Menschenrace.
Obgleich aber diese in ihren hier beschriebenen dreifachen Wohnplätzen
allgemeine Kennzeichen der Aehnlichkeit und Verwandtschaft an
sich trägt, so ist noch bei weitem nicht hinlänglich ergründet, inwiefern
doch auch in ihr wesentliche Stammunterschiede statt finden mögen?
Namentlich sind ihre Sprachen noch durchaus nicht auf eine Weise untersucht,
welche eine gründliche Sprachforschung befriedigen könnte.
Zur Beurtheilung des organischen und grammatischen Baues giebt es
bloss von einem Stamm von Neu-Süd-Wales durch den Missionar Threlkeld
gesammelte Materialien. Ueberall zeichnet sich diese Race durch
grössere Wildheit und Uncultur gegen die von hellerer Farbe aus, und
281die Verschiedenheiten hierin beruhen wohl allein auf näherem oder entfernterem
Umgange mit Stämmen der letzteren. Die Bewohner von
Neu-Holland und Van Diemens Land scheinen auf der niedrigsten Stufe
der Cultur zu stehen, auf welcher man noch überhaupt die Menschheit
auf dem Erdboden angetroffen hat. Eine sonderbare Erscheinung
ist es, auch auf der Halbinsel Malacca die helle und dunkle Race wieder
neben einander anzutreffen. Denn die Semang, welche einen Theil der
Gebirge derselben bewohnen, sind, nach ganz unverwerflichen Zeugnissen,
ein wollhaariger Negrito-Stamm. Da sich derselbe auf diesem
einzigen Punkte des Asiatischen Festlandes findet, 6 so ist er unstreitig
auch, nur in früherer Zeit, dahin übergewandert. Auch von der helleren
Race hat es, wie die offenbar Malayischen orang benūa, Menschen des
Landes, zu beweisen scheinen, 7 wohl mehr als Eine Einwanderung gegeben.
Beide Ereignisse beweisen daher nur, dass dieselben Länderverhältnisse
in verschiedenen Zeiten gleiche geschichtliche Begebenheiten
hervorbringen, und haben insofern nichts Auffallendes in sich. In Rücksicht
auf den Culturzustand der verschiedenen Menschenstämme dieses
Inselmeeres aber wird die Erklärung durch Ueberwanderung in diesem
mislich. Für unternehmende Nationen besitzt zwar das Meer eher
eine leicht verbindende, als abschneidend trennende Macht, und die
Allgegenwart der thätigen, segelkundigen Malayen lässt sich auf diese
Weise durch Fahrten von Insel zu Insel, bald willkührlich mit Hülfe,
bald fortgerissen durch die Gewalt der regelmässigen Winde, erklären.
Denn diese Regsamkeit, Gewandtheit und Schiffahrtskunde sind nicht
bloss Charakterzüge der eigentlichen Malayen, sondern mehr oder weniger
der ganzen lichtbraunen Bevölkerung. Ich brauche hier nur an die
Bugis auf Celebes und an die Südsee-Insulaner zu erinnern. Wenn aber
dieselbe Erklärung von den Negritos und ihrer Verbreitung von Neu-Holland
bis zu den Philippinen und von Neu-Guinea bis zu den Andamans-Inseln
gelten soll, so müssen diese Stämme mehr, als sich annehmen
lässt, von einem civilisirteren Zustande heruntergekommen und
verwildert seyn. Ihr heutiger begünstigt weit mehr die, auch an sich
nicht unwahrscheinliche Hypothese, dass durch Naturrevolutionen,
von welchen noch uralte Sagen auf Java herum gehen, ein bevölkerter
Continent in die jetzige Inselmenge zerschlagen wurde. Wie Trümmer,
konnten dann die Menschen, insoweit die menschliche Natur solche
Umwälzungen zu überdauern vermag, auf den zerstückelten Inselschollen
zurückgeblieben seyn. Diese beiden Erklärungsarten können vielleicht
nur verbunden, wenn auch die Zersplitterung durch Naturkräfte
durch Jahrtausende von der Verbindung durch menschliche Ueberwandrungen
sollte getrennt gewesen seyn, von der Verbreitung dieser beiden,
uns jetzt so verschieden erscheinenden Racen einigermassen Rechenschaft
geben.282
Tanna, eine der Hebriden, deren Name aber Malayischen Ursprungs
ist, 8 Neu-Caledonien, Timor, Ende und einige andre Inseln haben eine
Bevölkerung, welche die Forschung zweifelhaft lässt, ob man in ihr mit
Crawfurd 9 eine dritte Race, oder mit Marsden 10 eine Vermischung der
beiden andren erkennen soll. Denn ihre Bewohner stehen in körperlicher
Bildung, Krausheit der Haare und Farbe der Haut in der Mitte zwischen
der lichtbraunen und schwarzen Race. Wenn sich jedoch die analoge
Behauptung auch von ihren Sprachen bestätigt, so spricht schon
dieser Umstand entschieden für die Vermischung. Es bleibt überhaupt
noch eine wichtige, aber nach den bis jetzt vorhandenen Nachrichten
kaum befriedigend zu entscheidende Frage, inwieweit ältere und tiefere
Vermischungen der weissen und schwarzen Race in diesen Gegenden
statt gefunden haben mögen, und inwiefern daraus allmähliche Uebergänge
in Sprache und selbst in Farbe und Haarwuchs, dessen Krausheit
übrigens an einigen Orten auch Putzliebe künstlich zu Hülfe kommt,
entstanden seyn können. 11 Um die negerartige Race richtig und in ihrer
reinen Gestalt zu beurtheilen, wird man immer von den Bewohnern des
grossen südlichen Festlandes ausgehen müssen, da zwischen diesen und
den braunen Stämmen keine unmittelbare Berührung denkbar, und
nach ihrem heutigen Zustande selbst die Art einer mittelbaren schwer
zu ersinnen ist. Desto auffallender bleibt es aber, dass auch die Sprache
dieser Stämme in einigen Wörtern, da wir überhaupt nur eine geringe
Anzahl derselben besitzen, sichtbare Aehnlichkeit mit Wörtern der
SüdseeInseln zeigt.
In diesen geographischen und mehr oder weniger nachbarlichen Verhältnissen
haben nun einige Malayische Völkerschaften Indische Cultur
in so reicher Fülle in sich aufgenommen, dass man vielleicht nirgends
ein zweites Beispiel einer Nation findet, die, ohne ihre Selbstständigkeit
aufzugeben, in diesem Grade von der Geistesbildung einer andren
durchdrungen worden wäre. Die Erscheinung im Ganzen ist an sich
sehr begreiflich. Ein grosser Theil des Archipels, und gerade ein durch
Klima und Fruchtbarkeit vorzugsweise anlockender, lag in geringer Entfernung
von dem grossen Festlande Indiens; es konnte daher an Gelegenheiten
und Punkten der Berührung nicht fehlen. Wo aber eine solche
eintrat, musste die Uebermacht einer so uralten und in allen Zweigen
menschlicher Thätigkeit ausgebildeten Civilisation, als es die Indische
war, Nationen von reger und lebendiger Empfänglichkeit nach sich reissen.
Es war dies indess mehr eine moralische, als eine politische Umwandlung.
Wir erkennen sie an ihren Folgen, an den Indischen Elementen,
die sich in einem gewissen Kreise der Malayischen Stämme der
Wahrnehmung unabweisbar aufdrängen; wie aber diese Vermischung
entstanden ist? darüber gehen unter den Malayen selbst, wie wir sehen
werden, nur Ungewisse und dunkle Sagen. Hätten mächtige Völkerzüge
283und grosse Eroberungen diesen Zustand bewirkt, so würden sich deutlichere
Spuren dieser politischen Ereignisse erhalten haben. Geistige und
sittliche Kräfte wirken, wie die Natur selbst, unbemerkt, und wachsen
plötzlich aus einem Samen empor, der sich der Beobachtung entzieht.
Auch die ganze Art, wie der Hinduismus in den Malayischen Stämmen
Wurzel schlug, beweist, dass er, als geistige Kraft, wieder geistig anregte,
die Phantasie in Bewegung setzte und durch den Eindruck mächtig
wurde, den er auf die Bewunderung bildungsfähiger Völker hervorbrachte.
In Indien selbst, in dem, was wir von Indischer Geschichte und
Literatur wissen, finden wir, soviel mir bekannt ist, keine Erwähnung
des südöstlichen Archipels. Wenn auch vielleicht Lanka südlicher angenommen
wurde, als sich Ceylon erstreckt, so war dies wohl nur dunkle
und ungewisse Kunde oder bloss dichterische Annahme. Vom Archipel
selbst gieng daher, was auch sehr begreiflich ist, nichts aus, was auf das
Festland hätte irgend bedeutend einwirken können. Die mächtige Wirkung
übte Indien, und wahrscheinlich sogar durch Ansiedelungen, deren
Absicht es nicht war, das Stammland fernerhin als ihre Heimath zu
betrachten oder Verbindungen damit zu unterhalten. Die Ursachen
hierzu konnten mannigfaltig seyn. Inwiefern die Buddhistischen Verfolgungen
darunter wirksam seyn mochten, werde ich in der Folge erörtern.
Um aber die Vermischung Indischer und Malayischer Elemente und
den Einfluss Indiens auf den ganzen südöstlichen Archipel gehörig zu
würdigen, muss man die verschiedenen Arten seiner Wirksamkeit unterscheiden
und dabei schon darum von derjenigen ausgehen, welche,
wie früh sie auch begonnen haben mag, bis in die späteste Zeit hin fortgesetzt
worden ist, weil sie auch natürlich die deutlichsten und unverkennbarsten
Spuren hinterlassen hat. Hier übt nicht nur, wie bei aller
Völkervermischung, die geredete fremde Sprache, sondern zugleich die
ganze, in und mit ihr aufgeblühte geistige Bildung Einfluss aus. Ein solcher
nun ist unläugbar in dem Uebergange Indischer Sprache, Literatur,
Mythe und religiöser Philosophie nach Java sichtbar. Hiervon handelt,
nur in näherer Beziehung auf die Sprache, die ganze Folge dieser
Schrift, und ich kann mich daher hier mit der blossen Erwähnung begnügen.
Diese Art des Einflusses traf nur den eigentlich Indischen Archipel,
den Malayischen Kreis im engeren Verstande, vielleicht aber
auch diesen nicht ganz, und gewiss nicht in gleichem Masse. Der Brennpunkt
desselben war so sehr Java, dass man nicht mit Unrecht zweifelhaft
bleiben kann, ob nicht der auf den Ueberrest des Archipels grossentheils
nur ein mittelbarer, von dieser Insel ausgehender war. Ausser
ihr finden wir nur noch deutliche und vollständige Beweise literarischer
Indischer Cultur bei den eigentlichen Malayen und bei den Bugis auf
Celebes. Eine wahre Literatur kann, und zwar aus inneren Gründen der
284Sprachbildung selbst, nur mit einer zugleich gegebenen und in Gebrauch
kommenden Schrift entstehen. Es macht daher ein wichtiges
Moment in den Culturverhältnissen des südöstlichen Archipels aus,
dass gerade der als Malayisch im engeren Verstande bezeichnete Inselkreis,
zwar nicht durchgängig, aber ausschliesslich gegen die anderen
Theile, alphabetische Schrift besitzt. Es ist aber hierbei doch ein nicht
zu übersehender Unterschied. Die alphabetische Schrift in diesem Theile
der Erde ist Indische. Dies liegt in den natürlichen Culturverhältnissen
dieser Gegenden, und ist bei den meisten dieser Alphabete, wenn
man etwa das der Bugis ausnimmt, auch in der Aehnlichkeit der Züge
sichtbar, der inneren Einrichtung der Lautbezeichnung nicht zu erwähnen,
die allerdings, da sie auch später nur dem fremden Alphabet angepasst
seyn könnte, keinen entscheidenden Beweisgrund abgiebt. Dennoch
waltet die völlige Aehnlichkeit, bloss mit Anpassung an das
einfachere Lautsystem der einheimischen Sprache, nur in Java und etwa
in Sumatra ob. Die Tagalische und Bugis-Schrift weichen so bedeutend
ab, dass man sie für eine Stufe in der alphabetischen Schrifterfindung
ansehen kann. Auf Madagascar hat die Arabische Schrift sich, so wie
die Indische auf dem Mittelpunkt des Archipels, Geltung verschafft. In
welcher Zeit aber dies geschehen seyn mag? ist unbekannt. Auch findet
sich keine Spur einer durch sie verdrängten einheimischen. Der Gebrauch
der Arabischen Schrift bei den eigentlichen Malayen entscheidet,
als offenbar spätere Einführung, nichts in den Culturverhältnissen,
von welchen hier die Rede ist. Von dem Mangel aller Schrift auf den
Inseln der Südsee und bei den negerartigen Stämmen habe ich schon
weiter oben gesprochen. Die Spuren des Hinduismus, den wir hier im
Gesicht haben, sind von der Art, dass man sie überall deutlich erkennen
und sogleich als fremde Elemente unterscheiden kann. Es ist hier keine
wahre Verwebung, noch weniger eine Verschmelzung, sondern nur eine
mosaikartige Verbindung von Fremdem und Einheimischem. Man
kann, was Sitten und Gebräuche betrifft, in dem Indischen Alterthume,
die ausländischen Wörter, die nicht einmal ganz von ihrer grammatischen
Formung entkleidet sind, in dem auf uns gekommenen Sanskrit
deutlich wiedererkennen; man kann sogar die Gesetze auffinden, welche
diese Verpflanzung fremder Sprachelemente auf den einheimischen
Boden geregelt haben. Es ist dies die Grundlage der vornehmen und der
Dichtersprache auf Java, und hängt ganz genau mit dem Uebergange
der Literatur und Religion zusammen. Bei weitem nicht Alles dieser Art
hat sich auch in der Volkssprache Geltung verschafft, und ebenso wenig
lässt sich behaupten, dass, wo diese Indische Wörter besitzt, sie dieselben
allein auf diesem Wege erhalten habe. Es entstehen daher, wenn
man die Gattungen des verschiednen Indischen Einflusses weiter verfolgt,
zwei tiefer liegende, durch factische Umstände hervorgerufene,
285aber mit Bestimmtheit schwer zu beantwortende Fragen: ob nemlich
die ganze Civilisation des Archipels überhaupt Indischen Ursprunges
ist? und ob auch aus einer Zeit her, die aller Literatur und der letzten
und feinsten Sprachentwicklung vorausgeht, Verbindungen zwischen
dem Sanskrit und den Malayischen Sprachen im weitesten Sinne bestanden
haben, die sich noch in gemeinschaftlichen Sprachelementen
nachweisen lassen?
Die erste dieser beiden Fragen wäre ich zu verneinen geneigt. Es
scheint mir ausgemacht, dass es eigentliche und ursprüngliche Civilisation
der braunen Race des Archipels gegeben habe. Sie findet sich noch
in dem östlichsten Theile, und ist nicht einmal in Java unverkennbar
untergegangen. Es liesse sich zwar allerdings sagen, dass die Bevölkerung
des Archipels allmählich von der Mitte, aufweiche Indien zunächst
wirkte, ausgegangen sey, und sich von da gegen Osten verbreitet habe, so
dass der bestimmt Indische Charakter sich an den Endpunkten mehr
vermischt habe. Eine solche Annahme wird doch aber um so weniger
durch bestimmte Aehnlichkeiten unterstützt, als gerade in demjenigen,
was sich gar nicht vorzugsweise als Indisch ankündigt, auffallende
Uebereinstimmungen der Sitten von Völkerschaften des mittleren und
östlicheren Archipels namhaft gemacht worden sind. Man sieht auch
durchaus nicht ein, warum man einem Völkerstamme, wie der Malayische
ist, eine aus ihm selbst hervorgebildete gesellschaftliche Civilisation
absprechen sollte, der Gang der Bevölkerung und allmählichen Gesittung
möge übrigens diese oder jene Richtung genommen haben? Selbst
die Fähigkeit der zu ihm gehörenden Völkerschaften, den ihnen zugebrachten
Hinduismus in sich aufzunehmen, ist ein Beweis dafür, und
noch mehr die Art, wie sie dennoch das Einheimische damit verwebten
und dem Indischen fast nie seine ganze fremde Gestalt liessen. Beides
hätte nothwendig anders seyn müssen, wenn die Indischen Ansiedlungen
diese Stämme als rohe, uncultivirte Wilde angetroffen hätten. Wenn ich
hier von Indiern rede, so meine ich natürlich nur den Sanskrit redenden
Stamm, nicht Bewohner des Indischen Festlandes überhaupt. Inwiefern
solche von jenem Stamme angetroffen und vielleicht von ihm verjagt
wurden, ist eine andere Frage, in die ich hier nicht eingehe, wo es mir nur
darauf ankommt, zu zeigen, von welchen verschiedenen Culturverhältnissen
die Malayischen Stämme umgeben waren.
Die zweite, allein die Sprache angehende Frage muss, wie ich glaube,
allerdings bejaht werden. In dieser Hinsicht dehnen sich die Gränzen
des Indischen Einflusses weiter aus. Ohne noch des Tagalischen zu
erwähnen, welches eine ziemliche Anzahl von Sanskritwörtern für ganz
verschiedene Gattungen von Gegenständen in sich fasst, finden sich
auch in der Sprache von Madagascar und in der der SüdseeInseln, bis in
das Pronomen hinein, zugleich dem Sanskrit angehörende Laute und
286Wörter; und auch die Stufen der Lautveränderung, die als comparatives
Kennzeichen des Alters der Verwehung angesehen werden können, sind
selbst in solchen Sprachen des engeren Malayischen Kreises verschieden,
in welchen, wie im Javanischen, auch ein noch viel später ausgeübter
Einfluss Indischer Sprache und Literatur sichtbar ist. Wie nun dies
zu erklären, und welches gegenseitige Verhältniss den in dieser Hinsicht
sich nähernden beiden grossen Sprachstämmen anzuweisen ist? bleibt
natürlich höchst zweifelhaft. Ich werde aber am Ende dieser Schrift
ausführlicher darauf zurückkommen, da mir hier genügt, auf einen Einfluss
des Sanskrits auf die Sprachen des Malayischen Stammes aufmerksam
gemacht zu haben, der sich von dem der in sie verpflanzten
Geistesbildung und Literatur wesentlich unterscheidet, und einer viel
früheren Epoche und andren Völkerverhältnissen anzugehören scheint.
Ich werde alsdann auch die Sprachen der negerartigen Racen berühren,
muss aber hier im voraus bemerken, dass, wenn sich in einigen derselben,
z.B. in der Papua-Sprache in Neu-Guinea, Aehnlichkeiten mit
Sanskrit-Wörtern finden sollten, dies noch keinesweges nur einmal unmittelbare
Verbindungen zwischen Indien und jenen Eilanden beweist,
da solche gemeinschaftliche Wörter auch mittelbar durch Malayische
Schiffahrt dahin gebracht seyn können, so wie dies mit Arabischen
sichtlich der Fall gewesen ist.
Zwischen so contrastirende Verwandtschaften und Einflüsse gleichsam
eingedrängt, finden wir nun die Malayischen Völkerschaften, wenn
wir die hier versuchte Schilderung des Culturzustandes des grossen Archipels
übersehen. Auf denselben Inseln und Inselgruppen, welche zum
Theil noch jetzt in ihrem Schoosse eine Bevölkerung tragen, die auf der
niedrigsten Stufe der Menschheit steht, oder wo eine solche doch im
früheren Alterthume bestanden hat, ist zugleich eine uralte und zu der
glücklichsten Blüthe gediehene Bildung von Indien herüber einheimisch
geworden. Die Malayischen Stämme haben sich dieselbe zum Theil in
ihrer ganzen Fülle angeeignet. Dabei sind sie sichtbar Stammverwandte
der, gegen diese Bildung, als Wilde zu betrachtenden Bewohner der
Südsee-Inseln, und es ist noch zweifelhaft, ob wenigstens ihre Sprache
der negerartigen Race ganz fremd ist. Sie haben sich in einer ihnen eigenthümlichen
Gestalt und in einer, in ihrer Vollendung, nur ihnen angehörenden
Sprachform, die sich in bestimmten Umrissen darstellen
lässt, von jenen rohen Stämmen abgesondert erhalten. Diejenige Bevölkerung
des grossen Archipels, die sich, nach den bis jetzt bekannten
Angaben, auf dem Asiatischen Continente nicht nachweisen lässt, befindet
sich, wenn wir den fremden Einfluss abrechnen, mehr oder weniger,
entweder in einem ganz rohen und wilden Zustände, oder auf der
Civilisationsstufe beginnender Gesellschaft. Dies ist vorzüglich dann
genau wahr, wenn wir bloss die negerartige Race und die Südsee-Bewohner
287im Auge behalten, und die im engeren Verstande Malayisch zu
nennenden Stämme davon absondern, obgleich kein ganz hinreichender
Grund vorhanden ist, diesen, vor allem Indischen Einfluss, einen
sehr viel höheren Culturgrad zuzuschreiben. Wir treffen ja noch heute
bei den Batta's auf Sumatra, in deren Mythen und Religion sogar Indischer
Einfluss unverkennbar ist, die barbarische Sitte an, bei gewissen
Gelegenheiten Menschenfleisch zu essen. Der grosse Archipel dehnt
sich aber unter der ganzen Länge Asiens hin, und überflügelt sie, westlich
und östlich von Afrika und Amerika eingeschlossen, zu beiden Seiten.
Seine Mitte befindet sich in einer, für die Schiffahrt immer nur mässigen
Entfernung selbst von den äussersten Endpunkten Asiatischen
Festlands. Es haben daher auch die drei grossen Brennpunkte der frühesten
Geistesbildung des Menschengeschlechts: China, Indien und die
Sitze des Semitischen Sprachstamms in verschiedenen Zeiten auf ihn
eingewirkt. In verhältnissmässig späterer hat er von allen Einfluss erfahren.
Auf seine frühere Gestaltung aber hat nur Indien wahrhaft tief
eingewirkt, Arabien, wenn man, was doch, der Zeitbestimmung nach,
auch zweifelhaft bleibt, Madagascar ausnimmt, gar nicht, und ebenso
wenig bedeutend, seiner frühen Ansiedlungen ungeachtet, China.
Selbst eine Verwandtschaft Chinesischer Sprache mit den Mundarten
der Südsee, auf welche ein gewisser Gebrauch partikelartiger Wörter
führen könnte, ist bis jetzt nicht gezeigt worden.
Eine solche Lage und ein solches Verhältniss der Völker und Sprachen
gegen einander bietet ethnographischen und linguistischen Untersuchungen
die wichtigsten, aber auch schwierigsten Probleme dar. In
die Erörterung dieser einzugehen, ist hier meine Absicht nicht. Es kann
dies nur, insofern sich etwas irgend Genügendes darüber ausmachen
lässt, der Gegenstand von Schlussbemerkungen nach gehöriger Darlegung
der Thatsachen seyn. Um aber diese von dem Punkte zu beginnen,
wo die geschichtlichen Data am klarsten und gewissesten vorliegen,
werde ich die Untersuchung in den beiden ersten Büchern dieser Schrift
bei der Epoche aufnehmen, wo der Indische Einfluss am tiefsten und
eingreifendsten in die Malayische Bildung eingewirkt hat. Dieser Culminationspunkt
ist offenbar die Blüthe der Kawi-Sprache, als der innigsten
Verzweigung Indischer und einheimischer Bildung auf der Insel,
welche die frühesten und zahlreichsten Indischen Ansiedelungen besass.
Ich werde dabei immer vorzugsweise auf das einheimische Element
in dieser Sprachverbindung hinsehn, dies aber aus erweitertem
Gesichtspunkte in seiner ganzen Stammverknüpfung betrachten, und
seine Entwicklung bis zu dem Punkte verfolgen, wo ich seinen Charakter
in der Tagalischen Sprache in seiner grössten und reinsten Entfaltung
zu finden glaube. Im dritten Buche werde ich mich, soweit es die
vorhandenen Hülfsmittel erlauben, über den ganzen Archipel verbreiten,
288auf die so eben angedeuteten Probleme zurückkommen, und so versuchen,
ob dieser Weg, verbunden mit dem bis dahin Erörterten, zu einer
richtigeren Beurtheilung des Völker- und Sprachverhältnisses der
ganzen Inselmenge zu führen vermag?
Gegenstand dieser Einleitung
2. Die gegenwärtige Einleitung glaube ich allgemeineren Betrachtungen
widmen zu müssen, deren Entwicklung den Uebergang zu den Thatsachen
und historischen Untersuchungen angemessener vorbereiten wird.
Die Vertheilung des Menschengeschlechts in Völker und Völkerstämme
und die Verschiedenheit seiner Sprachen und Mundarten hängen zwar
unmittelbar mit einander zusammen, stehen aber auch in Verbindung
und unter Abhängigkeit einer dritten, höheren Erscheinung, der Erzeugung
menschlicher Geisteskraft in immer neuer und oft gesteigerter Gestaltung.
Sie finden darin ihre Würdigung, aber auch, soweit die Forschung
in sie einzudringen und ihren Zusammenhang zu fassen vermag,
ihre Erklärung. Diese in dem Laufe der Jahrtausende und in dem Umfange
des Erdkreises, dem Grade und der Art nach, verschiedenartige
Offenbarwerdung der menschlichen Geisteskraft ist das höchste Ziel
aller geistigen Bewegung, die letzte Idee, welche die Weltgeschichte
klar aus sich hervorgehen zu lassen streben muss. Denn diese Erhöhung
oder Erweiterung des inneren Daseyns ist das Einzige, was der Einzelne,
insofern er daran Theil nimmt, als ein unzerstörbares Eigenthum
ansehen kann, und in einer Nation dasjenige, woraus sich unfehlbar
wieder grosse Individualitäten entwickeln. Das vergleichende Sprachstudium,
die genaue Ergründung der Mannigfaltigkeit, in welcher zahllose
Völker dieselbe in sie, als Menschen, gelegte Aufgabe der Sprachbildung
lösen, verliert alles höhere Interesse, wenn sie sich nicht an den
Punkt anschliesst, in welchem die Sprache mit der Gestaltung der nationellen
Geisteskraft zusammenhängt. Aber auch die Einsicht in das eigentliche
Wesen einer Nation und in den inneren Zusammenhang einer
einzelnen Sprache, so wie in das Verhältniss derselben zu den Sprachforderungen
überhaupt, hängt ganz und gar von der Betrachtung der
gesammten Geisteseigenthümlichkeit ab. Denn nur durch diese, wie die
Natur sie gegeben und die Lage darauf eingewirkt hat, schliesst sich der
Charakter der Nation zusammen, auf dem allein, was sie an Thaten,
Einrichtungen und Gedanken hervorbringt, beruht und in dem ihre sich
wieder auf die Individuen fortvererbende Kraft und Würde liegt. Die
Sprache auf der andren Seite ist das Organ des inneren Seyns, dies Seyn
selbst, wie es nach und nach zur inneren Erkenntniss und zur Aeusserung
gelangt. Sie schlägt daher alle feinste Fibern ihrer Wurzeln in die
289nationelle Geisteskraft; und je angemessener diese auf sie zurückwirkt,
desto gesetzmässiger und reicher ist ihre Entwicklung. Da sie in ihrer
zusammenhängenden Verwebung nur eine Wirkung des nationellen
Sprachsinns ist, so lassen sich gerade die Fragen, welche die Bildung
der Sprachen in ihrem innersten Leben betreffen, und woraus zugleich
ihre wichtigsten Verschiedenheiten entspringen, gar nicht gründlich beantworten,
wenn man nicht bis zu diesem Standpunkte hinaufsteigt.
Man kann allerdings dort nicht Stoff für das, seiner Natur nach, nur
historisch zu behandelnde vergleichende Sprachstudium suchen, man
kann aber nur da die Einsicht in den ursprünglichen Zusammenhang
der Thatsachen und die Durchschauung der Sprache, als eines innerlich
zusammenhängenden Organismus, gewinnen, was alsdann wieder die
richtige Würdigung des Einzelnen befördert.
Die Betrachtung des Zusammenhanges der Sprachverschiedenheit
und Völkervertheilung mit der Erzeugung der menschlichen Geisteskraft,
als einer sich nach und nach in wechselnden Graden und neuen
Gestaltungen entwickelnden, insofern sich diese beiden Erscheinungen
gegenseitig aufzuhellen vermögen, ist dasjenige, was mich in dieser
Schrift beschäftigen wird.
Allgemeine Betrachtung des menschlichen Entwicklungsganges
3. Die genauere Betrachtung des heutigen Zustandes der politischen,
künstlerischen und wissenschaftlichen Bildung führt auf eine lange,
durch viele Jahrhunderte hinlaufende Kette einander gegenseitig bedingender
Ursachen und Wirkungen. Man wird aber bei Verfolgung derselben
bald gewahr, dass darin zwei verschiedenartige Elemente obwalten,
mit welchen die Untersuchung nicht auf gleiche Weise glücklich ist.
Denn indem man einen Theil der fortschreitenden Ursachen und Wirkungen
genügend aus einander zu erklären vermag, so stösst man, wie
dies jeder Versuch einer Culturgeschichte des Menschengeschlechts beweist,
von Zeit zu Zeit gleichsam auf Knoten, welche der weiteren Lösung
widerstehen. Es liegt dies eben in jener geistigen Kraft, die sich in
ihrem Wesen nicht ganz durchdringen und in ihrem Wirken nicht vorher
berechnen lässt. Sie tritt mit dem vor ihr und um sie Gebildeten zusammen,
behandelt und formt es aber nach der in sie gelegten Eigenthümlichkeit.
Von jedem grossen Individuum einer Zeit aus könnte man die
weltgeschichtliche Entwicklung beginnen, auf welcher Grundlage es
aufgetreten ist und wie die Arbeit der vorausgegangenen Jahrhunderte
diese nach und nach aufgebaut hat. Allein die Art, wie dasselbe seine so
bedingte und unterstützte Thätigkeit zu demjenigen gemacht hat, was
sein eigenthümliches Gepräge bildet, lässt sich wohl nachweisen, und
290auch weniger darstellen als empfinden, jedoch nicht wieder aus einem
Anderen ableiten. Es ist dies die natürliche und überall wiederkehrende
Erscheinung des menschlichen Wirkens. Ursprünglich ist alles in ihm
innerlich, die Empfindung, die Begierde, der Gedanke, der Entschluss,
die Sprache und die That. Aber wie das Innerliche die Welt berührt,
wirkt es für sich fort, und bestimmt durch die ihm eigne Gestalt anderes,
inneres oder äusseres Wirken. Es bilden sich in der vorrückenden Zeit
Sicherungsmittel des zuerst flüchtig Gewirkten, und es geht immer weniger
von der Arbeit der verflossenen Jahrhunderte für die folgenden
verloren. Dies ist nun das Gebiet, worin die Forschung Stufe nach Stufe
verfolgen kann. Es ist aber immer zugleich von der Wirkung neuer und
nicht zu berechnender innerlicher Kräfte durchkreuzt, und ohne eine
richtige Absonderung und Erwägung dieses doppelten Elementes, von
welchem der Stoff des einen so mächtig werden kann, dass er die Kraft
des andren zu erdrücken Gefahr droht, ist keine wahre Würdigung des
Edelsten möglich, was die Geschichte aller Zeiten aufzuweisen hat.
Je tiefer man in die Vorzeit hinabsteigt, desto mehr schmilzt natürlich
die Masse des von den auf einander folgenden Geschlechtern fortgetragenen
Stoffes. Man begegnet aber auch dann einer andren, die
Untersuchung gewissermassen auf ein neues Feld versetzenden Erscheinung.
Die sicheren, durch ihre äusseren Lebenslagen bekannten Individuen
stehen seltner und ungewisser vor uns da; ihre Schicksale, ihre
Namen selbst, schwanken, ja es wird ungewiss, ob, was man ihnen zuschreibt,
allein ihr Werk, oder ihr Name nur der Vereinigungspunkt der
Werke Mehrerer ist? sie verlieren sich gleichsam in eine Classe von
Schattengestalten. Dies ist der Fall in Griechenland mit Orpheus und
Homer, in Indien mit Manu, Wyâsa, Wâlmiki, und mit andren gefeierten
Namen des Alterthums. Die bestimmte Individualität schwindet
aber noch mehr, wenn man noch weiter zurückschreitet. Eine so abgerundete
Sprache, wie die Homerische, muss schon lange in den Wogen
des Gesanges hin und her gegangen seyn, schon Zeitalter hindurch, von
denen uns keine Kunde geblieben ist. Noch deutlicher zeigt sich dies an
der ursprünglichen Form der Sprachen selbst. Die Sprache ist tief in die
geistige Entwicklung der Menschheit verschlungen, sie begleitet dieselbe
auf jeder Stufe ihres localen Vor- oder Rückschreitens, und der jedesmalige
Culturzustand wird auch in ihr erkennbar. Es giebt aber eine
Epoche, in der wir nur sie erblicken, wo sie nicht die geistige Entwicklung
bloss begleitet, sondern ganz ihre Stelle einnimmt. Die Sprache
entspringt zwar aus einer Tiefe der Menschheit, welche überall verbietet,
sie als ein eigentliches Werk und als eine Schöpfung der Völker zu
betrachten. Sie besitzt eine sich uns sichtbar offenbarende, wenn auch
in ihrem Wesen unerklärliche, Selbstthätigkeit, und ist, von dieser Seite
betrachtet, kein Erzeugniss der Thätigkeit, sondern eine unwillkührliche
291Emanation des Geistes, nicht ein Werk der Nationen, sondern eine
ihnen durch ihr inneres Geschick zugefallene Gabe. Sie bedienen sich
ihrer, ohne zu wissen, wie sie dieselbe gebildet haben. Demungeachtet
müssen sich die Sprachen doch immer mit und an den aufblühenden
Völkerstämmen entwickelt, aus ihrer Geisteseigenthümlichkeit, die ihnen
manche Beschränkungen aufgedrückt hat, herausgesponnen haben.
Es ist kein leeres Wortspiel, wenn man die Sprache als in Selbstthätigkeit
nur aus sich entspringend und göttlich frei, die Sprachen aber als
gebunden und von den Nationen, welchen sie angehören, abhängig darstellt.
Denn sie sind dann in bestimmte Schranken eingetreten. 12 Indem
Rede und Gesang zuerst frei strömten, bildete sich die Sprache nach
dem Mass der Begeisterung und der Freiheit und Stärke der zusammenwirkenden
Geisteskräfte. Dies konnte aber nur von allen Individuen zugleich
ausgehn, jeder Einzelne musste darin von dem Andren getragen
werden, da die Begeisterung nur durch die Sicherheit, verstanden und
empfunden zu seyn, neuen Aufflug gewinnt. Es eröffnet sich daher hier,
wenn auch nur dunkel und schwach, ein Blick in eine Zeit, wo für uns
die Individuen sich in der Masse der Völker verlieren und wo die Sprache
selbst das Werk der intellectuellen schaffenden Kraft ist.
4. In jeder Ueberschauung der Weltgeschichte liegt ein, auch hier
angedeutetes Fortschreiten. Es ist jedoch keineswegs meine Absicht,
ein System der Zwecke oder bis ins Unendliche gehenden Vervollkommnung
aufzustellen; ich befinde mich vielmehr im Gegentheil hier
auf einem ganz verschiednen Wege. Völker und Individuen wuchern
gleichsam, sich vegetativ, wie Pflanzen, über den Erdboden verbreitend,
und gemessen ihr Daseyn in Glück und Thätigkeit. Dies, mit jedem
Einzelnen hinsterbende Leben geht ohne Rücksicht auf Wirkungen
für die folgenden Jahrhunderte ungestört fort; die Bestimmung der
Natur, dass alles, was athmet, seine Bahn bis zum letzten Hauche vollende,
der Zweck wohlthätig ordnender Güte, dass jedes Geschöpf zum
Genusse seines Lebens gelange, werden erreicht, und jede neue Generation
durchläuft denselben Kreis freudigen oder leidvollen Daseyns,
gelingender oder gehemmter Thätigkeit. Wo aber der Mensch auftritt,
wirkt er menschlich, verbindet sich gesellig, macht Einrichtungen,
giebt sich Gesetze; und wo dies auf unvollkommnere Weise geschehen
ist, verpflanzen das an andren Orten besser Gelungene hinzukommende
Individuen oder Völkerhaufen dahin. So ist mit dem Entstehen
des Menschen auch der Keim der Gesittung gelegt und wächst mit seinem
sich fortentwickelnden Daseyn. Diese Vermenschlichung können
wir in steigenden Fortschritten wahrnehmen, ja es liegt theils in ihrer
Natur selbst, theils in dem Umfange, zu welchem sie schon gediehen
ist, dass ihre weitere Vervollkommnung kaum wesentlich gestört werden
kann.292
In den beiden hier ausgeführten Punkten liegt eine nicht zu verkennende
Planmässigkeit; sie wird auch in andren, wo sie uns nicht auf
diese Weise entgegentritt, vorhanden seyn. Sie darf aber nicht vorausgesetzt
werden, wenn nicht ihr Aufsuchen die Ergründung der Thatsachen
irre führen soll. Dasjenige, wovon wir hier eigentlich reden, lässt
sich am wenigsten ihr unterwerfen. Die Erscheinung der geistigen
Kraft des Menschen in ihrer verschiedenartigen Gestaltung bindet sich
nicht an Fortschritte der Zeit und an Sammlung des Gegebenen. Ihr
Ursprung ist ebenso wenig zu erklären, als ihre Wirkung zu berechnen,
und das Höchste in dieser Gattung ist nicht gerade das Späteste in der
Erscheinung. Will man daher hier den Bildungen der schaffenden Natur
nachspähen, so muss man ihr nicht Ideen unterschieben, sondern
sie nehmen, wie sie sich zeigt. In allen ihren Schöpfungen bringt sie
eine gewisse Zahl von Formen hervor, in welchen sich das ausspricht,
was von jeder Gattung zur Wirklichkeit gediehen ist und zur Vollendung
ihrer Idee genügt. Man kann nicht fragen, warum es nicht mehr
oder andre Formen giebt? es sind nun einmal nicht andre vorhanden, würde
die einzige naturgemässe Antwort seyn. Man kann aber nach
dieser Ansicht, was in der geistigen und körperlichen Natur lebt, als die
Wirkung einer zum Grunde liegenden, sich nach uns unbekannten
Bedingungen entwickelnden Kraft ansehen. Wenn man nicht auf alle
Entdeckung eines Zusammenhanges der Erscheinungen im Menschengeschlecht
Verzicht leisten will, muss man doch auf irgend eine selbstständige
und ursprüngliche, nicht selbst wieder bedingt und vorübergehend
erscheinende Ursach zurückkommen. Dadurch aber wird man am
natürlichsten auf ein inneres, sich in seiner Fülle frei entwickelndes Lebensprincip
geführt, dessen einzelne Entfaltungen darum nicht in sich
unverknüpft sind, weil ihre äusseren Erscheinungen isolirt dastehen.
Diese Ansicht ist gänzlich von der der Zwecke verschieden, da sie nicht
nach einem gesteckten Ziele hin, sondern von einer, als unergründlich
anerkannten Ursach ausgeht. Sie nun ist es, welche mir allein auf die
verschiedenartige Gestaltung der menschlichen Geisteskraft anwendbar
scheint, da, wenn es erlaubt ist so abzutheilen, durch die Kräfte der
Natur und das gleichsam mechanische Fortbilden der menschlichen
Thätigkeit die gewöhnlichen Forderungen der Menschheit befriedigend
erfüllt werden, aber das durch keine eigentlich genügende Herleitung
erklärbare Auftauchen grösserer Individualität in Einzelnen und in Völkermassen
dann wieder plötzlich und unvorhergesehen in jenen sichtbarer
durch Ursach und Wirkung bedingten Weg eingreift.
Dieselbe Ansicht ist nun natürlich gleich anwendbar auf die Hauptwirksamkeiten
der menschlichen Geisteskraft, namentlich, wobei wir
hier stehen bleiben wollen, auf die Sprache. Ihre Verschiedenheit lässt
sich als das Streben betrachten, mit welchem die in den Menschen allgemein
293gelegte Kraft der Rede, begünstigt oder gehemmt durch die den
Völkern beiwohnende Geisteskraft, mehr oder weniger glücklich hervorbricht.
Denn wenn man die Sprachen genetisch, als eine auf einen bestimmten
Zweck gerichtete Geistesarbeit betrachtet, so fällt es von selbst in
die Augen, dass dieser Zweck in minderem oder höherem Grade erreicht
werden kann, ja es zeigen sich sogar die verschiedenen Hauptpunkte,
in welchen diese Ungleichheit der Erreichung des Zweckes bestehen
wird. Das bessere Gelingen kann nemlich in der Stärke und Fülle
der auf die Sprache wirkenden Geisteskraft überhaupt, dann aber auch
in der besonderen Angemessenheit derselben zur Sprachbildung liegen,
also z. B. in der besonderen Klarheit und Anschaulichkeit der Vorstellungen,
in der Tiefe der Eindringung in das Wesen eines Begriffs, um
aus demselben gleich das am meisten bezeichnende Merkmal loszureissen,
in der Geschäftigkeit und der schaffenden Stärke der Phantasie,
in dem richtig empfundenen Gefallen an Harmonie und Rhythmus der
Töne, wohin also auch Leichtigkeit und Gewandtheit der Lautorgane
und Schärfe und Feinheit des Ohres gehören. Ferner aber ist auch die
Beschaffenheit des überkommenen Stoffs und der geschichtlichen Mitte
zu beachten, in welcher sich, zwischen einer auf sie einwirkenden Vorzeit
und den in ihr selbst ruhenden Keimen fernerer Entwicklung, eine
Nation in der Epoche einer bedeutenden Sprachumgestaltung befindet.
Es giebt auch Dinge in den Sprachen, die sich in der That nur nach dem
auf sie gerichteten Streben, nicht gleich gut nach den Erfolgen dieses
Strebens beurtheilen lassen. Denn nicht immer gelingt es den Sprachen,
ein, auch noch so klar in ihnen angedeutetes Streben vollständig durchzuführen.
Hierhin gehört z. B. die ganze Frage über Flexion und Agglutination,
über welche sehr viel Misverständniss geherrscht hat und noch
fortwährend herrscht. Dass nun Nationen von glücklicheren Gaben und
unter günstigeren Umständen vorzüglichere Sprachen, als andere, besitzen,
liegt in der Natur der Sache selbst. Wir werden aber auch auf die
eben angeregte tiefer liegende Ursach geführt. Die Hervorbringung der
Sprache ist ein inneres Bedürfniss der Menschheit, nicht bloss ein äusserliches
zur Unterhaltung gemeinschaftlichen Verkehrs, sondern ein
in ihrer Natur selbst liegendes, zur Entwicklung ihrer geistigen Kräfte
und zur Gewinnung einer Weltanschauung, zu welcher der Mensch nur
gelangen kann, indem er sein Denken an dem gemeinschaftlichen Denken
mit Anderen zur Klarheit und Bestimmtheit bringt, unentbehrliches.
Sieht man nun, wie man kaum umhin kann zu thun, jede Sprache
als einen Versuch, und wenn man die Reihe aller Sprachen zusammennimmt,
als einen Beitrag zur Ausfüllung dieses Bedürfnisses an; so lässt
sich wohl annehmen, dass die sprachbildende Kraft in der Menschheit
nicht ruht, bis sie, sey es einzeln, sey es im Ganzen, das hervorgebracht
294hat, was den zu machenden Forderungen am meisten und am vollständigsten
entspricht. Es kann sich also, im Sinne dieser Voraussetzung,
auch unter Sprachen und Sprachstämmen, welche keinen geschichtlichen
Zusammenhang verrathen, ein stufenweis verschiednes Vorrücken
des Princips ihrer Bildung auffinden lassen. Wenn dies aber der Fall
ist, so muss dieser Zusammenhang äusserlich nicht verbundener Erscheinungen
in einer allgemeinen inneren Ursach liegen, welche nur die
Entwicklung der wirkenden Kraft seyn kann. Die Sprache ist eine der
Seiten, von welchen aus die allgemeine menschliche Geisteskraft in beständig
thätige Wirksamkeit tritt. Anders ausgedrückt, erblickt man
darin das Streben, der Idee der Sprachvollendung Daseyn in der Wirklichkeit
zu gewinnen. Diesem Streben nachzugehen und dasselbe darzustellen,
ist das Geschäft des Sprachforschers in seiner letzten, aber
einfachsten Auflösung. 13 Das Sprachstudium bedarf übrigens dieser,
vielleicht zu hypothetisch scheinenden Ansicht durchaus nicht als einer
Grundlage. Allein es kann und muss dieselbe als eine Anregung benutzen,
zu versuchen, ob sich in den Sprachen ein solches stufenweis fortschreitendes
Annähern an die Vollendung ihrer Bildung entdecken
lässt. Es könnte nemlich eine Reihe von Sprachen einfacheren und zusammengesetzteren
Baues geben, welche, bei der Vergleichung mit einander,
in den Principien ihrer Bildung eine fortschreitende Annäherung
an die Erreichung des gelungensten Sprachbaues verriethen. Der Organismus
dieser Sprachen müsste dann, selbst bei verwickelten Formen,
in Consequenz und Einfachheit die Art ihres Strebens nach Sprachvollendung
leichter erkennbar, als es in andren der Fall ist, an sich tragen.
Das Fortschreiten auf diesem Wege würde sich in solchen Sprachen
vorzüglich zuerst in der Geschiedenheit und vollendeten Articulation
ihrer Laute, daher in der davon abhängigen Bildung der Sylben, der
reinen Sonderung derselben in ihre Elemente, und im Baue der einfachsten
Wörter finden; ferner in der Behandlung der Wörter, als Lautganze,
um dadurch wirkliche Worteinheit, entsprechend der Begriffseinheit,
zu erhalten; endlich in der angemessnen Scheidung desjenigen,
was in der Sprache selbstständig und was nur, als Form, am Selbstständigen
erscheinen soll, wozu natürlich ein Verfahren erfordert wird, das
in der Sprache bloss an einander Geheftete von dem symbolisch Verschmolznen
zu unterscheiden. Auch hierin gehe ich, aus den eben angegebenen
Gründen, nicht näher ein, sondern wünsche nur, dass man an
den eben aufgestellten Gesichtspunkten diejenigen erkennen möge,
welche mich auch bei der gleich jetzt vorzunehmenden Bestimmung des
Standpunktes des Kawi im Malayischen Sprachstamme geleitet haben.
In dieser Betrachtung der Sprachen sondre ich aber die Veränderungen,
die sich in jeder, ihren Schicksalen nach, aus einander entwickeln lassen,
gänzlich von ihrer für uns ersten, ursprünglichen Form ab. Der
295Kreis dieser Urformen scheint geschlossen zu seyn, und in der Lage, in
der wir die Entwicklung der menschlichen Kräfte jetzt finden, nicht
wiederkehren zu können. Denn so innerlich auch die Sprache durchaus
ist, so hat sie dennoch zugleich ein unabhängiges, äusseres, gegen den
Menschen selbst Gewalt ausübendes Daseyn. Die Entstehung solcher
Urformen würde daher eine Geschiedenheit der Völker voraussetzen,
die sich jetzt, und vorzüglich verbunden mit regerer Geisteskraft, nicht
mehr denken lässt, wenn auch nicht, was noch wahrscheinlicher ist,
dem Hervorbrechen neuer Sprachen überhaupt eine bestimmte Epoche
im Menschengeschlechte, wie im einzelnen Menschen, angewiesen war.
Einwirkung ausserordentlicher Geisteskraft, Civilisation,
Cultur und Bildung
6. Die aus ihrer inneren Tiefe und Fülle in den Lauf der Weltbegebenheiten
eingreifende Geisteskraft ist das wahrhaft schaffende Princip in
dem verborgenen und gleichsam geheimnissvollen Entwicklungsgange
der Menschheit, von dem ich oben, im Gegensatz mit dem offenbaren,
sichtbar durch Ursach und Wirkung verketteten gesprochen habe. Es ist
die ausgezeichnete, den Begriff menschlicher Intellectualität erweiternde
Geisteseigenthümlichkeit, welche unerwartet und in dem Tiefsten
ihrer Erscheinung unerklärbar hervortritt. Sie unterscheidet sich besonders
dadurch, dass ihre Werke nicht bloss Grundlagen werden, auf die
man fortbauen kann, sondern zugleich den wieder entzündenden
Hauch in sich tragen, der sie erzeugt. Sie pflanzen Leben fort, weil sie
aus vollem Leben hervorgehn. Denn die sie hervorbringende Kraft
wirkt mit der Spannung ihres ganzen Strebens und in ihrer vollen Einheit,
zugleich aber wahrhaft schöpferisch, ihr eignes Erzeugen als ihr
selbst unerklärliche Natur betrachtend; sie hat nicht bloss zufällig Neues
ergriffen oder bloss an bereits Bekanntes angeknüpft. So entstand die
Aegyptische plastische Kunst, der es gelang, die menschliche Gestalt
aus dem organischen Mittelpunkt ihrer Verhältnisse heraus aufzubauen,
und die dadurch zuerst ihren Werken das Gepräge ächter Kunst aufdrückte.
In dieser Art tragen, bei sonst naher Verwandtschaft, Indische
Poesie und Philosophie und das classische Alterthum einen verschiednen
Charakter an sich, und in dem letzteren wiederum Griechische und
Römische Denkweise und Darstellung. Ebenso entsprang in späterer
Zeit aus der Romanischen Poesie und dem geistigen Leben, das sich mit
dem Untergange der Römischen Sprache plötzlich in dem nun selbstständig
gewordenen Europäischen Abendland entwickelte, der hauptsächlichste
Theil der modernen Bildung. Wo solche Erscheinungen
nicht auftraten, oder durch widrige Umstände erstickt wurden, da vermochte
296auch das Edelste, einmal in seinem natürlichen Gange gehemmt,
nicht wieder grosses Neues zu gestalten, wie wir es an der Griechischen
Sprache und so vielen Ueberresten Griechischer Kunst in dem
Jahrhunderte lang, ohne seine Schuld, in Barbarei gehaltenen Griechenland
sehen. Die alte Form der Sprache wird dann zerstückt und mit
Fremdem vermischt, ihr wahrer Organismus zerfällt, und die gegen ihn
andringenden Kräfte vermögen nicht, ihn zum Beginnen einer neuen
Bahn umzuformen und ihm ein neu begeisterndes Lebensprincip einzuhauchen.
Zur Erklärung aller solcher Erscheinungen lassen sich begünstigende
und hemmende, vorbereitende und verzögernde Umstände
nachweisen. Der Mensch knüpft immer an Vorhandenes an. Bei jeder
Idee, deren Entdeckung oder Ausführung dem menschlichen Bestreben
einen neuen Schwung verleiht, lässt sich durch scharfsinnige und sorgfältige
Forschung zeigen, wie sie schon früher und nach und nach wachsend
in den Köpfen vorhanden gewesen. Wenn aber der anfachende
Odem des Genies in Einzelnen oder Völkern fehlt, so schlägt das Helldunkel
dieser glimmenden Kohlen nie in leuchtende Flammen auf. Wie
wenig auch die Natur dieser schöpferischen Kräfte sie eigentlich zu
durchschauen gestattet, so bleibt doch soviel offenbar, dass in ihnen
immer ein Vermögen obwaltet, den gegebenen Stoff von innen heraus
zu beherrschen, in Ideen zu verwandeln oder Ideen unterzuordnen.
Schon in seinen frühesten Zuständen geht der Mensch über den Augenblick
der Gegenwart hinaus und bleibt nicht bei bloss sinnlichem Genusse.
Bei den rohesten Völkerhorden finden sich Liebe zum Putz,
Tanz, Musik und Gesang, dann aber auch Ahndungen überirdischer
Zukunft, darauf gegründete Hoffnungen und Besorgnisse, Ueberlieferungen
und Mährchen, die gewöhnlich bis zur Entstehung des Menschen
und seines Wohnsitzes hinabsteigen. Je kräftiger und heller die
nach ihren Gesetzen und Anschauungsformen selbstthätig wirkende
Geisteskraft ihr Licht in diese Welt der Vorzeit und Zukunft ausgiesst,
mit welcher der Mensch sein augenblickliches Daseyn umgiebt, desto
reiner und mannigfaltiger zugleich gestaltet sich die Masse. So entsteht
die Wissenschaft und die Kunst, und immer ist daher das Ziel des sich
entwickelnden Fortschreitens des Menschengeschlechts die Verschmelzung
des aus dem Innern selbstthätig Erzeugten mit dem von aussen
Gegebenen, jedes in seiner Reinheit und Vollständigkeit aufgefasst und
in der Unterordnung verbunden, welche das jedesmalige Bestreben, seiner
Natur nach, erheischt.
Wie wir aber hier die geistige Individualität als etwas Vorzügliches
und Ausgezeichnetes dargestellt haben, so kann und so muss man sogar
dieselbe, auch wo sie die höchste Stufe ereicht hat, doch zugleich
wieder als eine Beschränkung der allgemeinen Natur, eine Bahn, in welche
der Einzelne eingezwängt ist, ansehen, da jede Eigenthümlichkeit
297dies nur durch ein vorherrschendes und daher ausschliessendes Princip
zu seyn vermag. Aber gerade auch durch die Einengung wird die Kraft
erhöht und gespannt, und die Ausschliessung kann dennoch dergestalt
von einem Princip der Totalität geleitet werden, dass mehrere solche
Eigenthümlichkeiten sich wieder in ein Ganzes zusammenfügen. Hierauf
beruht in ihren innersten Gründen jede höhere Menschenverbindung
in Freundschaft, Liebe oder grossartigem, dem Wohl des Vaterlandes
und der Menschheit gewidmeten Zusammenstreben. Ohne die
Betrachtung weiter zu verfolgen, wie gerade die Beschränkung der Individualität
dem Menschen den einzigen Weg eröffnet, der unerreichbaren
Totalität immer näher zu kommen, genügt es mir hier, nur darauf
aufmerksam zu machen, dass die Kraft, die den Menschen eigentlich
zum Menschen macht, und also die schlichte Definition seines Wesens
ist, in ihrer Berührung mit der Welt, in dem, wenn der Ausdruck erlaubt
ist, vegetativen und sich auf gegebener Bahn gewissermassen mechanisch
fortentwickelnden Leben des Menschengeschlechts, in einzelnen
Erscheinungen sich selbst und ihre vielfältigen Bestrebungen in
neuen, ihren Begriff erweiternden Gestalten offenbart. So war z. B. die
Erfindung der Algebra eine solche neue Gestaltung in der mathematischen
Richtung des menschlichen Geistes, und so lassen sich ähnliche
Beispiele in jeder Wissenschaft und Kunst nachweisen. In der Sprache
werden wir sie weiter unten ausführlicher aufsuchen.
Sie beschränken sich aber nicht bloss auf die Denk- und Darstellungsweise,
sondern finden sich auch ganz vorzüglich in der Charakterbildung.
Denn was aus dem Ganzen der menschlichen Kraft hervorgeht,
darf nicht ruhen, ehe es nicht wieder in die ganze zurückkehrt,
und die Gesammtheit der inneren Erscheinung, Empfindung und Gesinnung,
verbunden mit der von ihr durchstrahlten äusseren, muss
wahrnehmen lassen, dass sie, vom Einflüsse jener erweiterten einzelnen
Bestrebungen durchdrungen, auch die ganze menschliche Natur in erweiterter
Gestalt offenbart. Gerade daraus entspringt die allgemeinste
und das Menschengeschlecht am würdigsten emporhebende Wirkung.
Gerade die Sprache aber, der Mittelpunkt, in welchem sich die verschiedensten
Individualitäten durch Mittheilung äusserer Bestrebungen und
innerer Wahrnehmungen vereinigen, steht mit dem Charakter in der
engsten und regsten Wechselwirkung. Die kraftvollsten und die am leisesten
berührbaren, die eindringendsten und die am fruchtbarsten in
sich lebenden Gemüther giessen in sie ihre Stärke und Zartheit, ihre
Tiefe und Innerlichkeit, und sie schickt zur Fortbildung der gleichen
Stimmungen die verwandten Klänge aus ihrem Schoosse herauf. Der
Charakter, je mehr er sich veredelt und verfeinert, ebnet und vereinigt
die einzelnen Seiten des Gemüths und giebt ihnen, gleich der bildenden
Kunst, eine in ihrer Einheit zu fassende, aber den jedesmaligen Umriss
298immer reiner aus dem Innern hervorbildende Gestalt. Diese Gestaltung
ist aber die Sprache durch die feine, oft im Einzelnen unsichtbare, aber
in ihr ganzes wundervolles symbolisches Gewebe verflochtene Harmonie
darzustellen und zu befördern geeignet. Die Wirkungen der Charakterbildung
sind nur ungleich schwerer zu berechnen, als die der bloss
intellectuellen Fortschritte, da sie grossentheils auf den geheimnissvollen
Einflüssen beruhen, durch welche eine Generation mit der andren
zusammenhängt.
7. Es giebt also in dem Entwicklungsgange des Menschengeschlechts
Fortschritte, die nur erreicht werden, weil eine ungewöhnliche
Kraft unerwartet ihren Aufflug bis dahin nimmt, Fälle, wo man an
die Stelle gewöhnlicher Erklärung der hervorgebrachten Wirkung die
Annahme einer ihr entsprechenden Kraftäusserung setzen muss. Alles
geistige Vorrücken kann nur aus innerer Kraftäusserung hervorgehen,
und hat insofern immer einen verborgenen und, weil er selbstthätig ist,
unerklärlichen Grund. Wenn aber diese innere Kraft plötzlich aus sich
selbst hervor so mächtig schafft, dass sie durch den bisherigen Gang
gar nicht dahin geführt werden konnte, so hört eben dadurch alle Möglichkeit
der Erklärung von selbst auf. Ich wünsche diese Sätze bis zur
Ueberzeugung deutlich gemacht zu haben, weil sie in der Anwendung
wichtig sind. Denn es folgt nun von selbst, dass, wo sich gesteigerte
Erscheinungen derselben Bestrebung wahrnehmen lassen, wenn es
nicht die Thatsachen unabweislich verlangen, kein allmähliches Fortschreiten
vorausgesetzt werden darf, da jede bedeutende Steigerung
vielmehr einer eigenthümlich schaffenden Kraft angehört. Ein Beispiel
kann der Bau der Chinesischen und der Sanskrit-Sprache liefern. Es
liesse sich wohl hier ein allmählicher Fortgang von dem einen zum andren
denken. Wenn man aber das Wesen der Sprache überhaupt und
dieser beiden insbesondere wahrhaft fühlt, wenn man bis zu dem
Punkte der Verschmelzung des Gedanken mit dem Laute in beiden vordringt,
so entdeckt man in ihm das von innen heraus schaffende Princip
ihres verschiednen Organismus. Man wird alsdann, die Möglichkeit
allmählicher Entwicklung einer aus der andren aufgebend, jeder
ihren eignen Grund in dem Geiste der Volksstämme anweisen, und nur
in dem allgemeinen Triebe der Sprachentwicklung, also nur ideal sie
als Stufen gelungener Sprachbildung betrachten. Durch die Verabsäumung
der hier aufgestellten sorgfältigen Trennung des zu berechnenden
stufenartigen und des nicht vorauszusehenden unmittelbar schöpferischen
Fortschreitens der menschlichen Geisteskraft verbannt man
ganz eigentlich aus der Weltgeschichte die Wirkungen des Genies, das
sich ebensowohl in einzelnen Momenten in Völkern, als in Individuen
offenbart.
Man läuft aber auch Gefahr, die verschiednen Zustände der menschlichen
299Gesellschaft unrichtig zu würdigen. So wird der Civilisation und
der Cultur oft zugeschrieben, was aus ihnen durchaus nicht hervorgehen
kann, sondern durch eine Kraft gewirkt wird, welcher sie selbst ihr
Daseyn verdanken.
In Absicht der Sprachen ist es eine ganz gewöhnliche Vorstellung,
alle ihre Vorzüge und jede Erweiterung ihres Gebiets ihnen beizumessen,
gleichsam als käme es nur auf den Unterschied gebildeter und ungebildeter
Sprachen an. Zieht man die Geschichte zu Rathe, so bestätigt
sich eine solche Macht der Civilisation und Cultur über die Sprache
keinesweges. Java erhielt höhere Civilisation und Cultur offenbar von
Indien aus, und beide in bedeutendem Grade, aber darum änderte die
einheimische Sprache nicht ihre unvollkommnere und den Bedürfnissen
des Denkens weniger angemessne Form, sondern beraubte vielmehr
das so ungleich edlere Sanskrit der seinigen, um es in die ihrige zu
zwängen. Auch Indien selbst, mochte es noch so früh und nicht durch
fremde Mittheilung civilisirt seyn, erhielt seine Sprache nicht dadurch,
sondern das tief aus dem ächtesten Sprachsinn geschöpfte Princip derselben
floss, wie jene Civilisation selbst, aus der genialischen Geistesrichtung
des Volks. Darum stehen auch Sprache und Civilisation durchaus
nicht immer im gleichen Verhältniss zu einander. Peru war, welchen
Zweig seiner Einrichtungen unter den Incas man betrachten mag, leicht
das am meisten civilisirte Land in Amerika; gewiss wird aber kein
Sprachkenner der allgemeinen Peruanischen Sprache, die man durch
Kriege und Eroberungen auszubreiten versuchte, ebenso den Vorzug
vor den übrigen des neuen Welttheils einräumen. Sie steht namentlich
der Mexicanischen, meiner Ueberzeugung zufolge, bedeutend nach.
Auch angeblich rohe und ungebildete Sprachen können hervorstechende
Trefflichkeiten in ihrem Baue besitzen und besitzen dieselben wirklich,
und es wäre nicht unmöglich, dass sie darin höher gebildete überträfen.
Schon die Vergleichung der Barmanischen, in welche das Pali
unläugbar einen Theil Indischer Cultur verwebt hat, mit der Delaware-Sprache,
geschweige denn mit der Mexicanischen, dürfte das Urtheil
über den Vorzug der letzteren kaum zweifelhaft lassen.
Die Sache ist aber zu wichtig, um sie nicht näher und aus ihren innren
Gründen zu erörtern. Insofern Civilisation und Cultur den Nationen
ihnen vorher unbekannte Begriffe aus der Fremde zuführen oder aus
ihrem Innren entwickeln, ist jene Ansicht auch von einer Seite unläugbar
richtig. Das Bedürfniss eines Begriffs und seine daraus entstehende
Verdeutlichung muss immer dem Worte, das bloss der Ausdruck seiner
vollendeten Klarheit ist, vorausgehn. Wenn man aber bei dieser Ansicht
einseitig stehen bleibt und die Unterschiede in den Vorzügen der Sprachen
allein auf diesem Wege zu entdecken glaubt, so verfällt man in einen,
der wahren Beurtheilung der Sprache verderblichen Irrthum. Es ist
300schon an sich sehr mislich, den Kreis der Begriffe eines Volks in einer
bestimmten Epoche aus seinem Wörterbuche beurtheilen zu wollen.
Ohne hier die offenbare Unzweckmässigkeit zu rügen, dies nach den
unvollständigen und zufälligen Wörtersammlungen zu versuchen, die
wir von so vielen Ausser-Europäischen Nationen besitzen, muss es
schon von selbst in die Augen fallen, dass eine grosse Zahl, besonders
unsinnlicher Begriffe, auf die sich jene Behauptungen vorzugsweise beziehen,
durch uns ungewöhnliche und daher unbekannte Metaphern
oder auch durch Umschreibungen ausgedrückt seyn können. Es liegt
aber, und dies ist hier bei weitem entscheidender, auch sowohl in den
Begriffen, als in der Sprache jedes, noch so ungebildeten Volkes eine,
dem Umfange der unbeschränkten menschlichen Bildungsfähigkeit entsprechende
Totalität, aus welcher sich alles Einzelne, was die Menschheit
umfasst, ohne fremde Beihülfe, schöpfen lässt; und man kann der
Sprache nicht fremd nennen, was die auf diesen Punkt gerichtete Aufmerksamkeit
unfehlbar in ihrem Schoosse antrifft. Einen factischen Beweis
hiervon liefern solche Sprachen uncultivirter Nationen, welche,
wie z. B. die Philippinischen und Amerikanischen, lange von Missionarien
bearbeitet worden sind. Auch sehr abstracte Begriffe findet man in
ihnen, ohne die Hinzukunft fremder Ausdrücke, bezeichnet. Es wäre allerdings
interessant, zu wissen, wie die Eingebornen diese Wörter verstehen.
Da sie aber aus Elementen ihrer Sprache gebildet sind, so müssen
sie nothwendig mit ihnen irgend einen analogen Sinn verbinden.
Worin jedoch jene eben erwähnte Ansicht hauptsächlich irre führt, ist,
dass sie die Sprache viel zu sehr als ein räumliches, gleichsam durch
Eroberungen von aussen her zu erweiterndes Gebiet betrachtet und dadurch
ihre wahre Natur in ihrer wesentlichsten Eigenthümlichkeit verkennt.
Es kommt nicht gerade darauf an, wie viele Begriffe eine Sprache
mit eignen Wörtern bezeichnet. Dies findet sich von selbst, wenn sie
sonst den wahren, ihr von der Natur vorgezeichneten Weg verfolgt, und
es ist nicht dies die Seite, von welcher sie zuerst beurtheilt werden
muss. Ihre eigentliche und wesentliche Wirksamkeit im Menschen geht
auf seine denkende und im Denken schöpferische Kraft selbst und ist in
viel tieferem Sinne immanent und constitutiv. Ob und inwiefern sie die
Deutlichkeit und richtige Anordnung der Begriffe befördert oder ihr
Schwierigkeiten in den Weg legt? den aus der Weltansicht in die Sprache
übergetragenen Vorstellungen die ihnen beiwohnende sinnliche
Anschaulichkeit erhält? durch den Wohllaut ihrer Töne harmonisch
und besänftigend, und wieder energisch und erhebend auf die Empfindung
und die Gesinnung einwirkt? darin und in vielen andren solchen
Stimmungen der ganzen Denkweise und Sinnesart liegt dasjenige, was
ihre wahren Vorzüge ausmacht und ihren Einfluss auf die Geistesentwicklung
bestimmt. Dies aber beruht auf der Gesammtheit ihrer ursprünglichen
301Anlagen, auf ihrem organischen Bau, ihrer individuellen
Form. Auch hieran gehen die selbst erst spät eintretende Civilisation
und Cultur nicht fruchtlos vorüber. Durch den Gebrauch zum Ausdruck
erweiterter und veredelter Ideen gewinnt die Deutlichkeit und
die Präcision der Sprache, die Anschaulichkeit läutert sich in einer auf
höhere Stufe gestiegenen Phantasie, und der Wohllaut gewinnt vor dem
Urtheile und den erhöhten Forderungen eines geübteren Ohrs. Allein
dies ganze Fortschreiten gesteigerter Sprachbildung kann sich nur in
den Gränzen fortbewegen, welche ihr die ursprüngliche Sprachanlage
vorschreibt. Eine Nation kann eine unvollkommnere Sprache zum
Werkzeuge einer Ideenerzeugung machen, zu welcher sie die ursprüngliche
Anregung nicht gegeben haben würde, sie kann aber die inneren
Beschränkungen nicht aufheben, die einmal tief in ihr gegründet sind.
Insofern bleibt auch die höchste Ausbildung unwirksam. Selbst was die
Folgezeit von aussen hinzufügt, eignet sich die ursprüngliche Sprache
an und modificirt es nach ihren Gesetzen.
Von dem Standpunkt der innren Geisteswürdigung aus kann man
auch Civilisation und Cultur nicht als den Gipfel ansehen, zu welchem
der menschliche Geist sich zu erheben vermag. Beide sind in der neuesten
Zeit bis auf den höchsten Punkt und zu der grössten Allgemeinheit
gediehen. Ob aber darum zugleich die innere Erscheinung der menschlichen
Natur, wie wir sie z. B. in einigen Epochen des Alterthums erblicken,
auch gleich häufig und mächtig oder gar in gesteigerten Graden
zurückgekehrt ist? dürfte man schon schwerlich mit gleicher Sicherheit
behaupten wollen, und noch weniger, ob dies gerade in den Nationen
der Fall gewesen ist, welchen die Verbreitung der Civilisation und einer
gewissen Cultur am meisten verdankt?
Die Civilisation ist die Vermenschlichung der Völker in ihren äusseren
Einrichtungen und Gebräuchen und der darauf Bezug habenden
innren Gesinnung. Die Cultur fügt dieser Veredlung des gesellschaftlichen
Zustandes Wissenschaft und Kunst hinzu. Wenn wir aber in unsrer
Sprache Bildung sagen, so meinen wir damit etwas zugleich Höheres
und mehr Innerliches, nemlich die Sinnesart, die sich aus der Erkenntniss
und dem Gefühle des gesammten geistigen und sittlichen Strebens
harmonisch auf die Empfindung und den Charakter ergiesst.
Die Civilisation kann aus dem Inneren eines Volkes hervorgehen und
zeugt alsdann von jener, nicht immer erklärbaren Geisteserhebung.
Wenn sie dagegen aus der Fremde in eine Nation verpflanzt wird, verbreitet
sie sich schneller, durchdringt auch vielleicht mehr alle Verzweigungen
des geselligen Zustandes, wirkt aber auf Geist und Charakter
nicht gleich energisch zurück. Es ist ein schönes Vorrecht der neuesten
Zeit, die Civilisation in die entferntesten Theile der Erde zu tragen, dies
Bemühen an jede Unternehmung zu knüpfen und hierauf, auch fern von
302andren Zwecken, Kraft und Mittel zu verwenden. Das hierin waltende
Princip allgemeiner Humanität ist ein Fortschritt, zu dem sich erst unsre
Zeit wahrhaft emporgeschwungen hat, und alle grossen Erfindungen
der letzten Jahrhunderte streben dahin zusammen, es zur Wirklichkeit
zu bringen. Die Colonien der Griechen und Römer waren hierin weit weniger
wirksam. Es lag dies allerdings in der Entbehrung so vieler äusserer
Mittel der Länderverknüpfung und der Civilisirung selbst. Es fehlte
ihnen aber auch das innre Princip, aus dem allein diesem Streben das
wahre Leben erwachsen kann. Sie besassen einen klaren und tief in ihre
Empfindung und Gesinnung verwebten Begriff hoher und edler
menschlicher Individualität; aber der Gedanke, den Menschen bloss
darum zu achten, weil er Mensch ist, hatte nie Geltung in ihnen erhalten,
und noch viel weniger das Gefühl daraus entspringender Rechte
und Verpflichtungen. Dieser wichtige Theil allgemeiner Gesittung war
dem Gange ihrer zu nationellen Entwicklung fremd geblieben. Selbst in
ihren Colonien vermischten sie sich wohl weniger mit den Eingebornen,
als sie dieselben nur aus ihren Gränzen zurückdrängten; aber ihre
Pflanzvölker selbst bildeten sich in den veränderten Umgebungen verschieden
aus, und so entstanden, wie wir an GrossGriechenland, Sicilien
und Iberien sehen, in entfernten Ländern neue Völkergestaltungen
in Charakter, politischer Gesinnung und wissenschaftlicher Entwicklung.
Ganz vorzugsweise verstanden es die Indier, die eigne Kraft der
Völker, denen sie sich beigesellten, anzufachen und fruchtbar zu machen.
Der Indische Archipel und gerade Java geben uns hiervon einen
merkwürdigen Beweis. Denn wir sehen da, indem wir auf Indisches
stossen, auch gewöhnlich, wie das Einheimische sich dessen bemächtigte
und darauf fortbaute. Zugleich mit ihren vollkommneren äusseren
Einrichtungen, ihrem grösseren Reichthum an Mitteln zu erhöhetem
Lebensgenuss, ihrer Kunst und Wissenschaft, trugen die Indischen Ansiedler
auch den lebendigen Hauch in die Fremde hinüber, durch dessen
beseelende Kraft sich bei ihnen selbst alles dies erst gestaltet hatte. Alle
einzelnen geselligen Bestrebungen waren bei den Alten noch nicht so
geschieden, als bei uns; sie konnten, was sie besassen, viel weniger ohne
den Geist mittheilen, der es geschaffen hatte. Weil sich dies jetzt bei uns
durchaus anders verhält, und eine in unsrer eignen Civilisation liegende
Gewalt uns immer bestimmter in dieser Richtung forttreibt, so bekommen
unter unserem Einfluss die Völker eine viel gleichförmigere Gestalt,
und die Ausbildung der originellen Volkseigenthümlichkeit wird
oft, auch da, wo sie vielleicht statt gefunden hätte, im Aufkeimen erstickt.303
Zusammenwirken der Individuen und Nationen
8. Wir haben in dem Ueberblick der geistigen Entwicklung des Menschengeschlechts
bis hierher dieselbe in ihrer Folge durch die verschiednen
Generationen hindurch betrachtet und darin vier sie hauptsächlich
bestimmende Momente bezeichnet: das ruhige Leben der
Völker nach den natürlichen Verhältnissen ihres Daseyns auf dem Erdboden,
ihre bald durch Absicht geleitete oder aus Leidenschaft und innerem
Drange entspringende, bald ihnen gewaltsam abgenöthigte Thätigkeit
in Wanderungen, Kriegen u. s. f., die Reihe geistiger Fortschritte,
welche sich gegenseitig als Ursachen und Wirkungen an einander ketten,
endlich die geistigen Erscheinungen, die nur in der Kraft ihre Erklärung
finden, die sich in ihnen offenbart. Es bleibt uns jetzt die zweite
Betrachtung, wie jene Entwicklung in jeder einzelnen Generation bewirkt
wird, welche den Grund ihres jedesmaligen Fortschrittes enthält.
Die Wirksamkeit des Einzelnen ist immer eine abgebrochene, aber,
dem Anschein nach und bis auf einen gewissen Punkt auch in Wahrheit,
eine sich mit der des ganzen Geschlechts in derselben Richtung bewegende,
da sie, als bedingt und wieder bedingend, in ungetrenntem Zusammenhange
mit der vergangenen und nachfolgenden Zeit steht. In
andrer Rücksicht aber und ihrem tiefer durchschauten Wesen nach, ist
die Richtung des Einzelnen gegen die des ganzen Geschlechts doch eine
divergirende, so dass das Gewebe der Weltgeschichte, insofern sie den
innren Menschen betrifft, aus diesen beiden, einander durchkreuzenden,
aber zugleich sich eng verkettenden Richtungen besteht. Die Divergenz
ist unmittelbar daran sichtbar, dass die Schicksale des Geschlechts,
unabhängig von dem Hinschwinden der Generationen,
ungetrennt fortgehen, wechselnd, aber, soviel wir es übersehen können,
doch im Ganzen in steigender Vollkommenheit, der Einzelne dagegen
nicht bloss und oft unerwartet mitten in seinem bedeutendsten Wirken
von allem Antheil an jenen Schicksalen ausscheidet, sondern auch darum,
seinem inneren Bewusstseyn, seinen Ahndungen und Ueberzeugungen
nach, doch nicht am Ende seiner Laufbahn zu stehen glaubt. Er
sieht also diese als von dem Gange jener Schicksale abgesondert an,
und es entsteht in ihm, auch schon im Leben, ein Gegensatz der Selbstbildung
und derjenigen Weltgestaltung, mit der jeder in seinem Kreise
in die Wirklichkeit eingreift. Dass dieser Gegensatz weder der Entwicklung
des Geschlechts noch der individuellen Bildung verderblich werde,
verbürgt die Einrichtung der menschlichen Natur. Die Selbstbildung
kann nur an der Weltgestaltung fortgehen, und über sein Leben hinaus
knüpfen den Menschen Bedürfnisse des Herzens und Bilder der Phantasie,
Familienbande, Streben nach Ruhm, freudige Aussicht auf die Entwicklung
gelegter Keime in folgenden Zeiten an die Schicksale, die er
304verlässt. Es bildet sich aber durch jenen Gegensatz, und liegt demselben
sogar ursprünglich zum Grunde eine Innerlichkeit des Gemüths, auf
welcher die mächtigsten und heiligsten Gefühle beruhen. Sie wirkt um
so eingreifender, als der Mensch nicht bloss sich, sondern alle seines
Geschlechts als ebenso bestimmt zur einsamen, sich über das Leben
hinaus erstreckenden Selbstentwicklung betrachtet, und als dadurch
alle Bande, die Gemüth an Gemüth knüpfen, eine andre und höhere
Bedeutung gewinnen. Aus den verschiednen Graden, zu welchen sich
jene, das Ich, auch selbst in der Verknüpfung damit, doch von der Wirklichkeit
absondernde Innerlichkeit erhebt, und aus ihrer mehr oder
minder ausschliesslichen Herrschaft entspringen für alle menschliche
Entwicklung wichtige Nuancen. Indien gerade giebt von der Reinheit,
zu welcher sie sich zu läutern vermag, aber auch von den schroffen
Contrasten, in welche sie ausarten kann, ein merkwürdiges Beispiel,
und das Indische Alterthum lässt sich hauptsächlich von diesem Standpunkte
aus erklären. Auf die Sprache übt diese Seelenstimmung einen
besondren Einfluss. Sie gestaltet sich anders in einem Volke, das gern
die einsamen Wege abgezogenen Nachdenkens verfolgt, und in Nationen,
die des vermittelnden Verständnisses hauptsächlich zu äusserem
Treiben bedürfen. Das Symbolische wird ganz anders von den ersteren
erfasst, und ganze Theile des Sprachgebiets bleiben bei den letzteren
unangebaut. Denn die Sprache muss erst durch ein noch dunkles und
unentwickeltes Gefühl in die Kreise eingeführt werden, über die sie ihr
Licht ausgiessen soll. Wie sich dies hier abbrechende Daseyn der Einzelnen
mit der fortgehenden Entwicklung des Geschlechts vielleicht in
einer uns unbekannten Region vereinigt? bleibt ein undurchdringliches
Geheimniss. Aber die Wirkung des Gefühls dieser Undurchdringlichkeit
ist vorzüglich ein wichtiges Moment in der inneren individuellen
Ausbildung, indem sie die ehrfurchtsvolle Scheu vor etwas Unerkanntem
weckt, das doch nach dem Verschwinden alles Erkennbaren übrigbleibt.
Sie ist dem Eindruck der Nacht vergleichbar, in der auch nur das
einzeln zerstreute Funkeln uns unbekannter Körper an die Stelle alles
gewohnten Sichtbaren tritt.
Sehr bedeutend auch wirkt das Fortgehen der Schicksale des Geschlechts
und das Abbrechen der einzelnen Generationen durch die
verschiedne Geltung, welche dadurch für jede der letzteren die Vorzeit
bekommt. Die später eintretenden befinden sich gleichsam und vorzüglich
durch die Vervollkommnung der die Kunde der Vergangenheit aufbewahrenden
Mittel vor eine Bühne gestellt, auf welcher sich ein reicheres
und heller erleuchtetes Drama entfaltet. Der fortreissende Strom
der Begebenheiten versetzt auch, scheinbar zufällig, Generationen in
dunklere und in verhängnisschwerere, oder in hellere und leichter zu
durchlebende Perioden. Für die wirkliche, lebendige, individuelle Ansicht
305ist dieser Unterschied minder gross, als er in der geschichtlichen
Betrachtung erscheint. Es fehlen viele Punkte der Vergleichung, man
erlebt in jedem Augenblick nur einen Theil der Entwicklung, greift mit
Genuss und Thätigkeit ein, und die Rechte der Gegenwart führen über
ihre Unebenheiten hinweg. Gleich den sich aus Nebel hervorziehenden
Wolken, nimmt ein Zeitalter erst aus der Ferne gesehen eine rings begränzte
Gestalt an. Allein in der Einwirkung, die jedes auf das nachfolgende
ausübt, wird diejenige deutlich, welche es selbst von seiner Vorzeit
erfahren hat. Unsre moderne Bildung z. B. beruht grossentheils auf
dem Gegensatz, in welchem uns das classische Alterthum gegenübersteht.
Es würde schwer und betrübend zu sagen seyn, was von ihr zurückbleiben
möchte, wenn wir uns von Allem trennen sollten, was diesem
Alterthum angehört. Wenn wir den Zustand der Völker, die
dasselbe ausmachten, in allen ihren geschichtlichen Einzelheiten erforschen,
so entsprechen auch sie nicht eigentlich dem Bilde, das wir von
ihnen in der Seele tragen. Was auf uns die mächtige Wirkung ausübt, ist
unsre Auffassung, die von dem Mittelpunkt ihrer grössten und reinsten
Bestrebungen ausgeht, mehr den Geist, als die Wirklichkeit ihrer Einrichtungen
heraushebt, die contrastirenden Punkte unbeachtet lässt
und keine, nicht mit der von ihnen aufgenommenen Idee übereinstimmende
Forderung an sie macht. Zu einer solchen Auffassung ihrer Eigenthümlichkeit
führt aber keine Willkühr. Die Alten berechtigen zu
derselben; sie wäre von keinem andren Zeitalter möglich. Das tiefe Gefühl
ihres Wesens verleiht uns selbst erst die Fähigkeit, uns zu ihr zu
erheben. Weil bei ihnen die Wirklichkeit immer mit glücklicher Leichtigkeit
in die Idee und die Phantasie übergieng und sie mit beiden auf
dieselbe zurückwirkten, so versetzen wir sie mit Recht ausschliesslich
in dies Gebiet. Denn dem, auf ihren Schriften, ihren Kunstwerken und
thatenreichen Bestrebungen ruhenden Geiste nach, beschreiben sie,
wenn auch die Wirklichkeit bei ihnen nicht überall dem entsprach, den
der Menschheit in ihren freiesten Entwicklungen angewiesenen Kreis in
vollendeter Reinheit, Totalität und Harmonie und hinterliessen auf diese
Weise ein auf uns, wie erhöhte Menschennatur, idealisch wirkendes
Bild. Wie zwischen sonnigem und bewölktem Himmel, liegt ihr Vorzug
gegen uns nicht sowohl in den Gestalten des Lebens selbst, als in dem
wundervollen Licht, das sich bei ihnen über sie ergoss. Den Griechen
selbst, wenn man auch einen noch so grossen Einfluss früherer Völker
auf sie annimmt, fehlte eine solche Erscheinung, die ihnen aus der
Fremde herübergeleuchtet hätte, offenbar gänzlich. In sich selbst hatten
sie etwas Aehnliches in den Homerischen und den sich an diese anreihenden
Gesängen. Wie sie uns als Natur und in den Gründen ihrer Gestaltung
unerklärbar erscheinen, uns Muster der Nacheiferung, Quelle
für eine grosse Menge von Geistesbereicherungen werden, so war für
306sie jene dunkle und doch in so einzigen Vorbildern ihnen entgegenstrahlende
Zeit. Für die Römer wurden sie nicht ebenso zu etwas Aehnlichem,
als sie uns sind. Auf die Römer wirkten sie nur als eine gleichzeitige,
höher gebildete Nation, die eine von früher Zeit her beginnende
Literatur besitzt. Indien geht für uns in zu dunkle Ferne hinauf, als dass
wir über seine Vorzeit zu urtheilen im Stande wären. Auf das Abendland
wirkte es, da sich eine solche Einwirkung nicht hätte so spurlos
verwischen lassen, in der ältesten Zeit wenigstens nicht durch die eigenthümliche
Form seiner Geisteswerke, sondern höchstens durch einzelne
herübergekommene Meinungen, Erfindungen und Sagen. Wie
wichtig aber dieser Unterschied des geistigen Einflusses der Völker auf
einander ist, habe ich in meiner Schrift über die Kawi-Sprache Gelegenheit
gehabt näher zu berühren. Ihr eignes Alterthum wird den Indiern
in ähnlicher Gestalt, als den Griechen das ihrige erschienen seyn. Sehr
viel deutlicher aber ist dies in China durch den Einfluss und den Gegensatz
der Werke des alten Styls und der darin enthaltenen philosophischen
Lehre.
Da die Sprachen oder wenigstens ihre Elemente (ein nicht unbeachtet
zu lassender Unterschied) von einem Zeitalter dem anderen überliefert
werden und wir nur mit gänzlicher Ueberschreitung unsres Erfahrungsgebiets
von neu beginnenden Sprachen reden können, so greift
das Verhältniss der Vergangenheit zu der Gegenwart in das Tiefste ihrer
Bildung ein. Der Unterschied, in welche Lage ein Zeitalter durch den
Platz gesetzt wird, den es in der Reihe der uns bekannten einnimmt,
wird aber auch bei schon ganz geformten Sprachen unendlich mächtig,
weil die Sprache zugleich eine Auffassungsweise der gesammten Denk-
und Empfindungsart ist, und diese, sich einem Volke aus entfernter Zeit
her darstellend, nicht auf dasselbe einwirken kann, ohne auch für dessen
Sprache einflussreich zu werden. So würden unsre heutigen Sprachen
doch eine in mehreren Stücken andre Gestalt angenommen haben,
wenn, statt des classischen Alterthums, das Indische so anhaltend und
eindringlich auf uns eingewirkt hätte.
9. Der einzelne Mensch hängt immer mit einem Ganzen zusammen,
mit dem seiner Nation, des Stammes, zu welchem diese gehört, und des
gesammten Geschlechts. Sein Leben, von welcher Seite man es betrachten
mag, ist nothwendig an Geselligkeit geknüpft, und die äussere untergeordnete
und innre höhere Ansicht führen auch hier, wie wir es in
einem ähnlichen Falle weiter oben gesehen haben, auf denselben Punkt
hin. In dem gleichsam nur vegetativen Daseyn des Menschen auf dem
Erdboden treibt die Hülfsbedürftigkeit des Einzelnen zur Verbindung
mit Anderen und fordert zur Möglichkeit gemeinschaftlicher Unternehmungen
das Verständniss durch Sprache. Ebenso aber ist die geistige
Ausbildung, auch in der einsamsten Abgeschlossenheit des Gemüths,
307nur durch diese letztere möglich, und die Sprache verlangt, an ein äusseres,
sie verstehendes Wesen gerichtet zu werden. Der articulirte Laut
reisst sich aus der Brust los, um in einem andren Individuum einen zum
Ohre zurückkehrenden Anklang zu wecken. Zugleich macht dadurch
der Mensch die Entdeckung, dass es Wesen gleicher innerer Bedürfnisse
und daher fähig, der in seinen Empfindungen liegenden mannigfachen
Sehnsucht zu begegnen, um ihn her giebt. Denn das Ahnden einer Totalität
und das Streben danach ist unmittelbar mit dem Gefühle der Individualität
gegeben und verstärkt sich in demselben Grade, als das letztere
geschärft wird, da doch jeder Einzelne das Gesammtwesen des
Menschen, nur auf einer einzelnen Entwicklungsbahn, in sich trägt. Wir
haben auch nicht einmal die entfernteste Ahndung eines andren als eines
individuellen Bewusstseyns. Aber jenes Streben und der durch den
Begriff der Menschheit selbst in uns gelegte Keim unauslöschlicher
Sehnsucht lassen die Ueberzeugung nicht untergehen, dass die geschiedne
Individualität überhaupt nur eine Erscheinung bedingten Daseyns
geistiger Wesen ist.
Der Zusammenhang des Einzelnen mit einem, die Kraft und die Anregung
verstärkenden Ganzen ist ein zu wichtiger Punkt in der geistigen
Oekonomie des Menschengeschlechts, wenn ich mir diesen Ausdruck
erlauben darf, als dass er nicht hier hätte bestimmt angedeutet werden
müssen. Die allemal zugleich Absonderung hervorrufende Verbindung
der Nationen und Volksstämme hängt allerdings zunächst von geschichtlichen
Ereignissen, grossentheils selbst von der Beschaffenheit
ihrer Wohn- und Wanderungsplätze ab. Wenn man aber auch, ohne
dass ich diese Ansicht geradezu rechtfertigen möchte, allen Einfluss
innerer, auch nur instinctartiger Uebereinstimmung oder Abstossung
davon trennen will, so kann und muss doch jede Nation, noch abgesondert
von ihren äussren Verhältnissen, als eine menschliche Individualität,
die eine innere eigenthümliche Geistesbahn verfolgt, betrachtet
werden. Je mehr man einsieht, dass die Wirksamkeit der Einzelnen, auf
welche Stufe sie auch ihr Genius gestellt haben möchte, doch nur in
dem Grade eingreifend und dauerhaft ist, in welchem sie zugleich
durch den in ihrer Nation liegenden Geist emporgetragen werden, und
diesem wiederum von ihrem Standpunkte aus neuen Schwung zu ertheilen
vermögen, desto mehr leuchtet die Nothwendigkeit ein, den Erklärungsgrund
unserer heutigen Bildungsstufe in diesen nationellen geistigen
Individualitäten zu suchen. Die Geschichte bietet sie uns auch
überall, wo sie uns die Data zur Beurtheilung der innren Bildung der
Völker überliefert, in bestimmten Umrissen dar. Civilisation und Cultur
heben die grellen Contraste der Völker allmählich auf, und noch mehr
gelingt das Streben nach allgemeinerer sittlicher Form der tiefer eindringenden,
edleren Bildung. Damit stimmen auch die Fortschritte der
308Wissenschaft und Kunst überein, die immer nach allgemeineren, von
nationellen Ansichten entfesselten Idealen hinstreben. Wenn aber das
Gleiche gesucht wird, kann es doch nur in verschiednem Geiste errungen
werden, und die Mannigfaltigkeit, in welcher sich die menschliche
Eigentümlichkeit, ohne fehlerhafte Einseitigkeit, auszusprechen vermag,
geht ins Unendliche. Gerade von dieser Verschiedenheit hängt
aber das Gelingen des allgemein Erstrebten unbedingt ab. Denn dieses
erfordert die ganze, ungetrennte Einheit der, in ihrer Vollständigkeit nie
zu erklärenden, aber notwendig in ihrer schärfsten Individualität wirkenden
Kraft. Es kommt daher, um in den allgemeinen Bildungsgang
fruchtbar und mächtig einzugreifen, in einer Nation nicht allein auf das
Gelingen in einzelnen wissenschaftlichen Bestrebungen, sondern vorzüglich
auf die gesammte Anspannung in demjenigen an, was den Mittelpunkt
des menschlichen Wesens ausmacht, sich am klarsten und vollständigsten
in der Philosophie, Dichtung und Kunst ausspricht und sich
von da aus über die ganze Vorstellungsweise und Sinnesart des Volkes
ergiesst.
Vermöge des hier betrachteten Zusammenhangs des Einzelnen mit
der ihn umgebenden Masse gehört, jedoch nur mittelbar und gewissermassen,
jede bedeutende Geistesthätigkeit des ersteren zugleich auch
der letzteren an. Das Daseyn der Sprachen beweist aber, dass es auch
geistige Schöpfungen giebt, welche ganz und gar nicht von Einem Individuum
aus auf die übrigen übergehen, sondern nur aus der gleichzeitigen
Selbstthätigkeit Aller hervorbrechen können. In den Sprachen also
sind, da dieselben immer eine nationelle Form haben, die Nationen, als
solche, eigentlich und unmittelbar schöpferisch.
Doch muss man sich wohl hüten, diese Ansicht ohne die ihr gebührende
Beschränkung aufzufassen. Da die Sprachen unzertrennlich mit
der innersten Natur des Menschen verwachsen sind und weit mehr
selbstthätig aus ihr hervorbrechen, als willkührlich von ihr erzeugt werden,
so könnte man die intellectuelle Eigenthümlichkeit der Völker
ebensowohl ihre Wirkung nennen. Die Wahrheit ist, dass beide zugleich
und in gegenseitiger Uebereinstimmung aus unerreichbarer Tiefe des
Gemüths hervorgehen. Aus der Erfahrung kennen wir eine solche
Sprachschöpfung nicht, es bietet sich uns auch nirgends eine Analogie
zu ihrer Beurtheilung dar. Wenn wir von ursprünglichen Sprachen reden,
so sind sie dies nur für unsre Unkenntniss ihrer früheren Bestandtheile.
Eine zusammenhängende Kette von Sprachen hat sich Jahrtausende
lang fortgewälzt, ehe sie an den Punkt gekommen ist, den unsre
dürftige Kunde als den ältesten bezeichnet. Nicht bloss aber die primitive
Bildung der wahrhaft ursprünglichen Sprache, sondern auch die secundären
Bildungen späterer, die wir recht gut in ihre Bestandtheile zu
zerlegen verstehen, sind uns, gerade in dem Punkte ihrer eigentlichen
309Erzeugung, unerklärbar. Alles Werden in der Natur, vorzüglich aber das
organische und lebendige entzieht sich unsrer Beobachtung. Wie genau
wir die vorbereitenden Zustände erforschen mögen, so befindet sich
zwischen dem letzten und der Erscheinung immer die Kluft, welche das
Etwas vom Nichts trennt; und ebenso ist es bei dem Momente des Aufhörens.
Alles Begreifen des Menschen liegt nur in der Mitte von beiden.
In den Sprachen liefert uns eine Entstehungs-Epoche, aus ganz zugänglichen
Zeiten der Geschichte, ein auffallendes Beispiel. Man kann einer
vielfachen Reihe von Veränderungen nachgehen, welche die Römische
Sprache in ihrem Sinken und Untergang erfuhr, man kann ihnen die
Mischungen durch einwandernde Völkerhaufen hinzufügen: man erklärt
sich darum nicht besser das Entstehen des lebendigen Keims, der
in verschiedenartiger Gestalt sich wieder zum Organismus neu aufblühender
Sprachen entfaltete. Ein inneres, neu entstandenes Princip fügte,
in jeder auf eigne Art, den zerfallenden Bau wieder zusammen, und
wir, die wir uns immer nur auf dem Gebiete seiner Wirkungen befinden,
werden seiner Umänderungen nur an der Masse derselben gewahr. Es
mag daher scheinen, dass man diesen Punkt lieber ganz unberührt liesse.
Dies ist aber unmöglich, wenn man den Entwicklungsgang des
menschlichen Geistes auch nur in den gröbsten Umrissen zeichnen will,
da die Bildung der Sprachen, auch der einzelnen in allen Arten der Ableitung
oder Zusammensetzung, eine denselben am wesentlichsten bestimmende
Thatsache ist, und sich in dieser das Zusammenwirken der
Individuen in einer sonst nicht vorkommenden Gestalt zeigt. Indem
man also bekennt, dass man an einer Gränze steht, über welche weder
die geschichtliche Forschung, noch der freie Gedanke hinüberzuführen
vermögen, muss man doch die Thatsache und die unmittelbaren Folgerungen
aus derselben getreu aufzeichnen.
Die erste und natürlichste von diesen ist, dass jener Zusammenhang
des Einzelnen mit seiner Nation gerade in dem Mittelpunkte ruht, von
welchem aus die gesammte geistige Kraft alles Denken, Empfinden und
Wollen bestimmt. Denn die Sprache ist mit Allem in ihr, dem Ganzen
wie dem Einzelnen verwandt, nichts davon ist oder bleibt ihr je fremd.
Sie ist zugleich nicht bloss passiv, Eindrücke empfangend, sondern folgt
aus der unendlichen Mannigfaltigkeit möglicher intellectueller Richtungen
Einer bestimmten und modificirt durch innre Selbstthätigkeit jede
auf sie geübte äussre Einwirkung. Sie kann aber gegen die Geisteseigenthümlichkeit
gar nicht als etwas von ihr äusserlich Geschiedenes angesehen
werden und lässt sich daher, wenn es auch auf den ersten Anblick
anders erscheint, nicht eigentlich lehren, sondern nur im Gemüthe wecken,
man kann ihr nur den Faden hingeben, an dem sie sich von selbst
entwickelt. Indem die Sprachen nun also in dem von allem Misverständniss
befreiten Sinne des Worts 14 Schöpfungen der Nationen sind,
310bleiben sie doch Selbstschöpfungen der Individuen, indem sie sich nur
in jedem Einzelnen, in ihm aber nur so erzeugen können, dass jeder das
Verständniss aller voraussetzt und alle dieser Erwartung genügen. Mag
man nun die Sprache als eine Weltanschauung oder als eine Gedankenverknüpfung,
da sie diese beiden Richtungen in sich vereinigt, betrachten,
so beruht sie immer nothwendig auf der Gesammtkraft des Menschen;
es lässt sich nichts von ihr ausschliessen, da sie alles umfasst.
Diese Kraft nun ist in den Nationen, sowohl überhaupt, als in verschiednen
Epochen, dem Grade und der in der gleichen allgemeinen
Richtung möglichen eigenen Bahn nach, individuell verschieden. Die
Verschiedenheit muss aber an dem Resultate, der Sprache, sichtbar
werden, und wird es natürlich vorzüglich durch das Uebergewicht der
äussren Einwirkung oder der innren Selbstthätigkeit. Es tritt daher
auch hier der Fall ein, dass, wenn man die Reihe der Sprachen vergleichend
verfolgt, die Erklärung des Baues der einen aus der andren mehr
oder minder leichten Fortgang gewinnt, allein auch Sprachen dastehen,
die durch eine wirkliche Kluft von den übrigen getrennt erscheinen.
Wie Individuen durch die Kraft ihrer Eigenthümlichkeit dem menschlichen
Geiste einen neuen Schwung in bis dahin unentdeckt gebliebener
Richtung ertheilen, so können dies Nationen der Sprachbildung. Zwischen
dem Sprachbaue aber und dem Gelingen aller andren Arten intellectueller
Thätigkeit besteht ein unläugbarer Zusammenhang. Er liegt
vorzüglich, und wir betrachten ihn hier allein von dieser Seite, in dem
begeisternden Hauche, den die sprachbildende Kraft der Sprache in
dem Acte der Verwandlung der Welt in Gedanken dergestalt einflösst,
dass er sich durch alle Theile ihres Gebietes harmonisch verbreitet.
Wenn man es als möglich denken kann, dass eine Sprache in einer Nation
gerade auf die Weise entsteht, wie sich das Wort am sinnvollsten
und anschaulichsten aus der Weltansicht entwickelt, sie am reinsten
wieder darstellt und sich selbst so gestaltet, um in jede Fügung des Gedanken
am leichtesten und am körperlosesten einzugehen; so muss diese
Sprache, so lange sich nur irgend ihr Lebensprincip erhält, dieselbe
Kraft in derselben Richtung gleich gelingend in jedem Einzelnen hervorrufen.
Der Eintritt einer solchen oder auch nur einer ihr nahe kommenden
Sprache in die Weltgeschichte muss daher eine wichtige Epoche
in dem menschlichen Entwicklungsgange und gerade in seinen
höchsten und wundervollsten Erzeugungen begründen. Gewisse Bahnen
des Geistes und ein gewisser, ihn auf denselben forttragender
Schwung lassen sich nicht denken, ehe solche Sprachen entstanden
sind. Sie machen daher einen wahren Wendepunkt in der inneren Geschichte
des Menschengeschlechts aus; wenn man sie als den Gipfel der
Sprachbildung ansehen muss, so sind sie die Anfangsstufe seelenvoller
und phantasiereicher Bildung, und es ist insofern ganz richtig zu behaupten,
311dass das Werk der Nationen den Werken der Individuen vorausgehen
müsse, obgleich gerade das hier Gesagte unumstösslich beweist,
wie gleichzeitig in diesen Schöpfungen die Thätigkeit beider in
einander verschlungen ist.
Uebergang zur näheren Betrachtung der Sprache
10. Wir sind jetzt bis zu dem Punkte gelangt, auf dem wir in der primitiven
Bildung des Menschengeschlechts die Sprachen als die erste
nothwendige Stufe erkennen, von der aus die Nationen erst jede höhere
menschliche Richtung zu verfolgen im Stande sind. Sie wachsen auf
gleich bedingte Weise mit der Geisteskraft empor und bilden zugleich
das belebend anregende Princip derselben. Beides aber geht nicht nach
einander und abgesondert vor sich, sondern ist durchaus und unzertrennlich
dieselbe Handlung des intellectuellen Vermögens. Indem ein
Volk der Entwicklung seiner Sprache, als des Werkzeuges jeder
menschlichen Thätigkeit in ihm, aus seinem Inneren Freiheit erschafft,
sucht und erreicht es zugleich die Sache selbst, also etwas Anderes und
Höheres; und indem es auf dem Wege dichterischer Schöpfung und grübelnder
Ahndung dahin gelangt, wirkt es zugleich wieder auf die Sprache
zurück. Wenn man die ersten, selbst rohen und ungebildeten Versuche
des intellectuellen Strebens mit dem Namen der Literatur belegt, so
geht die Sprache immer den gleichen Gang mit ihr, und so sind beide
unzertrennlich mit einander verbunden.
Die Geisteseigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes
stehen in solcher Innigkeit der Verschmelzung in einander, dass, wenn
die eine gegeben wäre, die andre müsste vollständig aus ihr abgeleitet
werden können. Denn die Intellectualität und die Sprache gestatten
und befördern nur einander gegenseitig zusagende Formen. Die Sprache
ist gleichsam die äusserliche Erscheinung des Geistes der Völker;
ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache, man kann sich
beide nie identisch genug denken. Wie sie in Wahrheit mit einander in
einer und ebenderselben, unserem Begreifen unzugänglichen Quelle
zusammenkommen, bleibt uns unerklärlich verborgen. Ohne aber über
die Priorität der einen oder andren entscheiden zu wollen, müssen wir
als das reale Erklärungsprincip und als den wahren Bestimmungsgrund
der Sprachverschiedenheit die geistige Kraft der Nationen ansehen,
weil sie allein lebendig selbstständig vor uns steht, die Sprache dagegen
nur an ihr haftet. Denn insofern sich auch diese uns in schöpferischer
Selbstständigkeit offenbart, verliert sie sich über das Gebiet der Erscheinungen
hinaus in ein ideales Wesen. Wir haben es historisch nur
immer mit dem wirklich sprechenden Menschen zu thun, dürfen aber
312darum das wahre Verhältniss nicht aus den Augen lassen. Wenn wir Intellectualität
und Sprache trennen, so existirt eine solche Scheidung in
der Wahrheit nicht. Wenn uns die Sprache mit Recht als etwas Höheres
erscheint, als dass sie für ein menschliches Werk, gleich andren Geisteserzeugnissen,
gelten könnte; so würde sich dies anders verhalten,
wenn uns die menschliche Geisteskraft nicht bloss in einzelnen Erscheinungen
begegnete, sondern ihr Wesen selbst uns in seiner unergründlichen
Tiefe entgegenstrahlte und wir den Zusammenhang der
menschlichen Individualität einzusehen vermöchten, da auch die Sprache
über die Geschiedenheit der Individuen hinausgeht. Für die praktische
Anwendung besonders wichtig ist es nur, bei keinem niedrigeren
Erklärungsprincipe der Sprachen stehen zu bleiben, sondern wirklich
bis zu diesem höchsten und letzten hinaufzusteigen und als den festen
Punkt der ganzen geistigen Gestaltung den Satz anzusehen, dass der
Bau der Sprachen im Menschengeschlechte darum und insofern verschieden
ist, weil und als es die Geisteseigenthümlichkeit der Nationen
selbst ist.
Gehen wir aber, wie wir uns nicht entbrechen können zu thun, in die
Art dieser Verschiedenheit der einzelnen Gestaltung des Sprachbaues
ein, so können wir nicht mehr die Erforschung der geistigen Eigenthümlichkeit,
erst abgesondert für sich angestellt, auf die Beschaffenheiten
der Sprache anwenden wollen. In den frühen Epochen, in welche
uns die gegenwärtigen Betrachtungen zurückversetzen, kennen wir die
Nationen überhaupt nur durch ihre Sprachen, wissen nicht einmal immer
genau, welches Volk wir uns, der Abstammung und Verknüpfung
nach, bei jeder Sprache zu denken haben. So ist das Zend wirklich für
uns die Sprache einer Nation, die wir nur auf dem Wege der Vermuthung
genauer bestimmen können. Unter allen Aeusserungen, an
welchen Geist und Charakter erkennbar sind, ist aber die Sprache auch
die allein geeignete, beide bis in ihre geheimsten Gänge und Falten darzulegen.
Wenn man also die Sprachen als einen Erklärungsgrund der
successiven geistigen Entwicklung betrachtet, so muss man zwar dieselben
als durch die intellectuelle Eigenthümlichkeit entstanden ansehen,
allein die Art dieser Eigenthümlichkeit bei jeder einzelnen in ihrem
Baue aufsuchen, so dass, wenn die hier eingeleiteten Betrachtungen zu
einiger Vollständigkeit durchgeführt werden sollen, es uns jetzt obliegt,
in die Natur der Sprachen und die Möglichkeit ihrer rückwirkenden
Verschiedenheiten näher einzugehen, um auf diese Weise das vergleichende
Sprachstudium an seinen letzten und höchsten Beziehungspunkt
anzuknüpfen.313
Form der Sprachen
11. Es gehört aber allerdings eine eigne Richtung der Sprachforschung
dazu, den im Obigen vorgezeichneten Weg mit Glück zu verfolgen.
Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein todtes Erzeugtes, sondern
weit mehr wie eine Erzeugung ansehen, mehr von demjenigen abstrahieren,
was sie als Bezeichnung der Gegenstände und Vermittlung des
Verständnisses wirkt, und dagegen sorgfältiger auf ihren mit der innren
Geistesthätigkeit eng verwebten Ursprung und ihren gegenseitigen Einfluss
zurückgehen. Die Fortschritte, welche das Sprachstudium den gelungenen
Bemühungen der letzten Jahrzehnde verdankt, erleichtern die
Uebersicht desselben in der Totalität seines Umfangs. Man kann nun
dem Ziele näher rücken, die einzelnen Wege anzugeben, auf welchen in
den mannigfach abgetheilten, isolirten und verbundenen Völkerhaufen
des Menschengeschlechts das Geschäft der Spracherzeugung zur Vollendung
gedeiht. Hierin aber liegt gerade sowohl die Ursach der Verschiedenheit
des menschlichen Sprachbaues, als ihr Einfluss auf den
Entwicklungsgang des Geistes, also der ganze uns hier beschäftigende
Gegenstand.
Gleich bei dem ersten Betreten dieses Forschungsweges stellt sich
uns jedoch eine wichtige Schwierigkeit in den Weg. Die Sprache bietet
uns eine Unendlichkeit von Einzelnheiten dar, in Wörtern, Regeln, Analogieen
und Ausnahmen aller Art, und wir gerathen in nicht geringe
Verlegenheit, wie wir diese Menge, die uns, der schon in sie gebrachten
Anordnung ungeachtet, doch noch als verwirrendes Chaos erscheint,
mit der Einheit des Bildes der menschlichen Geisteskraft in beurtheilende
Vergleichung bringen sollen. Wenn man sich auch im Besitze alles
nöthigen lexicalischen und grammatischen Details zweier wichtigen
Sprachstämme, z.B. des Sanskritischen und Semitischen, befindet; so
wird man dadurch doch noch wenig in dem Bemühen gefördert, den
Charakter eines jeden von beiden in so einfache Umrisse zusammenzuziehen,
dass dadurch eine fruchtbare Vergleichung derselben und die
Bestimmung der ihnen, nach ihrem Verhältniss zur Geisteskraft der
Nationen, gebührenden Stelle in dem allgemeinen Geschäfte der
Spracherzeugung möglich wird. Dies erfordert noch ein eignes Aufsuchen
der gemeinschaftlichen Quellen der einzelnen Eigenthümlichkeiten,
das Zusammenziehen der zerstreuten Züge in das Bild eines organischen
Ganzen. Erst dadurch gewinnt man eine Handhabe, an der man
die Einzelnheiten festzuhalten vermag. Um daher verschiedne Sprachen
in Bezug auf ihren charakteristischen Bau fruchtbar mit einander zu
vergleichen, muss man der Form einer jeden derselben sorgfältig nachforschen
und sich auf diese Weise vergewissern, auf welche Art jede die
hauptsächlichen Fragen löst, welche aller Spracherzeugung als Aufgaben
314vorliegen. Da aber dieser Ausdruck der Form in Sprachuntersuchungen
in mehrfacher Beziehung gebraucht wird, so glaube ich ausführlicher
entwickeln zu müssen, in welchem Sinne ich ihn hier genommen
wünsche. Dies erscheint um so nothwendiger, als wir hier nicht
von der Sprache überhaupt, sondern von den' einzelnen verschiedner
Völkerschaften reden, und es daher auch darauf ankommt, abgränzend
zu bestimmen, was unter einer einzelnen Sprache, im Gegensatz auf der
einen Seite des Sprachstammes, auf der andren des Dialektes, und was
unter Einer da zu verstehen ist, wo die nemliche in ihrem Verlaufe wesentliche
Veränderungen erfährt.
12. Die Sprache, in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas beständig
und in jedem Augenblicke Vorübergehendes. Selbst ihre Erhaltung
durch die Schrift ist immer nur eine unvollständige, mumienartige
Aufbewahrung, die es doch erst wieder bedarf, dass man dabei den lebendigen
Vortrag zu versinnlichen sucht. Sie selbst ist kein Werk (Ergon),
sondern eine Thätigkeit (Energeia). Ihre wahre Definition kann
daher nur eine genetische seyn. Sie ist nemlich die sich ewig wiederholende
Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum Ausdruck des Gedanken
fähig zu machen. Unmittelbar und streng genommen, ist dies die
Definition des jedesmaligen Sprechens; aber im wahren und wesentlichen
Sinne kann man auch nur gleichsam die Totalität dieses Sprechens
als die Sprache ansehen. Denn in dem zerstreuten Chaos von Wörtern
und Regeln, welches wir wohl eine Sprache zu nennen pflegen, ist nur
das durch jenes Sprechen hervorgebrachte Einzelne vorhanden und dies
niemals vollständig, auch erst einer neuen Arbeit bedürftig, um daraus
die Art des lebendigen Sprechens zu erkennen und ein wahres Bild der
lebendigen Sprache zu geben. Gerade das Höchste und Feinste lässt sich
an jenen getrennten Elementen nicht erkennen und kann nur (was um so
mehr beweist, dass die eigentliche Sprache in dem Acte ihres wirklichen
Hervorbringens liegt) in der verbundenen Rede wahrgenommen oder geahndet
werden. Nur sie muss man sich überhaupt in allen Untersuchungen,
welche in die lebendige Wesenheit der Sprache eindringen sollen,
immer als das Wahre und Erste denken. Das Zerschlagen in Wörter und
Regeln ist nur ein todtes Machwerk wissenschaftlicher Zergliederung.
Die Sprachen als eine Arbeit des Geistes zu bezeichnen, ist schon
darum ein vollkommen richtiger und adäquater Ausdruck, weil sich das
Daseyn des Geistes überhaupt nur in Thätigkeit und als solche denken
lässt. Die zu ihrem Studium unentbehrliche Zergliederung ihres Baues
nöthigt uns sogar sie als ein Verfahren zu betrachten, das durch bestimmte
Mittel zu bestimmten Zwecken vorschreitet, und sie insofern
wirklich als Bildungen der Nationen anzusehen. Der hierbei möglichen
Misdeutung ist schon oben 15 hinlänglich vorgebeugt worden, und so
können jene Ausdrücke der Wahrheit keinen Eintrag thun.315
Ich habe schon im Obigen (VII 39) darauf aufmerksam gemacht,
dass wir uns, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit unsrem Sprachstudium
durchaus in eine geschichtliche Mitte versetzt befinden, und dass
weder eine Nation noch eine Sprache unter den uns bekannten ursprünglich
genannt werden kann. Da jede schon einen Stoff von früheren
Geschlechtern aus uns unbekannter Vorzeit empfangen hat, so ist
die, nach der obigen Erklärung, den Gedankenausdruck hervorbringende
geistige Thätigkeit immer zugleich auf etwas schon Gegebenes gerichtet,
nicht rein erzeugend, sondern umgestaltend.
Diese Arbeit nun wirkt auf eine constante und gleichförmige Weise.
Denn es ist die gleiche, nur innerhalb gewisser, nicht weiter Gränzen
verschiedne geistige Kraft, welche dieselbe ausübt. Sie hat zum Zweck
das Verständniss. Es darf also Niemand auf andre Weise zum Andren
reden, als dieser, unter gleichen Umständen, zu ihm gesprochen haben
würde. Endlich ist der überkommene Stoff nicht bloss der nemliche,
sondern auch, da er selbst wieder einen gleichen Ursprung hat, ein mit
der Geistesrichtung durchaus nahe verwandter. Das in dieser Arbeit des
Geistes, den articulirten Laut zum Gedankenausdruck zu erheben, liegende
Beständige und Gleichförmige, so vollständig, als möglich, in seinem
Zusammenhange aufgefasst und systematisch dargestellt, macht
die Form der Sprache aus.
In dieser Definition erscheint dieselbe als ein durch die Wissenschaft
gebildetes Abstractum. Es würde aber durchaus unrichtig seyn, sie auch
an sich bloss als ein solches daseynloses Gedankenwesen anzusehen. In
der That ist sie vielmehr der durchaus individuelle Drang, vermittelst
dessen eine Nation dem Gedanken und der Empfindung Geltung in der
Sprache verschafft. Nur weil uns nie gegeben ist, diesen Drang in der
ungetrennten Gesammtheit seines Strebens, sondern nur in seinen jedesmal
einzelnen Wirkungen zu sehen, so bleibt uns auch bloss übrig,
die Gleichartigkeit seines Wirkens in einen todten allgemeinen Begriff
zusammenzufassen. In sich ist jener Drang Eins und lebendig.
Die Schwierigkeit gerade der wichtigsten und feinsten Sprachuntersuchungen
liegt sehr häufig darin, dass etwas aus dem Gesammteindruck
der Sprache Fliessendes zwar durch das klarste und überzeugendste
Gefühl wahrgenommen wird, dennoch aber die Versuche scheitern, es
in genügender Vollständigkeit einzeln darzulegen und in bestimmte Begriffe
zu begränzen. Mit dieser nun hat man auch hier zu kämpfen. Die
charakteristische Form der Sprachen hängt an jedem einzelnen ihrer
kleinsten Elemente; jedes wird durch sie, wie unmerklich es im Einzelnen
sey, auf irgend eine Weise bestimmt. Dagegen ist es kaum möglich,
Punkte aufzufinden, von denen sich behaupten liesse, dass sie an ihnen,
einzeln genommen, entscheidend haftete. Wenn man daher irgend eine
gegebene Sprache durchgeht, so findet man Vieles, das man sich, dem
316Wesen ihrer Form unbeschadet, auch wohl anders denken könnte, und
wird, um diese rein geschieden zu erblicken, zu dem Gesammteindruck
zurückgewiesen. Hier nun tritt sogleich das Gegentheil ein. Die entschiedenste
Individualität fällt klar in die Augen, drängt sich unabweisbar
dem Gefühl auf. Die Sprachen können hierin noch am wenigsten unrichtig
mit den menschlichen Gesichtsbildungen verglichen werden. Die
Individualität steht unabläugbar da, Aehnlichkeiten werden erkannt,
aber kein Messen und kein Beschreiben der Theile, im Einzelnen und in
ihrem Zusammenhange, vermag die Eigenthümlichkeit in einen Begriff
zusammenzufassen. Sie ruht auf dem Ganzen und in der wieder individuellen
Auffassung, daher auch gewiss jede Physiognomie jedem anders
erscheint. Da die Sprache, in welcher Gestalt man sie aufnehmen möge,
immer ein geistiger Aushauch eines nationell individuellen Lebens ist, so
muss beides auch bei ihr eintreffen. Wie viel man in ihr heften und verkörpern,
vereinzeln und zergliedern möge, so bleibt immer etwas unerkannt
in ihr übrig, und gerade dies der Bearbeitung Entschlüpfende ist
dasjenige, worin sie Einheit und der Odem eines Lebendigen ist. Bei dieser
Beschaffenheit der Sprachen kann daher die Darstellung der Form
irgend einer in dem hier angegebenen Sinne niemals ganz vollständig,
sondern immer nur bis auf einen gewissen, jedoch zur Uebersicht des
Ganzen genügenden Grad gelingen. Darum ist aber dem Sprachforscher
durch diesen Begriff nicht minder die Bahn vorgezeichnet, in welcher er
den Geheimnissen der Sprache nachspüren und ihr Wesen zu enthüllen
suchen muss. Bei der Vernachlässigung dieses Weges übersieht er unfehlbar
eine Menge von Punkten der Forschung, muss sehr vieles wirklich
Erklärbares unerklärt lassen und hält für isolirt dastehend, was durch
lebendigen Zusammenhang verknüpft ist.
Es ergiebt sich schon aus dem bisher Gesagten von selbst, dass unter
Form der Sprache hier durchaus nicht bloss die sogenannte grammatische
Form verstanden wird. Der Unterschied, welchen wir zwischen
Grammatik und Lexicon zu machen pflegen, kann nur zum praktischen
Gebrauche der Erlernung der Sprachen dienen, allein der wahren
Sprachforschung weder Gränze noch Regel vorschreiben. Der Begriff
der Form der Sprachen dehnt sich weit über die Regeln der Redefügung
und selbst über die der Wortbildung hin aus, insofern man unter der
letzteren die Anwendung gewisser allgemeiner logischer Kategorieen
des Wirkens, des Gewirkten, der Substanz, der Eigenschaft u. s.w. auf
die Wurzeln und Grundwörter versteht. Er ist ganz eigentlich auf die
Bildung der Grundwörter selbst anwendbar und muss in der That möglichst
auf sie angewandt werden, wenn das Wesen der Sprache wahrhaft
erkennbar seyn soll.
Der Form steht freilich ein Stoff gegenüber; um aber den Stoff der
Sprachform zu finden, muss man über die Gränzen der Sprache hinausgehen.
317Innerhalb derselben lässt sich etwas nur beziehungsweise gegen
etwas andres als Stoff betrachten, z. B. die Grundwörter in Beziehung
auf die Declination. In andren Beziehungen aber wird, was hier Stoff
ist, wieder als Form erkannt. Eine Sprache kann auch aus einer fremden
Wörter entlehnen und wirklich als Stoff behandeln. Aber alsdann sind
dieselben dies wiederum in Beziehung auf sie, nicht an sich. Absolut
betrachtet, kann es innerhalb der Sprache keinen ungeformten Stoff geben,
da alles in ihr auf einen bestimmten Zweck, den Gedankenausdruck,
gerichtet ist, und diese Arbeit schon bei ihrem ersten Element,
dem articulirten Laute, beginnt, der ja eben durch Formung zum articulirten
wird. Der wirkliche Stoff der Sprache ist auf der einen Seite der
Laut überhaupt, auf der andren die Gesammtheit der sinnlichen Eindrücke
und selbstthätigen Geistesbewegungen, welche der Bildung des
Begriffs mit Hülfe der Sprache vorausgehen.
Es versteht sich daher von selbst, dass die reelle Beschaffenheit der
Laute, um eine Vorstellung von der Form einer Sprache zu erhalten, ganz
vorzugsweise beachtet werden muss. Gleich mit dem Alphabete beginnt
die Erforschung der Form einer Sprache, und durch alle Theile derselben
hindurch wird dies als ihre hauptsächlichste Grundlage behandelt.
Ueberhaupt wird durch den Begriff der Form nichts Factisches und Individuelles
ausgeschlossen, sondern alles nur wirklich historisch zu Begründende,
so wie das Allerindividuellste, gerade in diesen Begriff befasst und
eingeschlossen. Sogar werden alle Einzelnheiten nur, wenn man die hier
bezeichnete Bahn verfolgt, mit Sicherheit in die Forschung aufgenommen,
da sie sonst leicht übersehen zu werden Gefahr laufen. Dies führt
freilich in eine mühvolle, oft ins Kleinliche gehende Elementaruntersuchung;
es sind aber auch lauter in sich kleinliche Einzelnheiten, auf welchen
der Totaleindruck der Sprachen beruht, und nichts ist mit ihrem
Studium so unverträglich, als in ihnen bloss das Grosse, Geistige, Vorherrschende
aufsuchen zu wollen. Genaues Eingehen in jede grammatische
Subtilität und Spalten der Wörter in ihre Elemente ist durchaus
nothwendig, um sich nicht in allen Urtheilen über sie Irrthümern auszusetzen.
Es versteht sich indess von selbst, dass in den Begriff der Form der
Sprachen keine Einzelnheiten als isolirte Thatsache, sondern immer nur
insofern aufgenommen werden darf, als sich eine Methode der Sprachbildung
an ihr entdecken lässt. Man muss durch die Darstellung der Form
den specifischen Weg erkennen, welchen die Sprache und mit ihr die
Nation, der sie angehört, zum Gedankenausdruck einschlägt. Man muss
zu übersehen im Stande seyn, wie sie sich zu andren Sprachen, sowohl in
den bestimmten ihr vorgezeichneten Zwecken, als in der Rückwirkung
auf die geistige Thätigkeit der Nation, verhält. Sie ist in ihrer Natur selbst
eine Auffassung der einzelnen, im Gegensatze zu ihr als Stoff zu betrachtenden
Sprachelemente in geistiger Einheit. Denn in jeder Sprache liegt
318eine solche, und durch diese zusammenfassende Einheit macht eine Nation
die ihr von ihren Vorfahren überlieferte Sprache zu der ihrigen. Dieselbe
Einheit muss sich also in der Darstellung wiederfinden; und nur
wenn man von den zerstreuten Elementen bis zu dieser Einheit hinaufsteigt,
erhält man wahrhaft einen Begriff von der Sprache selbst, da man,
ohne ein solches Verfahren, offenbar Gefahr läuft, nicht einmal jene Elemente
in ihrer wahren Eigenthümlichkeit und noch weniger in ihrem
realen Zusammenhange zu verstehen.
Die Identität, um dies hier im Voraus zu bemerken, so wie die Verwandtschaft
der Sprachen muss auf der Identität und der Verwandtschaft
ihrer Formen beruhen, da die Wirkung nur der Ursach gleich
seyn kann. Die Form entscheidet daher allein, zu welchen andren eine
Sprache, als stammverwandte, gehört. Dies findet sogleich eine Anwendung
auf das Kawi, das, wie viele Sanskritwörter es auch in sich aufnehmen
möchte, darum nicht aufhört, eine Malayische Sprache zu seyn.
Die Formen mehrerer Sprachen können in einer noch allgemeineren
Form zusammenkommen, und die Formen aller thun dies in der That,
insofern man überall bloss von dem Allgemeinsten ausgeht: von den
Verhältnissen und Beziehungen der zur Bezeichnung der Begriffe und
zur Redefügung nothwendigen Vorstellungen, von der Gleichheit der
Lautorgane, deren Umfang und Natur nur eine bestimmte Zahl articulirter
Laute zulässt, von den Beziehungen endlich, welche zwischen
einzelnen Consonant- und Vocallauten und gewissen sinnlichen Eindrücken
obwalten, woraus dann Gleichheit der Bezeichnung, ohne
Stammverwandtschaft, entspringt. Denn so wundervoll ist in der Sprache
die Individualisirung innerhalb der allgemeinen Uebereinstimmung,
dass man ebenso richtig sagen kann, dass das ganze Menschengeschlecht
nur Eine Sprache, als dass jeder Mensch eine besondere
besitzt. Unter den durch nähere Analogieen verbundenen Sprachähnlichkeiten
aber zeichnet sich vor allen die aus Stammverwandtschaft
der Nationen entstehende aus. Wie gross und von welcher Beschaffenheit
eine solche Aehnlichkeit seyn muss, um zur Annahme von Stammverwandtschaft
da zu berechtigen, wo nicht geschichtliche Thatsachen
dieselbe ohnehin begründen, ist es hier nicht der Ort zu untersuchen.
Wir beschäftigen uns hier nur mit der Anwendung des eben entwickelten
Begriffs der Sprachform auf stammverwandte Sprachen. Bei dieser
ergiebt sich nun natürlich aus dem Vorigen, dass die Form der einzelnen
stammverwandten Sprachen sich in der des ganzen Stammes wiederfinden
muss. Es kann in ihnen nichts enthalten seyn, was nicht mit der
allgemeinen Form in Einklang stände; vielmehr wird man in der Regel
in dieser jede ihrer Eigenthümlichkeiten auf irgend eine Weise angedeutet
finden. In jedem Stamme wird es auch eine oder die andre Sprache
geben, welche die ursprüngliche Form reiner und vollständiger in sich
319enthält. Denn es ist hier nur von aus einander entstandenen Sprachen
die Rede, wo also ein wirklich gegebener Stoff (dies Wort immer, nach
den obigen Erklärungen, beziehungsweise genommen) von einem Volke
zum andren in bestimmter Folge, die sich jedoch nur selten genau nachweisen
lässt, übergeht und umgestaltet wird. Die Umgestaltung selbst
aber kann bei der ähnlichen Vorstellungsweise und Ideenrichtung der
sie bewirkenden Geisteskraft, bei der Gleichheit der Sprachorgane und
der überkommenen Lautgewohnheiten, endlich bei vielen zusammentreffenden
historischen äusserlichen Einflüssen immer nur eine nah verwandte
bleiben.
Natur und Beschaffenheit der Sprache überhaupt
13. Da der Unterschied der Sprachen auf ihrer Form beruht, und diese
mit den Geistesanlagen der Nationen und der sie im Augenblicke der
Erzeugung oder neuen Auffassung durchdringenden Kraft in der engsten
Verbindung steht, so ist es nunmehr nothwendig, diese Begriffe
mehr im Einzelnen zu entwickeln und wenigstens einige der Hauptrichtungen
der Sprache näher zu verfolgen. Ich wähle dazu die am meisten
folgenreichen aus, welche am deutlichsten zeigen, wie die innere Kraft
auf die Sprache ein- und diese auf sie zurückwirkt.
Zwei Principe treten bei dem Nachdenken über die Sprache im Allgemeinen
und der Zergliedrung der einzelnen, sich deutlich von einander
absondernd, an das Licht: die Lautform und der von ihr zur Bezeichnung
der Gegenstände und Verknüpfung der Gedanken gemachte
Gebrauch. Der letztere gründet sich auf die Forderungen, welche das
Denken an die Sprache bindet, woraus die allgemeinen Gesetze dieser
entspringen; und dieser Theil ist daher in seiner ursprünglichen Richtung,
bis auf die Eigenthümlichkeit ihrer geistigen Naturanlagen oder
nachherigen Entwicklungen, in allen Menschen, als solchen, gleich.
Dagegen ist die Lautform das eigentlich constitutive und leitende Princip
der Verschiedenheit der Sprachen, sowohl an sich, als in der befördernden
oder hemmenden Kraft, welche sie der inneren Sprachtendenz
gegenüberstellt. Sie hängt natürlich, als ein in enger Beziehung auf die
innere Geisteskraft stehender Theil des ganzen menschlichen Organismus,
ebenfalls genau mit der Gesammtanlage der Nation zusammen;
aber die Art und die Gründe dieser Verbindung sind in, kaum irgend
eine Aufklärung erlaubendes Dunkel gehüllt. Aus diesen beiden Principien
nun, zusammengenommen mit der Innigkeit ihrer gegenseitigen
Durchdringung, geht die individuelle Form jeder Sprache hervor, und
sie machen die Punkte aus, welche die Sprachzergliedrung zu erforschen
und in ihrem Zusammenhange darzustellen versuchen muss. Das
320Unerlasslichste hierbei ist, dass dem Unternehmen eine richtige und
würdige Ansicht der Sprache, der Tiefe ihres Ursprungs und der Weite
ihres Umfangs zum Grunde gelegt werde; und bei der Aufsuchung dieser
haben wir daher hier noch zunächst zu verweilen.
14. Ich nehme hier das Verfahren der Sprache in seiner weitesten
Ausdehnung, nicht bloss in der Beziehung derselben auf die Rede und
den Vorrath ihrer Wortelemente, als ihr unmittelbares Erzeugniss, sondern
auch in ihrem Verhältniss zu dem Denk- und Empfindungsvermögen.
Der ganze Weg kommt in Betrachtung, auf dem sie, vom Geiste
ausgehend, auf den Geist zurückwirkt.
Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken. Die intellectuelle
Thätigkeit, durchaus geistig, durchaus innerlich und gewissermassen
spurlos vorübergehend, wird durch den Laut in der Rede äusserlich und
wahrnehmbar für die Sinne. Sie und die Sprache sind daher Eins und
unzertrennlich von einander. Sie ist aber auch in sich an die Nothwendigkeit
geknüpft, eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen; das
Denken kann sonst nicht zur Deutlichkeit gelangen, die Vorstellung nicht
zum Begriff werden. Die unzertrennliche Verbindung des Gedanken, der
Stimmwerkzeuge und des Gehörs zur Sprache liegt unabänderlich in der
ursprünglichen, nicht weiter zu erklärenden Einrichtung der menschlichen
Natur. Die Uebereinstimmung des Lautes mit dem Gedanken fällt
indess auch klar in die Augen. Wie der Gedanke, einem Blitze oder Stosse
vergleichbar, die ganze Vorstellungskraft in Einen Punkt sammelt und
alles Gleichzeitige ausschliesst, so erschallt der Laut in abgerissener
Schärfe und Einheit. Wie der Gedanke das ganze Gemüth ergreift so
besitzt der Laut vorzugsweise eine eindringende, alle Nerven erschütternde
Kraft. Dies ihn von allen übrigen sinnlichen Eindrücken Unterscheidende
beruht sichtbar darauf, dass das Ohr (was bei den übrigen
Sinnen nicht immer oder anders der Fall ist) den Eindruck einer Bewegung,
ja bei dem der Stimme entschallenden Laut einer wirklichen Handlung
empfängt, und diese Handlung hier aus dem Innern eines lebenden
Geschöpfs, im articulirten Laut eines denkenden, im unarticulirten eines
empfindenden, hervorgeht. Wie das Denken in seinen menschlichsten
Beziehungen eine Sehnsucht aus dem Dunkel nach dem Licht, aus der
Beschränkung nach der Unendlichkeit ist, so strömt der Laut aus der
Tiefe der Brust nach aussen und findet einen ihm wundervoll angemessenen,
vermittelnden Stoff in der Luft, dem feinsten und am leichtesten
bewegbaren aller Elemente, dessen scheinbare Unkörperlichkeit dem
Geiste auch sinnlich entspricht. Die schneidende Schärfe des Sprachlauts
ist dem Verstande bei der Auffassung der Gegenstände unentbehrlich.
Sowohl die Dinge in der äusseren Natur, als die innerlich angeregte Thätigkeit
dringen auf den Menschen mit einer Menge von Merkmalen zugleich
ein. Er aber strebt nach Vergleichung, Trennung und Verbindung
321und in seinen höheren Zwecken nach Bildung immer mehr umschliessender
Einheit. Er verlangt also auch, die Gegenstände in bestimmter Einheit
aufzufassen, und fordert die Einheit des Lautes, um ihre Stelle zu
vertreten. Hierbei verdrängt dieser aber keinen der andren Eindrücke,
welche die Gegenstände auf den äusseren oder inneren Sinn hervorzubringen
fähig sind, sondern wird ihr Träger und fügt in seiner individuellen,
mit der des Gegenstandes und zwar gerade nach der Art, wie ihn die
individuelle Empfindungsweise des Sprechenden auffasst, zusammenhängenden
Beschaffenheit einen neuen bezeichnenden Eindruck hinzu.
Zugleich erlaubt die Schärfe des Lauts eine unbestimmbare Menge sich
doch vor der Vorstellung genau absondernder und in der Verbindung
nicht vermischender Modificationen, was bei keiner anderen sinnlichen
Einwirkung in gleichem Grade der Fall ist. Da das intellectuelle Streben
nicht bloss den Verstand beschäftigt, sondern den ganzen Menschen anregt,
so wird auch dies vorzugsweise durch den Laut der Stimme befördert.
Denn sie geht, als lebendiger Klang, wie das athmende Daseyn
selbst, aus der Brust hervor, begleitet, auch ohne Sprache, Schmerz und
Freude, Abscheu und Begierde, und haucht also das Leben, aus dem sie
hervorströmt, in den Sinn, der sie aufnimmt, so wie auch die Sprache
selbst immer zugleich mit dem dargestellten Object die dadurch hervorgebrachte
Empfindung wiedergiebt und in immer wiederholten Acten die
Welt mit dem Menschen oder, anders ausgedrückt, seine Selbstthätigkeit
mit seiner Empfänglichkeit in sich zusammenknüpft. Zum Sprachlaut
endlich passt die, den Thieren versagte aufrechte Stellung des Menschen,
der gleichsam durch ihn emporgerufen wird. Denn die Rede will nicht
dumpf am Boden verhallen, sie verlangt, sich frei von den Lippen zu dem,
an den sie gerichtet ist, zu ergiessen, von dem Ausdruck des Blickes und
der Mienen, so wie der Geberde der Hände begleitet zu werden und sich
so zugleich mit Allem zu umgeben, was den Menschen menschlich bezeichnet.
Nach dieser vorläufigen Betrachtung der Angemessenheit des Lautes
zu den Operationen des Geistes können wir nun genauer in den Zusammenhang
des Denkens mit der Sprache eingehen. Subjective Thätigkeit
bildet im Denken ein Object. Denn keine Gattung der Vorstellungen
kann als ein bloss empfangendes Beschauen eines schon vorhandenen
Gegenstandes betrachtet werden. Die Thätigkeit der Sinne muss sich
mit der inneren Handlung des Geistes synthetisch verbinden, und aus
dieser Verbindung reisst sich die Vorstellung los, wird, der subjectiven
Kraft gegenüber, zum Object und kehrt, als solches auf neue wahrgenommen,
in jene zurück. Hierzu aber ist die Sprache unentbehrlich.
Denn indem in ihr das geistige Streben sich Bahn durch die Lippen
bricht, kehrt das Erzeugniss desselben zum eignen Ohre zurück. Die
Vorstellung wird also in wirkliche Objectivität hinüberversetzt, ohne
322darum der Subjectivität entzogen zu werden. Dies vermag nur die Sprache;
und ohne diese, wo Sprache mitwirkt, auch stillschweigend immer
vorgehende Versetzung in zum Subject zurückkehrende Objectivität ist
die Bildung des Begriffs, mithin alles wahre Denken unmöglich. Ohne
daher irgend auf die Mittheilung zwischen Menschen und Menschen zu
sehn, ist das Sprechen eine nothwendige Bedingung des Denkens des
Einzelnen in abgeschlossener Einsamkeit. In der Erscheinung entwickelt
sich jedoch die Sprache nur gesellschaftlich, und der Mensch versteht
sich selbst nur, indem er die Verstehbarkeit seiner Worte an Andren
versuchend geprüft hat. Denn die Objectivität wird gesteigert,
wenn das selbstgebildete Wort aus fremdem Munde wiedertönt. Der
Subjectivität aber wird nichts geraubt, da der Mensch sich immer Eins
mit dem Menschen fühlt; ja auch sie wird verstärkt, da die in Sprache
verwandelte Vorstellung nicht mehr ausschliessend Einem Subject angehört.
Indem sie in andre übergeht, schliesst sie sich an das dem ganzen
menschlichen Geschlechte Gemeinsame an, von dem jeder Einzelne
eine, das Verlangen nach Vervollständigung durch die andren in sich
tragende Modification besitzt. Je grösser und bewegter das gesellige Zusammenwirken
auf eine Sprache ist, desto mehr gewinnt sie unter übrigens
gleichen Umständen. Was die Sprache in dem einfachen Acte der
Gedankenerzeugung nothwendig macht, das wiederholt sich auch unaufhörlich
im geistigen Leben des Menschen; die gesellige Mittheilung
durch Sprache gewährt ihm Ueberzeugung und Anregung. Die Denkkraft
bedarf etwas ihr Gleiches und doch von ihr Geschiednes. Durch
das Gleiche wird sie entzündet, durch das von ihr Geschiedne erhält sie
einen Prüfstein der Wesenheit ihrer innren Erzeugungen. Obgleich der
Erkenntnissgrund der Wahrheit, des unbedingt Festen, für den Menschen
nur in seinem Inneren liegen kann, so ist das Anringen seines geistigen
Strebens an sie immer von Gefahren der Täuschung umgeben.
Klar und unmittelbar nur seine veränderliche Beschränktheit fühlend,
muss er sie sogar als etwas ausser ihm Liegendes ansehn; und eines der
mächtigsten Mittel, ihr nahe zu kommen, seinen Abstand von ihr zu
messen, ist die gesellige Mittheilung an Andre. Alles Sprechen, von dem
einfachsten an, ist ein Anknüpfen des einzeln Empfundenen an die gemeinsame
Natur der Menschheit.
Mit dem Verstehen verhält es sich nicht anders. Es kann in der Seele
nichts, als durch eigne Thätigkeit vorhanden seyn, und Verstehen und
Sprechen sind nur verschiedenartige Wirkungen der nemlichen Sprachkraft.
Die gemeinsame Rede ist nie mit dem Uebergeben eines Stoffes
vergleichbar. In dem Verstehenden, wie im Sprechenden, muss derselbe
aus der eignen, innren Kraft entwickelt werden; und was der erstere
empfängt, ist nur die harmonisch stimmende Anregung. Es ist daher
dem Menschen auch so natürlich, das eben Verstandene gleich wieder
323auszusprechen. Auf diese Weise liegt die Sprache in jedem Menschen in
ihrem ganzen Umfange, was aber nichts Andres bedeutet, als dass jeder
ein, durch eine bestimmt modificirte Kraft, anstossend und beschränkend,
geregeltes Streben besitzt, die ganze Sprache, wie es äussere oder
innere Veranlassung herbeiführt, nach und nach aus sich hervorzubringen
und hervorgebracht zu verstehen.
Das Verstehen könnte jedoch nicht, so wie wir es eben gefunden haben,
auf innerer Selbstthätigkeit beruhen, und das gemeinschaftliche
Sprechen müsste etwas Andres, als bloss gegenseitiges Wecken des
Sprachvermögens des Hörenden seyn, wenn nicht in der Verschiedenheit
der Einzelnen die, sich nur in abgesonderte Individualitäten spaltende
Einheit der menschlichen Natur läge. Das Begreifen von Wörtern
ist durchaus etwas Andres, als das Verstehen unarticulirter Laute, und
fasst weit mehr in sich, als das blosse gegenseitige Hervorrufen des
Lauts und des angedeuteten Gegenstandes. Das Wort kann allerdings
auch als untheilbares Ganzes genommen werden, wie man selbst in der
Schrift wohl den Sinn einer Wortgruppe erkennt, ohne noch ihrer alphabetischen
Zusammensetzung gewiss zu seyn, und es wäre möglich,
dass die Seele des Kindes in den ersten Anfängen des Verstehens so verführe.
So wie aber nicht bloss das thierische Empfindungsvermögen,
sondern die menschliche Sprachkraft angeregt wird (und es ist viel
wahrscheinlicher, dass es auch im Kinde keinen Moment giebt, wo dies,
wenn auch noch so schwach, nicht der Fall wäre), so wird auch das
Wort, als articulirt, vernommen. Nun ist aber dasjenige, was die Articulation
dem blossen Hervorrufen seiner Bedeutung (welches natürlich
auch durch sie in höherer Vollkommenheit geschieht) hinzufügt, dass
sie das Wort unmittelbar durch seine Form als einen Theil eines unendlichen
Ganzen, einer Sprache, darstellt. Denn es ist durch sie, auch in
einzelnen Wörtern, die Möglichkeit gegeben, aus den Elementen dieser
eine wirklich bis ins Unbestimmte gehende Anzahl anderer Wörter
nach bestimmenden Gefühlen und Regeln zu bilden und dadurch unter
allen Wörtern eine Verwandtschaft, entsprechend der Verwandtschaft
der Begriffe, zu stiften. Die Seele würde aber von diesem künstlichen
Mechanismus gar keine Ahndung erhalten, die Articulation ebensowenig,
als der Blinde die Farbe begreifen, wenn ihr nicht eine Kraft beiwohnte,
jene Möglichkeit zur Wirklichkeit zu bringen. Denn die Sprache
kann ja nicht als ein da liegender, in seinem Ganzen übersehbarer
oder nach und nach mittheilbarer Stoff, sondern muss als ein sich ewig
erzeugender angesehen werden, wo die Gesetze der Erzeugung bestimmt
sind, aber der Umfang und gewissermassen auch die Art des
Erzeugnisses gänzlich unbestimmt bleiben. Das Sprechenlernen der
Kinder ist nicht ein Zumessen von Wörtern, Niederlegen im Gedächtniss
und Wiedernachlallen mit den Lippen, sondern ein Wachsen des
324Sprachvermögens durch Alter und Uebung. Das Gehörte thut mehr, als
bloss sich mitzutheilen; es schickt die Seele an, auch das noch nicht Gehörte
leichter zu verstehen, macht längst Gehörtes, aber damals halb
oder gar nicht Verstandenes, indem die Gleichartigkeit mit dem eben
Vernommenen der seitdem schärfer gewordenen Kraft plötzlich einleuchtet,
klar und schärft den Drang und das Vermögen, aus dem Gehörten
immer mehr und schneller in das Gedächtniss hinüberzuziehen,
immer weniger davon als blossen Klang vorüberrauschen zu lassen. Die
Fortschritte beschleunigen sich daher auch nicht, wie etwa beim Vocabellernen,
in gleichmässigern, nur durch die verstärkte Uebung des
Gedächtnisses wachsendem Verhältniss, sondern in beständig sich
selbst steigerndem Verhältniss, da die Erhöhung der Kraft und die Gewinnung
des Stoffs sich gegenseitig verstärken und erweitern. Dass bei
den Kindern nicht ein mechanisches Lernen der Sprache, sondern eine
Entwicklung der Sprachkraft vorgeht, beweist auch, dass, da den
hauptsächlichsten menschlichen Kräften ein gewisser Zeitpunkt im Lebensalter
zu ihrer Entwicklung angewiesen ist, alle Kinder unter den
verschiedenartigsten Umständen ungefähr in demselben, nur innerhalb
eines kurzen Zeitraums schwankenden Alter sprechen und verstehen.
Wie aber könnte sich der Hörende bloss durch das Wachsen seiner eignen,
sich abgeschieden in ihm entwickelnden Kraft des Gesprochenen
bemeistern, wenn nicht in dem Sprechenden und Hörenden dasselbe,
nur individuell und zu gegenseitiger Angemessenheit getrennte Wesen
wäre, so dass ein so feines, aber gerade aus der tiefsten und eigentlichsten
Natur desselben geschöpftes Zeichen, wie der articulirte Laut ist,
hinreicht, beide auf übereinstimmende Weise vermittelnd anzuregen?
Man könnte gegen das hier Gesagte einwenden wollen, dass Kinder
jedes Volkes, ehe sie sprechen, unter jedes fremde versetzt, ihr Sprachvermögen
an dessen Sprache entwickeln. Diese unläugbare Thatsache,
könnte man sagen, beweist deutlich, dass die Sprache bloss ein Wiedergeben
des Gehörten ist und, ohne Rücksicht auf Einheit oder Verschiedenheit
des Wesens, allein vom geselligen Umgange abhängt. Man hat
aber schwerlich in Fällen dieser Art mit hinlänglicher Genauigkeit bemerken
können, mit welcher Schwierigkeit die Stammanlage hat überwunden
werden müssen, und wie sie doch vielleicht in den feinsten
Nuancen unbesiegt zurückgeblieben ist. Ohne indess auch hierauf zu
achten, erklärt sich jene Erscheinung hinlänglich daraus, dass der
Mensch überall Eins mit dem Menschen ist, und die Entwicklung des
Sprachvermögens daher mit Hülfe jedes gegebenen Individuum vor
sich gehen kann. Sie geschieht darum nicht minder aus dem eignen Innern;
nur weil sie immer zugleich der äusseren Anregung bedarf, muss
sie sich derjenigen analog erweisen, die sie gerade erfährt, und kann es
bei der Uebereinstimmung aller menschlichen Sprachen. Die Gewalt
325der Abstammung über diese liegt demungeachtet klar genug in ihrer
Vertheilung nach Nationen vor Augen. Sie ist auch an sich leicht begreiflich,
da die Abstammung so vorherrschend mächtig auf die ganze
Individualität einwirkt, und mit dieser wieder die jedesmalige besondre
Sprache auf das innigste zusammenhängt. Träte nicht die Sprache
durch ihren Ursprung aus der Tiefe des menschlichen Wesens auch mit
der physischen Abstammung in wahre und eigentliche Verbindung,
warum würde sonst für den Gebildeten und Ungebildeten die vaterländische
eine so viel grössere Stärke und Innigkeit besitzen, als eine fremde,
dass sie das Ohr, nach langer Entbehrung, mit einer Art plötzlichen
Zaubers begrüsst und in der Ferne Sehnsucht erweckt? Es beruht dies
sichtbar nicht auf dem Geistigen in derselben, dem ausgedrückten Gedanken
oder Gefühle, sondern gerade auf dem Unerklärlichsten und Individuellsten,
auf ihrem Laute; es ist uns, als wenn wir mit dem heimischen
einen Theil unseres Selbst vernähmen.
Auch bei der Betrachtung des durch die Sprache Erzeugten wird die
Vorstellungsart, als bezeichne sie bloss die schon an sich wahrgenommenen
Gegenstände, nicht bestätigt. Man würde vielmehr niemals
durch sie den tiefen und vollen Gehalt der Sprache erschöpfen. Wie,
ohne diese, kein Begriff möglich ist, so kann es für die Seele auch kein
Gegenstand seyn, da ja selbst jeder äussere nur vermittelst des Begriffes
für sie vollendete Wesenheit erhält. In die Bildung und in den Gebrauch
der Sprache geht aber nothwendig die ganze Art der subjectiven Wahrnehmung
der Gegenstände über. Denn das Wort entsteht eben aus dieser
Wahrnehmung, ist nicht ein Abdruck des Gegenstandes an sich,
sondern des von diesem in der Seele erzeugten Bildes. Da aller objectiven
Wahrnehmung unvermeidlich Subjectivität beigemischt ist, so kann
man, schon unabhängig von der Sprache, jede menschliche Individualität
als einen eignen Standpunkt der Weltansicht betrachten. Sie wird
aber noch viel mehr dazu durch die Sprache, da das Wort sich der Seele
gegenüber auch wieder, wie wir weiter unten sehen werden, mit einem
Zusatz von Selbstbedeutung zum Object macht und eine neue Eigenthümlichkeit
hinzubringt. In dieser, als der eines Sprachlauts, herrscht
nothwendig in derselben Sprache eine durchgehende Analogie; und da
auch auf die Sprache in derselben Nation eine gleichartige Subjectivität
einwirkt, so liegt in jeder Sprache eine eigenthümliche Weltansicht. Wie
der einzelne Laut zwischen den Gegenstand und den Menschen, so tritt
die ganze Sprache zwischen ihn und die innerlich und äusserlich auf ihn
einwirkende Natur. Er umgiebt sich mit einer Welt von Lauten, um die
Welt von Gegenständen in sich aufzunehmen und zu bearbeiten. Diese
Ausdrücke überschreiten auf keine Weise das Mass der einfachen Wahrheit.
Der Mensch lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, ja, da Empfinden
und Handlen in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar
326ausschliesslich so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Durch denselben
Act, vermöge dessen er die Sprache aus sich herausspinnt, spinnt er
sich in dieselbe ein, und jede zieht um das Volk, welchem sie angehört,
einen Kreis, aus dem es nur insofern hinauszugehen möglich ist, als
man zugleich in den Kreis einer andren hinübertritt. Die Erlernung einer
fremden Sprache sollte daher die Gewinnung eines neuen Standpunkts
in der bisherigen Weltansicht seyn und ist es in der That bis auf
einen gewissen Grad, da jede Sprache das ganze Gewebe der Begriffe
und die Vorstellungsweise eines Theils der Menschheit enthält. Nur
weil man in eine fremde Sprache immer, mehr oder weniger, seine eigne
Welt-, ja seine eigne Sprachansicht hinüberträgt, so wird dieser Erfolg
nicht rein und vollständig empfunden.
Selbst die Anfänge der Sprache darf man sich nicht auf eine so dürftige
Anzahl von Wörtern beschränkt denken, als man wohl zu thun
pflegt, indem man ihre Entstehung, statt sie in dem ursprünglichen Berufe
zu freier, menschlicher Geselligkeit zu suchen, vorzugsweise dem
Bedürfniss gegenseitiger Hülfsleistung beimisst und die Menschheit in
einen eingebildeten Naturstand versetzt. Beides gehört zu den irrigsten
Ansichten, die man über die Sprache fassen kann. Der Mensch ist nicht
so bedürftig, und zur Hülfsleistung hätten unarticulirte Laute ausgereicht.
Die Sprache ist auch in ihren Anfängen durchaus menschlich
und dehnt sich absichtslos auf alle Gegenstände zufälliger sinnlicher
Wahrnehmung und innerer Bearbeitung aus. Auch die Sprache der sogenannten
Wilden, die doch einem solchen Naturstande näher kommen
müssten, zeigen gerade eine überall über das Bedürfniss überschiessende
Fülle und Mannigfaltigkeit von Ausdrücken. Die Worte entquillen
freiwillig, ohne Noth und Absicht, der Brust, und es mag wohl in keiner
Einöde eine wandernde Horde gegeben haben, die nicht schon ihre Lieder
besessen hätte. Denn der Mensch, als Thiergattung, ist ein singendes
Geschöpf, aber Gedanken mit den Tönen verbindend.
Die Sprache verpflanzt aber nicht bloss eine unbestimmbare Menge
stoffartiger Elemente aus der Natur in die Seele, sie führt ihr auch dasjenige
zu, was uns als Form aus dem Ganzen entgegenkommt. Die Natur
entfaltet vor uns eine bunte und nach allen sinnlichen Eindrücken
hin gestaltenreiche Mannigfaltigkeit, von lichtvoller Klarheit umstrahlt;
unser Nachdenken entdeckt in ihr eine unsrer Geistesform zusagende
Gesetzmässigkeit; abgesondert von dem körperlichen Daseyn der Dinge,
hängt an ihren Umrissen, wie ein nur für den Menschen bestimmter
Zauber, äussere Schönheit, in welcher die Gesetzmässigkeit mit dem
sinnlichen Stoff einen uns, indem wir von ihm ergriffen und hingerissen
werden, doch unerklärbar bleiben Bund eingeht. Alles dies finden wir
in analogen Anklängen in der Sprache wieder, und sie vermag es darzustellen.
Denn indem wir an ihrer Hand in eine Welt von Lauten übergehen,
327verlassen wir nicht die uns wirklich umgebende; mit der Gesetzmässigkeit
der Natur ist die ihres eignen Baues verwandt, und indem sie
durch diesen den Menschen in der Thätigkeit seiner höchsten und
menschlichsten Kräfte anregt, bringt sie ihn auch überhaupt dem Verständniss
des formalen Eindrucks der Natur näher, da diese doch auch
nur als eine wenngleich unerklärliche Entwicklung geistiger Kräfte betrachtet
werden kann; durch die dem Laute in seinen Verknüpfungen
eigenthümliche rhythmische und musikalische Form erhöht die Sprache,
ihn in ein andres Gebiet versetzend, den Schönheitseindruck der
Natur, wirkt aber, auch unabhängig von ihm, durch den blossen Fall der
Rede auf die Stimmung der Seele ein.
Von dem jedesmal Gesprochenen ist die Sprache, als die Masse seiner
Erzeugnisse, verschieden; und wir müssen, ehe wir diesen Abschnitt
verlassen, noch bei der näheren Betrachtung dieser Verschiedenheit
verweilen. Eine Sprache in ihrem ganzen Umfange enthält alles
durch sie in Laute Verwandelte. Wie aber der Stoff des Denkens und die
Unendlichkeit der Verbindungen desselben niemals erschöpft werden,
so kann dies ebensowenig mit der Menge des zu Bezeichnenden und zu
Verknüpfenden in der Sprache der Fall seyn. Die Sprache besteht daher,
neben den schon geformten Elementen, ganz vorzüglich auch aus Methoden,
die Arbeit des Geistes, welcher sie die Bahn und die Form vorzeichnet,
weiter fortzusetzen. Die einmal fest geformten Elemente bilden
zwar eine gewissermassen todte Masse, diese Masse trägt aber den
lebendigen Keim nie endender Bestimmbarkeit in sich. Auf jedem einzelnen
Punkt und in jeder einzelnen Epoche erscheint daher die Sprache,
gerade wie die Natur selbst, dem Menschen, im Gegensatze mit allem
ihm schon Bekannten und von ihm Gedachten, als eine
unerschöpfliche Fundgrube, in welcher der Geist immer noch Unbekanntes
entdecken und die Empfindung noch nicht auf diese Weise Gefühltes
wahrnehmen kann. In jeder Behandlung der Sprache durch eine
wahrhaft neue und grosse Genialität zeigt sich diese Erscheinung in der
Wirklichkeit; und der Mensch bedarf es zur Begeisterung in seinem immer
fortarbeitenden intellectuellen Streben und der fortschreitenden
Entfaltung seines geistigen Lebensstoffes, das ihm, neben dem Gebiete
des schon Errungenen, der Blick in eine unendliche, allmählich weiter
zu entwirrende Masse offen bleibe. Die Sprache enthält aber zugleich
nach zwei Richtungen hin eine dunkle, unenthüllte Tiefe. Denn auch
rückwärts fliesst sie aus unbekanntem Reichthum hervor, der sich nur
bis auf eine gewisse Weite noch erkennen lässt, dann aber sich schliesst
und nur das Gefühl seiner Unergründlichkeit zurücklässt. Die Sprache
hat diese anfangs- und endlose Unendlichkeit für uns, denen nur eine
kurze Vergangenheit Licht zuwirft, mit dem ganzen Daseyn des Menschengeschlechts
gemein. Man fühlt und ahndet aber in ihr deutlicher
328und lebendiger, wie auch die ferne Vergangenheit sich noch an das Gefühl
der Gegenwart knüpft, da die Sprache durch die Empfindungen
der früheren Geschlechter durchgegangen ist und ihren Anhauch bewahrt
hat, diese Geschlechter aber uns in denselben Lauten der Muttersprache,
die auch uns Ausdruck unsrer Gefühle wird, nationell und familienartig
verwandt sind.
Dies theils Feste, theils Flüssige in der Sprache bringt ein eignes Verhältniss
zwischen ihr und dem redenden Geschlechte hervor. Es erzeugt
sich in ihr ein Vorrath von Wörtern und ein System von Regeln, durch
welche sie in der Folge der Jahrtausende zu einer selbstständigen Macht
anwächst. Wir sind im Vorigen darauf aufmerksam geworden, dass der
in Sprache aufgenommene Gedanke für die Seele zum Object wird und
insofern eine ihr fremde Wirkung auf sie ausübt. Wir haben aber das
Object vorzüglich als aus dem Subject entstanden, die Wirkung als aus
demjenigen, worauf sie zurückwirkt, hervorgegangenen betrachtet.
Jetzt tritt die entgegengesetzte Ansicht ein, nach welcher die Sprache
wirklich ein fremdes Object, ihre Wirkung in der That aus etwas andrem,
als worauf sie wirkt hervorgegangen ist. Denn die Sprache muss
nothwendig (VII 56. 57.) zweien angehören und ist wahrhaft ein Eigenthum
des ganzen Menschengeschlechts. Da sie nun auch in der Schrift
den schlummernden Gedanken dem Geiste erweckbar erhält, so bildet
sie sich ein eigenthümliches Daseyn, das zwar immer nur in jedesmaligem
Denken Geltung erhalten kann, aber in seiner Totalität von diesem
unabhängig ist. Die beiden hier angeregten, einander entgegengesetzten
Ansichten, dass die Sprache der Seele fremd und ihr angehörend, von
ihr unabhängig und abhängig ist, verbinden sich wirklich in ihr und
machen die Eigenthümlichkeit ihres Wesens aus. Es muss dieser Widerstreit
auch nicht so gelöst werden, dass sie zum Theil fremd und unabhängig
und zum Theil beides nicht sey. Die Sprache ist gerade insofern
objectiv einwirkend und selbstständig, als sie subjectiv gewirkt und abhängig
ist. Denn sie hat nirgends, auch in der Schrift nicht, eine bleibende
Stätte, ihr gleichsam todter Theil muss immer im Denken aufs
neue erzeugt werden, lebendig in Rede oder Verständniss, und folglich
ganz in das Subject übergehen; es liegt aber in dem Act dieser Erzeugung,
sie gerade ebenso zum Object zu machen: sie erfährt auf diesem
Wege jedesmal die ganze Einwirkung des Individuum; aber diese Einwirkung
ist schon in sich durch das, was sie wirkt und gewirkt hat, gebunden.
Die wahre Lösung jenes Gegensatzes liegt in der Einheit der
menschlichen Natur. Was aus dem stammt, was eigentlich mit mir Eins
ist, darin gehen die Begriffe des Subjects und Objects, der Abhängigkeit
und Unabhängigkeit in einander über. Die Sprache gehört mir an, weil
ich sie so hervorbringe, als ich thue; und da der Grund hiervon zugleich
in dem Sprechen und Gesprochenhaben aller Menschengeschlechter
329liegt, soweit Sprachmittheilung ohne Unterbrechung unter ihnen gewesen
seyn mag, so ist es die Sprache selbst, von der ich dabei Einschränkung
erfahre. Allein was mich in ihr beschränkt und bestimmt, ist in sie
aus menschlicher, mit mir innerlich zusammenhängender Natur gekommen,
und das Fremde in ihr ist daher dies nur für meine augenblicklich
individuelle, nicht meine ursprünglich wahre Natur.
Wenn man bedenkt, wie auf die jedesmalige Generation in einem
Volke alles dasjenige bildend einwirkt, was die Sprache desselben alle
vorigen Jahrhunderte hindurch erfahren hat, und wie damit nur die
Kraft der einzelnen Generation in Berührung tritt und diese nicht einmal
rein, da das aufwachsende und abtretende Geschlecht untermischt
neben einander leben, so wird klar, wie gering eigentlich die Kraft des
Einzelnen gegen die Macht der Sprache ist. Nur durch die ungemeine
Bildsamkeit der letzteren, durch die Möglichkeit, ihre Formen, dem allgemeinen
Verständniss unbeschadet, auf sehr verschiedene Weise aufzunehmen,
und durch die Gewalt, welche alles lebendig Geistige über
das todt Ueberlieferte ausübt, wird das Gleichgewicht wieder einigermassen
hergestellt. Doch ist es immer die Sprache, in welcher jeder Einzelne
am lebendigsten fühlt, dass er nichts als ein Ausfluss des ganzen
Menschengeschlechts ist. Weil indess doch jeder einzeln und unaufhörlich
auf sie zurückwirkt, bringt demungeachtet jede Generation eine
Veränderung in ihr hervor, die sich nur oft der Beobachtung .entzieht.
Denn die Veränderung liegt nicht immer in den Wörtern und Formen
selbst, sondern bisweilen nur in dem anders modificirten Gebrauche
derselben; und dies letztere ist, wo Schrift und Literatur mangeln,
schwieriger wahrzunehmen. Die Rückwirkung des Einzelnen auf die
Sprache wird einleuchtender, wenn man, was zur scharfen Begränzung
der Begriffe nicht fehlen darf, bedenkt, dass die Individualität einer
Sprache (wie man das Wort gewöhnlich nimmt) auch nur vergleichungsweise
eine solche ist, dass aber die wahre Individualität nur in
dem jedesmal Sprechenden liegt. Erst im Individuum erhält die Sprache
ihre letzte Bestimmtheit. Keiner denkt bei dem Wort gerade und genau
das, was der andre, und die noch so kleine Verschiedenheit zittert, wie
ein Kreis im Wasser, durch die ganze Sprache fort. Alles Verstehen ist
daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen, alle Uebereinstimmung in
Gedanken und Gefühlen zugleich ein Auseinandergehen. In der Art,
wie sich die Sprache in jedem Individuum modificirt, offenbart sich, ihrer
im Vorigen dargestellten Macht gegenüber, eine Gewalt des Menschen
über sie. Ihre Macht kann man (wenn man den Ausdruck auf geistige
Kraft anwenden will) als ein physiologisches Wirken ansehen; die
von ihm ausgehende Gewalt ist ein rein dynamisches. In dem auf ihn
ausgeübten Einfluss liegt die Gesetzmässigkeit der Sprache und ihrer
Formen, in der aus ihm kommenden Rückwirkung ein Princip der Freiheit.
330Denn es kann im Menschen etwas aufsteigen, dessen Grund kein
Verstand in den vorhergehenden Zuständen aufzufinden vermag; und
man würde die Natur der Sprache verkennen und gerade die geschichtliche
Wahrheit ihrer Entstehung und Umänderung verletzen, wenn man
die Möglichkeit solcher unerklärbaren Erscheinungen von ihr ausschliessen
wollte. Ist aber auch die Freiheit an sich unbestimmbar und
unerklärlich, so lassen sich doch vielleicht ihre Gränzen innerhalb eines
gewissen ihr allein gewährten Spielraums auffinden; und die Sprachuntersuchung
muss die Erscheinung der Freiheit erkennen und ehren,
aber auch gleich sorgfältig ihren Gränzen nachspüren.
Lautsystem der Sprachen. Natur des articulirten Lautes
15. Der Mensch nöthigt den articulirten Laut, die Grundlage und das
Wesen alles Sprechens, seinen körperlichen Werkzeugen durch den
Drang seiner Seele ab, und das Thier würde das Nemliche zu thun vermögen,
wenn es von dem gleichen Drange beseelt wäre. So ganz und
ausschliesslich ist die Sprache schon in ihrem ersten und unentbehrlichsten
Elemente in der geistigen Natur des Menschen gegründet, dass
ihre Durchdringung hinreichend, aber nothwendig ist, den thierischen
Laut in articulirten zu verwandeln. Denn die Absicht und die Fähigkeit
zur Bedeutsamkeit, und zwar nicht zu dieser überhaupt, sondern zu der
bestimmten durch Darstellung eines Gedachten, macht allein den articulirten
Laut aus, und es lässt sich nichts andres angeben, um seinen
Unterschied auf der einen Seite vom thierischen Geschrei, auf der andren
vom musikalischen Ton zu bezeichnen. Er kann nicht seiner Beschaffenheit,
sondern nur seiner Erzeugung nach beschrieben werden,
und dies liegt nicht im Mangel unsrer Fähigkeit, sondern charakterisirt
ihn in seiner eigenthümlichen Natur, da er eben nichts, als das absichtliche
Verfahren der Seele, ihn hervorzubringen, ist und nur so viel Körper
enthält, als die äussere Wahrnehmung nicht zu entbehren vermag.
Dieser Körper, der hörbare Laut, lässt sich sogar gewissermassen
von ihm trennen und die Articulation dadurch noch reiner herausheben.
Dies sehen wir an den Taubstummen. Durch das Ohr ist jeder Zugang
zu ihnen verschlossen; sie lernen aber das Gesprochene an der
Bewegung der Sprachwerkzeuge des Redenden und an der Schrift, deren
Wesen die Articulation schon ganz ausmacht, verstehen; sie sprechen
selbst, indem man die Lage und Bewegung ihrer Sprachwerkzeuge
lenkt. Dies kann nur durch das, auch ihnen beiwohnende Articulationsvermögen
geschehen, indem sie, durch den Zusammenhang ihres Denkens
mit ihren Sprachwerkzeugen, im Andren aus dem einen Gliede,
der Bewegung seiner Sprachwerkzeuge, das andre, sein Denken, errathen
331lernen. Der Ton, den wir hören, offenbart sich ihnen durch die
Lage und Bewegung der Organe und durch die hinzukommende
Schrift, sie vernehmen durch das Auge und das angestrengte Bemühen
des Selbstsprechens seine Articulation ohne sein Geräusch. Es geht also
in ihnen eine merkwürdige Zerlegung des articulirten Lautes vor. Sie
verstehen, da sie alphabetisch lesen und schreiben und selbst reden lernen,
wirklich die Sprache, erkennen nicht bloss angeregte Vorstellungen
an Zeichen oder Bildern. Sie lernen reden, nicht bloss dadurch,
dass sie Vernunft, wie andre Menschen, sondern ganz eigentlich dadurch,
dass sie auch Sprachfähigkeit besitzen, Uebereinstimmung ihres
Denkens mit ihren Sprachwerkzeugen, und Drang, beide zusammenwirken
zu lassen, das eine und das andere wesentlich gegründet in der
menschlichen, wenn auch von einer Seite verstümmelten Natur. Der
Unterschied zwischen ihnen und uns ist, dass ihre Sprachwerkzeuge
nicht durch das Beispiel eines fertigen articulirten Lautes zur Nachahmung
geweckt werden, sondern die Aeusserung ihrer Thätigkeit auf einem
naturwidrigen, künstlichen Umwege erlernen müssen. Es erweist
sich aber auch an ihnen, wie tief und enge die Schrift, selbst wo die
Vermittlung des Ohres fehlt, mit der Sprache zusammenhängt.
Die Articulation beruht auf der Gewalt des Geistes über die Sprachwerkzeuge,
sie zu einer der Form seines Wirkens entsprechenden Behandlung
des Lautes zu nöthigen. Dasjenige, worin sich diese Form und
die Articulation, wie in einem verknüpfenden Mittel, begegnen, ist, dass
beide ihr Gebiet in Grundtheile zerlegen, deren Zusammenfügung lauter
solche Ganze bildet, welche das Streben in sich tragen, Theile neuer
Ganze zu werden. Das Denken fordert ausserdem Zusammenfassung
des Mannigfaltigen in Einheit. Die nothwendigen Merkmale des articulirten
Lautes sind daher scharf zu vernehmende Einheit und eine Beschaffenheit,
die sich mit andren und allen denkbaren articulirten Lauten
in ein bestimmtes Verhältniss zu stellen vermag. Die Geschiedenheit
des Lautes von allen ihn verunreinigenden Nebenklängen ist zu seiner
Deutlichkeit und der Möglichkeit zusammentönenden Wohllauts unentbehrlich,
fliesst aber auch unmittelbar aus der Absicht, ihn zum Elemente
der Rede zu machen. Er steht von selbst rein da, wenn diese
wahrhaft energisch ist, sich von verwirrtem und dunklem thierischen
Geschrei losmacht und als Erzeugniss rein menschlichen Dranges und
menschlicher Absicht hervortritt. Die Einpassung in ein System, vermöge
dessen jeder articulirte Laut etwas an sich trägt, in Beziehung worauf
andre ihm zur Seite oder gegenüber stehen, wird durch die Art der Erzeugung
bewirkt. Denn jeder einzelne Laut wird in Beziehung auf die
übrigen, mit ihm gemeinschaftlich zur freien Vollständigkeit der Rede
nothwendigen gebildet. Ohne dass sich angeben liesse, wie dies zugeht,
brechen aus jedem Volke gerade die articulirten Laute und in derjenigen
332Beziehung auf einander hervor, welche und wie sie das Sprachsystem
desselben erfordert. Die ersten Hauptunterschiede bildet die Verschiedenheit
der Sprachwerkzeuge und des räumlichen Ortes in jedem
derselben, wo der articulirte Laut hervorgebracht wird. Es gesellen sich
dann zu ihm Nebenbeschaffenheiten, die jedem, ohne Rücksicht auf die
Verschiedenheit der Organe, eigen seyn können, wie Hauch, Zischen,
Nasenton u.s.w. Von diesen droht jedoch der reinen Geschiedenheit
der Laute Gefahr, und es ist ein doppelt starker Beweis des Vorwaltens
richtigen Sprachsinns, wenn ein Alphabet diese Laute dergestalt durch
die Aussprache gezügelt enthält, dass sie vollständig und doch dem
feinsten Ohre unvermischt und rein hervortönen. Diese Nebenbeschaffenheiten
müssen alsdann mit der ihnen zum Grunde liegenden Articulation
in eine eigne Modification des Hauptlautes zusammenschmelzen
und auf jede andre, ungeregelte Weise durchaus verbannt seyn.
Die consonantisch gebildeten articulirten Laute lassen sich nicht anders,
als von einem Klang gebenden Luftzuge begleitet aussprechen.
Dies Ausströmen der Luft giebt nach dem Orte, wo es erzeugt wird,
und nach der Oeffnung, durch die es strömt, ebenso bestimmt verschiedne
und gegen einander in festen Verhältnissen stehende Laute, als
die der Consonantenreihe. Durch dies gleichzeitig zwiefache Lautverfahren
wird die Sylbe gebildet. In dieser aber liegen nicht, wie es, nach
unsrer Art zu schreiben, scheinen sollte, zwei oder mehrere Laute, sondern
eigentlich nur Ein auf eine bestimmte Weise herausgestossener.
Die Theilung der einfachen Sylbe in einen Consonanten und Vocal, insofern
man sich beide als selbstständig denken will, ist nur eine künstliche.
In der Natur bestimmen sich Consonant und Vocal dergestalt gegenseitig,
dass sie für das Ohr eine durchaus unzertrennliche Einheit
ausmachen. Soll daher auch die Schrift diese natürliche Beschaffenheit
bezeichnen, so ist es richtiger, so wie es mehrere Asiatische Alphabete
thun, die Vocale gar nicht als eigne Buchstaben, sondern bloss als Modificationen
der Consonanten zu behandeln. Genau genommen, können
auch die Vocale nicht allein ausgesprochen werden. Der sie bildende
Luftstrom bedarf eines ihn hörbar machenden Anstosses; und giebt diesen
kein klar anlautender Consonant, so ist dazu ein, auch noch so leiser
Hauch erforderlich, den einige Sprachen auch in der Schrift jedem
Anfangsvocal vorausgehen lassen. Dieser Hauch kann sich gradweise
bis zum wirklich gutturalen Consonanten verstärken, und die Sprache
kann die verschiednen Stufen dieser Verhärtung, als eigne Buchstaben,
bezeichnen. Der Vocal verlangt dieselbe reine Geschiedenheit, als der
Consonant, und die Sylbe muss diese doppelte an sich tragen. Sie ist
aber im Vocalsystem, obgleich der Vollendung der Sprache nothwendiger,
dennoch schwieriger zu bewahren. Der Vocal verbindet sich nicht
bloss mit einem ihm vorangehenden, sondern ebensowohl mit einem
333ihm nachfolgenden Laute, der ein reiner Consonant, aber auch ein blosser
Hauch, wie das Sanskritische Wisarga und in einigen Fällen das
Arabische schliessende Elif seyn kann. Gerade dort aber ist die Reinheit
des Lautes, vorzüglich wenn sich kein eigentlicher Consonant, sondern
nur eine Nebenbeschaffenheit der articulirten Laute an den Vocal anschliesst,
für das Ohr schwieriger, als beim Anlaute zu erreichen, so
dass die Schrift einiger Völker von dieser Seite her sehr mangelhaft erscheint.
Durch die zwei, sich immer gegenseitig bestimmenden, aber
doch sowohl durch das Ohr, als die Abstraction bestimmt unterschiedenen
Consonanten- und Vocalreihen entsteht nicht nur eine neue Mannigfaltigkeit
von Verhältnissen im Alphabete, sondern auch ein Gegensatz
dieser beiden Reihen gegen einander, von welchem die Sprache
vielfachen Gebrauch macht.
In der Summe der articulirten Laute lässt sich also bei jedem Alphabete
ein Zwiefaches unterscheiden, wodurch dasselbe mehr oder weniger
wohlthätig auf die Sprache einwirkt, nemlich der absolute Reichthum
desselben an Lauten und das relative Verhältniss dieser Laute zu
einander und zu der Vollständigkeit und Gesetzmässigkeit eines vollendeten
Lautsystems. Ein solches System enthält nemlich, seinem Schema
nach, als ebenso viele Classen der Buchstaben, die Arten, wie die articulirten
Laute sich in Verwandtschaft an einander reihen oder in Verschiedenheit
einander gegenüberstellen, Gegensatz und Verwandtschaft von
allen den Beziehungen aus genommen, in welchen sie statt finden können.
Bei Zergliederung einer einzelnen Sprache fragt es sich nun zuerst,
ob die Verschiedenartigkeit ihrer Laute vollständig oder mangelhaft die
Punkte des Schemas besetzt, welche die Verwandtschaft oder der Gegensatz
angeben, und ob daher der, oft nicht zu verkennende Reichthum
an Lauten nach einem dem Sprachsinne des Volks in allen seinen
Theilen zusagenden Bilde des ganzen Lautsystems gleichmässig vertheilt
ist oder Classen Mangel leiden, indem andre Ueberfluss haben?
Die wahre Gesetzmässigkeit, der das Sanskrit in der That sehr nahe
kommt, würde erfordern, dass jeder nach dem Ort seiner Bildung verschiedenartige
articulirte Laut durch alle Classen, mithin durch alle
Laut-Modificationen durchgeführt sey, welche das Ohr in den Sprachen
zu unterscheiden pflegt. Bei diesem ganzen Theile der Sprachen kommt
es, wie man leicht sieht, vor allem auf eine glückliche Organisation des
Ohrs und der Sprachwerkzeuge an. Es ist aber auch keinesweges gleichgültig,
wie klangreich oder lautarm, gesprächig oder schweigsam ein
Volk seinem Naturell und seiner Empfindungsweise nach sey. Denn das
Gefallen am articulirt hervorgebrachten Laute giebt demselben Reichthum
und Mannigfaltigkeit an Verknüpfungen. Selbst dem unarticulirten
Laute kann ein gewisses freies und daher edleres Gefallen an seiner
Hervorbringung nicht immer abgesprochen werden. Oft entpresst ihn
334zwar, wie bei widrigen Empfindungen, die Noth; in andren Fällen liegt
ihm Absicht zum Grunde, indem er lockt, warnt oder zur Hülfe herbeiruft.
Aber er entströmt auch, ohne Noth und Absicht, dem frohen Gefühle
des Daseyns und nicht bloss der rohen Lust, sondern auch dem
zarteren Gefallen am kunstvolleren Schmettern der Töne. Dies Letzte
ist das Poetische, ein aufglimmender Funke in der thierischen Dumpfheit.
Diese verschiednen Arten der Laute sind unter die mehr oder minder
stummen und klangreichen Geschlechter der Thiere sehr ungleich
vertheilt, und verhältnissmässig wenigen ist die höhere und freudigere
Gattung geworden. Es wäre, auch für die Sprache, belehrend, bleibt
aber vielleicht immer unergründet, woher diese Verschiedenheit
stammt. Dass die Vögel allein Gesang besitzen, liesse sich vielleicht daraus
erklären, dass sie freier, als alle andre Thiere, in dem Elemente des
Tons und in seinen reineren Regionen leben, wenn nicht so viele Gattungen
derselben, gleich den auf der Erde wandelnden Thieren, an wenige
einförmige Laute gebunden wären.
In der Sprache entscheidet jedoch nicht gerade der Reichthum an
Lauten, es kommt vielmehr im Gegentheil auf keusche Beschränkung
auf die der Rede notwendigen Laute und auf das richtige Gleichgewicht
zwischen denselben an. Der Sprachsinn muss daher noch etwas
andres enthalten, was wir uns nicht im Einzelnen zu erklären vermögen,
ein instinctartiges Vorgefühl des ganzen Systems, dessen die Sprache
in dieser ihrer individuellen Form bedürfen wird. Was sich eigentlich
in der ganzen Spracherzeugung wiederholt, tritt auch hier ein. Man
kann die Sprache mit einem ungeheuren Gewebe vergleichen, in dem
jeder Theil mit dem andren und alle mit dem Ganzen in mehr oder weniger
deutlich erkennbarem Zusammenhange stehen. Der Mensch berührt
im Sprechen, von welchen Beziehungen man ausgehen mag, immer
nur einen abgesonderten Theil dieses Gewebes, thut dies aber
instinctartig immer dergestalt, als wären ihm zugleich alle, mit welchen
jener einzelne nothwendig in Uebereinstimmung stehen muss, im gleichen
Augenblick gegenwärtig.
Lautsystem der Sprachen. Lautveränderungen
16. Die einzelnen Articulationen machen die Grundlage aller Lautverknüpfungen
der Sprache aus. Die Gränzen, in welche diese dadurch
eingeschlossen werden, erhalten aber zugleich ihre noch nähere Bestimmung
durch die den meisten Sprachen eigentümliche Lautumformung,
die auf besondren Gesetzen und Gewohnheiten beruht. Sie geht
sowohl die Consonanten-, als Vocalreihe an, und einige Sprachen unterscheiden
sich noch dadurch, dass sie von der einen oder andren dieser
335Reihen vorzugsweise oder zu verschiednen Zwecken Gebrauch machen.
Der wesentliche Nutzen dieser Umformung besteht darin, dass,
indem der absolute Sprachreichthum und die Laut-Mannigfaltigkeit dadurch
vermehrt werden, dennoch an dem umgeformten Element sein
Urstamm erkannt werden kann. Die Sprache wird dadurch in den
Stand gesetzt, sich in grösserer Freiheit zu bewegen, ohne dadurch den
dem Verständnisse und dem Aufsuchen der Verwandtschaft der Begriffe
nothwendigen Faden zu verlieren. Denn diese folgen der Veränderung
der Laute oder geben ihr gesetzgebend voran, und die Sprache
gewinnt dadurch an lebendiger Anschaulichkeit. Mangelnde Lautumformung
setzt dem Wiedererkennen der bezeichneten Begriffe an den
Lauten Hindernisse entgegen, eine Schwierigkeit, die im Chinesischen
noch fühlbarer seyn würde, wenn nicht dort sehr häufig, in Ableitung
und Zusammensetzung, die Analogie der Schrift an die Stelle der Laut-Analogie
träte. Die Lautumformung unterliegt aber einem zwiefachen,
sich oft gegenseitig unterstüzenden, allein auch in andren Fällen einander
entgegenkämpfenden Gesetze. Das eine ist ein bloss organisches,
aus den Sprachwerkzeugen und ihrem Zusammenwirken entstehend,
von der Leichtigkeit und Schwierigkeit der Aussprache abhängend und
daher der natürlichen Verwandtschaft der Laute folgend. Das andre
wird durch das geistige Princip der Sprache gegeben, hindert die Organe,
sich ihrer blossen Neigung oder Trägheit zu überlassen, und hält sie
bei Lautverbindungen fest, die ihnen an sich nicht natürlich seyn würden.
Bis auf einen gewissen Grad stehen beide Gesetze in Harmonie
mit einander. Das geistige muss zur Beförderung leichter und fliessender
Aussprache dem andren, soviel es möglich ist, nachgebend huldigen,
ja bisweilen, um von einem Laute zum andren, wenn eine solche
Verbindung durch die Bezeichnung als nothwendig erachtet wird, zu
gelangen, andre, bloss organische Uebergänge ins Werk richten. In gewisser
Absicht aber stehen beide Gesetze einander so entgegen, dass,
wenn das geistige in der Kraft seiner Einwirkung nachlässt, das organische
das Uebergewicht gewinnt, so wie im thierischen Körper beim
Erlöschen des Lebensprincips die chemischen Affinitäten die Herrschaft
erhalten. Das Zusammenwirken und der Widerstreit dieser beiden
Gesetze bringt sowohl in der uns ursprünglich scheinenden Form
der Sprachen, als in ihrem Verfolge mannigfaltige Erscheinungen hervor,
welche die genaue grammatische Zergliederung entdeckt und aufzählt.
Die Lautumformung, von der wir hier reden, kommt hauptsächlich
in zwei oder wenn man will, in drei Stadien der Sprachbildung vor: bei
den Wurzeln, den daraus abgeleiteten Wörtern und deren weiterer Ausbildung
in die verschiednen allgemeinen, in der Natur der Sprache liegenden
Formen. Mit dem eigenthümlichen Systeme, welches jede Sprache
336hierin annimmt, muss ihre Schilderung beginnen. Denn es ist
gleichsam das Bett, in welchem ihr Strom von Zeitalter zu Zeitalter
fliesst; ihre allgemeinen Richtungen werden dadurch bedingt und ihre
individuellsten Erscheinungen weiss eine beharrliche Zergliederung auf
diese Grundlage zurückzuführen.
Lautsystem der Sprachen. Vertheilung der Laute
unter die Begriffe
17. Unter Wörtern versteht man die Zeichen der einzelnen Begriffe. Die
Sylbe bildet eine Einheit des Lautes; sie wird aber erst zum Worte, wenn
sie für sich Bedeutsamkeit erhält, wozu oft eine Verbindung mehrerer
gehört. Es kommt daher in dem Worte allemal eine doppelte Einheit,
des Lautes und des Begriffes, zusammen. Dadurch werden die Wörter
zu den wahren Elementen der Rede, da die der Bedeutsamkeit ermangelnden
Sylben nicht eigentlich so genannt werden können. Wenn man
sich die Sprache als eine zweite, von dem Menschen nach den Eindrücken,
die er von der wahren empfängt, aus sich selbst heraus objectivirte
Welt vorstellt, so sind die Wörter die einzelnen Gegenstände darin, denen
daher der Charakter der Individualität, auch in der Form, erhalten
werden muss. Die Rede läuft zwar in ungetrennter Stätigkeit fort, und
der Sprechende, ehe auf die Sprache gerichtete Reflexion hinzutritt, hat
darin nur das Ganze des zu bezeichnenden Gedanken im Auge. Man
kann sich unmöglich die Entstehung der Sprache als von der Bezeichnung
der Gegenstände durch Wörter beginnend und von da zur Zusammenfügung
übergehend denken. In der Wirklichkeit wird die Rede nicht
aus ihr vorangegangenen Wörtern zusammengesetzt, sondern die Wörter
gehen umgekehrt aus dem Ganzen der Rede hervor. Sie werden aber
auch schon ohne eigentliche Reflexion und selbst in dem rohesten und
ungebildetsten Sprechen empfunden, da die Wortbildung ein wesentliches
Bedürfniss des Sprechens ist. Der Umfang des Worts ist die Gränze,
bis zu welcher die Sprache selbstthätig bildend ist. Das einfache
Wort ist die vollendete, ihr entknospende Blüthe. In ihm gehört ihr das
fertige Erzeugniss selbst an. Dem Satz und der Rede bestimmt sie nur
die regelnde Form und überlässt die individuelle Gestaltung der Willkühr
des Sprechenden. Die Wörter erscheinen auch oft in der Rede
selbst isolirt, allein ihre wahre Herausfindung aus dem Continuum derselben
gelingt nur der Schärfe des schon mehr vollendeten Sprachsinnes;
und es ist dies gerade ein Punkt, in welchem die Vorzüge und Mängel
einzelner Sprachen vorzüglich sichtbar werden.
Da die Wörter immer Begriffen gegenüberstehen, so ist es natürlich,
verwandte Begriffe mit verwandten Lauten zu bezeichnen. Wenn man
337die Abstammung der Begriffe, mehr oder weniger deutlich, im Geiste
wahrnimmt, so muss ihr eine Abstammung in den Lauten entsprechen,
so dass Verwandtschaft der Begriffe und Laute zusammentrifft. Die
Lautverwandtschaft, die doch nicht zu Einerleiheit des Lautes werden
soll, kann nur daran sichtbar seyn, dass ein Theil des Wortes einen, gewissen
Regeln unterworfenen Wechsel erfährt, ein anderer Theil dagegen
ganz unverändert oder nur in leicht erkennbarer Veränderung bestehen
bleibt. Diese festen Theile der Wörter und Wortformen nennt
man die wurzelhaften und wenn sie abgesondert dargestellt werden, die
Wurzeln der Sprache selbst. Diese Wurzeln erscheinen in ihrer nackten
Gestalt in der zusammengefügten Rede in einigen Sprachen selten, in
anderen gar nicht. Sondert man die Begriffe genau, so ist das letztere
sogar immer der Fall. Denn so wie sie in die Rede eintreten, nehmen sie
auch in Gedanken eine ihrer Verbindung entsprechende Kategorie an
und enthalten daher nicht mehr den nackten und formlosen Wurzelbegriff.
Auf der andren Seite kann man sie aber auch nicht in allen
Sprachen ganz als eine Frucht der blossen Reflexion und als das letzte
Resultat der Wortzergliederung, also lediglich wie eine Arbeit der
Grammatiker ansehen. In Sprachen, welche bestimmte Ableitungsgesetze
in grosser Mannigfaltigkeit von Lauten und Ausdrücken besitzen,
müssen die wurzelhaften Laute sich in der Phantasie und dem Gedächtniss
der Redenden leicht als die eigentlich ursprünglich, aber, bei ihrer
Wiederkehr in so vielen Abstufungen der Begriffe, als die allgemein bezeichnenden
herausheben. Prägen sie sich als solche dem Geiste tief
ein, so werden sie leicht auch in die verbundene Rede unverändert eingeflochten
werden und mithin der Sprache auch in wahrer Wortform
angehören. Sie können aber auch schon in uralter Zeit in der Periode
des Aufsteigens zur Formung auf diese Weise gebräuchlich gewesen
seyn, so dass sie wirklich den Ableitungen vorausgegangen und Bruchstücke
einer später erweiterten und umgeänderten Sprache wären. Auf
diese Weise lässt sich erklären, wie wir z. B. im Sanskrit, wenn wir die
uns bekannten Schriften zu Rathe ziehen, nur gewisse Wurzeln gewöhnlich
in die Rede eingefugt finden. Denn in diesen Dingen waltet
natürlich in den Sprachen auch der Zufall mit; und wenn die Indischen
Grammatiker sagen, dass jede ihrer angeblichen Wurzeln so gebraucht
werden könne, so ist dies wohl nicht eine aus der Sprache entnommene
Thatsache, sondern eher ein ihr eigenmächtig gegebenes Gesetz. Sie
scheinen überhaupt, auch bei den Formen, nicht bloss die gebräuchlichen
gesammelt, sondern jede Form durch alle Wurzeln durchgeführt
zu haben; und dies System der Verallgemeinerung ist auch in andren
Theilen der SanskritGrammatik genau zu beachten. Die Aufzählung
der Wurzeln beschäftigte die Grammatiker vorzüglich, und die vollständige
Zusammenstellung derselben ist unstreitig ihr Werk. 16 Es giebt
338aber auch Sprachen, die in dem hier angenommenen Sinn wirklich keine
Wurzeln haben, weil es ihnen an Ableitungsgesetzen und Lautumformung
von einfacheren Lautverknüpfungen aus fehlt. Alsdann fallen,
wie im Chinesischen, Wurzeln und Wörter zusammen, da sich die letzteren
in keine Formen auseinander legen oder erweitern; die Sprache
besitzt bloss Wurzeln. Von solchen Sprachen aus wäre es denkbar, dass
andere, den Wörtern jene Lautumformung hinzufügende entstanden
wären, so dass die nackten Wurzeln der letzteren den Wortvorrath einer
älteren, in ihnen aus der Rede ganz oder zum Theil verschwundenen
Sprache ausmachten. Ich führe dies aber bloss als eine Möglichkeit an;
dass es sich wirklich mit irgend einer Sprache also verhielte, könnte nur
geschichtlich erwiesen werden.
Wir haben die Wörter hier, zum Einfachen hinaufgehend, von den
Wurzeln gesondert. Wir können sie aber auch, zum noch Verwickelteren
hinabsteigend, von den eigentlich grammatischen Formen unterscheiden.
Die Wörter müssen nemlich, um in die Rede eingefugt zu
werden, verschiedene Zustände andeuten, und die Bezeichnung dieser
kann an ihnen selbst geschehen, so dass dadurch eine dritte, in der Regel
erweiterte Lautform entspringt. Ist die hier angedeutete Trennung
scharf und genau in einer Sprache, so können die Wörter der Bezeichnung
dieser Zustände nicht entbehren und also, insofern dieselben
durch Lautverschiedenheit bezeichnet sind, nicht unverändert in die
Rede eintreten, sondern höchstens als Theile andrer, diese Zeichen an
sich tragender Wörter darin erscheinen. Wo dies nun in einer Sprache
der Fall ist, nennt man diese Wörter Grundwörter; die Sprache besitzt
alsdann wirklich eine Lautform in dreifach sich erweiternden Stadien,
und dies ist der Zustand, in welchem sich ihr Lautsystem zu dem grössten
Umfange ausdehnt.
18. Die Vorzüge einer Sprache in Absicht ihres Lautsystems beruhen
aber, ausser der Feinheit der Sprachwerkzeuge und des Ohrs und ausser
der Neigung, dem Laute die grösste Mannigfaltigkeit und die vollendetste
Ausbildung zu geben, ganz besonders noch auf der Beziehung desselben
zur Bedeutsamkeit. Die äusseren, zu allen Sinnen zugleich sprechenden
Gegenstände und die innren Bewegungen des Gemüths bloss
durch Eindrücke auf das Ohr darzustellen, ist eine im Einzelnen grossentheils
unerklärbare Operation. Dass Zusammenhang zwischen dem
Laute und dessen Bedeutung vorhanden ist, scheint gewiss; die Beschaffenheit
dieses Zusammenhanges aber lässt sich selten vollständig
angeben, oft nur ahnden und noch viel öfter gar nicht errathen. Wenn
man bei den einfachen Wörtern stehen bleibt, da von den zusammengesetzten
hier nicht die Rede seyn kann, so sieht man einen dreifachen
Grund, gewisse Laute mit gewissen Begriffen zu verbinden, fühlt aber
zugleich, dass damit, besonders in der Anwendung, bei weitem nicht
339Alles erschöpft ist. Man kann hiernach eine dreifache Bezeichnung der
Begriffe unterscheiden:
1. Die unmittelbar nachahmende, wo der Ton, welchen ein tönender
Gegenstand hervorbringt, in dem Worte so weit nachgebildet wird, als
articulirte Laute unarticulirte wiederzugeben im Stande sind. Diese Bezeichnung
ist gleichsam eine malende; so wie das Bild die Art darstellt,
wie der Gegenstand dem Auge erscheint, zeichnet die Sprache die, wie
er vom Ohre vernommen wird. Da die Nachahmung hier immer unarticulirte
Töne trifft, so ist die Articulation mit dieser Bezeichnung gleichsam
im Widerstreite; und je nachdem sie ihre Natur zu wenig oder zu
heftig in diesem Zwiespalte geltend macht, bleibt entweder zu viel des
Unarticulirten übrig, oder es verwischt sich bis zur Unkennbarkeit. Aus
diesem Grunde ist diese Bezeichnung, wo sie irgend stark hervortritt,
nicht von einer gewissen Rohheit freizusprechen, kommt bei einem reinen
und kräftigen Sprachsinn wenig hervor und verliert sich nach und
nach in der fortschreitenden Ausbildung der Sprache.
2. Die nicht unmittelbar, sondern in einer dritten, dem Laute und
dem Gegenstande gemeinschaftlichen Beschaffenheit nachahmende Bezeichnung.
Man kann diese, obgleich der Begriff des Symbols in der
Sprache viel weiter geht, die symbolische nennen. Sie wählt für die zu.
bezeichnenden Gegenstände Laute aus, welche theils an sich, theils in
Vergleichung mit andren für das Ohr einen dem des Gegenstandes auf
die Seele ähnlichen Eindruck hervorbringen, wie stehen, stätig, starr
den Eindruck des Festen, das Sanskritische lî, schmelzen, auseinandergehen,
den des Zerfliessenden, nicht, nagen, Neid den des fein und
scharf Abschneidenden. Auf diese Weise erhalten ähnliche Eindrücke
hervorbringende Gegenstände Wörter mit vorherrschend gleichen Lauten,
wie wehen, Wind, Wolke, wirren, Wunsch, in welchen allen die
schwankende, unruhige, vor den Sinnen undeutlich durcheinandergehende
Bewegung durch das aus dem, an sich schon dumpfen und hohlen
u verhärtete w ausgedrückt wird. Diese Art der Bezeichnung, die
auf einer gewissen Bedeutsamkeit jedes einzelnen Buchstaben und ganzer
Gattungen derselben beruht, hat unstreitig auf die primitive Wortbezeichnung
eine grosse, vielleicht ausschliessliche Herrschaft ausgeübt.
Ihre nothwendige Folge musste eine gewisse Gleichheit der
Bezeichnung durch alle Sprachen des Menschengeschlechts hindurch
seyn, da die Eindrücke der Gegenstände überall mehr oder weniger in
dasselbe Verhältniss zu denselben Lauten treten mussten. Vieles von
dieser Art lässt sich noch heute in den Sprachen erkennen und muss
billigerweise abhalten, alle sich antreffende Gleichheit der Bedeutung
und Laute sogleich für Wirkung gemeinschaftlicher Abstammung zu
halten. Will man aber daraus, statt eines bloss die geschichtliche Herleitung
beschränkenden oder die Entscheidung durch einen nicht zurückzuweisenden
340Zweifel aufhaltenden, ein constitutives Princip machen
und diese Art der Bezeichnung als eine durchgängige an den Sprachen
beweisen, so setzt man sich grossen Gefahren aus und verfolgt einen in
jeder Rücksicht schlüpfrigen Pfad. Es ist, andrer Gründe nicht zu gedenken,
schon viel zu ungewiss, was in den Sprachen sowohl der ursprüngliche
Laut, als die ursprüngliche Bedeutung der Wörter gewesen
ist; und doch kommt hierauf Alles an. Sehr häufig tritt ein Buchstabe
nur durch organische oder gar zufällige Verwechslung an die Stelle eines
andren, wie n an die von l, d von r, und es ist jetzt nicht immer
sichtbar, wo dies der Fall gewesen ist. Da mithin dasselbe Resultat verschiednen
Ursachen zugeschrieben werden kann, so ist selbst grosse
Willkührlichkeit von dieser Erklärungsart nicht auszuschliessen.
3. Die Bezeichnung durch Lautähnlichkeit nach der Verwandtschaft
der zu bezeichnenden Begriffe. Wörter, deren Bedeutungen einander
nahe liegen, erhalten gleichfalls ähnliche Laute; es wird aber nicht, wie
bei der eben betrachteten Bezeichnungsart, auf den in diesen Lauten
selbst liegenden Charakter gesehen. Diese Bezeichnungsweise setzt, um
recht an den Tag zu kommen, in dem Lautsysteme Wortganze von einem
gewissen Umfange voraus oder kann wenigstens nur in einem solchen
Systeme in grösserer Ausdehnung angewendet werden. Sie ist
aber die fruchtbarste von allen, und die am klarsten und deutlichsten
den ganzen Zusammenhang des intellectuell Erzeugten in einem ähnlichen
Zusammenhange der Sprache darstellt. Man kann diese Bezeichnung,
in welcher die Analogie der Begriffe und der Laute, jeder in ihrem
eignen Gebiete, dergestalt verfolgt wird, dass beide gleichen Schritt halten
müssen, die analogische nennen.
Lautsystem der Sprachen. Bezeichnung allgemeiner Beziehungen
19. In dem ganzen Bereiche des in der Sprache zu Bezeichnenden unterscheiden
sich zwei Gattungen wesentlich von einander: die einzelnen
Gegenstände oder Begriffe und solche allgemeine Beziehungen, die sich
mit vielen der ersteren theils zur Bezeichnung neuer Gegenstände oder
Begriffe, theils zur Verknüpfung der Rede verbinden lassen. Die allgemeinen
Beziehungen gehören grösstentheils den Formen des Denkens
selbst an und bilden, indem sie sich aus einem ursprünglichen Princip
ableiten lassen, geschlossene Systeme. In diesen wird das Einzelne sowohl
in seinem Verhältniss zu einander, als zu der das Ganze zusammenfassenden
Gedankenform durch intellectuelle Notwendigkeit bestimmt.
Tritt nun in einer Sprache ein ausgedehntes, Mannigfaltigkeit
erlaubendes Lautsystem hinzu, so können die Begriffe dieser Gattung
und die Laute in einer sich fortlaufend begleitenden Analogie durchgeführt
341werden. Bei diesen Beziehungen sind von den drei im Vorigen
(VII 75.) aufgezählten Bezeichnungsarten vorzugsweise die symbolische
und analogische anwendbar und lassen sich wirklich in mehreren
Sprachen deutlich erkennen. Wenn z.B. im Arabischen eine sehr gewöhnliche
Art der Bildung der Collectiva die Einschiebung eines gedehnten
Vocals ist, so wird die zusammengefasste Menge durch die
Länge des Lautes symbolisch dargestellt. Man kann dies aber schon als
eine Verfeinerung durch höher gebildeten Articulationssinn betrachten.
Denn einige rohere Sprachen deuten Aehnliches durch eine wahre
Pause zwischen den Sylben des Wortes oder auf eine Art an, die der
Gebehrde nahe kommt, so dass alsdann die Andeutung noch mehr körperlich
nachahmend wird. 17 Von ähnlicher Art ist die unmittelbare Wiederholung
der gleichen Sylbe zu vielfacher Andeutung, namentlich
auch zu der der Mehrheit, so wie der vergangenen Zeit. Es ist merkwürdig,
im Sanskrit, zum Theil auch schon im Malayischen Sprachstamme
zu sehen, wie edle Sprachen die Sylbenverdopplung, indem sie dieselbe
in ihr Lautsystem verflechten, durch Wohllautsgesetze verändern und
ihr dadurch das rohere, symbolisch nachahmende Sylbengeklingel nehmen.
Sehr fein und sinnvoll ist die Bezeichnung der intransitiven Verba
im Arabischen durch das schwächere, aber zugleich schneidend eindringende
i, im Gegensatz des a der activen, und in einigen Sprachen
des Malayischen Stammes durch die Einschiebung des dumpfen, gewissermassen
mehr in dem Inneren verhaltenen Nasenlauts. Dem Nasenlaute
muss hier ein Vocal vorausgehen. Die Wahl dieses Vocals folgt
aber wieder der Analogie der Bezeichnung; dem m wird, die wenigen
Fälle ausgenommen, wo durch eine vom Laute über die Bedeutsamkeit
geübte Gewalt dieser Vocal sich dem der folgenden Sylbe assimilirt, das
hohle, aus der Tiefe der Sprachwerkzeuge kommende u vorausgeschickt,
so dass die eingeschobene Sylbe um die intransitive Charakteristik
ausmacht.
Da sich aber die Sprachbildung hier in einem ganz intellectuellen
Gebiete befindet, so entwickelt sich hier auch auf ganz vorzügliche
Weise noch ein andres höheres Princip, nemlich der reine und, wenn
der Ausdruck erlaubt ist, gleichsam nackte Articulationssinn. So wie
das Streben, dem Laute Bedeutung zu geben, die Natur des articulirten
Lautes, dessen Wesen ausschliesslich in dieser Absicht besteht, überhaupt
schafft, so wirkt dasselbe Streben hier auf eine bestimmte Bedeutung
hin. Diese Bestimmtheit ist um so grösser, als das Gebiet des zu
Bezeichnenden, indem die Seele selbst es erzeugt, wenn es auch nicht
immer in seiner Totalität in die Klarheit des Bewusstseyns tritt, doch
dem Geiste wirksam vorschwebt. Die Sprachbildung kann also hier reiner
von dem Bestreben, das Aehnliche und Unähnliche der Begriffe bis
in die feinsten Grade durch Wahl und Abstufung der Laute zu unterscheiden,
342geleitet werden. Je reiner und klarer die intellectuelle Ansicht
des zu bezeichnenden Gebietes ist, desto mehr fühlt sie sich gedrungen,
sich von diesem Principe leiten zu lassen, und ihr vollendeter Sieg in
diesem Theil ihres Geschäftes ist die vollständige und sichtbare Herrschaft
desselben. In der Stärke und Reinheit dieses Articulationssinnes
liegt daher, wenn wir die Feinheit der Sprachorgane und des Ohres, so
wie des Gefühls für Wohllaut als den ersten ansehen, ein zweiter wichtiger
Vorzug der sprachbildenden Nationen. Es kommt hier Alles darauf
an, dass die Bedeutsamkeit den Laut wahrlich durchdringe, und dass
dem sprachempfänglichen Ohre, zugleich und ungetrennt, in dem Laute
nichts als seine Bedeutung und, von dieser ausgegangen, der Laut
gerade und einzig für sie bestimmt erscheine. Dies setzt natürlich eine
grosse Schärfe der abgegränzten Beziehungen, da wir vorzüglich von
diesen hier reden, aber auch eine gleiche in den Lauten voraus. Je bestimmter
und körperloser diese sind, desto schärfer setzen sie sich von
einander ab. Durch die Herrschaft des Articulationssinnes wird die
Empfänglichkeit sowohl, als die Selbstthätigkeit der sprachbildenden
Kraft nicht bloss gestärkt, sondern auch in dem allein richtigen Gleise
erhalten; und da diese, wie ich schon oben (VII 70.) bemerkt habe, jedes
Einzelne in der Sprache immer so behandelt, als wäre ihr zugleich
instinctartig das ganze Gewebe, zu dem das Einzelne gehört, gegenwärtig,
so ist auch in diesem Gebiete dieser Instinct im Verhältniss der Stärke
und Reinheit des Articulationssinnes wirksam und fühlbar.
Lautsystem der Sprachen. Lautform der Sprachen
20. Die Lautform ist der Ausdruck, welchen die Sprache dem Gedanken
erschafft. Sie kann aber auch als ein Gehäuse betrachtet werden, in
welches sie sich gleichsam hineinbaut. Das Schaffen, wenn es ein eigentliches
und vollständiges seyn soll, könnte nur von der ursprünglichen
Spracherfindung, also von einem Zustande gelten, den wir nicht
kennen, sondern nur als nothwendige Hypothese voraussetzen. Die Anwendung
schon vorhandener Lautform auf die innren Zwecke der
Sprache aber lässt sich in mittleren Perioden der Sprachbildung als
möglich denken. Ein Volk könnte, durch innre Erleuchtung und Begünstigung
äusserer Umstände, der ihm überkommenen Sprache so sehr
eine andre Form ertheilen, dass sie dadurch zu einer ganz andren und
neuen würde. Dass dies bei Sprachen von gänzlich verschiedener Form
möglich sey, lässt sich mit Grunde bezweifeln. Dagegen ist es unläugbar,
dass Sprachen durch die klarere und bestimmtere Einsicht der innern
Sprachform geleitet werden, mannigfaltigere und schärfer abgegränzte
Nuancen zu bilden, und dazu nun ihre vorhandene Lautform, erweiternd
343oder verfeinernd, gebrauchen. In Sprachstämmen lehrt alsdann
die Vergleichung der verwandten einzelnen Sprachen, welche den andren
auf diese Weise vorgeschritten ist. Mehrere solcher Fälle finden
sich im Arabischen, wenn man es mit dem Hebräischen vergleicht; und
eine, meiner Schrift über das Kawi vorbehaltene interessante Untersuchung
wird es seyn, ob und auf welche Weise man die Sprachen der
Südsee-Inseln als die Grundform ansehen kann, aus welcher sich die im
engeren Verstande Malayischen des Indischen Archipelagus und Madagascars
nur weiter entwickelt haben?
Die Erscheinung im Ganzen erklärt sich vollständig aus dem natürlichen
Verlauf der Spracherzeugung. Die Sprache ist, wie es aus ihrer
Natur selbst hervorgeht, der Seele in ihrer Totalitit gegenwärtig, d. h.
jedes Einzelne in ihr verhält sich so, dass es Andrem, noch nicht deutlich
Gewordenem und einem durch die Summe der Erscheinungen und
die Gesetze des Geistes gegebenen oder vielmehr zu schaffen möglichen
Ganzen entspricht. Allein die wirkliche Entwicklung geschieht allmählich,
und das neu Hinzutretende bildet sich analogisch nach dem schon
Vorhandenen. Von diesen Grundsätzen muss man nicht nur bei aller
Spracherklärung ausgehen, sondern sie springen auch so klar aus der
geschichtlichen Zergliederung der Sprachen hervor, dass man es mit
völliger Sicherheit zu thun vermag. Das schon in der Lautform Gestaltete
reisst gewissermassen gewaltsam die neue Formung an sich und erlaubt
ihr nicht, einen wesentlich andren Weg einzuschlagen. Die verschiednen
Gattungen des Verbum in den Malayischen Sprachen werden
durch Sylben angedeutet, welche sich vorn an das Grundwort anschliessen.
Dieser Sylben hat es sichtbar nicht immer so viele und fein
unterschiedne gegeben, als man bei den Tagalischen Grammatikern findet.
Aber die nach und nach hinzugekommenen behalten immer dieselbe
Stellung unverändert bei. Ebenso ist es in den Fällen, wo das Arabische
von der älteren Semitischen Sprache unbezeichnet gelassene
Unterschiede zu bezeichnen sucht. Es entschliesst sich eher, für die Bildung
einiger Tempora Hülfsverba herbeizurufen, als dem Worte selbst
eine dem Geiste des Sprachstammes nicht gemässe Gestalt durch Sylbenanfügung
zu geben.
Es wird daher sehr erklärbar, dass die Lautform hauptsächlich dasjenige
ist, wodurch der Unterschied der Sprachen begründet wird. Es
liegt dies an sich in ihrer Natur, da der körperliche, wirklich gestaltete
Laut allein in Wahrheit die Sprache ausmacht, der Laut auch eine weit
grössere Mannigfaltigkeit der Unterschiede erlaubt, als bei der inneren
Sprachform, die nothwendig mehr Gleichheit mit sich führt, statt finden
kann. Ihr mächtigerer Einfluss entsteht aber zum Theil auch aus
dem, welchen sie auf die innere Form selbst ausübt. Denn wenn man
sich, wie man nothwendig muss und wie es weiter unten noch ausführlicher
344entwickelt werden wird, die Bildung der Sprache immer als ein
Zusammenwirken des geistigen Strebens, den durch den innren
Sprachzweck geforderten Stoff zu bezeichnen, und des Hervorbringens
des entsprechenden articulirten Lautes denkt, so muss das schon wirklich
gestaltete Körperliche und noch mehr das Gesetz, auf welchem seine
Mannigfaltigkeit beruht, nothwendig leicht das Uebergewicht über
die erst durch neue Gestaltung klar zu werden versuchende Idee gewinnen.
Man muss die Sprachbildung überhaupt als eine Erzeugung ansehen,
in welcher die innere Idee, um sich zu manifestiren, eine Schwierigkeit
zu überwinden hat. Diese Schwierigkeit ist der Laut, und die Ueberwindung
gelingt nicht immer in gleichem Grade. In solch einem Fall ist es
oft leichter, in den Ideen nachzugeben und denselben Laut oder dieselbe
Lautforrn für eigentlich verschiedne anzuwenden, wie wenn Sprachen
Futurum und Conjunctivus, wegen der in beiden liegenden Ungewissheit,
auf gleiche Weise gestalten (s. unten §.21.). Allerdings ist
alsdann immer auch Schwäche der lauterzeugenden Ideen im Spiel, da
der wahrhaft kräftige Sprachsinn die Schwierigkeit allemal siegreich
überwindet. Aber die Lautform benutzt seine Schwäche und bemeistert
sich gleichsam der neuen Gestaltung. In allen Sprachen finden sich Fälle,
wo es klar wird, dass das innre Streben, in welchem man doch, nach
einer andren und richtigeren Ansicht, die wahre Sprache aufsuchen
muss, in der Annahme des Lautes von seinem ursprünglichen Wege
mehr oder weniger abgebeugt wird. Von denjenigen, wo die Sprachwerkzeuge
einseitigerweise ihre Natur geltend machen und die wahren
Stammlaute, welche die Bedeutung des Wortes tragen, verdrängen, ist
schon oben (VII 70. 71.) gesprochen worden. Es ist hier und da merkwürdig
zu sehen, wie der von innen heraus arbeitende Sprachsinn sich
dies oft lange gefallen lässt, dann aber in einem einzelnen Fall plötzlich
durchdringt und, ohne der Lautneigung nachzugeben, sogar an einem
einzelnen Vocal unverbrüchlich fest hält. In andren Fällen wird eine
neue von ihm geforderte Formung zwar geschaffen, allein auch im nemlichen
Augenblick von der Lautneigung, zwischen der und ihm gleichsam
ein vermittelnder Vertrag entsteht, modificirt. Im Grossen aber
üben wesentlich verschiedne Lautformen einen entscheidenden Einfluss
auf die ganze Erreichung der inneren Sprachzwecke aus. Im Chinesischen
z. B. konnte keine, die Verbindung der Rede leitende Wortbeugung
entstehen, da sich der, die Sylben starr auseinander haltende
Lautbau, ihrer Umformung und Zusammenfügung widerstrebend, festgesetzt
hatte. Die ursprünglichen Ursachen dieser Hindernisse können
aber ganz entgegengesetzter Natur seyn. Im Chinesischen scheint es
mehr an der dem Volke mangelnden Neigung zu liegen, dem Laute
phantasiereiche Mannigfaltigkeit und die Harmonie befördernde Abwechslung
345zu geben; und wo dies fehlt und der Geist nicht die Möglichkeit
sieht, die verschiedenen Beziehungen des Denkens auch mit gehörig
abgestuften Nuancen des Lauts zu umkleiden, geht er in die feine
Unterscheidung dieser Beziehungen weniger ein. Denn die Neigung,
eine Vielfachheit fein und scharf abgegränzter Articulationen zu bilden,
und das Streben des Verstandes, der Sprache so viele und bestimmt gesonderte
Formen zu schaffen, als sie deren bedarf, um den in seiner unendlichen
Mannigfaltigkeit flüchtigen Gedanken zu fesseln, wecken
sich immer gegenseitig. Ursprünglich, in den unsichtbaren Bewegungen
des Geistes, darf man sich, was den Laut angeht und was der innere
Sprachzweck erfordert, die bezeichnenden und die das zu Bezeichnende
erzeugenden Kräfte auf keine Weise geschieden denken. Beide vereint
und umfasst das allgemeine Sprachvermögen. Wie aber der Gedanke,
als Wort, die Aussenwelt berührt, wie durch die Ueberlieferung
einer schon vorhandenen Sprache dem Menschen, der sie doch in sich
immer wieder selbstthätig erzeugen muss, die Gewalt eines schon geformten
Stoffes entgegentritt, kann die Scheidung entstehen, welche
uns berechtigt und verpflichtet, die Spracherzeugung von diesen zwei
verschiedenen Seiten zu betrachten. In den Semitischen Sprachen dagegen
ist vielleicht das Zusammentreffen des organischen Unterscheidens
einer reichen Mannigfaltigkeit von Lauten und eines zum Theil durch
die Art dieser Laute motivirten feinen Articulationssinnes der Grund,
dass diese Sprachen weit mehr eine künstliche und sinnreiche Lautform
besitzen, als sie sogar nothwendige und hauptsächliche grammatische
Begriffe mit Klarheit und Bestimmtheit unterscheiden. Der Sprachsinn
hat, indem er die eine Richtung nahm, die andere vernachlässigt. Da er
dem wahren, naturgemässen Zweck der Sprache nicht mit gehöriger
Entschiedenheit nachstrebte, wandte er sich zur Erreichung eines auf
dem Wege liegenden Vorzugs, sinnvoll und mannigfaltig bearbeiteter
Lautform. Hierzu aber führte ihn die natürliche Anlage derselben. Die
Wurzelwörter, in der Regel zweisylbig gebildet, erhielten Raum, ihre
Laute innerlich umzuformen, und diese Formung forderte vorzugsweise
Vocale. Da nun diese offenbar feiner und körperloser, als die Consonanten
sind, so weckten und stimmten sie auch den inneren Articulationssinn
zu grösserer Feinheit. 18
Lautsystem der Sprachen. Technik derselben
Auf eine andre Weise lässt sich noch ein, den Charakter der Sprachen
bestimmendes Uebergewicht der Lautform, ganz eigentlich als solcher
genommen, denken. Man kann den Inbegriff aller Mittel, deren sich die
Sprache zur Erreichung ihrer Zwecke bedient, ihre Technik nennen und
346diese Technik wieder in die phonetische und intellectuelle eintheilen.
Unter der ersteren verstehe ich die Wort- und Formenbildung, insofern
sie bloss den Laut angeht oder durch ihn motivirt wird. Sie ist reicher,
wenn die einzelnen Formen einen weiteren und volltönenderen Umfang
besitzen, so wie wenn sie für denselben Begriff oder dieselbe Beziehung
sich bloss durch den Ausdruck unterscheidende Formen angiebt. Die
intellectuelle Technik begreift dagegen das in der Sprache zu Bezeichnende
und zu Unterscheidende. Zu ihr gehört es also z.B., wenn eine
Sprache Bezeichnung des Genus, des Dualis, der Tempora durch alle
Möglichkeiten der Verbindung des Begriffes der Zeit mit dem des Verlaufes
der Handlung u. s. f. besitzt.
In dieser Ansicht erscheint die Sprache als ein Werkzeug zu einem
Zwecke. Da aber dies Werkzeug offenbar die rein geistigen, so wie die
edelsten sinnlichen Kräfte durch die, sich in ihm ausprägende Ideenordnung,
Klarheit und Schärfe, so wie durch den Wohllaut und Rhythmus
anregt, so kann das organische Sprachgebäude, die Sprache an sich und
gleichsam abgesehen von ihrem Zwecke, die Begeisterung der Nationen
an sich reissen und thut dies in der That. Die Technik überwächst alsdann
die Erfordernisse zur Erreichung des Zwecks; und es lässt sich
ebensowohl denken, dass Sprachen hierin über das Bedürfniss hinausgehen,
als dass sie hinter demselben zurückbleiben. Wenn man die Englische,
Persische und eigentlich Malayische Sprache mit dem Sanskrit
und dem Tagalischen vergleicht, so nimmt man eine solche, hier angedeutete
Verschiedenheit des Umfangs und des Reichthums der Sprachtechnik
wahr, bei welcher doch der unmittelbare Sprachzweck, die Wiedergebung
des Gedanken, nicht leidet, da alle diese drei Sprachen ihn
nicht nur überhaupt, sondern zum Theil in beredter und dichterischer
Mannigfaltigkeit erreichen. Auf das Uebergewicht der Technik überhaupt
und im Ganzen behalte ich mir vor in der Folge zurückzukommen.
Hier wollte ich nur desjenigen erwähnen, das sich die phonetische
über die intellectuelle anmassen kann. Welches alsdann auch die Vorzüge
des Lautsystems seyn möchten, so beweist ein solches Misverhältniss
immer einen Mangel in der Stärke der sprachbildenden Kraft, da, was
in sich Eins und energisch ist, auch in seiner Wirkung die in seiner Natur
liegende Harmonie unverletzt bewahrt. Wo das Mass nicht durchaus
überschritten ist, lässt sich der Lautreichthum in den Sprachen mit dem
Colorit in der Malerei vergleichen. Der Eindruck beider bringt eine ähnliche
Empfindung hervor; und auch der Gedanke wirkt anders zurück,
wenn er, einem blossen Umrisse gleich, in grösserer Nacktheit auftritt
oder, wenn der Ausdruck erlaubt ist, mehr durch die Sprache gefärbt
erscheint.347
Innere Sprachform
21. Alle Vorzüge noch so kunstvoller und tonreicher Lautformen, auch
verbunden mit dem regesten Articulationssinn, bleiben aber unvermögend,
dem Geiste würdig zusagende Sprachen hervorzubringen, wenn
nicht die strahlende Klarheit der auf die Sprache Bezug habenden Ideen
sie mit ihrem Lichte und ihrer Wärme durchdringt. Dieser ihr ganz innerer
und rein intellectueller Theil macht eigentlich die Sprache aus; er
ist der Gebrauch, zu welchem die Spracherzeugung sich der Lautform
bedient, und auf ihm beruht es, dass die Sprache Allem Ausdruck zu
verleihen vermag, was ihr, bei fortrückender Ideenbildung, die grössten
Köpfe der spätesten Geschlechter anzuvertrauen streben. Diese ihre
Beschaffenheit hängt von der Uebereinstimmung und dem Zusammenwirken
ab, in welchem die sich in ihr offenbarenden Gesetze unter einander
und mit den Gesetzen des Anschauens, Denkens und Fühlens
überhaupt stehen. Das geistige Vermögen hat aber sein Daseyn allein in
seiner Thätigkeit, es ist das auf einander folgende Aufflammen der
Kraft in ihrer ganzen Totalität, aber nach einer einzelnen Richtung hin
bestimmt. Jene Gesetze sind also nichts anders, als die Bahnen, in welchen
sich die geistige Thätigkeit in der Spracherzeugung bewegt, oder
in einem andren Gleichniss als die Formen, in welchen diese die Laute
ausprägt. Es giebt keine Kraft der Seele, welche hierbei nicht thätig
wäre; nichts in dem Inneren des Menschen ist so tief, so fein, so weit
umfassend, das nicht in die Sprache übergienge und in ihr erkennbar
wäre. Ihre intellectuellen Vorzüge beruhen daher ausschliesslich auf der
wohlgeordneten, festen und klaren Geistes-Organisation der Völker in
der Epoche ihrer Bildung oder Umgestaltung und sind das Bild, ja der
unmittelbare Abdruck derselben.
Es kann scheinen, als müssten alle Sprachen in ihrem intellectuellen
Verfahren einander gleich seyn. Bei der Lautform ist eine unendliche,
nicht zu berechnende Mannigfaltigkeit begreiflich, da das sinnlich und
körperlich Individuelle aus so verschiedenen Ursachen entspringt, dass
sich die Möglichkeit seiner Abstufungen nicht überschlagen lässt. Was
aber, wie der intellectuelle Theil der Sprache, allein auf geistiger
Selbstthätigkeit beruht, scheint auch bei der Gleichheit des Zwecks und
der Mittel in allen Menschen gleich seyn zu müssen; und eine grössere
Gleichförmigkeit bewahrt dieser Theil der Sprache allerdings. Aber
auch in ihm entspringt aus mehreren Ursachen eine bedeutende Verschiedenheit.
Einestheils wird sie durch die vielfachen Abstufungen
hervorgebracht, in welchen, dem Grade nach, die spracherzeugende
Kraft, sowohl überhaupt, als in dem gegenseitigen Verhältniss der in ihr
her-vortretenden Thätigkeiten, wirksam ist. Andrentheils sind aber
auch hier Kräfte geschäftig, deren Schöpfungen sich nicht durch den
348Verstand und nach blossen Begriffen ausmessen lassen. Phantasie und
Gefühl bringen individuelle Gestaltungen hervor, in welchen wieder der
individuelle Charakter der Nation hervortritt und wo, wie bei allem Individuellen,
die Mannigfaltigkeit der Art, wie sich das Nemliche in immer
verschiedenen Bestimmungen darstellen kann, ins Unendliche
geht.
Doch auch in dem bloss ideellen, von den Verknüpfungen des Verstandes
abhängenden Theile finden sich Verschiedenheiten, die aber
alsdann fast immer aus unrichtigen oder mangelhaften Combinationen
herrühren. Um dies zu erkennen, darf man nur bei den eigentlich grammatischen
Gesetzen stehen bleiben. Die verschiedenen Formen z. B.,
welche, dem Bedürfniss der Rede gemäss, in dem Baue des Verbum abgesondert
bezeichnet werden müssen, sollten, da sie durch blosse Ableitung
von Begriffen gefunden werden können, in allen Sprachen auf dieselbe
Weise vollständig aufgezählt und richtig geschieden seyn.
Vergleicht man aber hierin das Sanskrit mit dem Griechischen, so ist es
auffallend, dass in dem ersteren der Begriff des Modus nicht allein offenbar
unentwickelt geblieben, sondern auch in der Erzeugung der
Sprache selbst nicht wahrhaft gefühlt und nicht rein von dem des Tempus
unterschieden worden ist. Er ist daher nicht mit dem der Zeit gehörig
verknüpft und gar nicht vollständig durch denselben durchgeführt
worden. 19 Dasselbe findet bei dem Infinitivus statt, der noch ausserdem,
mit gänzlicher Verkennung seiner Verbalnatur, zu dem Nomen
herübergezogen worden ist. Bei aller, noch so gerechten Vorliebe für
das Sanskrit muss man gestehen, dass es hierin hinter der jüngeren
Sprache zurückbleibt. Die Natur der Rede begünstigt indess Ungenauigkeiten
dieser Art, indem sie dieselben für die wesentliche Erreichung
ihrer Zwecke unschädlich zu machen versteht. Sie lässt eine Form die
Stelle der anderen vertreten, 20 oder bequemt sich zu Umschreibungen,
wo es ihr an dem eigentlichen und kurzen Ausdruck gebricht. Darum
bleiben aber solche Fälle nicht weniger fehlerhafte Unvollkommenheiten
und zwar gerade in dem rein intellectuellen Theile der Sprache. Ich
habe schon oben (VII82.) bemerkt, dass hiervon bisweilen die Schuld
auf die Lautform fallen kann, welche, einmal an gewisse Bildungen gewöhnt,
den Geist verleitet, auch neue Gattungen der Bildung fordernde
Begriffe in diesen ihren Bildungsgang zu ziehen. Immer aber ist dies
nicht der Fall. Was ich so eben von der Behandlung des Modus und Infinitivs
im Sanskrit gesagt habe, dürfte man wohl auf keine Weise aus
der Lautform erklären können. Ich wenigstens vermag in dieser nichts
der Art zu entdecken. Ihr Reichthum an Mitteln ist auch hinlänglich,
um der Bezeichnung genügenden Ausdruck zu leihen. Die Ursach ist
offenbar eine mehr innerliche. Der ideelle Bau des Verbum, sein innerer,
vollständig in seine verschiednen Theile gesonderter Organismus
349entfaltete sich nicht in hinreichender Klarheit vor dem bildenden Geiste
der Nation. Dieser Mangel ist jedoch um so wunderbarer, als übrigens
keine Sprache die wahrhafte Natur des Verbum, die reine Synthesis des
Seyns mit dem Begriff, so wahrhaft und so ganz eigentlich geflügelt darstellt,
als das Sanskrit, welches gar keinen anderen, als einen nie ruhenden,
immer bestimmte einzelne Zustände andeutenden Ausdruck für
dasselbe kennt. Denn die Wurzelwörter können durchaus nicht als Verba,
nicht einmal ausschliesslich als Verbalbegriffe angesehen werden.
Die Ursach einer solchen mangelhaften Entwicklung oder unrichtigen
Auffassung eines Sprachbegriffs möge aber, gleichsam äusserlich, in der
Lautform oder innerlich in der ideellen Auffassung gesucht werden
müssen, so liegt der Fehler immer in mangelnder Kraft des erzeugenden
Sprachvermögens. Eine mit der erforderlichen Kraft geschleuderte Kugel
lässt sich nicht durch entgegenwirkende Hindernisse von ihrer Bahn
abbringen, und ein mit gehöriger Stärke ergriffener und bearbeiteter
Ideenstoff entwickelt sich in gleichförmiger Vollendung bis in seine
feinsten und nur durch die schärfste Absonderung zu trennenden Glieder.
Wie bei der Lautform als die beiden hauptsächlichsten zu beachtenden
Punkte die Bezeichnung der Begriffe und die Gesetze der Redefügung
erschienen, ebenso ist es in dem inneren, intellectuellen Theil der
Sprache. Bei der Bezeichnung tritt auch hier, wie dort, der Unterschied
ein, ob der Ausdruck ganz individueller Gegenstände gesucht wird oder
Beziehungen dargestellt werden sollen, welche, auf eine ganze Zahl einzelner
anwendbar, diese gleichförmig in einen allgemeinen Begriff versammeln,
so dass eigentlich drei Fälle zu unterscheiden sind. Die Bezeichnung
der Begriffe, unter welche die beiden ersteren gehören,
machte bei der Lautform die Wortbildung aus, welcher hier die Begriffsbildung
entspricht. Denn es muss innerlich jeder Begriff an ihm
selbst eigenen Merkmalen oder an Beziehungen auf andere festgehalten
werden, indem der Articulationssinn die bezeichnenden Laute auffindet.
Dies ist selbst bei äusseren körperlichen, geradezu durch die Sinne
wahrnehmbaren Gegenständen der Fall. Auch bei ihnen ist das Wort
nicht das Aequivalent des den Sinnen vorschwebenden Gegenstandes,
sondern der Auffassung desselben durch die Spracherzeugung im bestimmten
Augenblicke der Worterfindung. Es ist dies eine vorzügliche
Quelle der Vielfachheit von Ausdrücken für die nemlichen Gegenstände;
und wenn z. B. im Sanskrit der Elephant bald der zweimal Trinkende,
bald der Zweizahnige, bald der mit einer Hand Versehene heisst, so
sind dadurch, wenn auch immer derselbe Gegenstand gemeint ist,
ebenso viele verschiedene Begriffe bezeichnet. Denn die Sprache stellt
niemals die Gegenstände, sondern immer die durch den Geist in der
Spracherzeugung selbstthätig von ihnen gebildeten Begriffe dar; und
350von dieser Bildung, insofern sie als ganz innerlich, gleichsam dem Articulationssinne
vorausgehend angesehen werden muss, ist hier die Rede.
Freilich gilt aber diese Scheidung nur für die Sprachzergliederung und
kann nicht als in der Natur vorhanden betrachtet werden.
Von einem anderen Gesichtspunkte aus stehen die beiden letzten der
drei oben unterschiedenen Fälle einander näher. Die allgemeinen, an den
einzelnen Gegenständen zu bezeichnenden Beziehungen und die grammatischen
Wortbeugungen beruhen beide grösstentheils auf den allgemeinen
Formen der Anschauung und der logischen Anordnung der Begriffe.
Es liegt daher in ihnen ein übersehbares System, mit welchem sich
das aus jeder besondren Sprache hervorgehende vergleichen lässt, und es
fallen dabei wieder die beiden Punkte ins Auge: die Vollständigkeit und
richtige Absonderung des zu Bezeichnenden und die für jeden solchen
Begriff ideell gewählte Bezeichnung selbst. Denn es trifft hier gerade das
schon oben Ausgeführte ein. Da es hier aber immer die Bezeichnung unsinnlicher
Begriffe, ja oft blosser Verhältnisse gilt, so muss der Begriff für
die Sprache oft, wenn nicht immer bildlich genommen werden; und hier
zeigen sich nun die eigentlichen Tiefen des Sprachsinnes in der Verbindung
der die ganze Sprache von Grund aus beherrschenden einfachsten
Begriffe. Person, mithin Pronomen, und Raum Verhältnisse spielen hierin
die wichtigste Rolle und oft lässt es sich nachweisen, wie dieselben auch
auf einander bezogen und in einer noch einfacheren Wahrnehmung verknüpft
sind. Es offenbart sich hier das, was die Sprache, als solche, am
eigenthümlichsten und gleichsam instinctartig im Geiste begründet. Der
individuellen Verschiedenheit dürfte hier am wenigsten Raum gelassen
seyn und der Unterschied der Sprachen in diesem Punkte mehr bloss
darauf beruhen, dass in einigen theils ein fruchtbarerer Gebrauch davon
gemacht, theils die aus dieser Tiefe geschöpfte Bezeichnung klarer und
dem Bewusstseyn zugänglicher angedeutet ist.
Tiefer in die sinnliche Anschauung, die Phantasie, das Gefühl und,
durch das Zusammenwirken von diesen, in den Charakter überhaupt
dringt die Bezeichnung der einzelnen inneren und äusseren Gegenstände
ein, da sich hier wahrhaft die Natur mit dem Menschen, der zum
Theil wirklich materielle Stoff mit dem formenden Geiste verbindet. In
diesem Gebiete leuchtet daher vorzugsweise die nationelle Eigenthümlichkeit
hervor. Denn der Mensch naht sich auffassend der äusseren
Natur und entwickelt selbstthätig seine inneren Empfindungen nach der
Art, wie seine geistigen Kräfte sich in verschiedenem Verhältniss gegen
einander abstufen, und dies prägt sich ebenso in der Spracherzeugung
aus, insofern sie innerlich die Begriffe dem Worte entgegenbildet. Die
grosse Gränzlinie ist auch hier, ob ein Volk in seine Sprache mehr objective
Realität oder mehr subjective Innerlichkeit legt. Obgleich sich dies
immer erst allmählich in der fortschreitenden Bildung deutlicher entwickelt,
351so liegt doch schon der Keim dazu in unverkennbarem Zusammenhange
in der ersten Anlage und auch die Lautform trägt das Gepräge
davon. Denn je mehr Helle und Klarheit der Sprachsinn in der Darstellung
sinnlicher Gegenstände und je reiner und körperloser
umschriebene Bestimmtheit er bei geistigen Begriffen fordert, desto
schärfer, da in dem Innern der Seele, was wir reflectirend sondern, ungetrennt
Eins ist, zeigen sich auch die articulirten Laute und desto volltönender
reihen sich die Sylben zu Wörtern an einander. Dieser Unterschied
mehr klarer und fester Objectivität und tiefer geschöpfter
Subjectivität springt bei sorgfältiger Vergleichung des Griechischen mit
dem Deutschen in die Augen. Man bemerkt aber diesen Einfluss der
nationellen Eigenthümlichkeit in der Sprache auf eine zwiefache Weise:
an der Bildung der einzelnen Begriffe und an dem verhältnissmässig verschiedenen
Reichthum der Sprache an Begriffen gewisser Gattung. In
die einzelne Bezeichnung geht sichtbar bald die Phantasie und das Gefühl,
von sinnlicher Anschauung geleitet, bald der fein sondernde Verstand,
bald der kühn verknüpfende Geist ein. Die gleiche Farbe, welche
dadurch die Ausdrücke für die mannigfaltigsten Gegenstände erhalten,
zeigt die der Naturauffassung der Nation. Nicht minder deutlich ist das
Uebergewicht der Ausdrücke, die einer einzelnen Geistesrichtung angehören.
Ein solches ist z. B. im Sanskrit an der vorwaltenden Zahl religiös
philosophischer Wörter sichtbar, in der sich vielleicht keine andere Sprache
mit ihr messen kann. Man muss hierzu noch hinzufügen, dass diese
Begriffe grösstentheils in möglichster Nacktheit nur aus ihren einfachen
Urelementen gebildet sind, so dass der tief abstrahirende Sinn der Nation
auch daraus noch klarer hervorstrahlt. Die Sprache trägt dadurch
dasselbe Gepräge an sich, das man in der ganzen Dichtung und geistigen
Thätigkeit des Indischen Alterthums, ja in der äusseren Lebensweise und
Sitte wiederfindet. Sprache, Literatur und Verfassung bezeugen einstimmig,
dass im Inneren die Richtung auf die ersten Ursachen und das letzte
Ziel des menschlichen Daseyns, im Aeusseren der Stand, welcher sich
dieser ausschliesslich widmete, also Nachdenken und Aufstreben zur
Gottheit und Priesterthum die vorherrschenden, die Nationalität bezeichnenden
Züge waren. Eine Nebenfärbung in allen diesen drei Punkten
war das oft in Nichts auszugehen drohende, ja nach diesem Ziele
wirklich strebende Grübeln und der Wahn, die Gränzen der Menschheit
durch abenteuerliche Uebungen überschreiten zu können.
Es wäre jedoch eine einseitige Vorstellung, zu denken, dass sich die
nationelle Eigenthümlichkeit des Geistes und des Charakters allein in
der Begriffsbildung offenbarte; sie übt einen gleich grossen Einfluss auf
die Redefügung aus und ist an ihr gleich erkennbar. Es ist auch begreiflich,
wie sich das in dem Innern heftiger oder schwächer, flammender
oder dunkler, lebendiger oder langsamer lodernde Feuer in den Ausdruck
352des ganzen Gedanken und der ausströmenden Reihe der Empfindungen
vorzugsweise so ergiesst, dass seine eigenthümliche Natur
daraus unmittelbar hervorleuchtet. Auch in diesem Punkte führt das
Sanskrit und das Griechische zu anziehenden und belehrenden Vergleichungen.
Die Eigentümlichkeiten in diesem Theile der Sprache prägen
sich aber nur zum kleinsten Theile in einzelnen Formen und in bestimmten
Gesetzen aus und die Sprachzergliederung findet daher hier
ein schwierigeres und mühevolleres Geschäft. Auf der anderen Seite
hängt die Art der syntaktischen Bildung ganzer Ideenreihen sehr genau
mit demjenigen zusammen, wovon wir weiter oben sprachen, mit der
Bildung der grammatischen Formen. Denn Armuth und Unbestimmtheit
der Formen verbietet, den Gedanken in zu weitem Umfange der
Rede schweifen zu lassen, und nöthigt zu einem einfachen, sich an wenigen
Ruhepunkten begnügenden Periodenbau. Allein auch da, wo ein
Reichthum fein gesonderter und scharf bezeichneter grammatischer
Formen vorhanden ist, muss doch, wenn die Redefügung zur Vollendung
gedeihen soll, noch ein innerer, lebendiger Trieb nach längerer,
sinnvoller verschlungner, mehr begeisterter Satzbildung hinzukommen.
Dieser Trieb musste in der Epoche, in welcher das Sanskrit die Form
seiner uns bekannten Producte erhielt, minder energisch wirken, da er
sich sonst, wie es dem Genius der Griechischen Sprache gelang, auch
gewissermassen vorahnend die Möglichkeit dazu geschaffen hätte, die
sich uns jetzt wenigstens selten in seiner Redefügung durch die That
offenbart.
Vieles im Periodenbaue und der Redefügung lässt sich aber nicht auf
Gesetze zurückführen, sondern hängt von dem jedesmal Redenden
oder Schreibenden ab. Die Sprache hat dann das Verdienst, der Mannigfaltigkeit
der Wendungen Freiheit und Reichthum an Mitteln zu gewähren,
wenn sie oft auch nur die Möglichkeit darbietet, diese in jedem
Augenblick selbst zu erschaffen. Ohne die Sprache in ihren Lauten und
noch weniger in ihren Formen und Gesetzen zu verändern, führt die
Zeit durch wachsende Ideenentwicklung, gesteigerte Denkkraft und
tiefer eindringendes Empfindungsvermögen oft in sie ein, was sie früher
nicht besass. Es wird alsdann in dasselbe Gehäuse ein anderer Sinn gelegt,
unter demselben Gepräge etwas Verschiedenes gegeben, nach den
gleichen Verknüpfungsgesetzen ein anders abgestufter Ideengang angedeutet.
Es ist dies eine beständige Frucht der Literatur eines Volkes, in
dieser aber vorzüglich der Dichtung und Philosophie. Der Ausbau der
übrigen Wissenschaften liefert der Sprache mehr ein einzelnes Material
oder sondert und bestimmt fester das vorhandene; Dichtung und Philosophie
aber berühren in einem noch ganz andren Sinne den innersten
Menschen selbst und wirken daher auch stärker und bildender auf die
mit diesem innig verwachsene Sprache. Auch der Vollendung in ihrem
353Fortgange sind daher die Sprachen am meisten fähig, in welchen poetischer
und philosophischer Geist wenigstens in einer Epoche vorgewaltet
hat, und doppelt mehr, wenn dies Vorwalten aus eignem Triebe entsprungen,
nicht dem Fremden nachgeahmt ist. Bisweilen ist auch in
ganzen Stämmen, wie im Semitischen und Sanskritischen der Dichtergeist
so lebendig, dass der einer früheren Sprache des Stammes in einer
späteren gleichsam wieder neu ersteht. Ob der Reichthum sinnlicher
Anschauung auf diese Weise in den Sprachen einer Zunahme fähig ist,
möchte schwer zu entscheiden seyn. Dass aber intellectuelle Begriffe
und aus innerer Wahrnehmung geschöpfte den sie bezeichnenden Lauten
im fortschreitenden Gebrauche einen tieferen, seelenvolleren Gehalt
mittheilen, zeigt die Erfahrung an allen Sprachen, die sich Jahrhunderte
hindurch fortgebildet haben. Geistvolle Schriftsteller geben den
Wörtern diesen gesteigerten Gehalt und eine regsam empfängliche Nation
nimmt ihn auf und pflanzt ihn fort. Dagegen nutzen sich Metaphern,
welche den jugendlichen Sinn der Vorzeit, wie die Sprachen
selbst die Spuren davon an sich tragen, wunderbar ergriffen zu haben
scheinen, im täglichen Gebrauch so ab, dass sie kaum noch empfunden
werden. In diesem gleichzeitigen Fortschritt und Rückgang üben die
Sprachen den der fortschreitenden Entwicklung angemessenen Einfluss
aus, der ihnen in der grossen geistigen Oekonomie des Menschengeschlechts
angewiesen ist.
Verbindung des Lautes mit der inneren Sprachform
22. Die Verbindung der Lautform mit den inneren Sprachgesetzen bildet
die Vollendung der Sprachen, und der höchste Punkt dieser ihrer
Vollendung beruhet darauf, dass diese Verbindung, immer in gleichzeitigen
Acten des spracherzeugenden Geistes vor sich gehend, zur wahren
und reinen Durchdringung werde. Von dem ersten Elemente an ist
die Erzeugung der Sprache ein synthetisches Verfahren und zwar ein
solches im ächtesten Verstande des Worts, wo die Synthesis etwas
schafft, das in keinem der verbundenen Theile für sich liegt. Das Ziel
wird daher nur erreicht, wenn auch der ganze Bau der Lautform und
der inneren Gestaltung ebenso fest und gleichzeitig zusammenfliessen.
Die daraus entspringende, wohlthätige Folge ist dann die völlige Angemessenheit
des einen Elements zu dem andren, so dass keins über das
andere gleichsam überschiesst. Es wird, wenn dieses Ziel erreicht ist,
weder die innere Sprachentwicklung einseitige Pfade verfolgen, auf denen
sie von der phonetischen Formenerzeugung verlassen wird, noch
wird der Laut in wuchernder Ueppigkeit über das schöne Bedürfniss
des Gedanken hinaus walten. Er wird dagegen gerade durch die inneren,
354die Sprache in ihrer Erzeugung vorbereitenden Seelenregungen zu
Euphonie und Rhythmus hingeleitet werden, in beiden ein Gegengewicht
gegen das blosse, klingelnde Sylbengetön finden und durch sie
einen neuen Pfad entdecken, auf dem, wenn eigentlich der Gedanke
dem Laute die Seele einhaucht, dieser ihm wieder aus seiner Natur ein
begeisterndes Princip zurückgiebt. Die feste Verbindung der beiden
constitutiven Haupttheile der Sprache äussert sich vorzüglich in dem
sinnlichen und phantasiereichen Leben, das ihr dadurch aufblüht, da
hingegen einseitige Verstandesherrschaft, Trockenheit und Nüchternheit
die unfehlbaren Folgen sind, wenn sich die Sprache in einer Epoche
intellectueller erweitert und verfeinert, wo der Bildungstrieb der Laute
nicht mehr die erforderliche Stärke besitzt oder wo gleich anfangs die
Kräfte einseitig gewirkt haben. Im Einzelnen sieht man dies an den
Sprachen, in denen einige Tempora, wie im Arabischen nur durch getrennte
Hülfsverba gebildet werden, wo also die Idee solcher Formen
nicht mehr wirksam von dem Triebe der Lautformung begleitet gewesen
ist. Das Sanskrit hat in einigen Zeitformen das Verbum seyn wirklich
mit dem Verbalbegriff in Worteinheit verbunden.
Weder dies Beispiel aber noch auch andre ähnlicher Art, die man
leicht, besonders auch aus dem Gebiete der Wortbildung aufzählen
könnte, zeigen die volle Bedeutung des hier ausgesprochnen Erfordernisses.
Nicht aus Einzelnheiten, sondern aus der ganzen Beschaffenheit
und Form der Sprache geht die vollendete Synthesis, von der hier die
Rede ist, hervor. Sie ist das Product der Kraft im Augenblicke der
Spracherzeugung und bezeichnet genau den Grad ihrer Stärke. Wie
eine stumpf ausgeprägte Münze zwar alle Umrisse und Einzelnheiten
der Form wiedergiebt, aber des Glanzes ermangelt, der aus der Bestimmtheit
und Schärfe hervorspringt, ebenso ist es auch hier. Ueberhaupt
erinnert die Sprache oft, aber am meisten hier, in dem tiefsten
und unerklärbarsten Theile ihres Verfahrens, an die Kunst. Auch der
Bildner und Maler vermählt die Idee mit dem Stoff und auch seinem
Werke sieht man es an, ob diese Verbindung, in Innigkeit der Durchdringung,
dem wahren Genius in Freiheit entstrahlt oder ob die abgesonderte
Idee mühevoll und ängstlich mit dem Meissel oder dem Pinsel
gleichsam abgeschrieben ist. Aber auch hier zeigt sich dies letztere
mehr in der Schwäche des Totaleindrucks, als in einzelnen Mängeln.
Wie sich nun eigentlich das geringere Gelingen der nothwendigen Synthesis
der äusseren und inneren Sprachfonn an einer Sprache offenbart,
werde ich zwar weiter unten an einigen einzelnen grammatischen Punkten
zu zeigen bemüht seyn; die Spuren eines solchen Mangels aber bis
in die äussersten Feinheiten des Sprachbaues zu verfolgen, ist nicht allein
schwierig, sondern bis auf einen gewissen Grad unmöglich. Noch
weniger kann es gelingen, denselben überall in Worten darzustellen.
355Das Gefühl aber täuscht sich darüber nicht und noch klarer und deutlicher
äussert sich das Fehlerhafte in den Wirkungen. Die wahre Synthesis
entspringt aus der Begeisterung, welche nur die hohe und energische
Kraft kennt. Bei der unvollkommenen hat diese Begeisterung gefehlt,
und ebenso übt auch eine so entstandene Sprache eine minder begeisternde
Kraft in ihrem Gebrauch aus. Dies zeigt sich in ihrer Literatur,
die weniger zu den Gattungen hinneigt, welche einer solchen Begeisterung
bedürfen, oder den schwächeren Grad derselben an der Stirn
trägt. Die geringere nationelle Geisteskraft, welcher die Schuld dieses
Mangels anheimfällt, bringt dann wieder eine solche durch den Einfluss
einer unvollkommneren Sprache in den nachfolgenden Geschlechtern
hervor oder vielmehr die Schwäche zeigt sich durch das ganze Leben
einer solchen Nation, bis durch irgend einen Anstoss eine neue Geistesumformung
derselben entsteht.
Genauere Darlegung des Sprachverfahrens
24. Der Zweck dieser Einleitung, die Sprachen in der Verschiedenartigkeit
ihres Baues, als die nothwendige Grundlage der Fortbildung des
menschlichen Geistes darzustellen und den wechselseitigen Einfluss der
einen auf die andre näher zu erörtern, hat mich genöthigt, in die Natur
der Sprache überhaupt einzugehen. Jenen Standpunkt genau festhaltend,
muss ich diesen Weg weiter verfolgen. Ich habe im Vorigen das
Wesen der Sprache nur in seinen allgemeinsten Grundzügen dargelegt
und wenig mehr gethan, als ihre Definition ausführlicher zu entwickeln.
Wenn man ihr Wesen in der Laut- und Ideenform und der richtigen und
energischen Durchdringung beider sucht, so bleibt dabei eine zahllose
Menge die Anwendung verwirrender Einzelnheiten zu bestimmen übrig.
Um daher, wie es hier meine Absicht ist, der individuell historischen
Sprachvergleichung durch vorbereitende Betrachtungen den Weg zu
bahnen, ist es zugleich nothwendig, das Allgemeine mehr auseinanderzulegen
und das dann hervortretende Besondere dennoch mehr in Einheit
zusammenzuziehen. Eine solche Mitte zu erreichen, bietet die
Natur der Sprache selbst die Hand. Da sie, in unmittelbarem Zusammenhange
mit der Geisteskraft, ein vollständig durchgeführter Organismus
ist, so lassen sich in ihr nicht bloss Theile unterscheiden, sondern
auch Gesetze des Verfahrens oder, da ich überall hier gern Ausdrücke
wähle, welche der historischen Forschung auch nicht einmal scheinbar
vorgreifen, vielmehr Richtungen und Bestrebungen desselben. Man
kann diese, wenn man den Organismus der Körper dagegen halten will,
mit den physiologischen Gesetzen vergleichen, deren wissenschaftliche
Betrachtung sich auch wesentlich von der zergliedernden Beschreibung
356der einzelnen Theile unterscheidet. Es wird daher hier nicht einzeln
nach einander, wie in unsren Grammatiken, vom Lautsysteme, Nomen,
Pronomen u.s.f., sondern von Eigenthümlichkeiten der Sprachen die
Rede seyn, welche durch alle jene einzelnen Theile, sie selbst näher bestimmend,
durchgehen. Dies Verfahren wird auch von einem andren
Standpunkte aus hier zweckmässiger erscheinen. Wenn das oben angedeutete
Ziel erreicht werden soll, muss die Untersuchung hier gerade
vorzugsweise eine solche Verschiedenheit des Sprachbaues im Auge behalten,
welche sich nicht auf Einerleiheit eines Sprachstammes zurückführen
lässt. Diese nun wird man vorzüglich da suchen müssen, wo sich
das Verfahren der Sprache am engsten in ihren endlichen Bestrebungen
zusammenknüpft. Dies führt uns wieder, aber in andrer Beziehung zur
Bezeichnung der Begriffe und zur Verknüpfung des Gedanken im Satze.
Beide fliessen aus dem Zwecke der inneren Vollendung des Gedanken
und des äusseren Verständnisses. Gewissermassen unabhängig hiervon
bildet sich in ihr zugleich ein künstlerisch schaffendes Princip aus, das
ganz eigentlich ihr selbst angehört. Denn die Begriffe werden in ihr von
Tönen getragen und der Zusammenklang aller geistigen Kräfte verbindet
sich also mit einem musikalischen Element, das, in sie eintretend,
seine Natur nicht aufgiebt, sondern nur modificirt. Die künstlerische
Schönheit der Sprache wird ihr daher nicht als ein zufälliger Schmuck
verliehen; sie ist, gerade im Gegentheil, eine in sich nothwendige Folge
ihres übrigen Wesens, ein untrüglicher Prüfstein ihrer inneren und allgemeinen
Vollendung. Denn die innere Arbeit des Geistes hat sich erst
dann auf die kühnste Höhe geschwungen, wenn das Schönheitsgefühl
seine Klarheit darüber ausgiesst.
Das Verfahren der Sprache ist aber nicht bloss ein solches, wodurch
eine einzelne Erscheinung zu Stande kommt; es muss derselben zugleich
die Möglichkeit eröffnen, eine unbestimmbare Menge solcher
Erscheinungen und unter allen, ihr von dem Gedanken gestellten Bedingungen
hervorzubringen. Denn sie steht ganz eigentlich einem unendlichen
und wahrhaft gränzenlosen Gebiete, dem Inbegriff alles
Denkbaren gegenüber. Sie muss daher von endlichen Mitteln einen unendlichen
Gebrauch machen, und vermag dies durch die Identität der
Gedanken- und Spracheerzeugenden Kraft. Es liegt hierin aber auch
nothwendig, dass sie nach zwei Seiten hin ihre Wirkung zugleich ausübt,
indem diese zunächst aus sich heraus auf das Gesprochene geht,
dann aber auch zurück auf die sie erzeugenden Kräfte. Beide Wirkungen
modificiren sich in jeder einzelnen Sprache durch die in ihr beobachtete
Methode und müssen daher bei der Darstellung und Beurtheilung
dieser zusammengenommen werden.357
Wortverwandtschaft und Wortform
25. Wir haben schon im Vorigen gesehen, dass die Worterfindung im
Allgemeinen nur darin besteht, nach der in beiden Gebieten aufgefassten
Verwandtschaft analogen Begriffen analoge Laute zu wählen und
die letzteren in eine mehr oder weniger bestimmte Form zu giessen. Es
kommen also hier zwei Dinge, die Wortform und die Wortverwandtschaft
in Betrachtung. Die letztere ist, weiter zergliedert, eine dreifache,
nemlich die der Laute, die logische der Begriffe und die aus der Rückwirkung
der Wörter auf das Gemüth entstehende. Da die Verwandtschaft,
insofern sie logisch ist, auf Ideen beruht, so erinnert man sich
hier zuerst an denjenigen Theil des Wortvorraths, in welchem Wörter
nach Begriffen allgemeiner Verhältnisse zu andren Wörtern, concrete
zu abstracten, einzelne Dinge andeutende zu collectiven u.s.f. umgestempelt
werden. Ich sondre ihn aber hier ab, da die charakteristische
Modification dieser Wörter sich ganz enge an diejenige anschliesst, welche
dasselbe Wort in den verschiednen Verhältnissen zur Rede annimmt.
In diesen Fällen wird ein sich immer gleich bleibender Theil der
Bedeutung des Wortes mit einem andren, wechselnden verbunden. Dasselbe
findet aber auch sonst in der Sprache statt. Sehr oft lässt sich in
dem, in der Bezeichnung verschiedenartiger Gegenstände gemeinschaftlichen
Begriffe ein stammhafter Grundtheil des Wortes erkennen,
und das Verfahren der Sprache kann diese Erkennung befördern oder
erschweren, den Stammbegriff und das Verhältniss seiner Modificationen
zu ihm herausheben oder verdunkeln. Die Bezeichnung des Begriffs
durch den Laut ist eine Verknüpfung von Dingen, deren Natur sich
wahrhaft niemals vereinigen kann. Der Begriff vermag sich aber ebensowenig
von dem Worte abzulösen, als der Mensch seine Gesichtszüge
ablegen kann. Das Wort ist seine individuelle Gestaltung und er kann,
wenn er diese verlassen will, sich selbst nur in andren Worten wiederfinden.
Dennoch muss die Seele immerfort versuchen, sich von dem
Gebiete der Sprache unabhängig zu machen, da das Wort allerdings
eine Schranke ihres inneren, immer mehr enthaltenden Empfindens ist
und oft gerade sehr eigenthümliche Nuancen desselben durch seine im
Laut mehr materielle, in der Bedeutung zu allgemeine Natur zu ersticken
droht. Sie muss das Wort mehr wie einen Anhaltspunkt ihrer inneren
Thätigkeit behandeln, als sich in seinen Gränzen gefangen halten
lassen. Was sie aber auf diesem Wege schützt und erringt, fügt sie wieder
dem Worte hinzu, und so geht aus diesem ihrem fortwährenden
Streben und Gegenstreben, bei gehöriger Lebendigkeit der geistigen
Kräfte, eine immer grössere Verfeinerung der Sprache, eine wachsende
Bereicherung derselben an seelenvollem Gehalte hervor, die ihre Forderungen
in eben dem Grade höher steigert, in dem sie besser befriedigt
358werden. Die Wörter erhalten, wie man an allen hoch gebildeten Sprachen
sehen kann, in dem Grade, in welchem Gedanke und Empfindung
einen höheren Schwung nehmen, eine mehr umfassende oder tiefer eingreifende
Bedeutung.
Die Verbindung der verschiedenartigen Natur des Begriffs und des
Lautes fordert, auch ganz abgesehen vom körperlichen Klange des letzteren
und bloss vor der Vorstellung selbst, die Vermittlung beider durch
etwas Drittes, in dem sie zusammentreffen können. Dies Vermittelnde
ist nun allemal sinnlicher Natur, wie in Vernunft die Vorstellung des
Nehmens, in Verstand die des Stehens, in Blüthe die des Hervorquellens
liegt; es gehört der äusseren oder inneren Empfindung oder Thätigkeit
an. Wenn die Ableitung es richtig entdecken lässt, kann man, immer das
Concretere mehr davon absondernd, es entweder ganz oder neben seiner
individuellen Beschaffenheit auf Extension oder Intension oder Veränderung
in beiden zurückführen, so dass man in die allgemeinen Sphären
des Raumes und der Zeit und des Empfindungsgrades gelangt.
Wenn man nun auf diese Weise die Wörter einer einzelnen Sprache
durchforscht, so kann es, wenn auch mit Ausnahme vieler einzelnen
Punkte, gelingen, die Fäden ihres Zusammenhanges zu erkennen und
das allgemeine Verfahren in ihr individualisirt, wenigstens in seinen
Hauptumrissen, zu zeichnen. Man versucht alsdann, von den concreten
Wörtern zu den gleichsam wurzelhaften Anschauungen und Empfindungen
aufzusteigen, durch welche jede Sprache, nach dem sie beseelenden
Genius, in ihren Wörtern den Laut mit dem Begriffe vermittelt.
Diese Vergleichung der Sprache mit dem ideellen Gebiete, als demjenigen,
dessen Bezeichnung sie ist, scheint jedoch umgekehrt zu fordern,
von den Begriffen aus zu den Wörtern herabzusteigen, da nur die Begriffe,
als die Urbilder, dasjenige enthalten können, was zur Beurtheilung
der Wortbezeichnung, ihrer Gattung und ihrer Vollständigkeit
nach, nothwendig ist. Das Verfolgen dieses Weges wird aber durch ein
inneres Hinderniss gehemmt, da die Begriffe, so wie man sie mit einzelnen
Wörtern stempelt, nicht mehr bloss etwas Allgemeines, erst näher
zu Individualisirendes darstellen können. Versucht man aber, durch
Aufstellung von Kategorieen zum Zweck zu gelangen, so bleibt zwischen
der engsten Kategorie und dem durch das Wort individualisirten
Begriff eine nie zu überspringende Kluft. Inwiefern also eine Sprache
die Zahl der zu bezeichnenden Begriffe erschöpft und in welcher Festigkeit
der Methode sie von den ursprünglichen Begriffen zu den abgeleiteten
besonderen herabsteigt, lässt sich im Einzelnen nie mit einiger Vollständigkeit
darstellen, da der Weg der Begriffsverzweigung nicht
durchführbar ist und der der Wörter wohl das Geleistete, nicht aber das
zu Fordernde zeigt.
Man kann den Wortvorrath einer Sprache auf keine Weise als eine
359fertig daliegende Masse ansehen. Er ist, auch ohne ausschliesslich der
beständigen Bildung neuer Wörter und Wortformen zu gedenken, so
lange die Sprache im Munde des Volks lebt, ein fortgehendes Erzeugniss
und Wiedererzeugniss des wortbildenden Vermögens, zuerst in
dem Stamme, dem die Sprache ihre Form verdankt, dann in der kindischen
Erlernung des Sprechens und endlich im täglichen Gebrauche
der Rede. Die unfehlbare Gegenwart des jedesmal nothwendigen Wortes
in dieser ist gewiss nicht bloss Werk des Gedächtnisses. Kein
menschliches Gedächtniss reichte dazu hin, wenn nicht die Seele instinctartig
zugleich den Schlüssel zur Bildung der Wörter selbst in sich
trüge. Auch eine fremde erlernt man nur dadurch, dass man sich nach
und nach, sey es auch nur durch Uebung, dieses Schlüssels zu ihr bemeistert,
nur vermöge der Einerleiheit der Sprachanlagen überhaupt
und der besonderen zwischen einzelnen Völkern bestehenden Verwandtschaft
derselben. Mit den todten Sprachen verhält es sich nur um
Weniges anders. Ihr Wortvorrath ist allerdings nach unserer Seite hin
ein geschlossenes Ganze, in dem nur glückliche Forschung in ferner
Tiefe liegende Entdeckungen zu machen im Stande ist. Allein ihr Studium
kann auch nur durch Aneignung des ehemals in ihnen lebendig
gewesenen Princips gelingen; sie erfahren ganz eigentlich eine wirkliche
augenblickliche Wiederbelebung. Denn eine Sprache kann unter keiner
Bedingung wie eine abgestorbene Pflanze erforscht werden. Sprache
und Leben sind unzertrennliche Begriffe und die Erlernung ist in diesem
Gebiete immer nur Wiedererzeugung.
Von dem hier gefassten Standpunkte aus zeigt sich nun die Einheit
des Wortvorrathes jeder Sprache am deutlichsten. Er ist ein Ganzes,
weil Eine Kraft ihn erzeugt hat und diese Erzeugung in unzertrennlicher
Verkettung fortgeführt worden ist. Seine Einheit beruht auf dem,
durch die Verwandtschaft der Begriffe geleiteten Zusammenhange der
vermittelnden Anschauungen und der Laute. Dieser Zusammenhang ist
es daher, den wir hier zunächst zu betrachten haben.
Die Indischen Grammatiker bauten ihr gewiss zu künstliches, aber
in seinem Ganzen von bewundrungswürdigem Scharfsinn zeugendes
System auf die Voraussetzung, dass sich der ihnen vorliegende Wortschatz
ihrer Sprache ganz durch sich selbst erklären lasse. Sie sahen
dieselbe daher als eine ursprüngliche an und schlössen auch alle Möglichkeit
im Verlaufe der Zeit aufgenommener fremder Wörter aus. Beides
war unstreitig falsch. Denn aller historischen oder aus der Sprache
selbst aufzufindenden Gründe nicht zu gedenken, ist es auf keine Weise
wahrscheinlich, dass sich irgend eine wahrhaft ursprüngliche Sprache
in ihrer Urform bis auf uns erhalten habe. Vielleicht hatten die Indischen
Grammatiker bei ihrem Verfahren auch nur mehr den Zweck im
Auge, die Sprache zur Bequemlichkeit der Erlernung in systematische
360Verbindung zu bringen, ohne sich gerade um die historische Richtigkeit
dieser Verbindung zu kümmern. Es mochte aber auch den Indiern in
diesem Punkte wie den meisten Nationen bei dem Aufblühen ihrer Geistesbildung
ergehen. Der Mensch sucht immer die Verknüpfung, auch
der äusseren Erscheinungen, zuerst im Gebiete der Gedanken auf; die
historische Kunst ist immer die späteste und die reine Beobachtung,
noch weit mehr aber der Versuch folgen erst in weiter Entfernung idealischen
oder phantastischen Systemen nach. Zuerst versucht der
Mensch die Natur von der Idee aus zu beherrschen. Dies zugestanden,
zeugt aber jene Voraussetzung der Erklärlichkeit des Sanskrits durch
sich allein von einem richtigen und tiefen Blick in die Natur der Sprache
überhaupt. Denn eine wahrhaft ursprüngliche und von fremder Einmischung
rein geschiedene müsste wirklich einen solchen thatsächlich
nachzuweisenden Zusammenhang ihres gesammten Wortvorraths in
sich bewahren. Es war überdies ein schon durch seine Kühnheit Achtung
verdienendes Unternehmen, sich gerade mit dieser Beharrlichkeit
in die Wortbildung, als den tiefsten und geheimnissvollsten Theil aller
Sprachen zu versenken.
Das Wesen des Lautzusammenhanges der Wörter beruht darauf,
dass eine massige Anzahl dem ganzen Wortvorrathe zum Grunde liegender
Wurzellaute durch Zusätze und Veränderungen auf immer bestimmtere
und mehr zusammengesetzte Begriffe angewendet wird. Die
Wiederkehr desselben Stammlauts oder doch die Möglichkeit, ihn nach
bestimmten Regeln zu erkennen, und die Gesetzmässigkeit in der Bedeutsamkeit
der modificirenden Zusätze oder innren Umänderungen
bestimmen alsdann diejenige Erklärlichkeit der Sprache durch sich
selbst, die man eine mechanische oder technische nennen kann.
Es giebt aber einen, sich auch auf die Wurzelwörter beziehenden,
wichtigen, noch bisher sehr vernachlässigten Unterschied unter den
Wörtern in Absicht auf ihre Erzeugung. Die grosse Anzahl derselben ist
gleichsam erzählender oder beschreibender Natur, bezeichnet Bewegungen,
Eigenschaften und Gegenstände an sich, ohne Beziehung auf
eine anzunehmende oder gefühlte Persönlichkeit; bei andren hingegen
macht gerade der Ausdruck dieser oder die schlichte Beziehung auf dieselbe
das ausschliessliche Wesen der Bedeutung aus. Ich glaube in einer
früheren Abhandlung 21 richtig gezeigt zu haben, dass die Personenwörter
die ursprünglichen in jeder Sprache seyn müssen und dass es eine
ganz unrichtige Vorstellung ist, das Pronomen als den spätesten Redetheil
in der Sprache anzusehen. Eine eng grammatische Vorstellungsart
der Vertretung des Nomen durch das Pronomen hat hier die tiefer aus
der Sprache geschöpfte Ansicht verdrängt. Das Erste ist natürlich die
Persönlichkeit des Sprechenden selbst, der in beständiger unmittelbarer
Berührung mit der Natur steht und unmöglich unterlassen kann, auch
361in der Sprache ihr den Ausdruck seines Ichs gegenüberzustellen. Im Ich
aber ist von selbst auch das Du gegeben, und durch einen neuen Gegensatz
entsteht die dritte Person, die sich aber, da nun der Kreis der Fühlenden
und Sprechenden verlassen wird, auch zur todten Sache erweitert.
Die Person, namentlich das Ich steht, wenn man von jeder
concreten Eigenschaft absieht, in der äusseren Beziehung des Raumes
und der inneren der Empfindung. Es schliessen sich also an die Personenwörter
Praepositionen und Interjectionen an. Denn die ersten sind
Beziehungen des Raumes oder der als Ausdehnung betrachteten Zeit
auf einen bestimmten, von ihrem Begriff nicht zu trennenden Punkt, die
letzteren sind blosse Ausbrüche des Lebensgefühls. Es ist sogar wahrscheinlich,
dass die wirklich einfachen Personenwörter ihren Ursprung
selbst in einer Raum- oder Empfindungsbeziehung haben.
Der hier gemachte Unterschied ist aber fein und muss genau in seiner
bestimmten Sonderung genommen werden. Denn auf der einen Seite
werden alle, die inneren Empfindungen bezeichnenden Wörter, wie
die für die äusseren Gegenstände, beschreibend und allgemein objectiv
gebildet. Der obige Unterschied beruht nur darauf, dass der wirkliche
Empfindungsausbruch einer bestimmten Individualität das Wesen der
Bezeichnung ausmacht. Auf der andren Seite kann es in den Sprachen
Pronomina und Praepositionen geben und giebt deren wirklich, die von
ganz concreten Eigenschaftswörtern hergenommen sind. Die Person
kann durch etwas mit ihrem Begriff Verbundenes bezeichnet werden,
die Praeposition auf eine ähnliche Weise durch ein mit ihrem Begriff
verwandtes Nomen, wie hinter durch Rücken, vor durch Brust u.s.f.
Wirklich so entstandene Wörter können durch die Zeit so unkenntlich
werden, dass die Entscheidung schwer fällt, ob sie so abgeleitete oder
ursprüngliche Wörter sind. Wenn hierüber aber auch in einzelnen Fällen
hin und her gestritten werden kann, so bleibt darum nicht abzuläugnen,
dass jede Sprache ursprünglich solche dem unmittelbaren Gefühl
der Persönlichkeit entstammte Wörter gehabt haben muss. Bopp hat
das wichtige Verdienst, diese zwiefache Gattung der Wurzelwörter zuerst
unterschieden und die bisher unbeachtet gebliebene in die Wort-
und Formenbildung eingeführt zu haben. Wir werden aber gleich weiter
unten sehen, auf welche sinnvolle, auch von ihm zuerst an den Sanskritformen
entdeckte Weise die Sprache beide, jede in einer verschiedenen
Geltung, zu ihren Zwecken verbindet.
Die hier unterschiednen objectiven und subjectiven Wurzeln der
Sprache (wenn ich mich der Kürze wegen dieser, allerdings bei weitem
nicht erschöpfenden Bezeichnung derselben bedienen darf) theilen indess
nicht ganz die gleiche Natur mit einander und können daher, genau
genommen, auch nicht auf dieselbe Weise als Grundlaute betrachtet
werden. Die objectiven tragen das Ansehen der Entstehung durch Analyse
362an sich; man hat die Nebenlaute abgesondert, die Bedeutung, um
alle darunter geordnete Wörter zu umfassen, zu schwankendem Umfange
erweitert und so Formen gebildet, die in dieser Gestalt nur uneigentlich
Wörter genannt werden können. Die subjectiven hat sichtbar
die Sprache selbst geprägt. Ihr Begriff erlaubt keine Weite, ist vielmehr
überall Ausdruck scharfer Individualität; er war dem Sprechenden unentbehrlich
und konnte bis zur Vollendung allmählicher Spracherweiterung
gewissermassen ausreichen. Er deutet daher, wie wir gleich in der
Folge näher untersuchen werden, auf einen primitiven Zustand der
Sprachen hin, was, ohne bestimmte historische Beweise, von den objectiven
Wurzeln nur mit grosser Behutsamkeit angenommen werden
kann.
Mit dem Namen der Wurzeln können nur solche Grundlaute belegt
werden, welche sich unmittelbar, ohne Dazwischenkunft anderer, schon
für sich bedeutsamer Laute, dem zu bezeichnenden Begriffe anschliessen.
In diesem strengen Verstande des Worts brauchen die Wurzeln
nicht der wahrhaften Sprache anzugehören, und in Sprachen, deren
Form die Umkleidung der Wurzeln mit Nebenlauten mit sich führt,
kann dies sogar überhaupt kaum oder doch nur unter bestimmten Bedingungen
der Fall seyn. Denn die wahre Sprache ist nur die in der
Rede sich offenbarende und die Spracherfindung lässt sich nicht auf
demselben Wege abwärts schreitend denken, den die Analyse aufwärts
verfolgt. Wenn in einer solchen Sprache eine Wurzel als Wort erscheint,
wie im Sanskrit yudh, Kampf, oder als Theil einer Zusammensetzung,
wie in dharmawid, gerechtigkeitskundig, so sind dies Ausnahmen, die
ganz und gar nicht zu der Voraussetzung eines Zustandes berechtigen,
wo auch, gleichsam wie im Chinesischen, die unbekleideten Wurzeln
sich mit der Rede verbanden. Es ist sogar viel wahrscheinlicher, dass, je
mehr die Stammlaute dem Ohre und dem Bewusstseyn der Sprechenden
geläufig wurden, solche einzelnen Fälle ihrer nackten Anwendung
dadurch eintraten. Indem aber durch die Zergliederung auf die Stammlaute
zurückgegangen wird, fragt es sich, ob man überall bis zu dem
wirklich Einfachen gelangt ist? Im Sanskrit ist schon mit glücklichem
Scharfsinn von Bopp und in einer schon oben erwähnten, wichtigen
Arbeit, die gewiss zur Grundlage weiterer Forschungen dienen wird,
von Pott gezeigt worden, dass mehrere angebliche Wurzeln zusammengesetzt
oder durch Reduplication abgeleitet sind. Aber auch auf solche,
die wirklich einfach scheinen, kann der Zweifel ausgedehnt werden. Ich
meine hier besonders die, welche von dem Bau der einfachen oder doch
den Vocal nur mit solchen Consonantenlauten, die sich bis zu schwieriger
Trennung mit ihm verschmelzen, umkleidenden Sylben abweichen.
Auch in ihnen können unkenntlich gewordene und phonetisch durch
Zusammenziehung, Abwerfung von Vocalen oder sonst veränderte Zusammensetzungen
363versteckt seyn. Ich sage dies nicht, um leere Muthmassungen
an die Stelle von Thatsachen zu setzen, wohl aber, um der
historischen Forschung nicht willkührlich das weitere Vordringen in
noch nicht gehörig durchschaute Sprachzustände zu verschliessen, und
weil die uns hier beschäftigende Frage des Zusammenhanges der Sprachen
mit dem Bildungsvermögen es nothwendig macht, alle Wege aufzusuchen,
welche die Entstehung des Sprachbaues genommen haben
kann.
Insofern sich die Wurzellaute durch ihre stätige Wiederkehr in sehr
abwechselnden Formen kenntlich machen, müssen sie in dem Grade
mehr zur Klarheit gelangen, in welchem eine Sprache den Begriff des
Verbum seiner Natur gemässer in sich ausgebildet hat. Denn bei der
Flüchtigkeit und Beweglichkeit dieses, gleichsam nie ruhenden Redetheils
zeigt sich nothwendig dieselbe Wurzelsylbe mit immer wechselnden
Nebenlauten. Die Indischen Grammatiker verfuhren daher nach einem
ganz richtigen Gefühl ihrer Sprache, indem sie alle Wurzeln als
Verbalwurzeln behandelten und jede bestimmten Conjugationen zuwiesen.
Es liegt aber auch in der Natur der Sprachentwicklung selbst, dass,
sogar geschichtlich, die Bewegungs- und Beschaffenheitsbegriffe die
zuerst bezeichneten seyn werden, da nur sie natürlich wieder gleich und
oft in dem nemlichen Acte die bezeichnenden der Gegenstände seyn
können, insofern diese einfache Wörter ausmachen. Bewegung und Beschaffenheit
stehen einander aber an sich nahe und ein lebhafter
Sprachsinn reisst die letztere noch häufiger zu der ersteren hin. Dass
die Indischen Grammatiker auch diese wesentliche Verschiedenheit der
Bewegung und Beschaffenheit und der selbstständige Sachen andeutenden
Wörter empfanden, beweist ihre Unterscheidung der Krit- und
Unâdi-Suffixe. Durch beide werden Wörter unmittelbar von den Wurzellauten
abgeleitet. Die ersteren aber bilden nur solche, in welchen der
Wurzelbegriff selbst bloss mit allgemeinen, auf mehrere zugleich passenden
Modificationen versehen wird. Wirkliche Substanzen finden
sich bei ihnen seltener und nur insofern, als die Bezeichnung derselben
von dieser bestimmten Art ist. Die Unâdi-Suffixe begreifen gerade im
Gegentheil nur Benennungen concreter Gegenstände und in den durch
sie gebildeten Wörtern ist der dunkelste Theil gerade das Suffix selbst,
welches den allgemeineren, den Wurzellaut modificirenden Begriff enthalten
sollte. Es ist nicht zu läugnen, dass ein grosser Theil dieser Bildungen
erzwungen und offenbar ungeschichtlich ist. Man erkennt zu
deutlich ihre absichtliche Entstehung aus dem Princip, alle Wörter der
Sprache, ohne Ausnahme, auf die einmal angenommenen Wurzeln zurückzubringen.
Unter diesen Benennungen concreter Gegenstände können
einestheils fremde in die Sprache aufgenommene, andrentheils aber
unkenntlich gewordene Zusammensetzungen liegen, wie es von den
364letzteren in der That erkennbare bereits unter den Unâdi-Wörtern
giebt. Es ist dies natürlich der dunkelste Theil aller Sprachen und man
hat daher mit Recht neuerlich vorgezogen, aus einem grossen Theile der
Unâdi-Wörter eine eigne Classe dunkler und ungewisser Herleitung zu
bilden.
Das Wesen des Lautzusammenhanges beruht auf der Kenntlichkeit
der Stammsylbe, die von den Sprachen überhaupt nach dem Grade der
Richtigkeit ihres Organismus mit mehr oder minder sorgfältiger Schonung
behandelt wird. In denen eines sehr vollkommenen Baues schliessen
sich aber an den Stammlaut, als den den Begriff individualisirenden,
Nebenlaute, als allgemeine, modificirende an. Wie nun in der
Aussprache der Wörter in der Regel jedes nur Einen Hauptaccent hat
und die unbetonten Sylben gegen die betonte sinken (s. unten §. 28.), so
nehmen auch in den einfachen, abgeleiteten Wörtern die Nebenlaute in
richtig organisirten Sprachen einen kleineren, obgleich sehr bedeutsamen
Raum ein. Sie sind gleichsam die scharfen und kurzen Merkzeichen
für den Verstand, wohin er den Begriff der mehr und deutlicher sinnlich
ausgeführten Stammsylbe zu setzen hat. Dies Gesetz sinnlicher Unterordnung,
das auch mit dem rhythmischen Baue der Wörter in Zusammenhang
steht, scheint durch sehr rein organisirte Sprachen auch formell,
ohne dass dazu die Veranlassung von den Wörtern selbst ausgeht,
allgemein zu herrschen, und das Bestreben der Indischen Grammatiker,
alle Wörter ihrer Sprache danach zu behandeln, zeugt wenigstens von
richtiger Einsicht in den Geist ihrer Sprache. Da sich die Unâdi-Suffixa
bei den früheren Grammatikern nicht gefunden haben sollen, so scheint
man aber hierauf erst später gekommen zu seyn. In der That zeigt sich in
den meisten Sanskrit-Wörtern für concrete Gegenstände dieser Bau einer
kurz abfallenden Endung neben einer vorherrschenden Stammsylbe
und dies lässt sich sehr füglich mit dem oben über die Möglichkeit unkenntlich
gewordener Zusammensetzung Gesagten vereinen. Der gleiche
Trieb hat, wie auf die Ableitung, so auch auf die Zusammensetzung
gewirkt und gegen den individueller oder sonst bestimmt bezeichnenden
Theil den anderen im Begriff und im Laute nach und nach fallen
lassen. Denn wenn wir in den Sprachen, ganz dicht neben einander, beinahe
unglaublich scheinende Verwischungen und Entstellungen der Laute
durch die Zeit und wieder ein, Jahrhunderte hindurch zu verfolgendes,
beharrliches Halten an ganz einzelnen und einfachen antreffen, so
liegt dies wohl meistentheils an dem durch irgend einen Grund motivirten
Streben oder Aufgeben des inneren Sprachsinnes. Die Zeit verlöscht
nicht an sich, sondern nur in dem Masse, als er vorher einen Laut absichtlich
oder gleichgültig fallen lässt.365
Isolirung der Wörter. Flexion und Agglutination
26. Ehe wir jetzt zu den wechselseitigen Beziehungen der Worte in der
zusammenhängenden Rede übergehen, muss ich eine Eigenschaft der
Sprachen erwähnen, welche sich zugleich über diese Beziehungen und
über einen Theil der Wortbildung selbst verbreitet. Ich habe schon im
Vorigen (VII 99. 108.) die Aehnlichkeit des Falles erwähnt, wenn ein
Wort durch die Hinzufügung eines allgemeinen, auf eine ganze Classe
von Wörtern anwendbaren Begriffs aus der Wurzel abgeleitet und wenn
dasselbe auf diese Weise, seiner Stellung in der Rede nach, bezeichnet
wird. Die hier wirksame oder hemmende Eigenschaft der Sprachen ist
nemlich die, welche man unter den Ausdrücken: Isolirung der Wörter,
Flexion und Agglutination zusammenzubegreifen pflegt. Sie ist der Angelpunkt,
um welchen sich die Vollkommenheit des Sprachorganismus
drehet, und wir müssen sie daher so betrachten, dass wir nach einander
untersuchen, aus welcher innren Forderung sie in der Seele entspringt,
wie sie sich in der Lautbehandlung äussert und wie jene innren Forderungen
durch diese Aeusserung erfüllt werden oder unbefriedigt bleiben?
immer der oben gemachten Eintheilung der in der Sprache zusammenwirkenden
Thätigkeiten folgend.
In allen hier zusammengefassten Fällen liegt in der innerlichen Bezeichnung
der Wörter ein Doppeltes, dessen ganz verschiedene Natur
sorgfältig getrennt werden muss. Es gesellt sich nemlich zu dem Acte
der Bezeichnung des Begriffes selbst noch eine eigne, ihn in eine bestimmte
Kategorie des Denkens oder Redens versetzende Arbeit des
Geistes, und der volle Sinn des Wortes geht zugleich aus jenem Begriffsausdruck
und dieser modificirenden Andeutung hervor. Diese beiden
Elemente aber liegen in ganz verschiedenen Sphären. Die Bezeichnung
des Begriffs gehört dem immer mehr objectiven Verfahren des Sprachsinnes
an. Die Versetzung desselben in eine bestimmte Kategorie des
Denkens ist ein neuer Act des sprachlichen Selbstbewusstseyns, durch
welchen der einzelne Fall, das individuelle Wort, auf die Gesammtheit
der möglichen Fälle in der Sprache oder Rede bezogen wird. Erst durch
diese, in möglichster Reinheit und Tiefe vollendete und der Sprache
selbst fest einverleibte Operation verbindet sich in derselben, in der gehörigen
Verschmelzung und Unterordnung, ihre selbstständige, aus
dem Denken entspringende und ihre mehr den äusseren Eindrücken in
reiner Empfänglichkeit folgende Thätigkeit.
Es giebt daher natürlich Grade, in welchen die verschiedenen Sprachen
diesem Erfordernisse genügen, da in der innerlichen Sprachgestaltung
keine dasselbe ganz unbeachtet zu lassen vermag. Allein auch in
denen, wo dasselbe bis zur äusserlichen Bezeichnung durchdringt,
kommt es auf die Tiefe und Lebendigkeit an, in welcher sie wirklich zu
366den ursprünglichen Kategorieen des Denkens aufsteigen und denselben
in ihrem Zusammenhange Geltung verschaffen. Denn diese Kategorien
bilden wieder ein zusammenhängendes Ganzes unter sich, dessen
systematische Vollständigkeit die Sprachen mehr oder weniger durchstrahlt.
Die Neigung der Classificirung der Begriffe, der Bestimmung
der individuellen durch die Gattung, welcher sie angehören, kann aber
auch aus einem Bedürfniss der Unterscheidung und der Bezeichnung
entstehen, indem man den Gattungsbegriff an den individuellen anknüpft.
Sie lässt daher an sich und nach diesem oder dem reineren
Ursprünge aus dem Bedürfniss des Geistes nach lichtvoller logischer
Ordnung verschiedene Stufen zu. Es giebt Sprachen, welche den Benennungen
der lebendigen Geschöpfe regelmässig den Gattungsbegriff
hinzufügen, und unter diesen solche, wo die Bezeichnung dieses Gattungsbegriffs
zum wirklichen, nur durch Zergliederung erkennbaren
Suffixe geworden ist. Diese Fälle hängen zwar noch immer mit dem
oben Gesagten zusammen, insofern auch in ihnen ein doppeltes Princip,
ein objectives der Bezeichnung und ein subjectives logischer Eintheilung,
sichtbar wird. Sie entfernen sich aber auf der andren Seite
gänzlich dadurch davon, dass hier nicht mehr Formen des Denkens und
der Rede, sondern nur verschiedene Classen wirklicher Gegenstände in
die Bezeichnung eingehen. So gebildete Wörter werden nun denjenigen
ganz ähnlich, in welchen zwei Elemente einen zusammengesetzten
Begriff bilden. Was dagegen in der innerlichen Gestaltung dem Begriffe
der Flexion entspricht, unterscheidet sich gerade dadurch, dass gar
nicht zwei Elemente, sondern nur Eines, in eine bestimmte Kategorie
versetztes das Doppelte ausmacht, von dem wir bei der Bestimmung
dieses Begriffs ausgiengen. Dass dies Doppelte, wenn man es auseinanderlegt,
nicht gleicher, sondern verschiedner Natur ist und verschiednen
Sphären angehört, bildet gerade hier das charakteristische Merkmal.
Nur dadurch können rein organisirte Sprachen die tiefe und feste
Verbindung der Selbstthätigkeit und Empfänglichkeit erreichen, aus
der hernach in ihnen eine Unendlichkeit von Gedankenverbindungen
hervorgeht, welche alle das Gepräge ächter, die Forderungen der Sprache
überhaupt rein und voll befriedigender Form an sich tragen. Dies
schliesst in der Wirklichkeit nicht aus, dass in den auf diese Weise gebildeten
Wörtern nicht auch bloss aus der Erfahrung geschöpfte Unterschiede
Platz finden könnten. Sie sind aber alsdann in Sprachen, die
einmal in diesem Theile ihres Baues von dem richtigen geistigen Principe
ausgehen, allgemeiner gefasst und schon durch das ganze übrige
Verfahren der Sprache auf eine höhere Stufe gestellt. So würde z. B.
der Begriff des Geschlechtsunterschiedes nicht haben ohne die wirkliche
Beobachtung entstehen können, wenn er sich gleich durch die allgemeinen
Begriffe der Selbstthätigkeit und Empfänglichkeit an die ursprünglichen
367Verschiedenheiten denkbarer Kräfte gleichsam von selbst
anreiht. Zu dieser Höhe nun wird er in der That in Sprachen gesteigert,
die ihn ganz und vollständig in sich aufnehmen und ihn auch auf
ganz ähnliche Weise, als die aus den bloss logischen Verschiedenheiten
der Begriffe entstehenden Wörter bezeichnen. Man knüpft nun nicht
zwei Begriffe an einander, man versetzt bloss einen, durch eine innere
Beziehung des Geistes, in eine Classe, deren Begriff durch viele Naturwesen
durchgeht, aber als Verschiedenheit wechselseitig thätiger Kräfte
auch unabhängig von einzelner Beobachtung aufgefasst werden
könnte.
Das lebhaft im Geiste Empfundene verschafft sich in den sprachbildenden
Perioden der Nationen auch allemal Geltung in den entsprechenden
Lauten. Wie daher zuerst innerlich das Gefühl der Nothwendigkeit
aufstieg, dem Worte, nach dem Bedürfniss der wechselnden
Rede oder seiner dauernden Bedeutung, seiner Einfachheit unbeschadet,
einen zwiefachen Ausdruck beizugeben, so entstand von innen hervor
Flexion in den Sprachen. Wir aber können nur den entgegengesetzten
Weg verfolgen, nur von den Lauten und ihrer Zergliederung in den
inneren Sinn eindringen. Hier nun finden wir, wo diese Eigenschaft ausgebildet
ist, in der That ein Doppeltes, eine Bezeichnung des Begriffs
und eine Andeutung der Kategorie, in die er versetzt wird. Denn auf
diese Weise lässt sich vielleicht am bestimmtesten das zwiefache Streben
unterscheiden, den Begriff zugleich zu stempeln und ihm das Merkzeichen
der Art beizugeben, in der er gerade gedacht werden soll. Die
Verschiedenheit dieser Absicht muss aber aus der Behandlung der Laute
selbst hervorspringen.
Das Wort lässt nur auf zwei Wegen eine Umgestaltung zu: durch innere
Veränderung oder äusseren Zuwachs. Beide sind unmöglich, wo
die Sprache alle Wörter starr in ihre Wurzelform, ohne Möglichkeit
äusseren Zuwachses, einschliesst und auch in ihrem Inneren keiner Veränderung
Raum giebt. Wo dagegen innere Veränderung möglich ist und
sogar durch den Wortbau befördert wird, ist die Unterscheidung der
Andeutung von der Bezeichnung, um diese Ausdrücke festzuhalten, auf
diesem Wege leicht und unfehlbar. Denn die in diesem Verfahren liegende
Absicht, dem Worte seine Identität zu erhalten und dasselbe doch als
verschieden gestaltet zu zeigen, wird am besten durch die innere Umänderung
erreicht. Ganz anders verhält es sich mit dem äusseren Zuwachs.
Er ist allemal Zusammensetzung im weiteren Sinne und es soll
hier der Einfachheit des Wortes kein Eintrag geschehen, es sollen nicht
zwei Begriffe zu einem dritten verknüpft, Einer soll in einer bestimmten
Beziehung gedacht werden. Es ist daher hier ein scheinbar künstlicheres
Verfahren erforderlich, das aber durch die Lebendigkeit der im Geiste
empfundenen Absicht von selbst in den Lauten hervortritt. Der andeutende
368Theil des Wortes muss mit der in ihn zugleich gelegten Lautschärfe
gegen das Uebergewicht des bezeichnenden auf eine andre Linie,
als dieser gestellt erscheinen; der ursprüngliche bezeichnende Sinn
des Zuwachses, wenn ihm ein solcher beigewohnt hat, muss in der Absicht,
ihn nur andeutend zu benutzen, untergehen, und der Zuwachs
selbst muss, verbunden mit dem Worte, nur als ein nothwendiger und
abhängiger Theil desselben, nicht als für sich der Selbstständigkeit fähig
behandelt werden. Geschieht dies, so entsteht, ausser der inneren
Veränderung und der Zusammensetzung, eine dritte Umgestaltung der
Wörter durch Anbildung und wir haben alsdann den wahren Begriff eines
Suffixes. Die fortgesetzte Wirksamkeit des Geistes auf den Laut verwandelt
dann von selbst die Zusammensetzung in Anbildung. In beiden
liegt ein entgegengesetztes Princip. Die Zusammensetzung ist für die
Erhaltung der mehrfachen Stammsylben in ihren bedeutsamen Lauten
besorgt, die Anbildung strebt, ihre Bedeutung, wie dieselbe an sich ist,
zu vernichten, und unter dieser entgegenstreitenden Behandlung erreicht
die Sprache hier ihren zwiefachen Zweck, durch die Bewahrung
und die Zerstörung der Erkennbarkeit der Laute. Die Zusammensetzung
wird erst dunkel, wenn, wie wir im Vorigen sahen, die Sprache,
einem anderen Gefühle folgend, sie als Anbildung behandelt. Ich habe
jedoch der Zusammensetzung hier mehr darum erwähnt, weil die Anbildung
hätte irrig mit ihr verwechselt werden können, als weil sie wirklich
mit ihr in Eine Classe gehörte. Dies ist immer nur scheinbar der
Fall, und auf keine Weise darf man sich die Anbildung mechanisch, als
absichtliche Verknüpfung des an sich Abgesonderten und Ausglättung
der Verbindungsspuren durch Worteinheit denken. Das durch Anbildung
flectirte Wort ist ebenso Eins, als die verschiedenen Theile einer
aufknospenden Blume es sind, und was hier in der Sprache vorgeht, ist
rein organischer Natur. Das Pronomen möge noch so deutlich an der
Person des Verbum haften, so wurde in acht flectirenden Sprachen es
nicht an dasselbe geknüpft. Das Verbum wurde nicht abgesondert gedacht,
sondern stand als individuelle Form vor der Seele da, und ebenso
gieng der Laut als Eins und untheilbar über die Lippen. Durch die unerforschliche
Selbstthätigkeit der Sprache brechen die Suffixa aus der
Wurzel hervor und dies geschieht so lange und so weit, als das schöpferische
Vermögen der Sprache ausreicht. Erst wenn dies nicht mehr thätig
ist, kann mechanische Anfügung eintreten. Um die Wahrheit des
wirklichen Vorgangs nicht zu verletzen und die Sprache nicht zu einem
blossen Verstandesverfahren niederzuziehen, muss man die hier zuletzt
gewählte Vorstellungsweise immer im Auge behalten. Man darf sich
aber nicht verhehlen, dass eben darum, weil sie auf das Unerklärliche
hingeht, sie nichts erklärt, dass die Wahrheit nur in der absoluten Einheit
des zusammen Gedachten und im gleichzeitigen Entstehen und in
369der symbolischen Uebereinkunft der inneren Vorstellung mit dem äusseren
Laute liegt, dass sie aber übrigens das nicht zu erhellende Dunkel
unter bildlichem Ausdruck verhüllt. Denn wenn auch die Laute der
Wurzel oft das Suffix modificiren, so thun sie dies nicht immer und nie
lässt sich anders, als bildlich sagen, dass das letztere aus dem Schoosse
der Wurzel hervorbricht. Dies kann immer nur heissen, dass der Geist
sie untrennbar zusammen denkt und der Laut, diesem zusammen Denken
folgsam, sie auch vor dem Ohre in Eins giesst. Ich habe daher die
oben gewählte Darstellung vorgezogen und werde sie auch in der Folge
dieser Blätter beibehalten. Mit der Verwahrung gegen alle Einmischung
eines mechanischen Verfahrens kann sie nicht zu Misverständnissen
Anlass geben. Für die Anwendung auf die wirklichen Sprachen aber ist
die Zerlegung in Anbildung und Worteinheit passender, weil die Sprache
technische Mittel für beide besitzt, besonders aber, weil sich die
Anbildung in gewissen Gattungen von Sprachen nicht rein und absolut,
sondern nur dem Grade nach von der wahren Zusammensetzung abscheidet.
Der Ausdruck der Anbildung, der nur den durch Zuwachs
acht flectirenden Sprachen gebührt, sichert schon, verglichen mit dem
der Anfügung, die richtige Auffassung des organischen Vorgangs.
Da die Aechtheit der Anbildung sich vorzüglich in der Verschmelzung
des Suffixes mit dem Worte offenbart, so besitzen die flectirenden
Sprachen zugleich wirksame Mittel zur Bildung der Worteinheit. Die
beiden Bestrebungen, den Wörtern durch feste Verknüpfung der Sylben
in ihrem Innren eine äusserlich bestimmt trennende Form zu geben und
Anbildung von Zusammensetzung zu sondern, befördern gegenseitig
einander. Dieser Verbindung wegen habe ich hier nur von Suffixen, Zuwächsen
am Ende des Wortes, nicht von Affixen überhaupt geredet.
Das hier die Einheit des Wortes Bestimmende kann, im Laute und in
der Bedeutung, nur von der Stammsylbe, von dem bezeichnenden Theile
des Wortes ausgehen und seine Wirksamkeit im Laute hauptsächlich
nur über das ihm Nachfolgende erstrecken. Die vorn zuwachsenden
Sylben verschmelzen immer in geringerem Grade mit dem Worte, so
wie auch in der Betonung und der metrischen Behandlung die Gleichgültigkeit
der Sylben vorzugsweise in den vorschlagenden liegt und der
wahre Zwang des Metrum erst mit der dasselbe eigentlich bestimmenden
Tactsylbe angeht. Diese Bemerkung scheint mir für die Beurteilung
derjenigen Sprachen besonders wichtig, die den Wörtern die ihnen
zuwachsenden Sylben in der Regel am Anfange anschliessen. Sie verfahren
mehr durch Zusammensetzung, als durch Anbildung und das
Gefühl wahrhaft gelungener Beugung bleibt ihnen fremd. Das, alle
Nuancen der Verbindung des zart andeutenden Sprachsinnes mit dem
Laute so vollkommen wiedergebende Sanskrit setzt andre Wohllautsregeln
für die Anschliessung der suffigirten Endungen und der praefigirten
370Praepositionen fest. Es behandelt die letzteren wie die Elemente zusammengesetzter
Wörter.
Das Suffix deutet die Beziehung an, in welcher das Wort genommen
werden soll; es ist also in diesem Sinne keinesweges bedeutungslos.
Dasselbe gilt von der inneren Umänderung der Wörter, also von der Flexion
überhaupt. Zwischen der inneren Umänderung aber und dem Suffixe
ist der wichtige Unterschied der, dass der ersteren ursprünglich gar
keine andere Bedeutung zum Grunde gelegen haben kann, die zuwachsende
Sylbe dagegen wohl meistentheils eine solche gehabt hat. Die innere
Umänderung ist daher allemal, wenn wir uns auch nicht immer in
das Gefühl davon versetzen können, symbolisch. In der Art der Umänderung,
dem Uebergange von einem helleren zu einem dunkleren, einem
schärferen zu einem gedehnteren Laute besteht eine Analogie mit
dem, was in beiden Fällen ausgedrückt werden soll. Bei dem Suffixe
waltet dieselbe Möglichkeit ob. Es kann ebensowohl ursprünglich und
ausschliesslich symbolisch seyn und diese Eigenschaft kann alsdann
bloss in den Lauten liegen. Es ist aber keinesweges nothwendig, dass
dies immer so sey, und es ist eine unrichtige Verkennung der Freiheit
und Vielfachheit der Wege, welche die Sprache in ihren Bildungen
nimmt, wenn man nur solche zuwachsenden Sylben Beugungssylben
nennen will, denen durchaus niemals eine selbstständige Bedeutung
beigewohnt hat und die ihr Daseyn in den Sprachen überhaupt nur der
auf Flexion gerichteten Absicht verdanken. Wenn man sich Absicht des
Verstandes unmittelbar schaffend in den Sprachen denkt, so ist dies,
meiner innersten Ueberzeugung nach, überhaupt immer eine irrige Vorstellungsweise.
Insofern das erste Bewegende in der Sprache allemal im
Geiste gesucht werden muss, ist allerdings Alles in ihr und die Ausstossung
des articulirten Lautes selbst Absicht zu nennen. Der Weg aber,
auf dem sie verfährt, ist immer ein andrer und ihre Bildungen entspringen
aus der Wechselwirkung der äusseren Eindrücke und des inneren
Gefühls, bezogen auf den allgemeinen, Subjectivität mit Objectivität in
der Schöpfung einer idealen, aber weder ganz innerlichen noch ganz
äusserlichen Welt verbindenden Sprachzweck. Das nun an sich nicht
bloss Symbolische und bloss Andeutende, sondern wirklich Bezeichnende
verliert diese letztere Natur da, wo es das Bedürfniss der Sprache
verlangt, durch die Behandlungsart im Ganzen. Man braucht z. B. nur
das selbstständige Pronomen mit dem in den Personen des Verbum
angebildeten zu vergleichen. Der Sprachsinn unterscheidet richtig Pronomen
und Person und denkt sich unter der letzteren nicht die selbstständige
Substanz, sondern eine der Beziehungen, in welchen der
Grundbegriff des flectirten Verbum nothwendig erscheinen muss. Er
behandelt sie also lediglich als einen Theil von diesem und gestattet der
Zeit, sie zu entstellen und abzuschleifen, sicher, dem durch sein ganzes
371Verfahrein befestigten Sinne solcher Andeutungen vertrauend, dass die
Entstellung der Laute dennoch die Erkennung der Andeutung nicht verhindern
wird. Die Entstellung mag nun wirklich statt gefunden haben
oder das angefügte Pronomen grösstentheils unverändert geblieben
seyn, so ist der Fall und der Erfolg immer der nemliche. Das Symbolische
beruht hier nicht auf einer unmittelbaren Analogie der Laute, es
geht aber aus der in sie auf kunstvollere Weise gelegten Ansicht der
Sprache hervor. Wenn es unbezweifelt ist, dass nicht bloss im Sanskrit,
sondern auch in andren Sprachen die Anbildungssylben mehr oder weniger
aus dem Gebiete der oben erwähnten, sich unmittelbar auf den
Sprechenden beziehenden Wurzelstämme genommen sind, so ruht das
Symbolische darin selbst. Denn die durch die Anbildungssylben angedeutete
Beziehung auf die Kategorieen des Denkens und Redens kann
keinen bedeutsameren Ausdruck finden, als in Lauten, die unmittelbar
das Subject zum Ausgangs- oder Endpunkt ihrer Bedeutung haben.
Hierzu kann sich hernach auch die Analogie der Töne gesellen, wie
Bopp so vortrefflich an der Sanskritischen Nominativ- und AccusativEndung
gezeigt hat. Im Pronomen der dritten Person ist der helle s-Laut
dem Lebendigen, der dunkle des m dem geschlechtslosen Neutrum offenbar
symbolisch beigegeben, und derselbe Buchstabenwechsel der
Endungen unterscheidet nun das in Handlung gestellte Subject, den
Nominativ, von dem Accusativ, dem Gegenstande der Wirkung.
Die ursprünglich selbstständige Bedeutsamkeit der Suffixe ist daher
kein nothwendiges Hinderniss der Reinheit ächter Flexion. Mit solchen
Beugungssylben gebildete Wörter erscheinen ebenso bestimmt, als wo
innere Umänderung statt findet, nur als einfache, in verschiedne Formen
gegossne Begriffe und erfüllen daher genau den Zweck der Flexion.
Allein diese Bedeutsamkeit fordert allerdings grössere Stärke des inneren
Flexionssinnes und entschiednere Lautherrschaft des Geistes, die
bei ihr die Ausartung der grammatischen Bildung in Zusammensetzung
zu überwinden hat. Eine Sprache, die sich, wie das Sanskrit, hauptsächlich
solcher ursprünglich selbstständig bedeutsamen Beugungssylben
bedient, zeigt dadurch selbst das Vertrauen, das sie in die Macht des sie
belebenden Geistes setzt.
Das phonetische Vermögen und die sich daran knüpfenden Lautgewohnheiten
der Nationen wirken aber auch in diesem Theile der Sprache
bedeutend mit. Die Geneigtheit, die Elemente der Rede mit einander
zu verbinden, Laute an Laute anzuknüpfen, wo es ihre Natur
erlaubt, einen in den andren zu verschmelzen und überhaupt sie, ihrer
Beschaffenheit gemäss, in der Berührung zu verändern, erleichtert dem
Flexionssinne sein Einheit bezweckendes Geschäft, so wie das strengere
Auseinanderhalten der Töne einiger Sprachen seinem Gelingen entgegenwirkt.
Befördert nun das Lautvermögen das innerliche Erforderniss,
372so wird der ursprüngliche Articulationssinn rege und es kommt auf diese
Weise das bedeutsame Spalten der Laute zu Stande, vermöge dessen
auch ein einzelner zum Träger eines formalen Verhältnisses werden
kann, was hier gerade, mehr als in irgend einem andren Theile der Sprache,
entscheidend ist, da hier eine Geistesrichtung angedeutet, nicht ein
Begriff bezeichnet werden soll. Die Schärfe des Articulationsvermögens
und die Reinheit des Flexionssinnes stehen daher in einem sich wechselseitig
verstärkenden Zusammenhange.
Zwischen dem Mangel aller Andeutung der Kategorieen der Wörter,
wie er sich im Chinesischen zeigt, und der wahren Flexion kann es kein
mit reiner Organisation der Sprachen verträgliches Drittes geben. Das
einzige dazwischen Denkbare ist als Beugung gebrauchte Zusammensetzung,
also beabsichtigte, aber nicht zur Vollkommenheit gediehene
Flexion, mehr oder minder mechanische Anfügung, nicht rein organische
Anbildung. Dies, nicht immer leicht zu erkennende Zwitterwesen
hat man in neuerer Zeit Agglutination genannt. Diese Art der Anknüpfung
von bestimmenden Nebenbegriffen entspringt auf der einen Seite
allemal aus Schwäche des innerlich organisirenden Sprachsinnes oder
aus Vernachlässigung der wahren Richtung desselben, deutet aber auf
der andren dennoch das Bestreben an, sowohl den Kategorieen der Begriffe
auch phonetische Geltung zu verschaffen, als dieselben in diesem
Verfahren nicht durchaus gleich mit der wirklichen Bezeichnung der
Begriffe zu behandeln. Indem also eine solche Sprache nicht auf die
grammatische Andeutung Verzicht leistet, bringt sie dieselbe nicht rein
zu Stande, sondern verfälscht sie in ihrem Wesen selbst. Sie kann daher
scheinbar und bis auf einen gewissen Grad sogar wirklich eine Menge
von grammatischen Formen besitzen und doch nirgends den Ausdruck
des wahren Begriffs einer solchen Form wirklich erreichen. Sie kann
übrigens einzeln auch wirkliche Flexion durch innere Umänderung der
Wörter enthalten und die Zeit kann ihre ursprünglich wahren Zusammensetzungen
scheinbar in Flexionen verwandeln, so dass es schwer
wird, ja zum Theil unmöglich bleibt, jeden einzelnen Fall richtig zu beurtheilen.
Was aber wahrhaft über das Ganze entscheidet, ist die Zusammenfassung
aller zusammen gehörenden Fälle. Aus der allgemeinen
Behandlung dieser ergiebt sich alsdann, in welchem Grade der Stärke
oder Schwäche das flectirende Bestreben des inneren Sinnes über den
Bau der Laute Gewalt ausübte. Hierin allein kann der Unterschied gesetzt
werden. Denn diese sogenannten agglutinirenden Sprachen unterscheiden
sich von den flectirenden nicht der Gattung nach, wie die alle
Andeutung durch Beugung zurückweisenden, sondern nur durch den
Grad, in welchem ihr dunkles Streben nach derselben Richtung hin
mehr oder weniger mislingt.
Wo Helle und Schärfe des Sprachsinns in der Bildungsperiode den
373richtigen Weg eingeschlagen hat - und er ergreift mit diesen Eigenschaften
keinen falschen - ergiesst sich die innere Klarheit und Bestimmtheit
über den ganzen Sprachbau und die hauptsächlichsten
Aeusserungen seiner Wirksamkeit stehen in ungetrenntem Zusammenhange
mit einander. So haben wir die unauflösliche Verbindung des Flexionssinnes
mit dem Streben nach Worteinheit und dem, Laute bedeutsam
spaltenden Articulationsvermögen gesehen. Die Wirkung kann
nicht dieselbe da seyn, wo nur einzelne Funken der reinen Bestrebungen
dem Geiste entsprühen, und der Sprachsinn hat, worauf wir gleich
in der Folge kommen werden, alsdann gewöhnlich einen einzelnen,
vom richtigen ablenkenden, allein oft von gleich grossem Scharfsinne
und gleich feinem Gefühl zeugenden Weg ergriffen. Dies äussert alsdann
seine Wirkung auch oft auf den einzelnen Fall. So ist in diesen
Sprachen, die man nicht als flectirende zu bezeichnen berechtigt ist, die
innere Umgestaltung der Wörter, wo es eine solche giebt, meistentheils
von der Art, dass sie dem inneren angedeuteten Verfahren gleichsam
durch eine rohe Nachbildung des Lautes folgt, den Plural und das Praeteritum
z. B. durch materielles Aufhalten der Stimme oder durch heftig
aus der Kehle hervorgestossenen Hauch bezeichnet und gerade da, wo
rein gebildete Sprachen, wie die Semitischen, die grösste Schärfe des
Articulationssinnes durch symbolische Veränderung des Vocals, zwar
nicht gerade in den genannten, aber in andren grammatischen Umgestaltungen
beweisen, das Gebiet der Articulation beinahe verlassend,
auf die Gränzen des Naturlauts zurückkehrt. Keine Sprache ist, meiner
Erfahrung nach, durchaus agglutinirend und bei den einzelnen Fällen
lässt sich oft nicht entscheiden, wie viel oder wenig Antheil der Flexionssinn
an dem scheinbaren Suffix hat. In allen Sprachen, die in der
That Neigung zur Lautverschmelzung äussern oder doch dieselbe nicht
starr zurückweisen, ist einzeln Flexionsbestreben sichtbar. Ueber das
Ganze der Erscheinung aber kann nur nach dem Organismus des gesammten
Baues einer solchen Sprache ein sicheres Urtheil gefällt werden.
Nähere Betrachtung der Worteinheit.
Einverleibungssystem der Sprachen
27. Wie jede aus der inneren Auffassung der Sprache entspringende Eigenthümlichkeit
derselben in ihren ganzen Organismus eingreift, so ist
dies besonders mit der Flexion der Fall. Sie steht namentlich mit zwei
verschiedenen und scheinbar entgegengesetzten, allein in der That organisch
zusammenwirkenden Stücken, mit der Worteinheit und der angemessenen
Trennung der Theile des Satzes, durch welche seine Gliederung
374möglich wird, in der engsten Verbindung. Ihr Zusammenhang mit
der Worteinheit wird von selbst begreiflich, da ihr Streben ganz eigentlich
auf Bildung einer Einheit, sich nicht bloss an einem Ganzen begnügend,
hinausgeht. Sie befördert aber auch die angemessene Gliederung
des Satzes und die Freiheit seiner Bildung, indem sie in ihrem eigentlich
grammatischen Verfahren die Wörter mit Merkzeichen versieht, welchen
man das Wiedererkennen ihrer Beziehung zum Ganzen des Satzes
mit Sicherheit anvertrauen kann. Sie hebt dadurch die Aengstlichkeit
auf, ihn wie ein einzelnes Wort zusammenzuhalten, und ermuthigt zu
der Kühnheit, ihn in seine Theile zu zerschlagen. Sie weckt aber, was
noch weit wichtiger ist, durch den in ihr liegenden Rückblick auf die
Formen des Denkens, insofern diese auf die Sprache bezogen werden,
eine richtigere und anschaulichere Einsicht in seine Zusammenfügungen.
Denn eigentlich entspringen alle drei hier genannten Eigenthümlichkeiten
der Sprache aus Einer Quelle, aus der lebendigen Auffassung
des Verhältnisses der Rede zur Sprache. Flexion, Worteinheit und angemessene
Gliederung des Satzes sollten daher in der Betrachtung der
Sprache nie getrennt werden. Die Flexion erscheint erst durch die Hinzufügung
dieser andren Punkte in ihrer wahren, wohlthätig einwirkenden
Kraft.
Die Rede fordert, gehörig zu der Möglichkeit ihres gränzenlosen, in
keinem Augenblick messbaren Gebrauchs zugerichtete Elemente, und
diese Forderung wächst an intensivem und extensivem Umfang, je höher
die Stufe ist, auf welche sie sich stellt. Denn in ihrer höchsten Erhebung
wird sie zur Ideenerzeugung und gesammten Gedankenentwicklung
selbst. Ihre Richtung geht aber allemal im Menschen, auch wo die
wirkliche Entwicklung noch so viele Hemmungen erfährt, auf diesen
letzten Zweck hin. Sie sucht daher immer die Zurichtung der Sprachelemente,
welche den lebendigsten Ausdruck der Formen des Denkens
enthält, und darum sagt ihr vorzugsweise die Flexion zu, deren Charakter
es gerade ist, den Begriff immer zugleich nach seiner äussren und
nach der innren Beziehung zu betrachten, welche das Fortschreiten des
Denkens durch die Regelmässigkeit des eingeschlagenen Weges erleichtert.
Mit diesen Elementen aber will die Rede die zahllosen Combinationen
des geflügelten Gedanken, ohne in ihrer Unendlichkeit beschränkt
zu werden, erreichen. Dem Ausdrucke aller dieser Verknüpfungen liegt
die Satzbildung zum Grunde, und es ist jener freie Aufflug nur möglich,
wenn die Theile des einfachen Satzes nach aus seinem Wesen geschöpfter
Nothwendigkeit, nicht mit mehr oder weniger Willkühr an einander
gelassen oder getrennt sind.
Die Ideenentwicklung erfordert ein zwiefaches Verfahren, ein Vorstellen
der einzelnen Begriffe und eine Verknüpfung derselben zum Gedanken.
Beides tritt auch in der Rede hervor. Ein Begriff wird in zusammengehörende,
375ohne Zerstörung der Bedeutung nicht trennbare Laute eingeschlossen
und empfängt Kennzeichen seiner Beziehung zur Construction
des Satzes. Das so gebildete Wort spricht die Zunge, indem sie es von
andren, in dem Gedanken mit ihm verbundenen trennt, als ein Ganzes
zusammen aus, hebt aber dadurch nicht die gleichzeitige Verschlingung
aller Worte der Periode auf. Hierin zeigt sich die Worteinheit im engsten
Verstande, die Behandlung jedes Wortes als eines Individuums, welches,
ohne seine Selbstständigkeit aufzugeben, mit andren in verschiedene
Grade der Berührung treten kann. Wir haben aber oben gesehen, dass
sich auch innerhalb der Sphäre desselben Begriffs, mithin desselben
Wortes bisweilen ein verbundenes Verschiedenes findet, und hieraus entspringt
eine andre Gattung der Worteinheit, die man zum Unterschiede
von der obigen äusseren eine innere nennen kann. Je nachdem nun das
Verschiedene gleichartig ist und sich bloss zum zusammengesetzten Ganzen
verbindet oder ungleichartig (Bezeichnung und Andeutung) den
Begriff als mit bestimmtem Gepräge versehen darstellen muss, hat die
innere Worteinheit eine weitere und engere Bedeutung.
Die Worteinheit in der Sprache hat eine doppelte Quelle, in dem innren,
sich auf das Bedürfnis der Gedankenentwicklung beziehenden
Sprachsinn und in dem Laute. Da alles Denken in Trennen und Verknüpfen
besteht, so muss das Bedürfniss des Sprachsinnes, alle verschiedenen
Gattungen der Einheit der Begriffe symbolisch in der Rede
darzustellen, von selbst wach werden und nach Massgabe seiner Regsamkeit
und geordneten Gesetzmässigkeit in der Sprache ans Licht
kommen. Auf der andren Seite sucht der Laut seine verschiedenen, in
Berührung tretenden Modificationen in ein, der Aussprache und dem
Ohre zusagendes Verhältniss zu bringen. Oft gleicht er dadurch nur
Schwierigkeiten aus oder folgt organisch angenommenen Gewohnheiten.
Er geht aber auch weiter, bildet RhythmusAbschnitte und behandelt
diese als Ganze für das Ohr. Beide nun aber, der innere Sprachsinn
und der Laut, wirken, indem sich der letztere an die Forderungen des
ersteren anschliesst, zusammen und die Behandlung der Lauteinheit
wird dadurch zum Symbole der gesuchten bestimmten Begriffseinheit.
Diese, dadurch in die Laute gelegt, ergiesst sich als geistiges Princip
über die Rede und die melodisch und rhythmisch künstlerisch behandelte
Lautformung weckt, zurückwirkend, in der Seele eine engere Verbindung
der ordnenden Verstandeskräfte mit bildlich schaffender Phantasie,
woraus also die Verschlingung der sich nach aussen und nach
innen, nach dem Geist und nach der Natur hin bewegenden Kräfte ein
erhöhtes Leben und eine harmonische Regsamkeit schöpft.376
Bezeichnungsmittel der Worteinheit. Pause
Die Bezeichnungsmittel der Worteinheit in der Rede sind Pause, Buchstabenveränderung
und Accent.
Die Pause kann nur zur Andeutung der äusseren Einheit dienen; innerhalb
des Wortes würde sie, gerade umgekehrt, seine Einheit zerstören.
In der Rede aber ist ein flüchtiges, nur dem geübten Ohre merkbares
Innehalten der Stimme am Ende der Wörter, um die Elemente des
Gedanken kenntlich zu machen, natürlich. Indess steht mit dem Streben
nach der Bezeichnung der Einheit des Begriffs das gleich nothwendige
nach der Verschlingung des Satzes, die lautbar werdende Einheit
des Begriffs mit der Einheit des Gedanken im Gegensatz, und Sprachen,
in welchen sich ein richtig und fein fühlender Sinn offenbart, machen
die doppelte Absicht kund und ebnen jenen Gegensatz, oft noch
indem sie ihn verstärken, wieder durch andre Mittel. Ich werde die erläuternden
Beispiele hier immer aus dem Sanskrit hernehmen, 22 weil
diese Sprache glücklicher und erschöpfender, als irgend eine andere die
Worteinheit behandelt und auch ein Alphabet besitzt, das mehr, als die
unsrigen die genaue Aussprache vor dem Ohre auch dem Auge graphisch
darzustellen bemüht ist. Das Sanskrit nun gestattet nicht jedem
Buchstaben, ein Wort zu beschliessen, und erkennt also dadurch schon
die selbstständige Individualität des Wortes an, sanctionirt auch seine
Absonderung in der Rede dadurch, dass es die Veränderungen in Berührung
tretender Buchstaben bei den schliessenden und anfangenden
anders, als in der Mitte der Wörter regelt. Zugleich aber folgt in ihr
mehr, als in einer andren Sprache ihres Stammes der Verschlingung des
Gedanken auch die Verschmelzung der Laute, so dass, auf den ersten
Anblick, die Worteinheit durch die Gedankeneinheit zerstört zu werden
scheint. Wenn sich der End- und der Anfangsvocal in einen dritten verwandeln,
so entsteht dadurch unläugbar eine Lauteinheit beider Wörter.
Wo Endconsonanten sich vor Anfangsvocalen verändern, ist dies
zwar wohl darum nicht der Fall, weil der Anfangsvocal, immer von einem
gelinden Hauche begleitet, sich nicht in dem Verstande an den
Endconsonanten anschliesst, in welchem das Sanskrit den Consonanten
mit dem in derselben Sylbe auf ihn folgenden Vocal als unlösbar Eins
betrachtet. Indess stört diese Consonantenveränderung immer die Andeutung
der Trennung der einzelnen Wörter. Diese leise Störung kann
aber dieselbe im Geiste des Hörers nie wirklich aufheben, nicht einmal
die Anerkennung derselben bedeutend schwächen. Denn einestheils
finden gerade die beiden Hauptgesetze der Veränderung zusammenstossender
Wörter, die Verschmelzung der Vocale und die Verwandlung
dumpfer Consonanten in tönende vor Vocalen, innerhalb desselben
Wortes nicht statt, andrentheils aber ist im Sanskrit die innere Worteinheit
377so klar und bestimmt geordnet, dass man in aller Lautverschlingung
der Rede nie verkennen kann, dass es selbstständige Lauteinheiten
sind, die nur in unmittelbare Berührung mit einander treten. Wenn
übrigens die Lautverschlingung der Rede für die feine Empfindlichkeit
des Ohres und für das lebendige Dringen auf die symbolische Andeutung
der Einheit des Gedanken spricht, so ist es doch merkwürdig, dass
auch andre Indische Sprachen, namentlich die Telingische, welchen
man keine, aus ihnen selbst entsprungene, grosse Cultur zuschreiben
kann, diese, mit den innersten Lautgewohnheiten eines Volks zusammenhängende
und daher wohl nicht leicht bloss aus einer Sprache in
die andre übergehende Eigenthümlichkeit besitzen. An sich ist das Verschlingen
aller Laute der Rede in dem ungebildeten Zustande der Sprache
natürlicher, da das Wort erst aus der Rede abgeschieden werden
muss; im Sanskrit aber ist diese Eigenthümlichkeit zu einer inneren und
äusseren Schönheit der Rede geworden, die man darum nicht geringer
schätzen darf, weil sie, gleichsam als ein dem Gedanken nicht nothwendiger
Luxus, entbehrt werden könnte. Es giebt offenbar eine, von dem
einzelnen Ausdruck verschiedene Rückwirkung der Sprache auf den
Gedanken erzeugenden Geist selbst und für diese geht keiner ihrer,
auch einzeln entbehrlich scheinenden Vorzüge verloren.
Bezeichnungsmittel der Worteinheit. Buchstabenveränderung
Die innere Worteinheit kann wahrhaft nur in Sprachen zum Vorschein
kommen, welche durch Umkleidung des Begriffs mit seinen Nebenbestimmungen
den Laut zur Mehrsylbigkeit erweitern und innerhalb dieser
mannigfaltige Buchstabenveränderungen zulassen. Der auf die
Schönheit des Lauts gerichtete Sprachsinn behandelt alsdann diese innere
Sphäre des Wortes nach allgemeinen und besondren Gesetzen des
Wohllauts und des Zusammenklanges. Allein auch der Articulationssinn
wirkt und zwar hauptsächlich auf diese Bildungen mit, indem er
bald Laute zu verschiedener Bedeutsamkeit umändert, bald aber auch
solche, die auch selbstständige Geltung besitzen, dadurch, dass sie nun
bloss als Zeichen von Nebenbestimmungen gebraucht werden, in sein
Gebiet herüberzieht. Denn ihre ursprünglich sachliche Bedeutung wird
jetzt zu einer symbolischen, der Laut selbst wird durch die Unterordnung
unter einen Hauptbegriff oft bis zum einfachen Elemente abgeschliffen
und erhält daher, auch bei verschiedenem Ursprünge, eine
ähnliche Gestalt mit den durch den Articulationssinn wirklich gebildeten,
rein symbolischen. Je reger und thätiger der Articulationssinn in
der beständigen Verschmelzung des Begriffs mit dem Laute ist, desto
schneller geht diese Operation von statten.378
Vermittelst dieser, hier zusammenwirkenden Ursachen entspringt nun
ein, zugleich den Verstand und das ästhetische Gefühl befriedigender
Wortbau, in welchem eine genaue Zergliederung, von dem Stammworte
ausgehend, von jedem hinzugekommenen, ausgestossenen oder veränderten
Buchstaben aus Gründen der Bedeutsamkeit oder des Lauts Rechenschaft
zu geben bemüht seyn muss. Sie kann aber dies Ziel auch
wirklich wenigstens insofern erreichen, als sie jeder solcher Veränderung
erklärende Analogieen an die Seite zu stellen vermag. Der Umfang und
die Mannigfaltigkeit dieses Wortbaues ist in den Sprachen am grössten
und am befriedigendsten für den Verstand und das Ohr, welche den ursprünglichen
Wortformen kein einförmig bestimmtes Gepräge aufdrücken
und sich zur Andeutung der Nebenbestimmungen, vorzugsweise vor
der inneren rein symbolischen Buchstabenveränderung, der Anbildung
bedienen. Das, wenn man es mit mechanischer Anfügung verwechselt,
ursprünglich roher und ungebildeter scheinende Mittel übt, durch die
Stärke des Flexionssinns auf eine höhere Stufe gestellt, unläugbar hierin
einen Vorzug vor dem in sich feineren und kunstvolleren aus. Es liegt
gewiss grossentheils in dem zweisylbigen Wurzelbaue und in der Scheu
vor Zusammensetzung, dass der Wortbau in den Semitischen Sprachen,
ungeachtet des sich in ihm so bewundrungswürdig mannigfaltig und sinnreich
offenbarenden Flexions- und Articulationssinnes, doch bei weitem
nicht der Mannigfaltigkeit, dem Umfange und der Angemessenheit zu
dem gesammten Zweck der Sprache des Sanskritischen gleichkommt.
Das Sanskrit bezeichnet durch den Laut die verschiedenen Grade
der Einheit, zu deren Unterscheidung der innere Sprachsinn ein Bedürfniss
fühlt. Es bedient sich dazu hauptsächlich einer verschiedenartigen
Behandlung der als verschiedene Begriffselemente in demselben Wort
zusammentretenden Sylben und einzelnen Laute in den Buchstaben, in
welchen sich dieselben berühren. Ich habe schon oben angeführt, dass
diese Behandlung eine verschiedene bei getrennten Worten und in der
Wortmitte ist. Denselben Weg verfolgt die Sprache nun weiter, und
wenn man die Regeln für diese beiden Fälle als zwei grosse einander
entgegengesetzte Classen bildend ansieht, so deutet die Sprache, von
der mehr lockren zur festeren Verbindung hin, die Worteinheit in folgenden
Abstufungen an:
bei zusammengesetzen Wörtern,
bei mit Praefixen verbundenen, meistentheils Verben,
bei solchen, die durch Suffixa (Taddhita-Suffixa) aus in der Sprache
vorhandenen Grundwörtern gebildet sind,
bei solchen (Kridanta-Wörtern), welche durch Suffixa aus Wurzeln,
also aus Wörtern, die eigentlich ausserhalb der Sprache liegen,
abgeleitet werden,
bei den grammatischen Declinations- und Conjugationsformen.379
Die beiden zuerst genannten Gattungen der Wörter folgen im Ganzen
den Anfügungsregeln getrennter Wörter, die drei letzten denen der
Wortmitte. Doch giebt es hierin, wie sich von selbst versteht, einzelne
Ausnahmen, und der ganzen hier aufgestellten Abstufung liegt natürlich
keine für jede Classe absolute Verschiedenheit der Regeln, sondern
nur ein, aber sehr entschiedenes, grösseres oder geringeres Annähern
an die beiden Hauptclassen zum Grunde. In den Ausnahmen selbst
aber verräth sich oft wieder auf sinnvolle Weise die Absicht festerer
Vereinigung. So übt bei getrennten Wörtern eigentlich, wenn man Eine,
nur scheinbare Ausnahme hinwegnimmt, der Endconsonant eines vorhergehenden
Worts niemals eine Veränderung des Anfangsbuchstaben
des nachfolgenden; dagegen findet dies bei einigen zusammengesetzten
Wörtern und bei Praefixen auf eine Weise statt, die bisweilen noch auf
den zweiten Anfangsconsonanten Einfluss hat, wie wenn aus agni, Feuer,
und stôma, Opfer, verbunden agnishtôma, Brandopfer, wird. Durch
diese Entfernung von den Anfügungsregeln getrennter Wörter deutet
die Sprache offenbar ihr Gefühl der Forderung der Worteinheit an.
Dennoch ist es nicht zu läugnen, dass die zusammengesetzten Wörter
im Sanskrit durch die übrige und allgemeinere Behandlung der sich in
ihnen berührenden End- und Anfangsbuchstaben und durch den Mangel
von Verbindungslauten, deren sich die Griechische Sprache immer
in diesem Falle bedient, den getrennten Wörtern zu sehr gleichkommen.
Die, uns freilich unbekannte Betonung kann dies kaum aufgehoben
haben. Wo das erste Glied der Zusammensetzung seine grammatische
Beugung beibehält, liegt die Verbindung wirklich allein im
Sprachgebrauch, der entweder diese Wörter immer verknüpft oder sich
des letzten Gliedes niemals einzeln bedient. Allein auch der Mangel der
Beugungen bezeichnet die Einheit dieser Wörter mehr nur vor dem Verstande,
ohne dass sie durch Verschmelzung der Laute vor dem Ohre
Gültigkeit erhält. Wo Grundform und Casusendung im Laute zusammenfallen,
lässt es die Sprache ohne ausdrückliche Bezeichnung, ob ein
Wort für sich steht oder Element eines zusammengesetzten ist. Ein langes
Sanskritisches Compositum ist daher, der ausdrücklichen grammatischen
Andeutung nach, weniger ein einzelnes Wort, als eine Reihe
beugungslos an einander gestellter Wörter, und es ist ein richtiges Gefühl
der Griechischen Sprache, ihr Compositum nie durch zu grosse
Länge dahin ausarten zu lassen. Allein auch das Sanskrit beweist wieder
in andren Eigenthümlichkeiten, wie sinnvoll es bisweilen die Einheit
dieser Wörter anzudeuten versteht, so z.B., wenn es zwei oder
mehrere Substantiva, welches Geschlechts sie seyn mögen, in Ein geschlechtsloses
zusammenfasst.
Unter den Classen von Wörtern, welche den Anfügungsgesetzen der
Wortmitte folgen, stehen die Kridanta-Wörter und die grammatisch
380flectirten einander am nächsten, und wenn es zwischen denselben Spuren
noch innigerer Verbindung giebt, so liegen sie eher in dem Unterschiede
der Casus- und Verbalendungen. Die Krit-Suffixa verhalten sich
durchaus wie die letzteren. Denn sie bearbeiten unmittelbar die Wurzel,
die sie erst eigentlich in die Sprache einführen, indess die Casusendungen,
hierin den TaddhitaSuffixen gleich, sich an schon durch die
Sprache selbst gegebene Grundwörter anschliessen. Am festesten ist
die Innigkeit der Lautverschmelzung mit Recht in den Beugungen des
Verbum, da sich der Verbalbegriff auch vor dem Verstande am wenigsten
von seinen Nebenbestimmungen trennen lässt.
Ich habe hier nur zu zeigen bezweckt, auf welche Weise die Wohllautsgesetze
bei sich berührenden Buchstaben, nach den Graden der inneren
Worteinheit, von einander abweichen. Man muss sich aber wohl
hüten, etwas eigentlich Absichtliches hierin zu finden, so wie überhaupt
das Wort Absicht, von Sprachen gebraucht, mit Vorsicht verstanden
werden muss. Insofern man sich darunter gleichsam Verabredung
oder auch nur vom Willen ausgehendes Streben nach einem deutlich
vorgestellten Ziele denkt, ist, woran man nicht zu oft erinnern kann,
Absicht den Sprachen fremd. Sie äussert sich immer nur in einem ursprünglich
instinctartigen Gefühl. Ein solches Gefühl der Begriffseinheit
nun ist hier, meiner Ueberzeugung nach, allerdings in den Laut
übergegangen, und eben weil es ein Gefühl ist, nicht überall in gleichem
Masse und gleicher Consequenz. Mehrere der einzelnen Abweichungen
der Anfügungsgesetze von einander entspringen zwar phonetisch aus
der Natur der Buchstaben selbst. Da nun alle grammatisch geformten
Wörter immer in derselben Verbindung der Anfangs- und Endbuchstaben
dieser Elemente vorkommen, bei getrennten und selbst bei zusammengesetzten
Wörtern aber dieselbe Berührung nur wechselnd und einzeln
wiederkehrt, so bildet sich bei den ersteren natürlich leicht eine
eigne, alle Elemente inniger verschmelzende Aussprache und man kann
daher das Gefühl der Worteinheit in diesen Fällen als hieraus, mithin
auf dem umgekehrten Wege, als ich es oben gethan, entstanden ansehen.
Indess bleibt doch der Einfluss jenes inneren Einheitsgefühls der
primitive, da es aus ihm herausfliesst, dass überhaupt die grammatischen
Anfügungen dem Stammwort einverleibt werden und nicht, wie
in einigen Sprachen, abgesondert stehen bleiben. Für die phonetische
Wirkung ist es von wichtigem Einfluss, dass sowohl die Casusendungen
als die Suffixa nur mit gewissen Consonanten anfangen und daher nur
eine bestimmte Anzahl von Verbindungen eingehen können, die bei den
Casusendungen am beschränktesten, bei den Krit-Suffixen und Verbalendungen
grösser ist, bei den Taddhita-Suffixen aber sich noch mehr
erweitert.
Ausser der Verschiedenheit der Anfügungsgesetze der sich in der
381Wortmitte berührenden Consonanten giebt es in den Sprachen noch
eine andere, seine innere Einheit noch bestimmter bezeichnende Lautbehandlung
des Wortes, nemlich diejenige, welche seiner Gesammtbildung
Einfluss auf die Veränderung der einzelnen Buchstaben, namentlich
der Vocale verstattet. Dies geschieht, wenn die Anschliessung mehr
oder weniger gewichtiger Sylben auf die, schon im Wort vorhandenen
Vocale Einfluss ausübt, wenn ein beginnender Zuwachs des Wortes
Verkürzungen oder Ausstossungen am Ende desselben hervorbringt,
wenn anwachsende Sylben ihren Vocal denen des Wortes oder diese
sich ihnen assimiliren, oder wenn Einer Sylbe durch Lautverstärkung
oder durch Lautveränderung ein die übrigen des Wortes vor dem Ohre
beherrschendes Uebergewicht gegeben wird. Jeder dieser Fälle kann,
wo er nicht rein phonetisch ist, als unmittelbar symbolisch für die innere
Worteinheit betrachtet werden. Im Sanskrit erscheint diese Lautbehandlung
in mehrfacher Gestalt und immer mit merkwürdiger Rücksicht
auf die Klarheit der logischen und die Schönheit der ästhetischen
Form. Das Sanskrit assimilirt daher nicht die Stammsylbe, deren Festigkeit
erhalten werden muss, den Endungen; es erlaubt sich aber wohl
Erweiterungen des Stammvocals, aus deren regelmässiger Wiederkehr
in der Sprache das Ohr den ursprünglichen leicht wiedererkennt. Es ist
dies eine von feinem Sprachsinn zeugende Bemerkung Bopp's, die er
sehr richtig so ausdrückt, dass die hier in Rede stehende Veränderung
des Stammvocals im Sanskrit nicht qualitativ, sondern quantitativ ist. 23
Die qualitative Assimilation entsteht aus Nachlässigkeit der Aussprache
oder aus Gefallen an gleichförmig klingenden Sylben; in der quantitativen
Umstellung des Zeitmasses spricht sich ein höheres und feineres
Wohllautsgefühl aus. In jener wird der bedeutsame Stamm vocal geradezu
dem Laute geopfert, in dieser bleibt er in der Erweiterung dem Ohre
und dem Verstande gleich gegenwärtig.
Einer Sylbe eines Worts in der Aussprache ein das ganze Wort beherrschendes
Uebergewicht zu geben, besitzt das Sanskrit im Guṇa und
Wṛiddhi zwei so kunstvoll ausgebildete und mit der übrigen Lautverwandtschaft
so eng verknüpfte Mittel, dass sie in dieser Ausbildung und
in diesem Zusammenhange ihm ausschliesslich eigenthümlich geblieben
sind. Keine der Schwestersprachen hat diese Lautveränderungen,
ihrem Systeme und ihrem Geiste nach, in sich aufgenommen; nur einzelne
Bruchstücke sind als fertige Resultate in einige übergegangen.
Guna und Wriddhi bilden bei a eine Verlängerung, aus i und u die Diphthongen
ê und ô, ändern das Vocal-r in ar und âr um, 24 und verstärken
ê und ô durch neue Diphthongisirung zu âi und âu. Wenn auf das
durch Guna und Wriddhi entstandene ê und âi, ô und âu ein Vocal
folgt, so lösen sich diese Diphthongen in ay und ây, aw und âw auf.
Hierdurch entsteht eine doppelte Reihe fünffacher Lautveränderungen,
382welche durch bestimmte Gesetze der Sprache und durch ihre beständige
Rückkehr im Gebrauche derselben dennoch immer zu dem gleichen
Urlaute zurückführen. Die Sprache erhält dadurch eine Mannigfaltigkeit
wohltönender Lautverknüpfungen, ohne dem Verständniss im mindesten
Eintrag zu thun. Im Guna und Wriddhi tritt jedesmal ein Laut an
die Stelle eines andren. Doch darf man darum Guna und Wriddhi nicht
als einen blossen, sonst in vielen Sprachen gewöhnlichen Vocalwechsel
ansehen. Der wichtige Unterschied zwischen beiden liegt darin, dass
bei dem Vocalwechsel der Grund des an die Stelle eines andren gesetzten
Vocals immer, wenigstens zum Theil, dem ursprünglichen der veränderten
Sylbe fremd ist, bald in grammatisch unterscheidendem Streben,
bald im Assimilationsgesetz oder in irgend einer andren Ursach
gesucht werden muss, und dass daher der neue Laut nach Verschiedenheit
der Umstände wechseln kann, da er bei Guna und Wriddhi immer
gleichförmig aus dem Urlaut der veränderten Sylbe selbst, ihr allein angehörend,
entspringt. Wenn man daher den Guna-Laut wêdmi und den,
nach der Boppschen Erklärung, durch Assimilation entstehenden tênima
mit einander vergleicht, so ist das hineingekommene ê in der ersteren
Form aus dem i der veränderten, in der letzteren aus dem der nachfolgenden
Sylbe entstanden.
Guna und Wriddhi sind Verstärkungen des Grundlauts und zwar
nicht bloss gegen diesen, sondern auch gegen einander selbst, gleichsam
wie Comparativus und Superlativus, in gleichem quantitativen Masse
steigende Verstärkungen des einfachen Vocals. In der Breite der Aussprache
und dem Laute vor dem Ohre ist diese Steigerung unverkennbar;
sie zeigt sich aber in einem schlagenden Beispiel auch in der Bedeutung
bei dem durch Anhängung von ya gebildeten Participium des
Passiv-Futurum. Denn der einfache Begriff fordert dort nur Guna, der
verstärkte, mit Notwendigkeit verknüpfte aber Wriddhi: stawya, ein
Preiswürdiger, stâwya, ein nothwendig und auf alle Weise zu Preisender.
Der Begriff der Verstärkung erschöpft aber nicht die besondre Natur
dieser Lautveränderungen. Zwar muss man hier das Wriddhi von a
ausnehmen, das aber auch nur gewissermassen in seiner grammatischen
Anwendung, durchaus nicht seinem Laut nach in diese Classe gehört.
Bei allen übrigen Vocalen und Diphthongen liegt das Charakteristische
dieser Verstärkungen darin, dass durch sie eine, vermittelst der Verbindung
ungleichartiger Vocale oder Diphthongen hervorgebrachte Umbeugung
des Lautes entsteht. Denn allem Guna und Wriddhi liegt eine
Verbindung von a mit den übrigen Vocalen oder Diphthongen zum
Grunde, man mag nun annehmen, dass im Guna ein kurzes, im Wriddhi
ein langes a vor den einfachen Vocal oder dass immer ein kurzes a, im
Guna vor den einfachen Vocal, im Wriddhi vor den schon durch Guna
verstärkten tritt. 25 Die blosse Entstehung verlängerter Vocale durch
383Verbindung gleichartiger wird, soviel mir bekannt ist, das einzige a ausgenommen,
auch von den Indischen Grammatikern nicht zum Wriddhi
gerechnet. Da nun in Guna und Wriddhi immer ein sehr verschieden
auf das Ohr einwirkender Laut entsteht und seinen Grund ausschliesslich
in dem Urlaut der Sylbe selbst findet, so gehen die Guna- und
Wriddhi-Laute auf eine, mit Worten nicht zu beschreibende, aber dem
Ohre deutlich vernehmbare Weise aus der inneren Tiefe der Sylbe selbst
hervor. Wenn daher Guna, das im Verbum so häufig die Stammsylbe
verändert, eine bestimmte Charakteristik gewisser grammatischer Formen
wäre, so würde man diese, auch der sinnlichen Erscheinung nach,
buchstäblich Entfaltungen aus dem Innren der Wurzel und in praegnanterem
Sinne, als in den Semitischen Sprachen, wo bloss symbolischer
Vocalwechsel vorgeht, nennen können. 26 Es ist dies aber durchaus nicht
der Fall, da das Guna nur eine der Nebengestaltungen ist, welche das
Sanskrit den Verbalformen, ausser ihren wahren Charakteristiken, nach
bestimmten Gesetzen beigiebt. Es ist, seiner Natur nach, eine rein phonetische
und, soweit wir seine Gründe einzusehen vermögen, auch allein
aus den Lauten erklärbare Erscheinung und nicht einzeln bedeutsam
oder symbolisch. Der einzige Fall in der Sprache, den man hiervon
ausnehmen muss, ist die Gunirung des Verdoppelungsvocals in den Intensivverben.
Diese zeigt um so mehr den verstärkenden Ausdruck an,
welchen die Sprache, auf eine sonst ungewöhnliche Weise, in diese Formen
zu legen beabsichtigt, als die Verdoppelung sonst den langen Vocal
zu verkürzen pflegt und als das Guna hier auch, wie sonst nicht, bei
langen Mittelvocalen der Wurzel statt findet.
Dagegen kann man es wohl in vielen Fällen als Symbol der inneren
Worteinheit ansehen, indem diese, sich stufenweis in der Vocalsphäre
bewegenden Lautveränderungen eine weniger materielle, entschiednere
und enger verbundene Wortverschmelzung hervorbringen, als die Veränderungen
sich berührender Consonanten. Sie gleichen hierin gewissermassen
dem Accent, indem die gleiche Wirkung, das Uebergewicht
einer vorherrschenden Sylbe, im Accent durch die Tonhöhe, im Guna
und Wriddhi durch die erweiterte Lautumbeugung hervorgebracht
wird. Wenn sie daher auch nur in bestimmten Fällen die innere Worteinheit
begleiten, so sind sie doch immer einer der verschiedenen Ausdrücke,
deren sich die, bei weitem nicht immer dieselben Wege verfolgende
Sprache zur Andeutung derselben bedient. Es mag auch hierin
liegen, dass sie den sylbenreichen, langen Formen der zehnten Verbalclasse
und der mit dieser verwandten Causalverben ganz besonders eigenthümlich
sind. Wenn sie sich freilich auf der andren Seite auch bei
ganz kurzen finden, so ist darum doch nicht zu läugnen, dass sie bei den
langen das abgebrochene Auseinanderfallen der Sylben verhindern und
die Stimme nöthigen, sie fest zusammenzuhalten. Sehr bedeutsam
384scheint es auch in dieser Beziehung, dass das Guna in den Wortgattungen
der festesten Einheit, den.Kridanta-Wörtern und Verbalendungen
herrschend ist und in ihnen gewöhnlich die Wurzelsylbe trifft, dagegen
nie auf der Stammsylbe der Declinationsbeugungen oder der durch
Taddhita-Suffixa gebildeten Wörter vorkommt.
Das Wriddhi findet eine doppelte Anwendung. Auf der einen Seite
ist es, wie das Guna, rein phonetisch und steigert dasselbe entweder
nothwendig oder nach der Willkühr des Sprechenden; auf der andren
Seite ist es bedeutsam und rein symbolisch. In der ersteren Gestalt trifft
es vorzugsweise die Endvocale, so wie auch die langen unter diesen,
was sonst nicht geschieht, Guna annehmen. Es entsteht dies daraus,
dass die Erweiterung eines Endvocals keine Beschränkung vor sich findet.
Es ist dasselbe Princip, das im Javanischen im gleichen Falle das
dem Consonanten einverleibte a als dunkles o auslauten lässt. Die Bedeutsamkeit
des Wriddhi zeigt sich besonders bei den TaddhitaSuffixen
und scheint ihren ursprünglichen Sitz in den Geschlechtsbenennungen,
den Collectiv- und abstracten Substantiven zu haben. In allen diesen
Fällen erweitert sich der ursprünglich einfache concrete Begriff. Dieselbe
Erweiterung wird aber auch metaphorisch auf andre Fälle, wenn
auch nicht in gleicher Beständigkeit übergetragen. Daher mag es kommen,
dass die durch Taddhita-Suffixe gebildeten Adjectiva bald Wriddhi
annehmen, bald den Vocal unverändert lassen. Denn das Adjectivum
kann als concrete Beschaffenheit, aber auch als die ganze Menge
von Dingen, an welchen es erscheint, unter sich befassend angesehen
werden.
Die Annahme oder der Mangel des Guna bildet im Verbum in grammatisch
genau bestimmten Fällen einen Gegensatz zwischen gunirten
und gunalosen Formen der Abwandlung. Bisweilen, aber viel seltener
wird ein gleicher Gegensatz durch den bald nothwendigen, bald willkührlichen
Gebrauch des Wriddhi gegen Guna hervorgebracht. Bopp
hat zuerst diesen Gegensatz auf eine Weise, die, wenn sie auch einige
Fälle gewissermassen als Ausnahme übersehen muss, doch gewiss im
Ganzen vollkommen befriedigend erscheint, aus der Wirkung der Lautschwere
oder Lautleichtigkeit der Endungen auf den Wurzel vocal erklärt.
Die erstere verhindert nemlich seine Erweiterung, welche die letztere
hervorzulocken scheint, und das Eine und das Andere findet
überall da statt, wo sich die Endung unmittelbar an die Wurzel anschliesst
oder auf ihrem Wege dahin einen des Guna fähigen Vocal antrifft.
Wo aber der Einfluss der Beugungssylbe durch einen andren, dazwischentretenden
Vocal oder einen Consonanten gehemmt wird,
mithin die Abhängigkeit des Wurzelvocals von ihr aufhört, lässt sich
der Gebrauch und Nichtgebrauch des Guna, obgleich er auch da in bestimmten
Fällen regelmässig eintritt, auf keine Weise aus den Lauten
385erklären und dieser Unterschied der Wurzelsylbe sich also überhaupt in
der Sprache auf kein ganz allgemeines Gesetz zurückführen. Die wahrhafte
Erklärung der Anwendung und Nichtanwendung des Guna überhaupt
scheint mir nur aus der Geschichte der Abwandlungsformen des
Verbum geschöpft werden zu können. Dies ist aber ein noch sehr dunkles
Gebiet, in dem wir nur fragmentarisch Einzelnes zu errathen vermögen.
Vielleicht gab es ehemals, nach Verschiedenheit der Dialekte, oder
Zeiten, zweierlei Gattungen der Abwandlung mit und ohne Guna, aus
deren Mischung die jetzige Gestaltung in der uns vorliegenden Niedersetzung
der Sprache entsprang. In der That scheinen auf eine solche
Vermuthung einige Classen der Wurzeln zu führen, die sich zugleich
und grösstentheils in der nemlichen Bedeutung mit und ohne Guna abwandeln
lassen oder ein durchgängiges Guna annehmen, wo die übrige
Analogie der Sprache den oben erwähnten Gegensatz erfordern würde.
Dies letztere geschieht nur in einzelnen Ausnahmen; das erstere aber
findet bei allen Verben statt, die zugleich nach der ersten und sechsten
Classe conjugirt werden, so wie in denjenigen der ersten Classe, welche
ihr vielförmiges Praeteritum nach der sechsten Gestaltung, bis auf das
fehlende Guna ganz gleichförmig mit ihrem Augment-Praeteritum bilden.
Diese ganze, dem Griechischen zweiten Aorist entsprechende,
sechste Gestaltung dürfte wohl nichts andres, als ein wahres Augment-Praeteritum
einer gunalosen Abwandlung seyn, neben welcher eine mit
Guna (unser jetziges Augment-Praeteritum der Wurzeln der ersten
Classe) bestanden hat. Denn es ist mir sehr wahrscheinlich, dass es im
wahren Sinne des Wortes im Sanskrit nur zwei, nicht, wie wir jetzt zählen,
drei Praeterita giebt, so dass die Bildungen des angeblich dritten,
nemlich des vielförmigen nur Nebenformen, aus anderen Epochen der
Sprache herstammend, sind.
Wenn man auf diese Weise eine ursprünglich zwiefache Conjugation
mit und ohne Guna in der Sprache annimmt, so entsteht gewissermassen
die Frage, ob da, wo die Gewichtigkeit der Endungen einen Gegensatz
hervorbringt, das Guna verdrängt oder angenommen worden ist?
und man muss sich unbedenklich für das erstere erklären. Lautveränderungen,
wie Guna und Wriddhi, lassen sich nicht einer Sprache einimpfen,
sie gehen, nach Grimm's vom deutschen Ablaut gebrauchtem
glücklichem Ausdruck, bis auf den Grund und Boden derselben und
können in ihrem Ursprünge sich aus den dunklen und breiten Diphthongen,
die wir auch in andren Sprachen antreffen, erklären lassen.
Das Wohllautsgefühl kann diese gemildert und zu einem quantitativ
bestimmten Verhältniss geregelt haben. Dieselbe Neigung der Sprachwerkzeuge
zur Vocalerweiterung kann aber auch in einem glücklich organisirten
Volksstamm unmittelbar in rhythmischer Haltung hervorgebrochen
seyn. Denn es ist nicht nothwendig und kaum einmal rathsam,
386sich jede Trefflichkeit einer gebildeten Sprache als stufenartig und allmählich
entstanden zu denken.
Der Unterschied zwischen rohem Naturlaut und geregeltem Ton
zeigt sich noch bei weitem deutlicher an einer andren, zur inneren
Wortausbildung wesentlich beitragenden Lautform, der Reduplication.
Die Wiederholung der Anfangssylbe eines Wortes oder auch des ganzen
Wortes selbst ist, bald in verstärkender Bedeutsamkeit zu mannigfachem
Ausdruck, bald als blosse Lautgewohnheit, den Sprachen vieler
ungebildeten Völker eigen. In anderen, wie in einigen des Malayischen
Stammes, verräth sie schon dadurch einen Einfluss des Lautgefühls,
dass nicht immer der Wurzel vocal, sondern gelegentlich ein verwandter
wiederholt wird. Im Sanskrit aber wird die Reduplication so genau dem
jedesmaligen inneren Wortbau angemessen modificirt, dass man fünf
oder sechs verschiedene, durch die Sprache vertheilte Gestaltungen
derselben zählen kann. Alle aber fliessen aus dem doppelten Gesetz der
Anpassung dieser Vorschlagssylbe an die besondere Form des Wortes
und aus dem der Beförderung der inneren Worteinheit. Einige sind zugleich
für bestimmte grammatische Formen bezeichnend. Die Anpassung
ist bisweilen so künstlich, dass die eigentlich dem Worte voranzugehen
bestimmte Sylbe dasselbe spaltet und sich zwischen seinen
Anfangsvocal und Endconsonanten stellt, was vielleicht darin seinen
Grund hat, dass dieselben Formen auch den Vorschlag des Augments
verlangen und diese beiden Vorschlagssylben sich, als solche, an vocalisch
anlautenden Wurzeln nicht hätten auf unterscheidbare Weise andeuten
lassen. Die Griechische Sprache, in welcher Augment und Reduplication
wirklich in diesen Fällen im augmentum temporale
zusammenfliessen, hat zur Erreichung desselben Zweckes ähnliche Formen
entwickelt. 27 Es ist dies ein merkwürdiges Beispiel, wie, bei regem
und lebendigem Articulationssinn, die Lautformung sich eigne und
wunderbar scheinende Bahnen bricht, um den innerlich organisirenden
Sprachsinn in allen seinen verschiedenen Richtungen, jede kenntlich erhaltend,
zu begleiten.
Die Absicht, das Wort fest mit dem Vorschlage zu verbinden, äussert
sich im Sanskrit bei den consonantischen Wurzeln durch die Kürze des
Wiederholungsvocals, auch gegen einen langen Wurzellaut, so dass der
Vorschlag vom Worte übertönt werden soll. Die einzigen zwei Ausnahmen
von dieser Verkürzung in der Sprache haben wieder ihren eigenthümlichen,
den allgemeinen überwiegenden Grund, bei den Intensivverben
die Andeutung ihrer Verstärkung, bei dem vielförmigen
Praeteritum der Causalverba das euphonisch geforderte Gleichgewicht
zwischen dem Wiederholungs- und Wurzelvocal. Bei vocalisch anlautenden
Wurzeln fällt da, wo sich die Reduplication durch Verlängerung
des Anfangsvocals ankündigt, das Uebergewicht des Lautes auf die Anfangssylbe
387und befördert dadurch, wie wir es beim Guna gesehen, die
enge Verbindung der übrigen dicht an sie angeschlossenen Sylben. Die
Reduplication ist in den meisten Fällen ein wirkliches Kennzeichen bestimmter
grammatischer Formen oder doch eine, sie charakteristisch
begleitende Lautmodification. Nur in einem kleinen Theil der Verben
(in denen der dritten Classe) ist sie diesen an sich eigen. Aber auch hier,
wie beim Guna, wird man auf die Vermuthung geführt, dass sich in einer
früheren Zeit der Sprache Verba mit und ohne Reduplication abwandeln
liessen, ohne dadurch weder in sich noch in ihrer Bedeutung
eine Veränderung zu erfahren. Denn das Augment-Praeteritum und das
vielförmige einiger Verba der dritten Classe unterscheiden sich bloss
durch die Anwendung oder den Mangel der Reduplication. Dies erscheint
bei dieser Lautform noch natürlicher, als bei dem Guna. Denn
die Verstärkung der Aussage durch den Laut vermittelst der Wiederholunz
kann ursprünglich nur die Wirkung der Lebendigkeit des individuellen
Gefühls seyn und daher, auch wenn sie allgemeiner und geregelter
wird, leicht zu wechselndem Gebrauche Anlass geben.
Das, in seiner Andeutung der vergangenen Zeit der Reduplication
verwandte Augment wird gleichfalls auf eine, die Worteinheit befördernde
Weise bei Wurzeln mit anlautenden Vocalen behandelt und
zeigt darin einen merkwürdigen Gegensatz gegen den, Verneinung andeutenden
gleichlautenden Vorschlag. Denn da das Alpha privativum
sich bloss mit Einschiebung eines n vor diese Wurzeln stellt, verschmilzt
das Augment mit ihrem Anfangsvocal und zeigt also schon dadurch
die ihm, als Verbalform, bestimmte grössere Innigkeit der Verbindung
an. Es überspringt aber in dieser Verschmelzung das durch
dieselbe entstehende Guna und erweitert sich zu Wriddhi, wohl offenbar
darum, weil das Gefühl für die innere Worteinheit diesem das Wort
zusammenhaltenden Anfangsvocal ein so grosses Uebergewicht, als
möglich, geben will. Zwar trifft man in einer andren Verbalform, im reduplicirten
Praeteritum in einigen Wurzeln auch die Einschiebung des n
an; der Fall steht aber ganz einzeln in der Sprache da und die Anfügung
ist mit einer Verlängerung des Vorschlagsvocals verbunden.
Ausser den hier kurz berührten besitzen tonreiche Sprachen noch
eine Reihe andrer Mittel, die alle das Gefühl des Bedürfnisses ausdrücken,
dem Worte einen, innere Fülle und Wohllaut vereinenden organischen
Bau zu geben. Man kann im Sanskrit hierher die Vocalverlängerung,
den Vocalwechsel, die Verwandlung des Vocals in einen
Halbvocal, die Erweiterung desselben zur Sylbe durch nachfolgenden
Halbvocal und gewissermassen die Einschiebung eines Nasenlautes
rechnen, ohne der Veränderungen zu gedenken, welche die allgemeinen
Gesetze der Sprache in den, sich in der Wortmitte berührenden Buchstaben
hervorbringen. In allen diesen Fällen entspringt die letzte Bildung
388des Lautes zugleich aus der Beschaffenheit der Wurzel und der
Natur der grammatischen Anfügungen. Zugleich äussern sich aber die
Selbstständigkeit und Festigkeit, die Verwandtschaft und der Gegensatz
und das Lautgewicht der einzelnen Buchstaben bald in ursprünglicher
Harmonie, bald in einem, immer von dem organisirenden Sprachsinn
schön geschlichteten Widerstreite. Noch deutlicher verräth sich die auf
die Bildung des Ganzen des Wortes gerichtete Sorgfalt in dem Compensationsgesetze,
nach welchem in einem Theile des Worts vorgefallene
Verstärkung oder Schwächung, zur Herstellung des Gleichgewichts,
eine entgegengesetzte Veränderung in einem anderen Theile desselben
nach sich zieht. Hier, in dieser letzten Ausbildung, wird von der qualitativen
Beschaffenheit der.Buchstaben abgesehen. Der Sprachsinn hebt
nur die körperlosere quantitative heraus und behandelt das Wort,
gleichsam metrisch, als eine rhythmische Reihe. Das Sanskrit enthält
hierin so merkwürdige Formen, als sich nicht leicht in anderen Sprachen
antreffen lassen. Das vielförmige Praeteritum der Causalverba
(die siebente Bildung bei Bopp), zugleich versehen mit Augment und
Reduplication, liefert hierzu ein in jeder Rücksicht merkwürdiges Beispiel.
Da in den Formen dieser Gestaltung dieses Tempus auf das, immer
kurze Augment bei consonantisch anlautenden Wurzeln unmittelbar
die Wiederholungs- und Wurzelsylbe auf einander folgen, so
bemüht sich die Sprache, den Vocalen dieser beiden ein bestimmtes metrisches
Verhältniss zu geben. Mit wenigen Ausnahmen, wo diese beiden
Sylben pyrrhichisch (ajagadam,‿‿‿‿, von gad, reden) oder
spondaeisch (adadhrâḍam, ‿__‿, von dhrâḍ, abfallen, welken) klingen,
steigen sie entweder jambisch (adudûsham, ‿‿_‿, von dush,
sündigen, sich beflecken) auf oder senken sich, was die Mehrheit der
Fälle ausmacht, trochaeisch (achîkalam, ‿_‿‿, von kal, schleudern,
schwingen) und lassen bei denselben Wurzeln selten der Aussprache
die Wahl zwischen diesem doppelten Vocalmass. Untersucht man nun
das, auf den ersten Anblick sehr verwickelte quantitative Verhältniss
dieser Formen, so findet man, dass die Sprache dabei ein höchst einfaches
Verfahren befolgt. Sie wendet nemlich, indem sie eine Veränderung
mit der Wurzelsylbe vornimmt, lediglich das Gesetz der Lautcompensation
an. Denn sie stellt, nach einer vorgenommenen Verkürzung
der Wurzelsylbe, bloss das Gleichgewicht durch Verlängerung der Wiederholungssylbe
wieder her, woraus die trochaeische Senkung entsteht,
an welcher die Sprache, wie es scheint, hier ein besonderes Wohlgefallen
fand. Die Veränderung der Quantität der Wurzelsylbe scheint das
höhere, auf die Erhaltung der Stammsylben gerichtete Gesetz zu verletzen.
Genauere Nachforschung aber zeigt, dass dies keinesweges der Fall
ist. Denn diese Praeterita werden nicht aus der primitiven, sondern aus
der schon grammatisch veränderten Causalwurzel gebildet. Die verkürzte
389Länge ist daher in der Regel nur der Causalwurzel eigen. Wo die
Sprache in diesen Bildungen auf eine primitiv stammhafte Länge oder
gar auf einen solchen Diphthongen stösst, giebt sie ihr Vorhaben auf,
lässt die Wurzelsylbe unverändert und verlängert nun auch nicht die,
der allgemeinen Regel nach, kurze Wiederholungssylbe. Aus dieser, sich
dem in diesen Formen eigentlich beabsichtigten Verfahren entgegenstellenden
Schwierigkeit entspringt der jambische Aufschwung, der das
natürliche, unveränderte Quantitäts-Verhältniss ist. Zugleich beachtet
die Sprache die Fälle, wo die Länge der Sylbe nicht aus der Natur des
Vocals, sondern aus dessen Stellung vor zwei auf einander folgenden
Consonanten herfliesst. Sie häuft nicht zwei Verlängerungsmittel und
lässt also auch in der trochaeischen Senkung den Wiederholungsvocal
vor zwei Anfangsconsonanten der Wurzel unverlängert. Bemerkenswerth
ist es, dass auch die eigentlich Malayische Sprache eine solche
Sorgfalt, die Einheit des Worts bei grammatischen Anfügungen zu erhalten
und dasselbe als ein euphonisches Lautganzes zu behandeln,
durch Quantitäts-Versetzung der Wurzelsylben zeigt. Die angeführten
Sanskritischen Formen sind, ihrer Sylbenfülle und ihres Wohllauts wegen,
die deutlichsten Beispiele, was eine Sprache aus einsylbigen Wurzeln
zu entfalten vermag, wenn sie mit einem reichen Alphabete ein festes
und durch Feinheit des Ohres den zartesten Anklängen der
Buchstaben folgendes Lautsystem verbindet und Anbildung und innere
Veränderung, wieder nach bestimmten Regeln aus mannigfaltigen und
fein unterschiedenen grammatischen Gründen, hinzutreten. 28
Bezeichnungsmittel der Worteinheit. Accent
28. Eine andere, der Natur der Sache nach allen Sprachen gemeinschaftliche,
in den todten aber uns nur da noch kenntliche Worteinheit,
wo die Flüchtigkeit der Aussprache durch uns verständliche Zeichen
festgehalten wird, liegt im Accent. Man kann nemlich an der Sylbe dreierlei
phonetische Eigenschaften unterscheiden: die eigenthümliche Geltung
ihrer Laute, ihr Zeitmass und ihre Betonung. Die beiden ersten
werden durch ihre eigne Natur bestimmt und machen gleichsam ihre
körperliche Gestalt aus; der Ton aber (unter welchem ich hier immer
den Sprachton, nicht die metrische Arsis verstehe) hängt von der Freiheit
des Redenden ab, ist eine ihr von ihm mitgetheilte Kraft und gleicht
einem ihr eingehauchten fremden Geist. Er schwebt, wie ein noch seelenvolleres
Princip, als die materielle Sprache selbst ist, über der Rede
und ist der unmittelbare Ausdruck der Geltung welche der Sprechende
ihr und jedem ihrer Theile aufprägen will. An sich ist jede Sylbe der
Betonung fähig. Wenn aber unter mehreren nur Eine den Ton wirklich
390erhält, wird dadurch die Betonung der sie unmittelbar begleitenden,
wenn der Sprechende nicht auch unter diesen eine ausdrücklich vorlauten
lässt, aufgehoben und diese Aufhebung bringt eine Verbindung der
tonlos werdenden mit der betonten und dadurch vorwaltenden und sie
beherrschenden hervor. Beide Erscheinungen, die Tonaufhebung und
die Sylbenverbindung bedingen einander und jede zieht unmittelbar
und von selbst die andre nach sich. So entsteht der Wortaccent und die
durch ihn bewirkte Worteinheit. Kein selbstständiges Wort lässt sich
ohne einen Accent denken und jedes Wort kann nicht mehr als Einen
Hauptaccent haben. Es zerfiele mit zweien in zwei Ganze und würde
mithin zu zwei Wörtern. Dagegen kann es allerdings in einem Worte
Nebenaccente geben, die entweder aus der rhythmischen Beschaffenheit
des Wortes oder aus Nüancirungen der Bedeutung entspringen. 29
Die Betonung unterliegt mehr, als irgend ein anderer Theil der Sprache
dem doppelten Einfluss der Bedeutsamkeit der Rede und der metrischen
Beschaffenheit der Laute. Ursprünglich und in ihrer wahren Gestalt
geht sie unstreitig aus der ersteren hervor. Je mehr aber der Sinn
einer Nation auch auf rhythmische und musikalische Schönheit gerichtet
ist, desto mehr Einfluss wird auch diesem Erforderniss auf die Betonung
verstattet. Es liegt aber in dem Betonungstriebe, wenn der Ausdruck
erlaubt ist, weit mehr, als die auf das blosse Verständniss gehende
Bedeutsamkeit. Es drückt sich darin ganz vorzugsweise auch der Drang
aus, die intellectuelle Stärke des Gedanken und seiner Theile weit über
das Mass des blossen Bedürfnisses hinaus zu bezeichnen. Dies ist in keiner
andren Sprache so sichtbar, als in der Englischen, wo der Accent
sehr häufig das Zeitmass und sogar die eigenthümliche Geltung der Sylben
verändernd mit sich fortreisst. Nur mit dem höchsten Unrecht würde
man dies einem Mangel an Wohllautsgefühl zuschreiben. Es ist im
Gegentheil nur die, mit dem Charakter der Nation zusammenhängende
intellectuelle Energie, bald die rasche Gedanken-Entschlossenheit, bald
die ernste Feierlichkeit, welche das, durch den Sinn hervorgehobene
Element auch in der Aussprache über alle andren überwiegend zu bezeichnen
strebt. Aus der Verbindung dieser Eigenthümlichkeit mit den,
oft in grosser Reinheit und Schärfe aufgefassten Wohllautsgesetzen entspringt
der in Absicht auf Betonung und Aussprache wahrhaft wundervolle
Englische Wortbau. Wäre das Bedürfniss starker und scharf nüancirter
Betonung nicht so tief in dem Englischen Charakter gegründet, so
würde auch das Bedürfniss der öffentlichen Beredsamkeit nicht zur Erklärung
der grossen Aufmerksamkeit hinreichen, welche auf diesen
Theil der Sprache in England so sichtbar gewandt wird. Wenn alle andren
Theile der Sprache mehr mit den intellectuellen Eigenthümlichkeiten
der Nationen in Verbindung stehen, so hängt die Betonung zugleich
näher und auf innigere Weise mit dem Charakter zusammen.391
Die Verknüpfung der Rede bietet auch Fälle dar, wo gewichtlosere
Wörter sich an gewichtigere durch die Betonung anschliessen, ohne
doch mit ihnen in eines zu verschmelzen. Dies ist der Zustand der Anlehnung,
der Griechischen έγϰλισις. Das gewichtlosere Wort giebt alsdann
seine Unabhängigkeit, nicht aber seine Selbstständigkeit, als getrenntes
Element der Rede, auf. Es verliert seinen Accent und fällt in
das Gebiet des Accents des gewichtigeren Wortes. Erhält aber dies Gebiet
durch diesen Zuwachs eine, den Gesetzen der Sprache zuwiderlaufende
Ausdehnung, so verwandelt das gewichtigere Wort, indem es
zwei Accente annimmt, seine tonlose Endsylbe in eine scharfbetonte
und schliesst dadurch das gewichtlosere an sich an. 30 Durch diese Anschliessung
soll aber die natürliche Wortabtheilung nicht gestört werden;
dies beweist deutlich das Verfahren der enklitischen Betonung in
einigen besonderen Fällen. Wenn zwei enklitische Wörter auf einander
folgen, so fällt das letztere, seiner Betonung nach, nicht, wie das erstere,
in das Gebiet des gewichtigeren Worts, sondern das erstere nimmt für
das letztere die scharfe Betonung auf sich auf. Das enklitische Wort
wird also nicht übersprungen, sondern als ein selbstständiges Wort geehrt
und schliesst ein andres an sich an. Die besondre Eigenthümlichkeit
eines solchen enklitischen Wortes macht sogar, was das eben Gesagte
noch mehr bestätigt, ihren Einfluss auf die Art der Betonung
geltend. Denn da ein Circumflex sich nicht in einen Acutus verwandeln
kann, so wird, wenn von zwei auf einander folgenden enklitischen Wörtern
das erste circumflectirt ist, das ganze Anlehnungsverfahren unterbrochen
und das zweite enklitische Wort behält alsdann seine ursprüngliche
Betonung. 31 Ich habe diese Einzelnheiten nur angeführt, um zu
zeigen, wie sorgfältig Nationen, welche die Richtung ihres Geistes auf
sehr hohe und feine Ausbildung ihrer Sprache geführt hat, auch die verschiedenen
Grade der Worteinheit bis zu den Fällen herab andeuten,
wo weder die Trennung noch die Verschmelzung vollständig und entschieden
ist.
Einverleibungssystem der Sprachen. Gliederung des Satzes
29a. Das grammatisch gebildete Wort, wie wir es bis hierher in der Zusammenfügung
seiner Elemente und in seiner Einheit, als ein Ganzes
betrachtet haben, ist bestimmt, wieder als Element in den Satz einzutreten.
Die Sprache muss also hier eine zweite, höhere Einheit bilden, höher,
nicht bloss weil sie von grösserem Umfange ist, sondern auch weil
sie, indem der Laut nur nebenher auf sie einwirken kann, ausschliesslicher
von der ordnenden inneren Form des Sprachsinnes abhängt. Sprachen,
die, wie das Sanskrit, schon in die Einheit des Wortes seine Beziehungen
392zum Satze verflechten, lassen den letzteren in die Theile zerfallen,
in welchen er sich, seiner Natur nach, vor dem Verstande darstellt;
sie bauen aus diesen Theilen seine Einheit gleichsam auf. Sprachen, die,
wie die Chinesische, jedes Stammwort veränderungslos starr in sich
einschliessen, thun zwar dasselbe und fast in noch strengerem Verstande,
da die Wörter ganz vereinzelt dastehen; sie kommen aber bei dem
Aufbau der Einheit des Satzes dem Verstande nur durch lautlose Mittel,
wie z. B. die Stellung ist, oder durch eigne, wieder abgesonderte Wörter
zu Hülfe. Es giebt aber, wenn man jene beiden zusammennimmt, ein
zweites, beiden entgegengesetztes Mittel, das wir hier jedoch besser als
ein drittes betrachten, die Einheit des Satzes für das Verständniss festzuhalten,
nemlich ihn mit allen seinen nothwendigen Theilen nicht wie
ein aus Worten zusammengesetztes Ganzes, sondern wirklich als ein
einzelnes Wort zu behandeln.
Wenn man, wie es ursprünglich richtiger ist, da jede, noch so unvollständige
Aussage in der Absicht des Sprechenden wirklich einen geschlossenen
Gedanken ausmacht, vom Satze ausgeht, so zerschlagen
Sprachen, die sich dieses Mittels bedienen, die Einheit des Satzes gar
nicht, sondern streben vielmehr in ihrer Ausbildung, sie immer fester
zusammenzuknüpfen. Sie verrücken aber sichtbar die Gränzen der Worteinheit,
indem sie dieselbe in das Gebiet der Satzeinheit hinüberziehen.
Die richtige Unterscheidung beider geht daher allein, da die Chinesische
Methode das Gefühl der Satzeinheit zu schwach in die Sprache überführt,
von den wahren Flexionssprachen aus, und die Sprachen beweisen
nur dann, dass die Flexion in ihrem wahren Geiste ihr ganzes Wesen
durchdrungen hat, wenn sie auf der einen Seite die Worteinheit bis zur
Vollendung ausbilden, auf der andren aber zugleich dieselbe in ihrem
eigentlichen Gebiete festhalten, den Satz in alle seine nothwendigen
Theile trennen und erst aus ihnen seine Einheit wieder aufbauen. Insofern
gehören Flexion, Worteinheit und Gliederung des Satzes dergestalt
enge zusammen, dass eine unvollkommene Ausbildung des einen oder
des andren dieser Stücke immer sicher beweist, dass keines in seinem
ganz reinen, ungetrübten Sinn in der Sprachbildung vorgewaltet hat. Jenes
dreifache Verfahren nun, das sorgfältige grammatische Zurichten des
Wortes zur Satzverknüpfung, die ganz indirecte und grösstentheils lautlose
Andeutung derselben und das enge Zusammenhalten des ganzen
Satzes, soviel es immer möglich ist, in Einer zusammen ausgesprochenen
Form, erschöpft die Art, wie die Sprachen den Satz aus Wörtern zusammenfügen.
Von allen drei Methoden finden sich in den meisten Sprachen
einzelne, stärkere oder schwächere Spuren. Wo aber eine derselben
bestimmt vorwaltet und zum Mittelpunkt des Organismus wird, da lenkt
sie auch den ganzen Bau, in strengerer oder loserer Consequenz, nach
sich hin. Als Beispiele des stärksten Vorwaltens jeder derselben lassen
393sich das Sanskrit, die Chinesische und, wie ich gleich ausführen werde,
die Mexicanische Sprache aufstellen.
Um die Verknüpfung des einfachen Satzes in Eine lautverbundene
Form hervorzubringen, hebt die letztere 32 das Verbum, als den wahren
Mittelpunkt desselben heraus, fügt, soviel es möglich ist, die regierenden
und regierten Theile des Satzes an dasselbe an und giebt dieser Verknüpfung
durch Lautformung das Gepräge eines verbundenen Ganzen:
1 2 3 / ni-naca-qua, 1 2 3 / ich esse Fleisch. Man könnte diese Verbindung des Substantivs
mit dem Verbum als ein zusammengesetztes Verbum, gleich
dem Griechischen ϰϱεωφαγέω, ansehen; die Sprache nimmt es aber offenbar
anders. Denn wenn aus irgend einem Grunde das Substantivum
nicht selbst einverleibt wird, so ersetzt sie es durch das Pronomen der
dritten Person, zum deutlichen Beweise, dass sie mit dem Verbum und
in ihm enthalten zugleil das Schema der Construction zu haben verlangt:
1 2 3 4 5 / ni-c-qua in nacatl, 1 2 3 4 5 / ich esse es, das Fleisch. Der Satz soll, seiner
Form nach, schon im Verbum abgeschlossen erscheinen und wird nur
nachher, gleichsam durch Apposition, näher bestimmt. Das Verbum lässt
sich gar nicht ohne diese vervollständigenden Nebenbestimmungen nach
Mexicanischer Vorstellungsweise denken. Wenn daher kein bestimmtes
Object dasteht, so verbindet die Sprache mit dem Verbum ein eignes, in
doppelter Form für Personen und Sachen gebrauchtes, unbestimmtes
Pronomen: 1 2 3 / ni-tla-qua, 1 3 2 / ich esse etwas, 1 2 3 4 / ni-te-tla-maca, 1 4 2 3 / ich gebe jemandem
etwas. Ihre Absicht, diese Zusammenfügungen als ein Ganzes erscheinen
zu lassen, bekundet die Sprache auf das deutlichste. Denn
wenn ein solches, den Satz selbst oder gleichsam sein Schema in sich
fassendes Verbum in eine vergangene Zeit gestellt wird und dadurch
das Augment o erhält, so stellt sich dieses an den Anfang der Zusammenfügung,
was klar anzeigt, dass jene Nebenbestimmungen dem Verbum
immer und nothwendig angehören, das Augment aber ihm nur gelegentlich,
als Vergangenheits-Andeutung hinzutritt. So ist von ni-nemi,
ich lebe, das als ein intransitives Verbum keine andren Pronomina mit
sich führen kann, das Perfectum o-ni-nen, ich habe gelebt, von maca,
geben, o-ni-c-te-maca-c, ich habe es jemandem gegeben. Noch wichtiger
aber ist es, dass die Sprache für die zur Einverleibung gebrauchten
Wörter sehr sorgfältig eine absolute und eine Einverleibungsform unterscheidet,
eine Vorsicht, ohne welche diese ganze Methode mislich für
das Verständniss werden würde und die man daher als die Grundlage
derselben anzusehen hat. Die Nomina legen in der Einverleibung, ebenso
wie in zusammengesetzten Wörtern die Endungen ab, welche sie im
absoluten Zustande immer begleiten und sie als Nomina charakterisiren.
Fleisch, das wir im Vorigen einverleibt als naca fanden, heisst absolut
394nacatl. 33 Von den einverleibten Pronominen wird keines in gleicher
Form abgesondert gebraucht. Die beiden unbestimmten kommen im
absoluten Zustande gar nicht in der Sprache vor. Die auf ein bestimmtes
Object gehenden haben eine von ihrer selbstständigen mehr oder
weniger verschiedene Form. Die beschriebene Methode zeigt aber
schon von selbst, dass die Einverleibungsform eine doppelte seyn müsse,
eine für das regierende und eine für das regierte Pronomen. Die
selbstständigen persönlichen Pronomina können zwar den hier geschilderten
Formen zu besonderem Nachdruck vorgesetzt werden, die sich
auf sie beziehenden einverleibten bleiben aber darum nicht weg. Das in
einem eignen Worte ausgedrückte Subject des Satzes wird nicht einverleibt;
sein Vorhandenseyn zeigt sich aber an der Form dadurch, dass in
dieser allemal bei der dritten Person ein sie andeutendes regierendes
Pronomen fehlt.
Wenn man die Verschiedenheit der Art überschlägt, in welcher sich
auch der einfache Satz dem Verstande darstellen kann, so sieht man
leicht ein, dass das strenge Einverleibungssystem nicht durch alle verschiednen
Fälle durchgeführt werden kann. Es müssen daher oft Begriffe
in einzelnen Wörtern aus der Form, welche sie nicht alle umschliessen
kann, herausgestellt werden. Die Sprache verfolgt aber hierbei immer
die einmal gewählte Bahn und ersinnt, wo sie auf Schwierigkeiten stösst,
neue künstliche Abhelfungsmittel. Wenn also z.B. eine Sache in Beziehung
auf einen andren, für oder wider ihn geschehen soll und nun das
bestimmte regierte Pronomen, da es sich auf zwei Objecte beziehen
müsste, Undeutlichkeit erregen würde, so bildet sie, vermittelst einer zuwachsenden
Endung, eine eigne Gattung solcher Verben und verfährt
übrigens wie gewöhnlich. Das Schema des Satzes liegt nun wieder vollständig
in der verknüpften Form, die Andeutung einer verrichteten Sache
im regierten Pronomen, die Nebenbeziehung auf einen andren in
der Endung und sie kann jetzt mit Sicherheit des Verständnisses diese
beiden Objecte, ohne sie mit Kennzeichen ihrer Beziehung auszustatten,
ausserhalb nachfolgen lassen: chihua, machen, chihui-lia, für oder
wider jemand machen, mit Veränderung des a in i nach dem Assimilationsgesetz,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 / ni-c-chihui-lia in no-piltzin ce calli, 1 3 2 4 5 6 7 8 9 / ich mache es für der
mein Sohn ein Haus.
Die Mexicanische Einverleibungsmethode zeugt darin von einem
richtigen Gefühle der Bildung des Satzes, dass sie die Bezeichnung seiner
Beziehungen gerade an das Verbum anknüpft, also an den Punkt, in
welchem sich derselbe zur Einheit zusammenschlingt. Sie unterscheidet
sich dadurch wesentlich und vortheilhaft von der Chinesischen Andeutungslosigkeit,
in welcher das Verbum nicht einmal sicher durch seine
Stellung, sondern oft nur materiell an seiner Bedeutung kenntlich ist. In
395den bei verwickeiteren Sätzen ausserhalb des Verbum stehenden Theilen
aber kommt sie der letzteren wieder vollkommen gleich. Denn indem
sie ihre ganze Andeutungs-Geschäftigkeit auf das Verbum wirft,
lässt sie das Nomen durchaus beugungslos. Dem Sanskritischen Verfahren
nähert sie sich zwar insofern, als sie den, die Theile des Satzes verknüpfenden
Faden wirklich angiebt; übrigens aber steht sie mit demselben
in einem merkwürdigen Gegensatz. Das Sanskrit bezeichnet auf
ganz einfache und natürliche Weise jedes Wort als constitutiven Theil
des Satzes. Die Einverleibungsmethode thut dies nicht, sondern lässt,
wo sie nicht Alles in Eins zusammenschlagen kann, aus dem Mittelpunkte
des Satzes Kennzeichen, gleichsam wie Spitzen ausgehen, die
Richtungen anzuzeigen, in welchen die einzelnen Theile, ihrem Verhältniss
zum Satze gemäss, gesucht werden müssen. Des Suchens und
Rathens wird man nicht überhoben, vielmehr durch die bestimmte Art
der Andeutung in das entgegengesetzte System der Andeutungslosigkeit
zurückgeworfen. Wenn aber auch dies Verfahren auf diese Weise
etwas mit den beiden übrigen gemein hat, so würde man seine Natur
dennoch verkennen, wenn man es als eine Mischung von beiden ansehen,
oder es so auffassen wollte, als hätte nur der innere Sprachsinn
nicht die Kraft besessen, das Andeutungssystem durch alle Theile der
Sprache durchzuführen. Es liegt vielmehr offenbar in dieser Mexicanischen
Satzbildung eine eigenthümliche Vorstellungsweise. Der Satz soll
nicht construirt, nicht aus Theilen allmählich aufgebaut, sondern als
zur Einheit geprägte Form auf Einmal hingegeben werden.
Wenn man es wagt, in die Uranfänge der Sprache hinabzusteigen, so
verbindet zwar der Mensch gewiss immer mit jedem, als Sprache ausgestossenen
Laute innerlich einen vollständigen Sinn, also einen geschlossenen
Satz, stellt nicht bloss, seiner Absicht nach, ein vereinzeltes Wort
hin, wenn auch seine Aussage nach unserer Ansicht nur ein solches enthält.
Darum aber kann man sich das ursprüngliche Verhältniss des Satzes
zum Worte nicht so denken, als würde ein schon in sich vollständiger
und ausführlicher nur nachher durch Abstraction in Wörter zerlegt.
Denkt man sich, wie es doch das Natürlichste ist, die Sprachbildung
successiv so muss man ihr, wie allem Entstehen in der Natur, ein Evolutionssystem
unterlegen. Das sich im Laut äussernde Gefühl enthält Alles
im Keime, im Laute selbst aber ist nicht Alles zugleich sichtbar. Nur
wie das Gefühl sich klarer entwickelt, die Articulation Freiheit und Bestimmtheit
gewinnt und das mit Glück versuchte gegenseitige Verständniss
den Muth erhöht, werden die erst dunkel eingeschlossenen Theile
nach und nach heller und treten in einzelnen Lauten hervor. Mit diesem
Gange hat das Mexicanische Verfahren eine gewisse Aehnlichkeit. Es
stellt zuerst ein verbundenes Ganzes hin, das formal vollständig und
genügend ist; es bezeichnet ausdrücklich das noch nicht individuell Bestimmte
396als ein unbestimmtes Etwas durch das Pronomen, malt aber
nachher dies unbestimmt Gebliebene einzeln aus. Es folgt aus diesem
Gange von selbst, dass, da den einverleibten Wörtern die Endungen
fehlen, welche sie im selbstständigen Zustande besitzen, man sich dies
in der Wirklichkeit der Spracherfindung nicht als ein Abwerfen der Endungen
zum Behuf der Einverleibung, sondern als ein Hinzufügen im
Zustande der Selbstständigkeit denken muss. Man darf mich darum
nicht so misverstehen, als schiene mir deshalb der Mexicanische
Sprachbau jenen Uranfängen näher zu liegen. Die Anwendung von
Zeitbegriffen auf die Entwicklung einer so ganz im Gebiete der nicht zu
berechnenden ursprünglichen Seelenvermögen liegenden menschlichen
Eigenthümlichkeit, als die Sprache, hat immer etwas sehr Misliches.
Offenbar ist auch die Mexicanische Satzbildung schon eine sehr kunstvoll
und oft bearbeitete Zusammenfügung, die von jenen Urbildungen
nur den allgemeinen Typus beibehalten hat, übrigens aber schon durch
die regelmässige Absonderung der verschiedenen Arten des Pronomen
an eine Zeit erinnert, in welcher eine klarere grammatische Vorstellungsweise
herrscht. Denn diese Zusammenfügungen am Verbum haben
sich schon harmonisch und in gleichem Grade, wie die Zusammenbildung
in eine Worteinheit und die Beugungen des Verbum selbst
ausgebildet. Das Unterscheidende liegt nur darin, dass, was in den Uranfängen
gleichsam die unentwickelt in sich schliessende Knospe ausmacht,
in der Mexicanischen Sprache als ein zusammengebildetes Ganzes
vollständig und unzertrennbar hingelegt wird, da die Chinesische es
ganz dem Hörer überlässt, die, kaum irgend durch Laute angedeutete
Zusammenfügung aufzusuchen, und die lebendigere und kühnere Sanskritische
sich gleich den Theil in seiner Beziehung zum Ganzen, sie fest
bezeichnend, vor Augen stellt.
Die Malayischen Sprachen folgen zwar nicht dem Einverleibungssysteme,
haben aber darin mit demselben eine gewisse Aehnlichkeit, dass
sie die Richtungen, welche der Gang des Satzes nimmt, durch sorgfältige
Bezeichnung der intransitiven, transitiven oder causalen Natur des
Verbum angeben und dadurch den Mangel an Beugungen für das Verständniss
des Satzes zu ersetzen suchen. Einige von ihnen häufen Bestimmungen
aller Art auf diese Weise am Verbum, so dass sie sogar gewissermassen
daran ausdrücken, ob es im Singularis oder Pluralis steht.
Es wird daher auch durch Bezeichnung am Verbum der Wink gegeben,
wie man die anderen Theile des Satzes darauf beziehen soll. Auch ist
das Verbum bei ihnen nicht durchaus beugungslos. Der Mexicanischen
kann man am Verbum, in welchem die Zeiten durch einzelne Endbuchstaben
und zum Theil offenbar symbolisch bezeichnet werden, Flexionen
und ein gewisses Streben nach Sanskritischer Worteinheit nicht absprechen.397
Ein gleichsam geringerer Grad des Einverleibungsverfahrens ist es,
wenn Sprachen zwar dem Verbum nicht zumuthen, ganze Nomina in
den Schooss seiner Beugungen aufzunehmen, allein doch an ihm nicht
bloss das regierende Pronomen, sondern auch das regierte ausdrücken.
Auch hierin giebt es verschiedene Nuancen, je nachdem diese Methode
sich mehr oder weniger tief in der Sprache festgesetzt hat und je nachdem
diese Andeutung auch da gefordert wird, wo der ausdrückliche
Gegenstand der Handlung selbstständig nachfolgt. Wo diese Beugungsart
des Verbum mit dem, in dasselbe verwebten, nach verschiedenen
Richtungen hin bedeutsamen Pronomen seine volle Ausbildung erreicht
hat; wie in einigen Nordamerikanischen Sprachen und in der Vaskischen,
da wuchert eine schwer zu übersehende Anzahl von verbalen
Beugungsformen auf. Mit bewundrungswürdiger Sorgfalt aber ist die
Analogie ihrer Bildung dergestalt festgehalten, dass das Verständniss
an einem leicht zu erkennenden Faden durch dieselben hindurchläuft.
Da in diesen Formen häufig dieselbe Person des Pronomen in verschiedenen
Beziehungen als handelnd, als directer und indirecter Gegenstand
der Handlung wiederkehrt und diese Sprachen grösstentheils aller
Declinationsbeugungen ermangeln, so muss es entweder dem Laut
nach verschiedene Pronominal-Affixa in ihnen geben oder auf irgend
eine andre Weise dem möglichen Misverständniss vorgebeugt werden.
Hierdurch entsteht nun oft ein höchst kunstvoller Bau des Verbum. Als
ein vorzügliches Beispiel eines solchen kann man die Massachusetts-Sprache
in NeuEngland, einen Zweig des grossen Delaware-Stamms
anführen. Mit den gleichen Pronominal-Affixen, zwischen denen sie
nicht, wie die Mexicanische, einen Lautunterschied macht, bestimmt
sie in ihrer verwickelten Conjugation alle vorkommenden Beugungen.
Sie bedient sich dazu hauptsächlich des Mittels, in bestimmten Fällen
die leidende Person zu praefigiren, so dass man, wenn man einmal die
Regel eingesehen hat, meistentheils gleich am Anfangsbuchstaben der
Form die Gattung erkennt, zu welcher sie gehört. Da aber auch dies
Mittel nicht vollkommen ausreicht, so verbindet sie damit andere, namentlich
einen Endungslaut, der, wenn die beiden ersten Personen die
leidenden sind, die dritte als wirkend bezeichnet. Dieser Umstand, die
verschiedene Bedeutung des Pronomen durch den Ort seiner Stellung
im Verbum anzudeuten, hat mir immer sehr merkwürdig geschienen,
indem er entweder eine bestimmte Vorstellungsweise in dem Geiste des
Volkes voraussetzt oder darauf hinführt, dass das Ganze der Conjugation
gleichsam dunkel dem Sprachsinne vorgeschwebt habe und dieser
nun willkührlich sich der Stellung als Unterscheidungsmittels bediente.
Mir ist jedoch das Erstere bei weitem wahrscheinlicher. Zwar
scheint es auf den ersten Anblick in der That willkührlich, wenn die
erste Person, als regierte, da suffigirt wird, wo die zweite die handelnde
398ist, dagegen dem Verbum da vorangeht, wo die dritte als wirkend
auftritt, wenn man mithin immer du greifst mich und mich greift er,
nicht umgekehrt sagt. Indess mag doch ein Grund darin liegen, dass
die beiden ersten Personen einen höheren Grad von Lebendigkeit vor
der Phantasie des Volkes ausübten und dass das Wesen dieser Formen,
wie es nicht unnatürlich zu denken ist, von der betroffenen, leidenden
Person ausgieng. Unter den beiden ersten scheint wieder die zweite das
Uebergewicht zu haben; denn die dritte wird, als leidende, nie praefigirt
und die zweite hat in demselben Zustand nie eine andre Stellung.
Wo aber die zweite, als wirkend mit der ersten, als leidenden zusammenkommt,
behauptet die zweite, indem die Sprache auf andre Weise
für die Vermeidung der Verwechslung sorgt, dennoch ihren vorzüglicheren
Platz. Auch spricht für diese Ansicht, dass in der Sprache des
Hauptzweiges des Delaware-Stammes, in der Lenni Lenape-Sprache,
die Stellung des Pronomen in diesen Formen dieselbe ist. Auch die
Mundart der unter uns durch den geistvollen Cooperschen Roman bekannt
gewordenen Mohegans (eigentlich Muhhekaneew) scheint sich
hiervon nicht zu entfernen. Immer aber bleibt das Gewebe dieser Conjugation
so künstlich, dass man sich des Gedanken nicht erwehren
kann, dass auch hier, wie schon weiter oben von der Sprache überhaupt
bemerkt worden ist, die Bildung jedes Theiles in Beziehung auf das
dunkel gefühlte Ganze gemacht worden sey. Die Grammatiken geben
bloss Paradigmen und enthalten keine Zergliederung des Baues. Ich
habe mich aber durch eine solche genaue, in weitläuftige Tabellen gebrachte
aus Eliot's 34 Paradigmen vollständig von der in dem anscheinenden
Chaos herrschenden Regelmässigkeit überzeugt. Die Mangelhaftigkeit
der Hülfsmittel erlaubt der Zergliederung nicht immer, durch
alle Theile jeder Form durchzudringen, und besonders nicht, das, was
die Grammatiker nur als Wohllautsbuchstaben ansehen, von allen charakteristischen
zu scheiden. Durch den grössten Theil der Beugungen
aber führen die erkannten Regeln, und wo hiernach Fälle zweifelhaft
bleiben, lässt sich die Bedeutung der Form doch immer dadurch zeigen,
dass sie aus bestimmt anzugebenden Gründen keine andere seyn
kann. Dennoch ist es kein glücklicher Wurf, wenn die innere Organisation
eines Volkes, verbunden mit äusseren Umständen, den Sprachbau
auf diese Bahn führt. Die grammatischen Formen fügen sich für den
Verstand und den Laut in zu grosse und unbehülfliche Massen zusammen.
Die Freiheit der Rede fühlt sich gebunden, indem sie sich, anstatt
den in seinen Verknüpfungen wechselnden Gedanken aus einzelnen
Elementen zusammenzusetzen, grossentheils ein für allemal gestempelter
Ausdrücke bedienen muss, von welchen sie nicht einmal aller Theile
in jedem Augenblicke bedarf. Dabei ist die Verbindung innerhalb
dieser zusammengesetzten Formen doch zu locker und zu lose, als dass
399ihre einzelnen Theile zu wahrer Worteinheit in einander verschmelzen
könnten.
So leidet die Verbindung bei nicht organisch richtig vorgenommener
Trennung. Der hier erhobene Vorwurf trifft das ganze Einverleibungsverfahren.
Die Mexicanische Sprache macht zwar dadurch die Worteinheit
wieder stärker, dass sie weniger Bestimmungen durch Pronomina
in die Verbalbeugungen verwebt, niemals auf diese Weise zwei bestimmte
regierte Gegenstände andeutet, sondern die Bezeichnung der
indirecten Beziehung, wenn zugleich eine directe da ist, in die Endung
des Verbum selbst legt; allein sie verknüpft immer auch, was besser unverbunden
wäre. In Sprachen, welche einen hohen Sinn für die Worteinheit
verrathen, ist zwar auch bisweilen die Andeutung des regierten
Pronomen an der Verbalform eingedrungen, wie z. B. im Hebräischen
diese regierten Pronomina suffigirt werden. Allein die Sprache giebt
hier selbst zu erkennen, welchen Unterschied sie zwischen diesen Pronominen
und denen der handelnden Personen, welche wesentlich zur
Natur des Verbum selbst gehören, macht. Denn indem sie diese letzteren
in die allerengste Verbindung mit dem Stamme setzt, hängt sie die
ersteren locker an, ja trennt sie bisweilen gänzlich vom Verbum und
stellt sie für sich hin.
Die Sprachen, welche auf diese Weise die Gränzen der Wort- und
Satzbildung in einander überführen, pflegen der Declination zu ermangeln,
entweder gar keine Casus zu haben oder, wie die Vaskische, den
Nominativus nicht immer im Laut vom Accusativus zu unterscheiden.
Man darf aber dies nicht als die Ursache jener Einfügung des regierten
Objects ansehen, als wollten sie gleichsam der aus dem Declinationsmangel
entstehenden Undeutlichkeit vorbeugen. Dieser Mangel ist vielmehr
die Folge jenes Verfahrens. Denn der Grund dieser ganzen Verwechslung
dessen, was dem Theile und was dem Ganzen des Satzes
gebührt, liegt darin, dass dem Geiste bei der Organisation der Sprache
nicht der richtige Begriff der einzelnen Redetheile vorgeschwebt hat.
Aus diesem würde unmittelbar selbst zugleich die Declination des Nomen
und die Beschränkung der Verbalformen auf ihre wesentlichen Bestimmungen
hervorgesprungen seyn. Gerieth man aber statt dessen zuerst
auf den Weg, das bloss in der Construction Zusammengehörende
auch im Worte eng zusammenzuhalten, so erschien natürlich die Ausbildung
des Nomen minder nothwendig. Sein Bild war in der Phantasie
des Volkes nicht als Theil des Satzes vorherrschend, sondern wurde
bloss als erklärender Begriff nachgebracht. Das Sanskrit hat sich von
dieser Verwehung regierter Pronomina in das Verbum durchaus frei erhalten.
Ich habe bisher einer andren Verbindung des Pronomen in Fällen,
wo es natürlicher unverbunden steht, nemlich des Besitzpronomen mit
400dem Nomen nicht erwähnt, weil derselben zugleich und sogar hauptsächlich
etwas anderes, als das, wovon wir hier reden, zum Grunde
liegt. Die Mexicanische Sprache hat eine eigen für das Besitzpronomen
bestimmte Abkürzung und das Pronomen umschlingt auf diese Weise in
zwei abgesonderten Formen die beiden Haupttheile der Sprache. Im
Mexicanischen und nicht bloss in dieser Sprache hat diese Verbindung
zugleich eine syntaktische Anwendung und gehört daher genau hierher.
Man bedient sich nemlich der Zusammenfügung des Pronomen der
dritten Person mit dem Nomen als einer Andeutung des Genitiv-Verhältnisses,
indem man das im Genitiv stehende Nomen nachfolgen
lässt, sein Haus der Gärtner statt das Haus des Gärtners sagt. Man
sieht, dass dies gerade dasselbe Verfahren, als bei dem, ein nachgesetztes
Substantiv regierenden Verbum ist.
Die Verbindungen mit dem Besitzpronomen sind im Mexicanischen
nicht bloss überhaupt viel häufiger, als die Hinzufügung desselben unsrer
Vorstellungsweise nothwendig erscheint, sondern mit gewissen Begriffen,
z.B. denen der Verwandtschaftsgrade und der Glieder des
menschlichen Körpers ist dies Pronomen gleichsam unablöslich verwachsen.
Wo keine einzelne Person zu bestimmen ist, fügt man dem
Verwandtschaftsgrade das unbestimmte persönliche Pronomen, den
Gliedmassen des Körpers das der ersten Person des Plurals hinzu. Man
sagt daher nicht leicht nantli, die Mutter, sondern gewöhnlich te-nan,
jemandes Mutter, und ebensowenig maitl, die Hand, sondern to-ma,
unsere Hand. Auch in vielen andren Amerikanischen Sprachen geht das
Anknüpfen dieser Begriffe an das Besitzpronomen bis zur anscheinenden
Unmöglichkeit der Trennung davon. Hier ist der Grund nun wohl
offenbar kein syntaktischer, sondern liegt vielmehr noch tiefer in der
Vorstellungsweise des Volks. Wo der Geist noch wenig an Abstraction
gewöhnt ist, fasst er in Eins, was er oft an einander anknüpft, und was
der Gedanke schwer oder überall nicht zu sondern vermag, das verbindet
die Sprache, wo sie überhaupt zu solchen Verknüpfungen hinneigt,
in Ein Wort. Solche Wörter erhalten nachher, als ein für allemal gestempelte
Gepräge, Umlauf und die Sprechenden denken nicht mehr daran,
ihre Elemente zu trennen. Die beständige Beziehung der Sache auf die
Person liegt überdies in der ursprünglicheren Ansicht des Menschen
und beschränkt sich erst bei steigender Cultur auf die Fälle, in welchen
sie wirklich nothwendig ist. In allen Sprachen, welche stärkere Spuren
jenes früheren Zustandes enthalten, spielt daher das persönliche Pronomen
eine wichtigere Rolle. In dieser Ansicht bestätigen mich auch einige
andere Erscheinungen. Im Mexicanischen bemächtigen sich die Besitzpronomina
dergestalt des Wortes, dass die Endungen desselben
gewöhnlich verändert werden und diese Verknüpfungen durchaus eine
ihnen eigne Pluralendung haben. Eine solche Umgestaltung des ganzen
401Wortes beweist sichtbar, dass es auch innerlich als ein neuer individueller
Begriff, nicht als eine bloss gelegentlich in der Rede vorkommende
Verknüpfung zweier verschiedener angesehen wird. In der Hebräischen
Sprache zeigt sich der Einfluss der verschiedenen Festigkeit der Begriffsverknüpfung
auf die Wortverknüpfung in besonders bedeutsamen
Nuancen. Am festesten und engsten schliessen sich, wie schon oben bemerkt
worden ist, an den Stamm die Pronomina der handelnden Person
des Verbum an, weil dieses gar nicht ohne sie gedacht werden kann. Die
dann folgende festere Verbindung gehört dem Besitzpronomen an und
am losesten tritt das Pronomen des Objects des Verbum zu dem Stamme
hinzu. Nach rein logischen Gründen sollte bei den beiden letzten
Fällen, wenn man überhaupt in ihnen einen Unterschied gestatten wollte,
die grössere Festigkeit auf der Seite des vom Verbum regierten Objects
seyn. Denn offenbar wird dieses nothwendiger vom transitiven
Verbum, als das Besitzpronomen im Allgemeinen vom Nomen gefordert.
Dass die Sprache hier den entgegengesetzen Weg wählt, kann
kaum einen andren Grund, als den haben, dass dies Verhältniss in den
Fällen, die es am häufigsten mit sich führt, sich dem Volke in individueller
Einheit darstellte.
Wenn man zu dem Einverleibungssysteme, wie man streng genommen
thun muss, alle die Fälle rechnet, wo dasjenige, was einen eignen
Satz bilden könnte, in eine Wortform zusammengezogen wird, so finden
sich Beispiele desselben auch in Sprachen, die ihm übrigens fremd
sind. Sie kommen aber alsdann gewöhnlicher so vor, dass sie in zusammengesetzten
Sätzen zur Vermeidung von Zwischensätzen gebraucht
werden. Wie die Einverleibung im einfachen Satze mit der Beugungslosigkeit
des Nomen zusammenhängt, so ist dies hier entweder mit dem
Mangel eines Relativpronomen und gehöriger Conjunctionen oder mit
der geringeren Gewohnheit der Fall, sich dieser Verbindungsmittel zu
bedienen. In den Semitischen Sprachen ist der Gebrauch des Status
constructus auch in diesen Fällen weniger auffallend, da sie überhaupt
der Einverleibung nicht abgeneigt sind. Allein auch im Sanskrit brauche
ich hier nur an die in twá und ya ausgehenden sogenannten beugungslosen
Participia und selbst an die Composita zu erinnern, die, wie die
Bahuwrîhi's, ganze Relativsätze in sich schliessen. Die letzteren sind
nur in geringerem Masse in die Griechische Sprache übergegangen,
welche überhaupt auch von dieser Art der Einverleibung einen weniger
häufigen Gebrauch macht. Sie bedient sich mehr des Mittels verknüpfender
Conjunctionen. Sie vermehrt sogar lieber die Arbeit des Geistes
durch unverbunden gelassene Constructionen, als sie durch allzu grosse
Zusammenziehungen dem Periodenbau eine gewisse Ungelenkigkeit
aufbürdet, von welcher, in Vergleichung mit ihr, das Sanskrit nicht immer
ganz frei zu sprechen ist. Es ist hier der nemliche Fall, als da, wo
402die Sprachen überhaupt als Eins geprägte Wortformen in Sätze auflösen.
Nur braucht der Grund zu diesem Verfahren nicht immer die Abstumpfung
der Formen bei geschwächter Bildungskraft der Sprachen zu
seyn. Auch da, wo sich eine solche nicht annehmen lässt, kann die Gewöhnung
an richtigere und kühnere Trennung der Begriffe auflösen,
was, zwar sinnlich und lebendig, allein den Ausdruck der wechselnden
und geschmeidigen Gedankenverknüpfung weniger angemessen, in
Eins zusammengegossen war. Die Gränzbestimmung, was und wie viel
in Einer Form verbunden werden kann, erfordert einen zarten und feinen
grammatischen Sinn, wie er unter allen Nationen wohl vorzugsweise
den Griechen ursprünglich eigen war und sich in ihrem, durchaus
mit reichem und sorgfältigem Gebrauche der Sprache verschlungenen
Leben bis zur höchsten Verfeinerung ausbildete.
Congruenz der Lautformen der Sprache
mit den grammatischen Forderungen
29b. Die grammatische Formung entspringt aus den Gesetzen des Denkens
durch Sprache und beruht auf der Congruenz der Lautformen mit
denselben. Eine solche Congruenz muss auf irgend eine Weise in jeder
Sprache vorhanden seyn; der Unterschied liegt nur in den Graden und
die Schuld mangelnder Vollendung kann das nicht gehörig deutliche
Hervorspringen jener Gesetze in der Seele oder die nicht ausreichende
Geschmeidigkeit des Lautsystemes treffen. Der Mangel in dem einen
Punkte wirkt aber immer zugleich auf den andren zurück. Die Vollendung
der Sprache fordert, dass jedes Wort als ein bestimmter Redetheil
gestempelt sey und diejenigen Beschaffenheiten an sich trage, welche
die philosophische Zergliederung der Sprache an ihm erkennt. Sie setzt
dadurch selbst Flexion voraus. Es fragt sich nun also, auf welche Weise
der einfachste Theil der vollendeten Sprachbildung, die Ausprägung eines
Wortes zum Redetheil durch Flexion in dem Geiste eines Volkes vor
sich gehend gedacht werden kann? Reflectirendes Bewusstseyn der
Sprache lässt sich bei ihrem Ursprünge nicht voraussetzen und würde
auch keine schöpferische Kraft für die Lautformung in sich tragen. Jeder
Vorzug, den eine Sprache in diesen wahrhaft vitalen Theilen ihres
Organismus besitzt, geht ursprünglich aus der lebendigen, sinnlichen
Weltanschauung hervor. Weil aber die höchste und von der Wahrheit
am wenigsten abirrende Kraft aus der reinsten Zusammenstimmung aller
Geistesvermögen, deren idealischste Blüthe die Sprache selbst ist,
entspringt, so wirkt das aus der Weltanschauung Geschöpfte von selbst
auf die Sprache zurück. So ist es nun auch hier. Die Gegenstände der
äusseren Anschauung, so wie der innren Empfindung stellen sich in
403zwiefacher Beziehung dar, in ihrer besondren qualitativen Beschaffenheit,
welche sie individuell unterscheidet, und in ihrem allgemeinen,
sich für die gehörig regsame Anschauung immer auch durch etwas in
der Erscheinung und dem Gefühl offenbarenden Gattungsbegriff; der
Flug eines Vogels z. B. als diese bestimmte Bewegung durch Flügelkraft,
zugleich aber als die unmittelbar vorübergehende und nur an diesem
Vorübergehen festzuhaltende Handlung, und auf ähnliche Weise in allen
andren Fällen. Eine aus der regsten und harmonischsten Anstrengung
der Kräfte hervorgehende Anschauung erschöpft alles, sich in
dem Angeschauten Darstellende und vermischt nicht das Einzelne,
sondern legt es in Klarheit aus einander. Aus dem Erkennen jener doppelten
Beziehung der Gegenstände nun, dem Gefühle ihres richtigen
Verhältnisses und der Lebendigkeit des von jeder einzelnen hervorgebrachten
Eindrucks entspringt, wie von selbst, die Flexion, als der
sprachliche Ausdruck des Angeschauten und Gefühlten.
Es ist aber zugleich merkwürdig zu sehen, auf welchem verschiedenen
Wege die geistige Ansicht hier zur Satzbildung gelangt. Sie geht
nicht von seiner Idee aus, setzt ihn nicht mühevoll zusammen, sondern
gelangt zu ihm, ohne es noch zu ahnden, indem sie nur dem scharf und
vollständig aufgenommenen Eindruck des Gegenstandes Gestaltung im
Laute ertheilt. Indem dies jedesmal richtig und nach demselben Gefühle
geschieht, ordnet sich der Gedanke aus den so gebildeten Wörtern
zusammen. In ihrem wahren, inneren Wesen ist die hier erwähnte geistige
Verrichtung ein unmittelbarer Ausfluss der Stärke und Reinheit
des ursprünglich im Menschen liegenden Sprachvermögens. Anschauung
und Gefühl sind nur gleichsam die Handhaben, an welchen sie in
die äussere Erscheinung herübergezogen wird, und dadurch ist es begreiflich,
dass in ihrem letzten Resultate so unendlich mehr liegt, als
diese, an sich betrachtet, darzubieten scheint. Die Einverleibungsmethode
befindet sich, streng genommen, in ihrem Wesen selbst in wahrem
Gegensatze mit der Flexion, indem diese vom Einzelnen, sie aber
vom Ganzen ausgeht. Nur theilweise kann sie durch den siegreichen
Einfluss des inneren Sprachsinnes wieder zu ihr zurückkehren. Immer
aber verräth sich in ihr, dass durch seine geringere Stärke die Gegenstände
sich nicht in gleicher Klarheit und Sonderung der in ihnen das
Gefühl einzeln berührenden Punkte vor der Anschauung darlegen. Indem
sie aber dadurch auf ein anderes Verfahren geräth, erlangt sie
durch das lebendige Verfolgen dieser neuen Bahn wieder eine eigenthümliche
Kraft und Frische der Gedankenverknüpfung. Die Beziehung
der Gegenstände auf ihre allgemeinsten Gattungsbegriffe, welchen die
Redetheile entsprechen, ist eine ideale und ihr allgemeinster und reinster
symbolischer Ausdruck wird von der Persönlichkeit hergenommen,
die sich zugleich, auch sinnlich, als ihre natürlichste Bezeichnung darstellt.
404So knüpft sich das weiter oben von der sinnvollen Verwebung der
Pronominalstämme in die grammatischen Formen Gesagte wieder hier
an.
Ist einmal Flexion in einer Sprache wahrhaft vorwaltend, so folgt die
fernere Ausspinnung des Flexionssystems nach vollendeter grammatischer
Ansicht von selbst und es ist schon oben angedeutet worden, wie
die weitere Entwicklung sich bald neue Formen schafft, bald sich in vorhandene,
aber bis dahin nicht in verschiedener Bedeutsamkeit gebrauchte,
auch bei Sprachen desselben Stammes, hineinbaut. Ich darf hier nur
an die Entstehung des Griechischen Plusquamperfectum aus einer bloss
verschiedenen Form eines Sanskritischen Aoristes erinnern. Denn bei
dem, nie zu übergehenden Einfluss der Lautformung auf diesen Punkt
darf man nicht mit einander verwechseln, ob die letztere auf die Unterscheidung
der mannigfaltigen grammatischen Begriffe beschränkend einwirkt
oder dieselben nur nicht vollständig in sich aufgenommen hat. Es
kann, auch bei der richtigsten Sprachansicht, in früherer Periode der
Sprache ein Uebergewicht der sinnlichen Formenschöpfung geben, in
welchem einem und demselben grammatischen Begriff eine Mannigfaltigkeit
von Formen entspricht. Die Wörter stellten sich in diesen früheren
Perioden, wo der innerlich schöpferische Geist des Menschen ganz in
die Sprache versenkt war, selbst als Gegenstände dar, ergriffen die Einbildungskraft
durch ihren Klang und machten ihre besondere Natur in
Vielförmigkeit vorherrschend geltend. Erst später und allmählich gewann
die Bestimmtheit und die Allgemeinheit des grammatischen Begriffs
Kraft und Gewicht, bemächtigte sich der Wörter und unterwarf sie
ihrer Gleichförmigkeit. Auch im Griechischen, besonders in der Homerischen
Sprache haben sich bedeutende Spuren jenes früheren Zustandes
erhalten. Im Ganzen aber zeigt sich gerade in diesem Punkte der merkwürdige
Unterschied zwischen dem Griechischen und dem Sanskrit, dass
das erstere die Formen genauer nach den grammatischen Begriffen umgränzt
und ihre Mannigfaltigkeit sorgfältiger benutzt, feinere Abstufungen
derselben zu bezeichnen, wogegen das Sanskrit die technischen Bezeichnungsmittel
mehr heraushebt, sie auf der einen Seite in grösserem
Reichthum anwendet, auf der andren aber dennoch besser, einfacher und
mit weniger zahlreichen Ausnahmen festhält.
Hauptunterschied der Sprachen
nach der Reinheit ihres Bildungsprincips
30. Da die Sprache, wie ich bereits öfter im Obigen bemerkt habe, immer
nur ein ideales Daseyn in den Köpfen und Gemüthern der Menschen,
niemals, auch in Stein oder Erz gegraben, ein materielles besitzt
405und auch die Kraft der nicht mehr gesprochenen, insofern sie noch von
uns empfunden werden kann, grossentheils von der Stärke unsres eignen
Wiederbelebungsgeistes abhängt, so kann es in ihr ebensowenig,
als in den unaufhörlich fortflammenden Gedanken der Menschen selbst
einen Augenblick wahren Stillstandes geben. Es ist ihre Natur, ein fortlaufender
Entwicklungsgang unter dem Einflüsse der jedesmaligen Geisteskraft
der Redenden zu seyn. In diesem Gange entstehen natürlich
zwei bestimmt zu unterscheidende Perioden, die eine, wo der lautschaffende
Trieb der Sprache noch im Wachsthum und in lebendiger Thätigkeit
ist, die andre, wo, nach vollendeter Gestaltung wenigstens der
äussren Sprachform, ein scheinbarer Stillstand eintritt und dann eine
sichtbare Abnahme jenes schöpferischen sinnlichen Triebes folgt. Allein
auch aus der Periode der Abnahme können neue Lebensprincipe und
neu gelingende Umgestaltungen der Sprache hervorgehen, wie ich in
der Folge näher berühren werde.
In dem Entwicklungsgange der Sprachen überhaupt wirken zwei
sich gegenseitig beschränkende Ursachen zusammen, das ursprünglich
die Richtung bestimmende Princip und der Einfluss des schon hervorgebrachten
Stoffes, dessen Gewalt immer in umgekehrtem Verhältniss
mit der sich geltend machenden Kraft des Princips steht. An dem Vorhandenseyn
eines solchen Princips in jeder Sprache kann nicht gezweifelt
werden. So wie ein Volk oder eine menschliche Denkkraft überhaupt
Sprachelemente in sich aufnimmt, muss sie dieselben, selbst
unwillkührlich und ohne zum deutlichen Bewusstseyn davon zu gelangen,
in eine Einheit verbinden, da ohne diese Operation weder ein Denken
durch Sprache im Individuum noch ein gegenseitiges Verständniss
möglich wäre. Eben dies müsste man annehmen, wenn man bis zu einem
ersten Hervorbringen einer Sprache aufsteigen könnte. Jene Einheit
aber kann nur die eines ausschliesslich vorwaltenden Princips seyn.
Nähert sich dies Princip dem allgemeinen sprachbildenden Principe im
Menschen so weit, als dies die nothwendige Individualisirung desselben
erlaubt, und durchdringt es die Sprache in voller und ungeschwächter
Kraft, so wird diese alle Stadien ihres Entwicklungsganges dergestalt
durchlaufen, dass an die Stelle einer schwindenden Kraft immer wieder
eine neue, der sich fortschlingenden Bahn angemessene eintritt. Denn
es ist jeder intellectuellen Entwicklung eigen, dass die Kraft eigentlich
nicht abstirbt, sondern nur in ihren Functionen wechselt oder eines ihrer
Organe durch ein anderes ersetzt. Mischt sich aber schon dem ersten
Principe etwas nicht in der Nothwendigkeit der Sprachform Gegründetes
bei oder durchdringt das Princip nicht wahrhaft den Laut
oder schliesst sich an einen nicht rein organischen Stoff zu noch grösserer
Abweichung anderes gleich Verbildetes an, so stellt sich dem natürlichen
Entwicklungsgange eine fremde Gewalt gegenüber und die Sprache
406kann nicht, wie es sonst bei jeder richtigen Entwicklung intellectueller
Kräfte der Fall seyn muss, durch die Verfolgung ihrer Bahn selbst
neue Stärke gewinnen. Auch hier, wie bei der Bezeichnung der mannigfaltigen
Gedankenverknüpfungen, bedarf die Sprache der Freiheit und
man kann es als ein sicheres Merkmal des reinsten und gelungensten
Sprachbaues ansehen, wenn in demselben die Formung der Wörter und
der Fügungen keine andren Beschränkungen erleidet, als nothwendig
sind, mit der Freiheit auch Gesetzmässigkeit zu verbinden, d.h. der
Freiheit durch Schranken ihr eignes Daseyn zu sichern. Mit dem richtigen
Entwicklungsgange der Sprache steht der des intellectuellen Vermögens
überhaupt in natürlichem Einklange. Denn da das Bedürfniss
des Denkens die Sprache im Menschen weckt, so muss, was rein aus
ihrem Begriffe abfliesst, auch nothwendig das gelingende Fortschreiten
des Denkens befördern. Versänke aber auch eine mit solcher Sprache
begabte Nation durch andere Ursachen in Geistesträgheit und Schwäche,
so würde sie sich immer an ihrer Sprache selbst leichter aus diesem
Zustande hervorarbeiten können. Umgekehrt muss das intellectuelle
Vermögen aus sich selbst Hebel seines Aufschwunges finden, wenn ihm
eine, von jenem richtigen und natürlichen Entwicklungsgange abweichende
Sprache zur Seite steht. Es wird alsdann durch die aus ihm
selbst geschöpften Mittel auf die Sprache einwirken, nicht zwar schaffend,
da ihre Schöpfungen nur das Werk ihres eignen Lebenstriebes
seyn können, allein in sie hineinbauend, ihren Formen einen Sinn leihend
und eine Anwendung verstattend, den sie nicht hineingelegt und
zu der sie nicht geführt hatte.
Wir können nun in der zahllosen Mannigfaltigkeit der vorhandenen
und untergegangenen Sprachen einen Unterschied feststellen, der für
die fortschreitende Bildung des Menschengeschlechts von entschiedner
Wichtigkeit ist, nemlich den zwischen Sprachen, die sich aus reinem
Principe in gesetzmässiger Freiheit kräftig und consequent entwickelt
haben, und zwischen solchen, die sich dieses Vorzuges nicht rühmen
können. Die ersten sind die gelungenen Früchte des in mannigfaltiger
Bestrebung im Menschengeschlecht wuchernden Sprachtriebes. Die
letzten haben eine abweichende Form, in welcher zwei Dinge zusammentreffen,
Mangel an Stärke des ursprünglich immer im Menschen
rein liegenden Sprachsinnes und eine einseitige, aus dem Umstände entspringende
Verbildung, dass an eine nicht aus der Sprache nothwendig
herfliessende Lautform andere, durch sie an sich gerissene angeschlossen
werden.
Die obigen Untersuchungen geben einen Leitfaden an die Hand, dies
in den wirklichen Sprachen, wie sehr man auch anfangs in ihnen eine
verwirrende Menge von Einzelnheiten zu sehen glaubt, zu erforschen
und in einfacher Gestalt darzustellen. Denn wir haben gesucht zu zeigen,
407worauf es in den höchsten Principien ankommt, und dadurch
Punkte festzustellen, zu welchen sich die Sprachzergliederung erheben
kann. Wie auch diese Bahn noch wird erhellt und geebnet werden können,
so begreift man die Möglichkeit, in jeder Sprache die Form aufzufinden,
aus welcher die Beschaffenheit ihres Baues fliesst, und sieht nun
in dem eben Entwickelten den Massstab ihrer Vorzüge und ihrer Mängel.
Wenn es mir gelungen ist, die Flexionsmethode in ihrer ganzen Vollständigkeit
zu schildern, wie sie allein dem Worte vor dem Geiste und
dem Ohre die wahre innere Festigkeit verleiht und zugleich mit Sicherheit
die Theile des Satzes, der nothwendigen Gedankenverschlingung
gemäss, auseinander wirft, so bleibt es unzweifelhaft, dass sie ausschliesslich
das reine Princip des Sprachbaues in sich bewahrt. Da sie
jedes Element der Rede in seiner zwiefachen Geltung, seiner objectiven
Bedeutung und seiner subjectiven Beziehung auf den Gedanken und die
Sprache nimmt und dies Doppelte in seinem verhältnissmässigen Gewichte
durch darnach zugerichtete Lautformen bezeichnet, so steigert
sie das ursprünglichste Wesen der Sprache, die Articulation und die
Symbolisirung, zu ihren höchsten Graden. Es kann daher nur die Frage
seyn, in welchen Sprachen diese Methode am consequentesten, vollständigsten
und freiesten bewahrt ist. Den Gipfel hierin mag keine
wirkliche Sprache erreicht haben. Allein einen Unterschied des Grades
sahen wir oben zwischen den Sanskritischen und Semitischen Sprachen:
in den letzteren die Flexion in ihrer wahrsten und unverkennbarsten
Gestalt und verbunden mit der feinsten Symbolisirung, allein nicht
durchgeführt durch alle Theile der Sprache und beschränkt durch mehr
oder minder zufällige Gesetze, die zweisylbige Wortform, die ausschliesslich
zu Flexionsbezeichnung verwendeten Vocale, die Scheu vor
Zusammensetzung; in den ersteren die Flexion durch die Festigkeit der
Worteinheit von jedem Verdachte der Agglutination gerettet, durch alle
Theile der Sprache durchgeführt und in der höchsten Freiheit in ihr
waltend.
Verglichen mit dem einverleibenden und ohne wahre Worteinheit
lose anfügenden Verfahren, erscheint die Flexionsmethode als ein geniales,
aus der wahren Intuition der Sprache hervorgehendes Princip.
Denn indem solche Sprachen ängstlich bemüht sind, das Einzelne zum
Satz zu vereinigen oder den Satz gleich auf einmal vereint darzustellen,
stempelt sie unmittelbar den Theil der jedesmaligen Gedankenfügung
gemäss und kann, ihrer Natur nach, in der Rede gar nicht sein Verhältniss
zu dieser von ihm trennen. Schwäche des sprachbildenden Triebes
lässt bald, wie im Chinesischen, die Flexionsmethode nicht in den Laut
übergehen, bald, wie in den Sprachen, welche einzeln ein Einverleibungsverfahren
befolgen, nicht frei und allein vorwalten. Die Wirkung
408des reinen Princips kann aber auch zugleich durch einseitige Verbildung
gehemmt werden, wenn eine einzelne Bildungsform, wie z.B. im
Malayischen die Bestimmung des Verbum durch modificirende Praefixe
bis zur Vernachlässigung aller andren herrschend wird.
Wie verschieden aber auch die Abweichungen von dem reinen Principe
seyn mögen, so wird man jede Sprache doch immer darnach charakterisiren
können, inwiefern in ihr der Mangel von Beziehungs-Bezeichnungen,
das Streben, solche hinzuzufügen und zu Beugungen zu
erheben, und der Nothbehelf, als Wort zu stempeln, was die Rede als
Satz darstellen sollte, sichtbar ist. Aus der Mischung dieser Principe
wird das Wesen einer solchen Sprache hervorgehen, allein in der Regel
sich aus der Anwendung derselben eine noch individuellere Form entwickeln.
Denn wo die volle Energie der leitenden Kraft nicht das richtige
Gleichgewicht bewahrt, da erlangt leicht ein Theil der Sprache vor
dem andren ungerechterweise eine unverhältnissmässige Ausbildung.
Hieraus und aus anderen Umständen können einzelne Trefflichkeiten
auch in Sprachen entstehen, in welchen man sonst nicht gerade den
Charakter erkennen kann, vorzüglich geeignete Organe des Denkens zu
seyn. Niemand kann läugnen, dass das Chinesische des alten Styls dadurch,
dass lauter gewichtige Begriffe unmittelbar an einander treten,
eine ergreifende Würde mit sich führt und dadurch eine einfache Grosse
erhält, dass es gleichsam, mit Abwerfung aller unnützen Nebenbeziehungen,
nur zum reinen Gedanken vermittelst der Sprache zu entfliehen
scheint. Das eigentlich Malayische wird wegen seiner Leichtigkeit
und der grossen Einfachheit seiner Fügungen nicht mit Unrecht gerühmt.
Die Semitischen Sprachen bewahren eine bewundernswürdige
Kunst in der feinen Unterscheidung der Bedeutsamkeit vieler Vocalabstufungen.
Das Vaskische besitzt im Wortbau und in der Redefügung
eine besondere, aus der Kürze und der Kühnheit des Ausdrucks hervorgehende
Kraft. Die Delaware-Sprache und auch andre Amerikanische
verbinden mit einem einzigen Wort eine Zahl von Begriffen, zu deren
Ausdruck wir vieler bedürfen würden. Alle diese Beispiele beweisen
aber nur, dass der menschliche Geist, in welche Bahn er sich auch einseitig
wirft, immer etwas Grosses und auf ihn befruchtend und begeisternd
Zurückwirkendes hervorzubringen vermag. Ueber den Vorzug
der Sprachen vor einander entscheiden diese einzelnen Punkte nicht.
Der wahre Vorzug einer Sprache ist nur der, sich aus einem Princip und
in einer Freiheit zu entwickeln, die es ihr möglich machen, alle intellectuelle
Vermögen des Menschen in reger Thätigkeit zu erhalten, ihnen
zum genügenden Organ zu dienen und durch die sinnliche Fülle und
geistige Gesetzmässigkeit, welche sie bewahrt, ewig anregend auf sie
einzuwirken. In dieser formalen Beschaffenheit liegt Alles, was sich
wohlthätig für den Geist aus der Sprache entwickeln lässt. Sie ist das
409Bett, in welchem er seine Wogen im sichren Vertrauen fortbewegen
kann, dass die Quellen, welche sie ihm zuführt, niemals versiegen werden.
Denn wirklich schwebt er auf ihr, wie auf einer unergründlichen
Tiefe, aus der er aber immer mehr zu schöpfen vermag, je mehr ihm
schon daraus zugeflossen ist. Diesen formalen Massstab also kann man
allein an die Sprachen anlegen, wenn man sie unter eine allgemeine Vergleichung
zu bringen versucht.
Charakter der Sprachen
31. Mit dem grammatischen Baue, wie wir ihn bisher im Ganzen und
Grossen betrachtet haben, und der äusserlichen Structur der Sprache
überhaupt ist jedoch ihr Wesen bei weitem nicht erschöpft und ihr eigentlicher
und wahrer Charakter beruht noch auf etwas viel Feinerem,
tiefer Verborgenem und der Zergliederung weniger Zugänglichem. Immer
aber bleibt jenes, vorzugsweise bis hierher Betrachtete die
nothwendige, sichernde Grundlage, in welcher das Feinere und Edlere
Wurzel fassen kann. Um dies deutlicher darzustellen, ist es nothwendig,
einen Augenblick wieder auf den allgemeinen Entwicklungsgang der
Sprachen zurückzublicken. In der Periode der Formenbildung sind die
Nationen mehr mit der Sprache, als mit dem Zwecke derselben, mit
dem, was sie bezeichnen sollen, beschäftigt. Sie ringen mit dem Gedankenausdruck
und dieser Drang, verbunden mit der begeisternden Anregung
des Gelungenen, bewirkt und erhält ihre schöpferische Kraft. Die
Sprache entsteht, wenn man sich ein Gleichniss erlauben darf, wie in
der physischen Natur ein Krystall an den andren anschiesst Die Bildung
geschieht allmählich, aber nach einem Gesetz. Diese anfänglich
stärker vorherrschende Richtung auf die Sprache, als auf die lebendige
Erzeugung des Geistes liegt in der Natur der Sache; sie zeigt sich aber
auch an den Sprachen selbst, die, je ursprünglicher sie sind, desto reichere
Formenfülle besitzen. Diese schiesst in einigen sichtbar über das
Bedürniss des Gedanken über und mässigt sich daher in den Umwandlungen,
welche die Sprachen gleichen Stammes unter dem Einfluss reiferer
Geistesbildung erfahren. Wenn diese Krystallisation geendigt ist,
steht die Sprache gleichsam fertig da. Das Werkzeug ist vorhanden und
es fällt nun dem Geiste anheim, es zu gebrauchen und sich hineinzubauen.
Dies geschieht in der That und durch die verschiedene Weise,
wie er sich durch dasselbe ausspricht, empfängt die Sprache Farbe und
Charakter.
Man würde indess sehr irren, wenn man, was ich hier mit Absicht
zur deutlichen Unterscheidung grell von einander gesondert habe, auch
in der Natur für so geschieden halten wollte. Auch auf die wahre Structur
410der Sprache und den eigentlichen Formenbau hat die fortwährende
Arbeit des Geistes in ihrem Gebrauche einen bestimmten und fortlaufenden
Einfluss; nur ist derselbe feiner und entzieht sich bisweilen dem
ersten Anblick. Auch kann man keine Periode des Menschengeschlechtes
oder eines Volkes als ausschliesslich und absichtlich sprachentwickelnd
ansehen. Die Sprache wird durch Sprechen gebildet und das
Sprechen ist Ausdruck des Gedanken oder der Empfindung. Die Denk-
und Sinnesart eines Volkes, durch welche, wie ich eben sagte, seine
Sprache Farbe und Charakter erhält, wirkt schon von den ersten Anfängen
auf dieselbe ein. Dagegen ist es gewiss, dass, je weiter eine Sprache
in ihrer grammatischen Structur vorgerückt ist, sich immer weniger Fälle
ergeben, welche einer neuen Entscheidung bedürfen. Das Ringen mit
dem Gedankenausdruck wird daher geringer, und je mehr sich der Geist
nur des schon Geschaffenen bedient, desto mehr erschlafft sein schöpferischer
Trieb und mit ihm auch seine schöpferische Kraft. Auf der andren
Seite wächst die Menge des in Lauten hervorgebrachten Stoffs und
diese nun auf den Geist zurückwirkende äussere Masse macht ihre
eigenthümlichen Gesetze geltend und hemmt die freie und selbstständige
Einwirkung der Intelligenz. In diesen zwei Punkten liegt dasjenige,
was in dem oben erwähnten Unterschiede nicht der subjectiven Ansicht,
sondern dem wirklichen Wesen der Sache angehört. Man muss
also, um die Verflechtung des Geistes in die Sprache genauer zu verfolgen,
dennoch den grammatischen und lexicalischen Bau der letzteren
gleichsam als den festen und äusseren von dem inneren Charakter unterscheiden,
der wie eine Seele in ihr wohnt und die Wirkung hervorbringt,
mit welcher uns jede Sprache, so wie wir nur anfangen, ihrer
mächtig zu werden, eigenthümlich ergreift. Es ist damit auf keine Weise
gemeint, dass diese Wirkung dem äusseren Baue fremd sey. Das individuelle
Leben der Sprache erstreckt sich durch alle Fibern derselben und
durchdringt alle Elemente des Lautes. Es soll nur darauf aufmerksam
gemacht werden, dass jenes Reich der Formen nicht das einzige Gebiet
ist, das der Sprachforscher zu bearbeiten hat, und dass er wenigstens
nicht verkennen muss, dass es noch etwas Höheres und Ursprünglicheres
in der Sprache giebt, von dem er, wo das Erkennen nicht mehr ausreicht,
doch das Ahnden in sich tragen muss. In Sprachen eines weit
verbreiteten und vielfach getheilten Stammes lässt sich das hier Gesagte
mit einfachen Beispielen belegen. Sanskrit, Griechisch und Lateinisch
haben eine nahe verwandte und in sehr vielen Stücken gleiche Organisation
der Wortbildung und der Redefügung. Jeder aber fühlt die Verschiedenheit
ihres individuellen Charakters, die nicht bloss eine, in der
Sprache sichtbar werdende des Charakters der Nationen ist, sondern,
tief in die Sprachen selbst eingewachsen, den eigenthümlichen Bau jeder
bestimmt. Ich werde daher bei diesem Unterschiede zwischen dem
411Principe, aus welchem sich nach dem Obigen die Structur der Sprache
entwickelt, und dem eigentlichen Charakter dieser hier noch verweilen
und schmeichle mir, sicher seyn zu können, dass dieser Unterschied
weder als zu schneidend angesehen noch auf der andren Seite als bloss
subjectiv verkannt werde.
Um den Charakter der Sprachen, insofern wir ihn dem Organismus
entgegensetzen, genauer zu betrachten, müssen wir auf den Zustand
nach Vollendung ihres Baues sehen. Das freudige Staunen über die
Sprache selbst, als ein immer neues Erzeugniss des Augenblicks mindert
sich allmählich. Die Thätigkeit der Nation geht von der Sprache
mehr auf ihren Gebrauch über und diese beginnt mit dem eigenthümlichen
Volksgeiste eine Laufbahn, in der keiner beider Theile sich von
dem andren unabhängig nennen kann, jeder aber sich der begeisternden
Hülfe des andren erfreut. Die Bewunderung und das Gefallen wenden
sich nun zu Einzelnem, glücklich Ausgedrücktem. Lieder, Gebetsformeln,
Sprüche, Erzählungen erregen die Begierde, sie der Flüchtigkeit
des vorübereilenden Gesprächs zu entreissen, werden aufbewahrt, umgeändert
und nachgebildet. Sie werden die Grundlagen der Literatur
und diese Bildung des Geistes und der Sprache geht allmählich von der
Gesammtheit der Nation auf Individuen über und die Sprache kömmt
in die Hände der Dichter und Lehrer des Volkes, welchen sich dieses
nach und nach gegenüberstellt. Dadurch gewinnt die Sprache eine
zwiefache Gestalt, aus welcher, so lange der Gegensatz sein richtiges
Verhältniss behält, für sie zwei sich gegenseitig ergänzende Quellen der
Kraft und der Läuterung entspringen.
Neben diesen lebendig in ihren Werken die Sprache gestaltenden
Bildnern stehen dann die eigentlichen Grammatiker auf und legen die
letzte Hand an die Vollendung des Organismus. Es ist nicht ihr Geschäft,
zu schaffen; durch sie kann in einer Sprache, der es sonst daran
fehlt, weder Flexion noch Verschlingung der End- und Anfangslaute
volksmässig werden. Aber sie werfen aus, verallgemeinern, ebnen Ungleichheiten
und füllen übrig gebliebene Lücken. Von ihnen kann man
mit Recht in Flexionssprachen das Schema der Conjugationen und
Declinationen herleiten, indem sie erst die Totalität der darunter begriffenen
Fälle zusammengestellt vor das Auge bringen. In diesem Gebiete
werden sie, indem sie selbst aus dem unendlichen Schatze der vor ihnen
liegenden Sprache, schöpfen, gesetzgebend. Da sie eigentlich zuerst
den Begriff solcher Schemata in das Bewusstseyn einführen, so können
dadurch Formen, die alles eigentlich Bedeutsame verloren haben, bloss
durch die Stelle, die sie in dem Schema einnehmen, wieder bedeutsam
werden. Solche Bearbeitungen einer und derselben Sprache können in
verschiedenen Epochen auf einander folgen; immer aber muss, wenn
die Sprache zugleich volksthümlich und gebildet bleiben soll, die Regelmässigkeit
412ihrer Strömung von dem Volke zu den Schriftstellern und
Grammatikern und von diesen zurück zu dem Volke ununterbrochen
fortrollen.
So lange der Geist eines Volks in lebendiger Eigenthümlichkeit in
sich und auf seine Sprache fortwirkt, erhält diese Verfeinerungen und
Bereicherungen, die wiederum einen anregenden Einfluss auf den Geist
ausüben. Es kann aber auch hier in der Folge der Zeit eine Epoche eintreten,
wo die Sprache gleichsam den Geist überwächst und dieser in
eigner Erschlaffung, nicht mehr selbstschöpferisch, mit ihren aus wahrhaft
sinnvollem Gebrauch hervorgegangenen Wendungen und Formen
ein immer mehr leeres Spiel treibt. Dies ist dann ein zweites Ermatten
der Sprache, wenn man das Absterben ihres äusseren Bildungstriebes
als das erste ansieht. Bei dem zweiten welkt die Blüthe des Charakters,
von diesem aber können Sprachen und Nationen wieder durch den Genius
einzelner grosser Männer geweckt und emporgerissen werden.
Ihren Charakter entwickelt die Sprache vorzugsweise in den Perioden
ihrer Literatur und in der vorbereitend zu dieser hinführenden.
Denn sie zieht sich alsdann mehr von den Alltäglichkeiten des materiellen
Lebens zurück und erhebt sich zu reiner Gedankenentwicklung und
freier Darstellung. Es scheint aber wunderbar, dass die Sprachen ausser
demjenigen, den ihnen ihr äusserer Organismus giebt, sollten einen eigenthümlichen
Charakter besitzen können, da jede bestimmt ist, den
verschiedensten Individualitäten zum Werkzeug zu dienen. Denn ohne
des Unterschiedes der Geschlechter und des Alters zu gedenken, so umschliesst
eine Nation wohl alle Nuancen menschlicher Eigenthümlichkeit.
Auch diejenigen, die, von derselben Richtung ausgehend, das gleiche
Geschäft treiben, unterscheiden sich in der Art es zu ergreifen und
auf sich zurückwirken zu lassen. Diese Verschiedenheit wächst aber
noch für die Sprache, da diese in die geheimsten Falten des Geistes und
des Gemüthes eingeht. Jeder nun braucht dieselbe zum Ausdruck seiner
besondersten Eigenthümlichkeit; denn sie geht immer von dem Einzelnen
aus und jeder bedient sich ihrer zunächst nur für sich selbst. Dennoch
genügt sie jedem dazu, insofern überhaupt immer dürftig bleibende
Worte dem Drange des Ausdrucks der innersten Gefühle zusagen. Es
lässt sich auch nicht behaupten, dass die Sprache, als allgemeines Organ,
diese Unterschiede mit einander ausgleicht. Sie baut wohl Brücken
von einer Individualität zur andren und vermittelt das gegenseitige Verständniss;
den Unterschied selbst aber vergrössert sie eher, da sie durch
die Verdeutlichung und Verfeinerung der Begriffe klarer ins Bewusstseyn
bringt, wie er seine Wurzeln in die ursprüngliche Geistesanlage
schlägt. Die Möglichkeit, so verschiedenen Individualitäten zum Ausdruck
zu dienen, scheint daher eher in ihr selbst vollkommene Charakterlosigkeit
vorauszusetzen, die sie doch aber sich auf keine Weise zu
413Schulden kommen lässt. Sie umfasst in der That die beiden entgegengesetzten
Eigenschaften, sich als Eine Sprache in derselben Nation in unendlich
viele zu theilen und als diese vielen gegen die Sprachen andrer
Nationen mit bestimmtem Charakter als Eine zu vereinigen. Wie verschieden
jeder dieselbe Muttersprache nimmt und gebraucht, findet
man, wenn es nicht schon das gewöhnliche Leben deutlich zeigte, in der
Vergleichung bedeutender Schriftsteller, deren jeder sich seine eigne
Sprache bildet. Die Verschiedenheit des Charakters mehrerer Sprachen
ergiebt sich aber beim ersten Anblick, wie z. B. beim Sanskrit, dem
Griechischen und Lateinischen aus ihrer Vergleichung.
Untersucht man nun genauer, wie die Sprache diesen Gegensatz vereinigt,
so liegt die Möglichkeit, den verschiedensten Individualitäten
zum Organe zu dienen, in dem tiefsten Wesen ihrer Natur. Ihr Element,
das Wort, bei dem wir der Vereinfachung wegen stehen bleiben können,
theilt nicht, wie eine Substanz, etwas schon Hervorgebrachtes mit,
enthält auch nicht einen schon geschlossenen Begriff, sondern regt
bloss an, diesen mit selbstständiger Kraft, nur auf bestimmte Weise zu
bilden. Die Menschen verstehen einander nicht dadurch, dass sie sich
Zeichen der Dinge wirklich hingeben, auch nicht dadurch, dass sie sich
gegenseitig bestimmen, genau und vollständig denselben Begriff hervorzubringen,
sondern dadurch, dass sie gegenseitig in einander dasselbe
Glied der Kette ihrer sinnlichen Vorstellungen und inneren Begriffserzeugungen
berühren, dieselbe Taste ihres geistigen Instruments
anschlagen, worauf alsdann in jedem entsprechende, nicht aber dieselben
Begriffe hervorspringen. Nur in diesen Schranken und mit diesen
Divergenzen kommen sie auf dasselbe Wort zusammen. Bei der Nennung
des gewöhnlichsten Gegenstandes, z.B. eines Pferdes meinen sie
alle dasselbe Thier, jeder aber schiebt dem Worte eine andere Vorstellung,
sinnlicher oder rationeller, lebendiger, als einer Sache oder näher
den todten Zeichen u. s.f. unter. Daher entstehen in der Periode.der
Sprachbildung in einigen Sprachen die Menge der Ausdrücke für denselben
Gegenstand. Es sind ebenso viele Eigenschaften, unter welchen
er gedacht worden ist und deren Ausdruck man an seine Stelle gesetzt
hat. Wird nun aber auf diese Weise das Glied der Kette, die Taste des
Instrumentes berührt, so erzittert das Ganze, und was, als Begriff aus
der Seele hervorspringt, steht in Einklang mit allem, was das einzelne
Glied bis auf die weiteste Entfernung umgiebt. Die von dem Worte in
Verschiedenen geweckte Vorstellung trägt das Gepräge der Eigenthümlichkeit
eines jeden, wird aber von allen mit demselben Laute bezeichnet.
Die sich innerhalb derselben Nation befindenden Individualitäten
umschliesst aber die nationelle Gleichförmigkeit, die wiederum jede
einzelne Sinnesart von der ihr ähnlichen in einem andren Volke unterscheidet.
414Aus dieser Gleichförmigkeit und aus der besonderen, jeder
Sprache eignen Anregung entspringt der Charakter der letzteren. Jede
Sprache empfängt eine bestimmte Eigenthümlichkeit durch die der Nation
und wirkt gleichförmig bestimmend auf diese zurück. Der nationelle
Charakter wird zwar durch Gemeinschaft des Wohnplatzes und des
Wirkens unterhalten, verstärkt, ja bis zu einem gewissen Grad hervorgebracht;
eigentlich aber beruht er auf der Gleichheit der Naturanlage,
die man gewöhnlich aus Gemeinschaft der Abstammung erklärt. In dieser
liegt auch gewiss das undurchdringliche Geheimniss der tausendfältig
verschiedenen Verknüpfung des Körpers mit der geistigen Kraft,
welche das Wesen jeder menschlichen Individualität ausmacht. Es kann
nur die Frage seyn, ob es keine andere Erklärungsweise der Gleichheit
der Naturanlagen geben könne? und auf keinen Fall darf man hier die
Sprache ausschliessen. Denn in ihr ist die Verbindung des Lautes mit
seiner Bedeutung etwas mit jener Anlage gleich Unerforschliches.
Mann kann Begriffe spalten, Wörter zergliedern, so weit man es vermag,
und man tritt darum dem Geheimniss nicht näher, wie eigentlich
der Gedanke sich mit dem Worte verbindet. In ihrer ursprünglichsten
Beziehung auf das Wesen der Individualität sind also der Grund aller
Nationalität und die Sprache einander unmittelbar gleich. Allein die
letztere wirkt augenscheinlicher und stärker darauf ein und der Begriff
einer Nation muss vorzugsweise auf sie gegründet werden. Da die Entwicklung
seiner menschlichen Natur im Menschen von der der Sprache
abhängt, so ist durch diese unmittelbar selbst der Begriff der Nation als
der eines auf bestimmte Weise sprachbildenden Menschenhaufens gegeben.
Die Sprache aber besitzt auch die Kraft, zu entfremden und einzuverleiben,
und theilt durch sich selbst den nationellen Charakter, auch
bei verschiedenartiger Abstammung, mit. Dies unterscheidet namentlich
eine Familie und eine Nation. In der ersteren ist unter den Gliedern
factisch erkennbare Verwandtschaft; auch kann dieselbe Familie in
zwei verschiedenen Nationen fortblühen. Bei den Nationen kann es
noch zweifelhaft scheinen und macht bei weit verbreiteten Stämmen
eine wichtige Betrachtung aus, ob alle dieselben Sprachen Redenden
einen gemeinschaftlichen Ursprung haben oder ob diese ihre Gleichförmigkeit
aus uranfänglicher Naturanlage, verbunden mit Verbreitung
über einen gleichen Erdstrich, unter dem Einfluss gleichförmig wirkender
Ursachen entstanden ist? Welche Bewandtniss es aber auch mit
den, uns unerforschlichen ersten Ursachen haben möge, so ist es gewiss,
dass die Entwicklung der Sprache die nationellen Verschiedenheiten
erst in das hellere Gebiet des Geistes überführt. Sie werden durch
sie zum Bewusstseyn gebracht und erhalten von ihr Gegenstände, in
denen sie sich nothwendig ausprägen müssen, die der deutlichen Einsicht
415zugänglicher sind und an welchen zugleich die Verschiedenheiten
selbst feiner und bestimmter ausgesponnen erscheinen. Denn indem die
Sprache den Menschen bis auf den ihm erreichbaren Punkt intellectualisirt,
wird immer mehr der dunklen Region der unentwickelten Empfindung
entzogen. Dadurch nun erhalten die Sprachen, welche die
Werkzeuge dieser Entwicklung sind, selbst einen so bestimmten Charakter,
dass der der Nation besser an ihnen, als an den Sitten, Gewohnheiten
und Thaten jener erkannt werden kann. Es entspringt hieraus,
wenn Völker, welchen eine Literatur mangelt und in deren Sprachgebrauch
wir nicht tief genug eindringen, uns oft gleichförmiger erscheinen,
als sie sind. Wir erkennen nicht die sie unterscheidenden Züge,
weil nicht das Medium sie uns zuführt, das sie uns sichtbar machen
würde.
Wenn man den Charakter der Sprachen von ihrer äusseren Form,
unter welcher allein eine bestimmte Sprache gedacht werden kann, absondert
und beide einander gegenüberstellt, so besteht er in der Art der
Verbindung des Gedanken mit den Lauten. Er ist, in diesem Sinne genommen,
gleichsam der Geist, der sich in der Sprache einheimisch
macht und sie, wie einen aus ihm herausgebildeten Körper beseelt. Er
ist eine natürliche Folge der fortgesetzten Einwirkung der geistigen Eigenthümlichkeit
der Nation. Indem diese die allgemeinen Bedeutungen
der Wörter immer auf dieselbe individuelle Weise aufnimmt und mit
den gleichen Nebenideen und Empfindungen begleitet, nach denselben
Richtungen hin Ideenverbindungen eingeht und sich der Freiheit der
Redefügungen in demselben Verhältniss bedient, in welchem das Mass
ihrer intellectuellen Kühnheit zu der Fähigkeit ihres Verständnisses
steht, ertheilt sie der Sprache eine eigenthümliche Farbe und Schattirung,
welche diese fixirt und so in demselben Gleise zurückwirkt. Aus
jeder Sprache lässt sich daher auf den Nationalcharakter zurückschliessen.
Auch die Sprachen roher und ungebildeter Völker tragen diese
Spuren in sich und lassen dadurch oft Blicke in intellectuelle Eigenthümlichkeiten
werfen, die man auf dieser Stufe mangelnder Bildung
nicht erwarten sollte. Die Sprachen der Amerikanischen Eingebornen
sind reich an Beispielen dieser Gattung, an kühnen Metaphern, richtigen,
aber unerwarteten Zusammenstellungen von Begriffen, an Fällen,
wo leblose Gegenstände durch eine sinnreiche Ansicht ihres auf die
Phantasie wirkenden Wesens in die Reihe der lebendigen versetzt werden,
u. s. f. Denn da diese Sprachen grammatisch nicht den Unterschied
der Geschlechter, wohl aber und in sehr ausgedehntem Umfange den
lebloser und lebendiger Gegenstände beachten, so geht ihre Ansicht
hiervon aus der grammatischen Behandlung hervor. Wenn sie die Gestirne
mit dem Menschen und den Thieren grammatisch in dieselbe
Classe versetzen, so sehen sie offenbar die ersteren als sich durch eigne
416Kraft bewegende und wahrscheinlich auch als die menschlichen
Schicksale von oben herab leitende, mit Persönlichkeit begabte Wesen
an. In diesem Sinn die Wörterbücher der Mundarten solcher Völker
durchzugehen, gewährt ein eignes, auf die mannigfaltigsten Betrachtungen
führendes Vergnügen, und wenn man zugleich bedenkt, dass die
Versuche beharrlicher Zergliederung der Formen solcher Sprachen, wie
wir im Vorigen gesehen haben, die geistige Organisation entdecken lassen,
aus welcher ihr Bau entspringt, so verschwindet alles Trockne und
Nüchterne aus dem Sprachstudium. In jedem seiner Theile führt es zu
der inneren geistigen Gestaltung zurück, welche alle Menschenalter
hindurch die Trägerin der tiefsten Ansichten, der reichsten Gedankenfülle
und der edelsten Gefühle ist.
Bei den Völkern aber, bei denen wir nur in den einzelnen Elementen
ihrer Sprache die Kennzeichen ihrer Eigenthümlichkeit auffinden können,
lässt sich selten oder nie ein zusammenhängendes Bild von der
letzteren entwerfen. Wenn dies überall ein schwieriges Geschäft ist, so
wird es nur da wahrhaft möglich, wo Nationen in einer mehr oder weniger
ausgedehnten Literatur ihre Weltansicht niedergelegt und in zusammenhängender
Rede der Sprache eingeprägt haben. Denn die Rede enthält
auch in Absicht der Geltung ihrer einzelnen Elemente und in den
Nuancen ihrer Fügungen, die sich nicht gerade auf grammatische Regeln
zurückführen lassen, unendlich viel, was, wenn sie in die einzelnen
Elemente zerschlagen ist, nicht mehr an diesen erkennbar zu haften vermag.
Ein Wort hat meistentheils seine vollständige Geltung erst durch
die Verbindung, in der es erscheint. Diese Gattung der Sprachforschung
erfordert daher eine kritisch genaue Bearbeitung der in einer
Sprache vorhandenen schriftlichen Denkmäler und findet einen meisterhaft
vorbereiteten Stoff in der philologischen Behandlung der Griechischen
und Lateinischen Schriftsteller. Denn wenn auch immer bei
dieser das Studium der ganzen Sprache selbst der höchste Gesichtspunkt
ist, so geht sie dennoch zunächst von den in ihr übrigen Denkmälern
aus, strebt, dieselben in möglichster Reinheit und Treue herzustellen
und zu bewahren und sie zu zuverlässiger Kenntniss des Alterthums
zu benutzen. So enge auch die Zergliederung der Sprache, die Aufsuchung
ihres Zusammenhanges mit verwandten und die nur auf diesem
Wege erreichbare Erklärung ihres Baues mit der Bearbeitung der
Sprachdenkmäler verbunden bleiben muss, so sind es doch sichtbar
zwei verschiedene Riehtungen des Sprachstudiums, die verschiedene
Talente erfordern und unmittelbar auch verschiedene Resultate hervorbringen.
Es wäre vielleicht nicht unrichtig, auf diese Weise Linguistik
und Philologie zu unterscheiden und ausschliesslich der letzteren die
engere Bedeutung zu geben, die man bisher damit zu verbinden pflegte,
die man aber in den letztverflossenen Jahren, besonders in Frankreich
417und England auf jede Beschäftigung mit irgend einer Sprache ausgedehnt
hat. Gewiss ist es wenigstens, dass die Sprachforschung, von welcher
hier die Rede ist, sich nur auf eine in dem hier aufgestellten Sinne
wahrhaft philologische Behandlung der Sprachdenkmäler stützen kann.
Indem die grossen Männer, welche dies Fach der Gelehrsamkeit in den
letzten Jahrhunderten verherrlicht haben, mit gewissenhafter Treue und
bis zu den kleinsten Modificationen des Lautes herab den Sprachgebrauch
jedes Schriftstellers feststellen, zeigt sich die Sprache beständig
unter dem beherrschenden Einfluss geistiger Individualität und gewährt
eine Ansicht dieses Zusammenhanges, durch die es zugleich möglich
wird, die einzelnen Punkte aufzusuchen, an welchen er haftet. Man
lernt zugleich, was dem Zeitalter, der Localität und dem Individuum
angehört und wie die allgemeine Sprache alle diese Unterschiede umfasst.
Das Erkennen der Einzelnheiten aber ist immer von dem Eindruck
eines Ganzen begleitet, ohne dass die Erscheinung durch Zergliedrung
etwas an ihrer Eigenthümlichkeit verliert.
Sichtbar wirkt auf die Sprache nicht bloss die ursprüngliche Anlage
der Nationaleigenthümlichkeit ein, sondern jede durch die Zeit herbeigeführte
Abänderung der inneren Richtung und jedes äussere Ereigniss,
welches die Seele und den Geistesschwung der Nation hebt oder niederdrückt,
vor allem aber der Impuls ausgezeichneter Köpfe. Ewige Vermittlerin
zwischen dem Geiste und der Natur, bildet sie sich nach jeder
Abstufung des ersteren um, nur dass die Spuren davon immer feiner
und schwieriger im Einzelnen zu entdecken werden und die Thatsache
sich nur im Totaleindruck offenbart. Keine Nation könnte die Sprache
einer andren mit dem ihr selbst eignen Geiste beleben und befruchten,
ohne sie eben dadurch zu einer verschiedenen umzubilden. Was aber
schon weiter oben von aller Individualität bemerkt worden ist, gilt auch
hier. Darum, dass unter verschiedenen jede, weil sie Eine bestimmte
Bahn verfolgt, alle andren ausschliesst, können dennoch mehrere in einem
allgemeinen Ziele zusammentreffen. Der Charakterunterschied
der Sprachen braucht daher nicht nothwendig in absoluten Vorzügen
der einen vor der andren zu bestehen. Die Einsicht in die Möglichkeit
der Bildung eines solchen Charakters erfordert aber noch eine genauere
Betrachtung des Standpunktes, aus dem eine Nation ihre Sprache innerlich
behandeln muss, um ihr ein solches Gepräge aufzudrücken.
Wenn eine Sprache bloss und ausschliesslich zu den Alltagsbedürfnissen
des Lebens gebraucht würde, so gälten die Worte bloss als Repräsentanten
des auszudrückenden Entschlusses oder Begehrens und es
wäre von einer inneren, die Möglichkeit einer Verschiedenheit zulassenden
Auffassung gar nicht in ihr die Rede. Die materielle Sache oder
Handlung träte in der Vorstellung des Sprechenden und Erwiedernden
sogleich und unmittelbar an die Stelle des Wortes. Eine solche wirkliche
418Sprache kann es nun glücklicherweise unter immer doch denkenden
und empfindenden Menschen nicht geben. Es liessen sich höchstens mit
ihr die Sprachmischungen vergleichen, welche der Verkehr unter Personen
von ganz verschiedenen Nationen und Mundarten hier und dort,
vorzüglich in Seehäfen, wie die lingua franca an den Küsten des Mittelmeeres,
bildet. Ausserdem behaupten die individuelle Ansicht und das
Gefühl immer zugleich ihre Rechte. Ja es ist sogar sehr wahrscheinlich,
dass der erste Gebrauch der Sprache, wenn man bis zu demselben hinaufzusteigen
vermöchte, ein blosser Empfindungsausdruck gewesen
sey. Ich habe mich schon weiter oben (VII 60.) gegen die Erklärung des
Ursprungs der Sprachen aus der Hülflosigkeit des Einzelnen ausgesprochen.
Nicht einmal der Trieb der Geselligkeit entspringt unter den Geschöpfen
aus der Hülflosigkeit. Das stärkste Thier, der Elephant, ist zugleich
das geselligste. Ueberall in der Natur entwickelt sich Leben und
Thätigkeit aus innerer Freiheit, deren Urquell man vergeblich im Gebiete
der Erscheinungen sucht. In jeder Sprache aber, auch der am höchsten
gebildeten kommt einzeln der hier erwähnte Gebrauch derselben
vor. Wer einen Baum zu fällen befiehlt, denkt sich nichts, als den bezeichneten
Stamm bei dem Worte; ganz anders aber ist es, wenn dasselbe,
auch ohne Beiwort und Zusatz, in einer Naturschilderung oder
einem Gedichte erscheint. Die Verschiedenheit der auffassenden Stimmung
giebt denselben Lauten eine auf verschiedene Weise gesteigerte
Geltung und es ist, als wenn bei jedem Ausdruck etwas durch ihn nicht
absolut Bestimmtes gleichsam überschwankte.
Dieser Unterschied liegt sichtbar darin, ob die Sprache auf ein inneres
Ganzes des Gedankenzusammenhanges und der Empfindung
bezogen oder mit vereinzelter Seelenthätigkeit einseitig zu einem abgeschlossnen
Zwecke gebraucht wird. Von dieser Seite wird sie ebensowohl
durch bloss wissenschaftlichen Gebrauch, wenn dieser nicht unter
dem leitenden Einfluss höherer Ideen steht, als durch das Alltagsbedürfniss
des Lebens, ja, da sich diesem Empfindung und Leidenschaft beimischen,
noch stärker beschränkt. Weder in den Begriffen noch in der
Sprache selbst steht irgend etwas vereinzelt da. Die Verknüpfungen
wachsen aber den Begriffen nur dann wirklich zu, wenn das Gemüth in
innerer Einheit thätig ist, wenn die volle Subjectivität einer vollendeten
Objectivität entgegenstrahlt. Dann wird keine Seite, von welcher der
Gegenstand einwirken kann, vernachlässigt und jede dieser Einwirkungen
lässt eine leise Spur in der Sprache zurück. Wenn in der Seele wahrhaft
das Gefühl erwacht, dass die Sprache nicht bloss ein Austauschungsmittel
zu gegenseitigem Verständniss, sondern eine wahre Welt
ist, welche der Geist zwischen sich und die Gegenstände durch die innere
Arbeit seiner Kraft setzen muss, so ist sie auf dem wahren Wege, immer
mehr in ihr zu finden und in sie zu legen.419
Wo ein solches Zusammenwirken der in bestimmte Laute eingeschlossenen
Sprache und der ihrer Natur nach immer weiter greifenden
inneren Auffassung lebendig ist, da betrachtet der Geist die Sprache,
wie sie denn in der That in ewiger Schöpfung begriffen ist, nicht als
geschlossen, sondern strebt unaufhörlich, Neues zuzuführen, um es, an
sie geheftet, wieder auf sich zurückwirken zu lassen. Dies setzt aber ein
Zwiefaches voraus, ein Gefühl, dass es etwas giebt, das die Sprache
nicht unmittelbar enthält, sondern der Geist, von ihr angeregt, ergänzen
muss, und den Trieb, wiederum alles, was die Seele empfindet, mit
dem Laut zu verknüpfen. Beides entquillt der lebendigen Ueberzeugung,
dass das Wesen des Menschen Ahndung eines Gebietes besitzt,
welches über die Sprache hinausgeht und das durch die Sprache eigentlich
beschränkt wird, dass aber wiederum sie das einzige Mittel ist, dies
Gebiet zu erforschen und zu befruchten, und dass sie gerade durch
technische und sinnliche Vollendung einen immer grösseren Theil desselben
in sich zu verwandeln vermag. Diese Stimmung ist die Grundlage
des Charakterausdrucks in den Sprachen, und je lebendiger dieselbe
in der doppelten Richtung, nach der sinnlichen Form der Sprache und
nach der Tiefe des Gemüths hin wirkt, desto klarer und bestimmter
stellt sich die Eigenthümlichkeit in der Sprache dar. Sie gewinnt gleichsam
an Durchsichtigkeit und lässt in das Innere des Sprechenden
schauen.
Dasjenige, was auf diese Weise durch die Sprache durchscheint,
kann nicht etwas einzeln, objectiv und qualitativ Andeutendes seyn.
Denn jede Sprache würde alles andeuten können, wenn das Volk, dem
sie angehört, alle Stufen seiner Bildung durchliefe. Jede hat aber einen
Theil, der entweder nur noch jetzt verborgen ist oder, wenn sie früher
untergeht, ewig verborgen bleibt. Jede ist, wie der Mensch selbst, ein
sich in der Zeit allmählich entwickelndes Unendliches. Jenes Durchschimmernde
ist daher etwas alle Andeutungen subjectiv und eher
quantitativ Modificirendes. Es erscheint darin nicht als Wirkung, sondern
die wirkende Kraft äussert sich unmittelbar als solche und eben
darum auf eine eigne, schwerer zu erkennende Weise, die Wirkungen
gleichsam nur mit ihrem Hauche umschwebend. Der Mensch stellt sich
der Welt immer in Einheit gegenüber. Es ist immer dieselbe Richtung,
dasselbe Ziel, dasselbe Mass der Bewegung, in welchen er die Gegenstände
erfasst und behandelt. Auf dieser Einheit beruht seine Individualität.
Es liegt aber in dieser Einheit ein Zwiefaches, obgleich wieder einander
Bestimmendes, nemlich die Beschaffenheit der wirkenden Kraft
und die ihrer Thätigkeit, wie sich in der Körperwelt der sich bewegende
Körper von dem Impulse unterscheidet, der die Heftigkeit, Schnelligkeit
und Dauer seiner Bewegung bestimmt. Das Erstere haben wir im
Sinn, wenn wir einer Nation mehr lebendige Anschaulichkeit und
420schöpferische Einbildungskraft, mehr Neigung zu abgezogenen Ideen
oder eine bestimmtere praktische Richtung zuschreiben, das Letztere,
wenn wir eine vor der andren heftig, veränderlich, schneller in ihrem
Ideengange, beharrender in ihren Empfindungen nennen. In Beidem
unterscheiden wir also das Seyn von dem Wirken und stellen das erstere,
als unsichtbare Ursach dem in die Erscheinung tretenden Denken,
Empfinden und Handeln gegenüber. Wir meinen aber dann nicht dieses
oder jenes einzelne Seyn des Individuums, sondern das allgemeine, das
in jedem einzelnen bestimmend hervortritt. Jede erschöpfende Charakterschilderung
muss dies Seyn als Endpunkt ihrer Forschung vor Augen
haben.
Wenn man nun die gesammte innere und äussere Thätigkeit des
Menschen bis zu ihren einfachsten Endpunkten verfolgt, so findet man
diese in der Art, wie er die Wirklichkeit als Object, das er aufnimmt,
oder als Materie, die er gestaltet, mit sich verknüpft oder auch unabhängig
von ihr sich eigene Wege bahnt. Wie tief und auf welche Weise
der Mensch in die Wirklichkeit Wurzel schlägt, ist das ursprünglich
charakteristische Merkmal seiner Individualität. Die Arten jener Verknüpfung
können zahllos seyn, je nachdem sich die Wirklichkeit oder
die Innerlichkeit, deren keine die andre ganz zu entbehren vermag, von
einander zu trennen versuchen oder sich mit einander in verschiedenen
Graden und Richtungen verbinden.
Man darf aber nicht glauben, dass ein solcher Massstab bloss bei
schon intellectuell gebildeten Nationen anwendbar sey. In den Aeusserungen
der Freude eines Haufens von Wilden wird sich unterscheiden
lassen, wie weit sich dieselbe von der blossen Befriedigung der Begierde
unterscheidet und ob sie, als ein wahrer Götterfunke, aus dem inneren
Gemüthe als wahrhaft menschliche Empfindung, bestimmt, einmal in
Gesang und Dichtung aufzublühen, hervorbricht. Wenn aber auch, wie
daran kein Zweifel seyn kann, der Charakter der Nation sich an allem
ihr wahrhaft Eigenthümlichen offenbart, so leuchtet er vorzugsweise
durch die Sprache durch. Indem sie mit allen Aeusserungen des Gemüths
verschmilzt, bringt sie schon darum das immer sich gleich bleibende,
individuelle Gepräge öfter zurück. Sie ist aber auch selbst durch
so zarte und innige Bande mit der Individualität verknüpft, dass sie immer
wieder eben solche an das Gemüth des Hörenden heften muss, um
vollständig verstanden zu werden. Die ganze Individualität des Sprechenden
wird daher von ihr in den Andren übergetragen, nicht um seine
eigne zu verdrängen, sondern um aus der fremden und eignen einen
neuen, fruchtbaren Gegensatz zu bilden.
Das Gefühl des Unterschiedes zwischen dem Stoff, den die Seele
aufnimmt und erzeugt, und der in dieser doppelten Thätigkeit treibenden
und stimmenden Kraft, zwischen der Wirkung und dem wirkenden
421Seyn, die richtige und verhältnissmässige Würdigung beider und die
gleichsam hellere Gegenwart des dem Grade nach obenan stehenden
vor dem Bewusstseyn liegt nicht gleich stark in jeder nationellen Eigenthümlichkeit.
Wenn man den Grund des Unterschiedes hiervon tiefer
untersucht, so findet man ihn in der mehr oder minder empfundenen
Nothwendigkeit des Zusammenhanges aller Gedanken und Empfindungen
des Individuums durch die ganze Zeit seines Daseyns und des
gleichen in der Natur geahndeten und geforderten. Was die Seele hervorbringen
mag, so ist es nur Bruchstück, und je beweglicher und lebendiger
ihre Thätigkeit ist, desto mehr regt sich alles, in verschiedenen
Abstufungen mit dem Hervorgebrachten Verwandte. Ueber das Einzelne
schiesst also immer etwas, minder bestimmt Auszudrückendes über
oder vielmehr an das Einzelne hängt sich die Forderung weiterer Darstellung
und Entwicklung, als in ihm unmittelbar liegt, und geht durch
den Ausdruck in der Sprache in den Andren über, der gleichsam eingeladen
wird, in seiner Auffassung das Fehlende harmonisch mit dem Gegebenen
zu ergänzen. Wo der Sinn hierfür lebendig ist, erscheint die
Sprache mangelhaft und dem vollen Ausdruck ungenügend, da im entgegengesetzten
Fall kaum die Ahndung entsteht, dass über das Gegebene
hinaus noch etwas fehlen könne. Zwischen diesen beiden Extremen
aber befindet sich eine zahllose Menge von Mittelstufen und sie selbst
gründen sich offenbar auf vorherrschende Richtung nach dem Inneren
des Gemüths und nach der äusseren Wirklichkeit.
Die Griechen, die in diesem ganzen Gebiete das lehrreichste Beispiel
abgeben, verbanden in ihrer Dichtung überhaupt, besonders aber in der
lyrischen, mit den Worten Gesang, Instrumentalmusik, Tanz und Geberde.
Dass sie dies aber nicht bloss thaten, um den sinnlichen Eindruck
zu vermehren und zu vervielfachen, sieht man deutlich daraus,
dass sie allen diesen einzelnen Einwirkungen einen gleichförmigen Charakter
beigaben. Musik, Tanz und die Rede im Dialekte mussten sich
einer und ebenderselben ursprünglich nationellen Eigenthümlichkeit
unterwerfen, Dorisch, Aeolisch oder von einer andren Tonart und andrem
Dialekte seyn. Sie suchten also das Treibende und Stimmende in
der Seele auf, um die Gedanken des Liedes in einer bestimmten Bahn zu
erhalten und durch die, nicht als Idee geltende Regung des Gemüthes in
dieser Bahn zu beleben und zu verstärken. Denn wie in der Dichtung
und dem Gesänge die Worte und ihr Gedankengehalt vorwalten und die
begleitende Stimmung und Anregung ihnen nur zur Seite steht, so verhält
es sich umgekehrt in der Musik. Das Gemüth wird nur zu Gedanken,
Empfindungen und Handlungen angefeuert und begeistert. Diese
müssen in eigner Freiheit aus dem Schoosse dieser Begeisterung hervorgehen
und die Töne bestimmen sie nur insofern, als in den Bahnen, in
welche sie die Regung einleiten, sich nur bestimmte entwickeln können.
422Das Gefühl des Treibenden und Stimmenden im Gemüth ist aber
nothwendig immer, wie es sich hier bei den Griechen zeigt, ein Gefühl
vorhandener oder geforderter Individualität, da die Kraft, welche alle
Seelenthätigkeit umschliesst, nur eine bestimmte seyn und nur in einer
solchen Richtung wirken kann.
Wenn ich daher im Vorigen von etwas über den Ausdruck Ueberschiessendem,
ihm selbst Mangelnden sprach, so darf man sich darunter
durchaus nichts Unbestimmtes denken. Es ist vielmehr das Allerbestimmteste,
weil es die letzten Züge der Individualität vollendet, was
das seiner Abhängigkeit vom Objecte und der von ihm geforderten allgemeinen
Gültigkeit wegen immer minder individualisirende Wort vereinzelt
nicht zu thun vermag. Wenn daher auch dasselbe Gefühl eine
mehr innerliche, sich nicht auf die Wirklichkeit beschränkende Stimmung
voraussetzt und nur aus einer solchen entspringen kann, so führt
es darum nicht von der lebendigen Anschauung in abgezogenes Denken
zurück. Es weckt vielmehr, da es von der eignen Individualität ausgeht,
die Forderung der höchsten Individualisirung des Objects, die nur
durch das Eindringen in alle Einzelnheiten der sinnlichen Auffassung
und durch die höchste Anschaulichkeit der Darstellung erreichbar ist.
Dies zeigen eben wieder die Griechen. Ihr Sinn gieng vorzugsweise auf
das, was die Dinge sind und wie sie erscheinen, nicht einseitig auf dasjenige
hin, wofür sie im Gebrauche der Wirklichkeit gelten. Ihre Richtung
war daher ursprünglich eine innere und intellectuelle. Dies beweist ihr
ganzes Privat- und öffentliches Leben, da Alles in demselben theils
ethisch behandelt, theils mit Kunst begleitet und meistentheils gerade
das Ethische in die Kunst selbst verflochten wurde. So erinnert bei ihnen
fast jede äussere Gestaltung, oft mit Gefährdung und selbst wahrem
Nachtheil der praktischen Tauglichkeit, an eine innere. Eben darum
nun giengen sie in allen geistigen Thätigkeiten auf die Auffassung
und Darstellung des Charakters aus, immer aber mit dem Gefühle, dass
nur das vollendete Eindringen in die Anschauung ihn zu erkennen und
zu zeichnen vermag und dass das an sich nie völlig auszudrückende
Ganze derselben nur aus einer, vermittelst richtigen, gerade auf jene
Einheit gerichteten Tacts geordneten Verknüpfung der Einzelnheiten
hervorspringen kann. Dies macht besonders ihre frühere Dichtung, namentlich
die Homerische so durch und durch plastisch. Die Natur wird,
wie sie ist, die Handlung, selbst die kleinste, z. B. das Anlegen der Rüstung,
wie sie allmählich fortschreitet, vor die Augen gestellt und aus
der Schilderung geht immer der Charakter hervor, ohne dass sie je zu
einer blossen Herzählung des Geschehenen herabsinkt. Dies aber wird
nicht sowohl durch eine Auswahl des Geschilderten bewirkt, als dadurch,
dass die gewaltige Kraft des vom Gefühle der Individualität beseelten
und nach Individualisirung strebenden Sängers seine Dichtung
423durchströmt und sich dem Hörer mittheilt. Vermöge dieser geistigen Eigenthümlichkeit
wurden die Griechen durch ihre Intellectualität in diese
ganze lebendige Mannigfaltigkeit der Sinnenwelt und von dieser, da
sie in ihr doch etwas, das nur der Idee angehören kann, suchten, wieder
zur Intellectualität zurückgedrängt. Denn ihr Ziel war immer der Charakter,
nicht bloss das Charakteristische, da das Erahnden des ersteren
gänzlich vom Haschen nach diesem verschieden ist. Diese Richtung auf
den wahren, individuellen Charakter zog dann zugleich zu dem Idealischen
hin, da das Zusammenwirken der Individualitäten auf die höchste
Stufe der Auffassung, auf das Streben führt, das Individuelle als Beschränkung
zu vernichten und nur als leise Gränze bestimmter
Gestaltung zu erhalten. Daraus entsprang die Vollendung der Griechischen
Kunst, die Nachbildung der Natur aus dem Mittelpunkte des lebendigen
Organismus jedes Gegenstandes, gelingend durch das den
Künstlern neben der vollständigsten Durchschauung der Wirklichkeit
beseelende Streben nach höchster Einheit des Ideals.
Es liegt aber auch in der historischen Entwicklung des Griechischen
Völkerstammes etwas, das die Griechen vorzugsweise zur Ausbildung
des Charakteristischen hinwies, nemlich die Vertheilung in einzelne, in
Dialekt und Sinnesart verschiedne Stämme und die durch mannigfaltige
Wanderungen und inwohnende Beweglichkeit bewirkte geographische
Mischung derselben. Alle umschloss das allgemeine Griechenthum
und trug in jeden in allen Aeusserungen seiner Thätigkeit, von der Verfassung
des Staats bis zur Tonart des Flötenspielers, zugleich sein eigenthümliches
Gepräge über. Geschichtlich gesellte sich nun hierzu der
andre begünstigende Umstand, dass keiner dieser Stämme den andren
unterdrückte, sondern alle in einer gewissen Gleichheit des Strebens
aufblühten, keiner der einzelnen Dialekte der Sprache zum blossen
Volksdialekte herabgesetzt oder zum höheren allgemeinen erhoben
wurde und dass dies gleiche Aufspriessen der Eigenthümlichkeit gerade
in der Periode der lebendigsten und kraftvollsten Bildung der Sprache
und der Nation am stärksten und entschiedensten war. Hieraus bildete
nun der Griechische Sinn, in Allem darauf gerichtet, das Höchste aus
dem bestimmt Individuellsten hervorgehen zu lassen, etwas, das sich
bei keinem andren Volke in dem Grade zeigt. Er behandelte nemlich
diese ursprünglichen Volkseigenthümlichkeiten als Gattungen der
Kunst und führte sie auf diese Weise in die Architektur, Musik, Dichtung
und in den edleren Gebrauch der Sprache ein. 35 Das bloss Volksmässige
wurde ihnen genommen, Laute und Formen wurden in den
Dialekten geläutert und dem Gefühle der Schönheit und des Zusammenklanges
unterworfen. So veredelt, erhoben sie sich zu eignen Charakteren
des Styls und der Dichtung, fähig, in ihren sich ergänzenden
Gegensätzen idealisch zusammenzustreben. Ich brauche kaum zu bemerken,
424dass ich hier, was die Dialekte und die Dichtung betrifft, nur
von dem Gebrauch verschiedener Tonarten und Dialekte in der lyrischen
und dem Unterschiede der Chöre und des Dialogs in der tragischen
Poesie rede, nicht von den Fällen, wo in der Komödie verschiedene
Dialekte den handelnden Personen in den Mund gelegt werden.
Diese Fälle haben mit jenen durchaus nichts gemein und .finden sich
wohl mehr oder weniger in den Literaturen aller Völker.
In den Römern, wie sich ihre Eigenthümlichkeit auch in ihrer Sprache
und Literatur darstellt, offenbart sich viel weniger das Gefühl der
Notwendigkeit, die Aeusserungen des Gemüths zugleich mit dem unmittelbaren
Einfluss der treibenden und stimmenden Kraft auszustatten.
Ihre Vollendung und Grösse entwickelt sich auf einem andren, dem
Gepräge, das sie ihren äusseren Schicksalen aufdrückten, homogeneren
Wege. Dagegen spricht sich jenes Gefühl in der Deutschen Sinnesart
vielleicht nicht weniger stark, als bei den Griechen aus, nur dass, so wie
diese die äussere Anschauung, wir mehr die innere Empfindung zu individualisiren
geneigt sind.
Ich habe das Gefühl, dass alles sich im Gemüthe Erzeugende, als
Ausfluss Einer Kraft, ein grosses Ganzes ausmacht und dass das Einzelne,
gleichsam von dem Hauche jener Kraft, Merkzeichen seines Zusammenhanges
mit diesem Ganzen an sich tragen muss, bis hierher mehr in
seinem Einflüsse auf die einzelnen Aeusserungen betrachtet. Es übt
aber auch eine nicht minder bedeutende Rückwirkung auf die Art aus,
wie jene Kraft, als erste Ursach aller Geisteserzeugungen, zum Bewusstseyn
ihrer selbst gelangt. Das Bild seiner ursprünglichen Kraft kann
aber dem Menschen nur als ein Streben in bestimmter Bahn erscheinen
und eine solche setzt ein Ziel voraus, welches kein anderes, als das
menschliche Ideal seyn kann. In diesem Spiegel erblicken wir die
Selbstanschauung der Nationen. Der erste Beweis ihrer höheren Intellectualität
und ihrer tiefer eingreifenden Innerlichkeit ist es nun, wenn
sie dies Ideal nicht in die Schranken der Tauglichkeit zu bestimmten
Zwecken einschliessen, sondern, woraus innere Freiheit und Allseitigkeit
hervorgeht, dasselbe als etwas, das seinen Zweck nur in seiner eignen
Vollendung suchen kann, als ein allmähliches Aufblühen zu nie endender
Entwicklung betrachten. Allein auch diese erste Bedingung in
gleicher Reinheit vorausgesetzt, entstehen aus der Verschiedenheit der
individuellen Richtung nach der sinnlichen Anschauung, der inneren
Empfindung und dem abgezogenen Denken verschiedene Erscheinungen.
In jeder derselben strahlt die den Menschen umgebende Welt, von
einer andren Seite in ihn aufgenommen, in verschiedener Form aus ihm
zurück. In der äusseren Natur, um einen solchen Zug hier herauszuheben,
bildet Alles eine stätige Reihe, gleichzeitig vor dem Auge, auf einander
folgend in der Entwicklung der Zustände aus einander. Ebenso
425sehr ist dies in der bildenden Kunst der Fall. Bei den Griechen, denen es
verliehen war, immer die vollste und zarteste Bedeutung aus der sinnlichen,
äusseren Anschauung zu ziehen, ist vielleicht, was ihre geistige
Thätigkeit betrifft, der am meisten charakteristische Zug ihre Scheu vor
allem Uebermässigen und Uebertriebenen, die in wohnende Neigung,
bei aller Regsamkeit und Freiheit der Einbildungskraft, aller scheinbaren
Ungebundenheit der Empfindung, aller Veränderlichkeit der Gemüthsstimmung,
aller Beweglichkeit, von Entschlüssen zu Entschlüssen
überzugehen, dennoch immer Alles, was sich in ihnen gestaltete,
innerhalb der Gränzen des Ebenmasses und des Zusammenklanges zu
halten. Sie besassen in höherem Grade, als irgend ein anderes Volk Tact
und Geschmack und der sich in allen ihren Werken offenbarende zeichnet
sich noch vorzugsweise dadurch aus, dass die Verletzung der Zartheit
des Gefühls niemals auf Kosten seiner Stärke oder der Naturwahrheit
vermieden wird. Die innere Empfindung erlaubt, auch ohne von
der richtigen Bahn abzuweichen, stärkere Gegensätze, schroffere Uebergänge,
Spaltungen des Gemüths in unheilbare Kluft. Alle diese Erscheinungen
finden sich daher - und dies beginnt schon bei den Römern
- bei den Neueren.
Das Feld der Verschiedenheit geistiger Eigenthümlichkeit ist von unmessbarer
Ausdehnung und unergründlicher Tiefe. Der Gang der gegenwärtigen
Betrachtungen erlaubte mir aber nicht, es ganz unberührt
zu lassen. Dagegen kann es scheinen, dass ich den Charakter der Nationen
zu sehr in der inneren Stimmung des Gemüths gesucht habe, da er
sich vielmehr lebendig und anschaulich in der Wirklichkeit offenbart.
Er äussert sich, wenn man die.Sprache und ihre Werke ausnimmt, in
Physiognomie, Körperbau, Tracht, Sitten, Lebensweise, Familien- und
bürgerlichen Einrichtungen und vor allem in dem Gepräge, welches die
Völker eine Reihe von Jahrhunderten hindurch ihren Werken und Thaten
aufdrücken. Dies lebendige Bild scheint in einen Schatten verwandelt,
wenn man die Gestaltung des Charakters in der Gemüthsstimmung
sucht, welche diesen lebendigen Aeusserungen zum Grunde liegt.
Um aber den Einfluss desselben auf die Sprache zu zeigen, schien es mir
nicht möglich, dies Verfahren zu umgehen. Die Sprache lässt sich nicht
unmittelbar mit jenen thatsächlichen Aeusserungen überall in Verbindung
bringen. Es muss das Medium gefunden werden, in welchem beide
einander begegnen und, aus Einer Quelle entspringend, ihre verschiedenen
Wege einschlagen. Dies aber ist offenbar nur das Innerste
des Gemüths selbst.
32. Ebenso schwierig, als die Abgränzung der geistigen Individualität,
ist die Beantwortung der Frage, wie sie in den Sprachen Wurzel
schlägt? woran der Charakter der Sprachen in ihnen haftet? an welchem
ihrer Theile er erkennbar ist? Die geistige Eigenthümlichkeit der
426Nationen wird, indem sie sich der Sprachen bedienen, in allen Stadien
des Lebens derselben sichtbar. Ihr Einfluss modificirt die Sprachen verschiedener
Stämme, mehrere desselben Stammes, Mundarten einer einzelnen,
ja endlich dieselbe, sich äusserlich gleich bleibende Mundart
nach Verschiedenheit der Zeitalter und der Schriftsteller. Der Charakter
der Sprache vermischt sich dann mit dem des Styls, bleibt aber immer
der Sprache eigenthümlich, da nur gewisse Arten des Styls jeder Sprache
leicht und natürlich sind. Macht man zwischen diesen hier aufgezählten
Fällen den Unterschied, ob auch die Laute in den Wörtern und
Beugungen verschieden sind, wie es sich in immer absteigenden Graden
von den Sprachen verschiedenen Stammes an bis zu den Dialekten
zeigt, oder ob der Einfluss, indem jene äussere Form ganz oder doch
wesentlich dieselbe bleibt, nur in dem Gebrauche der Wörter und Fügungen
liegt, so ist in dem letzteren Falle die Einwirkung des Geistes,
da die Sprache hier schon zu hoher intellectueller Ausbildung gelangt
seyn muss, sichtbarer, aber feiner, in dem ersteren mächtiger, aber
dunkler, da sich der Zusammenhang der Laute mit dem Gemüthe nur in
wenigen Fällen bestimmt und scharf erkennen und schildern lässt.
Doch kann, selbst in Dialekten, kleine und im Ganzen die Sprache wenig
verändernde Umbildung einzelner Vocale mit Recht auf die Gemüthsbeschaffenheit
des Volkes bezogen werden, wie schon die Griechischen
Grammatiker von dem männlicheren Dorischen a gegen das
weichlichere Ionische ae (η) bemerken.
In der Periode der ursprünglichen Sprachbildung, in welche wir auf
unsrem Standpunkte die nicht von einander abzuleitenden Sprachen
verschiedener Stämme setzen müssen, waltet das Streben, die Sprache
nur erst wahrhaft, dem eignen Bewusstseyn anschaulich und dem Hörenden
verständlich, aus dem Geiste herauszubauen, gleichsam die
Schöpfung ihrer Technik zu sehr vor, um nicht den Einfluss der individuellen
Geistesstimmung, die ruhiger und klarer aus dem späteren Gebrauche
hervorleuchtet, einigermassen zu verdunkeln. Doch wirkt gerade
dazu die ursprüngliche Charakteranlage der Völker gewiss am
mächtigsten und einflussreichsten mit. Dies sehen wir gleich an zwei
Punkten, die, da sie die gesammte intellectuelle Anlage charakterisiren,
eine Menge anderer zugleich bestimmen. Die verschiedenen, oben
nachgewiesenen Wege, auf welchen die Sprachen die.Verknüpfung der
Sätze bezwecken, machen den wichtigsten Theil ihrer Technik aus. Gerade
hierin nun enthüllt sich erstlich die Klarheit und Bestimmtheit der
logischen Anordnung, welche allein der Freiheit des Gedankenflugs
eine sichere Grundlage verleiht und zugleich Gesetzmässigkeit und
Ausdehnung der Intellectualität darthut, und zweitens das mehr oder
minder durchscheinende Bedürfniss nach sinnlichem Reichthum und
Zusammenklang, die Forderung des Gemüths, was nur irgend innerlich
427wahrgenommen und empfunden wird, auch äusserlich mit Laut zu umkleiden.
Allein gewiss liegen auch in dieser technischen Form der Sprachen
noch Beweise anderer und mehr specieller Geistes-Individualitäten
der Nationen, wenn sie gleich sich minder gewiss aus ihnen
herleiten lassen. Sollte nicht z. B. die feine Unterscheidung zahlreicher
Vocalmodificationen und Vocalstellungen und die sinnvolle Anwendung
derselben, verbunden mit der Beschränkung auf dies Verfahren
und der Abneigung gegen Zusammensetzung, ein Uebergewicht scharfsinnig
und spitzfindig sondernden Verstandes in den Völkern Semitischen
Stammes, besonders den Arabern, verrathen und befördern?
Hiermit scheint zwar der Bilderreichthum der Arabischen Sprache in
Contrast zu stehen. Wenn es aber nicht selbst eine spitzfindige Sonderung
der Begriffe ist, so möchte ich sagen, dass jener Bilderreichthum in
den einmal geformten Wörtern liegt, dagegen die Sprache selbst, hierin
mit dem Sanskrit und dem Griechischen verglichen, einen viel geringeren
Reichthum von Mitteln enthält, immerfort Dichtung jeder Gattung
aus sich hervorspriessen zu lassen. Gewiss wenigstens scheint es mir,
dass man einen Zustand der Sprache, in welchem sie, als treues Abbild
einer solchen Periode, viel dichterisch geformte Elemente enthält, von
demjenigen unterscheiden muss, wo ihrem Organismus selbst in Lauten,
Formen, freigelassenen Verknüpfungen und Redefügungen unzerstörbare
Keime ewig sprossender Dichtung eingepflanzt sind. In dem
ersteren erkaltet nach und nach die einmal geprägte Form und ihr dichterischer
Gehalt wird nicht mehr begeisternd empfunden. In dem letzteren
kann die dichterische Form der Sprache sich in immer neuer Frische
nach der Geistescultur des Zeitalters und dem Genie der Dichter
selbsterzeugten Stoff aneignen. Das bereits oben bei Gelegenheit des
Flexionssystems Bemerkte findet sich auch hier bestätigt. Der wahre
Vorzug einer Sprache besteht darin, den Geist durch die ganze Folge
seiner Entwicklungen zu gesetzmässiger Thätigkeit und Ausbildung seiner
einzelnen Vermögen zu stimmen oder, um es von Seiten der geistigen
Einwirkung auszudrücken, das Gepräge einer solchen reinen gesetzmässigen
und lebendigen Energie an sich zu tragen.
Allein auch da, wo das Formensystem mehrerer Sprachen im Ganzen
dasselbe ist, wie im Sanskrit, Griechischen, Römischen und Deutschen,
in welchen allen Flexion, zugleich durch Vocalwechsel und Anbildung,
selten durch jenen, gewöhnlich durch diese bewirkt, herrscht,
können in der Anwendung dieses Systems wichtige, durch die geistige
Eigenthümlichkeit bewirkte Unterschiede liegen. Einer der wichtigsten
ist das mehr oder minder sichtbare Vorwalten richtiger und vollständiger
grammatischer Begriffe und die Vertheilung der verschiedenen
Lautformen unter dieselben. Je nachdem dies in einem Volke bei der
höheren Bearbeitung seiner Sprache herrschend wird, kehrt sich die
428Aufmerksamkeit von der sinnlichen Lautfülle und Mannigfaltigkeit der
Formen auf die Bestimmtheit und die scharf abgegränzte Feinheit ihres
Gebrauchs. Dies kann daher auch in derselben Sprache in verschiedenen
Zeiten gefunden werden. Eine solche sorgfältige Beziehung der
Formen auf die grammatischen Begriffe zeigt die Griechische Sprache
durchaus, und wenn man auch auf den Unterschied zwischen einigen
ihrer Dialekte Rücksicht nimmt, so verräth sie zugleich eine Neigung,
sich der zu üppigen Lautfülle der zu volltönenden Formen zu entledigen,
sie zusammenzuziehen oder durch kürzere zu ersetzen. Das jugendliche
Aufrauschen der Sprache in ihrer sinnlichen Erscheinung
concentrirt sich mehr auf ihre Angemessenheit zum inneren Gedankenausdruck.
Hierzu trägt die Zeit auf doppelte Weise bei, indem auf der
einen Seite der Geist sich im fortschreitenden Entwicklungsgange immer
mehr zu der inneren Thätigkeit hinneigt und indem auf der andren
auch die Sprache sich im Verlauf ihres Gebrauches da, wo die geistige
Eigenthümlichkeit nicht alle ursprünglich bedeutsamen Laute unversehrt
bewahrt, abschleift und vereinfacht. Auch im Griechischen ist,
gegen das Sanskrit gehalten, schon das Letztere sichtbar, allein nicht in
dem Grade, dass man hierin allein einen genügenden Erklärungsgrund
finden könnte. Wenn in dem Griechischen Formengebrauch in der
That, wie es mir scheint, eine mehr gereifte intellectuelle Tendenz liegt,
so entspringt sie wahrhaft aus dem der Nation inwohnenden Sinne für
schnelle, feine und scharf gesonderte Gedankenentwicklung. Die Deutsche
höhere Bildung dagegen hat unsere Sprache schon auf einem
Punkte der Abschleifung und der Abstumpfung bedeutsamer Laute gefunden,
so dass bei uns geringere Hinneigung zu sinnlicher Anschaulichkeit
und grösseres Zurückziehen auf die Empfindung allerdings
auch darin ihren Grund gehabt haben kann. In der Römischen Sprache
ist sehr üppige Lautfülle und grosse Freiheit der Phantasie über die
Lautformung nie ausgegossen gewesen; der männlichere, ernstere und
viel mehr auf die Wirklichkeit und auf den unmittelbar in ihr gültigen
Theil des Intellectuellen gerichtete Sinn des Volkes gestattete wohl kein
so üppiges und freies Aufspriessen der Laute. Den Griechischen grammatischen
Formen kann man, als Folge der grossen Beweglichkeit Griechischer
Phantasie und der Zartheit des Schönheitssinnes, auch wohl,
ohne zu irren, vorzugsweise vor den übrigen des Stammes grössere
Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und gefälligere Anmuth zuschreiben.
Auch das Mass, in welchem die Nationen von den technischen Mitteln
ihrer Sprachen Gebrauch machen, ist nach ihrer verschiedenen
Geisteseigenthümlichkeit verschieden. Ich erinnere hier nur an die Bildung
zusammengesetzter Wörter. Das Sanskrit bedient sich derselben
innerhalb der weitesten Gränzen, die sich eine Sprache überhaupt
leicht erlauben darf, die Griechen auf viel beschränktere Weise und
429nach Verschiedenheit der Dialekte und des Styls. In der Römischen Literatur
findet sie sich vorzugsweise bei den ältesten Schriftstellern und
wird von der fortschreitenden Cultur der Sprache mehr ausgeschlossen.
Erst bei genauerer Erwägung, aber dann klar und deutlich findet
man den Charakter der verschiedenen Weltauffassung der Völker an
der Geltung der Wörter haftend. Ich habe schon im Vorigen (VII 170.
176.) ausgeführt, dass nicht leicht irgend ein Wort, es müsste denn augenblicklich
bloss als materielles Zeichen seines Begriffes gebraucht
werden, von verschiedenen Individuen auf dieselbe Weise in die Vorstellung
aufgenommen wird. Man kann daher geradezu behaupten, dass
in jedem etwas nicht wieder mit Worten zu Unterscheidendes liegt und
dass die Wörter mehrerer Sprachen, wenn sie auch im Ganzen gleiche
Begriffe bezeichnen, doch niemals wahre Synonyma sind. Eine Definition
kann sie, genau und streng genommen, nicht umschliessen und oft
lässt sich nur gleichsam die Stelle andeuten, die sie in dem Gebiete, zu
dem sie gehören, einnehmen. Auf welche Weise dies sogar bei Bezeichnungen
körperlicher Gegenstände der Fall ist, habe ich gleichfalls schon
erwähnt. Das wahre Gebiet verschiedener Wortgeltung aber ist die Bezeichnung
geistiger Begriffe. Hier drückt selten ein Wort ohne sehr
sichtbare Unterschiede den gleichen mit dem Worte einer anderen
Sprache aus. Wo wir, wie bei den Sprachen roher und ungebildeter Völker,
von den feineren Nuancen ihrer Wörter keinen Begriff haben,
scheint uns wohl oft das Gegentheil statt zu finden. Allein die auf andere,
hochgebildete Sprachen gerichtete Aufmerksamkeit verwahrt vor
solcher übereilten Ansicht und es liesse sich eine fruchtbare Vergleichung
solcher Ausdrücke derselben Gattung, eine Synonymik mehrerer
Sprachen, wie sie von einzelnen Sprachen vorhanden sind, aufstellen.
Bei Nationen von grosser Geistesregsamkeit bleibt aber diese Geltung,
wenn man sie bis in die feinsten Abstufungen verfolgt, gleichsam in beständigem
Flusse. Jede Zeit, jeder selbstständige Schriftsteller fügt unwillkührlich
hinzu oder ändert ab, da er nicht vermeiden kann, seine
Individualität an seine Sprache zu heften, und diese ein anderes Bedürfniss
des Ausdrucks ihr entgegenträgt. Es wird in diesen Fällen lehrreich,
eine doppelte Vergleichung der für den im Ganzen gleichen Begriff in
mehreren Sprachen gebräuchlichen Wörter und derjenigen derselben
Sprache, welche zu der gleichen Gattung gehören, vorzunehmen. In der
letzteren zeichnet sich die geistige Eigenthümlichkeit in ihrer Gleichförmigkeit
und Einheit; es ist immer dieselbe, die sich den objectiven Begriffen
beimischt. In der ersteren erkennt man, wie derselbe Begriff,
z. B. der der Seele von verschiedenen Seiten aufgefasst wird, und lernt
dadurch gleichsam den Umfang menschlicher Vorstellungsweise auf geschichtlichem
Wege kennen. Diese kann durch einzelne Sprachen, ja
durch einzelne Schriftsteller erweitert werden. In beiden Fällen entsteht
430das Resultat theils durch die verschieden angespannte und zusammenwirkende
Geistesthätigkeit, theils durch die mannigfaltigen Verknüpfungen,
in welche der Geist, in dem nichts jemals einzeln dasteht, die
Begriffe bringt. Denn es ist hier von dem aus der Fülle des geistigen Lebens
hervorströmenden Ausdruck die Rede, nicht von der Gestaltung
der Begriffe durch die Schule, welche sie auf ihre.nothwendigen Kennzeichen
beschränkt. Aus dieser systematisch genauen Beschränkung
und Feststellung der Begriffe und ihrer Zeichen entsteht die wissenschaftliche
Terminologie, die wir im Sanskrit in allen Epochen des Philosophirens
und in allen Gebieten des Wissens ausgebildet finden, da
der Indische Geist vorzugsweise auf die Sonderung und Aufzählung der
Begriffe hingieng. Die oben angedeutete doppelte Vergleichung bringt
die bestimmte und feine Sonderung des Subjectiven und Objectiven in
die Klarheit des Bewusstseyns und zeigt, wie beide immer wechselsweise
auf einander wirken und die Erhöhung und Veredlung der schaffenden
Kraft mit der harmonischen Zusammenwölbung der Erkenntniss
gleichen Schritt hält.
Von der hier entwickelten Ansicht sind irrige oder mangelhafte Auffassungen
der Begriffe ausgeschlossen geblieben. Es handelte sich hier
nur von dem auf verschiedenen Bahnen gemeinschaftlichen geregelten
und energischen Streben nach dem Ausdruck von Begriffen, von der
Auffassung derselben in ihrer Abspiegelung in der geistigen Individualität
von unendlich vielen Seiten. Es kommt aber natürlich bei der Aufsuchung
der Geisteseigenthümlichkeiten in der Sprache vor Allem auch
die richtige Abtheilung der Begriffe in Betrachtung. Denn wenn z. B.
zwei oft, aber doch nicht nothwendig verbundene in einer Sprache in
demselben Worte zusammengefasst werden, so kann es an einem reinen
Ausdruck für jeden derselben allein fehlen. Ein Beispiel findet man in
einigen Sprachen an den Ausdrücken für Wollen, Wünschen und Werden.
Des Einflusses des Geistes auf die Art der Bezeichnung der Begriffe
nach Massgabe der Verwandtschaft der letzteren, welche Gleichheit
der Laute herbeiführt, und in Bezug auf die dabei gebrauchten Metaphern
ist es kaum nothwendig hier noch besonders zu erwähnen.
Weit mehr aber, als bei den einzelnen Wörtern zeichnet sich die intellectuelle
Verschiedenheit der Nationen in den Fügungen der Rede, in
dem Umfange, welchen sie den Sätzen zu geben vermag, und in der innerhalb
dieser Gränzen zu erreichenden Mannigfaltigkeit. Hierin liegt
das wahre Bild des Ganges und der Verkettung der Gedanken, an die
sich die Rede nicht wahrhaft anzuschliessen vermag, wenn nicht die
Sprache den gehörigen Reichthum und die begeisternde Freiheit der
Fügungen besitzt. Alles, was die Arbeit des Geistes in sich ihrer Form
nach ist, erscheint hier in der Sprache und wirkt ebenso wieder auf das
Innere zurück. Die Abstufungen sind hier unzählig und das Einzelne,
431was die Wirkung hervorbringt, lässt sich nicht immer genau und bestimmt
in Worten darstellen. Aber der dadurch hervorgebrachte verschiedene
Geist schwebt, wie ein leiser Hauch, über dem Ganzen.
Charakter der Sprachen. Poesie und Prosa
33. Ich habe bis hierher einzelne Punkte des gegenseitigen Einflusses
des Charakters der Nationen und der Sprachen berührt. Es giebt aber
zwei Erscheinungen in den letzteren, in welchen nicht nur alle am entschiedensten
zusammentreffen, sondern wo sich auch dermassen der
Einfluss des Ganzen offenbart, dass selbst der Begriff des Einzelnen daraus
verschwindet, die Poesie und die Prosa. Man muss sie Erscheinungen
der Sprache nennen, da schon die ursprüngliche Anlage dieser vorzugsweise
die Richtung zu der einen oder andren oder, wo die Form
wahrhaft grossartig ist, zur gleichen Entwicklung beider in gesetzmässigem
Verhältniss giebt und auch wieder in ihrem Verlaufe darauf zurückwirkt.
In der That aber sind sie zuerst Entwicklungsbahnen der Intellectualität
selbst und müssen sich, wenn ihre Anlage nicht mangelhaft ist
und ihr Lauf keine Störungen erleidet, nothwendig aus ihr entspinnen.
Sie erfordern daher das sorgfältigste Studium nicht nur in ihrem Verhältniss
zu einander überhaupt, sondern auch insbesondere in Beziehung
auf die Zeit ihrer Entstehung.
Wenn man beide zugleich von der in ihnen am meisten concreten
und idealen Seite betrachtet, so schlagen sie zu ähnlichem Zweck verschiedene
Pfade ein. Denn beide bewegen sich von der Wirklichkeit aus
zu einem ihr nicht angehörenden Etwas: die Poesie fasst die Wirklichkeit
in ihrer sinnlichen Erscheinung, wie sie äusserlich und innerlich
empfunden wird, auf, ist aber unbekümmert um dasjenige, wodurch
sie Wirklichkeit ist, stösst vielmehr diesen ihren Charakter absichtlich
zurück. Die sinnliche Erscheinung verknüpft sie sodann vor der Einbildungskraft
und führt durch sie zur Anschauung eines künstlerisch
idealischen Ganzen. Die Prosa sucht in der Wirklichkeit gerade die
Wurzeln, durch welche sie am Daseyn haftet, und die Fäden ihrer Verbindungen
mit demselben. Sie verknüpft alsdann auf intellectuellem
Wege Thatsache mit Thatsache und Begriffe mit Begriffen und strebt
nach einem objectiven Zusammenhang in einer Idee. Der Unterschied
beider ist hier so gezeichnet, wie er nach ihrem wahren Wesen im Geiste
sich ausspricht. Sieht man bloss auf die mögliche Erscheinung in der
Sprache und auch in dieser nur auf eine, in der Verbindung höchst
mächtige, aber vereinzelt fast gleichgültige Seite derselben, so kann die
innere prosaische Richtung in gebundener und die poetische in freier
Rede ausgeführt werden, meistentheils aber nur auf Kosten beider, so
432dass das poetisch ausgedrückte Prosaische weder den Charakter der
Prosa noch den der Poesie ganz an sich trägt und ebenso in Prosa gekleidete
Poesie. Der poetische Gehalt führt gewaltsam auch das poetische
Gewand herbei und es fehlt nicht an Beispielen, dass Dichter im Gefühle
dieser Gewalt das in Prosa Begonnene in Versen vollendet haben. Beiden
gemeinschaftlich, um zu ihrem wahren Wesen zurückzukehren, ist
die Spannung und der Umfang der Seelenkräfte, welche die Verbindung
der vollen Durchdringung der Wirklichkeit mit dem Erreichen eines
idealen Zusammenhanges unendlicher Mannigfaltigkeit erfordert, und
die Sammlung des Gemüthes auf die consequente Verfolgung des bestimmten
Pfades. Doch muss diese wieder so aufgefasst werden, dass
sie die Verfolgung des entgegengesetzten im Geiste der Nation nicht
ausschliesst, sondern vielmehr befördert. Beide, die poetische und prosaische
Stimmung müssen sich zu dem Gemeinsamen ergänzen, den
Menschen tief in die Wirklichkeit Wurzel schlagen zu lassen, aber nur,
damit sein Wuchs sich desto fröhlicher über sie in ein freieres Element
erheben kann. Die Poesie eines Volkes hat nicht den höchsten Gipfel
erreicht, wenn sie nicht in ihrer Vielseitigkeit und in der freien Geschmeidigkeit
ihres Schwunges zugleich die Möglichkeit einer entsprechenden
Entwicklung in Prosa verkündet. Da der menschliche Geist, in
Kraft und Freiheit gedacht, zu der Gestaltung von beiden gelangen
muss, so erkennt man die eine an der andren, wie man dem Bruchstück
eines Bildwerks ansieht, ob es Theil einer Gruppe gewesen ist.
Die Prosa kann aber auch bei blosser Darstellung des Wirklichen
und bei ganz äusserlichen Zwecken stehen bleiben, gewissermassen nur
Mittheilung von Sachen, nicht Anregung von Ideen oder Empfindungen
seyn. Dann weicht sie nicht von der gewöhnlichen Rede ab und erreicht
nicht die Höhe ihres eigentlichen Wesens. Sie ist dann nicht eine Entwicklungsbahn
der Intellectualität zu nennen und hat keine formale,
sondern nur materielle Beziehungen. Wo sie den höheren Weg verfolgt,
bedarf sie, um zum Ziele zu gelangen, auch tiefer in das Gemüth eingreifender
Mittel und erhebt sich dann zu derjenigen veredelten Rede,
von der allein gesprochen werden kann, wenn man sie als Gefährtin der
Poesie auf der intellectuellen Laufbahn der Nationen betrachtet. Sie
verlangt alsdann das Umfassen ihres Gegenstandes mit allen vereinten
Kräften des Gemüths, woraus zugleich eine Behandlung entsteht, welche
denselben als nach allen Seiten Strahlen aussendend zeigt, auf die
er Wirkung ausüben kann. Der sondernde Verstand ist nicht allein thätig,
die übrigen Kräfte wirken mit und bilden die Auffassung, die man
mit höherem Ausdruck die geistvolle nennt. In dieser Einheit trägt der
Geist auch, ausser der Bearbeitung des Gegenstandes, das Gepräge seiner
eignen Stimmung in die Rede über. Die Sprache, durch den
Schwung des Gedanken gehoben, macht ihre Vorzüge geltend, ordnet
433sie aber dem hier gesetzgebenden Zwecke unter. Die sittliche Gefühlsstimmung
theilt sich der Sprache mit und die Seele leuchtet aus dem
Style hervor. Auf eine ihr ganz eigenthümliche Weise offenbart sich
aber in der Prosa durch die Unterordnung und Gegeneinanderstellung
der Sätze die, der Gedankenentwicklung entsprechende logische Eurhythmie,
welche der prosaischen Rede in der allgemeinen Erhebung
durch ihren besondren Zweck geboten wird. Wenn sich der Dichter dieser
zu sehr überlässt, so macht er die Poesie der rhetorischen Prosa ähnlich.
Indem nun alles hier einzeln Genannte in der geistvollen Prosa zusammenwirkt,
zeichnet sich in ihr die ganze lebendige Entstehung des
Gedanken, das Ringen des Geistes mit seinem Gegenstande. Wo dieser
es erlaubt, gestaltet sich der Gedanke wie eine freie, unmittelbare Eingebung
und ahmt auf dem Gebiete der Wahrheit die selbstständige
Schönheit der Dichtung nach.
Aus allem diesen ergiebt sich, dass Poesie und Prosa durch dieselben
allgemeinen Forderungen bedingt sind. In beiden muss ein von innen
entstehender Schwung den Geist heben und tragen. Der Mensch in seiner
ganzen Eigenthümlichkeit muss sich mit dem Gedanken nach der
äusseren und inneren Welt hinbewegen und, indem er Einzelnes erfasst,
auch dem Einzelnen die Form lassen, die es an das Ganze knüpft. In
ihren Richtungen aber und den Mitteln ihres Wirkens sind beide verschieden
und können eigentlich nie mit einander vermischt werden. In
Rücksicht auf die Sprache ist auch besonders zu beachten, dass die Poesie
in ihrem wahren Wesen von Musik unzertrennlich ist, die Prosa dagegen
sich ausschliesslich der Sprache anvertraut. Wie genau die Poesie
der Griechen mit Instrumentalmusik verbunden war, ist bekannt und
das Gleiche gilt von der lyrischen Poesie der Hebräer. Auch von der Einwirkung
der verschiedenen Tonarten auf die Poesie ist oben gesprochen
worden. Wie poetisch Gedanke und Sprache seyn möge, fühlt man sich,
wenn das musikalische Element fehlt, nicht auf dem wahren Gebiete
der Poesie. Daher der natürliche Bund zwischen grossen Dichtern und
Componisten, obgleich die Neigung der Musik, sich in unbeschränkter
Selbstständigkeit zu entwickeln, auch wohl die Poesie absichtlich in
Schatten stellt.
Genau genommen lässt sich nie sagen, dass die Prosa aus der Poesie
hervorgeht. Auch wo beide, wie in der Griechischen Literatur, historisch 36
in der That so erscheinen, kann dies doch nur richtig so erklärt
werden, dass die Prosa aus einem, durch die ächteste und mannigfaltigste
Poesie Jahrhunderte lang bearbeiteten Geiste und in einer auf diese
Weise gebildeten Sprache entsprang. Beides aber ist wesentlich verschieden.
Der Keim zur Griechischen Prosa lag, wie der zur Poesie,
schon ursprünglich im Griechischen Geiste, durch dessen Individualität
auch beide, ihrem Wesen unbeschadet, einander in ihrem eigenthümlichen
434Gepräge entsprechen. Schon die Griechische Poesie zeigt
den weiten und freien Aufflug des Geistes, der das Bedürfniss der Prosa
hervorbringt. Beider Entwicklung war vollkommen naturgemäss aus
gemeinschaftlichem Ursprung und einem beide zugleich umfassenden
intellectuellen Drange, der nur durch äussere Umstände hätte an der
Vollendung seiner Entwicklung verhindert werden können. Noch weniger
lässt sich die höhere Prosa als durch eine, noch so sehr von dem
bestimmten Zwecke der Rede und feinem Geschmack geminderte Beimischung
poetischer Elemente entstehend erklären. Die Unterschiede
beider in ihrem Wesen üben ihre Wirkung natürlich auch in der Sprache
aus und die poetische und prosaische haben jede ihre Eigenthümlichkeiten
in der Wahl der Ausdrücke, der grammatischen Formen und Fügungen.
Viel weiter aber, als durch diese Einzelnheiten werden sie
durch den in ihrem tieferen Wesen gegründeten Ton des Ganzen auseinandergehalten.
Der Kreis des Poetischen ist, wie unendlich und unerschöpflich
auch in seinem Innren, doch immer ein geschlossener, der
nicht Alles in sich aufnimmt oder dem Aufgenommenen nicht seine
ursprüngliche Natur lässt; der durch keine äussere Form gebundene
Gedanke kann sich in freier Entwicklung nach allen Seiten hin weiter
bewegen, sowohl in der Auffassung des Einzelnen, als in der Zusammenfügung
der allgemeinen Idee. Insofern liegt das Bedürfniss zur Ausbildung
der Prosa in dem Reichthum und der Freiheit der Intellectualität
und macht die Prosa gewissen Perioden der geistigen Bildung
eigenthümlich. Sie hat aber auch noch eine andere Seite, durch welche
sie reizt und sich dem Gemüthe einschmeichelt: ihre nahe Verwandtschaft
mit den Verhältnissen des gewöhnlichen Lebens, das durch ihre
Veredlung in seiner Geistigkeit gesteigert werden kann, ohne darum an
Wahrheit und natürlicher Einfachheit zu verlieren. Von dieser Seite her
kann sogar die Poesie die prosaische Einkleidung wählen, um gleichsam
die Empfindung in ihrer ganzen Reinheit und Wahrheit darzustellen.
Wie der Mensch selbst der Sprache, als das Gemüth begränzend und
seine reinen Aeusserungen entstellend, abhold seyn und sich nach einem
Empfinden und Denken ohne ein solches Medium sehnen kann,
ebenso kann er sich durch Ablegung alles ihres Schmuckes, auch in der
höchsten poetischen Stimmung, zu der Einfachheit der Prosa flüchten.
Die Poesie trägt ihrem Wesen nach immer auch eine äussere Kunstform
an sich. Es kann aber in der Seele eine Neigung zur Natur im Gegensatz
mit der Kunst, jedoch dergestalt geben, dass dem Gefühl der Natur übrigens
ihr ganzer idealer Gehalt bewahrt wird, und dies scheint in der
That den neuern gebildeten Völkern eigen zu seyn. Gewiss wenigstens -
und dies hängt zugleich mit der bei gleicher Tiefe weniger sinnlichen
Formung unsrer Sprache zusammen - liegt dies in unserer Deutschen
Sinnesart. Der Dichter kann alsdann absichtlich den Verhältnissen des
435wirklichen Lebens nahe bleiben und, wenn die Macht seines Genies
dazu hinreicht, ein acht poetisches Werk in prosaischer Einkleidung
ausführen. Ich brauche hier nur an Göthe's Werther zu erinnern, von
dem jeder Leser fühlen wird, wie nothwendig die äussere Form mit dem
inneren Gehalte zusammenhängt. Ich erwähne dies jedoch nur, um zu
zeigen, wie aus ganz verschiedenen Seelenstimmungen Stellungen der
Poesie und Prosa gegen einander und Verknüpfungen ihres inneren und
äusseren Wesens entstehen können, welche alle auf den Charakter der
Sprache Einfluss haben, aber auch alle wieder, was uns noch sichtbarer
ist, ihre Rückwirkung erfahren.
Die Poesie und Prosa selbst erhalten aber auch jede für sich eine eigenthümliche
Färbung. In der Griechischen.Poesie herrschte, in Gemässheit
mit der allgemeinen intellectuellen Eigenthümlichkeit, die
äussere Kunstform vor allem Uebrigen vor. Dies entsprang zugleich aus
ihrer engen und durchgängigen Verknüpfung mit der Musik, allein auch
vorzüglich aus dem feinen Tact, mit welchem sie die inneren Wirkungen
auf das Gemüth abzuwägen und auszugleichen verstanden. So kleidete
sich die alte Komödie in das reichste und mannigfaltigste rhythmische
Gewand. Je tiefer sie oft in Schilderungen und Ausdrücken zum Gewöhnlichen
und sogar zum Gemeinen hinabstieg, desto mehr fühlte sie
die Nothwendigkeit, durch die Gebundenheit der äusseren Form Haltung
und Schwung zu gewinnen. Die Verbindung des hochpoetischen
Tones mit der durchaus praktischen, altväterlichen, auf Sitteneinfachheit
und Bürgertugend gerichteten Gediegenheit der gehaltvollen Parabasen
ergreift nun, wie man lebhaft beim Lesen des Aristophanes fühlt,
das Gemüth in einem sich in seinem Tiefsten wieder vereinigenden Gegensatze.
Auch war den Griechen die Einmischung der Prosa in die Poesie,
wie wir sie bei den Indiern und Shakespeare finden, schlechterdings
fremd. Das empfundene Bedürfniss, sich auf der Bühne dem Gespräch
zu nähern, und das richtige Gefühl, dass auch die ausführlichste Erzählung,
einer spielenden Person in den Mund gelegt, sich von dem epischen
Vortrage des Rhapsoden, an den sie übrigens immer lebhaft erinnerte,
unterscheiden musste, liess für diese Theile des Dramas eigne
Sylbenmasse entstehen, gleichsam Vermittler zwischen der Kunstform
der Poesie und der natürlichen Einfachheit der Prosa. Auf diese selbst
wirkte aber dieselbe allgemeine Stimmung ein und gab auch ihr eine
äusserlich kunstvollere Gestaltung. Die nationelle Eigenthümlichkeit
zeigt sich besonders in der kritischen Ansicht und der Beurtheilung der
grossen Prosaisten. Die Ursach ihrer Trefflichkeit wird da, wo wir einen
ganz andren Weg einschlagen würden, vorzüglich in Feinheiten des Numerus,
kunstvollen Redefiguren und in Aeusserlichkeiten des Periodenbaues
gesucht. Die Zusammenwirkung des Ganzen, die Anschauung
der inneren Gedankenentwicklung, von welcher der Styl nur ein Abglänz
436ist, scheint uns bei Lesung solcher Schriften, wie z. B. der in diese
Materie einschlagenden Bücher des Dionysius von Halikarnass gänzlich
zu verschwinden. Es ist indess nicht zu läugnen, dass, Einseitigkeiten
und Spitzfindigkeiten dieser Art der Kritik abgerechnet, die Schönheit
jener grossen Muster mit auf diesen Einzelnheiten beruht, und das genauere
Studium dieser Ansicht führt uns zugleich tiefer in die Eigenthümlichkeit
des Griechischen Geistes ein. Denn die Werke des Genies
üben doch ihre Wirkung nur durch die Art, wie sie von den Nationen
aufgefasst werden, aus und gerade die Einwirkung auf die Sprachen,
mit der wir es hier zu thun haben, hängt vorzugsweise von dieser Auffassung
ab.
Die fortschreitende Bildung des Geistes führt zu einer Stufe, wo er,
gleichsam aufhörend zu ahnden und zu vermuthen, die Erkenntniss zu
begründen und ihren Inbegriff in Einheit zusammenzufügen strebt. Es
ist dies die Epoche der Entstehung der Wissenschaft und der sich aus
ihr entwickelnden Gelehrsamkeit und dieser Moment kann nicht anders,
als im höchsten Grade einflussreich auf die Sprache seyn. Von der,
sich in der Schule der Wissenschaft bildenden Terminologie habe ich
schon oben (VII191.) gesprochen. Des allgemeinen Einflusses aber dieser
Epoche ist es hier der Ort zu erwähnen, da die Wissenschaft in
strengem Verstande die prosaische Einkleidung fordert und eine poetische
ihr nur zufällig zu Theil werden kann. In diesem Gebiete nun hat
der Geist es ausschliesslich mit Objectivem zu.thun, mit Subjectivem
nur insofern, als dies Nothwendigkeit enthält; er sucht Wahrheit und
Absonderung alles äusseren und inneren Scheins. Die Sprache erhält
also erst durch diese Bearbeitung die letzte Schärfe in der Sonderung
und Feststellung der Begriffe und die reinste Abwägung der zu Einem
Ziele zusammenstrebenden Sätze und ihrer Theile. Da sich aber durch
die wissenschaftliche Form des Gebäudes der Erkenntniss und die Feststellung
des Verhältnisses der letzteren zu dem erkennenden Vermögen
dem Geiste etwas ganz Neues aufthut, welches alles Einzelne an Erhabenheit
übertrifft, so wirkt dies zugleich auf die Sprache ein, giebt ihr
einen Charakter höheren Ernstes und einer, die Begriffe zur höchsten
Klarheit bringenden Stärke. Auf der andren Seite erheischt aber ihr Gebrauch
in diesem Gebiete Kälte und Nüchternheit und in den Fügungen
Vermeidung jeder kunstvolleren, der Leichtigkeit des Verständnisses
schädlichen und dem blossen Zwecke der Darstellung des Objectes unangemessenen
Verschlingung. Der wissenschaftliche Ton der Prosa ist
also ein ganz anderer, als der bisher geschilderte. Die Sprache soll, ohne
eigne Selbstständigkeit geltend zu machen, sich nur dem Gedanken so
eng, als möglich, anschliessen, ihn begleiten und darstellen. In dem uns
übersehbaren Gange des menschlichen Geistes kann mit Recht Aristoteles
der Gründer der Wissenschaft und des auf sie gerichteten Sinnes
437genannt werden. Obgleich das Streben darnach natürlich viel früher
entstand und die Fortschritte allmählich waren, so schloss es sich doch
erst mit ihm zur Vollendung des Begriffes zusammen. Als wäre dieser
plötzlich in bis dahin unbekannter Klarheit in ihm hervorgebrochen,
zeigt sich zwischen seinem Vortrage und der Methodik seiner Untersuchungen
und der seiner unmittelbarsten Vorgänger eine entschiedene,
nicht stufenweis zu vermittelnde Kluft. Er forschte nach Thatsachen,
sammelte dieselben und strebte, sie zu allgemeinen Ideen hinzuleiten.
Er prüfte die vor ihm aufgebauten Systeme, zeigte ihre Unhaltbarkeit
und bemühte sich, dem seinigen eine auf tiefer Ergründung des erkennenden
Vermögens im Menschen ruhende Basis zu geben. Zugleich
brachte er alle Erkenntnisse, die sein riesenmässiger Geist umfasste, in
einen nach Begriffen geordneten Zusammenhang. Aus einem solchen,
zugleich tief strebenden und weitumfassenden, gleich streng auf Materie
und Form der Erkenntniss gerichteten Verfahren, in welchem die
Erforschung der Wahrheit sich vorzüglich durch scharfe Absonderung
alles verführerischen Scheins auszeichnete, musste bei ihm eine Sprache
entstehen, die einen auffallenden Gegensatz mit der seines unmittelbaren
Vorgängers und Zeitgenossen, des Plato, bildete. Man kann
beide in der That nicht in dieselbe Entwicklungsperiode stellen, muss
die Platonische Diction als den Gipfel einer nachher nicht wieder erstandenen,
die Aristotelische als eine neue Epoche beginnend ansehen.
Hierin erblickt man aber auffallend die Wirkung der eigenthümlichen
Behandlungsart der philosophischen Erkenntniss. Man irrte gewiss
sehr, wenn man Aristoteles mehr von Anmuth entblösste, schmucklose
und unläugbar oft harte Sprache einer natürlichen Nüchternheit und
gleichsam Dürftigkeit seines Geistes zuschreiben wollte. Musik und
Dichtung hatten einen grossen Theil seiner Studien beschäftigt. Ihre
Wirkung war, wie man schon an den wenigen von ihm übrigen Urtheilen
in diesem Gebiete sieht, tief in ihn eingegangen und nur angeborne
Neigung konnte ihn zu diesem Zweige der Literatur geführt haben. Wir
besitzen noch einen Hymnus voll dichterischen Schwunges von ihm,
und wenn seine exoterischen Schriften, besonders die Dialogen auf uns
gekommen wären, so würden wir wahrscheinlich ein ganz anderes Urtheil
über den Umfang seines Styles fällen. Einzelne Stellen seiner auf
uns gekommenen Schriften, besonders der Ethik zeigen, zu welcher
Höhe er sich zu erheben vermochte. Die wahrhaft tiefe und abgezogne
Philosophie hat auch ihre eignen Wege, zu einem Gipfel grosser Diction
zu gelangen. Die Gediegenheit und selbst die Abgeschlossenheit der
Begriffe giebt, wo die Lehre aus acht schöpferischem Geiste hervorgeht,
auch der Sprache eine mit der inneren Tiefe zusammenpassende Erhabenheit.
Eine Gestaltung des philosophischen Styls von ganz eigenthümlicher
438Schönheit findet sich auch bei uns in der Verfolgung abgezogener Begriffe
in Fichte's und Schelling's Schriften und, wenn auch nur einzeln,
aber dann wahrhaft ergreifend, in Kant. Die Resultate factisch wissenschaftlicher
Untersuchungen sind vorzugsweise nicht allein einer ausgearbeiteten
und sich aus tiefer und allgemeiner Ansicht des Ganzen der
Natur von selbst hervorbildenden grossartigen Prosa fähig, sondern
eine solche befördert die wissenschaftliche Untersuchung selbst, indem
sie den Geist entzündet, der allein in ihr zu grossen Entdeckungen führen
kann. Wenn ich hier der in dies Gebiet einschlagenden Werke meines
Bruders erwähne, so glaube ich nur ein allgemeines, oft ausgesprochenes
Urtheil zu wiederholen.
Das Feld des Wissens kann sich von allen Punkten aus zum Allgemeinen
zusammenwölben und gerade diese Erhebung und die genaueste
und vollständigste Bearbeitung der thatsächlichen Grundlagen hängen
auf das innigste zusammen. Nur wo die Gelehrsamkeit und das
Streben nach ihrer Erweiterung nicht von dem ächten Geiste durchdrungen
sind, leidet auch die Sprache und alsdann ist dies eine der Seiten,
von welcher der Prosa,, ebenso wie vom Herabsinken des gebildeten,
ideenreichen Gespräches zu alltäglichem oder conventionellem,
Verfall droht. Die Werke der Sprache können nur gedeihen, so lange
der, auf seine eigne sich erweiternde Ausbildung und auf die Verknüpfung
des Weltganzen mit seinem Wesen gerichtete Schwung des Geistes
sie mit sich emporträgt. Dieser Schwung erscheint in unzähligen Abstufungen
und Gestalten, strebt aber immer zuletzt, auch wo der Mensch
sich dessen nicht einzeln bewusst ist, seinem angeborenen Triebe gemäss
nach jener grossen Verknüpfung. Wo sich die intellectuelle Eigenthümlichkeit
der Nation nicht kräftig genug zu dieser Höhe erhebt oder
die Sprache im intellectuellen Sinken einer gebildeten Nation von dem
Geiste verlassen wird, dem sie allein ihre Kraft und ihr blühendes Leben
verdanken kann, entsteht nie eine grossartige Prosa oder zerfällt,
wenn sich das Schaffen des Geistes zu gelehrtem Sammeln verflacht.
Die Poesie kann nur einzelnen Momenten des Lebens und einzelnen
Stimmungen des Geistes angehören, die Prosa begleitet den Menschen
beständig und in allen Aeusserungen seiner geistigen Thätigkeit. Sie
schmiegt sich jedem Gedanken und jeder Empfindung an, und wenn sie
sich in einer Sprache durch Bestimmtheit, helle Klarheit, geschmeidige
Lebendigkeit, Wohllaut und Zusammenklang zu der Fähigkeit, sich von
jedem Punkte aus zu dem freiesten Streben zu erheben, aber zugleich
zu dem feinen Tact ausgebildet hat, wo und wie weit ihr diese Erhebung
in jedem einzelnen Falle zusteht, so verräth und befördert sie einen
ebenso freien, leichten, immer gleich behutsam fortstrebenden Gang
des Geistes. Es ist dies der höchste Gipfel, den die Sprache in der Ausbildung
ihres Charakters zu erreichen vermag und der daher, von den
439ersten Keimen ihrer äusseren Form an, der breitesten und sichersten
Grundlagen bedarf.
Bei einer solchen Gestaltung der Prosa kann die Poesie nicht zurückgeblieben
seyn, da beide aus gemeinschaftlicher Quelle fliessen. Sie
kann aber einen hohen Grad der Trefflichkeit erreichen, ohne dass auch
die Prosa zur gleichen Entwicklung in der Sprache gelangt. Vollendet
wird der Kreis dieser letzteren immer nur durch beide zugleich. Die
Griechische Literatur bietet uns, wenn auch mit grossen und bedaurungswürdigen
Lücken, den Gang der Sprache in dieser Rücksicht vollständiger
und reiner dar, als er uns sonst irgendwo erscheint. Ohne erkennbaren
Einfluss fremder gestalteter Werke, wodurch der fremder
Ideen nicht ausgeschlossen wird, entwickelt sie sich von Homer bis zu
den Byzantinischen Schriftstellern durch alle Phasen ihres Laufes allein
aus sich selbst und aus den Umgestaltungen des nationellen Geistes
durch innere und äussere geschichtliche Umwälzungen. Die Eigenthümlichkeit
der Griechischen Volksstämme bestand in einer, immer
zugleich nach Freiheit und Obermacht, die aber auch meistentheils gern
den Unterworfenen den Schein der ersteren erhielt, ringenden volksthümlichen
Beweglichkeit. Gleich den Wellen des sie umgebenden, eingeschlossenen
Meeres, brachte diese innerhalb derselben massigen
Gränzen unaufhörliche Veränderungen, Wechsel der Wohnsitze, der
Grosse und der Herrschaft hervor und gab dem Geiste beständig neue
Nahrung und Antrieb, sich in jeder Art der Thätigkeit zu ergiessen. Wo
die Griechen, wie bei Anlegung von Pflanzstädten, in die Ferne wirkten,
herrschte der gleiche volksthümliche Geist. So lange dieser Zustand
währte, durchdrang dies innerliche nationelle Princip die Sprache und
ihre Werke. In dieser Periode fühlt man lebendig den inneren fortschreitenden
Zusammenhang aller Geistesproducte, das lebendige Ineinandergreifen
der Poesie und der Prosa und aller Gattungen beider. Als aber
seit Alexander Griechische Sprache und Literatur durch Eroberung ausgebreitet
wurden und später, als besiegtem Volke angehörend, sich mit
dem weltbeherrschenden der Sieger verbanden, erhoben sich zwar noch
ausgezeichnete Köpfe und poetische Talente, aber das beseelende Princip
war erstorben und mit ihm das lebendige, aus der Fülle seiner eignen
Kraft entspringende Schaffen. Die Kunde eines grossen Theils des Erdbodens
wurde nun erst wahrhaft eröffnet, die wissenschaftliche Beobachtung
und die systematische Bearbeitung des gesammten Gebietes des
Wissens war, in wahrhaft welthistorischer Verbindung eines thaten- und
eines ideenreichen ausserordentlichen Mannes, durch Aristoteles Lehre
und Vorbild dem Geiste klar geworden. Die Welt der Objecte trat mit
überwiegender Gewalt dem subjectiven Schaffen gegenüber und noch
mehr wurde dieses durch die frühere Literatur niedergedrückt, welche,
da ihr beseelendes Princip mit der Freiheit, aus der es quoll, verschwunden
440war, auf einmal wie eine Macht erscheinen musste, mit der, wenn
auch vielfache Nachahmungen versucht wurden, doch kein wahrer
Wetteifer zu wagen war. Von dieser Epoche an beginnt also ein allmähliches
Sinken der Sprache und Literatur. Die wissenschaftliche Thätigkeit
wandte sich aber nun auf die Bearbeitung beider, wie sie aus dem
reinsten Zustande ihrer Blüthe übrig waren, so dass zugleich ein grosser
Theil der Werke aus den besten Epochen und die Art, wie sich diese
Werke in der absichtlich auf sie gerichteten Betrachtung späterer Generationen
desselben, sich immer gleichen, aber durch äussere Schicksale
herabgedrückten Volkes abspiegelten, auf uns gekommen sind.
Vom Sanskrit lässt sich, unserer Kenntniss der Literatur desselben
nach, nicht mit Sicherheit beurtheilen, bis auf welchen Grad und Umfang
auch die Prosa in ihm ausgebildet war. Die Verhältnisse des bürgerlichen
und geselligen Lebens boten aber in Indien schwerlich die gleichen
Veranlassungen zu dieser Ausbildung dar. Der Griechische Geist
und Charakter gieng schon an sich mehr, als vielleicht je bei einer Nation
der Fall war, auf solche Vereinigungen hin, in welchem das Gespräch,
wenn nicht der alleinige Zweck, doch die hauptsächlichste
Würze war. Die Verhandlungen vor Gericht und in der Volksversammlung
forderten Ueberzeugung wirkende und die Gemüther lenkende Beredsamkeit.
In diesen und ähnlichen Ursachen kann es liegen, wenn
man auch künftig unter den Ueberresten der Indischen Literatur nichts
entdeckt, was man im Style den Griechischen Geschichtsschreibern,
Rednern und Philosophen an die Seite stellen könnte. Die reiche, beugsame,
mit allen Mitteln, durch welche die Rede Gediegenheit, Würde
und Anmuth erhält, ausgestattete Sprache bewahrt sichtbar alle Keime
dazu in sich und würde in der höheren prosaischen Bearbeitung noch
ganz andere Charakter Seiten, als wir an ihr jetzt kennen, entwickelt haben.
Dies beweist schon der einfache, anmuthvolle, auf bewunderungswürdige
Weise zugleich durch getreue und zierliche Schilderung und
eine ganz eigenthümliche Verstandesschärfe anziehende Ton der Erzählungen
des Hitôpadêša.
Die Römische Prosa stand in einem ganz andren Verhältnisse zur
Poesie, als die Griechische. Hierauf wirkte bei den Römern gleich stark
ihre Nachahmung der Griechischen Muster und ihre eigne, überall hervorleuchtende
Originalität. Denn sie drückten ihrer Sprache und ihrem
Style sichtbar das Gepräge ihrer inneren und äusseren politischen Entwicklung
auf. Mit ihrer Literatur in ganz andre Zeitverhältnisse versetzt,
konnte bei ihnen keine ursprünglich naturgemässe Entwicklung
statt finden, wie wir sie bei den Griechen vom Homerischen Zeitalter
an und durch den dauernden Einfluss jener frühesten Gesänge wahrnehmen.
Die grosse, originelle Römische Prosa entspringt unmittelbar
aus dem Gemüth und Charakter, dem männlichen Ernst, der Sittenstrenge
441und der ausschliessenden Vaterlandsliebe, bald an sich, bald im
Contraste mit späterer Verderbniss. Sie hat viel weniger eine bloss intellectuelle
Farbe und muss aus allen diesen Gründen zusammengenommen
der naiven Anmuth einiger Griechischen Schriftsteller entbehren,
die bei den Römern nur in poetischer Stimmung, da die Poesie das Gemüth
in jeden Zustand zu versetzen vermag, hervortritt. Ueberhaupt
erscheinen fast in allen Vergleichungen, die sich zwischen Griechischen
und Römischen Schriftstellern anstellen lassen, die ersteren minder feierlich,
einfacher und natürlicher. Hieraus entsteht ein mächtiger Unterschied
zwischen der Prosa beider Nationen und es ist kaum glaublich,
dass ein Schriftsteller wie Tacitus von den Griechen seiner Zeit wahrhaft
empfunden worden sey. Eine solche Prosa musste um so mehr auch
anders auf die Sprache einwirken, als beide den gleichen Impuls von
derselben Nationaleigenthümlichkeit empfiengen. Eine gleichsam unbeschränkte,
sich jedem Gedanken hingebende, jede Bahn des Geistes
mit gleicher Leichtigkeit verfolgende und gerade in dieser Allseitigkeit
und nichts zurückstossenden Beweglichkeit ihren wahren Charakter
findende Geschmeidigkeit konnte aus solcher Prosa nicht entspringen
und ebenso wenig eine solche erzeugen. Ein Blick in die Prosa der neuern
Nationen würde in noch verwickeltere Betrachtungen führen, da
die Neueren, wo sie nicht selbst original sind, nicht vermeiden konnten,
verschieden von den Römern und Griechen angezogen zu werden, zugleich
aber ganz neue Verhältnisse auch eine bis dahin unbekannte Originalität
in ihnen erzeugten. Ich begnüge mich nur mit der Bemerkung,
[dass] was die Verschiedenheit des Verhältnisses [betrifft], in welches
Prosa und Poesie sich gegen einander stellen und dadurch auf den Geist
zurückwirken, immer nur eines in einer Nation und Sprache vorhanden
seyn kann. In einem Stamme von Sprachen aber lässt sich in den einzelnen
desselben diese Verschiedenheit in grösserem Umfange übersehen
und stellt sich dann den Fortschritten der Bildung im Laufe der Jahrhunderte
gemäss in organischer Entwicklungsfolge dar. Die Grundlage
bleibt immer die dem ganzen Stamme eigenthümliche äussere Form,
das gemeinsame Bestreben der übereinkommenden intellectuellen
Eigenthümlichkeiten. Die Verschiedenheit bilden innerhalb dieses Gemeinsamen
die Charaktere der einzelnen Nationen und das Zeitalter, in
welchem jede den Grad der Geistigkeit erreicht, aus welchem Poesie
und Prosa hervorblühen. Hierzu wende ich mich daher jetzt.
Vorher aber muss ich noch eines andren, im Vorigen nicht betrachteten
Verhältnisses der Poesie zur Prosa gedenken, nemlich der Beziehung
beider auf die Schrift. Es ist seit den meisterhaften Wolfischen
Untersuchungen über die Entstehung der Homerischen Gedichte wohl
allgemein anerkannt, dass die Poesie eines Volkes noch lange nach der
Erfindung der Schrift unaufgezeichnet bleiben kann und dass beide
442Epochen durchaus nicht nothwendig zusammenfallen. Bestimmt, die
Gegenwart des Augenblicks zu verherrlichen und zur Begehung festlicher
Gelegenheiten mitzuwirken, war die Poesie in den frühesten Zeiten
zu innig mit dem Leben verknüpft, gieng zu freiwillig zugleich aus
der Einbildungskraft des Dichters und der Auffassung der Hörer hervor,
als dass ihr die Absichtlichkeit kalter Aufzeichnung nicht hätte
fremd bleiben sollen. Sie entströmte den Lippen des Dichters oder der
Sängerschule, welche seine Gedichte in sich aufgenommen hatte; es
war ein lebendiger, mit Gesang und Instrumentalmusik begleiteter Vortrag.
Die Worte machten von diesem nur einen Theil aus und waren mit
ihm unzertrennlich verbunden. Dieser ganze Vortrag wurde der Folgezeit
zugleich überliefert und es konnte nicht in den Sinn kommen, das
so fest Verschlungene absondern zu wollen. Nach der ganzen Weise,
wie in dieser Periode des geistigen Volkslebens die Poesie in demselben
Wurzel schlug, entstand gar nicht der Gedanke der Aufzeichnung. Diese
setzte erst die Reflexion voraus, die sich immer aus der, eine Zeit hindurch
bloss natürlich geübten Kunst entwickelt, und eine grössere Entfaltung
der Verhältnisse des bürgerlichen Lebens, welche den Sinn
hervorruft, die Thätigkeiten zu sondern und ihre Erfolge dauernd zusammenwirken
zu lassen. Erst dann konnte die Verbindung der Poesie
mit dem Vortrag und dem augenblicklichen Lebensgenuss loser werden.
Die Nothwendigkeit der poetischen Wortstellung und das Metrum
machten es auch grossentheils überflüssig, der Ueberlieferung vermittelst
des Gedächtnisses durch Schrift zu Hülfe zu kommen.
Bei der Prosa verhielt sich dies alles ganz anders. Die Hauptschwierigkeit
lässt sich zwar meiner Ueberzeugung nach hier nicht in der Unmöglichkeit
suchen, längere ungebundene Rede dem Gedächtniss anzuvertrauen.
Es giebt gewiss bei den Völkern auch bloss nationelle, durch
mündliche Ueberlieferung aufbewahrte Prosa, bei welcher die Einkleidung
und der Ausdruck sicher nicht zufällig sind. Wir finden in den Erzählungen
von Nationen, welche gar keine Schrift besitzen, einen Gebrauch
der Sprache, eine Art des Styls, welchen man es ansieht, dass sie
gewiss nur mit kleinen Veränderungen von Erzähler zu Erzähler übergegangen
sind. Auch die Kinder bedienen sich bei Wiederholung gehörter
Erzählungen gewöhnlich gewissenhaft derselben Ausdrücke. Ich
brauche hier nur an die Erzählung von Tangaloa.auf den Tonga-Inseln
zu erinnern. 37 Unter den Vasken gehen noch heute solche unaufgezeichnet
bleibenden Mährchen herum, die, zum sichtbaren Beweise, dass
auch und ganz vorzüglich die äussere Form dabei beachtet wird, nach
der Versicherung der Eingebornen allen ihren Reiz und ihre natürliche
Grazie durch Uebertragung in das Spanische verlieren. Das Volk ist ihnen
dergestalt ergeben, dass sie ihrem Inhalte nach in verschiedene
Classen getheilt werden. Ich hörte selbst ein solches, unserer Sage vom
443Hamelnschen Rattenfänger ganz ähnliches erzählen; andere stellen, nur
auf verschiedene Weise verändert, Mythen des Hercules und ein ganz
locales von einer kleinen, dem Lande vorliegenden Insel 38 die Geschichte
Hero's und Leander's, auf einen Mönch und seine Geliebte übertragen,
dar. Allein die Aufzeichnung, zu welcher der Gedanke bei der frühesten
Poesie gar nicht entsteht, liegt dennoch bei der Prosa
nothwendig und unmittelbar, auch ehe sie sich zur wahrhaft kunstvollen
erhebt, in dem ursprünglichen Zweck. Thatsachen sollen erforscht
oder dargestellt, Begriffe entwickelt und verknüpft, also etwas Objectives
ausgemittelt werden. Die Stimmung, welche dies hervorzubringen
strebt, ist eine nüchterne, auf Forschung gerichtete, Wahrheit von
Schein sondernde, dem Verstande die Leitung des Geschäfts übertragende.
Sie stösst also zuerst das Metrum zurück, nicht gerade wegen
der Schwierigkeit seiner Fesseln, sondern weil das Bedürfniss darnach
in ihr nicht gegründet seyn kann, ja vielmehr der Allseitigkeit des überall
hin forschenden und verknüpfenden Verstandes eine, die Sprache
nach einem bestimmten Gefühle einengende Form nicht zusagt. Aufzeichnung
wird nun hierdurch und durch das ganze Unternehmen wünschenswerth,
ja selbst unentbehrlich. Das Erforschte und selbst der
Gang der Forschung muss in allen Einzelnheiten fest und sicher dastehen.
Der Zweck selbst ist möglichste Verewigung: Geschichte soll das
sonst im Laufe der Zeit Verfliegende erhalten, Lehre zu weiterer Entwicklung
ein Geschlecht an das andere knüpfen. Die Prosa begründet
und befestigt auch erst das namentliche Heraustreten Einzelner aus der
Masse in Geisteserzeugnissen, da die Forschung persönliche Erkundigungen,
Besuche fremder Länder und eigen gewählte Methoden der
Verknüpfung mit sich führt, die Wahrheit, besonders in Zeiten, wo andere
Beweise mangeln, eines Gewährsmannes bedarf und der Geschichtschreiber
nicht, wie der Dichter, seine Beglaubigung vom Olymp
ableiten kann. Die sich in einer Nation entwickelnde Stimmung zur
Prosa muss daher die Erleichterung der Schriftmittel suchen und kann
durch die schon vorhandene angeregt werden.
In der Poesie entstehen durch den natürlichen. Gang der Bildung der
Völker zwei, gerade durch die Entbehrung und den Gebrauch der
Schrift zu bezeichnende, verschiedene Gattungen, 39 eine gleichsam vorzugsweise
natürliche, der Begeisterung ohne Absicht und Bewusstseyn
der Kunst entströmende und eine spätere kunstvollere, doch darum
nicht minder dem tiefsten und ächtesten Dichtergeiste angehörende.
Bei der Prosa kann dies nicht auf dieselbe Weise und noch weniger in
denselben Perioden statt finden. Allein in anderer Art ist dasselbe auch
bei ihr der Fall. Wenn sich nemlich in einem für Prosa und Poesie glücklich
organisirten Volke Gelegenheiten ausbilden, wo das Leben frei hervorströmender
Beredsamkeit bedarf, so ist hier, nur auf andere Weise,
444eine ähnliche Verknüpfung der Prosa mit dem Volksleben, als wir sie
oben bei der Poesie gefunden haben. Sie stösst dann auch, so lange sie
ohne Bewusstseyn absichtlicher Kunst fortdauert, die todte und kalte
Aufzeichnung zurück. Dies war wohl gewiss in den grossen Zeiten
Athens zwischen dem Perserkriege und dem Peloponnesischen und
noch später der Fall. Redner wie Themistokles, Perikles und Alcibiades
entwickelten gewiss mächtige Rednertalente; von den beiden letzteren
wird dies ausdrücklich herausgehoben. Dennoch sind von ihnen keine
Reden, da die in den Geschichtschreibern natürlich nur diesen angehören,
auf uns gekommen und auch das Alterthum scheint keine ihnen mit
Sicherheit beigelegte Schriften besessen zu haben. Zu Alcibiades Zeit
gab es zwar schon aufgezeichnete und sogar von Andren, als ihren Verfassern
gehalten zu werden bestimmte Reden; es lag aber doch in allen
Verhältnissen des Staatslebens jener Periode, dass diese Männer, welche
wirklich Lenker des Staates waren, keine Veranlassung fanden, ihre
Reden, weder ehe sie dieselben hielten, noch nachher niederzuschreiben.
Dennoch bewahrt diese natürliche Beredsamkeit gewiss ebenso
wie jene Poesie nicht nur den Keim, sondern war in vielen Stücken das
unübertroffne Vorbild der späteren kunstvolleren. Hier aber, wo von
dem Einflüsse beider Gattungen auf die Sprache die Rede ist, konnte
die nähere Erwägung dieses Verhältnisses nicht übergangen werden.
Die späteren Redner empfiengen die Sprache aus einer Zeit, wo schon
in bildender und dichtender Kunst so Grosses und Herrliches das Genie
der Redner angeregt und den Geschmack des Volkes gebildet hatte, in
einer ganz andren Fülle und Feinheit, als deren sie sich früher zu rühmen
vermöchte. Etwas sehr Aehnliches musste das lebendige Gespräch
in den Schulen der Philosophen darbieten.
Kraft der Sprachen, sich glücklich aus einander zu entwickeln
34. Es ist bewundrungswürdig zu sehen, welche lange Reihe von Sprachen
gleich glücklichen Baues und gleich anregender Wirkung auf den
Geist diejenige hervorgebracht hat, die wir an die Spitze des Sanskritischen
Stammes stellen müssen, wenn wir einmal überhaupt in jedem
Stamme Eine Ur- oder Muttersprache voraussetzen. Um nur die uns am
meisten nahe liegenden Momente hier aufzuzählen, so finden wir zuerst
das Zend und das Sanskrit in enger Verwandtschaft, aber auch in
merkwürdiger Verschiedenheit, das eine und das andre von dem lebendigsten
Principe der Fruchtbarkeit und Gesetzmässigkeit in Wort- und
Formenbildung durchdrungen. Dann giengen aus diesem Stamm die
beiden Sprachen unsrer classischen Gelehrsamkeit hervor und, wenn
auch in späterer wissenschaftlicher Entwicklung, der ganze Germanische
445Sprachzweig. Endlich, als die Römische Sprache durch Verderbniss
und Verstümmlung entartete, blühten, wie mit erneuerter Lebenskraft,
aus derselben die Romanischen Sprachen auf, welchen unsere
heutige Bildung so unendlich viel verdankt. Jene Ursprache bewahrte
also ein Lebensprincip in sich, an welchem sich wenigstens drei Jahrtausende
hindurch der Faden der geistigen Entwicklung des Menschengeschlechts
fortzuspinnen vermochte und das selbst aus dem Verfallnen
und Zersprengten neue Sprachbildungen zu regeneriren Kraft
besass.
Man hat wohl in der Völkergeschichte die Frage aufgeworfen, was
aus den Weltbegebenheiten geworden seyn würde, wenn Carthago
Rom besiegt und das Europäische Abendland beherrscht hätte. Man
kann mit gleichem Rechte fragen: in welchem Zustande sich unsre heutige
Cultur befinden würde, wenn die Araber, wie sie es eine Zeit hindurch
waren, im alleinigen Besitz der Wissenschaft geblieben wären
und sich über das Abendland verbreitet hätten? Weniger günstiger Erfolg
scheint mir in beiden Fällen nicht zweifelhaft. Derselben Ursache,
welche die Römische Weltherrschaft hervorbrachte, dem Römischen
Geist und Charakter, nicht äusseren, mehr zufälligen Schicksalen verdanken
wir den mächtigen Einfluss dieser Weltherrschaft auf unsre
bürgerlichen Einrichtungen, Gesetze, Sprache und Cultur. Durch die
Richtung auf diese Bildung und durch innre Stammverwandtschaft
wurden wir wirklich für Griechischen Geist und Griechische Sprache
empfänglich, da die Araber vorzugsweise nur an den wissenschaftlichen
Resultaten Griechischer Forschung hiengen. Sie würden, auch auf
der Grundlage desselben Alterthums, nicht das Gebäude der Wissenschaft
und Kunst aufzuführen vermocht haben, dessen wir uns mit
Recht rühmen.
Nimmt man nun dies als richtig an, so fragt sich, ob dieser Vorzug
der Völker Sanskritischen Stammes in ihren intellectuellen Anlagen
oder in ihrer Sprache oder in günstigeren geschichtlichen Schicksalen
zu suchen ist? Es springt in die Augen, dass man keine dieser Ursachen
als allein wirkend ansehen darf. Sprache und intellectuelle Anlagen lassen
sich in ihrer beständigen Wechselwirkung nicht von einander trennen
und auch die geschichtlichen Schicksale möchten, wenn uns gleich
der Zusammenhang bei weitem nicht in allen Punkten durchschimmert,
von dem innren Wesen der Völker und Individuen so unabhängig nicht
seyn. Dennoch muss jener Vorzug sich an irgend etwas in der Sprache
erkennen lassen und wir haben daher hier noch, vom Beispiele des
Sanskritischen Sprachstammes ausgehend, die Frage zu untersuchen,
woran es liegt, dass eine Sprache vor der andren ein stärker und mannigfaltiger
aus sich heraus erzeugendes Lebensprincip besitzt? Die Ursach
liegt, wie man hier deutlich sieht, in zwei Punkten, darin, dass es
446ein Stamm von Sprachen, keine einzelne ist, wovon wir hier reden,
dann aber in der individuellen Beschaffenheit des Sprachbaues selbst.
Ich bleibe hier zunächst bei der letzteren stehen, da ich auf die besondren
Verhältnisse der, einen Stamm bildenden Sprachen erst in der
Folge zurückkommen kann.
Es ergiebt sich von selbst, dass die Sprache, deren Bau dem Geiste
am meisten zusagt und seine Thätigkeit am lebendigsten anregt, auch
die dauerndste Kraft besitzen muss, alle neue Gestaltungen aus sich
hervorgehen zu lassen, welche der Lauf der Zeit und die Schicksale der
Völker herbeiführen. Eine solche auf die ganze Sprachform verweisende
Beantwortung der aufgeworfenen Frage ist aber viel zu allgemein
und giebt genau genommen nur die Frage in andren Worten zurück.
Wir bedürfen aber hier einer auf specielle Punkte führenden und eine
solche scheint mir auch möglich. Die Sprache, im einzelnen Wort und
in der verbundenen Rede, ist ein Act, eine wahrhaft schöpferische
Handlung des Geistes, und dieser Act ist in jeder Sprache ein individueller,
in einer von allen Seiten bestimmten Weise verfahrend. Begriff
und Laut, auf eine ihrem wahren Wesen gemässe, nur an der Thatsache
selbst erkennbare Weise verbunden, werden als Wort und als Rede hinausgestellt
und dadurch zwischen der Aussenwelt und dem Geiste etwas
von beiden Unterschiedenes geschaffen. Von der Stärke und Gesetzmässigkeit
dieses Actes hängt die Vollendung der Sprache in allen
ihren einzelnen Vorzügen, welchen Namen sie immer führen mögen, ab
und auf ihr beruht also auch das in ihr lebende, weiter erzeugende Princip.
Es ist aber nicht einmal nöthig, auch der Gesetzmässigkeit dieses
Actes zu erwähnen; denn diese liegt schon im Begriffe der Stärke. Die
volle Kraft entwickelt sich immer nur auf dem richtigen Wege. Jeder
unrichtige stösst auf eine die vollkommne Entwicklung hemmende
Schranke. Wenn also die Sanskritischen Sprachen mindestens drei Jahrtausende
hindurch Beweise ihrer zeugenden Kraft gegeben haben, so ist
dies lediglich eine Wirkung der Stärke des spracherschaffenden Actes
in den Völkern, welchen sie angehörten.
Wir haben im Vorigen (§.22.) ausführlich von der Zusammenfügung
der inneren Gedankenform mit dem Laute gesprochen und in ihr
eine Synthesis erkannt, die, was nur durch einen wahrhaft schöpferischen
Act des Geistes möglich ist, aus den beiden zu verbindenden Elementen
ein drittes hervorbringt, in welchem das einzelne Wesen beider
verschwindet. Diese Synthesis ist es, auf deren Stärke es hier ankommt.
Der Völkerstamm wird in der Spracherzeugung der Nationen den Sieg
erringen, welcher diese Synthesis mit der grössten Lebendigkeit und der
ungeschwächtesten Kraft vollbringt. In allen Nationen mit unvollkommneren
Sprachen ist diese Synthesis von Natur schwach oder wird
durch irgend einen hinzutretenden Umstand gehemmt und gelähmt.
447Allein auch diese Bestimmungen zeigen noch zu sehr im Allgemeinen,
was sich doch in den Sprachen selbst bestimmt und als Thatsache nachweisen
lässt.
Act des selbstthätigen Setzens in den Sprachen
Es giebt nemlich Punkte im grammatischen Baue der Sprachen, in welchen
jene Synthesis und die sie hervorbringende Kraft gleichsam nackter
und unmittelbarer ans Licht treten und mit denen der ganze übrige
Sprachbau dann auch nothwendig im engsten Zusammenhange steht.
Da die Synthesis, von welcher hier die Rede ist, keine Beschaffenheit,
nicht einmal eigentlich eine Handlung, sondern ein wirkliches, immer
augenblicklich vorübergehendes Handeln selbst ist, so kann es für sie
kein besonderes Zeichen an den Worten geben und das Bemühen, ein
solches Zeichen zu finden, würde schon an sich den Mangel der wahren
Stärke des Actes durch die Verkennung seiner Natur beurkunden. Die
wirkliche Gegenwart der Synthesis muss gleichsam immateriell sich in
der Sprache offenbaren, man muss inne werden, dass sie, gleich einem
Blitze, dieselbe durchleuchtet und die zu verbindenden Stoffe, wie eine
Gluth aus unbekannten Regionen, in einander verschmolzen hat. Dieser
Punkt ist zu wichtig, um nicht eines Beispiels zu bedürfen. Wenn in
einer Sprache eine Wurzel durch ein Suffix zum Substantivum gestempelt
wird, so ist das Suffix das materielle Zeichen der Beziehung des
Begriffs auf die Kategorie der Substanz. Der synthetische Act aber,
durch welchen unmittelbar beim Aussprechen des Wortes diese Versetzung
im Geiste wirklich vor sich geht, hat in dem Worte selbst kein eignes
einzelnes Zeichen, sondern sein Daseyn offenbart sich durch die
Einheit und Abhängigkeit von einander, zu welcher Suffix und Wurzel
verschmolzen sind, also durch eine verschiedenartige, indirecte, aber
aus dem nemlichen Bestreben fliessende Bezeichnung.
Wie ich es hier in diesem einzelnen Falle gethan habe, kann man diesen
Act überhaupt den Act des selbstthätigen Setzens durch Zusammenfassung
(Synthesis) nennen. Er kehrt überall in der Sprache zurück.
Am deutlichsten und offenbarsten erkennt man ihn in der
Satzbildung, dann in den durch Flexion oder Affixe abgeleiteten Wörtern,
endlich überhaupt in allen Verknüpfungen des Begriffs mit dem
Laute. In jedem dieser Fälle wird durch Verbindung etwas Neues geschaffen
und wirklich als etwas (ideal) für sich Bestehendes gesetzt.
Der Geist schafft, stellt sich aber das Geschaffene durch denselben Act
gegenüber und lässt es, als Object, auf sich zurückwirken. So entsteht
aus der sich im Menschen reflectirenden Welt zwischen ihm und ihr die
ihn mit ihr verknüpfende und sie durch ihn befruchtende Sprache. Auf
448diese Weise wird es klar, wie von der Stärke dieses Actes das ganze, eine
bestimmte Sprache durch alle Perioden hindurch beseelende Leben abhängt.
Wenn man nun aber zum Behuf der historischen und praktischen
Prüfung und Beurtheilung der Sprachen, von der ich mich in dieser Untersuchung
niemals entferne, nachforscht, woran die Stärke dieses Actes
in ihrem Baue erkennbar ist, so zeigen sich vorzüglich drei Punkte,
an welchen er haftet und bei denen man den Mangel seiner ursprünglichen
Stärke durch ein Bemühen, denselben auf andrem Wege zu ersetzen,
angedeutet findet. Denn auch hier äussert sich, worauf wir schon
im Vorigen mehrmals zurückgekommen sind, dass das richtige Verlangen
der Sprache (also z. B. im Chinesischen die Abgränzung der Redetheile)
im Geiste immer vorhanden, allein nicht immer so durchgreifend
lebendig ist, dass es sich auch wieder im Laute darstellen sollte. Es entsteht
alsdann im äusseren grammatischen Baue eine durch den Geist zu
ergänzende Lücke oder Ersetzung durch unadaequate Analoga. Auch
hier also kommt es auf eine solche Auffindung des synthetischen Actes
im Sprachbaue an, die nicht bloss seine Wirksamkeit im Geistes sondern
seinen wahren Uebergang in die Lautformung nachweist. Jene drei
Punkte sind nun das Verbum, die Conjunction und das Pronomen relativum
und wir müssen bei jedem derselben noch einige Augenblicke
verweilen.
Act des selbstthätigen Setzens in den Sprachen. Verbum
Das Verbum (um zuerst von diesem allein zu sprechen) unterscheidet
sich vom Nomen und den andren, möglicherweise im einfachen Satze
vorkommenden Redetheilen mit schneidender Bestimmtheit dadurch,
dass ihm allein der Act des synthetischen Setzens als grammatische
Function beigegeben ist. Es ist ebenso, als das declinirte Nomen, in der
Verschmelzung seiner Elemente mit dem Stammworte durch einen solchen
Act entstanden, es hat aber auch diese Form erhalten, um die Obliegenheit
und das Vermögen zu besitzen, diesen Act in Absicht des Satzes
wieder selbst auszuüben. Es liegt daher zwischen ihm und den
übrigen Wörtern des einfachen Satzes ein Unterschied, der diese mit
ihm zur gleichen Gattung zu zählen verbietet. Alle übrigen Wörter des
Satzes sind gleichsam todt daliegender, zu verbindender Stoff, das Verbum
allein ist der, Leben enthaltende und Leben verbreitende Mittelpunkt.
Durch einen und ebendenselben synthetischen Act knüpft es
durch das Seyn das Praedicat mit dem Subjecte zusammen, allein so,
dass das Seyn, welches mit einem energischen Praedicate in ein Handeln
übergeht, dem Subjecte selbst beigelegt, also das bloss als verknüpfbar
449Gedachte zum Zustande oder Vorgange in der Wirklichkeit
wird. Man denkt nicht bloss den einschlagenden Blitz, sondern der Blitz
ist es selbst, der herniederfährt; man bringt nicht bloss den Geist und
das unvergängliche als verknüpfbar zusammen, sondern der Geist ist
unvergänglich. Der Gedanke, wenn man sich so sinnlich ausdrücken
könnte, verlässt durch das Verbum seine innre Wohnstätte und tritt in
die Wirklichkeit über.
Wenn nun hierin die unterscheidende Natur und die eigenthümliche
Function des Verbum liegt, so muss die grammatische Gestaltung desselben
in jeder einzelnen Sprache kund geben, ob und auf welche Weise
sich gerade diese charakteristische Function in der Sprache andeutet?
Man pflegt wohl, um einen Begriff von der Beschaffenheit und dem
Unterschiede der Sprachen zu geben, anzuführen, wie viel Tempora,
Modi und Conjugationen das Verbum in ihnen hat, die verschiedenen
Arten der Verba aufzuzählen u.s.f. Alle hier genannten Punkte haben
ihre unbestreitbare Wichtigkeit. Allein über das wahre Wesen des Verbum,
insofern es der Nerv der ganzen Sprache ist, lassen sie ohne Belehrung.
Das, worauf es ankommt, ist, ob und wie sich am Verbum einer
Sprache seine synthetische Kraft, die Function, vermöge welcher es
Verbum ist, 40 äussert, und diesen Punkt lässt man nur zu häufig ganz
unberührt. Man geht auf diese Weise nicht tief genug und nicht bis zu
den wahren innren Bestrebungen der Sprachformung zurück, sondern
bleibt bei den Aeusserlichkeiten des Sprachbaues stehen, ohne zu bedenken,
dass diese erst dadurch Bedeutung erlangen, dass zugleich ihr
Zusammenhang mit jenen tiefer liegenden Richtungen dargethan wird.
Im Sanskrit beruht die Andeutung der zusammenfassenden Kraft
des Verbum allein auf der grammatischen Behandlung dieses Redetheiles
und lässt, da sie durchaus seiner Natur folgt, schlechterdings nichts
zu vermissen übrig. Wie das Verbum sich in dem hier in Rede stehenden
Punkte von allen übrigen Redetheilen des einfachen Satzes dem Wesen
nach unterscheidet, so hat es im Sanskrit durchaus nichts mit dem Nomen
gemein, sondern beide stehen vollkommen rein und geschieden da.
Man kann zwar aus dem geformten Nomen in gewissen Fällen abgeleitete
Verba bilden. Dies ist aber weiter nichts, als dass das Nomen, ohne
Rücksicht auf diese seine besondere Natur, wie ein Wurzelwort behandelt
wird. Seine Endung, also gerade sein grammatisch bezeichnender
Theil erfährt dabei mehrfache Aenderungen. Auch kommt gewöhnlich
ausser der in der Abwandlung liegenden Verbalbehandlung noch eine
Sylbe oder ein Buchstabe hinzu, welcher zu dem Begriffe des Nomen
einen zweiten einer Handlung fügt. Dies ist in der Sylbe kâmy von
kâma, Verlangen, unmittelbar deutlich. Sollten aber auch die übrigen
Einschiebsel andrer Art, wie y, sy u.s.f., keine reale Bedeutung besitzen,
so drücken sie ihre Verbalbeziehungen dadurch formal aus, dass
450sie bei den primitiven, aus wahren Wurzeln entstehenden Verben
gleichfalls, und wenn man in die Untersuchung der einzelnen Fälle eingeht,
auf sehr analoge Weise Platz finden. Dass Nomina ohne solchen
Zusatz in Verba übergehen, ist bei weitem der seltenste Fall. Ueberhaupt
hat aber von dieser ganzen Verwandlung der Nomina in Verba
die ältere Sprache nur sehr sparsamen Gebrauch gemacht.
Wie zweitens das Verbum in seiner hier betrachteten Function niemals
substanzartig ruht, sondern immer in einem einzelnen, von allen
Seiten bestimmten Handeln erscheint, so vergönnt ihm auch die Sprache
keine Ruhe. Sie bildet nicht, wie beim Nomen, erst eine Grundform,
an welche sie die Beziehungen anhängt, und selbst ihr Infinitiv ist
nicht verbaler Natur, sondern ein deutlich, auch nicht aus einem Theile
des Verbum, sondern aus der Wurzel selbst abgeleitetes Nomen. Dies
ist nun zwar ein Mangel in der Sprache zu nennen, die in der That die
ganz eigenthümliche Natur des Infinitivs zu verkennen scheint. Es beweist
aber nur noch mehr, wir sorgfältig sie jeden Schein der Nominalbeschaffenheit
von dem Verbum zu entfernen bemüht ist. Das Nomen
ist eine Sache und kann, als solche, Beziehungen eingehen und die Zeichen
derselben annehmen. Das Verbum ist, als augenblicklich verfliegende
Handlung, nichts als ein Inbegriff von Beziehungen und so stellt
es die Sprache in der That dar. Ich brauche hier kaum zu bemerken,
dass es wohl niemandem einfallen kann, die Classensylben der speciellen
Tempora des Sanskritischen Verbum als den Grundformen des Nomen
entsprechend anzusehen. Wenn man die Verba der vierten und
zehnten Classe ausnimmt, von welchen sogleich weiter unten die Rede
seyn wird, so bleiben nur Vocale mit oder ohne eingeschobene Nasenlaute
übrig, also sichtbar nur phonetische Zusätze zu der in die Verbalform
übergehenden Wurzel.
Wie endlich drittens überhaupt in den Sprachen die innere Gestaltung
eines Redetheils sich ohne directes Lautzeichen durch die symbolische
Lauteinheit der grammatischen Form ankündigt, so kann man mit
Wahrheit behaupten, dass diese Einheit in den Sanskritischen Verbalformen
noch viel enger, als in den nominalen geschlossen ist. Ich habe
schon im Vorigen darauf aufmerksam gemacht, dass das Nomen in seiner
Abwandlung niemals einen Stammvocal, wie das Verbum so häufig,
durch Gunirung steigert. Die Sprache scheint hierin offenbar eine Absonderung
des Stammes von dem Suffix, die sie im Verbum gänzlich
verlöscht, im Nomen noch allenfalls dulden zu wollen. Mit Ausnahme
der Pronominal-Suffixa in den Personenendungen ist auch die Bedeutung
der nicht bloss phonetischen Elemente der Verbalbildungen viel
schwieriger zu entdecken, als dies wenigstens in einigen Punkten der
Nominalbildung der Fall ist. Wenn man als die Scheidewand der von
dem wahren Begriff der grammatischen Formen ausgehenden (flectirenden)
451und der unvollkommen zu ihnen hinstrebenden (agglutinirenden)
Sprachen den zwiefachen Grundsatz aufstellt: aus der Form ein
einzeln ganz unverständliches Zeichen zu bilden oder zwei bedeutsame
Begriffe nur eng aneinander zu heften, so tragen in der ganzen Sanskritsprache
die Verbalformen den ersteren am deutlichsten an sich. Diesem
Gange zufolge ist die Bezeichnung jeder einzelnen Beziehung nicht dieselbe,
sondern nur analogisch gleichförmig und der einzelne Fall wird
besonders, nur mit Bewahrung der allgemeinen Analogie, nach den
Lauten der Bezeichnungsmittel und des Stammes behandelt. Daher haben
die einzelnen Bezeichnungsmittel verschiedene, nur immer auf bestimmte
Fälle anzuwendende Eigenheiten, wie ich hieran schon oben
(VII135-137.) bei Gelegenheit des Augments und der Reduplication
erinnert habe. Wahrhaft bewundrungswürdig ist die Einfachheit der
Mittel, mit welchen die Sprache eine so ungemein grosse Mannigfaltigkeit
der Verbalformen hervorbringt. Die Unterscheidung derselben ist
aber nur eben dadurch möglich, dass alle Umänderungen der Laute, sie
mögen bloss phonetisch oder bezeichnend seyn, auf verschiedenartige
Weise verbunden werden und nur die besondere unter diesen vielfachen
Combinationen den einzelnen Abwandlungsfall stempelt, der alsdann
auch bloss dadurch, dass er gerade diese Stelle im ConjugationsSchema
einnimmt, bezeichnend bleibt, selbst wenn die Zeit gerade seine bedeutsamen
Laute abgeschliffen hat. Personenendungen, die symbolischen
Bezeichnungen durch Augment und Reduplication, die, wahrscheinlich
bloss auf den Klang bezogenen Laute, deren Einschiebung
die Verbalclassen andeutet, sind die hauptsächlichen Elemente, aus
welchen die Verbalformen zusammengesetzt werden. Ausser denselben
giebt es nur zwei Laute, i und s, welche da, wo sie nicht auch bloss phonetischen
Ursprungs sind, als wirkliche Bezeichnungen von Gattungen,
Zeiten und Modi des Verbum gelten müssen. Da mir in diesen ein besonders
feiner und sinnvoller Gebrauch ursprünglich für sich bedeutsamer
Wörter grammatisch bezeichnet zu liegen scheint, so verweile ich
bei ihnen noch einen Augenblick länger.
Bopp hat zuerst mit grossem Scharfsinn und unbestreitbarer Gewissheit
das erste Futurum und eine der Formationen des vielförmigen Augment-Praeteritum
als zusammengesetzt aus einem Stammwort und dem
Verbum as, seyn, nachgewiesen. Haughton glaubt auf gleich sinnreiche
Weise in dem ya der Passiva das Verbum gehen, i oder yâ, zu entdecken.
Auch da, wo sich s oder sy zeigt, ohne dass die Gegenwart des Verbum
as in seiner eignen Abwandlung so sichtbar, als in den oben erwähnten
Zeiten ist, kann man diese Laute als von as herstammend betrachten
und es ist dies zum Theil auch von Bopp bereits geschehen. Erwägt man
dies und nimmt man zugleich alle Fälle zusammen, wo i oder von ihm
abstammende Laute in den Verbalformen bedeutsam zu seyn scheinen,
452so zeigt sich hier am Verbum etwas Aehnliches, als wir oben am Nomen
gefunden haben. Wie dort das Pronomen in verschiedener Gestalt Beugungsfälle
bildet, so thun dasselbe hier zwei Verba der allgemeinsten
Bedeutung. Sowohl dieser Bedeutung, als dem Laute nach verräth sich
in dieser Wahl die Absicht der Sprache, sich der Zusammensetzung
nicht zur wahren Verbindung zweier bestimmten Verbalbegriffe zu bedienen,
wie wenn andere Sprachen die Verbalnatur durch den Zusatz
des Begriffes thun oder machen andeuten, sondern, auf der eignen Bedeutung
des zugesetzten Verbum nur leise fussend, sich seines Lautes
als blossen Andeutungsmittels zu bedienen, in welche Kategorie des
Verbum die einzelne in Rede stehende Form gesetzt werden soll. Gehen
liess sich auf eine unbestimmbare Menge von Beziehungen des Begriffes
anwenden. Die Bewegung zu einer Sache hin kann von Seiten ihrer Ursach
als willkührlich oder unwillkührlich, als ein thätiges Wollen oder
leidendes Werden, von Seiten der Wirkung als ein Hervorbringen, Erreichen
u. s. f. angesehen werden. Von phonetischer Seite aber war der
i-Vocal gerade der schicklichste, um wesentlich als Suffix zu dienen und
diese Zwitterrolle zwischen Bedeutsamkeit und Symbolisirung gerade
so zu spielen, dass die erstere, wenn auch der Laut von ihr ausgieng,
dabei ganz in Schatten gestellt wurde. Denn er dient schon an sich im
Verbum häufig als Zwischenlaut und seine euphonischen Veränderungen
in y und ay vermehren die Mannigfaltigkeit der Laute in der Gestaltung
der Formen; a gewährte diesen Vortheil nicht und u hat einen zu
eigenthümlichen schweren Laut, um so häufig zu immaterieller Symbolisirung
zu dienen. Vom s des Verbum seyn lässt sich nicht dasselbe,
aber doch auch Aehnliches sagen, da es auch zum Theil phonetisch gebraucht
wird und seinen Laut nach Massgabe des ihm vorangehenden
Vocals verändert. 41
Wie in den Sprachen eine Entwicklung immer aus der andren, so
dass die frühere dadurch bestimmend wird, hervorgeht und wie sich
vorzüglich im Sanskrit der Faden dieser Entwicklungen hauptsächlich
an den Lautformen fortspinnen lässt, davon ist das Passivum der SanskritGrammatik
ein auffallender Beweis. Nach richtigen grammatischen
Begriffen ist diese Verbalgattung immer nur ein Correlatum des Activum
und zwar eine eigentliche Umkehrung desselben. Indem aber dem
Sinne nach der Wirkende zum Leidenden und umgekehrt wird, soll der
grammatischen Form nach dennoch der Leidende das Subject des Verbum
seyn und der Wirkende von diesem regiert werden. Von dieser, einzig
richtigen Seite hat die grammatische Formenbildung das Passivum
im Sanskrit nicht aufgefasst, wie sich überhaupt, am deutlichsten aber
da verräth, wo der Infinitiv des Passivum ausgedrückt werden soll. Zugleich
aber bezeichnet das Passivum etwas mit der Person Vorgehendes,
sich auf sie mit Ausschliessung ihrer Thätigkeit innerlich Beziehendes.
453Da nun die Sanskritsprache unmittelbar darauf gekommen war, das
Wirken nach aussen und das Erfahren im Innren in der ganzen Abwandlung
des Verbum von einander zu trennen, so fasste sie der Form
nach auch das Passivum von dieser Seite auf. Dadurch entstand es
wohl, dass diejenige Verbalclasse, die vorzugsweise jene innere Abwandlungsart
verfolgte, auch zur Kennsylbe des Passivum die Veranlassung
gab. Ist nun aber das Passivum in seinem richtigen Begriff, gleichsam
als die Vereinigung eines zwischen Bedeutung und Form liegenden
und unaufgehoben bleibenden Widerspruchs schwierig, so ist es in der
Zusammenschliessung mit der im Subjecte selbst befangenen Handlung
nicht adaequat aufzufassen und kaum von Nebenbegriffen rein zu erhalten.
In der ersteren Beziehung sieht man, wie einige Sprachen, z. B.
die Malayischen und unter diesen am sinnreichsten die Tagalische mühsam
danach streben, eine Art von Passivum hervorzubringen. In der
letzteren Beziehung wird es klar, dass der reine Begriff, den die spätere
Sanskritsprache, wie wir aus ihren Werken sehen, richtig auffasste, in
die frühere Sprachformung durchaus nicht übergieng. Denn anstatt
dem Passivum einen durch alle Tempora gleichförmig oder analog
durchgehenden Ausdruck zu geben, knüpft sie dasselbe an die vierte
Classe der Verba und lässt es ihre Kennsylbe an den Gränzen derselben
ablegen, indem sie sich in den nicht innerhalb dieser Schranken befindlichen
Formen an unvollkommener Bezeichnung begnügt.
Im Sanskrit also, um zu unsrem Hauptgegenstande zurückzukehren,
hat das Gefühl der zusammenfassenden Kraft des Verbum die Sprache
vollständig durchdrungen. Es hat sich in derselben nicht bloss einen
entschiednen, sondern gerade den ihm allein zusagenden Ausdruck, einen
rein symbolischen geschaffen, ein Beweis seiner Stärke und Lebendigkeit.
Denn ich habe schon oft in diesen Blättern bemerkt, dass, wo
die Sprachform klar und lebendig im Geiste dasteht, sie in die, sonst die
äussere Sprachbildung leitende äussere Entwicklung eingreift, sich
selbst geltend macht und nicht zugiebt, dass im blossen Fortspinnen angefangner
Fäden statt der reinen Formen gleichsam Surrogate derselben
gebildet werden. Das Sanskrit giebt uns hier zugleich vom Gelingen
und Mislingen in diesem Punkt passende Beispiele. Die Function des
Verbum drückt es rein und entscheidend aus, in der Bezeichnung des
Passivum lässt es sich auf der Verfolgung des äusseren Weges irre leiten.
Eine der natürlichsten und allgemeinsten Folgen der inneren Verkennung
oder vielmehr der nicht vollen Anerkennung der Verbalfunction
ist die Verdunkelung der Gränzen zwischen Nomen und Verbum. Dasselbe
Wort kann als beide Redetheile gebraucht werden; jedes Nomen
lässt sich zum Verbum stempeln; die Kennzeichen des Verbum modificiren
mehr seinen Begriff, als sie seine Function charakterisiren; die
der Tempora und Modi begleiten das Verbum in eigner Selbstständigkeit
454und die Verbindung des Pronomen ist so lose, dass man gezwungen
wird, zwischen demselben und dem angeblichen Verbum, das eher eine
Nominalform mit Verbalbedeutung ist, das Verbum seyn im Geist zu
ergänzen. Hieraus entsteht natürlich, dass wahre Verbalbeziehungen
zu Nominalbeziehungen hingezogen werden und beide auf die mannigfaltigste
Weise in einander übergehen. Alles hier Gesagte trifft vielleicht
nirgends in so hohem Grade zusammen, als im Malayischen
Sprachstamm, der auf der einen Seite mit wenigen Ausnahmen an Chinesischer
Flexionslosigkeit leidet und auf der andren nicht, wie die Chinesische
Sprache, die grammatische Formung mit verschmähender Resignation
zurückstösst, sondern dieselbe sucht, einseitig erreicht und in
dieser Einseitigkeit wunderbar vervielfältigt. Von den Grammatikern
als vollständige durch ganze Conjugationen durchgeführte Bildungen
lassen sich deutlich als wahre Nominalformen nachweisen, und obgleich
das Verbum keiner Sprache fehlen kann, so wandelt dennoch
den, welcher den wahren Ausdruck dieses Redetheiles sucht, in den
Malayischen Sprachen gleichsam ein Gefühl seiner Abwesenheit an.
Dies gilt nicht bloss von der Sprache auf Malacca, deren Bau überhaupt
von noch grösserer Einfachheit, als der der übrigen ist, sondern auch
von der, in der Malayischen Weise sehr formenreichen Tagalischen.
Merkwürdig ist es, dass im Javanischen durch die blosse Veränderung
des Anfangsbuchstaben in einen andren derselben Classe Nominal- und
Verbalformen wechselweise in einander übergehen. Dies scheint auf
den ersten Anblick eine wirklich symbolische Bezeichnung; ich werde
weiter unten (2. Buch.) zeigen, dass diese Buchstabenveränderung nur
die Folge der Abschleifung eines Praefixes im Laufe der Zeit ist. Ich verbreite
mich nur hier nicht ausführlicher über diesen Gegenstand, da er
im zweiten und dritten Buche dieser Schrift ausführlich und an seiner
eigentlichen Stelle erörtert werden muss.
In den Sprachen, in welchen das Verbum gar keine oder sehr unvollkommne
Kennzeichen seiner wahren Function besitzt, fällt es von
selbst mehr oder weniger mit dem Attributivum, also einem Nomen zusammen
und das eigentliche Verbum, welches das wirkliche Setzen des
Gedachten andeutet, muss, als Verbum seyn, zu dem Subject und diesem
Attributivum geradezu ergänzt werden. Eine solche Auslassung
des Verbum da, wo einer Sache bloss eine Eigenschaft beigelegt werden
soll, ist auch den höchstgebildeten Sprachen nicht fremd. Namentlich
trifft man sie häufig im Sanskrit und Lateinischen, seltner im Griechischen
an. Neben einem vollkommen ausgebildeten Verbum hat sie mit
der Charakterisirung des Verbum nichts zu schaffen, sondern ist bloss
eine Art der Satzbildung. Dagegen geben einige der Sprachen, welche
in ihrem Bau den Verbalausdruck nur mit Mühe erringen, diesen Constructionen
eine besondere Form und ziehen dieselben dadurch gewissermassen
455in den Bau des Verbum hinein. So kann man im Mexicanischen
ich liebe sowohl durch ni-tlazotla, als durch ni-tlazotla-ni ausdrücken.
Das Erstere ist die Verbindung des Verbalpronomen mit dem
Stamme des Verbum, das Letztere die gleiche mit dem Participium, insofern
nemlich gewisse Mexicanische Verbaladjectiva, ob sie gleich
nicht den Begriff des Verlaufs der Handlung (das Element, aus welchem
erst vermittelst der Verbindung mit den drei Stadien der Zeit das eigentliche
Tempus entsteht) 42 enthalten, doch in der Rücksicht Participia
heissen können, als sie activer, passiver oder reflexiver Bedeutung
sind. Vetancurt macht in seiner Mexicanischen Grammatik 43 die zweite
der obigen Mexicanischen Formen zu einem Gewohnheit andeutenden
Tempus. Dies ist zwar eine offenbar irrige Ansicht, da eine solche Form
im Verbum kein Tempus seyn könnte, sondern, was nicht der Fall ist,
durch die Tempora durchflectirt werden müsste. Man sieht aber aus
Vetancurt's genauerer Bestimmung der Bedeutung des Ausdrucks, dass
derselbe nichts andres, als die Verbindung eines Pronomen und eines
Nomen mit ausgelassenem Verbum seyn ist. Ich liebe hat den reinen
Verbalausdruck; ich bin ein Liebender (d. h. ich pflege zu lieben) ist genau
genommen keine Verbalform, sondern ein Satz. Die Sprache aber
stempelt diese Construction gewissermassen zum Verbum, da sie in derselben
nur den Gebrauch des Verbalpronomen erlaubt. Sie behandelt
auch das Attributivum dadurch wie ein Verbum, dass sie demselben die
von ihm regierten Wörter beigiebt: ni-te-tla-namaca-ni, ich (bin) ein jemandem
etwas Verkaufender, d.i. ich pflege zu verkaufen, bin Kaufmann.
Die gleichfalls Neuspanien angehörende Mixteca-Sprache unterscheidet
den Fall, wo das Attributivum, als schon dem Substantivum
anhängend, bezeichnet und wo es demselben erst durch den Verbalausdruck
beigelegt wird, durch die Stellung beider Redetheile. Im ersteren
muss das Attributivum auf das Substantivum folgen, im letzteren demselben
vorausgehen: naha quadza, die böse Frau, quadza naha, die
Frau ist böse. 44
Das Unvermögen, den Ausdruck des zusammenfassenden Seyns unmittelbar
in die Form des Verbum zu legen, welches in den eben genannten
Fällen diesen Ausdruck gänzlich fehlen lässt, kann auch im Gegentheil
dahin führen, ihn ganz materiell da eintreten zu lassen, wo er
auf diese Weise nicht stehen soll. Dies geschieht, wenn zu einem wahrhaft
attributiven Verbum (er geht, er fliegt) das Seyn in einem wirklichen
Hülfsverbum herbeigezogen wird (er ist gehend, fliegend). Doch
hilft dies Auskunftsmittel eigentlich der Verlegenheit des sprachbildenden
Geistes nicht ab. Da dies Hülfsverbum selbst die Form eines Verbum
haben muss und wieder nur die Verbindung des Seyns mit einem
energischen Attributiv seyn kann, so entsteht immer wieder die nemliche
456und der Unterschied ist bloss der, dass, da dieselbe sonst bei jedem
Verbum zurückkehrt, sie hier nur in Einem festgehalten wird. Auch
zeigt das.Gefühl der Nothwendigkeit eines solchen Hülfsverbum, dass
der Sprachbildung, wenn sie auch nicht die Kraft besessen hat, der
wahren Function des Verbum einen richtigen Ausdruck zu schaffen,
dennoch der Begriff derselben gegenwärtig gewesen ist. Es würde unnütz
seyn, für eine in den Sprachen, theils bei der ganzen Verbalbildung,
theils bei der einzelner Abwandlungen häufig vorkommende Sache
Beispiele anführen zu wollen. Dagegen verweile ich einige
Augenblicke bei einem interessanteren und seltneren Falle, nemlich bei
dem, wo die Function des Hülfsverbum (der Hinzufügung des Seyns)
einem andren Redetheil, als dem Verbum selbst, nemlich dem Pronomen
auf übrigens ganz gleiche Weise zugetheilt ist.
In der Sprache der Yarura, einer Völkerschaft am Casanare und unteren
Orinoco, wird die ganze Conjugation auf die einfachste Weise
durch die Verbindung des Pronomen mit den Partikeln der Tempora gebildet.
Diese Verbindungen machen für sich das Verbum seyn und einem
Worte suffigirt die Abwandlungssylben desselben aus. Ein eigner
Wurzellaut, der nicht zum Pronomen oder zu den TempusPartikeln gehörte,
fehlt dem Verbum seyn gänzlich, und da das Praesens keine eigne
Partikel hat, so bestehen die Personen desselben bloss aus den Personen
des Pronomen selbst, die sich nur als Abkürzungen von dem selbstständigen
Pronomen unterscheiden. 45 Die drei Personen des Singulars des
Verbum seyn heissen daher que, mé, di, 46 und in buchstäblicher Uebersetzung
bloss ich, du, er. Im Imperfectum wird diesen Sylben ri vorgesetzt,
ri-que, ich war, und verbunden mit einem Nomen, ui ri-di, Wasser
war (vorhanden), als wahres Verbum aber jura-ri-di, er ass. Hiernach
also bedeutete que ich bin und diese Form des Pronomen drückte eigentlich
die Function des Verbum aus. Indess kann diese Verbindung
des Pronomen mit den Zeitpartikeln niemals allein für sich gebraucht
werden, sondern immer nur so, dass dadurch vermittelst eines andren
Wortes, das aber jeder Redetheil seyn kann, ein Satz gebildet wird.
Que, di heissen niemals allein ich bin, er ist, wohl aber ui di es ist Wasser,
jura-n-di mit euphonischem n er isst. Genau untersucht ist daher
die grammatische Form dieser Redensarten nicht das, wovon ich hier
spreche, eine Einverleibung des Begriffs des Seyns in das Pronomen,
sondern der im Vorigen besprochene Fall einer Auslassung und Ergänzung
des Verbum seyn bei der Zusammenstellung des Pronomen mit
einem andren Worte. Die obige Zeitpartikel ri ist übrigens nichts andres,
als ein Entfernung anzeigendes Wort. Ihr steht gegenüber die Partikel
re, welche als Charakteristik des Conjunctivs angegeben wird.
Dies re ist aber bloss die Praeposition in, die in mehreren Amerikanischen
Sprachen eine ähnliche Anwendung findet. Sie bildet ein Analogon
457eines Gerundiums: jura-re, im Essen, edendo; und dies Gerundium
wird dann durch Vorsetzung des selbstständigen Pronomen zum Conjunctiv
oder Optativ gestempelt: wenn ich oder dass ich ässe. Hier wird
der Begriff des Seyns mit der Charakteristik des Conjunctivs verbunden
und es fallen daher die, sonst unveränderlich mit ihm verknüpften Verbalsuffixa
der Personen hinweg, indem das selbstständige Pronomen
vorgesetzt wird. Wirklich nimmt Forneri re, ri-re als Gerundia der Gegenwart
und der Vergangenheit in sein Paradigma des Verbum seyn auf
und übersetzt sie: wenn ich wäre, wenn ich gewesen wäre.
So wie hier die Sprache zwar eine eigne Form des Pronomen bestimmt,
mit welcher beständig und ausschliesslich der Begriff des Seyns
verbunden ist, allein der Fall, von dem wir hier reden, dass nemlich dieser
Begriff dem Pronomen selbst einverleibt sey, doch nicht rein vorhanden
war, ebenso ist es auch, nur wieder auf verschiedene Weise, in der
Huasteca-Sprache, die in einem Theile von Neuspanien gesprochen
wird. Auch in ihr verbinden sich die Pronomina, jedoch nur die selbständigen,
mit einer Zeitpartikel und machen alsdann das Verbum seyn
aus. Sie nähern sich diesem in seinem wahren Begriffe um so mehr, als
diese Verbindungen, wie in der Yarura-Sprache nicht der Fall war, auch
ganz allein stehen können: nânâ-itz, ich war, tâtâ-itz, du warst, u.s.w.
Beim Verbum attributivum werden die Personen durch andre Pronominalformen
angedeutet, welche dem Besitzpronomen sehr nahe kommen.
Allein der Ursprung der mit dem Pronomen verbundenen Partikel
ist zu unbekannt, als dass sich entscheiden liesse, ob nicht in derselben
eine eigne Verbalwurzel enthalten ist. Jetzt dient sie zwar allerdings in
der Sprache zur Charakteristik der Tempora der Vergangenheit, beim
Imperfectum beständig und ausschliesslich, bei den anderen Zeiten
nach besondren Regeln. Die Bergbewohner, bei welchen sich doch wohl
die älteste Sprache erhalten hat, sollen aber einen allgemeineren Gebrauch
von dieser Sylbe machen und sie auch dem Praesens und Futurum
hinzufügen. Bisweilen wird sie auch einem Verbum angehängt, um
Heftigkeit der Handlung anzudeuten, und in diesem Sinne, als Verstärkung
(wie auch in so vielen Sprachen die Reduplication das Perfectum
verstärkend begleitet), könnte sie wohl nach und nach zur ausschliesslichen
Charakteristik der Zeiten der Vergangenheit geworden seyn. 47
In der Maya-Sprache, welche auf der Halbinsel Yucatan gesprochen
wird, findet sich dagegen der Fall, von dem wir hier reden, rein und
vollständig. 48 Sie besitzt ein Pronomen, welches, allein gebraucht,
durch sich selbst das Verbum seyn ausmacht, und beweist eine höchst
merkwürdige Sorgfalt, die wahre Function des Verbum immer durch
ein eignes, besonders dazu bestimmtes Element anzuzeigen. Das Pronomen
ist nemlich zwiefach. Die eine Gattung desselben führt den Begriff
des Seyns mit sich, die andre besitzt diese Eigenschaft nicht, verbindet
458sich aber auch mit dem Verbum. Die erstere dieser Gattungen theilt
sich in zwei Unterarten, von welchen die eine die Bedeutung des Seyns
nur in Verbindung mit einem andren Worte hinzubringt, die andre aber
dieselbe unmittelbar in sich enthält. Diese letztere Unterart bildet, da
sie sich auch mit den Partikeln der Tempora verbindet (die der Sprache
jedoch im Praesens und Perfectum fehlen), vollkommen das Verbum
seyn. In den beiden ersten Personen des Singulars und Plurals lauten
diese Pronomina Pedro en, ich bin Peter, und so analogisch fort: ech,
on, ex; dagegen ten, ich bin, tech, du bist, toon, wir sind, teex, ihr seid.
Ein selbstständiges Pronomen ausser den hier genannten drei Gattungen
giebt es nicht, sondern die zugleich als Verbum seyn dienende (ten)
wird dazu gebraucht. Die den Begriff des Seyns nicht mit sich führende
wird allemal affigirt und en hat durchaus keinen andren, als den angeführten
Gebrauch. Wo das Verbum die erste Gattung des Pronomen
entbehrt, verbindet es sich regelmässig mit der zweiten. Alsdann aber
findet sich in den Formen desselben ein Element (cah und ah, nach bestimmten
Regeln abwechselnd), welches bei der Zergliederung desselben,
wenn man alle das Verbum gewöhnlich begleitende Elemente (Personen,
Zeit, Modus u. s.f.) absondert, übrig bleibt. En, ten, cah und ah
erscheinen daher in allen Verbalformen, jedoch immer so, dass eine dieser
Sylben die übrigen ausschliesst, woraus schon für sich hervorgeht,
dass alle Ausdruck der Verbalfunction sind, so dass eine nicht fehlen
kann, dagegen jede den Gebrauch der andren überflüssig macht. Ihre
Anwendung unterliegt nun bestimmten Regeln. En wird bloss beim intransitiven
Verbum und auch bei ihm nicht im Praesens und Imperfectum,
sondern nur in den übrigen Zeiten gebraucht, ah mit demselben
Unterschiede bei den transitiven Verben, cah bei allen Verben ohne
Unterschied, jedoch nur im Praesens und Imperfectum. Ten findet sich
bloss in einer angeblich anomalen Conjugation. Untersucht man diese
genauer, so führt sie die Bedeutung einer Gewohnheit oder eines bleibenden
Zustandes mit sich und die Form erhält, mit Wegwerfung von
cah und ah, Endungen, die zum Theil auch die sogenannten Gerundia
bilden. Es geht also hier eine Verwandlung einer Verbalform in eine
Nominalform vor sich und diese Nominalform bedarf nun des wahren
Verbum seyn, um wieder zum Verbum zu werden. Insofern stimmen
diese Formen gänzlich mit dem oben erwähnten Mexicanischen GewohnheitsTempus
überein. Bemerken muss ich noch, dass in dieser
Vorstellungsweise der Begriff der transitiven Verba auf solche beschränkt
wird, welche wirklich einen Gegenstand ausser sich regieren.
Unbestimmt gebrauchte, wahre Activa, lieben, tödten, so wie diejenigen,
welche, wie das Griechische ὀιϰοδομέω, den regierten Gegenstand
in sich enthalten, werden als intransitiv behandelt.
Es wird schon dem Leser aufgefallen seyn, dass die beiden Unterarten
459der ersten Pronominalgattung sich bloss durch ein vorgesetztes t unterscheiden.
Da sich dies t gerade in demjenigen Pronomen findet, welches
durch sich selbst Verbalbedeutung hat, so ist die natürliche Vermuthung
die, dass es den Wurzellaut eines Verbum ausmacht, so dass
genauer ausgedrückt nicht das Pronomen in der Sprache als Verbum
seyn, sondern umgekehrt dies Verbum als Pronomen gebraucht würde.
Die unzertrennliche Verbindung der Existenz mit der Person bliebe alsdann
dieselbe, die Ansicht aber wäre dennoch verschieden. Dass ten
und die übrigen von ihm abhängigen Formen wirklich auch als blosse
selbstständige Pronomina gebraucht werden, sieht man aus dem Mayischen
Vaterunser. 49 In der That halte auch ich dies t für einen Stimmlaut,
allein nicht eines Verbum, sondern des Pronomen selbst. Hierfür
spricht der für die dritte Person geltende Ausdruck. Dieser ist nemlich
gänzlich von den beiden ersten verschieden und im Singular für beide
das Verbum seyn ausdrückende Gattungen lai-lo, im Plural für die nicht
als Verbum dienende Gattung ob, für die andre loob. Wäre nun t Wurzellaut
eines Verbum, so liesse sich dies auf keine Weise erklären. Da
aber mehrere Sprachen eine Schwierigkeit finden, die dritte Person in
ihrem reinen Begriffe aufzufassen und vom Demonstrativpronomen zu
trennen, so kann es nicht auffallend erscheinen, dass die beiden ersten
Personen einen nur ihnen eigenthümlichen Stammlaut haben. Wirklich
wird in der Mayischen Sprache ein angebliches Pronomen relativum lai
aufgeführt und auch andre Amerikanische Sprachen besitzen durch
mehrere oder alle Personen des Pronomen durchgehende Stammlaute.
In der Sprache der Maipuren findet sich die dritte Person, nur mit verschiedenem
Zusatz, in den beiden ersten wieder, gleichsam als hiessen,
wenn die dritte vielleicht ursprünglich Mensch bedeutete, die beiden
ersten der Ich-Mensch und der Du-Mensch. Bei den Achaguas haben
alle drei Personen des Pronomen die gleiche Endsylbe. Beide diese Völkerschaften
wohnen zwischen dem Rio Negro und dem oberen Orinoco.
Zwischen den beiden Hauptgattungen des Mayischen Pronomen ist
nur in einigen Personen eine Verwandtschaft der Laute, in andren
herrscht dagegen grosse Verschiedenheit. Das t findet sich in dem affigirten
Pronomen nirgends. Das ex und ob der zweiten und dritten Pluralperson
des mit der Bedeutung des Seyns verbundenen Pronomen ist
gänzlich in dieselben Personen des andren, diese Bedeutung nicht mit
sich führenden Pronomen übergegangen. Da aber diese Sylben hier der
zweiten und dritten Person des Singulars nur als Endungen beigefügt
sind, so erkennt man, dass sie, von jenem, vielleicht älteren Pronomen
entnommen, dem andren bloss als Pluralzeichen dienen.
Cah und ah unterscheiden sich auch nur durch den hinzugefügten
Consonanten und dieser scheint mir ein wahrer Verbalwurzellaut, der,
verbunden mit ah, ein Hülfsverbum seyn bildet. Wo cah einem Verbum
460beständig einverleibt ist, führt es den Begriff der Heftigkeit mit sich und
dadurch mag es gekommen seyn, dass die Sprache sich dessen bedient
hat, alle Handlungen, da in jeder Kraft und Beweglichkeit liegt, zu bezeichnen.
Mit wahrhaft feinem Tact aber ist cah doch nur der Lebendigkeit
der währenden Handlung, also dem Praesens und Imperfectum aufbehalten
worden. Dass cah wirklich als ein Verbalstamm behandelt
wird, beweist die Verschiedenheit der Stellung des affigirten Pronomen
in den Formen mit cah und mit ah. In den ersteren steht dies Pronomen
immer unmittelbar vor dem cah, in den andren nicht vor dem ah, sondern
vor dem attributiven Verbum. Da es sich nun immer einem
StammWort, Nomen oder Verbum praefigirt, so beweist dies deutlich,
dass ah in diesen Formen keines von beiden ist, dass es dagegen mit cah
eine andere Bewandtniss hat. So ist von canan, bewachen, die erste Person
des Singulars im Praesens canan-in-cah, dagegen dieselbe Person
im Perfectum incanan-t-ah. In ist Pron. 1. sing., das dazwischengeschobene
t ein euphonischer Laut. Ah hat in der Sprache als Praefix einen
mehrfachen Gebrauch, indem es Charakteristik des männlichen Geschlechtes,
der Ortsbewohner, endlich der aus Activverben gebildeten
Nomina ist. Es mag daher aus einem Substantivum zum Demonstrativpronomen
und endlich zum Affixum geworden seyn. Da es seinem Ursprunge
nach weniger geeignet ist, die heftige Beweglichkeit des Verbum
anzuzeigen, so bleibt es für die Bezeichnung der Tempora, welche
der unmittelbaren Erscheinung ferner liegen. Dieselben Tempora intransitiver
Verba verlangen noch mehr, um in das Verbum einzutreten,
von dem bloss ruhenden Begriff des Seyns und begnügen sich daher mit
demjenigen Pronomen, bei welchem dieser immer hinzugedacht wird.
So bezeichnet die Sprache verschiedene Grade der Lebendigkeit der
Erscheinungen und bildet daraus ihre Conjugationsformen auf eine
künstlichere Weise, als es selbst die hochgebildeten Sprachen thun, allein
nicht auf einem so einfachen, naturgemässen, die Functionen der
verschiedenen Redetheile richtig abgränzenden Wege. Der Bau des Verbum
ist daher immer fehlerhaft; es leuchtet doch aber sichtbar das Gefühl
der wahren Function des Verbum und ein sogar ängstliches Bemühen,
es nicht dafür an einem Ausdruck fehlen zu lassen, daraus hervor.
Das affigirte Pronomen der zweiten Hauptgattung dient auch als Besitzpronomen
bei Substantiven. Es verräth ein völliges Miskennen des
Unterschiedes zwischen Nomen und Verbum, dem letzteren ein Besitzpronomen
zuzutheilen, unser Essen mit wir essen zu verwechseln. Dies
scheint mir jedoch in den Sprachen, die sich dessen schuldig machen,
mehr ein Mangel der gehörigen Absonderung der verschiedenen Pronominalgattungen
von einander. Denn offenbar wird der Irrthum geringer,
wenn der Begriff des Besitzpronomen selbst nicht in seiner eigentlichen
Schärfe aufgefasst wird, und dies scheint mir hier der Fall. Fast in allen
461Amerikanischen Sprachen geht das Verständniss ihres Baues gleichsam
vom Pronomen aus und dies schlingt sich in zwei grossen Zweigen, als
Besitzpronomen um das Nomen, als regierend oder regiert um das Verbum
und beide Redetheile bleiben meistentheils immer mit ihm verbunden.
Gewöhnlich besitzt die Sprache hierfür auch verschiedene Pronominalformen.
Wo dies aber nicht der Fall ist, verbindet sich der Begriff
der Person schwankend und unbestimmt mit dem einen und dem andren
Redetheil. Der Unterschied beider Fälle wird wohl empfunden,
aber nicht mit der formalen Schärfe und Bestimmtheit, welche der Uebergang
in die Lautbezeichnung erfordert. Bisweilen deutet sich aber
die Empfindung des Unterschiedes doch auf andere Weise, als durch die
genaue Absonderung eines doppelten Pronomen an. In der Sprache der
Betoi, die auch um den Casanare und unteren Orinoco herum wohnen,
hat das Pronomen, wenn es sich mit dem Verbum, als regierend, verbindet,
eine von der des Besitzpronomen beim Nomen verschiedene Stellung.
Das Besitzpronomen wird nemlich vorn, das die Person des Verbum
begleitende hinten angehängt; die Verschiedenheit der Laute
besteht nur in einer durch die Anfügung hervorgebrachten Abkürzung.
So heisst rau tucu mein Haus, aber humasoi-rrù Mensch bin ich und
ajoi-rrù ich bin. Im letzteren Worte ist mir die Bedeutung der Wurzelsylbe
unbekannt. Diese Suffigirung des Pronomen findet aber nur da
statt, wo dasselbe aoristisch ohne specielle Zeitbestimmung mit einem
andren Worte verbunden wird. Das Pronomen bildet alsdann mit diesem
Worte Einen Wortlaut und es entsteht wirklich eine Verbalform.
Denn der Accent geht in diesen Fällen von dem verbundenen Worte auf
das Pronomen über. Dies ist also gleichsam ein symbolisches Zeichen
der Beweglichkeit der Handlung, wie auch im Englischen da, wo dasselbe
zweisylbige Wort als Nomen und als Verbum gebraucht werden
kann, die Oxytonirung die Verbalform andeutet. Im Chinesischen findet
sich zwar auch die Bezeichnung des Ueberganges vom Nomen zum Verbum
und umgekehrt durch den Accent, allein nicht in symbolischer Beziehung
auf die Natur des Verbum da derselbe Accent unverändert den
doppelten Uebergang ausdrückt und nur andeutet, dass das Wort zu
dem seiner natürlichen Bedeutung und seinem gewöhnlichen Gebrauche
entgegengesetzten Redetheil wird. 50
Ich habe die obige Auseinandersetzung der Mayischen Conjugation
nicht durch die Erwähnung einer Ausnahme unterbrechen mögen, die
ich jedoch hier kurz nachholen will. Das Futurum unterscheidet sich
nemlich in seiner Bildung gänzlich von den übrigen Tempora. Es verbindet
zwar seine Kennsylben mit ten, führt aber niemals weder cah
noch ah mit sich, besitzt eigne Suffixa, entbehrt auch bei gewissen Veränderungen
seiner Form alle; besonders steht es der Sylbe ah entgegen.
Denn es schneidet dieselbe auch da ab, wo diese Sylbe wirkliche Endung
462des Stammverbum ist. Es würde hier zu weit führen, in die Untersuchung
einzugehen, ob diese Abweichungen aus der Natur der eigenthümlichen
Suffixa des Futurum oder aus andren Gründen entstehen.
Gegen das oben Gesagte kann aber diese Ausnahme nichts beweisen.
Vielmehr bestätigt die Abneigung gegen die Partikel ah die oben derselben
beigelegte Bedeutung, da die Ungewissheit der Zukunft nicht die
Lebendigkeit.eines Pronomen hervorruft und mit der einer wirklich dagewesenen
Erscheinung contrastirt.
Wo die Sprachen zwar den Weg einschlagen, die Function des Verbum
durch die engere Verknüpfung seiner immer wechselnden Modificationen
mit der Wurzel symbolisch anzudeuten, da ist es, wenn sie
auch das Ziel nicht vollkommen erreichen, ein günstiges Zeichen für ihr
richtiges Gefühl derselben, wenn sie die Enge dieser Verbindung vorzugsweise
mit dem Pronomen bezwecken. Sie nähern sich dann immer
mehr der Verwandlung des Pronomen in die Person und somit der wahren
Verbalform, in welcher die formale Andeutung der Personen (die
durch die blosse Vorausschickung des selbstständigen Pronomen nicht
erreicht wird) der wesentlichste Punkt ist. Alle übrigen Modificationen
des Verbum (die Modi abgerechnet, die mehr der Satzbildung angehören)
können auch den, mehr dem Nomen gleichenden, erst durch die
Verbalfunction in Bewegung zu setzenden Theil des Verbum charakterisiren.
Hierin vorzüglich liegt der Grund, dass in den Malayischen Sprachen,
in gewisser Aehnlichkeit mit dem Chinesischen, die Verbalnatur
so wenig sichtbar hervorspringt. Die bestimmte Neigung der Amerikanischen,
das Pronomen auf irgend eine Weise zu affigiren, führt dieselben
hierin auf einen richtigeren Weg. Werden alle Modificationen des
Verbum wirklich mit der Wurzelsylbe verknüpft, so beruht die Vollkommenheit
der Verbalformen nur auf der Enge der Verknüpfung, auf
dem Umstande, ob sich die im Verbum liegende Kraft des Setzens energischer
als flectirend oder träger als agglutinirend erweist.
Act des selbstthätigen Setzens in der Sprache. Conjunction
Gleich stark, als das Verbum beruht in den Sprachen die richtige und
genügende Bildung von Conjunctionen auf der Thätigkeit derselben
Kraft des sprachbildenden Geistes, von der wir hier reden. Denn die
Conjunction, im eigentlichen Sinne des Ausdrucks genommen, zeigt die
Beziehungen zweier Sätze auf einander an und es liegt daher ein doppeltes
Zusammenfassen, eine verwickeltere Synthesis in ihr. Jeder Satz
muss als Eins genommen, diese Einheiten müssen aber wieder in eine
grössere verknüpft und der vorhergehende Satz so lange schwebend vor
der Seele erhalten werden, bis der nachfolgende der ganzen Aussage die
463vollendete Bestimmung giebt. Die Satzbildung erweitert sich hier zur
Periode und die Conjunctionen theilen sich in die leichteren, die nur
Sätze verbinden und trennen, und in die schwierigeren, welche einen
Satz von dem andren abhängig machen. In diesen, gleichsam gerade
fortlaufenden oder verschlungenen Gang der Periode setzten schon
Griechische Grammatiker das Kennzeichen des einfacheren und des
sich kunstvoll erhebenden Styls. Die bloss verbundenen Sätze laufen in
unbestimmter Folge nach einander hin und gestalten sich nicht zu einem,
Anfang und Ende auf einander beziehenden Ganzen, da hingegen
die wahrhaft zur Periode verknüpften sich, gleich den Steinen eines
Gewölbes, gegenseitig stützen und halten. 51 Die weniger gebildeten
Sprachen haben gewöhnlich Mangel an Conjunctionen oder bedienen
sich dazu nur mittelbar zu diesem Gebrauch passender, ihm nicht ausschliesslich
gewidmeter Wörter und lassen sehr oft die Sätze unverbunden
auf einander folgen. Auch die von einander abhängigen werden,
soviel es irgend geschehen kann, in gerade fortlaufende verwandelt und
hiervon tragen selbst ausgebildete Sprachen noch die Spuren an sich.
Wenn wir z. B. sagen: ich sehe, daß du fertig bist, so ist das gewiss nichts
andres, als ich sehe das: du bist fertig, nur dass das richtige grammatische
Gefühl in späterer Zeit die Abhängigkeit des Folgesatzes symbolisch
durch die Umstellung des Verbum angedeutet hat.
Act des selbstthätigen Setzens in der Sprache. Pronomen relativum
Am schwierigsten für die grammatische Auffassung ist das, in dem Pronomen
relativum vorgehende synthetische Setzen. Zwei Sätze sollen
dergestalt verbunden werden, dass der eine einen blossen Beschaffenheitsausdruck
eines Nomen des andren ausmacht. Das Wort, durch welches
dies geschieht, muss daher zugleich Pronomen und Conjunction
seyn, das Nomen durch Stellvertretung darstellen und einen Satz regieren.
Sein Wesen geht sogleich verloren, als man sich nicht die beiden in
ihm verbundenen Redetheile, einander modificirend, als untheilbar zusammendenkt.
Die Beziehung beider Sätze auf einander fordert endlich,
dass das Conjunctions-Pronomen (das Relativum) in dem Casus
stehe, welchen das Verbum des relativen Satzes erfordert, dennoch
aber, welches dieser Casus immer seyn möge, den Satz selbst, an dessen
Spitze stehend, regiere. Hier häufen sich offenbar die Schwierigkeiten
und der ein Pronomen relativum mit sich führende Satz kann erst vermittelst
des andren vollständig aufgefasst werden. Ganz dem Begriffe
dieses Pronomen entsprechen können nur die Sprachen, in welchen das
Nomen declinirbar ist. Allein auch von diesem Erforderniss abgesehen
wird es den meisten, weniger gebildeten Sprachen unmöglich, einen
464wahren Ausdruck dieser Satzbezeichnung zu finden, das Relativpronomen
fehlt ihnen wirklich; sie umgehen, so viel als möglich, den Gebrauch
desselben, wo dies aber durchaus nicht geschehen kann, bedienen
sie sich mehr oder weniger geschickt dessen Stelle vertretender
Constructionen.
Eine solche, aber in der That sinnreiche ist in der Quichua-Sprache,
der allgemeinen Peruanischen, üblich. Die Folge der Sätze wird umgekehrt,
der relative geht, als selbstständige und einfache Aussage voran,
der Hauptsatz folgt ihm nach. Im relativen aber wird das Wort, auf welches
die Beziehung trifft, weggelassen und eben dies Wort mit ihm vorausgeschicktem
Demonstrativpronomen an die Spitze des Hauptsatzes
und in den von dessen Verbum regierten Casus gestellt. Anstatt also zu
sagen: der Mensch, welcher auf Gottes Gnade vertraut, erlangt dieselbe;
dasjenige, was du jetzt glaubst, wirst du künftig im Himmel offenbart
sehen; ich werde den Weg gehen, welchen du mich führst; sagt
man: er vertraut auf Gottes Gnade, dieser Mensch erlangt dieselbe; du
glaubst jetzt, dieses wirst du künftig im Himmel offenbart sehen; du
führst mich, diesen Weg werde ich gehen. In diesen Constructionen ist
die wesentliche Bedeutung der Relativsätze, dass nemlich ein Wort nur
unter der im Relativsatze enthaltenen Bestimmung gedacht werden soll,
nicht nur erhalten, sondern auch gewissermassen symbolisch ausgedrückt.
Der Relativsatz, auf den sich die Aufmerksamkeit zuerst sammeln
soll, geht voraus und ebenso stellt sich das durch ihn bestimmte
Nomen an die Spitze des Hauptsatzes, wenn seine Construction ihm
auch sonst eine andere Stelle anweisen würde. Allein alle grammatischen
Schwierigkeiten der Fügung sind umgangen. Die Abhängigkeit
beider Sätze bleibt ohne Ausdruck; die künstliche Methode, den Relativsatz
immer durch das Pronomen regieren zu lassen, wenn auch dasselbe
eigentlich von seinem Verbum regiert wird, fällt ganz hinweg. Es
giebt überhaupt gar kein Relativpronomen in diesen Fügungen. Es wird
aber dem Nomen das gewöhnliche und leicht zu fassende Demonstrativpronomen
beigegeben, so dass die Sprache sichtbar die Wechselbeziehung
beider Pronomina auf einander dunkel gefühlt, allein dieselbe
von der leichteren Seite aus angedeutet hat. Die Mexicanische Sprache
verfährt kürzer in diesem Punkt, aber nicht auf eine der wahren Bedeutsamkeit
des Relativsatzes so nahe kommende Weise. Sie stellt vor den
Relativsatz das Wort in, welches zugleich die Stelle des Demonstrativpronomen
und des Artikels vertritt, und knüpft ihn in dieser Gestalt an
den Hauptsatz.465
Betrachtung der Flexionssprachen in ihrer Fortentwicklung
Wenn ein Volksstamm in seiner Sprache die Kraft des synthetischen
Setzens bis zu dem Grade bewahrt, ihm in dem Baue derselben einen
genügenden und gerade den geeigneten Ausdruck zu geben, so folgt
daraus zunächst eine sich in allen Theilen gleich bleibende glückliche
Anordnung ihres Organismus. Wenn das Verbum richtig construirt ist,
so müssen es nach der Art, wie dasselbe den Satz beherrscht, auch die
übrigen Redetheile seyn. Dieselbe, Gedanken und Ausdruck in ihr richtiges
und fruchtbringendstes Verhältniss setzende Kraft durchdringt sie
in allen ihren Theilen und es kann ihr in dem leichteren nicht mislingen,
wenn sie die grössere Schwierigkeit der satzbildenden Synthesis überwunden
hat. Der wahre Ausdruck dieser letzteren kann daher nur ächten
Flexionssprachen und unter denselben immer nur denen, die es in
höherem Grade sind, eigen seyn. Sachausdruck und Beziehung müssen
in richtigem Verhältniss stehenden Ausdruck finden, die Worteinheit
muss unter dem Einfluss des Rhythmus die höchste Festigkeit besitzen
und der Satz dagegen wieder die, seine Freiheit sichernde Trennung der
einzelnen Worte zeigen. Diesen ganzen glücklichen Organismus bringt
in der Sprache die Kraft der Synthesis, als eine nothwendige Folge hervor.
Im Innren der Seele aber führt sie das vollendete Uebereinstimmen
des fortschreitenden Gedanken mit der ihn begleitenden Sprache mit
sich. Da Denken und Sprechen sich immer wechselsweise vollenden, so
wirkt der richtige Gang in beiden auf eine, ununterbrochene Fortschritte
verbürgende Weise. Die Sprache, insofern sie materiell ist und zugleich
von äusseren Einwirkungen abhängt, setzt, sich selbst überlassen,
der auf sie wirkenden inneren Form Schwierigkeiten in den Weg
oder schleicht, ohne recht vorwaltendes Eingreifen jener, in ihren Bildungen
nach ihr eigentümlichen Analogien fort. Wo sie aber, von innerer
energischer Kraft durchdrungen, sich durch diese getragen fühlt,
erhebt sie sich freudig und wirkt nun durch ihre materielle Selbstständigkeit
zurück. Gerade hier wird ihre bleibende und unabhängige Natur
wohlthätig, wenn sie, wie es bei glücklichem Organismus sichtbar der
Fall ist, immer neu aufkeimenden Generationen zum begeisternden
Werkzeuge dient. Das Gelingen geistiger Thätigkeit in Wissenschaft
und Dichtung beruht, ausser den inneren nationellen Anlagen und der
Beschaffenheit der Sprache, zugleich auf mannigfaltigen äusseren, bald
vorhandenen, bald fehlenden Einflüssen. Da aber der Bau der Sprache
unabhängig von solchen sich forterhält, so bedarf es nur eines glücklichen
Anstosses, um das Volk, dem sie angehört, erkennen zu lassen,
dass es in ihr ein zu ganz andrem Gedankenschwunge geeignetes Werkzeug
besitzt. Die nationellen Anlagen erwachen und ihrem Zusammenwirken
466mit der Sprache erblüht eine neue Periode. Wenn man die Geschichte
der Völker vergleicht, so findet man dies zwar seltner auf die
Weise, dass eine Nation zwei verschiedne und nicht mit einander zusammenhängende
Blüthen ihrer Literatur erlebte. Aber in andrer Beziehung
kann man, wie es mir scheint, nicht umhin, ein solches Aufblühen
der Völker zu einer höheren geistigen Thätigkeit aus einem Zustande
abzuleiten, in welchem sowohl in ihren geistigen Anlagen, als in ihrer
Sprache selbst die Keime der kräftigen Entwicklung schon gleichsam
schlummernd und praeformirt lagen. Möge man auch ganze Zeitalter
von Sängern vor Homer annehmen, so ist gewiss doch die Griechische
Sprache auch durch sie nur ausgebildet, nicht aber ursprünglich gebildet
worden. Ihr glücklicher Organismus, ihre ächte Flexionsnatur, ihre
synthetische Kraft, mit Einem Worte alles das, was die Grundlage und
den Nerv ihres Baues ausmacht, war ihr gewiss schon eine unbestimmbare
Reihe von Jahrhunderten hindurch eigen. Auf die entgegengesetzte
Weise sehen wir auch Völker im Besitze der edelsten Sprachen, ohne
dass sich unsrer Kenntniss nach jemals in denselben eine dem entsprechende
Literatur entwickelt hätte. Der Grund lag also hier in mangelndem
Anstoss oder hemmenden Umständen. Ich erinnere hier bloss an
die, dem Sanskritischen Stamm, zu dem sie gehört, viel.glücklicher, als
andre ihrer Schwestern getreu gebliebene Litthauische Sprache. Wenn
ich die hemmenden und fördernden Einflüsse äussere und zufällige
oder besser historische nenne, so ist dieser Ausdruck wegen der wirklichen
Gewalt, welche ihre Gegenwart oder Abwesenheit ausübt, vollkommen
richtig. In der Sache selbst aber kann die Wirkung doch nur
von innen ausgehen. Es muss ein Funke geweckt, ein Band, welches
gleichsam die Federkraft der Seele sich auszudehnen hindert, gelöst
werden und dies kann urplötzlich, ohne langsame Vorbildungen geschehen.
Das wahre und immer unbegreiflich bleibende Entstehen wird darum
nicht erklärbarer, dass man seinen ersten Moment weiter hinaufschiebt.
Der Einklang der Sprachbildung mit der gesammten Gedankenentwicklung,
von dem wir im concreten Sprachbau den geeigneten Ausdruck
des synthetischen Setzens als ein glückliches Zeichen betrachtet
haben, führt zunächst auf diejenige geistige Thätigkeit, welche allein
aus dem Innren heraus schöpferisch ist. Wenn wir den gelungenen
Sprachbau bloss als rückwirkend betrachten und augenblicklich vergessen,
dass, was er dem Geiste ertheilt, er erst selber von ihm empfieng,
so gewährt er Kraft der Intellectualität, Klarheit der logischen Anordnung,
Gefühl von etwas Tieferem, als sich durch blosse Gedankenzergliederung
erreichen lässt, und Begierde, es zu ergründen, Ahndung einer
Wechselbeziehung des Geistigen und Sinnlichen und endlich
rhythmisch melodische, auf allgemeine künstlerische Auffassung bezogene
467Behandlung der Töne oder befördert alles dies, wo es schon von
selbst vorhanden ist. Durch das Zusammenstreben der geistigen Kräfte
in der entsprechenden Richtung entsteht daher, so wie nur ein irgend
weckender Funke aufsprüht, eine Thätigkeit rein geistiger Gedankenentwicklung
und so ruft ein lebendig empfundener, glücklicher Sprachbau
durch seine eigne Natur Philosophie und Dichtung hervor. Das Gedeihen
beider lässt aber wieder umgekehrt auf die Lebendigkeit jener
Einwirkung der Sprache zurückschliessen. Die sich fühlende Sprache
bewegt sich am liebsten da, wo sie sich herrschend zu seyn dünkt, und
auch die geistige Thätigkeit äussert ihre grösste Kraftanstrengung und
erreicht ihre höchste Befriedigung da, wo sie in intellectueller Betrachtung
oder in selbstgeschaffener Bildung aus ihrer eignen Fülle schöpft
oder die Endfäden wissenschaftlicher Forschung zusammenknüpft. In
diesem Gebiete tritt aber auch am lebendigsten die intellectuelle Individualität
hervor. Indem also ein hochvollendeter, aus glücklichen Anlagen
entstandener und sie fortdauernd nährender und anregender
Sprachbau das Lebensprincip der Sprache sichert, veranlasst und befördert
er zugleich die Mannigfaltigkeit der Richtungen, die sich in der
oben betrachteten Verschiedenheit der Charaktere der Sprachen desselben
Sprachstammes offenbart.
Wie lässt sich aber die hier ausgeführte Behauptung, dass das fruchtbare
Lebensprincip der Sprachen hauptsächlich auf ihrer Flexionsnatur
beruht, mit der Thatsache vereinigen, dass der Reichthum an Flexionen
immer im jugendlichsten Alter der Sprachen am grössten ist, im Laufe
der Zeit aber allmählich abnimmt? Es erscheint wenigstens sonderbar,
dass gerade das einbüssende Princip das erhaltende seyn soll. Das Abschleifen
der Flexionen ist eine unläugbare Thatsache. Der die Sprache
formende Sinn lässt sie aus verschiednen Ursachen und in verschiednen
Stadien bald gleichgültig wegfallen, bald macht er sich absichtlich von
ihnen los, und es ist sogar richtiger, die Erscheinung auf diese Weise
auszudrücken, als die Schuld allein und ausschliesslich der Zeit beizumessen.
Schon in den Formationen der Declination und Conjugation,
die gewiss mehrere Niedersetzungen erfahren haben, werden sichtbar
charakteristische Laute immer sorgloser weggeworfen, je mehr sich der
Begriff des ganzen, jedem einzelnen Fall seine Stelle von selbst anweisenden
Schemas festsetzt. Man opfert kühner dem Wohllaute auf und
vermeidet die Häufung der Kennzeichen, wo die Form schon durch eines
gegen die Verwechslung mit andren gesichert ist. Wenn mich meine
Wahrnehmungen nicht trügen, so finden diese, gewöhnlich der Zeit zugeschriebene
Lautveränderungen weniger in den angeblich roheren, als
in den gebildeten Sprachen statt und diese Erscheinung liesse sich wohl
sehr natürlich erklären. Unter Allem, was auf die Sprache einwirkt, ist
das Beweglichste der menschliche Geist selbst und sie erfährt also auch
468die meisten Umgestaltungen von seiner lebendigsten Thätigkeit. Gerade
seinem Fortschreiten aber entspricht es, in der steigenden Zuversicht
auf die Festigkeit seiner innren Ansicht zu sorgfältige Modificirung der
Laute für überflüssig zu erachten. Gerade aus diesem Princip droht in
einer sehr viel späteren Sprachperiode den Flexionssprachen eine weit
tiefer in ihr Wesen eingreifende Umänderung. Je gereifter sich der Geist
fühlt, desto kühner wirkt er in eignen Verbindungen und desto zuversichtlicher
wirft er die Brücken ab, welche die Sprache dem Verständnisse
baut. Zu dieser Stimmung gesellt sich dann leicht Mangel an Gefühl
des auf dem Schalle ruhenden dichterischen Reizes. Die Dichtung
selbst bahnt sich dann mehr innerliche Wege, aufweichen sie jenes Vorzugs
gefahrloser zu entbehren vermag. Es ist also ein Uebergang von
mehr sinnlicher zu reinerer intellectueller Stimmung des Gemüths,
durch welche die Sprache hier umgestaltet wird. Doch sind die ersten
Ursachen nicht immer von der edleren Natur. Rauhere Organe, weniger
für die reine und feinere Lautabsonderung geeignet, ein von Natur weniger
empfindliches und musikalisch nicht geübtes Ohr legen den
Grund zu der Gleichgültigkeit gegen das tönende Princip in der Sprache.
Gleichergestalt kann die vorwaltende praktische Richtung der
Sprache Abkürzungen, Auslassungen von Beziehungswörtern, Ellipsen
aller Art aufdringen, weil man, nur das Verständniss bezweckend, alles
dazu nicht unmittelbar Nothwendige verschmäht.
Ueberhaupt muss die Beziehung des Volksgeistes auf die Sprache
durchaus eine andere seyn, so lange sich diese noch in der Gährung ihrer
ersten Formation befindet und wenn die schon geformte nur zum
Gebrauche des Lebens dient. So lange in jener früheren Periode die Elemente
auch ihrem Ursprunge nach noch klar vor der Seele stehen und
diese mit ihrer Zusammenfügung beschäftigt ist, hat sie Gefallen an dieser
Bildung des Werkzeugs ihrer Thätigkeit und lässt nichts fallen, was
durch irgendeine auszudrückende Nuance des Gefühls festgehalten
wird. In der Folge waltet mehr der Zweck des Verständnisses vor, die
Bedeutung der Elemente wird dunkler und die eingeübte Gewohnheit
des Gebrauchs macht sorglos über die Einzelnheiten des Baues und die
genaue Bewahrung der Laute. An die Stelle der Freude der Phantasie an
sinnreicher Vereinigung der Kennzeichen mit volltönendem Sylbenfall
tritt Bequemlichkeit des Verstandes und löst die Formen in Hülfsverba
und Praepositionen auf. Er erhebt dadurch zugleich den Zweck leichterer
Deutlichkeit über die übrigen Vorzüge der Sprache, da allerdings
diese analytische Methode die Anstrengung des Verständnisses vermindert,
ja in einzelnen Fällen die Bestimmtheit da vermehrt, wo die synthetische
dieselbe schwieriger erreicht. Bei dem Gebrauch dieser grammatischen
Hülfswörter aber werden die Flexionen entbehrlicher und
verlieren allmählich ihr Gewicht in der Achtsamkeit des Sprachsinnes.469
Welches nun immer die Ursache seyn mag, so ist es sicher, dass auf
diese Weise ächte Flexionssprachen ärmer an Formen werden, häufig
grammatische Wörter an die Stelle derselben setzen und auf diese Art
sich im Einzelnen denjenigen Sprachen nähern können, die sich von ihrem
Stamme durch ein ganz verschiednes und unvollkommneres Princip
unterscheiden. Unsre heutige und die Englische Sprache enthalten
hiervon häufige Beispiele, die letztere bei weitem mehr, woran mir aber
ihre Mischung mit Romanischem Stoff keine Schuld zu tragen scheint,
da diese auf ihren grammatischen Bau wenig oder gar keinen Einfluss
ausübt. Dass aber hieraus eine Einwendung gegen den fruchtbaren Einfluss
der Flexionsnatur auch auf die späteste Dauer der Sprachen hin
hergenommen werden könne, glaube ich dennoch nicht. Gäbe es auch
eine Sanskritische Sprache, die auf dem hier beschriebenen Wege Chinesischem
Entbehren der Beziehungs zeichen der Redetheile nahe gekommen
wäre, so bliebe der Fall dennoch immer gänzlich verschieden.
Dem Chinesischen Bau liegt, wie man ihn auch erklären möge, offenbar
eine Unvollkommenheit in der Sprachbildung, wahrscheinlich eine,
dem Volke eigenthümliche Gewohnheit der Isolirung der Laute, zusammentreffend
mit zu geringer Stärke des innren, ihre Verbindung und
Vermittlung erheischenden Sprachsinns, zum Grunde. In einer solchen
Sanskritsprache dagegen hätte sich die ächteste Flexionsnatur mit allen
ihren wohlthätigen Einflüssen seit einer unbestimmbaren Reihe von
Generationen festgesetzt und dem Sprachsinn seine Gestalt gegeben. In
ihrem wahren Wesen wäre daher solche Sprache immer Sanskritisch
geblieben; ihr Unterschied läge nur in einzelnen Erscheinungen, welche
das Gepräge nicht austilgen könnten, das die Flexionsnatur der ganzen
übrigen Sprache aufgedrückt hätte. Die Nation trüge ausserdem, da sie
zu dem gleichen Stamme gehörte, dieselben nationellen Anlagen in
sich, welchen der edlere Sprachbau seinen Ursprung verdankte, und
fasste mit demselben Geiste und Sinne ihre Sprache auf, wenn auch diese
in einzelnen Theilen jenem Geiste äusserlich minder entsprechend
wäre. Auch würden immer, wie es namentlich in der Englischen Conjugation
der Fall ist, einzelne ächte Flexionen übrig geblieben seyn, die
den Geist an dem wahren Ursprunge und dem eigentlichen Wesen der
Sprache nicht irre werden liessen. Ein auf diese Weise entstehender geringerer
Formenreichthum und einfacherer Bau macht daher die Sprachen,
wie wir eben an der Englischen und der unsrigen sehen, keineswegs
hoher Vorzüge unfähig, sondern ertheilt ihnen nur einen
verschiedenen Charakter. Ihre Dichtung entbehrt zwar dadurch der
vollständigen Kräftigkeit eines ihrer hauptsächlichen Elemente. Wenn
aber bei einer solchen Nation die Poesie wirklich sänke oder doch in
ihrer Fruchtbarkeit abnähme, so entspränge dies gewiss ohne Schuld
der Sprache aus tieferen innren Ursachen.470
Aus dem Lateinischen hervorgegangene Sprachen
Dem festen, ja man kann wohl sagen unaustilgbaren Haften des ächten
Organismus an den Sprachen, welchen er einmal eigenthümlich geworden
ist, verdanken auch die Lateinischen Töchtersprachen ihren reinen
grammatischen Bau. Es scheint mir ein hauptsächliches Erforderniss
zur richtigen Beurtheilung der merkwürdigen Erscheinung ihrer Entstehung,
darauf Gewicht zu legen, dass auf den Wiederaufbau der zertrümmerten
Römischen Sprache, wenn man allein das grammatisch
Formale desselben ins Auge fasst, kein fremder Stoff irgend wesentlich
eingewirkt hat. Die Ursprachen der Länder, in welchen die neuen
Mundarten aufblühten, scheinen durchaus keinen Antheil daran gehabt
zu haben. Vom Vaskischen ist dies gewiss; es gilt aber höchst wahrscheinlich
ebenso von den ursprünglich in Gallien herrschenden Sprachen.
Die fremden einwandernden Völkerschaften, grösstentheils von
Germanischem oder den Germanen verwandtem Stamme, haben der
Umbildung des Römischen eine grosse Anzahl von Wörtern zugeführt;
allein in dem grammatischen Theile lassen sich schwerlich irgend bedeutende
Spuren ihrer Mundarten auffinden. Die Völker lassen sich
nicht leicht die Form umgestalten, in welche sie den Gedanken zu giessen
gewohnt sind. Der Grund, aus welchem die Grammatik der neuen
Sprachen hervorgieng, war daher wesentlich und hauptsächlich der der
zertrümmerten selbst. Aber die Zertrümmerung und den Verfall muss
man ihren Ursachen nach schon viel früher, als in der Periode, in welcher
sie offenbar wurden, aufsuchen. Die Römische Sprache wurde
schon während des Bestehens der Grosse des Reichs in den Provinzen
und nach Verschiedenheit derselben anders, als in Latium und der
Herrscherstadt gesprochen. Selbst in diesen ursprünglichen Wohnsitzen
der Nation mochte die Volkssprache Eigenthümlichkeiten an sich
tragen, die erst spät nach dem Sinken der gebildeten allgemeiner zum
Vorschein kamen. Es entstanden natürlich Abweichungen der Aussprache,
Soloecismen in den Constructionen, ja wahrscheinlich schon Erleichterungen
der Formen durch Hülfswörter da, wo die gebildete Sprache
sie gar nicht oder nur in ganz einzelnen Ausnahmen zuliess. Die
Volkseigenthümlichkeiten mussten überwiegend werden, als die letztere
sich bei dem Verfalle des Gemeinwesens nicht mehr durch Literatur
und mündlichen öffentlichen Gebrauch auf ihrer Höhe getragen fühlte. 52
Die provincielle Entartung gieng immer weiter, je lockrer die Bande
wurden, welche die Provinzen mit dem Ganzen verknüpften.
Diesen doppelten Verfall steigerten endlich die fremden Einwanderungen
auf den höchsten Punkt. Es war nun nicht mehr ein blosses Ausarten
der herrschend gewesenen Sprache, sondern ein Abwerfen und
Zerschlagen ihrer wesentlichsten Formen, oft ein wahres Misverstehen
471derselben, immer aber zugleich ein Unterschieben neuer Erhaltungsmittel
der Einheit der Rede, geschöpft aus dem vorhandenen Vorrathe,
allein oft widersinnig verknüpft. Mitten in allen diesen Veränderungen
blieb aber in der untergehenden Sprache das wesentliche Princip ihres
Baues, die reine Unterscheidung des Sach- und Beziehungsbegriffs und
das Bedürfniss, beiden den ihnen eigenthümlichen Ausdruck zu verschaffen,
und im Volke das durch die Gewohnheit von Jahrhunderten
tief eingedrungene Gefühl hiervon. An jedem Bruchstück der Sprache
haftete dies Gepräge; es hätte sich nicht austilgen lassen, wenn die Völker
es auch verkannt hätten. Es lag jedoch in diesen selbst, es aufzusuchen,
zu enträthseln und zum Wiederaufbau anzuwenden. In dieser, aus
der allgemeinen Natur des Sprachsinnes selbst entspringenden Gleichförmigkeit
der neuen Umbildung, verbunden mit der Einheit der in Absicht
des Grammatischen unvermischt gebliebenen Muttersprache,
muss man die Erklärung der Erscheinung suchen, dass das Verfahren
der Romanischen Sprachen in ganz entfernten Länderstrichen sich so
gleich bleibt und oft durch ganz einzelne Uebereinstimmungen überrascht.
Es sanken Formen, nicht aber die Form, die vielmehr ihren alten
Geist über die neuen Umgestaltungen ausgoss.
Denn wenn in diesen neueren Sprachen eine Praeposition einen Casus
ersetzt, so ist der Fall nicht dem gleich, wenn in einer nur Partikeln
anfügenden ein Wort den Casus andeutet. Mag auch die ursprüngliche
Sachbedeutung desselben verloren gegangen seyn, so drückt es doch
nicht rein eine Beziehung bloss als solche aus, weil der ganzen Sprache
diese Ausdrucksweise nicht eigenthümlich ist, ihr Bau nicht aus der
innren Sprachansicht, welche rein und energisch auf scharfe Abgränzung
der Redetheile dringt, herfloss und der Geist der Nation ihre Bildungen
nicht von diesem Standpunkte aus in sich aufnimmt. In der Römischen
Sprache war dies Letztere genau und vollkommen der Fall. Die
Praepositionen bildeten ein Ganzes solcher Beziehungen, jede forderte
nach ihrer Bedeutung einen ihr geeigneten Casus; nur mit diesem zusammen
bezeichnete sie das Verhältniss. Diese schöne Uebereinstimmung
nahmen die ihrem Ursprunge nach entarteten Sprachen nicht in
sich auf. Allein das Gefühl davon, die Anerkennung der Praeposition
als eines eignen Redetheiles, ihre wahre Bedeutsamkeit giengen nicht
mit unter und dies ist keine bloss willkührliche Annahme. Es ist auf
nicht zu verkennende Weise in der Gestaltung der ganzen Sprache
sichtbar, die eine Menge von Lücken in den einzelnen Formen, aber im
Ganzen Formalität an sich trägt, ihrem Principe nach nicht weniger, als
ihre Stammmutter selbst Flexionssprache ist. Das Gleiche findet sich im
Gebrauche des Verbum. Wie mangelhaft seine Formen seyn mögen, so
ist seine synthetisch setzende Kraft dennoch dieselbe, da die Sprache
seine Scheidung vom Nomen einmal unauslöschbar in ihrem Gepräge
472trägt. Auch das in unzähligen Fällen, wo es die Muttersprache nicht
selbstständig ausdrückt, gebrauchte Pronomen entspricht dem Gefühl
nach dem wahren Begriff dieses Redetheils. Wenn es in Sprachen, denen
die Bezeichnung der Personen am Verbum fehlt, sich als Sachbegriff
vor das Verbum stellt, so ist es in den Lateinischen Töchtersprachen
seinem Begriffe nach wirklich die nur abgelöste, anders gestellte
Person. Denn die Unzertrennlichkeit des Verbum und der Person liegt
von der Stammmutter her fest in der Sprache und beurkundet sich sogar
in der Tochter durch einzelne übrig gebliebene Endlaute. Ueberhaupt
kommt in dieser, wie in allen Flexionssprachen, die stellvertretende
Function des Pronomen mehr an das Licht, und da diese zur reinen
Auffassung des Relativpronomen führt, so wird die Sprache auch dadurch
in den richtigen Gebrauch dieses letzteren eingeführt. Ueberall
kehrt daher dieselbe Erscheinung zurück. Die zertrümmerte Form ist in
ganz verschiedner Weise wieder aufgebaut, aber ihr Geist schwebt noch
über der neuen Bildung und beweist die schwer zerstörbare Dauer des
Lebensprincips ächt grammatisch gebildeter Sprachstämme.
Bei aller Gleichförmigkeit der Behandlung des umgebildeten Stoffes,
welche die Lateinischen Töchtersprachen im Ganzen beibehalten, liegt
doch einer jeden einzelnen ein besondres Princip in der individuellen
Auffassung zum Grunde. Die unzähligen Einzelnheiten, welche der Gebrauch
der Sprache nothwendig macht, müssen, wie ich im Vorigen
wiederholt angedeutet habe, wo und wie immer gesprochen werden
soll, in eine Einheit verknüpft werden und diese kann, da die Sprache
ihre Wurzeln in alle Fibern des menschlichen Geistes einsenkt, nur eine
individuelle seyn. Dadurch allein, dass ein verändertes Einheitsprincip,
eine neue Auffassung von dem Geiste eines Volkes vorgenommen wird,
tritt eben eine neue Sprache in die Wirklichkeit, und wo eine Nation auf
ihre Sprache mächtig einwirkende Umwälzungen erfährt, muss sie die
veränderten oder neuen Elemente durch neue Formung zusammenfassen.
Wir haben oben von dem Momente im Leben der Nationen geredet,
in welchem ihnen die Möglichkeit klar wird, die Sprache, unabhängig
von äusserem Gebrauche, zum Aufbau eines Ganzen der Gedanken
und der Gefühle hinzuwenden. Wenn auch das Entstehen einer Literatur,
das wir hier in seinem eigentlichen Wesen und vom Standpunkte
seiner letzten Vollendung aus bezeichnet haben, in der That nur allmählich
und aus dunkel empfundenem Triebe hervorgeht, so ist doch der
Beginn immer ein eigenthümlicher Schwung, ein von innen heraus entstehender
Drang eines Zusammenwirkens der Form der Sprache und
der individuellen des Geistes, aus welchem die ächte und reine Natur
beider zurückstrahlt und der keinen andren Zweck, als eben dies Zurückstrahlen
hat. Die Entwicklungsart dieses Dranges wird die Ideenbahn,
welche die Nation bis zum Verfall ihrer Sprache durchläuft. Es ist
473dies gleichsam eine zweite, höhere Verknüpfung der Sprache zur Einheit,
und wie diese sich zur Bildung der äusseren, technischen Form
verhält, ist oben bei Gelegenheit des Charakters der Sprachen näher erörtert
worden.
Bei dem Uebergange der Römischen Sprache in die neueren, aus ihr
entstandenen ist diese zwiefache Behandlung der Sprache sehr deutlich
zu unterscheiden. Zwei der letzteren, die Rhäto- und Dako-Romanische,
sind der wissenschaftlichen nicht theilhaft geworden, ohne dass
sich sagen lässt, dass ihre technische Form hinter den übrigen zurückstände.
Vielmehr hat gerade die Dako-Romanische am meisten Flexionen
der Muttersprache beibehalten und nähert sich ausserdem in der
Behandlung derselben der Italienischen. Der Fehler lag also hier nur an
äusseren Umständen, am Mangel von Ereignissen und Lagen, welche
den Schwung veranlassten, die Sprache zu höheren Zwecken zu gebrauchen.
Dasselbe war, wenn wir zu einem Falle ähnlicher Art übergehen, unstreitig
die Ursach, dass sich aus dem Verfall des Griechischen nicht
eine durch neue Eigenthümlichkeit hervorstechende Sprache erzeugte.
Denn sonst ist die Bildung des Neugriechischen in Vielem der der Romanischen
Sprachen sehr ähnlich. Da diese Umbildungen grossentheils
im natürlichen Laufe der Sprache liegen und beide Muttersprachen den
gleichen grammatischen Charakter an sich tragen, so ist diese Aehnlichkeit
leicht erklärbar, macht aber die Verschiedenheit im letzten Erfolge
noch auffallender. Griechenland, als Provinz eines sinkenden, oft Verheerungen
durch fremde Völkerzüge ausgesetzten Reiches, konnte
nicht die blühend sich emporschwingende Kraft gewinnen, welche im
Abendlande die Frische und Regsamkeit neu sich bildender innerer und
äusserer Verhältnisse erzeugte. Mit den neuen gesellschaftlichen Einrichtungen,
dem gänzlichen Aufhören des Zusammenhanges mit einem
in sich zerfallenen Staatskörper und verstärkt durch die Hinzukunft
kräftiger und muthvoller Völkerstämme, mussten die abendländischen
Nationen in allen Thätigkeiten des Geistes und des Charakters neue
Bahnen betreten. Die sich hieraus hervorbildende neue Gestaltung
führte zugleich eine Verbindung religiösen, kriegerischen und dichterischen
Sinnes mit sich, welche auf die Sprache den glücklichsten und
entschiedensten Einfluss ausübte. Es blühte diesen Nationen eine neue
poetisch schöpferische Jugend auf und ihr Zustand hierin wurde gewissermassen
dem ähnlich, der sonst durch das Dunkel der Vorzeit von uns
getrennt ist.
So gewiss man aber auch diesem äusseren historischen Umschwunge
das Aufblühen der neueren abendländischen Sprachen und Literaturen
zu einer Eigenthümlichkeit, in der sie mit der Stammmutter zu wetteifern
vermögen, zuschreiben muss, so wirkte doch, wie es mir scheint,
474ganz wesentlich noch eine andere, schon weiter oben (VII 243.) im Vorbeigehn
berührte Ursach mit, deren Erwägung, da sie besonders die
Sprache angeht, ganz eigentlich in die Reihe dieser Betrachtungen gehört.
Die Umänderung, welche die Römische Sprache erlitt, war ohne
allen Vergleich tiefer eingreifend, gewaltiger und plötzlicher, als die,
welche die Griechische erfuhr. Sie glich einer wahren Zertrümmerung,
da die des Griechischen sich mehr in den Schranken bloss einzelner Verstümmelungen
und Formenauflösungen erhielt. Man erkennt an diesem
Beispiele eine, auch durch andere in der Sprachgeschichte bestätigte,
doppelte Möglichkeit des Ueberganges einer formenreichen Sprache in
eine formlosere. In der einen zerfällt der kunstvolle Bau und wird, nur
weniger vollkommen, wiedergeschaffen. In der anderen werden der sinkenden
Sprache nur einzelne, wieder vernarbende Wunden geschlagen;
es entsteht keine reine neue Schöpfung, die veraltete Sprache dauert,
nur in beklagenswerther Entstellung, fort. Da das Griechische Kaiserthum
seiner Hinfälligkeit und Schwäche ungeachtet noch lange bestand,
so dauerte auch die alte Sprache länger fort und stand, wie ein Schatz,
aus dem sich immer schöpfen, ein Kanon, auf den sich immer zurückkommen
liess, noch lange da. Nichts beweist so überzeugend den Unterschied
zwischen der Neugriechischen und den Romanischen Sprachen
in diesem Punkte, als der Umstand, dass der Weg, auf welchem man die
erstere in der neuesten Zeit zu heben und zu läutern versucht hat, immer
der der möglichsten Annäherung an das Altgriechische gewesen ist.
Selbst einem Spanier oder Italiener konnte der Gedanke einer solchen
Möglichkeit nicht beikommen. Die Romanischen Nationen sahen sich
wirklich auf neue Bahnen hingeschleudert und das Gefühl des unabweislichen
Bedürfnisses beseelte sie mit dem Muthe, sie zu ebnen und in
den ihrem individuellen Geiste angemessenen Richtungen zum Ziele zu
führen, da eine Rückkehr unmöglich war. Von einer andren Seite aus
betrachtet, befindet sich aber gerade durch diese Verschiedenheit die
Neugriechische Sprache in einer günstigeren Lage. Es besteht ein mächtiger
Unterschied zwischen den Sprachen, welche, wie verwandt aufkeimende
desselben Stammes, auf dem Wege innerer Entwicklung aus einander
fortspriessen, und zwischen solchen, die sich auf dem Verfall und
den Trümmern andrer, also durch die Einwirkung äusserer Umstände
erheben. In den ersteren, durch gewaltsame Revolutionen und bedeutende
Mischungen mit fremden ungetrübten lässt sich mehr oder weniger
von jedem Ausdrucke, Wort oder Form aus in eine unabsehbare Tiefe
zurückgehen. Denn sie bewahren grösstentheils die Gründe derselben
in sich und nur sie können sich rühmen, sich selbst zu genügen und innerhalb
ihrer Gränzen nachzuweisende Consequenz zu besitzen. In dieser
Lage befinden sich Töchtersprachen in dem Sinne, wie es die Romanischen
sind, offenbar nicht. Sie ruhen gänzlich auf der einen Seite auf
475einer nicht mehr lebenden, auf der andren auf fremden Sprachen. Alle
Ausdrücke führen daher, wie man ihrem Ursprunge nachgeht, meistentheils
durch eine ganz kurze Reihe vermittelnder Gestaltungen auf ein
fremdes, dem Volke unbekanntes Gebiet. Selbst in dem, wenig oder gar
nicht mit fremden Elementen vermischten grammatischen Theil lässt
sich die Consequenz der Bildung, auch insofern sie wirklich vorhanden
ist, immer nur mit Bezugnahme auf die fremde Muttersprache darthun.
Das tiefere Verständniss dieser Sprachen, ja selbst der Eindruck, welchen
in jeder Sprache der innere harmonische Zusammenhang aller Elemente
bewirkt, ist daher durch sie selbst immer nur zur Hälfte möglich
und bedarf zu seiner Vervollständigung eines, dem Volke, das sie
spricht, unzugänglichen Stoffes. In beiden Gattungen von Sprachen
kann man genöthigt werden, auf die frühere zurückzugehen. Man fühlt
aber in der Art, wie dies geschieht, den Unterschied genau, wenn man
vergleicht, wie die Unzulänglichkeit der eigenen Erklärung im Römischen
auf Sanskritischen Grund und Boden und im Französischen auf
Römischen führt. Offenbar mischt sich der Umgestaltung in dem letzteren
Falle mehr durch äussere Einwirkung entstandene Willkühr bei und
selbst der natürliche, analogische Gang, der sich allerdings auch hier
wieder bildet, hängt an der Voraussetzung jener äusseren Einwirkung.
In dieser, hier von den Romanischen Sprachen geschilderten Lage befindet
sich nun das Neugriechische, eben weil es nicht wirklich zu einer
eigentlich neuen Sprache geworden ist, gar nicht oder doch unendlich
weniger. Von der Mischung mit fremden Wörtern kann es sich im Verlaufe
der Zeit befreien, da dieselben mit gewiss wenig zahlreichen Ausnahmen
nicht so tief, als in den Romanischen Sprachen, in sein wahres
Leben eingedrungen sind. Sein wirklicher Stamm aber, das Altgriechische,
kann auch dem Volke nicht als fremd erscheinen. Wenn sich das
Volk auch nicht mehr in das Ganze seines kunstvollen Baues hineinzudenken
vermag, so muss es doch die Elemente zum grössten Theil als
auch seiner Sprache angehörend erkennen.
In Absicht auf die Natur der Sprache selbst ist der hier erwähnte
Unterschied gewiss bemerkenswerth. Ob er auch auf den Geist und den
Charakter der Nation einen bedeutenden Einfluss ausübt? kann eher
zweifelhaft scheinen. Man kann mit Recht dagegen einwenden, dass
jede über den jedesmal gegenwärtigen Zustand der Sprache hinausgehende
Betrachtung dem Volke fremd ist, dass daher die auf sich selbst
ruhende Erklärbarkeit der rein organisch in sich geschlossenen Sprachen
für dasselbe unfruchtbar bleibt und dass jede aus einer andren, auf
welchem Wege es immer sey, entstandene, aber schon Jahrhunderte hindurch
fortgebildete Sprache eben dadurch eine vollkommen hinlängliche,
auf die Nation wirkende Consequenz gewinnt. Es lässt sich in der
That denken, dass es unter den früheren, uns als Muttersprachen erscheinenden
476Sprachen auf ähnliche Art, als es die Romanischen sind,
entstandene geben könne, obgleich eine sorgfältige und genaue Zergliederung
uns wohl bald ihre Unerklärbarkeit aus ihrem eignen Gebiete
verrathen dürfte. Unläugbar aber liegt in dem geheimen Dunkel der
Seelenbildung und des Forterbens geistiger Individualität ein unendlich
mächtiger Zusammenhang zwischen dem Tongewebe der Sprache und
dem Ganzen der Gedanken und Gefühle. Unmöglich kann es daher
gleichgültig seyn, ob in ununterbrochener Kette die Empfindung und
die Gesinnung sich an denselben Lauten hingeschlungen und sie mit
ihrem Gehalte und ihrer Wärme durchdrungen haben oder ob diese auf
sich selbst ruhende Reihe von Wirkungen und Ursachen gewaltsame
Störungen erfährt. Eine neue Consequenz bildet sich auch hier allerdings
und die Zeit hat in den Sprachen mehr, als sonst im menschlichen
Gemüthe eine Wunden heilende Kraft. Man darf aber auch nicht vergessen,
dass diese Consequenz nur allmählich wieder entsteht und dass
die, ehe sie zur Festigkeit gelangt, lebenden Generationen auch schon,
als Ursachen wirkend, in die Reihe treten. Es erscheint daher durchaus
nicht als einflusslos auf die Tiefe der Geistigkeit, die Innigkeit der Empfindung
und die Kraft der Gesinnung, ob ein Volk eine ganz auf sich
selbst ruhende oder doch eine aus rein organischer Fortentwicklung
hervorgegangene Sprache redet oder nicht? Es sollte daher bei der
Schilderung von Nationen, welche sich im letzteren Falle befinden,
nicht unerforscht bleiben, ob und inwiefern das durch den Einfluss ihrer
Sprache gleichsam gestörte Gleichgewicht in ihnen auf andere Weise
wiederhergestellt, ja ob und wie vielleicht aus der nicht abzuläugnenden
Unvollkommenheit ein neuer Vorzug gewonnen worden ist?
Rückblick auf den bisherigen Gang der Untersuchung
35. Wir haben jetzt einen der Endpunkte erreicht, auf welche die gegenwärtige
Untersuchung zu führen bestimmt ist.
Die ganze hier von der Sprache gegebene Ansicht beruht, um das bis
hierher Erörterte, soweit es die Anknüpfung des Folgenden erfordert,
kurz ins Gedächtniss zurückzurufen, wesentlich darauf, dass dieselbe
zugleich die nothwendige Vollendung des Denkens und die natürliche
Entwicklung einer den Menschen als solchen bezeichnenden Anlage ist.
Diese Entwicklung ist aber nicht die eines Instincts, der bloss physiologisch
erklärt werden könnte. Ohne ein Act des unmittelbaren Bewusstseyns,
ja selbst der augenblicklichen Spontaneität und der Freiheit zu
seyn, kann sie doch nur einem mit Bewusstseyn und Freiheit begabten
Wesen angehören und geht in diesem aus der ihm selbst unergründlichen
Tiefe seiner Individualität und aus der Thätigkeit der in ihm liegenden
477Kräfte hervor. Denn sie hängt durchaus von der Energie und der
Form ab, mit und in welcher der Mensch seiner gesammten geistigen
Individualität, ihm selbst unbewusst, den treibenden Anstoss ertheilt. 53
Durch diesen Zusammenhang mit einer individuellen Wirklichkeit, so
wie aus anderen, hinzukommenden Ursachen ist sie aber zugleich den,
den Menschen in der Welt umgebenden, sogar auf die Acte seiner Freiheit
Einfluss ausübenden Bedingungen unterworfen. In der Sprache
nun, insofern sie am Menschen wirklich erscheint, unterscheiden sich
zwei constitutive Principe: der innere Sprachsinn (unter welchem ich
nicht eine besondere Kraft, sondern das ganze geistige Vermögen, bezogen
auf die Bildung und den Gebrauch der Sprache, also nur eine Richtung
verstehe) und der Laut, insofern er von der Beschaffenheit der Organe
abhängt und auf schon Ueberkommenem beruht. Der innere
Sprachsinn ist das die Sprache von innen heraus beherrschende, überall
den leitenden Impuls gebende Princip. Der Laut würde an und für sich
der passiven, Form empfangenden Materie gleichen; allein vermöge der
Durchdringung durch den Sprachsinn in articulirten umgewandelt und
dadurch in untrennbarer Einheit und immer gegenseitiger Wechselwirkung
zugleich eine intellectuelle und sinnliche Kraft in sich fassend,
wird er zu dem in beständig symbolisirender Thätigkeit wahrhaft und
scheinbar sogar selbstständig schaffenden Princip in der Sprache. Wie
es überhaupt ein Gesetz der Existenz des Menschen in der Welt ist, dass
er nichts aus sich hinauszusetzen vermag, das nicht augenblicklich zu
einer auf ihn zurückwirkenden und sein ferneres Schaffen bedingenden
Masse wird, so verändert auch der Laut wiederum die Ansicht und das
Verfahren des inneren Sprachsinnes. Jedes fernere Schaffen bewahrt
also nicht die einfache Richtung der ursprünglichen Kraft, sondern
nimmt eine, aus dieser und der durch das früher Geschaffene gegebenen
zusammengesetzte an. Da die Naturanlage zur Sprache eine allgemeine
des Menschen ist und Alle den Schlüssel zum Verständniss aller
Sprachen in sich tragen müssen, so folgt von selbst, dass die Form aller
Sprachen sich im Wesentlichen gleich seyn und immer den allgemeinen
Zweck erreichen muss. Die Verschiedenheit kann nur in den Mitteln
und nur innerhalb der Gränzen liegen, welche die Erreichung des
Zweckes verstattet. Sie ist aber mannigfaltig in den Sprachen vorhanden
und nicht allein in den blossen Lauten, so dass dieselben Dinge nur
anders bezeichnet würden, sondern auch in dem Gebrauche, welchen
der Sprachsinn in Absicht der Form der Sprache von den Lauten macht,
ja in seiner eignen Ansicht dieser Form. Durch ihn allein sollte zwar, so
weit die Sprachen bloss formal sind, nur Gleichförmigkeit in ihnen entstehen
können. Denn er muss in allen den richtigen und gesetzmässigen
Bau verlangen, der nur Einer und ebenderselbe seyn kann. In der Wirklichkeit
aber verhält es sich anders, theils wegen der Rückwirkung des
478Lautes, theils wegen der Individualität des inneren Sinnes in der Erscheinung.
Es kommt nemlich auf die Energie der Kraft an, mit welcher
er auf den Laut einwirkt und denselben in allen, auch den feinsten
Schattirungen zum lebendigen Ausdruck des Gedanken macht. Diese
Energie kann aber nicht überall gleich seyn, nicht überall gleiche Intensität,
Lebendigkeit und Gesetzmässigkeit offenbaren. Sie wird auch
nicht immer durch gleiches Hinneigen zur symbolischen Behandlung
des Gedanken und durch gleiches ästhetisches Gefallen an Lautreichthum
und Einklang unterstützt. Dennoch bleibt das Streben des inneren
Sprachsinns immer auf Gleichheit in den Sprachen gerichtet und
auch abbeugende Formen sucht seine Herrschaft auf irgend eine Weise
zur richtigen Bahn zurückzuleiten. Dagegen ist der Laut wahrhaft das
die Verschiedenheit vermehrende Princip. Denn er hängt von der Beschaffenheit
der Organe ab, welche hauptsächlich das Alphabet bildet,
das, wie eine gehörig angestellte Zergliederung beweist, die Grundlage
jeder Sprache ist. Gerade der articulirte hat ferner seine, ihm eigenthümlichen,
theils auf Leichtigkeit, theils auf Wohlklang der Aussprache
gegründeten Gesetze und Gewohnheiten, die zwar auch wieder
Gleichförmigkeit mit sich führen, allein in der besonderen Anwendung
nothwendig Verschiedenheiten bilden. Er muss sich endlich, da wir es
nirgends mit einer isolirt, rein von neuem anfangenden Sprache zu thun
haben, immer an Vorhergegangenes oder Fremdes anschliessen. In diesem
allem zusammengenommen liegen die Gründe der nothwendigen
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. Die Sprachen können
nicht den nemlichen an sich tragen, weil die Nationen, die sie reden,
verschieden sind und eine durch verschiedene Lagen bedingte Existenz
haben.
In der Betrachtung der Sprache an sich muss sich eine Form offenbaren,
die unter allen denkbaren am meisten mit den Zwecken der Sprache
übereinstimmt, und man muss die Vorzüge und Mängel der vorhandenen
nach dem Grade beurtheilen können, in welchem sie sich dieser
einen Form nähern. Diesen Weg verfolgend, haben wir gefunden, dass
diese Form nothwendig diejenige ist, welche dem allgemeinen Gange
des menschlichen Geistes am meisten zusagt, sein Wachsthum durch
die am meisten geregelte Thätigkeit befördert und das verhältnissmässige
Zusammenstimmen aller seiner Richtungen nicht bloss erleichtert,
sondern durch zurückwirkenden Reiz lebendiger hervorruft. Die geistige
Thätigkeit hat aber nicht bloss den Zweck ihrer inneren Erhöhung.
Sie wird auf der Verfolgung dieser Bahn auch nothwendig zu dem äusseren
hingetrieben, ein wissenschaftliches Gebäude der Weltauffassung
aufzuführen und von diesem Standpunkte aus wieder schaffend zu wirken.
Auch dies haben wir in Betrachtung gezogen und es hat sich unverkennbar
gezeigt, dass diese Erweiterung des menschlichen Gesichtskreises
479am besten oder vielmehr allein an dem Leitfaden der vollkommensten
Sprachform gedeiht. Wir sind daher in diese genauer eingegangen
und ich habe versucht, die Beschaffenheit dieser Form in den Punkten
nachzuweisen, in welchen das Verfahren der Sprache sich zur
unmittelbaren Erreichung ihrer letzten Zwecke zusammenschliesst. Die
Frage, wie die Sprache es macht, um den Gedanken im einfachen Satze
und in der, viele Sätze in sich verflechtenden Periode darzustellen,
schien hier die einfachste Lösung der Aufgabe ihrer Würdigung zugleich
nach ihren inneren und äusseren Zwecken hin darzubieten. Von
diesem Verfahren liess sich aber zugleich auf die nothwendige Beschaffenheit
der einzelnen Elemente zurückgehn. Dass ein vorhandener
Sprachstamm oder auch nur eine einzelne Sprache eines solchen durchaus
und in allen Punkten mit der vollkommenen Sprachform übereinstimme,
lässt sich nicht erwarten und findet sich wenigstens nicht in
dem Kreise unserer Erfahrung. Die Sanskritischen Sprachen aber nähern
sich dieser Form am meisten und sind zugleich die, an welchen
sich die geistige Bildung des Menschengeschlechts in der längsten Reihe
der Fortschritte am glücklichsten entwickelt hat. Wir können sie mithin
als einen festen Vergleichungspunkt für alle übrigen betrachten.
Von der rein gesetzmässigen Form abweichende Sprachen
Diese letzteren lassen sich nicht gleich einfach darstellen. Da sie nach
denselben Endpunkten, als die rein gesetzmässigen hinstreben, dies Ziel
aber nicht in gleichem Grade oder nicht auf richtigem Wege erreichen,
so kann in ihrem Baue keine so klar hervorleuchtende Consequenz herrschen.
Wir haben oben zur Erreichung der Satzbildung ausser der, aller
grammatischen Formen entrathenden Chinesischen Sprache drei mögliche
Formen der Sprachen aufgestellt, die flectirende, agglutinirende und
die einverleibende. Alle Sprachen tragen eine oder mehrere dieser Formen
in sich und es kommt zur Beurtheilung ihrer relativen Vorzüge darauf
an, wie sie jene abstracten Formen in ihre concrete aufgenommen
haben oder vielmehr welches das Princip dieser Annahme oder Mischung
ist? Diese Unterscheidung der abstracten möglichen Sprachformen
von den concreten wirklich vorhandenen wird, wie ich mir
schmeichle, schon dazu beitragen, den befremdenden Eindruck des Heraushebens
einiger Sprachen, als der allein berechtigten, welches die andren
ebendadurch zu unvollkommneren stempelt, zu vermindern. Denn
dass unter den abstracten die flectirende die allein richtige genannt werden
kann, dürfte nicht leicht bestritten werden. Das hierdurch über die
andren gefällte Urtheil trifft aber nicht in gleichem Masse auch die concreten
vorhandenen Sprachen, in welchen nicht ausschliesslich Eine jener
480Formen herrschend, dagegen immer ein sichtbares Streben nach der
richtigen lebendig ist. Dennoch bedarf dieser Punkt noch einer genaueren
rechtfertigenden Erörterung.
Wohl sehr allgemein dürfte bei denen, die sich im Besitz der Kenntniss
mehrerer Sprachen befinden, die Empfindung die seyn, dass, insofern
diese letzteren auf gleichem Grade der Cultur stehen, jeder ihr eigenthümliche
Vorzüge gebühren, ohne dass einer der entschiedene
Vorzug über die andren eingeräumt werden könne. Hiermit nun steht
die in den gegenwärtigen Betrachtungen aufgestellte Ansicht in directem
Gegensatze; sie dürfte aber Vielen um so zurückstossender erscheinen,
als das Bemühen eben dieser Betrachtungen vorzugsweise dahin
geht, den engen und untrennbaren Zusammenhang zwischen den Sprachen
und dem geistigen Vermögen der Nationen zu beweisen. Dasselbe
zurückweisende Urtheil über die Sprachen scheint daher auch die Völker
zu treffen. Hier bedarf es jedoch einer genaueren Unterscheidung.
Wir haben im Vorigen schon bemerkt, dass die Vorzüge der Sprachen
zwar allgemein von der Energie der geistigen Thätigkeit abhängen, indess
doch noch ganz besonders von der eigenthümlichen Hinneigung
dieser zur Ausbildung des Gedanken durch den Laut. Eine unvollkommnere
Sprache beweist daher zunächst nur den geringeren auf sie
gerichteten Trieb der Nation, ohne darum über andere intellectuelle
Vorzüge derselben zu entscheiden. Ueberall sind wir zuerst rein von
dem Baue der Sprachen ausgegangen und zur Bildung eines Urtheils
über ihn auch nur bei ihm selbst stehen geblieben. Dass nun dieser Bau
dem Grade nach vorzüglicher in der einen, als in der andren sey, im
Sanskrit mehr, als im Chinesischen, im Griechischen mehr, als im Arabischen,
dürfte von unparteiischen Forschern schwerlich geläugnet
werden. Wie man es auch versuchen möchte, Vorzüge gegen Vorzüge
abzuwägen, so würde man doch immer gestehen müssen, dass ein
fruchtbareres Princip der Geistesentwicklung die einen, als die anderen
dieser Sprachen beseelt. Nun aber müsste man alle Beziehungen des
Geistes und der Sprache zu einander verkennen, wenn man nicht die
verschiedenartigen Folgerungen hieraus auf die Rückwirkung dieser
Sprachen und auf die Intellectualität der Völker ausdehnen wollte, welche
sie (so viel dies überhaupt innerhalb des menschlichen Vermögens
liegt) gebildet haben. Von dieser Seite rechtfertigt sich daher die aufgestellte
Ansicht vollkommen. Es lässt sich jedoch hiergegen noch der
Einwand erheben, dass einzelne Vorzüge der Sprache auch einzelne intellectuelle
Seiten vorzugsweise auszubilden im Stande sind und dass
die geistigen Anlagen der Nationen selbst weit mehr nach ihrer Mischung
und Beschaffenheit verschieden sind, als sie nach Graden abgemessen
werden können. Beides ist unläugbar richtig. Allein der wahre
Vorzug der Sprachen muss doch in ihrer allseitig und harmonisch einwirkenden
481Kraft gesucht werden. Sie sind Werkzeuge, deren die geistige
Thätigkeit bedarf, Bahnen, in welchen sie fortrollt. Sie sind daher
nur dann wahrhaft wohlthätig, wenn sie dieselbe nach jeder Richtung
hin erleichternd und begeisternd begleiten, sie in den Mittelpunkt versetzen,
aus welchem sich jede ihrer einzelnen Gattungen harmonisch
entfaltet. Wenn man daher auch gern zugesteht, dass die Form der Chinesischen
Sprache mehr, als vielleicht irgend eine andere die Kraft des
reinen Gedanken herausstellt und die Seele, gerade weil sie alle kleinen,
störenden Verbindungslaute abschneidet, ausschliesslicher und gespannter
auf denselben hinrichtet, wenn die Lesung auch nur weniger
Chinesischer Texte diese Ueberzeugung bis zur Bewunderung steigert,
so dürften doch auch die entschiedensten Vertheidiger dieser Sprache
schwerlich behaupten, dass sie die geistige Thätigkeit zu dem wahren
Mittelpunkt hinlenkt, aus dem Dichtung und Philosophie, wissenschaftliche
Forschung und beredter Vortrag gleich willig emporblühen.
Von welcher Seite der Betrachtung ich daher ausgehen mag, kann ich
immer nicht umhin, den entschiedenen Gegensatz zwischen den Sprachen
rein gesetzmässiger und einer von jener reinen Gesetzmässigkeit
abweichenden Form deutlich und unverholen aufzustellen. Meiner innigsten
Ueberzeugung nach wird dadurch bloss eine unabläugbare Thatsache
ausgedrückt. Die, einzelne Vortheile gewährende Trefflichkeit auch
jener abweichenden Sprachen, die Künstlichkeit ihres technischen Baues
wird nicht verkannt noch geringgeschätzt, man spricht ihnen nur die
Fähigkeit ab, gleich geordnet, gleich allseitig und harmonisch durch sich
selbst auf den Geist einzuwirken. Ein Verdammungsurtheil über irgend
eine Sprache, auch der rohesten Wilden, zu fällen, kann niemand entfernter
seyn, als ich. Ich würde ein solches nicht bloss als die Menschheit
in ihren eigenthümlichsten Anlagen entwürdigend ansehen, sondern
auch als unverträglich mit jeder, durch Nachdenken und Erfahrung von
der Sprache gegebenen richtigen Ansicht. Denn jede Sprache bleibt immer
ein Abbild jener ursprünglichen Anlage zur Sprache überhaupt, und
um zur Erreichung der einfachsten Zwecke, zu welchen jede Sprache
nothwendig gelangen muss, fähig zu seyn, wird immer ein so künstlicher
Bau erfordert, dass sein Studium nothwendig die Forschung an sich
zieht, ohne noch zu gedenken, dass jede Sprache ausser ihrem schon entwickelten
Theil eine unbestimmbare Fähigkeit sowohl der eignen Biegsamkeit,
als der Hineinbildung immer reicherer und höherer Ideen besitzt.
Bei allem hier Gesagten habe ich die Nationen nur auf sich selbst
beschränkt vorausgesetzt. Sie ziehen aber auch fremde Bildung an sich
und ihre geistige Thätigkeit erhält dadurch einen Zuwachs, den sie nicht
ihrer Sprache verdanken, der dagegen dieser zu einer Erweiterung ihres
eigenthümlichen Umfanges dient. Denn jede Sprache besitzt die Geschmeidigkeit,
Alles in sich aufnehmen und Allem wieder Ausdruck aus
482sich verleihen zu können. Sie kann dem Menschen niemals und unter
keiner Bedingung zur absoluten Schranke werden. Der Unterschied ist
nur, ob der Ausgangspunkt der Krafterhöhung und Ideenerweiterung in
ihr selbst liegt oder ihr fremd ist, mit anderen Worten, ob sie dazu begeistert
oder sich nur gleichsam passiv und mitwirkend hingiebt?
Wenn nun ein solcher Unterschied zwischen den Sprachen vorhanden
ist, so fragt es sich, an welchen Zeichen er sich erkennen lässt? und
es kann einseitig und der Fülle des Begriffs unangemessen erscheinen,
dass ich ihn gerade in der grammatischen Methode der Satzbildung aufgesucht
habe. Es ist darum keinesweges meine Absicht gewesen, ihn
darauf zu beschränken, da er gewiss gleich lebendig in jedem Elemente
und in jeder Fügung enthalten ist. Ich bin aber vorsätzlich auf dasjenige
zurückgegangen, was gleichsam die Grundvesten der Sprache ausmacht
und gleich von ganz entschiedener Wirkung auf die Entfaltung
der Begriffe ist. Ihre logische Anordnung, ihr klares Auseinandertreten,
die bestimmte Darlegung ihrer Verhältnisse zu einander macht die unentbehrliche
Grundlage aller, auch der höchsten Aeusserungen der geistigen
Thätigkeit aus, hängt aber, wie jedem einleuchten muss, wesentlich
von jenen verschiedenen Sprachmethoden ab. Mit der richtigen
geht auch das richtige Denken leicht und natürlich von statten, bei den
andren findet es Schwierigkeiten zu überwinden oder erfreut sich wenigstens
nicht einer gleichen Hülfe der Sprache. Dieselbe Geistesstimmung,
aus welcher jene drei verschiedenen Verfahrungsarten entspringen,
erstreckt sich auch von selbst über die Formung aller übrigen
Sprachelemente und wird nur an der Satzbildung vorzugsweise erkannt.
Zugleich endlich eigneten sich gerade diese Eigenthümlichkeiten
besonders, factisch an dem Sprachbau dargelegt zu werden, ein Umstand,
der bei einer Untersuchung vornehmlich wichtig ist, die ganz eigentlich
darauf hinausgeht, an dem Thatsächlichen, historisch Erkennbaren
in den Sprachen die Form aufzufinden, welche sie dem Geiste
ertheilen oder in der sie sich ihm innerlich darstellen.
Beschaffenheit und Ursprung des
weniger vollkommenen Sprachbaues
36. Die von der, durch die rein gesetzmässige Nothwendigkeit vorgezeichneten
Bahn abweichenden Wege können von unendlicher Mannigfaltigkeit
seyn. Die in diesem Gebiete befangenen Sprachen lassen sich
daher nicht aus Principien erschöpfen und classificiren; man kann sie
höchstens nach Aehnlichkeiten in den hauptsächlichsten Theilen ihres
Baues zusammenstellen. Wenn es aber richtig ist, dass der naturgemässe
Bau auf der einen Seite von fester Worteinheit, auf der andren
483von gehöriger Trennung der den Satz bildenden Glieder abhängt, so
müssen alle Sprachen, von denen wir hier reden, entweder die Worteinheit
oder die Freiheit der Gedankenverbindung schmälern oder endlich
diese beiden Nachtheile in sich vereinigen. Hierin wird sich immer bei
der Vergleichung auch der verschiedenartigsten ein allgemeiner Massstab
ihres Verhältnisses zur Geistesentwicklung finden lassen. Mit eigenthümlichen
Schwierigkeiten verbunden ist die Aufsuchung der
Gründe solcher Abweichungen von der naturgemässen Bahn. Dieser
lässt sich auf dem Wege der Begriffe nachgehen, die Abirrung aber beruht
auf Individualitäten, die bei dem Dunkel, in welches sich die frühere
Geschichte jeder Sprache zurückzieht, nur vermuthet und erahndet
werden können. Wo der unvollkommene Organismus bloss darin liegt,
dass der innere Sprachsinn sich nicht überall in dem Laute hat sinnlichen
Ausdruck verschaffen können und daher die Formen bildende
Kraft dieses letzteren vor Erreichung vollendeter Formalität ermattet
ist, tritt allerdings diese Schwierigkeit weniger ein, da der Grund der
Unvollkommenheit alsdann in dieser Schwäche selbst liegt. Allein auch
solche Fälle stellen sich selten so einfach dar und es giebt andere und
gerade die merkwürdigsten, welche sich durchaus nicht bloss auf diese
Weise erklären lassen. Dennoch muss man die Untersuchung unermüdlich
bis zu diesem Punkte verfolgen, wenn man es nicht aufgeben will,
den Sprachbau in seinen ersten Gründen, gleichsam da, wo er in den
Organen und dem Geiste Wurzel schlägt, zu enthüllen. Es würde unmöglich
seyn, in diese Materie hier irgend erschöpfend einzugehen. Ich
begnüge mich daher, nur einige Augenblicke bei zwei Beispielen stehen
zu bleiben, und wähle zu dem ersten derselben die Semitischen Sprachen,
vorzüglich aber wieder unter diesen die Hebräische.
Dieser Sprachstamm gehört zwar offenbar zu den flectirenden, ja es
ist schon oben bemerkt worden, dass die eigentlichste Flexion, im Gegensatz
bedeutsamer Anfügung, gerade in ihm wahrhaft einheimisch
ist. Die Hebräische und Arabische Sprache beurkunden auch die innere
Trefflichkeit ihres Baues, die erstere durch Werke des höchsten dichterischen
Schwunges, die letztere noch durch eine reiche, vielumfassende
wissenschaftliche Literatur neben der poetischen. Auch an sich, bloss
technisch betrachtet, steht der Organismus dieser Sprachen an Strenge
der Consequenz, kunstvoller Einfachheit und sinnreicher Anpassung
des Lautes an den Gedanken nicht nur keinem andren nach, sondern
übertrifft vielleicht hierin alle. Dennoch tragen diese Sprachen zwei Eigenthümlichkeiten
an sich, welche nicht in den natürlichen Forderungen,
ja man kann mit Sicherheit hinzusetzen, kaum den Zulassungen
der Sprache überhaupt liegen. Sie verlangen nemlich, wenigstens in ihrer
jetzigen Gestaltung, durchaus drei Consonanten in jedem Wortstamm
und Consonant und Vocal enthalten nicht zusammen die Bedeutung
484der Wörter, sondern Bedeutung und Beziehung sind ausschliesslich,
jene den Consonanten, diese den Vocalen zugetheilt. Aus der ersteren
dieser Eigenthümlichkeiten entsteht ein Zwang für die Wortform,
welchem man billig die Freiheit andrer Sprachen, namentlich des
Sanskritischen Stammes vorzieht. Auch bei der zweiten jener Eigenthümlichkeiten
finden sich Nachtheile gegen die Flexion durch Anfügung
gehörig untergeordneter Laute. Man muss also doch meiner
Ueberzeugung nach von diesen Seiten aus die Semitischen Sprachen zu
den, von der angemessensten Bahn der Geistesentwicklung abweichenden
rechnen. Wenn man aber nun versucht, den Gründen dieser Erscheinung
und ihrem Zusammenhange mit den nationellen Sprachanlagen
nachzuspüren, so dürfte man schwerlich zu einem vollkommen
befriedigenden Resultate gelangen. Es erscheint gleich zuerst zweifelhaft,
welche von jenen beiden Eigenthümlichkeiten man als den Bestimmungsgrund
der andren ansehen soll? Offenbar stehen beide in
dem innigsten Zusammenhange. Der bei drei Consonanten mögliche
Sylbenumfang lud gleichsam dazu ein, die mannigfaltigen Beziehungen
der Wörter durch Vocalwechsel anzudeuten, und wenn man die Vocale
ausschliesslich hierzu bestimmen wollte, so konnte man den nothwendigen
Reichthum an Bedeutungen nur durch mehrere Consonanten in
demselben Worte erreichen. Die hier geschilderte Wechselwirkung aber
ist mehr geeignet, den inneren Zusammenhang der Sprache in ihrer
heutigen Formung zu erläutern, als zum Entstehungsgrunde eines solchen
Baues zu dienen. Die Andeutung der grammatischen Beziehungen
durch die blossen Vocale lässt sich nicht füglich als erster Bestimmungsgrund
annehmen, da überall in den Sprachen natürlich die Bedeutung
vorausgeht und daher schon die Ausschliessung der Vocale
von derselben erklärt werden müsste. Die Vocale müssen zwar in einer
zwiefachen Beziehung betrachtet werden. Sie dienen zunächst nur als
Laut, ohne welchen der Consonant nicht ausgesprochen werden könnte;
dann aber nach der Verschiedenheit des Lautes, den sie in der Vocalreihe
annehmen. In der ersten Beziehung giebt es nicht Vocale, sondern
nur Einen, als zunächst stehenden, allgemeinen Vocallaut oder, wenn
man will, eigentlich noch gar keinen wahren Vocal, sondern einen unklaren,
noch im Einzelnen unentwickelten Schwa-Laut. Etwas Aehnliches
findet sich bei den Consonanten in ihrer Verbindung mit Vocalen.
Auch der Vocal bedarf, um hörbar zu werden, des consonantischen
Hauches, und insofern dieser nur die zu dieser Bestimmung erforderliche
Beschaffenheit an sich trägt, ist er von den in der Consonantenreihe
sich durch verschiednen Klang gegenüberstehenden Tönen verschieden. 54
Hieraus folgt schon von selbst, dass sich die Vocale in dem
Ausdruck der Begriffe nur den Consonanten beigesellen und, wie schon
von den tiefsten Sprachforschern 55 anerkannt worden ist, hauptsächlich
485zur näheren Bestimmung des durch die Consonanten gestalteten
Wortes dienen. Es liegt auch in der phonetischen Natur der Vocale,
dass sie etwas Feineres, mehr Eindringendes und Innerliches, als die
Consonanten andeuten und gleichsam körperlicher und seelenvoller
sind. Dadurch passen sie mehr zur grammatischen Andeutung, wozu
die Leichtigkeit ihres Schalles und ihre Fähigkeit, sich anzuschliessen,
hinzutritt. Indess ist von diesem allen doch ihr ausschliesslich grammatischer
Gebrauch in den Semitischen Sprachen noch sehr verschieden,
steht, wie ich glaube, als eine einzige Erscheinung in der Sprachgeschichte
da und erfordert daher einen eignen Erklärungsgrund. Will
man, um diesen zu finden, auf der andren Seite von dem zweisylbigen
Wurzelbau ausgehen, so stellt sich diesem Versuche der Umstand entgegen,
dass dieser Wurzelbau, wenn auch für den uns bekannten Zustand
dieser Sprachen der constitutive, dennoch wahrscheinlich nicht
der wirklich ursprüngliche war. Vielmehr lag ihm, wie ich weiter unten
näher ausführen werde, wahrscheinlich in grösserem Umfange, als man
es jetzt anzunehmen pflegt, ein einsylbiger zum Grunde. Vielleicht aber
lässt sich die Eigenthümlichkeit, von der wir hier reden, dennoch gerade
hieraus und aus dem Uebergange zu den zweisylbigen Formen herleiten.
Diese einsylbigen Formen, auf die wir durch die Vergleichung
der zweisylbigen unter einander geführt werden, hatten zwei Consonanten,
welche einen Vocal zwischen sich einschlossen. Vielleicht verlor
der so eingeschlossene und vom Consonantenklange übertönte Vocal
die Fähigkeit gehörig selbstständiger Entwicklung und nahm
deshalb keinen Theil an dem Ausdrucke der Bedeutung. Die sich später
offenbarende Nothwendigkeit grammatischer Bezeichnung rief erst
vielleicht jene Entwicklung hervor und bewirkte dann, um den grammatischen
Flexionen einen grösseren Spielraum zu geben, die Hinzufügung
einer zweiten Sylbe. Immer aber muss doch irgend noch ein anderer
Grund vorhanden gewesen seyn, die Vocale nicht frei auslauten zu
lassen, und dieser ist wohl eher in der Beschaffenheit der Organe und
in der Eigenthümlichkeit der Aussprache, als in der inneren Sprachansicht
zu suchen.
Gewisser, als das bis hierher Besprochene, scheint es mir dagegen
und wichtiger zur Bestimmung des Verhältnisses der Semitischen Sprachen
zur Geistesentwicklung ist es, dass es dem inneren Sprachsinn
dennoch bei diesen Völkern an der nothwendigen Schärfe und Klarheit
der Unterscheidung der materiellen Bedeutung und der Beziehungen
der Wörter theils zu den allgemeinen Formen des Sprechens und Denkens,
theils zur Satzbildung mangelte, so dass dadurch selbst die Reinheit
der Unterscheidung der Consonanten- und Vocalbestimmung zu
leiden Gefahr läuft. Zuerst muss ich hier auf die besondere Natur derjenigen
Laute aufmerksam machen, die man in den Semitischen Sprachen
486Wurzeln nennt, die sich aber wesentlich von den Wurzellauten anderer
Sprachen unterscheiden. Da die Vocale von der materiellen Bedeutsamkeit
ausgeschlossen sind, so müssen die drei Consonanten der Wurzel
streng genommen vocallos, d. h. bloss von dem zu ihrer Herausstossung
erforderlichen Laute begleitet seyn. In diesem Zustande aber fehlt ihnen
die zum Erscheinen in der Rede nothwendige Lautform, da auch die
Semitischen Sprachen nicht mehrere, unmittelbar auf einander folgende,
mit blossem Schwa verbundene Consonanten dulden. Mit hinzugefügten
Vocalen drücken sie diese oder jene bestimmte Beziehung aus
und hören auf, beziehungslose Wurzeln zu seyn. Wo daher die Wurzeln
wirklich in der Sprache erscheinen, sind sie schon wahre Wortformen;
in ihrer eigentlichen Wurzelgestalt mangelt ihnen noch ein wichtiger
Theil zur Vollendung ihrer Lautform in der Rede. Hierdurch erhält
selbst die Flexion in den Semitischen Sprachen einen andren Sinn, als
welchen dieser Begriff in den übrigen Sprachen hat, wo die Wurzel, frei
von aller Beziehung, wirklich dem Ohre vernehmbar, wenigstens als
Theil eines Wortes in der Rede erscheint. Flectirte Wörter enthalten in
den Semitischen Sprachen nicht Umbeugungen ursprünglicher Töne,
sondern Vervollständigungen zur wahren Lautform. Da nun der ursprüngliche
Wurzellaut nicht neben dem flectirten dem Ohre im Zusammenhange
der Rede vernehmbar werden kann, so leidet dadurch die
lebendige Unterscheidung des Bedeutungs- und Beziehungsausdrucks.
Allerdings wird zwar dadurch selbst die Verbindung beider noch inniger
und die Anwendung der Laute nach Ewald's geistvoller und richtiger
Bemerkung passender, als in irgend einer andren Sprache, da den leicht
beweglichen Vocalen das mehr Geistige, den Consonanten das mehr
Materielle zugetheilt ist. Aber das Gefühl der nothwendigen Einheit
des, zugleich Bedeutung und Beziehung in sich fassenden Worts ist
grösser und energischer, wenn die verschmolzenen Elemente in reiner
Selbstständigkeit geschieden werden können, und dies ist dem Zweck
der Sprache, die ewig trennt und verbindet, und der Natur des Denkens
selbst angemessen. Allein auch bei der Untersuchung der einzelnen Arten
des Beziehungs- und Bedeutungsausdrucks findet man die Sprache
nicht von einer gewissen Vermischung beider frei. Durch den Mangel
untrennbarer Praepositionen entgeht ihr eine ganze Classe von Beziehungsbezeichnungen,
die ein systematisches Ganzes bilden und sich in
einem vollständigen Schema darstellen lassen. In den Semitischen Sprachen
wird dieser Mangel zum Theil dadurch ersetzt, dass für diese,
durch Praepositionen modificirten Verbalbegriffe eigne Wörter bestimmt
sind. Dies kann aber keine Vollständigkeit gewähren und noch
weniger vermag dieser scheinbare Reichthum für den Nachtheil zu entschädigen,
dass, da sich nun der Gegensatz weniger fühlbar darstellt,
auch die Totalität nicht übersichtlich ins Auge fällt und die Redenden
487die Möglichkeit einer leichten und sicheren Spracherweiterung durch
einzelne, bis dahin unversucht gebliebene Anwendungen verlieren.
Auch einen mir wichtig scheinenden Unterschied in der Bezeichnung
verschiedener Arten von Beziehungen kann ich hier nicht übergehen.
Die Andeutung der Casus des Nomen, insofern sie einen Ausdruck
zulassen und nicht bloss durch die Stellung unterschieden werden, geschieht
durch Hinzufügung von Praepositionen, die der Personen des
Verbum durch Hinzufügung der Pronomina. Durch diese beiden Beziehungen
wird die Bedeutung der Wörter auf keinerlei Weise afficirt. Es
sind Ausdrücke reiner, allgemein anwendbarer Verhältnisse. Das grammatische
Mittel aber ist Anfügung und zwar solcher Buchstaben oder
Sylben, welche die Sprache als für sich bestehend anerkennt, die sie
auch nur bis auf einen gewissen Grad der Festigkeit mit den Wörtern
verbindet. Insofern auch Vocalwechsel dabei eintritt, ist er eine Folge
jener Zuwächse, deren Anfügung nicht ohne Wirkung auf die Wortform
in einer Sprache bleiben kann, welche so fest bestimmte Regeln für den
Bau der Wörter besitzt. Die übrigen Beziehungsausdrücke, sie mögen
nun in reinem Vocalwechsel oder zugleich in Hinzufügung consonantischer
Laute, wie im Hifil, Nifal u. s. f., oder in Verdoppelung eines der
Consonanten des Wortes selbst, wie bei den mehrsten Steigerungsformen,
bestehen, haben eine nähere Verwandtschaft mit der materiellen
Bedeutung des Worts, afficiren dieselbe mehr oder weniger, ändern sie
wohl auch gewissermassen ganz ab, wie wenn aus dem Stamm gross
gerade durch eine solche Form das Verbum erziehen hervorgebracht
wird. Ursprünglich und hauptsächlich bezeichnen sie zwar wirkliche
grammatische Beziehungen, den Unterschied des Nomen und Verbum,
die transitiven oder intransitiven, reflexiven und causativen Verba
u.s.w. Die Aenderung der ursprünglichen Bedeutung, durch welche aus
den Stämmen abgeleitete Begriffe entstehen, ist eine natürliche Folge
dieser Formen selbst, ohne dass darin eine Vermischung des Beziehungs-
und Bedeutungsausdrucks zu liegen braucht. Dies beweist auch
die gleiche Erscheinung in den Sanskritischen Sprachen. Allein der ganze
Unterschied jener zwei Classen (auf der einen Seite der Casus- und
Pronominalaffixa, auf der andren der inneren Verbalflexionen) und ihre
verschiedne Bezeichnung ist in sich selbst auffallend. Zwar liegt in
demselben eine gewisse Angemessenheit mit der Verschiedenheit der
Fälle. Da, wo der Begriff keine Aenderung erleidet, wird die Beziehung
nur äusserlich, dagegen innerlich, am Stamme selbst, da bezeichnet, wo
die grammatische Form, sich bloss auf das einzelne Wort erstreckend,
die Bedeutung afficirt. Der Vocal erhält an derselben den feinen ausmalenden,
näher modificirenden Antheil, von dem weiter oben die Rede
war. In der That sind alle Fälle der zweiten Classe von dieser Art und
können, wenn wir beim Verbum stehen bleiben, schon auf die blossen
488Participien angewendet werden, ohne die actuale Verbalkraft selbst anzugehen.
In der Barmanischen Sprache geschieht dies in der That und
auch die Verbalvorschläge der Malayischen Sprachen beschreiben ungefähr
denselben Kreis, als die Semitischen in dieser Bezeichnungsart.
Denn wirklich lassen sich alle Fälle derselben auf etwas den Begriff
selbst Abänderndes zurückführen. Dies gilt sogar von der Andeutung
der Tempora, insofern sie durch Beugung und nicht syntaktisch geschieht.
Denn auf jene Weise unterscheidet sie bloss die Wirklichkeit
und die noch nicht mit Sicherheit zu bestimmende Ungewissheit. Dagegen
erscheint es sonderbar, dass gerade diejenigen Beziehungen, die am
meisten den unveränderten Begriff nur in eine andere Beziehung stellen,
wie die Casus, und diejenigen, die am wesentlichsten die Verbalnatur
bilden, wie die Personen, weniger formal bezeichnet werden, ja sich
fast gegen den Begriff der Flexion zur Agglutination hinneigen und dagegen
die den Begriff selbst modificirenden den am meisten formalen
Ausdruck annehmen. Der Gang des Sprachsinns der Nation scheint
hier nicht sowohl der gewesen zu seyn, Beziehung und Bedeutung
scharf von einander zu trennen, als vielmehr der, die aus der ursprünglichen
Bedeutung fliessenden Begriffe nach systematischer Abtheilung
grammatischer Form in den verschiedenen Nuancen derselben, regelmässig
geordnet, abzuleiten. Man würde sonst nicht die gemeinsame
Natur aller grammatischen Beziehungen durch Behandlung in zwiefachem
Ausdruck gewissermassen verwischt haben. Wenn dies Raisonnement
richtig und mit den Thatsachen übereinstimmend erscheint, so
beweist dieser Fall, wie ein Volk seine Sprache mit bewundrungswürdigem
Scharfsinn und gleich seltnem Gefühl der gegenseitigen Forderungen
des Begriffs und des Lautes behandeln und doch die Bahn verfehlen
kann, die in der Sprache überhaupt die naturgemässeste ist. Die Abneigung
der Semitischen Sprachen gegen Zusammensetzung ist aus ihrer
ganzen, hier nach ihren Hauptzügen geschilderten Form leicht erklärlich.
Wenn auch die Schwierigkeit, vielsylbigen Wörtern die einmal fest
in die Sprache eingewachsene Wortform zu geben, wie es die zusammengesetzten
Eigennamen beweisen, überwunden werden konnte, so
mussten sie doch bei der Gewöhnung des Volks an eine kürzere, einen
streng gegliederten und leicht übersehbaren inneren Bau erlaubende
Wortform lieber vermieden werden. Es boten sich aber auch weniger
Veranlassungen zu ihrer Bildung dar, da der Reichthum an Stämmen sie
entbehrlicher machte.
In der Delaware-Sprache in Nord-Amerika herrscht mehr, als vielleicht
in irgend einer andren die Gewohnheit, neue Wörter durch Zusammensetzung
zu bilden. Die Elemente dieser Composita enthalten
aber selten das ganze ursprüngliche Wort, sondern es gehen von diesem
nur Theile, ja selbst nur einzelne Laute in die Zusammensetzung über.
489Aus einem von Du Ponceau 56 gegebenen Beispiel muss man sogar
schliessen, dass es von dem Redenden abhängt, solche Wörter oder
vielmehr ganze zu Wörtern gestempelte Phrasen gleichsam aus Bruchstücken
einfacher Wörter zusammenzufügen. Aus ki, du, wulit, gut,
schön, niedlich, wichgat, Pfote, und schis, einem als Endung im Sinne
der Kleinheit gebrauchten Worte, wird, als Anrede an eine kleine Katze,
k-uli-gat-schis, deine niedliche kleine Pfote, gebildet. Auf gleiche Weise
gehen Redensarten in Verba über und werden alsdann vollständig conjugirt.
Nad-hol-ineen, von naten, holen, amochol, Boot, und dem
schliessenden regierten Pronomen der ersten Person des Plurals, heisst:
hole uns mit dem Boote! nemlich: über den Fluss. Man sieht schon aus
diesen Beispielen, dass die Veränderungen der diese Composita bildenden
Wörter sehr bedeutend sind. So wird aus wulit in dem obigen Beispiel
uli, in anderen Fällen, wo im Compositum kein Consonant vorausgeht,
wul, allein auch mit vorausgehendem Consonanten ola. 57 Auch
die Abkürzungen sind bisweilen sehr gewaltsam. Von awesis, Thier,
wird, um das Wort Pferd zu bilden, bloss die Sylbe es in die Zusammensetzung
aufgenommen. Zugleich gehen, da die Bruchstücke der Wörter
nun in Verbindung mit anderen Lauten treten, Wohllautsveränderungen
vor, welche dieselben noch weniger kenntlich machen. Dem eben
erwähnten Worte für Pferd, nanayung-es, liegt ausser der Endung es
nur nayundam, eine Last auf dem Rücken tragen, zum Grunde. Das g
scheint eingeschoben und die Verstärkung durch die Verdopplung der
ersten Sylbe nur auf das Compositum angewandt. Ein blosses Anfangs-m
von machit, schlecht, oder von medhick, übel, giebt dem Worte
einen bösen und verächtlichen Sinn. 58 Man hat daher diese Wortverstümmlungen
verschiedentlich, als barbarische Rohheit sehr hart getadelt.
Man müsste aber eine tiefere Kenntniss der DelawareSprache und
der Verwandtschaft ihrer Wörter besitzen, um zu entscheiden, ob wirklich
in den abgekürzten Wörtern die Stammsylben vernichtet oder nicht
vielmehr gerade erhalten werden. Dass dies letztere in einigen Fällen
sich wirklich so verhält, sieht man an einem merkwürdigen Beispiel.
Lenape bedeutet Mensch; lenni, welches mit dem vorigen Worte zusammen
(Lenni Lenape) den Namen des Hauptstammes der Delawaren
ausmacht, hat die Bedeutung von etwas Ursprünglichem, Unvermischtem,
dem Lande von jeher Angehörigem und bedeutet daher auch gemein,
gewöhnlich. In diesem letzteren Sinne dient der Ausdruck zur Bezeichnung
alles Einheimischen, von dem grossen und guten Geiste dem
Lande Gegebenen, im Gegensatz mit dem aus der Fremde erst durch
die weissen Menschen Gekommenen. Ape heisst aufrecht gehen. 59 In
lenape sind also ganz richtig die charakteristischen Kennzeichen des
aufrecht wandelnden Eingebornen enthalten. Dass hernach das Wort
allgemein für Mensch gilt und, um zum Eigennamen zu werden, noch
490einmal den Begriff des Ursprünglichen mit sich verbindet, sind leicht
erklärliche Erscheinungen. In pilape, Jüngling, ist das Wort pilsit,
keusch, unschuldig, mit demjenigen Theil von lenape zusammengesetzt,
welcher die den Menschen charakterisirende Eigenschaft bezeichnet.
Da die in der Zusammensetzung verbundenen Wörter grossentheils
mehrsylbig und schon selbst wieder zusammengesetzt sind, so
kommt alles darauf an, welcher ihrer Theile zum Element des neuen
Compositum gebraucht wird, worüber nur die aus einem vollständigen
Wörterbuche zu schöpfende genauere Kenntniss der Sprache Aufklärung
geben könnte. Auch versteht es sich wohl von selbst, dass der
Sprachgebrauch diese Abkürzungen in bestimmte Regeln.eingeschlossen
haben wird. Dies sieht man schon daraus, dass das modificirte Wort
in den gegebenen Beispielen immer im Compositum, als das letzte Element,
den modificirenden nachsteht. Das Verfahren dieser scheinbaren
Verstümmlung der Wörter dürfte daher wohl ein milderes Urtheil verdienen
und nicht so zerstörend für die Etymologie seyn, als es der oberflächliche
Anblick befürchten lässt. Es hängt genau mit der, oben schon
als die Amerikanischen Sprachen auszeichnend angeführten Tendenz,
das Pronomen in abgekürzter oder noch mehr abweichender Gestalt
mit dem Verbum und dem Nomen zu verbinden, zusammen. Das eben
von der Delawarischen Gesagte beweist ein noch allgemeineres Streben
nach Verbindung mehrerer Begriffe in demselben Worte. Wenn man
mehrere der Sprachen mit einander vergleicht, welche die grammatischen
Beziehungen ohne Flexion durch Partikeln andeuten, so halten
einige derselben, wie die Barmanische, die meisten der Südsee-Inseln
und selbst die Mandschuische und die Mongolische, die Partikeln und
die durch sie bestimmten Wörter eher aus einander, da hingegen die
Amerikanischen eine Neigung, sie zu verknüpfen, verrathen. Die letztere
fliesst natürlich schon aus dem oben (§.29.a) geschilderten einverleibenden
Verfahren. Dieses habe ich im Vorigen als eine Beschränktheit
der Satzbildung dargestellt und durch die Aengstlichkeit des Sprachsinns
erklärt, die den Satz ausmachenden Theile für das Verständniss
recht enge zusammenzufassen.
Dem hier betrachteten Verfahren der Delawarischen Wortbildung
lässt sich aber zugleich noch eine andere Seite abgewinnen. Es liegt in
demselben sichtbar die Neigung, der Seele die im Gedanken verbundenen
Begriffe, statt ihr dieselben einzeln zuzuzählen, auf einmal und
auch durch den Laut verbunden vorzulegen. Es ist eine malerische Behandlung
der Sprache, genau zusammenhängend mit der übrigen, aus
allen ihren Bezeichnungen hervorblickenden bildlichen Behandlung der
Begriffe. Die Eichel heisst wunach-quim, die Nuss der Blatt-Hand (von
wumpach, Blatt, nach, Hand, und quim, die Nuss), weil die lebendige
Einbildungskraft des Volkes die eingeschnittenen Blätter der Eiche mit
491einer Hand vergleicht. Auch hier bemerke man die doppelte Befolgung
des oben erwähnten Gesetzes in der Stellung der Elemente, erst in dem
letzten, dann in den beiden ersten, wo wieder die Hand, gleichsam aus
einem Blatte gebildet, diesem letzteren Worte, nicht umgekehrt nachsteht.
Es ist offenbar von grosser Wichtigkeit, wie viel eine Sprache in
Ein Wort einschliesst, statt sich der Umschreibung durch mehrere zu
bedienen. Auch der gute Schriftsteller übt hierin sorgfältige Unterscheidung,
wo ihm die Sprache die Wahl frei lässt. Das richtige Gleichgewicht,
welches die Griechische Sprache hierin beobachtet, gehört gewiss
zu ihren grössten Schönheiten. Das in Einem Worte Verbundene
stellt sich auch der Seele mehr als Eins dar, da die Wörter in der Sprache
das sind, was die Individuen in der Wirklichkeit. Es erregt lebendiger
die Einbildungskraft, als was dieser einzeln zugezählt wird. Daher
ist das Einschliessen in Ein Wort mehr Sache der Einbildungskraft, die
Trennung mehr die des Verstandes. Beide können sich sogar hierin entgegenstehen
und verfahren wenigstens dabei nach ihren eignen Gesetzen,
deren Verschiedenheit sich hier in einem deutlichen Beispiel in der
Sprache verräth. Der Verstand fordert vom Worte, dass es den Begriff
vollständig und rein bestimmt hervorrufe, aber auch zugleich in ihm die
logische Beziehung anzeige, in welcher es in der Sprache und in der
Rede erscheint. Diesen Verstandesforderungen genügt die Delaware-Sprache
nur auf ihre, den höheren Sprachsinn nicht befriedigende Weise.
Dagegen wird sie zum lebendigen Symbol der, Bilder an einander
reihenden Einbildungskraft und bewahrt hierin eine sehr eigenthümliche
Schönheit. Auch im Sanskrit tragen die sogenannten undeclinirbaren
Participien, die so oft zum Ausdruck von Zwischensätzen dienen,
zur lebendigen Darstellung des Gedanken, dessen Theile sie mehr
gleichzeitig vor die Seele bringen, wesentlich bei. In ihnen vereinigt sich
aber, da sie grammatische Bezeichnung haben, die Strenge der Verstandesforderung
mit dem freien Erguss der Einbildungskraft. Dies ist ihre
beifallswürdige Seite. Denn allerdings haben sie auch eine entgegengesetzte,
wenn sie durch Schwerfälligkeit der Freiheit der Satzbildung
Fesseln anlegen und ihre einverleibende Methode an mangelnde Mannigfaltigkeit
von Mitteln erinnert, dem Satze gehörige Erweiterung zu
geben.
Es scheint mir nicht unmerkwürdig, dass diese kühn bildliche Zusammenfügung
der Wörter gerade einer Nord-Amerikanischen Sprache
angehört, ohne dass ich jedoch hieraus mit Sicherheit Folgerungen auf
den Charakter dieser Völker im Gegensatz mit den südlichen ziehen
möchte, da man hierzu mehr Data über beide und ihre frühere Geschichte
besitzen müsste. Gewiss aber ist es, dass wir in den Reden und
Verhandlungen dieser Nord-Amerikanischen Stämme eine grössere Erhebung
des Gemüths und einen kühneren Flug der Einbildungskraft erkennen,
492als von dem wir im südlichen Amerika Kunde haben. Natur,
Klima und das, den Völkern dieses Theils von Amerika mehr eigenthümliche
Jägerleben, das weite Streifzüge durch die einsamsten Wälder
mit sich bringt, mögen zugleich dazu beitragen. Wenn aber die
Thatsache in sich richtig ist, so übten unstreitig die grossen despotischen
Regierungen, besonders die zugleich priesterlich die freie Entwicklung
der Individualität niederdrückende Peruanische einen sehr
verderblichen Einfluss aus, da jene Jägerstämme, wenigstens soviel wir
wissen, immer nur in freien Verbindungen lebten. Auch seit der Eroberung
durch die Europäer erfuhren beide Theile ein verschiedenes,
gerade in der Hinsicht, von welcher wir hier reden, sehr wesentlich entscheidendes
Schicksal. Die fremden Anwohner in dem Nord-Amerikanischen
Küstenstrich drängten die Eingebornen zurück und beraubten
sie wohl auch ungerechter Weise ihres Eigenthums, unterwarfen sie
aber nicht, indem auch ihre Missionare, von dem freieren und milderen
Geiste des Protestantismus beseelt, einem drückenden mönchischen
Regimente, wie es die Spanier und Portugiesen systematisch einführten,
[fremd waren].
Ob übrigens in der reichen Einbildungskraft, von welcher Sprachen,
wie die Delawarische, das sichtbare Gepräge tragen, auch ein Zeichen
liegt, dass wir in ihnen eine jugendlichere Gestalt der Sprache aufbewahrt
finden? ist eine schwer zu beantwortende Frage, da man zu wenig
abzusondern vermag, was hierin der Zeit und was der Geistesrichtung
der Nation angehört. Ich bemerke in dieser Rücksicht hier nur,
dass die Zusammensetzung von Wörtern, von welchen in unsren heutigen
oft auch nur einzelne Buchstaben übrig geblieben seyn mögen, sich
leicht auch in den schönsten und gebildetsten Sprachen finden mag, da
es in der Natur der Dinge liegt, vom Einfachen an aufzusteigen, und im
Verlaufe so vieler Jahrtausende, in welchen sich die Sprache im Munde
der Völker fortgepflanzt hat, die Bedeutungen der Urlaute natürlich
verloren gegangen sind.
37. In dem entschiedensten Gegensatze befinden sich unter allen
bekannten Sprachen die Chinesische und das Sanskrit, da die erstere
alle grammatische Form der Sprache in die Arbeit des Geistes zurückweist,
das letztere sie bis in die feinsten Schattirungen dem Laute einzuverleiben
strebt. Denn offenbar liegt in der mangelnden und sichtbarlich
vorleuchtenden Bezeichnung der Unterschied beider Sprachen.
Den Gebrauch einiger Partikeln ausgenommen, deren sie, wie wir weiter
unten sehen werden, auch wieder bis auf einen hohen Grad zu entbehren
versteht, deutet die Chinesische alle Form der Grammatik im
weitesten Sinne durch Stellung, den einmal nur in einer gewissen Form
festgestellten Gebrauch der Wörter und den Zusammenhang des Sinnes
an, also bloss durch Mittel, deren Anwendung innere Anstrengung
493erheischt. Das Sanskrit dagegen legt in die Laute selbst nicht bloss den
Sinn der grammatischen Form, sondern auch ihre geistigere Gestalt, ihr
Verhältniss zur materiellen Bedeutung.
Hiernach sollte man auf den ersten Anblick die Chinesische Sprache
für die von der naturgemässen Forderung der Sprache am meisten abweichende,
für die unvollkommenste unter allen halten. Diese Ansicht
verschwindet aber vor der genaueren Betrachtung. Sie besitzt im Gegentheil
einen hohen Grad der Trefflichkeit und übt eine, wenn gleich
einseitige, doch mächtige Einwirkung auf das geistige Vermögen aus.
Man könnte zwar den Grund hiervon in ihrer frühen wissenschaftlichen
Bearbeitung und reichen Literatur suchen. Offenbar hat aber vielmehr
die Sprache selbst, als Aufforderung und Hülfsmittel, zu diesen Fortschritten
der Bildung wesentlich mitgewirkt. Zuerst kann ihr die grosse
Consequenz ihres Baues nicht bestritten werden. Alle andren flexionslosen
Sprachen, wenn sie auch noch so grosses Streben nach Flexion
verrathen, bleiben, ohne ihr Ziel zu erreichen, auf dem Wege dahin stehen.
Die Chinesische führt, indem sie gänzlich diesen Weg verlässt, ihren
Grundsatz bis zum Ende durch. Dann trieb gerade die Natur der in
ihr zum Verständniss alles Formalen angewandten Mittel ohne Unterstützung
bedeutsamer Laute darauf hin, die verschiedenen formalen
Verhältnisse strenger zu beachten und systematisch zu ordnen. Endlich
wird der Unterschied zwischen materieller Bedeutung und formeller
Beziehung dem Geiste dadurch von selbst um so mehr klar, als die Sprache,
wie sie das Ohr vernimmt, bloss die materiell bedeutsamen Laute
enthält, der Ausdruck der formellen Beziehungen aber an den Lauten
nur wieder als Verhältniss in Stellung und Unterordnung hängt. Durch
diese fast durchgängige lautlose Bezeichnung der formellen Beziehungen
unterscheidet sich die Chinesische Sprache, soweit die allgemeine
Uebereinkunft aller Sprachen in Einer inneren Form Verschiedenheit
zulässt, von allen andren bekannten. Man erkennt dies am deutlichsten,
wenn man irgend einen ihrer Theile in die Form der letzteren zu zwängen
versucht, wie einer ihrer grössten Kenner, Abel-Rémusat, eine vollständige
Chinesische Declination aufgestellt hat. 60 Sehr begreiflicher
Weise muss es in jeder Sprache Unterscheidungsmittel der verschiedenen
Beziehungen des Nomen geben. Diese aber kann man bei weitem
nicht immer darum als Casus im wahren Sinne dieses Wortes betrachten.
Die Chinesische Sprache gewinnt durchaus nicht bei einer solchen
Ansicht. Ihr charakteristischer Vorzug liegt im Gegentheil, wie auch
Rémusat an derselben Stelle sehr treffend bemerkt, in ihrem, von den
andren Sprachen abweichenden Systeme, wenn sie gleich eben durch
dasselbe auch mannigfaltiger Vorzüge entbehrt und allerdings, als Sprache
und Werkzeug des Geistes, den Sanskritischen und Semitischen
Sprachen nachsteht. Der Mangel einer Lautbezeichnung der formalen
494Beziehungen darf aber nicht in ihr allein genommen werden. Man muss
zugleich und sogar hauptsächlich die Rückwirkung ins Auge fassen,
welche dieser Mangel nothwendig auf den Geist ausübt, indem er ihn
zwingt, diese Beziehungen auf feinere Weise mit den Worten zu verbinden
und doch nicht eigentlich in sie zu legen, sondern wahrhaft in ihnen
zu entdecken. Wie paradox es daher klingt, so halte ich es dennoch für
ausgemacht, dass im Chinesischen gerade die scheinbare Abwesenheit
aller Grammatik die Schärfe des Sinnes, den formalen Zusammenhang
der Rede zu erkennen, im Geiste der Nation erhöht, da im Gegentheil
die Sprachen mit versuchter, aber nicht gelingender Bezeichnung der
grammatischen Verhältnisse den Geist vielmehr einschläfern und den
grammatischen Sinn durch Vermischung des materiell und formal Bedeutsamen
eher verdunkeln.
Dieser eigenthümliche Chinesische Bau rührt wohl unstreitig von
der Lauteigenthümlichkeit des Volkes in den frühesten Zeiten her, von
der Sitte, die Sylben stark in der Aussprache aus einander zu halten,
und von einem Mangel an der Beweglichkeit, mit welcher ein Ton auf
den andren umändernd einwirkt. Denn diese sinnliche Eigenthümlichkeit
muss, wenn die geistige der inneren Sprachforrn erklärt werden
soll, zum Grunde gelegt werden, da jede Sprache nur von der ungebildeten
Volkssprache ausgehen kann. Entstand nun durch den grübelnden
und erfindsamen Sinn der Nation, durch ihren scharfen und regen
und vor der Phantasie vorwaltenden Verstand eine philosophische und
wissenschaftliche Bearbeitung der Sprache, so konnte sie nur den sich
wirklich in dem älteren Style verrathenden Weg nehmen, die Absonderung
der Töne, wie sie im Munde des Volkes bestand, beibehalten, aber
alles das feststellen und genau unterscheiden, was im höheren Gebrauch
der Sprache, entblösst von der, dem Verständniss zu Hülfe kommenden
Betonung und Geberde, zur lichtvollen Darstellung des Gedanken
erfordert wurde. Dass aber eine solche Bearbeitung schon sehr früh
eintrat, ist geschichtlich erwiesen und zeigt sich auch in den unverkennbaren,
aber geringen Spuren bildlicher Darstellung in der Chinesischen
Schrift.
Es lässt sich wohl allgemein behaupten, dass, wenn der Geist anfängt,
sich zu wissenschaftlichem Denken zu erheben, und eine solche
Richtung in die Bearbeitung der Sprache kommt, überhaupt Bilderschrift
sich nicht lange erhalten kann. Bei den Chinesen muss dies doppelt
der Fall gewesen seyn. Auf eine alphabetische Schrift würden sie,
wie alle andre Völker, durch die Unterscheidung der Articulation des
Lautes geführt worden seyn. Es ist aber erklärlich, dass die Schrifterfindung
bei ihnen diesen Weg nicht verfolgte. Da die geredete Sprache die
Töne nie in einander verschlang, so war ihre einzelne Bezeichnung minder
erfordert. Wie das Ohr Monogramme des Lautes vernahm, so wurden
495diesen Monogramme der Schrift nachgebildet. Von der Bilderschrift
abgehend, ohne sich der alphabetischen zu nähern, bildete man
ein kunstvolles, willkührlich erzeugtes System von Zeichen, nicht ohne
Zusammenhang der einzelnen unter einander, aber immer nur in einem
idealen, niemals in einem phonetischen. Denn da die Verstandesrichtung
vor dem Gefallen an Lautwechsel in der Nation und der Sprache
vorherrschte, so wurden diese Zeichen mehr Andeutungen von Begriffen,
als von Lauten, nur dass jedem derselben doch immer ein bestimmtes
Wort entspricht, da der Begriff erst im Worte seine Vollendung erhält.
Auf diese Weise bilden die Chinesische und die Sanskrit-Sprache in
dem ganzen uns bekannten Sprachgebiete zwei feste Endpunkte, einander
nicht an Angemessenheit zur Geistesentwicklung, allein allerdings
an innerer Consequenz und vollendeter Durchführung ihres Systems
gleich. Die Semitischen Sprachen lassen sich nicht als zwischen ihnen
liegend ansehen. Sie gehören ihrer entschiedenen Richtung zur Flexion
nach in Eine Classe mit den Sanskritischen. Dagegen kann man alle
übrigen Sprachen als in der Mitte jener beiden Endpunkte befindlich
betrachten, da alle sich entweder der Chinesischen Entblössung der
Wörter von ihren grammatischen Beziehungen oder der festen Anschliessung
der dieselben bezeichnenden Laute nähern müssen. Selbst
einverleibende Sprachen, wie die Mexicanische, sind in diesem Falle, da
die Einverleibung nicht alle Verhältnisse andeuten kann und sie, wo diese
nicht ausreicht, Partikeln gebrauchen müssen, die angefügt werden
oder getrennt bleiben können. Weiter aber, als diese negativen Eigenschaften,
nicht aller grammatischen Bezeichnung zu entbehren und keine
Flexion zu besitzen, haben diese mannigfaltig unter sich verschiedenen
Sprachen nichts mit einander gemein und können daher nur auf
ganz unbestimmte Weise in Eine Classe geworfen werden.
Hiernach fragt es sich, ob es nicht in der Sprachbildung (nicht in
demselben Sprachstamm, aber überhaupt) stufenartige Erhebungen zu
immer vollkommnerer geben sollte? Man kann diese Frage von der
wirklichen Sprachentstehung thatsächlich so nehmen, als habe es in
verschiedenen Epochen des Menschengeschlechts nur successive
Sprachbildungen verschiedener, einander in ihrer Entstehung voraussetzender
und bedingender Grade gegeben. Alsdann wäre das Chinesische
die älteste, das Sanskrit die jüngste Sprache. Denn die Zeit könnte
uns Formen aus verschiedenen Epochen aufbewahrt haben. Ich habe
schon weiter oben genügend ausgeführt und es macht dies einen Hauptpunkt
meiner Sprachansichten aus, dass die vollkommnere, die Frage
bloss aus Begriffen betrachtet, nicht auch die spätere zu seyn braucht.
Historisch lässt sich nichts darüber entscheiden; doch werde ich in einem
der folgenden Abschnitte dieser Betrachtungen bei Gelegenheit
496der factischen Entstehung und Vermischung der Sprachen diesen Punkt
noch genauer zu bestimmen suchen. Man kann aber auch ohne Rücksicht
auf dasjenige, was wirklich bestanden hat, fragen, ob sich die in
jener Mitte liegenden Sprachen bloss ihrem Baue nach zu einander wie
solche stufenartige Erhebungen verhalten oder ob ihre Verschiedenheit
nicht erlaubt, einen so einfachen Massstab an sie zu legen? Auf der einen
Seite scheint nun wirklich das Erstere der Fall. Wenn z.B. die
Barmanische Sprache für die meisten grammatischen Beziehungen
wirkliche Lautbezeichnungen in Partikeln besitzt, aber diese weder unter
einander noch mit den Hauptwörtern durch Lautveränderungen
verschlingt, dagegen, wie ich gezeigt habe, Amerikanische Sprachen abgekürzte
Elemente verbinden und dem daraus entstehenden Worte eine
gewisse phonetische Einheit geben, so scheint das letztere Verfahren
der wirklichen Flexion näher zu stehen. Sicht man aber wieder bei der
Vergleichung des Barmanischen mit dem eigentlich Malayischen, dass
jenes zwar viel mehr Beziehungen bezeichnet, da wo dieses die Chinesische
Bezeichnungslosigkeit beibehält, dagegen das Malayische die vorhandenen
Anfügungssylben in sorgfältiger Beachtung sowohl ihrer eignen,
als der Laute des Hauptworts behandelt, so wird man verlegen,
welcher beider Sprachen man den Vorzug ertheilen soll, obgleich bei
Beurtheilung auf andrem Wege derselbe unzweifelhaft der Malayischen
Sprache gebührt.
Man sieht also, dass es einseitig seyn würde, auf diese Weise und
nach solchen Kriterien Stufen der Sprachen zu bestimmen. Es ist dies
auch vollkommen begreiflich. Wenn die bisherigen Betrachtungen mit
Recht Eine Sprachform als die einzig gesetzmässige anerkannt haben,
so beruht dieser Vorzug nur darauf, dass durch ein glückliches Zusammentreffen
eines reichen und feinen Organes mit lebendiger Stärke des
Sprachsinnes die ganze Anlage, welche der Mensch physisch und geistig
zur Sprache in sich trägt, sich vollständig und unverfälscht im Laute
entwickelt. Ein unter so begünstigenden Umständen sich bildender
Sprachbau erscheint dann als aus einer richtigen und energischen Intuition
des Verhältnisses des Sprechens zum Denken und aller Theile der
Sprache zu einander hervorgesprungen. In der That ist der wahrhaft gesetzmässige
Sprachbau nur da möglich, wo eine solche, gleich einer
belebenden Flamme, die Bildung leuchtend durchdringt. Ohne ein von
innen heraus arbeitendes Princip, auf mechanisch allmählich einwirkenden
Wegen bleibt er unerreichbar. Treffen aber auch nicht überall so
befördernde Umstände zusammen, so haben doch alle Völker bei ihrer
Sprachbildung nur immer eine und dieselbe Tendenz. Alle wollen das
Richtige, Naturgemässe und daher Höchste. Dies bewirkt die sich an
und in ihnen entfaltende Sprache von selbst und ohne ihr Zuthun und
es ist nicht denkbar, dass eine Nation gleichsam absichtlich z. B. nur die
497materielle Bedeutung bezeichnete, die grammatischen Beziehungen
aber der Lautbezeichnung entzöge. Da indess die Sprache, die, um hier
einen schon im Vorigen gebrauchten Ausdruck zu wiederholen, der
Mensch nicht sowohl bildet, als vielmehr in ihren, wie von selbst hervorgehenden
Entwicklungen mit einer Art freudigen Erstaunens an sich
entdeckt, durch die Umstände, in welchen sie in die Erscheinung tritt,
in ihrem Schaffen bedingt wird, so erreicht sie nicht überall das gleiche
Ziel, sondern fühlt sich, nicht ausreichend, an einer, nicht in ihr selbst
liegenden Schranke. Die Nothwendigkeit aber, demungeachtet immer
ihrem allgemeinen Zwecke zu genügen, treibt sie, wie es auch seyn
möge, von jener Schranke aus nach einer hierzu tauglichen Gestaltung.
So entsteht die concrete Form der verschiedenen menschlichen Sprachen
und enthält, insofern sie vom gesetzmässigen Baue abweicht, daher
immer zugleich einen negativen, die Schranke des Schaffens bezeichnenden
und einen positiven, das unvollständig Erreichte dem
allgemeinen Zweck zuführenden Theil. In dem negativen liesse sich
nun wohl eine stufenartige Erhebung nach dem Grade, in welchem die
schöpferische Kraft der Sprache ausgereicht hätte, denken. Der positive
aber, in welchem der oft sehr kunstvolle individuelle Bau auch der unvollkommneren
Sprachen liegt, erlaubt bei weitem nicht immer so einfache
Bestimmungen. Indem hier mehr oder weniger Uebereinstimmung
und Entfernung vom gesetzmässigen Baue zugleich vorhanden
ist, muss man sich oft nur bei einem Abwägen der Vorzüge und Mängel
begnügen. Bei dieser, wenn der Ausdruck erlaubt ist, anomalen Art der
Spracherzeugung wird oft ein einzelner Sprachtheil mit einer gewissen
Vorliebe vor andren ausgebildet und es liegt hierin häufig gerade der
charakteristische Zug einzelner Sprachen. Natürlich aber kann sich alsdann
die wahre Reinheit des richtigen Princips in keinem Theile aussprechen.
Denn dieses fordert gleichmässige Behandlung aller und würde,
könnte es einen Theil wahrhaft durchdringen, sich von selbst auch
über die anderen ergiessen. Mangel an wahrer innerer Consequenz ist
daher ein gemeinsamer Charakter aller dieser Sprachen. Selbst die Chinesische
kann eine solche doch nicht vollkommen erreichen, da doch
auch sie in einigen, allerdings nicht zahlreichen Fällen dem Principe der
Wortfolge mit Partikeln zu Hülfe kommen muss.
Wenn den unvollkommneren Sprachen die wahre Einheit eines, sie
von innen aus gleichmässig durchstrahlenden Principes mangelt, so
liegt es doch in dem hier geschilderten Verfahren, dass jede demungeachtet
einen festen Zusammenhang und eine; nicht zwar immer aus der
Natur der Sprache überhaupt, aber doch aus ihrer besonderen Individualität
hervorgehende Einheit besitzt. Ohne Einheit der Form wäre
überhaupt keine Sprache denkbar, und so wie die Menschen sprechen,
fassen sie nothwendig ihr Sprechen in eine solche Einheit zusammen.
498Dies geschieht bei jedem inneren und äusseren Zuwachs, welchen die
Sprache erhält. Denn ihrer innersten Natur nach macht sie ein zusammenhängendes
Gewebe von Analogieen aus, in dem sie das fremde Element
nur durch eigene Anknüpfung festhalten kann.
Die hier gemachten Betrachtungen zeigen zugleich, welche Mannigfaltigkeit
verschiedenen Baues die menschliche Spracherzeugung in
sich zu fassen vermag, und lassen zugleich an der Möglichkeit einer erschöpfenden
Classification derselben verzweifeln. Eine solche ist wohl
zu bestimmten Zwecken und, wenn man einzelne Erscheinungen an ihnen
zum Eintheilungsgrunde annimmt, ausführbar, verwickelt dagegen
in unauflösliche Schwierigkeiten, wenn bei tiefer eindringendem Forschen
die Eintheilung auch in ihre wesentliche Beschaffenheit und ihren
inneren Zusammenhang mit der geistigen Individualität der Nationen
eingehen soll. Die Aufstellung eines nur irgend vollständigen
Systems ihres Zusammenhanges und ihrer Verschiedenheiten wäre,
ständen derselben auch nicht die so eben angegebenen allgemeinen
Schwierigkeiten im Wege, doch bei dem jetzigen Zustande der Sprachkunde
unmöglich. Eine nicht unbedeutende Anzahl noch gar nicht unternommener
Forschungen müsste einer solchen Arbeit nothwendig
vorausgehen. Denn die richtige Einsicht in die Natur einer Sprache erfordert
viel anhaltendere und tiefere Untersuchungen, als bisher noch
den meisten Sprachen gewidmet worden sind.
Dennoch finden sich auch zwischen nicht stammverwandten Sprachen
und in Punkten, die am entschiedensten mit der Geistesrichtung
zusammenhängen, Unterschiede, durch welche mehrere wirklich verschiedene
Classen zu bilden scheinen. Ich habe weiter oben (§. 34.) von
der Wichtigkeit gesprochen, dem Verbum eine, seine wahre Function
formal charakterisirende Bezeichnung zu geben. In dieser Eigenthümlichkeit
nun unterscheiden sich Sprachen, welche sonst dem Ganzen ihrer
Bildung nach auf gleicher Stufe zu stehen scheinen. Es ist natürlich,
dass die Partikel-Sprachen, wie man diejenigen nennen könnte, welche
die grammatischen Beziehungen zwar durch Sylben oder Wörter bezeichnen,
allein diese gar nicht oder nur locker und verschiebbar anfügen,
keinen ursprünglichen Unterschied zwischen Nomen und Verbum
feststellen. Bezeichnen sie auch einige einzelne Gattungen des ersteren,
so geschieht dies nur in Beziehung auf bestimmte Begriffe und in bestimmten
Fällen, nicht im Sinne grammatischer Absonderung durchgängig.
Es ist daher in ihnen nicht selten, dass jedes Wort ohne Unterschied
zum Verbum gestempelt werden, dagegen auch wohl jede
Verbalflexion zugleich als Participium gelten kann. Sprachen nun, die
hierin einander gleich sind, unterscheiden sich dennoch wieder dadurch,
dass die einen das Verbum mit gar keinem, seine eigenthümliche
Function der Satzverknüpfung charakterisirenden Ausdruck ausstatten,
499die andren dies wenigstens durch die ihm in Abkürzungen oder Umänderungen
angefügten Pronomina thun, den schon im Obigen öfters berührten
Unterschied zwischen Pronomen und Verbalperson festhaltend.
Das erstere Verfahren beobachtet z.B. die Barmanische Sprache,
soweit ich sie genauer beurtheilen kann, auch die Siamesische, die Mandschuische
und Mongolische, insofern sie die Pronomina nicht zu Affixen
abkürzen, die Sprachen der Südsee-Inseln und grossentheils auch
die übrigen Malayischen des westlichen Archipelagus, das letztere die
Mexicanische, die Delaware-Sprache und andere Amerikanische. Indem
die Mexicanische dem Verbum das regierende und regierte Pronomen,
bald in concreter, bald in allgemeiner Bedeutung, beigiebt, drückt
sie wirklich auf eine geistigere Weise seine nur ihm angehörende
Function durch die Richtung auf die übrigen Haupttheile des Satzes
aus. Bei dem ersteren dieser beiden Verfahren können Subject und
Praedicat nur so verknüpft werden, dass man die Verbalkraft durch
Hinzufügung des Verbum seyn andeutet. Meistentheils aber wird dasselbe
bloss hinzugedacht; was in Sprachen dieses Verfahrens Verbum
heisst, ist nur Participium oder Verbalnomen und kann, wenn auch Genus
des Verbum, Tempus und Modus daran ausgedrückt sind, vollkommen
so gebraucht werden. Unter Modus verstehen aber diese Sprachen
nur die Fälle, wo die Begriffe des Wünschens, Befürchtens, des Könnens,
Müssens u.s.f. Anwendung finden. Der reine Conjunctivus ist
ihnen in der Regel fremd. Das durch ihn ohne Hinzukommen eines materiellen
Nebenbegriffs ausgedrückte Ungewisse und abhängige Setzen
kann in Sprachen nicht angemessen bezeichnet werden, in welchen das
einfache actuale Setzen keinen formalen Ausdruck findet. Dieser Theil
des angeblichen Verbum ist alsdann mehr oder weniger sorgfältig behandelt
und zu Worteinheit verschmolzen. Der hier geschilderte Unterschied
ist aber genau derselbe, als wenn man das Verbum in seine Umschreibung
auflöst oder es in seiner lebendigen Einheit gebraucht. Das
erstere ist mehr ein logisch geordnetes, das letztere ein sinnlich bildendes
Verfahren und man glaubt, wenn man sich in die Eigenthümlichkeit
dieser Sprachen versetzt, zu sehen, was in dem Geiste der Völker, welchen
nur das auflösende eigenthümlich ist, vorgehen muss. Die andren,
so wie die Sprachen gesetzmässiger Bildung bedienen sich beider nach
Verschiedenheit der Umstände. Die Sprache kann ihrer Natur nach den
sinnlich bildenden Ausdruck der Verbalfunction nicht ohne grosse
Nachtheile aufgeben. Auch wird in der That, selbst bei den Sprachen,
welche, wie man offenherzig gestehen muss, an wirklicher Abwesenheit
des wahren Verbum leiden, der Nachtheil dadurch verringert, dass bei
einem grossen Theile von Verben die Verbalnatur in der Bedeutung
selbst liegt und daher der formale Mangel materiell ersetzt wird.
Kommt nun noch, wie im Chinesischen, hinzu, dass Wörter, welche beide
500Functionen, des Nomen und des Verbum, übernehmen könnten,
durch den Gebrauch nur zu Einem gestempelt sind oder dass sie ihre
Geltung durch die Betonung anzeigen können, so hat sich die Sprache
auf einem andren Wege noch mehr wieder in ihre Rechte eingesetzt.
Unter allen, mir genauer bekannten Sprachen mangelt keiner so sehr
die formale Bezeichnung der Verbalfunction, als der Barmanischen. 61
Carey bemerkt ausdrücklich in seiner Grammatik, dass in der Barmanischen
Sprache Verba kaum anders, als in Participialformen gebraucht
werden, indem, setzt er hinzu, dies hinreichend sey, jeden durch ein
Verbum auszudrückenden Begriff anzudeuten. An einer andren Stelle
spricht er dem Barmanischen alle Verba ganz und gar ab. 62 Diese Eigenthümlichkeit
wird aber erst ganz verständlich, wenn man sie im Zusammenhange
mit dem übrigen Bau der Sprache betrachtet.
Die Barmanischen Stammwörter erfahren keine Veränderung durch
die Anfügung grammatischer Sylben. Die einzigen Buchstabenveränderungen
in der Sprache sind die Verwandlung des ersten aspirirten Buchstaben
in einen unaspirirten, da wo ein aspirirter verdoppelt wird, und
bei der Verbindung von zwei einsylbigen Stammwörtern zu Einem Worte
oder der Wiederholung des nemlichen der Uebergang des dumpfen
Anfangsconsonanten des zweiten in den unaspirirten tönenden. Auch
im Tamulischen 63 werden k, t (sowohl das linguale als dentale) und p in
der Mitte der Wörter zu g, d und b. Der Unterschied ist nur, dass im
Tamulischen der Consonant dumpf bleibt, wenn er sich doppelt in der
Wortmitte befindet, da hingegen im Barmanischen die Umwandlung
auch dann statt findet, wenn das erste beider Stammwörter mit einem
Consonanten schliesst. Das Barmanische erhält daher in jedem Falle die
grössere Einheit des Wortes durch die grössere Flüssigkeit des hinzutretenden
Consonanten. 64
Der Barmanische Wortbau beruht (mit Ausnahme der Pronomina
und der grammatischen Partikeln) auf einsylbigen Stammwörtern
und aus denselben gebildeten Zusammensetzungen. Von den Stammwörtern
lassen sich zwei Classen unterscheiden. Die einen deuten
Handlungen und Eigenschaften an und beziehen sich daher auf mehrere
Gegenstände. Die andren sind Benennungen einzelner Gegenstände,
lebendige Geschöpfe oder leblose Dinge. So liegt also hier Verbum, Adjectivum
und Substantivum in der Bedeutung der Stammwörter. Auch
besteht der eben angegebene Unterschied dieser Wörter nur in ihrer Bedeutung,
nicht in ihrer Form; ê, kühl seyn, erkalten, kû, umgeben, verbinden,
helfen, mâ, hart, stark, gesund seyn, sind nicht anders geformt,
als lê, der Wind, rê (ausgesprochen yê 65), das Wasser, lû, der Mensch.
Carey hat die Beschaffenheit und Handlung andeutenden Stammwörter
in ein besondres alphabetisches Verzeichniss gebracht, welches seiner
Grammatik angehängt ist, und hat sie ganz wie die Wurzeln des Sanskrit
501behandelt. Auf der einen Seite lassen sie sich in der That damit vergleichen.
Denn sie gehören in ihrer ursprünglichen Gestalt keinem einzelnen
Redetheile an und erscheinen auch in der Rede nur mit den
grammatischen Partikeln, welche ihnen ihre Bestimmung in derselben
geben. Es wird auch eine grosse Zahl von Wörtern von ihnen abgeleitet,
was schon aus der Art der durch sie bezeichneten Begriffe natürlich
herfliesst. Allein genau erwogen haben sie durchaus eine andere Natur,
als die Sanskritischen Wurzeln, da die grammatische Behandlung der
ganzen Sprache nur Stammwörter und grammatische Partikeln an einander
reiht und keine verschmolzenen Wortganze bildet, ebendarum
auch nicht blosse Ableitungssylben mit Stammlauten verbindet. Auf
diese Weise erscheinen die Stammwörter in der Rede nicht als untrennbare
Theile verbundener Wortformen, sondern wirklich in ihrer ganzen
unveränderten Gestalt und es bedarf keiner künstlichen Abtrennung
derselben aus grösseren, in sich verschmolzenen Formen. Die Ableitung
aus ihnen ist auch keine wahre Ableitung, sondern blosse Zusammensetzung.
Die Substantiva endlich haben zum grössten Theil nichts, was
sie von ihnen unterscheidet, und lassen sich meistens nicht von ihnen
ableiten. Im Sanskrit ist wenigstens, seltene Fälle ausgenommen, die
Form der Nomina von der Wurzelform verschieden, wenn es auch
mit Recht unstatthaft genannt werden mag, alle Nomina durch Unâdi-Suffixa
von den Wurzeln abzuleiten. Die angeblichen Barmanischen
Wurzeln verhalten sich daher eigentlich wie die Chinesischen Wörter,
verrathen aber allerdings, mit dem übrigen Baue der Sprache zusammengenommen,
eine gewisse Annäherung zu den Sanskritischen Wurzeln.
Sehr häufig hat die angebliche Wurzel ohne alle Veränderung auch
daneben die Bedeutung eines Substantivum, in welchem ihre eigenthümliche
Verbalbedeutung mehr oder weniger klar hervortritt. So
heisst mai schwarz seyn, drohen, schrecken und die Indigopflanze, nê
bleiben, fortwähren und die Sonne, pauñ zur Verstärkung hinzufügen,
daher verpfänden und die Lende, Hinterkeule bei Thieren. Dass bloss
die grammatische Kategorie durch eine Ableitungssylbe aus der Wurzel
verändert und bezeichnet werde, finde ich nur in einem einzigen Falle;
wenigstens unterscheidet sich nur dieser dem Anblicke nach von der
sonst gewöhnlichen Zusammensetzung. Es werden nemlich durch Praefigirung
eines a aus Wurzeln Substantiva, nach Hough (Voc. S. 20.)
auch Adjectiva gebildet: a-châ, Speise, Nahrungsmittel, von châ,
essen; a-myak (amyet H.), Aerger, von myak, ärgerlich seyn, sich ärgern;
a-pan:, ein abmattendes Geschäft, von pan:, mit Mühe athmen;
chang (chî), in eine ununterbrochene Reihe stellen, und a-chang, Ordnung,
Methode. Dies vorschlagende a wird aber wieder abgeworfen,
wenn das Substantivum als eines der letzten Glieder in ein Compositum
tritt. Diese Abwerfung findet aber auch, wie wir weiter unten bei ama
502sehen werden, in Fällen statt, wo das a gewiss keine Ableitungssylbe
aus einer Wurzel ist. Es giebt auch Substantiva, welche ohne Aenderung
der Bedeutung diesen Vorschlag bald haben, bald entbehren. So
lautet das oben angeführte pauñ, Lende, auch bisweilen apauñ. Man
kann daher doch dies a keiner wahren Ableitungssylbe gleichstellen.
In Zusammensetzungen sind theils zwei Beschaffenheits- oder
Handlungswörter (Carey's Wurzeln), theils zwei Nomina, theils endlich
ein Nomen mit einer solchen Wurzel verbunden. Der erste Fall wird oft
an der Stelle eines Modus des Verbum, z. B. des Optativs durch die Verbindung
irgend eines Verbalbegriffs mit wünschen angewandt. Es werden
jedoch auch zwei Wurzeln bloss zur Modificirung des Sinnes zusammengesetzt
und alsdann fügt die letzte demselben bisweilen kaum
eine kleine Nuance hinzu; ja die Ursach der Zusammensetzung lässt
sich bisweilen aus dem Sinne der einzelnen Wurzeln nicht errathen. So
heissen pan, pan-krâ: und pan-kwâ Erlaubniss fordern, bitten; krâ:
(kyâː) heisst Nachricht empfangen und geben, dann aber auch getrennt
seyn, kwâ sich trennen, nach vorheriger Verbindung geschieden werden.
In andren Compositis ist die Zusammensetzung erklärlicher: so
heisst prach-hmâː gegen etwas sündigen, übertreten und prach (prîch)
allein: nach etwas hinwerfen, hmâː irren, auf falschem Wege seyn,
daher auch für sich allein: sündigen. Es wird also hier durch die Zusammensetzung
eine Verstärkung des Begriffs erreicht. Aehnliche Fälle finden
sich häufiger und zeigen deutlich, dass die Sprache die Eigenthümlichkeit
besitzt, sehr oft neben einer einfachen und daher einsylbigen
Wurzel ein aus zweien zusammengesetztes und also zweisylbiges Verbum
ohne alle irgend wesentliche Veränderung der Bedeutung und so
zu bilden, dass die hinzutretende Wurzel den Begriff der anderen entweder
bloss auf etwas verschiedene Weise wiedergibt oder ihn auch
ganz einfach wiederholt oder endlich einen ganz allgemeinen Begriff
hinzufügt. 66 Ich werde auf diese, für den Sprachbau überhaupt wichtige
Erscheinung weiter unten wieder zurückkommen. Einige solcher Wurzeln
werden, auch wenn sie erste Glieder eines Compositum sind, niemals
einzeln gebraucht. Von dieser Art ist tuñ, das immer nur zusammen
mit wap (wet) vorkommt, obgleich beide Wurzeln die Bedeutung
des Compositum, sich aus Verehrung verneigen, an sich tragen. Man
sagt auch umgekehrt wap-tuñ, allein in verstärktem Sinn: auf der Erde
kriechen, vor Vornehmen liegen. Bisweilen dienen auch Wurzeln dergestalt
zu Zusammensetzungen, dass nur ein Theil ihrer Bedeutung in das
Compositum übergeht und nicht darauf geachtet wird, dass der Ueberrest
derselben mit dem andren Gliede der Zusammensetzung in Widerspruch
steht. So wird hchwat, sehr weiss seyn, nach Judson's ausdrücklicher
Bemerkung auch als Verstärkung mit Wörtern andrer Farben
gebraucht. Wie mächtig die Zusammensetzung auf das einzelne Wort
503wirkt, sieht man endlich auch daraus, dass Judson bei dem oben dagewesenen
Worte hchauñ bemerkt, dass dasselbe bisweilen durch die Verbindung,
in welcher es steht, eine besondere Bedeutung (a specific
meaning) erhält.
Wo Nomina mit Wurzeln verbunden sind, stehen die letzteren gewöhnlich
hinter den ersteren: lak-tat (let-tat H.), ein Künstler, Verfertiger,
von lak (let H.), die Hand, und tat, in etwas geschickt seyn, etwas
verstehen. Diese Zusammensetzungen kommen alsdann mit den Sanskritischen
überein, wo wie in dharmawid eine Wurzel als letztes Glied an
ein Nomen gefügt ist. Oft aber wird in diesen Zusammensetzungen auch
bloss die Wurzel im Sinne eines Adjectivum genommen und dann entsteht
nur insofern ein Compositum, als die Barmanische Sprache ein mit
seinem Substantivum verbundenes Adjectivum immer als ein solches
betrachtet: nwâː-kauñ, Kuh gute (genau: gut seyn). Ein Compositum
dieser Art im eigentlicheren Sinne des Worts ist lû-chu, Menschenmenge,
von lû, Mensch, und chu, sich versammeln. Bei der Zusammensetzung
der Nomina unter einander finden sich Fälle, wo dasjenige, welches
das letzte Glied ausmacht, sich so von seiner ursprünglichen Bedeutung
entfernt, dass es zu einem Suffix allgemeiner Bedeutung wird. So wird
ama, Weib, Mutter, 67 mit Wegwerfung des a zu ma abgekürzt und fügt
dann dem ersten Gliede des Compositum die Bedeutung des Grossen,
Vornehmsten, Hauptsächlichen hinzu: tak (tet), das Ruder, aber tak-ma,
das hauptsächliche Ruder, das Steuerruder.
Zwischen dem Nomen und dem Verbum giebt es in der Sprache keinen
ursprünglichen Unterschied. Erst in der Rede wird derselbe durch
die an das Wort geknüpften Partikeln bestimmt; man kann aber nicht,
wie im Sanskrit, das Nomen an bestimmten Ableitungssylben erkennen
und der Begriff einer zwischen der Wurzel und dem flectirten Nomen
stehenden Grundform fällt im Barmanischen gänzlich hinweg. Höchstens
machen hiervon die durch Praefigirung eines a gebildeten, weiter
oben erwähnten Substantiva eine Ausnahme. Alle grammatische Bildung
von Substantiven und Adjectiven besteht in deutlicher Zusammensetzung,
wo das letzte Glied dem Begriff des ersten einen allgemeineren
hinzufügt, es sey nun, dass das erste eine Wurzel oder ein Nomen
ist. Im ersteren Fall entstehen aus den Wurzeln Nomina, im letzteren
werden mehrere Nomina unter Einen Begriff, gleichsam unter eine
Classe zusammengestellt. Es fällt in die Augen, dass das letzte Glied
dieser Zusammensetzungen nicht eigentlich ein Affixum genannt werden
könne, obgleich es in der Barmanischen Grammatik immer diesen
Namen trägt. Das wahre Affixum zeigt durch die Lautbehandlung in
der Worteinheit an, dass es den bedeutsamen Theil des Wortes, ohne
ihm etwas materielles hinzuzufügen, in eine bestimmte Kategorie versetzt.
Wo, wie hier, eine solche Lautbehandlung fehlt, ist diese Verse
504nicht symbolisch in den Laut übergegangen, sondern der Sprechende
muss sie aus der Bedeutung des angeblichen Affixes oder aus
dem angenommenen Sprachgebrauch erst hineinlegen. Diesen Unterschied
muss man bei Beurtheilung der ganzen Barmanischen Sprache
wohl im Auge behalten. Sie drückt Alles oder doch das Meiste von dem
aus, was durch Flexion angedeutet werden kann, überall aber fehlt ihr
der wahre symbolische Ausdruck, durch welchen die Form in die Sprache
übergeht und wieder aus ihr in die Seele zurückkehrt. Daher findet
man in Carey's Grammatik unter dem Titel der Bildung der Nomina die
verschiedensten Fälle neben einander gestellt, abgeleitete Nomina, rein
zusammengesetzte, Gerundia, Participia u. s. f., und kann diese Zusammenstellung
nicht einmal wahrhaft tadeln, da in allen diesen Fällen
Wörter durch ein angebliches Affixum unter Einen Begriff und, soviel
die Sprache Worteinheit besitzt, auch in Ein Wort zusammengefasst
werden. Es ist auch nicht zu läugnen, dass der beständig wiederkehrende
Gebrauch dieser Zusammensetzungen im Geiste der Sprechenden
die letzten Glieder derselben den wahren Affixen näher bringt, besonders
wenn, wie im Barmanischen wirklich bisweilen der Fall ist, die sogenannten
Affixa gar keine für sich anzugebende Bedeutung oder in ihrer
Selbstständigkeit eine solche haben, die sich in ihrer Affigirung gar
nicht oder nur sehr entfernt wiederfinden lässt. Beide Fälle, von denen
sich aber der letztere, da die Ideenverbindungen so mannigfaltig seyn
können, nicht immer mit völliger Bestimmtheit beurtheilen lässt, kommen
in der Sprache, wie man bei der Durchgehung des Wörterbuchs
sieht, nicht selten vor, ob sie gleich auch nicht die häufigeren sind. Diese
Neigung zur Zusammensetzung oder Affigirung beweist sich auch
dadurch, dass, wie wir schon oben sahen, eine bedeutende Anzahl der
Wurzeln und Nomina niemals ausser dem Zustande der Zusammensetzung
selbstständig gebraucht wird, ein Fall, der sich auch in andren
Sprachen, namentlich im Sanskrit wiederfindet. Ein vielfältig gebrauchtes
und allemal die Verwandlung einer Wurzel, mithin eines Verbum in
ein Nomen mit sich führendes Affix ist hkyafiː. 68 Es bringt den abstracten
Begriff des Zustandes, welchen das Verbum enthält, hervor, die als
Sache gedachte Handlung: chê, senden, che-hkyañː (chê-gyeñː), Sendung.
Als für sich stehendes Verbum heisst hkyañː bohren, durchstechen,
durchdringen, wozwischen und seinem Sinne als Affixum gar
kein Zusammenhang zu entdecken ist. Unstreitig liegen aber diesen
heutigen concreten Bedeutungen verloren gegangene allgemeine zum
Grunde. Alle übrigen, Nomina bildenden Affixa sind, soviel ich sie
übersehen kann, mehr particulärer Natur.
Die Behandlung des Adjectivum ist allein aus der Zusammensetzung
zu erklären und beweist recht augenscheinlich, wie die Sprache immer
dies Mittel bei der grammatischen Bildung vor Augen hat. An und für
505sich kann das Adjectivum nichts, als die Wurzel selbst seyn. Seine
grammatische Beschaffenheit erlangt es erst in der Zusammensetzung
mit einem Substantivum oder wenn es absolut hingestellt wird, wo es,
wie die Nomina, ein praefigirtes a annimmt. Bei der Verbindung mit einem
Substantivum kann es vor demselben vorausgehen oder ihm nachfolgen,
muss sich aber in dem ersteren Falle durch eine Verbindungspartikel
(thang oder thau) demselben anschliessen. Den Grund dieses
Unterschiedes glaube ich in der Natur der Zusammensetzung zu finden.
Bei dieser muss das letzte Glied allgemeinerer Natur seyn und das erste
in seinen grösseren Umfang aufnehmen können. Bei der Verknüpfung
eines Adjectivum mit einem Substantivum hat aber jenes den grösseren
Umfang und bedarf daher eines seiner Natur angemessenen Zusatzes,
um sich an das Substantivum anzufügen. Jene Verbindungspartikeln,
von denen ich weiter unten ausführlicher reden werde, erfüllen diesen
Zweck und die Verbindung heisst nun nicht sowohl z.B. ein guter
Mann, als: ein gut seyender oder ein Mann, der gut ist, nur dass im Barmanischen
diese Begriffe umgekehrt (gut, welcher, Mann) auf einander
folgen. Das angebliche Adjectivum wird auf diese Weise ganz als Verbum
behandelt; denn wenn auf der einen Seite kauñː-thang-lû der gute
Mensch heisst, so würden, für sich stehend, die beiden ersten Elemente
des Compositum er ist gut heissen. Noch deutlicher erscheint dies dadurch,
dass man ganz auf dieselbe Weise einem Substantivum, statt eines
blossen Adjectivum, ein vollkommenes, sogar mit dem von ihm regierten
Worte versehenes Verbum vorausschicken kann; der in der Luft
fliegende Vogel lautet in Barmanischer Wortfolge: Luftraum in fliegen
(Verbindungspartikel) Vogel. Bei dem nachstehenden Adjectivum
kommt die Stellung der Begriffe mit den Zusammensetzungen überein,
wo eine als letztes Glied stehende Wurzel, wie besitzen, wägen, würdig
seyn, mit andren Wörtern durch ihre Bedeutung modificirte Nomina
bildet.
In der Verbindung der Rede werden die Beziehungen der Wörter auf
einander durch Partikeln angezeigt. Es ist daher begreiflich, dass diese
beim Nomen und Verbum verschieden sind. Indess ist dies nicht einmal
immer der Fall und Nomen und Verbum fallen dadurch noch mehr in
eine und dieselbe Kategorie. Die Verbindungspartikel thang ist zugleich
das wahre Nominativzeichen und bildet auch den Indicativ des Verbum.
In diesen beiden Functionen findet sie sich in der kurzen Redensart ich
thue, nâ-thang pruthang, dicht neben einander. Hier liegt offenbar dem
Gebrauche des Wortes eine andere Ansicht, als die gewöhnliche Bedeutung
der grammatischen Formen zum Grunde und wir werden diese
weiter unten aufsuchen. Dieselbe Partikel wird aber als Endung des Instrumentalis
aufgeführt und steht auf diese Weise in folgender Redensart:
lû-tat-thang hchauk-thang-im, das durch einen geschickten Mann
506gebaute Haus. Das erste dieser beiden Wörter enthält das Compositum
aus Mann und geschickt, welchem darauf das angebliche Zeichen des
Instrumentalis folgt. Im zweiten findet sich die Wurzel bauen, hier im
Sinne von gebaut seyn, auf die im Vorigen angegebene Weise als Adjectivum
vermittelst der Verbindungspartikel thang dem Substantivum im
(ieng H.), Haus, vorn angefügt. Es wird mir nun sehr zweifelhaft, ob der
Begriff des Instrumentalis wirklich ursprünglich in der Partikel thang
liegt oder ob erst später grammatische Ansicht ihn hineintrug, da ursprünglich
im ersten jener Worte bloss der Begriff des geschickten Mannes
lag und es dem Hörer überlassen blieb, die Beziehung hinzuzudenken,
in welcher derselbe hier vor das zweite Wort gestellt wurde. Auf
ähnliche Art giebt man thang auch als Genitivzeichen an. Wenn man die
grosse Zahl von Partikeln, welche angeblich als Casus die Beziehungen
des Nomen ausdrücken, zusammennimmt, so sieht man deutlich, dass
Pali-Grammatiker, welchen überhaupt die Barmanische Sprache ihre
wissenschaftliche Anordnung und Terminologie verdankt, bemüht gewesen
sind, sie unter die acht Casus des Sanskrit und ihrer Sprache zu
vertheilen und eine Declination zu bilden. Genau genommen ist aber
eine solche der Sprache fremd, die bloss in Rücksicht auf die Bedeutung
der Partikeln, durchaus nicht auf den Laut des Nomen die angeblichen
Casusendungen gebraucht. Jedem Casus werden mehrere zugetheilt, die
aber wieder jede eigne Näancen des Bezichungsbegriff es ausdrücken.
Einige bringt Carey auch noch nach Aufstellung seiner Declination abgesondert
nach. Zu einigen dieser Casuszeichen gesellen sich auch, bald
vorn, bald hinten, andere, den Sinn der Beziehung genauer bestimmende.
Uebrigens folgen dieselben allemal dem Nomen nach und zwischen
diesem und ihnen stehen, wenn sie vorhanden sind, die Bezeichnung
des Geschlechts und die des Plurals. Die letztere dient, so wie alle Casuszeichen,
auch bei dem Pronomen und es giebt keine eigne Pronomina
für wir, ihr, sie. Die Sprache scheidet also Alles nach der Bedeutsamkeit,
verbindet nichts durch den Laut und stösst dadurch sichtbar das
natürliche und ursprüngliche Streben des inneren Sprachsinns, aus Genus,
Numerus und Casus vereinte Lautmodificationen des materiell bedeutsamen
Wortes zu machen, zurück. Die ursprüngliche Bedeutung
des Casuszeichen lässt sich indess nur bei wenigen nachweisen, selbst
bei dem Pluralzeichen tô (do H.) nur dann, wenn man mit Nichtbeachtung
der Accente es von tôː, vermehren, hinzufügen, abzuleiten unternimmt.
Die persönlichen Pronomina erscheinen immer nur in selbstständiger
Form und dienen niemals, abgekürzt oder verändert, als
Affixe.
Das Verbum ist, wenn man das blosse Stammwort betrachtet, allein
durch seine materielle Bedeutung kenntlich. Das regierende Pronomen
steht allemal vor demselben und deutet schon dadurch an, dass es nicht
507zur Form des Verbum gehört, indem es sich gänzlich von den, immer
auf das Stammwort folgenden Verbalpartikeln absondert. Was die Sprache
von Verbalformen besitzt, beruht ausschliesslich auf den letzteren,
welche den Plural, wenn er vorhanden ist, den Modus und das Tempus
angeben. Eine solche Verbalform ist dieselbe für alle drei Personen und
die einfache Ansicht des ganzen Verbum oder vielmehr der Satzbildung
ist daher die, dass das Stammwort mit seiner Verbalform ein Participium
ausmacht, welches sich mit dem, von ihm unabhängig stehenden
Subject durch ein hinzugedachtes Verbum seyn verbindet. Das letztere
ist zwar auch in der Sprache ausdrücklich vorhanden, wird aber, wie es
scheint, zu dem gewöhnlichen Verbalausdruck selten zu Hülfe genommen.
Kehren wir nun zu der Verbalform zurück, so hängt sich der Pluralausdruck
unmittelbar an das Stammwort oder an den Theil an, der mit
diesem als ein und ebendasselbe Ganze angesehen wird. Es ist aber
merkwürdig und hierin liegt ein Erkennungsmittel des Verbum, dass
das Pluralzeichen der Conjugation gänzlich von dem der Declination
verschieden ist. Das niemals fehlende einsylbige Pluralzeichen kra
(kya) nimmt gewöhnlich, obgleich nicht immer, noch ein zweites, kun,
verwandt mit akun, völlig, vollständig, 69 unmittelbar nach sich und die
Sprache beweist auch hierin ihre doppelte Eigenthümlichkeit, die grammatische
Beziehung durch Zusammensetzung zu bezeichnen und in
dieser den Ausdruck, auch wo Ein Wort schon hinreichen würde, noch
durch Hinzufügung eines andren zu verstärken. Doch tritt hier der
nicht unmerkwürdige Fall ein, dass einem mit verloren gegangener ursprünglicher
Bedeutung zum Affixum gewordenen Worte eines von bekannter
Bedeutung beigegeben wird.
Die Modi beruhen, wie schon oben erwähnt worden ist, grösstentheils
auf der Verbindung von Wurzeln allgemeinerer Bedeutung mit
den concreten. Auf diese Weise sich bloss nach der materiellen Bedeutsamkeit
richtend, gehen sie ganz über den logischen Umfang dieser Verbalform
hinaus und ihre Zahl wird gewissermassen unbestimmbar. Die
Tempuszeichen folgen ihnen bis auf wenige Ausnahmen in der Anfügung
an das eigentliche Verbum nach; das Pluralzeichen aber richtet
sich nach der Festigkeit, mit welcher die den Modus anzeigende Wurzel
mit der concreten als verbunden betrachtet wird, worüber eine doppelte
Ansicht in dem Sprachsinne des Volks zu herrschen scheint. In einigen
wenigen Fällen tritt dasselbe zwischen beide Wurzeln, in den meisten
aber folgt es der letzten. Es ist offenbar, dass die den Modus
anzeigenden Wurzeln im ersteren Fall mehr von einem dunklen Gefühl
der grammatischen Form begleitet sind, da hingegen im letzteren beide
Wurzeln in der Vereinigung ihrer Bedeutungen gleichsam als ein und
dasselbe Stammwort gelten. Unter dem, was hier Modus durch Verbindung
508von Wurzeln genannt wird, kommen Formen ganz verschiedener
grammatischer Bedeutung vor, z. B. die Causalverba, welche durch Hinzufügung
der Wurzel schicken, auftragen, befehlen gebildet werden,
und Verba, deren Bedeutung andere Sprachen durch untrennbare Praepositionen
modificiren.
Von Tempuspartikeln führt Carey fünf des Praesens, drei zugleich
des Praesens und Praeteritum und zwei ausschliesslich dem letzteren
angehörende, dann einige des Futurum auf. Er nennt die damit gebildeten
Verbalbeugungen Formen des Verbum, ohne jedoch den Unterschied
des Gebrauchs der die gleiche Zeit bezeichnenden anzugeben.
Dass jedoch unter ihnen ein Unterschied gemacht wird, zeigt sich durch
seine gelegentliche Aeusserung, dass zwei, von denen er gerade spricht,
wenig in der Bedeutung von einander abweichen. Von thê: merkt Judson
an, dass es anzeigt, dass die Handlung noch im gegenwärtigen Augenblicke
nicht fortzudauern aufgehört hat. Ausser den so aufgeführten
kommen aber auch noch andere, namentlich eine für die ganz vollendete
Vergangenheit vor. Eigentlich gehören nun diese Tempuszeichen insofern
dem Indicativus an, als sie an und für sich keinen anderen Modus
andeuten; einige derselben dienen aber auch in der That zur Bezeichnung
des Imperativus, der jedoch auch seine ganz eigenen Partikeln hat
oder durch die nackte Wurzel angedeutet wird. Judson nennt einige dieser
Partikeln bloss euphonische oder ausfüllende. Verfolgt man sie im
Wörterbuche, so sind die meisten zugleich, wenn auch in einer gar nicht
oder nur entfernt verwandten Bedeutung, wirkliche Wurzeln und das
Verfahren der Sprache ist also auch hier bedeutsame Zusammensetzung.
Diese Partikeln machen der Absicht der Sprache nach offenbar
Ein Wort mit der Wurzel aus und man muss die ganze Form als ein
Compositum ansehen. Durch Buchstabenveränderung aber ist diese
Einheit nicht angedeutet, ausgenommen darin, dass in den oben angegebenen
Fällen die Aussprache die dumpfen Buchstaben in ihre unaspirirten
tönenden verwandelt. Auch dies wird von Carey nicht ausdrücklich
bemerkt; es scheint aber aus der Allgemeinheit seiner Regel und
der Schreibung bei Hough zu folgen, der diese Umwandlung bei allen
auf diese Weise als Partikeln gebrauchten Wörtern anwendet und z. B.
das Zeichen vollendeter Vergangenheit prîː in der Angabe der Aussprache
byîː schreibt. Auch eine wirklich in der geschriebenen Sprache vorkommende
Zusammenziehung der Vocale zweier solcher einsylbigen
Wörter finde ich in dem Futurum der Causalverba. Das Causalzeichen
chê (die Wurzel befehlen) und die Partikel aṅˑ des Futurum werden zu
chimˑ. 70 Der gleiche Fall scheint mit der zusammengesetzten Partikel
des Futurum limˑ-mang statt zu finden, wo nemlich die Partikel lê mit
aṅˑ zu limˑ zusammengezogen und dann eine andere Partikel des Futurum,
mang, hinzugesetzt wird. Aehnliche Fälle mag zwar die Sprache
509noch aufweisen, doch können sie, da man ihnen sonst nothwendig öfter
begegnen müsste, unmöglich häufig seyn. Die hier geschilderten Verbalformen
lassen sich wieder durch Anfügung von Casuszeichen decliniren,
dergestalt, dass das Casuszeichen entweder unmittelbar an die
Wurzel oder an die sie begleitenden Partikeln geheftet wird. Wenn dies
zwar mit der Natur der Gerundien und Participien anderer Sprachen
übereinkommt, so werden wir doch weiter unten sehen, dass die Barmanische
auch noch in einer ganz eigenthümlichen Art Verba und Verbalsätze
als Nomina behandelt.
Von den hier erwähnten Partikeln der Modi und Tempora muss man
eine andere absondern, welche auf die Bildung der Verbalformen den
wesentlichsten Einfluss ausübt, aber auch dem Nomen angehört und in
der Grammatik der ganzen Sprache eine wichtige Rolle spielt. Man erräth
schon aus dem Vorigen, dass ich hier das, als Nominativzeichen
weiter oben erwähnte thang meine. Auch Carey hat diesen Unterschied
gefühlt. Denn ob er gleich thang als die erste der Praesensformen des
Verbum bildend aufführt, so behandelt er es doch unter dem Namen
einer Verbindungspartikel (connective increment) immer ganz abgesondert.
Thang fügt dem Verbum nicht, wie die übrigen Partikeln, eine Modification
hinzu, 71 ist vielmehr für seine Bedeutung unwesentlich; es
zeigt aber an, in welchem grammatischen Sinne das Wort, dem es sich
anschliesst, genommen werden soll, und begränzt, wenn der Ausdruck
erlaubt ist, seine grammatischen Formen. Es gehört daher beim Verbum
nicht zu den bedeutsamen, sondern zu den, bei der Zusammenfügung
der Elemente der Rede das Verständniss leitenden Wörtern und kommt
ganz mit dem Begriff der im Chinesischen hohl oder leer genannten
Wörter überein. Wo thang das Verbum begleitet, stellt es sich entweder,
wenn keine andere Partikel vorhanden ist, unmittelbar hinten an die
Wurzel oder folgt den andren vorhandenen Partikeln nach. In beiden
Stellungen kann es durch Anheftung von Casuszeichen flectirt werden.
Es zeigt sich aber hier der merkwürdige Unterschied, dass bei der Declination
des Nomen thang bloss das Nominativzeichen ist und bei der
Anfügung der übrigen Casus nicht weiter erscheint, bei der des Participium
(denn für ein solches kann man doch hier nur das Verbum nehmen)
hingegen seine Stelle behält. Dies scheint zu beweisen, dass seine
Bestimmung im letzteren Fall die ist, das Zusammengehören der Partikeln
mit der Wurzel, folglich die Begränzung der Participialform anzuzeigen.
Seinen regelmässigen Gebrauch findet es nur im Indicativus.
Vom Subjunctivus ist es gänzlich ausgeschlossen, ebenso vom Imperativus,
und auch noch in einigen einzelnen andren Fügungen fällt es hinweg.
Nach Carey dient es, die Participialformen mit einem folgenden
Worte zu verbinden, was insofern mit meiner Behauptung übereinkommt,
dass es eine Abgränzung jener Formen von der auf sie folgenden
510ausmacht. Wenn man das hier Gesagte zusammennimmt und mit
dem Gebrauche des Wortes beim Nomen verbindet, so fühlt man bald,
dass dasselbe nicht nach der Theorie der Redetheile erklärt werden
kann, sondern dass man, wie bei den Chinesischen Partikeln, zu seiner
ursprünglichen Bedeutung zurückgehen muss. In dieser drückt es nun
den Begriff: dieses, also aus und wird in der That von Carey und Judson
(welche nur diese Bedeutung nicht mit dem Gebrauche des Worts als
Partikel in Verbindung bringen) ein Demonstrativpronomen und Adverbium
genannt. In beiden Functionen bildet es, als erstes Glied, mehrere
Composita. Sogar bei der Verbindung von Verbalwurzeln, wo eine
von allgemeinerer Bedeutung den Sinn der andren modificirt, führt Carey
thang in einem seiner Adverbialbedeutung verwandten Sinne: entsprechen,
übereinkommen (also: ebenso seyn) an, hat es jedoch nicht in
sein Wurzelverzeichniss aufgenommen und giebt leider auch kein Beispiel
dieser Bedeutung. 72 In demselben Sinne scheint es mir nun als Leitungsmittel
des Verständnisses gebraucht zu werden. Indem der Redende
einige Worte, die er genau zusammengenommen wissen will, oder
die Substantiva und Verba besonders heraushebt, lässt er auf sie: dies!
also! folgen und wendet die Aufmerksamkeit des Hörers auf das Gesagte,
um es nun weiter mit dem Folgenden zu verbinden oder auch, wenn
thang das letzte Wort des Satzes ist, die vollendete Rede zu beschliessen.
Auf diesen Fall passt Carey's Erklärung von thang, als einer, Vorhergehendes
und Nachfolgendes mit einander verbindenden Partikel
nicht und daher mag seine Aeusserung kommen, dass die mit thang verbundene
Wurzel oder Verbalform die Kraft eines Verbum hat, wenn sie
sich am Schluss eines Satzes befindet. 73 In der Mitte der Rede ist die mit
thang verbundene Verbalform nach ihm ein Participium oder wenigstens
eine Fügung, in der man nur mit Mühe das wahre Verbum erkennt,
am Schluss eines Satzes aber ein wirklich flectirtes Verbum. Mir
scheint dieser Unterschied ungegründet. Auch am Schluss eines Satzes
ist die hier besprochene Form nur Participium oder genauer zu reden
nur eine nach Aehnlichkeit eines Participium modificirte. Die eigentliche
Verbalkraft muss in beiden Stellungen immer hinzugedacht werden.
Dieselbe wirklich auszudrücken, besitzt jedoch die Sprache noch ein
anderes Mittel, über dessen wahre Beschaffenheit zwar weder Carey
noch Judson vollkommene Aufklärung gewähren, das aber mit der
Kraft eines hinzugefügten Hülfsverbum grosse Aehnlichkeit hat. Wenn
man nemlich einen Satz durch ein wirklich flectirtes Verbum wahrhaft
beschliessen und alle Verbindung mit dem Folgenden aufheben will, so
setzt man der Wurzel oder der Verbalform êng (î H.) an der Stelle von
thang nach. Es wird hierdurch allem Misverständniss vorgebeugt, das
aus der verbindenden Natur von thang entspringen könnte, und die
511Reihe an einander hängender Participien wirklich zum Schluss gebracht;
pru-êng heisst nun wirklich (ich u. s.w.) thue, nicht mehr: ich
bin thuend, pru-prîː-êng ich habe gethan, nicht: ich bin thuend gewesen.
Die eigentliche Bedeutung dieses Wörtchens giebt weder Carey
noch Judson an. Der Letztere sagt bloss, dass dasselbe mit hri (shi),
seyn, gleichgeltend (equivalent) sey. Dabei erscheint es aber sonderbar,
dass es zur Conjugation dieses Verbum selbst gebraucht wird. 74 Nach
Carey und Hough ist es auch Casuszeichen des Genitivs: lû-êng, des
Menschen. Judson hat diese Bedeutung nicht. 75 Dieses Schlusszeichen
wird aber, wie Carey versichert, im Gespräch selten gebraucht und auch
in Schriften findet es sich hauptsächlich in Uebersetzungen aus dem
Pali, ein Unterschied, der sich aus der Neigung des Barmanischen, die
Sätze der Rede an einander zu hängen, und dem regelmässigen Periodenbau
einer Tochtersprache des Sanskrit erklärt. Einen näheren
Grund, warum gerade Uebersetzungen aus dem Pali dies Hülfswort lieben,
glaube ich auch noch darin zu finden, dass die Pali-Sprache Participien
mit dem Verbum seyn zur Andeutung mehrerer Tempora verbindet
und alsdann immer das Hülfsverbum mit einiger Lautveränderung
nachfolgen lässt. 76 Die Barmanischen Uebersetzer konnten, sich genau
an die Worte haltend, ein Aequivalent dieses Hülfsverbum suchen und
dazu êng wählen. Deshalb ist aber dies Wort nicht weniger ein ächt Barmanisches,
kein dem Pali abgeborgtes. Eine treue Uebertragung der
Hülfsform des Pali war schon darum unmöglich, weil das Barmanische
Verbum nicht die Bezeichnung der Personen in sich aufnimmt. Eine Eigenheit
der Sprache ist es, dass dieses Schlusswort zwar hinter allen andren
Verbalformen, nicht aber hinter denen des Futurum gebraucht
werden kann. Die erwähnte Pali-Construction scheint sich vorzugsweise
bei Zeiten der Vergangenheit zu finden. Der Grund kann aber
schwerlich in der Natur der Partikeln des Futurum liegen, da diese
thang ohne Schwierigkeit zulassen. Carey, der eine lobenswürdige Aufmerksamkeit
auf die Unterscheidung der Participialformen und des
flectirten Verbum wendet, bemerkt, dass die befehlende und fragende
Form des Verbum die einzigen in der Sprache sind, welche einigen Anschein
dieses letzteren Redetheiles haben. 77 Diese scheinbare Ausnahme
liegt aber auch nur darin, dass die genannten Formen nicht mit Casuszeichen
verbunden werden können, mit welchen sich die ihnen
eigenthümlichen Partikeln nicht verbinden würden. Denn diese Partikeln
schliessen die Form und das verbindende thang steht bei den fragenden
Verben vor denselben, um sie selbst an die Tempuspartikeln anzuknüpfen.
Sehr ähnliche Beschaffenheit mit dem oben betrachteten thang hat
die Verbindungspartikel thau. Da es mir aber hier nur darauf ankommt,
den Charakter der Sprache im Ganzen anzugeben, so übergehe ich die
512einzelnen Punkte ihrer Uebereinstimmung und Verschiedenheit. Es
giebt noch andere Verbindungspartikeln, welche gleichfalls, ohne dem
Sinn etwas hinzuzufügen, an die Verbalform geheftet werden und alsdann
thang und thau von ihrer Stelle verdrängen. Einige von diesen
werden aber auch bei andren Gelegenheiten, als Bezeichnungen des
Conjunctivus gebraucht und nur der Zusammenhang der Rede verräth
ihre jedesmalige Bestimmung.
Die Folge der Theile des Satzes ist so, dass zuerst das Subject, dann
das Object, zuletzt aber das Verbum steht: Gott die Erde schuf, der
König zu seinem General sprach, er mir gab. Die Stelle des Verbum in
dieser Construction ist offenbar nicht die natürliche, da dieser Redetheil
sich in der Folge der Ideen zwischen Subject und Object stellt. Im
Barmanischen aber erklärt sie sich dadurch, dass das Verbum eigentlich
nur ein Participium ist, das erst später seinen Schlusssatz erwartet, und
auch eine Partikel in sich trägt, deren Bestimmung Verbindung mit etwas
Folgendem ist. Diese Verbalform nimmt nun, ohne als wirkliches
Verbum den Satz zu bilden, alles Vorhergehende in sich auf und trägt es
in das Nachfolgende über. Carey bemerkt, dass die Sprache vermöge
dieser Formen, soweit als es ihr gefällt, Sätze in einander verweben
kann, ohne zu einem Schlusse zu gelangen, und setzt hinzu, dass dies in
allen rein Barmanischen Werken in hohem Grade der Fall sey. Je mehr
nun der Schlussstein eines ganzen, in an einander gehängten Sätzen
fortlaufenden Raisonnements hinausgerückt wird, desto sorgfältiger
muss die Sprache seyn, die einzelnen Sätze immer mit jedem untergeordneten
Endwort abzuschliessen. Dieser Form bleibt sie nun auch
durchaus getreu und lässt immer die Bestimmung dem zu Bestimmenden
vorausgehen. Sie sagt daher nicht: der Fisch ist im Wasser, der Hirt
geht mit den Kühen, ich esse Reiss mit Butter gekocht, sondern: im
Wasser der Fisch ist, mit den Kühen der Hirt geht, ich mit Reiss gekocht
Butter esse. Auf diese Weise stellt sich an das Ende jedes Zwischensatzes
immer ein Wort, welches keine Bestimmung mehr nach sich zu erwarten
hat. Vielmehr geht regelmässig die weitere Bestimmung immer
der engeren voraus. Dies wird besonders deutlich in Uebersetzungen
aus andren Sprachen. Wenn es in der Englischen Bibel im Evangelium
Johannis 21, 2. heisst: and Nathanael of Cana in Galilee, so dreht die
Barmanische Uebersetzung den Satz um und sagt: Galiläa des Distrikts
Cana der Stadt Abkömmling Nathanael.
Ein anderes Mittel, viele Sätze mit einander zu verknüpfen, ist die
Verwandlung derselben in Theile eines Compositum, wo jeder einzelne
Satz ein dem Substantivum vorausgehendes Adjectivum bildet. In der
Redensart: ich preise Gott, welcher alle Dinge geschaffen hat, welcher
frei von Sünde ist u.s.f., wird jeder dieser, noch so zahlreichen Sätze
durch das oben schon in dieser Function betrachtete thau mit dem Substantivum,
513das aber erst dem letzten von ihnen nachfolgt, verbunden.
Diese einzelnen Relativsätze gehen also voran und werden mit dem auf
sie folgenden Substantivum als ein zusammengesetztes Wort angesehen;
das Verbum (ich preise) beschliesst den Satz. Zur Erleichterung
des Verständnisses sondert aber die Barmanische Schrift jedes einzelne
Element des langen Compositum durch ihr Interpunctionszeichen ab.
Die Regelmässigkeit dieser Stellung macht es eigentlich leicht, dem Periodenbaue
nachzugehen, wobei man nur, in Sätzen der beschriebenen
Art, vom Ende gegen den Anfang vorschreiten muss. Nur beim Hören
muss die Aufmerksamkeit schwierig angespannt werden, ehe sie erfährt,
wem die endlos vorangeschickten Praedicate gelten sollen. Vermuthlich
aber vermeidet die Umgangssprache so zahlreich an einander
gereihte Redensarten.
Es ist der Barmanischen Construction durchaus nicht eigen, die einzelnen
Theile der Perioden in gehöriger Absonderung dergestalt zu ordnen,
dass der regierte Satz dem regierenden nachfolgte. Sie sucht vielmehr
immer den ersteren in den letzteren aufzunehmen, wo er ihm
dann natürlich vorausgehen muss. Auf diese Weise werden in ihr ganze
Sätze wie einzelne Nomina behandelt. Um z.B. zu sagen: ich habe gehört,
dass du deine Bücher verkauft hast, dreht sie die Redensart um,
lässt in derselben deine Bücher vorangehen, hierauf das Perfectum des
Verbum verkaufen folgen und fügt nun diesem das Accusativzeichen
bei, an das sich wieder zuletzt ich habe gehört schliesst.
Wenn es der hier versuchten Zergliederung gelungen ist, die Bahn
richtig herauszufinden, auf welcher die Barmanische Sprache den Gedanken
in der Rede zusammenzufassen strebt, so sieht man, dass sie
sich zwar auf der einen Seite von dem gänzlichen Mangel grammatischer
Formen entfernt, allein auf der andren auch die Bildung derselben
nicht erreicht. Sie befindet sich insofern in der That in der Mitte zwischen
beiden Gattungen des Sprachbaues. Zu wahrhaft grammatischen
Formen zu gelangen, verhindert sie schon ihr ursprünglicher Wortbau,
da sie zu den einsylbigen Sprachen der zwischen China und Indien
wohnenden Volksstämme gehört. Zwar wirkt diese Eigenthümlichkeit
der Wortbildung nicht gerade dadurch auf den tieferen Bau dieser Sprachen
ein, dass jeder Begriff in einzelne eng verbundene Laute eingeschlossen
wird. Da aber in diesen Sprachen die Einsylbigkeit nicht zufällig
entsteht, sondern die Organe sie absichtlich und vermöge ihrer
individuellen Richtung festhalten, so ist mit ihr das einzelne Herausstossen
jeder Sylbe verbunden, was dann natürlich durch die Unmöglichkeit,
mit den materiell bedeutsamen Wörtern Beziehungsbegriffe
anzeigende Suffixa zu verschmelzen, in die innersten Tiefen des Sprachbaues
eingreift. Die Indo-Chinesischen Nationen, sagt Leyden, 78 haben
eine Menge von Pali-Wörtern in sich aufgenommen, sie passen sie aber
514alle ihrer eigenthümlichen Aussprache an, indem sie jede einzelne Sylbe
als ein besonderes Wort hervorstossen. Diese Eigenschaft also muss
man als die charakteristische Eigenthümlichkeit dieser Sprachen, so
wie der Chinesischen ansehen und bei den Untersuchungen über ihren
Bau fest im Auge behalten, wenn nicht sogar, da alle Sprache vom Laute
ausgeht, demselben zum Grunde legen. Mit ihr ist eine zweite, andren
Sprachen in viel geringerem Grade angehörende verbunden, die Vermannigfaltigung
und Vermehrung des Wortreichthums durch die den
Wörtern beigegebenen verschiedenen Accente. Die Chinesischen sind
bekannt; einige Indo-Chinesische Sprachen aber, namentlich die Siamesische
und Anam-Sprache besitzen eine so grosse Menge derselben,
dass es unsrem Ohre fast unmöglich ist, sie richtig zu unterscheiden.
Die Rede wird dadurch zu einer Art Gesang oder Recitativ und Low
vergleicht die Siamesischen vollkommen mit einer musikalischen Tonleiter. 79
Diese Accente geben zugleich zu noch grösseren und zahlreicheren
Dialektverschiedenheiten, als die wahren Buchstaben Veranlassung
und man versichert, dass in Anam jede irgend bedeutende
Ortschaft ihren eignen Dialekt hat und dass benachbarte, um sich zu
verständigen, bisweilen zu der geschriebenen Sprache ihre Zuflucht
nehmen müssen. 80 Die Barmanische Sprache besitzt zwei solcher Accente,
den in der Barmanischen Schrift mit zwei am Ende des Worts
über einander stehenden Punkten bezeichneten langen und sanften und
den durch einen unter das Wort gesetzten Punkt angedeuteten kurzen
und abgebrochnen. Rechnet man hierzu die accentlose Aussprache, so
lässt sich dasselbe Wort mit mehr oder minder verschiedener Bedeutung
in dreifacher Gestalt in der Sprache auffinden: pô, aufhalten, aufschütten,
überfüllen, ein langer ovaler Korb, pô:, an einander heften
oder binden, aufhängen, ein Insect, Wurm, pô, tragen, herbeibringen,
lehren, unterrichten, darbringen (wie einen Wunsch oder Segen), in
oder auf etwas geworfen werden; ñâ, ich, ñâː, fünf, ein Fisch. Nicht jedes
Wort aber ist dieser verschiednen Accentuation fähig. Einige Endvocale
nehmen keinen beider Accente, andere nur einen derselben an
und immer können sie nur sich an Wörter heften, die mit einem Vocal
oder nasalen Consonanten endigen. Dies letztere beweist deutlich, dass
sie Modificationen der Vocale sind und untrennbar mit ihnen zusammenhängen.
Wenn zwei Barmanische einsylbige Wörter als ein Compositum
zusammentreten, so verliert darum das erste seinen Accent nicht,
woraus sich wohl schliessen lässt, dass die Aussprache auch in Zusammensetzungen
die Sylben gleich besonderen Wörtern aus einander hält.
Man pflegt diese Accente dem Bedürfniss der einsylbigen Sprachen zuzuschreiben,
die Anzahl der möglichen Lautverbindungen zu vermehren.
Ein so absichtliches Verfahren ist aber kaum denkbar. Es scheint
umgekehrt viel natürlicher, dass diese mannigfaltigen Modificationen
515der Aussprache zuerst und ursprünglich in den Organen und den Lautgewohnheiten
der Völker lagen, dass, um sie deutlich austönen zu lassen,
die Sylben einzeln und mit kleinen Pausen dem Ohre zugezählt
wurden und dass eben diese Gewohnheit nicht zu der Bildung mehrsylbiger
Wörter einlud.
Die einsylbigen Indo-Chinesischen Sprachen haben daher auch,
ohne irgend eine historische Verwandtschaft unter ihnen vorauszusetzen,
mehrere Eigenschaften durch ihre Natur selbst sowohl mit einander,
als mit dem Chinesischen gemein. Ich bleibe jedoch hier nur bei der
Barmanischen stehen, da mir von den übrigen keine Hülfsmittel zu Gebote
stehen, welche hinreichende Data zu Untersuchungen, wie die gegenwärtigen
sind, darböten. 81 Von der Barmanischen Sprache muss
man zuerst zugestehen, dass sie niemals den Laut der Stammwörter
zum Ausdruck ihrer Beziehungen modificirt und die grammatischen
Kategorieen nicht zur Grundlage ihrer Redefügung macht. Denn wir
haben oben gesehen, dass sie dieselben nicht ursprünglich an den Wörtern
unterscheidet, dasselbe Wort mehreren zutheilt, die Natur des Verbum
verkennt und sogar eine Partikel dergestalt zugleich beim Verbum
und beim Nomen gebraucht, dass nur die Bedeutung des Worts und wo
auch diese nicht ausreicht, der Zusammenhang der Rede schliessen
lässt, welche beider Kategorieen gemeint ist. Das Princip ihrer Redefügung
ist, anzudeuten, welches Wort in der Rede das andere bestimmt.
Hierin kommt sie völlig mit der Chinesischen überein. 82 Sie hat, um nur
dies anzuführen, wie diese, unter ihren Partikeln eine nur zur Anordnung
der Construction bestimmte, zugleich und zu demselben Zwecke
trennende und verbindende; denn die Aehnlichkeit zwischen thang und
dem Chinesischen tchî in diesem Gebrauche in der Construction ist zu
auffallend, als dass sie verkannt werden könnte. 83 Dagegen weicht die
Barmanische Sprache wieder sehr bedeutend von der Chinesischen, sowohl
in dem Sinne, in welchem sie das Bestimmen nimmt, als in den
Mitteln der Andeutung ab. Das Bestimmen, von welchem hier die Rede
ist, begreift nemlich zwei Fälle unter sich, die es sehr wesentlich ist,
sorgfältig von einander zu unterscheiden: das Regiert-werden eines
Wortes durch das andre und die Vervollständigung eines von gewissen
Seiten unbestimmt gebliebenen Begriffs. Das Wort muss qualitativ seinem
Umfang und seiner Beschaffenheit nach und relativ seiner Causalität
nach als von andren abhängig oder selbst andre leitend begränzt
werden. 84 Die Chinesische Sprache unterscheidet in ihrer Construction
beide Fälle genau und wendet jeden da an, wo er wahrhaft hingehört.
Sie lässt das regierende Wort dem regierten vorangehen, das Subject
dem Verbum, dieses seinem directen Objecte, dies letztere endlich seinem
indirecten, wenn ein solches vorhanden ist. Hier lässt sich nicht
eigentlich sagen, dass das vorangehende Wort die Vervollständigung
516des Begriffs enthalte; vielmehr wird das Verbum sowohl durch das Subject,
als durch das Object, in deren Mitte es steht, in seinem Begriffe
vervollständigt und ebenso das directe Object durch das indirecte. Auf
der andren Seite lässt sie das vervollständigende Wort immer dem von
der Seite des Begriffs desselben noch unbestimmten vorausgehen, das
Adjectivum dem Substantivum, das Adverbium dem Verbum, den Genitiv
dem Nominativ, und beobachtet hierdurch wieder gewissermassen
ein dem im Vorigen entgegengesetztes Verfahren. Denn gerade dies
noch unbestimmte, hier nachstehende Wort ist das regierende und müsste
nach der Analogie des vorigen Falles, als solches, vorausgehen. Die
Chinesische Construction beruht also auf zwei grossen, allgemeinen,
aber in sich verschiedenen Gesetzen und thut sichtbar wohl daran, die
Beziehung des Verbum auf sein Object durch eine besondere Stellung
entschieden herauszuheben, da das Verbum in einem viel gewichtigeren
Sinne, als jedes andere Wort im Satze, regierend ist. Das erstere wendet
sie auf die Hauptgliederung des Satzes, das letztere auf seine Nebentheile
an. Hätte sie dieses dem ersteren nachgebildet, so dass sie Adjectivum,
Adverbium und Genitiv dem Substantivum, Verbum und Nominativ
nachfolgen liesse, so würde zwar die, gerade aus dem hier
entwickelten Gegensatz entspringende Concinnität der Satzbildung dadurch
leiden, auch die Stellung des Adverbium nach dem Verbum dasselbe
nicht deutlich vom Objecte zu unterscheiden erlauben; allein der
blossen Anordnung des Satzes selbst, der Uebereinstimmung zwischen
seinem Gange und dem inneren des Sprachsinnes geschähe dadurch
kein Eintrag. Das Wesentliche war, den Begriff des Regierens richtig
festzustellen, und an ihm hält die Chinesische Construction mit den
wenigen Ausnahmen fest, welche in allen Sprachen mehr oder weniger
Abweichungen von der gewöhnlichen Regel der Wortstellung rechtfertigen.
Die Barmanische Sprache unterscheidet jene zwei Fälle so gut als
gar nicht, bewahrt eigentlich nur Ein Constructionsgesetz und vernachlässigt
gerade das wichtigere von beiden. Sie lässt bloss das Subject dem
Object und Verbum voran-, das letztere aber dem Objecte nachgehen.
Durch diese Verkehrung macht sie es mehr als zweifelhaft, ob sie im
Voranschicken des Subjects den Zweck hat, es wirklich als regierend
darzustellen, und nicht vielmehr dasselbe als eine Vervollständigung
der nachfolgenden Satztheile ansieht. Das regierte Object wird offenbar
als eine vervollständigende Bestimmung des Verbum betrachtet, welches,
als an sich selbst unbestimmt, auf die vollständige Aufzählung aller
Bestimmungen durch sein Subject und Object folgt und den Satz
beschliesst. Dass Subject und Object wieder, jedes für sich, die sie vervollständigenden
Nebenbestimmungen vorn an sich anfügen, versteht
sich von selbst und ist aus den im Vorigen angeführten Beispielen klar.
Dieser Unterschied der Barmarnischen und Chinesischen Construction
517entspringt sichtbar aus der im Chinesischen liegenden richtigen
Ansicht des Verbum und der mangelhaften der Barmanischen Sprache.
Die Chinesische Construction verräth das Gefühl der wahren und eigenthümlichen
Function des Verbum. Sie drückt dadurch, dass sie dasselbe
in die Mitte des Satzes zwischen Subject und Object stellt, aus,
dass es ihn beherrscht und die Seele der ganzen Redefügung ist. Auch
von Lautmodificationen an demselben entblösst, giesst sie durch die
blosse Stellung über den Satz das Leben und die Bewegung aus, welche
vom Verbum ausgehen, und stellt das actuale Setzen des Sprachsinnes
dar oder verräth wenigstens das innere Gefühl desselben. Im Barmanischen
verhält sich dies alles durchaus auf andere Weise. Die Verbalformen
schwanken zwischen flectirtem Verbum und Participium, sind dem
materiellen Sinne nach eigentlich das letztere und können den formalen
nicht erreichen, da die Sprache für das Verbum selbst keine Form
besitzt. Denn seine wesentliche Function findet nicht allein keinen Ausdruck
in der Sprache, sondern die eigenthümliche Bildung der angeblichen
Verbalformen und ihr sichtbarer Anklang an das Nomen beweisen,
dass in den Sprechenden selbst alles lebendige Durchdringen des
Gefühls der wahren Kraft des Verbum mangelt. Bedenkt man auf der
andren Seite, dass die Barmanische Sprache das Verbum so ungleich
mehr, als die Chinesische durch Partikeln charakterisirt und vom Nomen
unterscheidet, so erscheint es um so wunderbarer, dass sie dasselbe
dennoch aus seiner wahren Kategorie herausrückt. Unläugbar aber ist
es nicht bloss so, sondern die Erscheinung wird auch dadurch erklärlicher,
dass die Sprache das Verbum bloss nach Modificationen, die auch
materiell genommen werden können, bezeichnet, ohne nur eine Ahndung
des in ihm lediglich Formalen zu verrathen. Die Chinesische Sprache
bedient sich dieser materiellen Andeutung selten, enthält sich derselben
oft gänzlich, erkennt aber in der richtigen Stellung der Wörter
eine unsichtbar an der Rede hängende Form an. Man könnte sagen,
dass, je weniger sie äussere Grammatik besitzt, desto mehr ihr innere
beiwohne. Wo grammatische Ansicht in ihr durchdringt, ist es die logisch
richtige. Diese trug ihre erste Anordnung in sie hinein und sie
musste sich durch den Gebrauch des so richtig gestimmten Instrumentes
im Geiste des Volks fortbilden. Man kann gegen das so eben hier
Vorgetragene einwenden, dass auch die Flexionssprachen gar nicht ungewöhnlich
das Verbum seinem Objecte nachsetzen und dass die Barmanische
die Casus des Nomen durch eigne Partikeln, wie jene, kenntlich
erhält. Da aber die Sprache in vielen andren Punkten deutlich zeigt,
dass ihr keine klare Vorstellung der Redetheile zum Grunde liegt, sondern
dass sie in ihren Fügungen nur die Modificirung der Wörter durch
einander verfolgt, so ist sie in der That von jener, das wahre Wesen der
Satzbildung verkennenden Ansicht nicht freizusprechen. Sie beweist
518dies auch durch die Unverbrüchlichkeit, mit der sie ihr angebliches Verbum
immer an das Ende des Satzes verweist. Dies springt um so deutlicher
in die Augen, als auch aus dem zweiten, schon oben angegebnen
Grunde dieser Stellung, an die Verbalform wieder einen neuen Satz anknüpfen
zu können, klar wird, dass sie weder von der eigentlichen Natur
des Periodenbaues noch von der darin geschäftigen Kraft des Verbum
durchdrungen ist. Sie hat einen sichtbaren Mangel an Partikeln,
die, gleich unsren Conjunctionen, durch die Verschlingung der Sätze
den Perioden Leben und Mannigfaltigkeit ertheilen. Die Chinesische,
welche auch hier das allgemeine Gesetz ihrer Wortstellung beobachtet,
indem sie, wie den Genitiv dem Nominativ, so den näher bestimmenden
und vervollständigenden Satz dem durch ihn modificirten vorausgehen
lässt, ist ihr hierin weit überlegen. In der Barmanischen laufen die Sätze
gleichsam in gerader Linie an einander fort. Allein selbst so sind sie
selten durch solche verbindenden Conjunctionen an einander gereiht,
welche, wie unser und, jedem seine Selbstständigkeit erhalten. Sie verbinden
sich auf eine den materiellen Inhalt mehr in einander verwebende
Weise. Dies liegt schon in der, gewöhnlich am Ende jedes solcher
fortlaufenden Sätze gebrauchten Partikel thang, die, indem sie das Vorhergehende
zusammennimmt, es immer zugleich zum Verständniss des
zunächst Folgenden anwendet. Dass hieraus eine gewisse Schwerfälligkeit,
bei der ausserdem ermüdende Gleichförmigkeit unvermeidlich
scheint, entstehen muss, fällt in die Augen.
In den Mitteln zur Andeutung der Wortfolge stimmen beide Sprachen
darin überein, dass sie sich zugleich der Stellung und besonderer
Partikeln bedienen. Die Barmanische bedürfte eigentlich nicht so strenger
Gesetze der ersteren, da eine grosse Anzahl, die Beziehungen andeutender
Partikeln das Verständniss hinreichend sichert. Sie bewahrt
aber zugleich noch gewissenhafter die einmal übliche Stellung und ist
nur in der Anordnung derselben in Einem Punkte nicht gleich consequent,
da sie das Adjectivum vor und hinter das Substantivum zu setzen
erlaubt. Indem aber die erstere dieser Stellungen immer der Hinzukunft
einer der zur Bestimmung der Wortfolge nöthigen Partikeln bedarf, so
sieht man hieraus, dass die zweite als die eigentlich natürliche betrachtet
wird, und dies muss man wohl als eine Folge des Umstandes ansehen,
dass Adjectiv und Substantiv ein Compositum zusammen ausmachen,
in welchem man die, wenn das Adjectivum vorausgeht, ihm nie
beigegebene Casusbeugung auch nur als dem in seiner Bedeutung
durch das Adjectivum modificirten Substantivum angehörig betrachten
muss. In ihren Compositis nun, sowohl der Nomina als der Verba, lässt
die Sprache gewöhnlich das ihr jedesmal als Gattungsbegriff geltende
Wort im ersten Gliede vorangehen und das specificirende (insofern, als
es auf mehrere Gattungen Anwendung finden kann) allgemeinere im
519zweiten nachfolgen. So bildet sie Modi der Verba, mit vorausgehendem
Worte Fisch eine grosse Anzahl von Fischnamen u. s. w. Wenn sie in andren
Fällen den entgegengesetzten Weg zu nehmen scheint, Wörter von
Handwerkern durch das allgemeine verfertigen, das als zweites Glied
hinter den Namen ihrer Werkzeuge steht, bildet, bleibt man zweifelhaft,
ob sie wirklich hierin einer andren Methode oder nur einer andren Ansicht
von dem, was ihr jedesmal als Gattungsbegriff gilt, folgt. Ebenso
nun behandelt sie in der Verbindung des nachfolgenden Adjectivum
dieses als einen Gattungsbegriff specificirend. Die Chinesische Sprache
bleibt auch hier ihrem allgemeinen Gesetze treu; das Wort, dem eine
speciellere Bestimmung zugehen soll, macht auch im Compositum das
letzte Glied aus. Wenn auf eine, an sich allerdings wenig natürliche
Weise das Verbum sehen zur Bildung oder vielmehr an der Stelle des
Passivum gebraucht wird, so geht es dem Hauptbegriffe vorauf: sehen
tödten, d. i. getödtet werden. Da so viele Dinge gesehen werden können,
so müsste eigentlich tödten vorausgehen. Die umgekehrte Stellung zeigt
aber, dass hier sehen als eine Modification des folgenden Wortes, mithin
als ein Zustand des Tödtens gedacht werden soll, und dadurch wird in
der, auf den ersten Anblick befremdenden Redensart auf eine sinnreich
feine Weise das grammatische Verhältniss angedeutet. Auf ähnliche Art
werden Ackersmann, Bücherhaus u.s.f. gebildet.
In Uebereinstimmung mit einander kommen die Barmanische und
Chinesische Sprache in der Redefügung der Wortstellung durch Partikeln
zu Hülfe. Beide gleichen einander auch darin, dass sie einige dieser
Partikeln dergestalt bloss zur Andeutung der Construction bestimmen,
dass dieselben der materiellen Bedeutung nichts hinzufügen. Doch liegt
gerade in diesen Partikeln der Wendepunkt, in welchem die Barmanische
Sprache den Charakter der Chinesischen verlässt und einen eignen
annimmt. Die Sorgfalt, die Beziehung, in der ein Wort mit dem andren
zusammengedacht werden soll, durch vermittelnde Begriffe zu bezeichnen,
vermehrt die Zahl dieser Partikeln und bringt in ihnen eine gewisse,
wenn auch allerdings nicht ganz systematische Vollständigkeit hervor.
Die Sprache zeigt aber auch ein Bestreben, diese Partikeln in
grössere Nähe mit dem Stammworte, als mit den übrigen Wörtern des
Satzes zu bringen. Wahre Worteinheit kann allerdings bei der sylbentrennenden
Aussprache und nach dem ganzen Geiste der Sprache nicht
statt finden. Wir haben aber doch gesehen, dass in einigen Fällen die
Einwirkung eines Wortes eine Consonantenveränderung in dem unmittelbar
daran gehängten hervorbringt, und bei den Verbalformen schliessen
die endenden Partikeln thang und êng die Verbalpartikeln mit dem
Stammwort in ein Ganzes zusammen. In einem einzelnen Falle entsteht
sogar eine Zusammenziehung zweier Sylben in Eine, was schon in Chinesischer
Schrift nur phonetisch, also fremdartig dargestellt werden
520könnte. Ein Gefühl der wahren Natur der Suffixa liegt auch darin, dass
selbst diejenigen unter diesen Partikeln, welche als bestimmende Adjectiva
angesehen werden könnten, wie die Pluralzeichen, nie dem Stammworte
vorausgehen, sondern immer nachfolgen. Im Chinesischen ist
nach Verschiedenheit der Pluralpartikeln bald die eine, bald die andre
Stellung üblich.
In dem Grade, in welchem sich die Barmanische Sprache von dem
Chinesischen Baue entfernt, nähert sie sich dem Sanskritischen. Es würde
aber überflüssig seyn, noch im speciellen zu schildern, welche wahre
Kluft sie wieder von diesem trennt. Der Unterschied liegt hierbei nicht
bloss in der mehr oder weniger engen Anschliessung der Partikeln an
das Hauptwort. Er geht ganz besonders aus der Vergleichung derselben
mit den Suffixen der Indischen Sprache hervor. Jene sind ebenso bedeutsame
Wörter, als alle andren der Sprache, wenn auch die Bedeutung
allerdings meistentheils schon in der Erinnerung des Volkes erloschen
ist. Diese sind grösstentheils subjective Laute, geeignet zu auch
nur inneren Beziehungen. Ueberhaupt kann man die Barmanische Sprache,
wenn sie auch in der Mitte zwischen den beiden andren zu stehen
scheint, doch niemals als einen Uebergangspunkt von der einen zur andren
ansehen. Das Leben jeder Sprache beruht auf der inneren Anschauung
des Volkes von der Art, den Gedanken in Laute zu hüllen.
Diese aber ist in den drei hier verglichenen Sprachstämmen durchaus
eine verschiedene. Wenn auch die Zahl der Partikeln und die Häufigkeit
ihres Gebrauchs eine stufenweis gesteigerte Annäherung zur grammatischen
Andeutung vom alten Styl des Chinesischen durch den neueren
hindurch bis zum Barmanischen verräth, so ist doch die letztere dieser
Sprachen von der ersteren gänzlich durch ihre Grundanschauung, die
auch im neueren Styl der Chinesischen wesentlich dieselbe bleibt, verschieden.
Die Chinesische stützt sich allein auf die Wortstellung und
auf das Gepräge der grammatischen Form im Inneren des Geistes. Die
Barmanische beruht in ihrer Redefügung nicht auf der Wortstellung,
obgleich sie mit noch grösserer Festigkeit an der ihrer Vorstellungsweise
gemässen hängt. Sie vermittelt die Begriffe durch neue hinzugefügte
und wird hierauf selbst durch die ihr eigne, ohne dies Hülfsmittel der
Zweideutigkeit ausgesetzte Stellung nothwendig geführt. Da die vermittelnden
Begriffe Ausdrücke der grammatischen Formen seyn müssen,
so stellen sich allerdings auch die letzteren in der Sprache heraus.
Die Anschauung derselben ist aber nicht gleich klar und bestimmt, als
im Chinesischen und im Sanskrit; nicht wie im ersteren, weil sie eben
jene Stütze vermittelnder Begriffe besitzt, welche die Notwendigkeit
der wahren Concentration des Sprachsinnes vermindert; nicht wie im
Sanskrit, weil sie nicht die Laute der Sprache beherrscht, nicht bis zur
Bildung wirklicher Worteinheit und ächter Formen durchdringt. Auf
521der andren Seite kann man das Barmanische auch nicht zu den agglutinirenden
Sprachen rechnen, da es in der Aussprache die Sylben im Gegentheil
geflissentlich aus einander hält. Es ist reiner und consequenter
in seinem Systeme, als jene Sprachen, wenn es sich auch eben dadurch
noch mehr von aller Flexion entfernt, die doch in den agglutinirenden
Sprachen auch nicht aus den eigentlichen Quellen fliesst, sondern nur
eine zufällige Erscheinung ist.
Das Sanskrit oder von ihm herstammende Dialekte haben sich mehr
oder weniger den Sprachen aller Indien umgebenden Völker beigesellt
und es ist anziehend, zu sehen, wie sich durch diese, mehr vom Geiste
der Religion und der Wissenschaft, als von politischen und Lebensverhältnissen
ausgehenden Verbindungen die verschiedenen Sprachen gegen
einander stellen. In Hinter-Indien ist nun das Pali, also eine um viele
Lautunterscheidungen der Formen gekommene Flexionssprache zu
Sprachen hinzugetreten, die in wesentlichen Punkten mit der Chinesischen
übereinstimmen, gerade also da und dahin, wo der Gegensatz reicher
grammatischer Andeutung mit fast gänzlichem Mangel derselben
am grössten ist. Ich kann nicht der Ansicht beistimmen, dass die Barmanische
Sprache in ihrer ächten Gestalt, und soweit sie der Nation
selbst angehört, irgend wesentlich durch das Pali anders gemodelt worden
ist. Die mehrsylbigen Wörter sind in ihr aus dem eigenthümlichen
Hange zur Zusammensetzung entstanden, ohne des Vorbildes des Pali
bedurft zu haben, und ebenso gehört ihr allein der sich den Formen nähernde
Partikelgebrauch an. Die Pali-Kundigen haben die Sprache nur
mit ihrem grammatischen Gewande äusserlich umkleidet. Dies sieht
man an der Vielfachheit der Casuszeichen und an den Classen der zusammengesetzten
Wörter. Was sie hier den Sanskritischen Karmadhâraya
gleichstellen, ist gänzlich davon verschieden, da das Barmanische
vorausgehende Adjectivum immer einer anknüpfenden Partikel
bedarf. An das Verbum scheinen sie, nach Carey's Grammatik zu urtheilen,
ihre Terminologie nicht einmal anzulegen gewagt zu haben.
Dennoch ist nicht die Möglichkeit zu läugnen, dass durch fortgesetztes
Studium des Pali der Styl und insofern auch der Charakter der Sprache
zur Annäherung an das Pali verändert seyn kann und immer mehr verändert
werden könnte. Die wahrhaft körperliche, auf den Lauten beruhende
Form der Sprachen gestattet eine solche Einwirkung nur innerhalb
sehr gemessener Gränzen. Dagegen ist einer solchen die innere
Anschauung der Form sehr zugänglich und die grammatischen Ansichten,
ja selbst die Stärke und Lebendigkeit des Sprachsinnes werden
durch die Vertraulichkeit mit vollkommneren Sprachen berichtigt und
erhöht. Dies wirkt alsdann auf die Sprache insoweit zurück, als sie dem
Gebrauche Herrschaft über sich verstattet. Im Barmanischen nun würde
diese Rückwirkung vorzugsweise stark seyn, da Haupttheile des
522Baues desselben sich schon dem Sanskritischen nähern und ihnen nur
vorzüglich fehlt, in dem rechten Sinne genommen zu werden, zu dem
die Sprache an sich nicht zu führen vermag, da sie nicht aus diesem Sinne
entstanden ist. Hierin nun käme ihr die fremde Ansicht zu Hülfe.
Man dürfte zu diesem Behufe nur allmählich die gehäuften Partikeln
mit Wegwerfung mehrerer bestimmten grammatischen Formen aneignen,
in der Construction häufiger das vorhandene Hülfsverbum gebrauchen
u.s.w. Allein bei dem sorgfältigsten Bemühen dieser Art wird es
nie gelingen, zu verwischen, dass der Sprache doch eine ganz verschiedene
Form eigenthümlich ist, und die Erzeugnisse eines solchen Verfahrens
würden immer Un-Barmanisch klingen, da, um nur diesen einen
Punkt herauszuheben, die mehreren für eine und dieselbe Form vorhandnen
Partikeln nicht gleichgültig, sondern nach feinen, im Sprachgebrauch
liegenden Nüancen Anwendung finden. Immer also würde
man erkennen, dass der Sprache etwas ihr Fremdartiges eingeimpft
worden sey.
Historische Verwandtschaft scheint nach allen Zeugnissen zwischen
dem Barmanischen und Chinesischen nicht vorhanden zu seyn. Beide
Sprachen sollen nur wenige Wörter mit einander gemein haben. Dennoch
weiss ich nicht, ob dieser Punkt nicht einer mehr sorgfältigen Prüfung
bedürfte. Auffallend ist die grosse Lautähnlichkeit einiger, gerade
aus der Classe der grammatischen genommener Wörter. Ich setze diese
für tiefere Kenner beider Sprachen hier her. Die Barmanischen Pluralzeichen
der Nomina und Verba lauten tô und kra (gesprochen kya) und
toû und kiâi sind Chinesische Pluralzeichen im alten und neuen Styl;
thang (gesprochen thi H.) entspricht, wie wir schon oben gesehen, dem
ti des neueren und dem tchî des älteren Styls; hri (gesprochen shi) ist
das Verbum seyn und ebenso im Chinesischen bei Rémusat chi. Morrison
und Hough schreiben beide Wörter nach Englischer Weise ganz
gleichförmig she. Das Chinesische Wort ist allerdings zugleich ein Pronomen
und eine Bejahungspartikel, so dass seine Verbalbedeutung
wohl nur daher entnommen ist. Dieser Ursprung würde aber der Verwandtschaft
beider Wörter keinen Eintrag thun. Endlich lautet der in
beiden Sprachen bei der Angabe gezählter Gegenstände gebrauchte allgemeine,
hierin unsrem Worte Stück ähnliche Gattungsausdruck im
Barmanischen hku und im Chinesischen ko. 85 Ist die Zahl dieser Wörter
auch gering, so gehören sie gerade zu den am meisten die Verwandtschaft
beider Sprachen verrathenden Theilen des Baues derselben und
auch die Verschiedenheiten zwischen der Chinesischen und Barmanischen
Grammatik sind, wenn auch gross und tief in den Sprachbau
eingreifend, doch nicht von der Art, dass sie, wie z. B. zwischen dem
Barmanischen und Tagalischen, Verwandtschaft unmöglich machen
sollten.523
38. Ganz nahe an die so eben angestellten Untersuchungen schliesst
sich die Frage an: ob der Unterschied zwischen ein- und mehrsylbigen
Sprachen ein absoluter oder nur ein dem Grade nach relativer ist und
ob diese Form der Wörter wesentlich den Charakter der Sprachen bildet
oder die Einsylbigkeit nur ein Uebergangszustand ist, aus welchem
sich die mehrsylbigen Sprachen nach und nach herausgebildet haben?
In früheren Zeiten der Sprachkunde erklärte man die Chinesische
und mehrere südöstliche Asiatische Sprachen geradehin für einsylbig.
Späterhin wurde man hierüber zweifelhaft und Abel-Rémusat bestritt
diese Behauptung ausdrücklich vom Chinesischen. 86 Diese Ansicht
schien aber doch zu sehr gegen die vor Augen liegende Thatsache zu
streiten und man kann wohl mit Grunde behaupten, dass man jetzt und
nicht mit Unrecht zur früheren Annahme zurückgekehrt ist. Dem ganzen
Streite liegen indess mehrere Misverständnisse zum Grunde und es
bedarf daher zuerst einer gehörigen Bestimmung desjenigen, was man
einsylbige Wortform nennt, und des Sinnes, in welchem man ein- und
mehrsylbige Sprachen unterscheidet. Alle von Rémusat angeführten
Beispiele der Mehrsylbigkeit des Chinesischen laufen auf Zusammensetzungen
hinaus und es kann wohl kein Zweifel seyn, dass Zusammensetzung
ganz etwas andres, als ursprüngliche Mehrsylbigkeit ist. In der
Zusammensetzung entsteht auch der durchaus als einfach betrachtete
Begriff doch aus zwei oder mehreren, mit einander verbundenen. Das
sich hieraus ergebende Wort ist also nie ein einfaches und eine Sprache
hört darum nicht auf, eine einsylbige zu seyn, weil sie zusammengesetzte
Wörter besitzt. Es kommt offenbar auf solche einfache an, in welchen
sich keine, den Begriff bildenden Elementarbegriffe unterscheiden
lassen, sondern wo die Laute zweier oder mehrerer, an sich bedeutungsloser
Sylben das Begriffszeichen ausmachen. Selbst wenn man Wörter
findet, bei welchen dies scheinbar der Fall ist, erfordert es immer genauere
Untersuchung, ob nicht doch jede einzelne Sylbe ursprünglich
eine, nur in ihr verloren gegangene eigenthümliche Bedeutung besass.
Ein richtiges Beispiel gegen die Einsylbigkeit einer Sprache müsste den
Beweis in sich tragen, dass alle Laute des Wortes nur gemeinschaftlich
und zusammen, nicht abgesondert für sich bedeutsam sind. Dies hat
Abel-Rémusat allerdings nicht klar genug vor Augen gehabt und darum
in der That die originelle Gestaltung des Chinesischen in der oben angeführten
Abhandlung verkannt. 87 Von einer andren Seite her aber gründete
sich Rémusat's Meinung doch auf etwas Wahres und richtig Gesehenes.
Er blieb nemlich bei der Eintheilung der Sprachen in ein- und
mehrsylbige stehen und es entgieng seinem Scharfblicke nicht, dass
diese, wie sie gewöhnlich verstanden wird, allerdings nicht genau zu
nehmen ist. Ich habe schon im Vorigen bemerkt, dass eine solche Eintheilung
nicht auf der blossen Thatsache des Vorherrschens ein- und
524mehrsylbiger Wörter beruhen kann, sondern dass ihr etwas viel Wesentlicheres
zum Grunde liegt, nemlich der doppelte Umstand des Mangels
der Affixa und die Eigenthümlichkeit der Aussprache, auch da, wo der
Geist die Begriffe verbindet, dennoch die Sylbenlaute getrennt zu erhalten.
Die Ursache des Mangels der Affixa liegt tiefer und wirklich im
Geiste. Denn wenn dieser lebendig das Abhängigkeitsverhältniss des
Affixum zum Hauptbegriff empfindet, so kann die Zunge unmöglich
dem ersteren gleiche Lautgeltung in einem eigenen Worte geben. Verschmelzung
zweier verschiedener Elemente zur Einheit des Wortes ist
eine nothwendige und unmittelbare Folge jener Empfindung. Rémusat
scheint mir daher nur darin gefehlt zu haben, dass er, anstatt die Einsylbigkeit
des Chinesischen anzugreifen, nicht vielmehr zu zeigen versuchte,
dass auch die übrigen Sprachen von einsylbigem Wurzelbau ausgehen
und nur, theils auf dem ihnen eigenthümlichen Wege der
Affigirung, theils auf dem, auch dem Chinesischen nicht fremden der
Zusammensetzung, zur Mehrsylbigkeit gelangen, dies Ziel aber, da ihnen
nicht, wie im Chinesischen, die oben genannten Hindernisse im
Wege standen, wirklich erreichen. Diese Bahn nun will ich hier einschlagen
und an dem Faden thatsächlicher Untersuchung einiger hier
vorzüglich in Betrachtung zu ziehender Sprachen verfolgen.
So schwer und zum Theil unmöglich es auch ist, die Wörter bis zu
ihrem wahren Ursprunge zurückzuführen, so leitet uns doch sorgfältig
angestellte Zergliederung in den meisten Sprachen auf einsylbige Stämme
hin und die einzelnen Fälle des Gegentheils können nicht als Beweise
auch ursprünglich mehrsylbiger gelten, da die Ursach der Erscheinung
mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit in nicht weit genug
fortgesetzter Zergliederung gesucht werden kann. Man geht aber auch,
wenn man die Frage bloss aus Ideen betrachtet, wohl nicht zu weit, indem
man allgemein annimmt, dass ursprünglich jeder Begriff nur durch
Eine Sylbe bezeichnet wurde. Der Begriff in der Spracherfindung ist der
Eindruck, welchen das Object, ein äusseres oder inneres, auf den Menschen
macht, und der durch die Lebendigkeit dieses Eindrucks der
Brust entlockte Laut ist das Wort. Auf diesem Wege können nicht leicht
zwei Laute Einem Eindruck entsprechen. Wenn wirklich zwei Laute,,
unmittelbar auf einander folgend, entständen, so bewiesen sie zwei von
demselben Object ausgehende Eindrücke und bildeten Zusammensetzung
schon in der Geburt des Wortes, ohne dass dadurch der Grundsatz
der Einsylbigkeit beeinträchtigt würde. Dies ist in der That bei der in
allen Sprachen, vorzugsweise aber in den ungebildeteren sich findenden
Verdoppelung der Fall. Jeder der wiederholten Laute spricht das ganze
Object aus; durch die Wiederholung aber tritt dem Ausdrucke eine
Nüance mehr hinzu, entweder blosse Verstärkung, als Zeichen der höheren
Lebendigkeit des erfahrnen Eindrucks, oder Anzeigen des sich
525wiederholenden Objects, weshalb die Verdoppelung vorzüglich bei Adjectiven
statt findet, da bei der Eigenschaft das besonders auffällt, dass
sie nicht als einzelner Körper, sondern gleichsam als Fläche überall in
demselben Raume erscheint. Wirklich gehört in mehreren Sprachen,
von denen ich hier nur die der Südsee-Inseln anführen will, die Verdoppelung
vorzugsweise, ja fast ausschliesslich den Adjectiven und den aus
ihnen gebildeten, also ursprünglich adjectivisch empfundenen Substantiven
an. Denkt man sich freilich die ursprüngliche Sprachbezeichnung
als ein absichtliches Vertheilen der Laute unter die Gegenstände, so erscheint
allerdings die Sache bei weitem anders. Die Sorgfalt, verschiedenen
Begriffen nicht ganz gleiche Zeichen zu geben, könnte dann die
wahrscheinlichste Ursach seyn, dass man einer Sylbe, durchaus unabhängig
von einer neuen Bedeutsamkeit, eine zweite und dritte hinzugefügt
hätte. Allein diese Vorstellungsart, bei der man gänzlich vergisst,
dass die Sprache kein todtes Uhrwerk, sondern eine lebendige Schöpfung
aus sich selbst ist und dass die ersten sprechenden Menschen bei
weitem sinnlicher erregbar waren als wir, abgestumpft durch Cultur
und auf fremder Erfahrung beruhende Kenntniss, ist offenbar eine falsche.
Alle Sprachen enthalten wohl Wörter, die durch ganz verschiedene
Bedeutung bei ganz gleichem Laute Zweideutigkeit zu erregen im
Stande sind. Dass dies aber selten ist und in der Regel jedem Begriff ein
anders nüancirter Laut entspricht, entstand gewiss nicht aus absichtlicher
Vergleichung der schon vorhandenen Wörter, welche dem Sprechenden
nicht einmal gegenwärtig seyn konnten, sondern daraus, dass
sowohl der Eindruck des Objects, als der durch ihn hervorgelockte Laut
immer individuell war und keine Individualität vollständig mit der andren
übereinkommt. Von einer andren Seite aus wurde allerdings der
Wortvorrath auch durch Erweiterung der einzelnen vorhandnen Bezeichnungen
vermehrt. Wie der Mensch mehr Gegenstände und die einzelnen
genauer kennen lernte, bot sich ihm bei vielen besondere Verschiedenheit
bei allgemeiner Aehnlichkeit dar und dieser neue Eindruck
bewirkte natürlich einen neuen Laut, der, an den vorigen geknüpft, zum
mehrsylbigen Worte wurde. Aber auch hier sind verbundene Begriffe
mit verbundenen Lauten als Bezeichnungen eines und ebendesselben
Objects. Aufs höchste könnte man, was die ursprüngliche Bezeichnung
anbetrifft, es für möglich halten, dass die Stimme bloss aus sinnlichem
Gefallen am Rauschen der Töne ganz bedeutungslose hinzugefügt hätte
oder dass bloss auslautende Hauche bei mehr geregelter Aussprache zu
wahren Sylben geworden wären. Dass Laute in der That ohne alle Bedeutsamkeit
sich in Sprachen bloss sinnlich erhalten, möchte ich nicht
in Abrede stellen; allein dies ist nur darum der Fall, weil ihre Bedeutsamkeit
verloren gegangen ist. Ursprünglich stösst die Brust keinen articulirten
Laut aus, den nicht eine Empfindung geweckt hat.526
Im Verlaufe der Zeit verhält es sich überhaupt auch anders mit der
Mehrsylbigkeit. Man kann sie, als Thatsache in den ausgebildeten Sprachen
nicht abläugnen, man bestreitet sie nur bei den Wurzeln und ausserhalb
dieses Kreises beruht sie durch ihren, im Ganzen anzunehmenden
und sehr häufig im Einzelnen nachzuweisenden Ursprung auf
Zusammensetzung und verliert dadurch ihre eigenthümliche Natur.
Denn nicht bloss weil uns die Bedeutung der einzelnen Wortelemente
fehlt, erscheinen sie uns als bedeutungslose, sondern es liegt der Erscheinung
auch oft etwas Positives zum Grunde. Die Sprache verbindet
zuerst einander wirklich modificirende Begriffe. Dann knüpft sie an einen
Hauptbegriff einen andren, nur metaphorisch oder nur mit einem
Theile seiner Bedeutung geltenden, wie wenn die Chinesische, um bei
Verwandtschaften den Unterschied des Aelteren oder Jüngeren anzudeuten,
das Wort Sohn in zusammengesetzten Verwandtschaftsnamen
da braucht, wo weder die directe Abstammung noch das Geschlecht,
sondern einzig das Nachstehen im Alter passt. Waren nun einige solche
Begriffe wegen der, durch ihre grössere Allgemeinheit gegebenen Möglichkeit
dazu häufig Wortelemente zur Specificirung von Begriffen geworden,
so gewöhnt sich die Sprache auch wohl, sie da anzuwenden,
wo ihre Beziehung nur eine ganz entfernte, kaum nachzuspürende ist
oder wo man frei gestehen muss, dass gar keine wirkliche Beziehung
vorliegt und daher die Bedeutsamkeit in der That in Nichts aufgeht.
Diese Erscheinung, dass die Sprache, einer allgemeinen Analogie folgend,
Laute von Fällen, wo sie wahrhaft hingehören, auf andere, denen
sie fremd sind, anwendet, findet sich auch in anderen Theilen ihres Verfahrens.
So ist nicht zu läugnen, dass in mehreren Flexionen der Sanskrit-Declination
Pronominalstämme verborgen sind, dass aber in einigen
dieser Fälle sich wirklich kein Grund auffinden lässt, warum gerade
dieser und kein anderer Stamm diesem oder jenem Casus beigegeben
ist, ja nicht einmal sagen, wie überhaupt ein Pronominalstamm den
Ausdruck dieses bestimmten Casusverhältnisses ausmachen kann. Es
mag allerdings auch in denjenigen solcher Fälle, die uns die schlagendsten
zu seyn scheinen, noch ganz individuelle, fein aufgefasste Verbindungen
zwischen dem Begriffe und dem Laute geben. Diese sind aber
alsdann so von allgemeiner Nothwendigkeit entblösst und so sehr, wenn
auch nicht zufällig, doch nur historisch erkennbar, dass für uns selbst
ihr Daseyn verloren geht. Der Einverleibung fremder mehrsylbiger
Wörter aus einer Sprache in die andere erwähne ich hier mit Absicht
nicht, da, wenn die hier aufgestellte Behauptung ihre Richtigkeit hat,
die Mehrsylbigkeit solcher Wörter niemals ursprünglich ist und die Bedeutungslosigkeit
ihrer einzelnen Elemente für die Sprache, welcher sie
zuwachsen, bloss eine relative bleibt.
Es giebt aber in den nicht einsylbigen Sprachen, nur allerdings in
527sehr verschiedenem Grade auch ein, aus zusammentreffenden inneren
und äusseren Ursachen entspringendes Streben nach reiner Mehrsylbigkeit
ohne Rücksicht auf den noch bekannten oder in Dunkel verschwundenen
Ursprung derselben aus Zusammensetzung. Die Sprache
verlangt alsdann Lautumfang als Ausdruck einfacher Begriffe und lässt
in diesen die in ihnen verbundenen Elementarbegriffe aufgehen. Auf
diesem zwiefachen Wege entsteht dann die Bezeichnung Eines Begriffs
durch mehrere Sylben. Denn wie die Chinesische Sprache der Mehrsylbigkeit
widerstrebt und wie ihre, sichtbar aus diesem Widerstreben hervorgegangene
Schrift sie in demselben bestätigt, so haben andere Sprachen
die entgegengesetzte Neigung. Durch Gefallen an Wohllaut und
durch Streben nach rhythmischen Verhältnissen gehen sie auf Bildung
grösserer Wortganzen hin und unterscheiden weiter, ein inneres Gefühl
hinzunehmend, die blosse, lediglich durch die Rede entstehende Zusammensetzung
von derjenigen, die mit dem Ausdruck eines einfachen
Begriffs durch mehrere Sylben, deren einzelne Bedeutung nicht mehr
bekannt ist oder nicht mehr beachtet wird, verwechselt werden kann.
Wie aber Alles in der Sprache immer innig verbunden ist, so ruht auch
dies, zuerst bloss sinnlich scheinende Streben auf einer breiteren und
festeren Basis. Denn die Richtung des Geistes, den Begriff und seine
Beziehungen in die Einheit desselben Wortes zu verknüpfen, wirkt offenbar
dazu mit, die Sprache mag nun, als wahrhaft flectirende dies
Ziel wirklich erreichen oder, als agglutinirende auf halbem Wege stehen
bleiben. Die schöpferische Kraft, mit welcher die Sprache selbst, um
mich eines figürlichen Ausdrucks zu bedienen, aus der Wurzel alles das
hervortreibt, was zur inneren und äusseren Bildung der Wortform gehört,
ist hier das ursprünglich Wirkende. Je weiter sich diese Schöpfung
erstreckt, desto grösser, je früher sie ermattet, desto geringer ist der
Grad jenes Strebens. In dem aus demselben entspringenden Lautumfang
des Wortes bestimmt aber die vollendete Abrundung dieses Strebens
nach Wohllautsgesetzen die nothwendige Gränze. Gerade die in
der Verschmelzung der Sylben zur Einheit minder glücklichen Sprachen
reihen eine grössere Anzahl derselben unrhythmisch an einander,
da das vollendete Einheitsstreben wenigere harmonisch zusammenschliesst.
So eng und genau mit einander übereinstimmend ist auch hier
das innere und äussere Gelingen. Durch die Begriffe selbst aber wird in
vielen Fällen ein Bemühen veranlasst, einige bloss in der Absicht zu verknüpfen,
einem einfachen ein angemessenes Zeichen zu geben, und
ohne gerade die Erinnerung an die einzelnen verknüpften erhalten zu
wollen. Hieraus entsteht alsdann natürlich um so mehr wahre Mehrsylbigkeit,
als der so zusammengesetzte Begriff bloss seine Einfachheit geltend
macht.
Unter den Fällen, von welchen wir hier reden, zeichnen sich hauptsächlich
528zwei verschiedene Classen aus. Bei der einen soll der durch einen
Laut schon gegebne Begriff durch Anknüpfung eines zweiten nur
bestimmter festgestellt oder mehr erläutert, also im Ganzen Ungewissheit
und Undeutlichkeit vermieden werden. Auf diese Weise verbinden
Sprachen oft ganz gleichbedeutende oder doch durch sehr kleine Nüancen
verschiedene Begriffe mit einander, auch allgemeine, speciellen angefügt
und zu solchen allgemeinen oft erst aus speciellen durch diesen
Gebrauch gestempelt, wie im Chinesischen der Begriff des Schlagens
fast in den des Machens überhaupt in diesen Zusammensetzungen
übergeht. In die andere Classe gehören die Fälle, wo wirklich aus zwei
verschiedenen Begriffen ein dritter gebildet wird, wie z. B. die Sonne
das Auge des Tages, die Milch das Wasser der Brust u. s.f. heisst. Der
ersten Classe von Verbindungen liegt ein Mistrauen in die Deutlichkeit
des gebrauchten Ausdrucks oder eine lebhafte Hast nach Vermehrung
derselben zum Grunde. Sie dürfte in sehr ausgebildeten Sprachen selten
gefunden werden, ist aber in einigen, die sich ihrem Baue nach einer
gewissen Unbestimmtheit bewusst sind, sehr häufig. In den Fällen der
zweiten Classe sind die beiden zu verbindenden Begriffe die unmittelbare
Schilderung des empfangenen Eindrucks, also in ihrer speciellen
Bedeutung das eigentliche Wort. An und für sich würden sie zwei bilden.
Da sie aber doch nur Eine Sache bezeichnen, so dringt der Verstand
auf ihre engste Verbindung in der Sprachform, und wie seine
Macht über die Sprache wächst und die ursprüngliche Auffassung in
dieser untergeht, so verlieren die sinnreichsten und lieblichsten Metaphern
dieser Art ihren rückwirkenden Einfluss und entschwinden, wie
deutlich sie auch noch nachzuweisen seyn mögen, der Beachtung der
Redenden. Beide Classen finden sich auch in den einsylbigen Sprachen,
nur dass in ihnen das innere Bedürfniss nach der Verbindung der Begriffe
nicht das Hangen an der Trennung der Sylben zu überwinden vermag.
Auf diese Weise, glaube ich, muss in den Sprachen die Erscheinung
der Ein- und Mehrsylbigkeit aufgefasst und beurtheilt werden. Ich will
jetzt versuchen, dies allgemeine Raisonnement, das ich nicht habe
durch Aufzählung von Thatsachen unterbrechen mögen, mit einigen
Beispielen zu belegen.
Schon der neuere Styl des Chinesischen besitzt eine nicht unbedeutende
Anzahl von Wörtern, die dergestalt aus zwei Elementen zusammengesetzt
sind, dass ihre Zusammensetzung nur die Bildung eines
dritten, einfachen Begriffes zum Zweck hat. Bei einigen derselben ist es
sogar offenbar, dass die Hinzufügung des einen Elements, ohne dem
Sinne etwas beizugeben, nur von wirklich bedeutsamen Fällen aus zur
Gewohnheit geworden ist. Die Erweiterung der Begriffe und der Sprachen
muss darauf leiten, neue Gegenstände durch Vergleichung mit andren,
529schon bekannten zu bezeichnen und das Verfahren des Geistes bei
der Bildung ihrer Begriffe in die Sprachen überzuführen. Diese Methode
muss allmählich an die Stelle der früheren treten, den Eindruck
durch die in den articulirten Tönen liegende Analogie symbolisirend
wiederzugeben. Aber auch die spätere Methode tritt bei Völkern von
grosser Lebendigkeit der Einbildungskraft und Schärfe der sinnlichen
Auffassung in ein sehr hohes Alter zurück und daher besitzen vorzugsweise
die am meisten noch vom Jugendalter ihrer Bildung zeugenden
Sprachen eine grosse Anzahl solcher malerisch die Natur der Gegenstände
darlegenden Wörter. Im Neu-Chinesischen zeigt sich aber hierin
sogar eine, erst späterer Cultur angehörende Verbildung. Mehr spielend
witzige, als wahrhaft dichterische Umschreibungen der Gegenstände,
in welchen diese oft gleich Räthseln verhüllt liegen, bilden häufig solche
aus zwei Elementen bestehende Wörter. 88 Eine andere Classe dieser
letzteren erscheint auf den ersten Anblick sehr wunderbar, nemlich die,
wo zwei einander entgegengesetzte Begriffe durch ihre Vereinigung den
allgemeinen, beide unter sich befassenden Begriff ausdrücken, wie
wenn die jüngeren und älteren Brüder, die hohen und niedrigen Berge
für die Brüder und die Berge überhaupt gesagt wird. Die in solchen
Fällen in dem bestimmten Artikel liegende Universalität wird hier anschaulicher
durch die entgegengesetzten Extreme auf eine keine Ausnahme
erlaubende Weise angedeutet. Eigentlich ist auch diese Wortgattung
mehr eine rednerische Figur, als eine Bildungsmethode der
Sprachen. In einer Sprache aber, wo der, sonst bloss grammatische Ausdruck
so häufig materiell in den Inhalt der Rede gelegt werden muss,
wird sie nicht mit Unrecht den letzteren beigezählt. Einzeln finden sich
übrigens solche Zusammensetzungen in allen Sprachen; im Sanskrit erinnern
sie an das in philosophischen Gedichten häufig vorkommende
sthâwarajaṇgamam. Im Chinesischen aber kommt noch der Umstand
hinzu, dass die Sprache in einigen dieser Fälle für den einfach allgemeinen
Begriff gar kein Wort besitzt und sich also nothwendig dieser Umschreibungen
bedienen muss. Die Bedingung des Alters z.B. lässt sich
von dem Worte Bruder nicht abtrennen, und man kann nur ältere und
jüngere Brüder, nicht Brüder allgemein sagen. Dies mag noch aus dem
Zustande früher Uncultur herstammen. Die Begierde, den Gegenstand
anschaulich mit seinen Eigenschaften im Worte darzustellen, und der
Mangel an Abstraction lassen den allgemeinen, mehrere Verschiedenheiten
unter sich befassenden Ausdruck vernachlässigen; die individuelle
sinnliche Auffassung greift der allgemeinen des Verstandes vor.
Auch in den Amerikanischen Sprachen ist diese Erscheinung häufig.
Von einer ganz entgegengesetzten Seite aus und gerade durch ein künstlich
gesuchtes Verstandes verfahren hebt sich diese Art der Wortzusammenfügung
im Chinesischen auch dadurch mehr hervor, dass die symmetrische
530Anordnung der in bestimmten Verhältnissen gegen einander
stehenden Begriffe als ein Vorzug und eine Zierlichkeit des Styls betrachtet
wird, worauf auch die Natur der, jeden Begriff in Ein Zeichen
einschliessenden Schrift Einfluss hat. Man sucht also solche Begriffe
absichtlich in die Rede zu verflechten und die Chinesische Rhetorik hat
sich ein eignes Geschäft daraus gemacht, da kein Verhältniss so bestimmt,
als das des reinen Gegensatzes ist, die contrastirenden Begriffe
in der Sprache aufzuzählen. 89 Der ältere Chinesische Styl macht keinen
Gebrauch von zusammengesetzten Wörtern, es sey nun, dass man in
früheren Zeiten, wie bei einigen Classen derselben sehr begreiflich ist,
noch nicht auf dies Verfahren gekommen war oder dass dieser strengere
Styl, welcher überhaupt der Anstrengung des Verstandes durch die
Sprache zu Hülfe zu kommen gewissermassen verschmähte, dasselbe
aus seinem Kreise ausschloss.
Die Barmanische Sprache kann ich hier übergehen, da ich schon
oben bei der allgemeinen Schilderung ihres Baues gezeigt habe, wie sie
durch Aneinanderheftung gleichbedeutender oder modificirender
Stämme aus einsylbigen mehrsylbige bildet.
In den Malayischen Sprachen bleibt nach Ablösung der Affixa sehr
häufig, ja man kann wohl sagen meistentheils ein zweisylbiger, in grammatischer
Beziehung auf die Redefügung nicht weiter theilbarer Stamm
übrig. Auch da, wo derselbe einsylbig ist, wird er häufig, im Tagalischen
sogar gewöhnlich verdoppelt. Man findet daher öfter des zweisylbigen
Baues dieser Sprachen erwähnt. Eine Zergliederung dieser Wortstämme
ist indess bis jetzt, soviel ich weiss, nirgends vorgenommen worden.
Ich habe sie versucht, und wenn ich auch noch nicht dahin gelangt bin,
vollkommene Rechenschaft über die Natur der Elemente aller dieser
Wörter zu geben, so habe ich mich dennoch überzeugt, dass in sehr vielen
Fällen jede der beiden vereinigten Sylben als ein einsylbiger Stamm
in der Sprache nachgewiesen werden kann und dass die Ursache der
Verbindung begreiflich wird. Wenn dies nun bei unsren unvollständigen
Hülfsmitteln und unsrer mangelhaften Kenntniss der Fall ist, so lässt
sich wohl auf eine grössere Ausdehnung dieses Princips und auf die ursprüngliche
Einsylbigkeit auch dieser Sprachen schliessen. Mehr
Schwierigkeit erregen zwar die Wörter, welche, wie z. B. die Tagalischen
lisà und lisaỳ von der Wurzel lis (s. unten), in blosse Vocallaute
ausgehen; doch auch diese werden vermuthlich bei künftiger Untersuchung
erklärlich werden. So viel ist schon jetzt offenbar, dass man der
Mehrzahl der Fälle nach die letzten Sylben der Malayischen zweisylbigen
Stämme nicht als an bedeutsame Wörter gefügte Suffixa betrachten
darf, sondern dass sich in ihnen wirkliche Wurzeln, ganz den die erste
Sylbe bildenden gleich, erkennen lassen. Denn sie finden sich auch
theils als erste Sylben jener Composita, theils ganz abgesondert in der
531Sprache. Die einsylbigen Stämme muss man aber meistentheils in ihren
Verdopplungen aufsuchen.
Aus dieser Beschaffenheit der, auf den ersten Anblick einfach scheinenden
und doch auf Einsylbigkeit zurückführenden zweisylbigen Wörter
geht eine Richtung der Sprache auf Mehrsylbigkeit hervor, die, wie
man aus der Häufigkeit der Verdopplung sieht, zum Theil auch phonetisch,
nicht bloss intellectuell ist. Die zusammentretenden Sylben werden
aber auch mehr, als im Barmanischen wirklich zu Einem Worte, indem
sie der Accent mit einander verbindet. Im Barmanischen trägt
jedes einsylbige Wort den seinigen an sich und bringt ihn in das Compositum.
Dass das ganze, nun entstehende Wort einen, seine Sylben zusammenhaltenden
besässe, wird nicht nur nicht gesagt, sondern ist bei
der Aussprache mit hörbarer Sylbentrennung unmöglich. Im Tagalischen
hat das mehrsylbige Wort allemal einen, die vorletzte Sylbe heraushebenden
oder fallen lassenden Accent. Buchstabenveränderung ist
jedoch mit der Zusammensetzung nicht verbunden.
Ich habe meine hierher gehörenden Forschungen vorzüglich bei der
Tagalischen und Neu-Seeländischen Sprache angestellt. Die erstere
zeigt meinem Urtheile nach den Malayischen Sprachbau in seinem grössten
Umfange und seiner reinen Consequenz. Die Südsee-Sprachen war
es wichtig in die Untersuchung einzuschliessen, weil ihr Bau noch uranfänglicher
zu seyn oder wenigstens noch mehr solche Elemente zu enthalten
scheint. Ich habe mich bei den hier folgenden, aus dem Tagalischen
entlehnten Beispielen fast ausschliesslich an diejenigen Fälle
gehalten, wo der einsylbige Stamm, wenigstens noch in der Verdopplung,
auch als solcher der Sprache angehört. Weit grösser ist natürlich
die Zahl solcher zweisylbigen Wörter, deren einsylbige Stämme bloss in
Zusammensetzungen erscheinen, aber in diesen an ihrer immer gleichen
Bedeutung kennbar sind. Diese Fälle sind aber nicht so beweisend,
indem gewöhnlich alsdann auch Wörter vorkommen, in welchen diese
Gleichheit weniger oder gar nicht vorhanden zu seyn scheint, obgleich
solche scheinbare Ausnahmen sehr leicht nur daher entstehen können,
dass man eine entfernter liegende Ideenverknüpfung nicht erräth. Dass
ich immer auf die Nachweisung beider Sylben gegangen bin, versteht
sich von selbst, da das entgegengesetzte Verfahren die Natur dieser
Wortbildungen nur zweifelhaft andeuten könnte. Auch auf Wörter, welche
ihren ursprünglichen Stamm nicht in der nemlichen, sondern in einer
andren Sprache haben, wie es im Tagalischen mit einigen aus dem
Sanskrit oder auch mit aus den Südsee-Sprachen übergegangenen Wörtern
der Fall ist, muss natürlich Bedacht genommen werden.532
Beispiele aus der Tagalischen Sprache:
bag-sàc, etwas mit Gewalt auf die Erde werfen oder gegen etwas andrängen;
bag-bàg, auf den Strand gerathen, ein Saatfeld aufbrechen
(also von gewaltsamem Stossen oder Werfen gebraucht); sac-sàc, etwas
fest einlegen, eindrängen, hineinstopfen, in etwas werfen (apretar embutiendo
algo, atestar, hincar). lab-sàc, etwas in den Koth, Abtritt werfen,
vom eben angeführten Wort und lab-läb, Sumpf, Kothhaufen, Abtritt.
Von diesem Wort und dem gleich weiter unten vorkommenden
as-às ist zusammengesetzt lab-às, semen suis ipsius manibus elicere.
Wahrscheinlich gehört auch hierher sac-àl, jemandem den Nacken, die
Hand oder den Fuss drücken, obgleich die Bedeutung des zweiten Elements
al-àl, die Zähne mit einem Steinchen abfeilen, wenig hierher
passt, und ebenso sac-yòr, Heuschrecken fangen, wo ich aber das zweite
Element nicht zu erklären weiss. Dagegen kann man sacsî, Zeuge, bezeugen,
nicht hierher rechnen, da das Wort wohl unbezweifelt das Sanskritische
sâkshin ist und, als ein gerichtliches mit Indischer Cultur in
die Sprache gekommen seyn kann. Dasselbe Wort findet sich auch in
der gleichen Bedeutung in der eigentlich Malayischen Sprache.
bac-às, Fussstapfen, Spur von Menschen undThieren, übrig bleibendes
Zeichen eines körperlichen Eindrucks von Thränen, Schlägen
u. s. w.; bac-bàc, die Rinde abnehmen oder verlieren; às-as, sich abreiben,
von Kleidern und andren Dingen gebraucht.
bac-làs, Wunde, und zwar solche die vom Kratzen herkommt; das
eben angeführte bac-bàc und las-làs, Blätter oder Dachziegel abnehmen,
auch vom Zerstören der Zweige und Dächer durch den Wind gebraucht.
Das Wort heisst auch bac-lìs von lis-lìs jäten, Gras ausreissen
(s. unten).
às-al, eingeführter Gebrauch, angenommene Gewohnheit, von dem
oben angeführten às-as und al-àl, also von der Verbindung der Begriffe
des Abnutzens und des Abfeilens.
it-ìt, einsaugen, und im-ìm, verschliessen, vom Munde gebraucht.
Aus diesen beiden ist vermuthlich it-ìm, schwarz (Malayisch ētam), entstanden,
da diese Farbe sehr gut mit etwas Eingesogenem und Verschlossnem
zu vergleichen ist.
tac-lìs, wetzen, schärfen, und zwar ein Messer mit dem andren; tac
bedeutet die Entleerung des Leibes, die Verrichtung der Nothdurft, das
verdoppelte tac-tàc einen grossen Spaten, eine Haue (azadon), und
zum Verbum gemacht, mit diesem Werkzeuge arbeiten, aushöhlen.
Hieraus wird klar, dass dieser letzte Begriff eigentlich die Grundbedeutung
auch der einfachen Wurzel ist. lis-lìs wird noch weiter unten vorkommen,
vereinigt aber die Begriffe des Zerstörens und des Kleinen,
Kleinmachens in sich. Beides passt sehr gut auf das abreibende Wetzen.533
lis-pìs mit dem Praefix pa, das Korn zur Saat reinigen, stammt vom
oft erwähnten lis-lìs und von pis-pìs, abkehren, abfegen, besonders von
den Brotkrumen mit einer Bürste gebraucht.
là-bay, ein Bündel Seide, Zwirn oder Baumwolle (madeja), und davon,
als Verbum, haspeln; là-la, Teppiche weben; bay-baỳ, gehen, und
zwar an der Küste des Meeres hin, also in einer bestimmten Richtung,
was zu der Bewegung des Haspelns gut passt.
tú-lis, Spitze, zuspitzen, namentlich von grossen hölzernen Nägeln
(estacas) gebraucht und im Javanischen und Malayischen auf den Begriff
des Schreibens angewandt. 90 lis-lìs, schlechte unnütze Gewächse
zerstören, ausreissen, ist schon oben da gewesen. Der Begriff ist eigentlich
kleinmachen und daher passend auf das Abschaben, um eine Spitze
hervorzubringen; lisà sind die kleinen Nisse der Läuse und aus dem
Begriff des Kleinen, des Staubes kommt auch die Anwendung des Wortes
auf das Ausfegen, Auskehren, wie in ua-lìs, dem allgemeinen Worte
für diese Arbeit. Das erste Element von tú-lìs finde ich weder einfach
noch verdoppelt im Tagalischen, dagegen wohl in den Südsee-Sprachen,
in dem Tongischen tu (bei Mariner too geschrieben), schneiden,
sich erheben, aufrecht stehen; im Neu-Seeländischen hat es diese letztere
Bedeutung neben der von schlagen.
tó-bo, hervorkommen, spriessen, von Pflanzen (nacer), bo-bò, etwas
ausleeren; tó-to hat im Tagalischen bloss metaphorische Bedeutungen:
Freundschaft knüpfen, einträchtig seyn, seine Absicht im Reden oder
Handeln erreichen. Aber im Neu-Seeländischen ist to Leben, Belebung
und davon toto Flut. Im Tongischen hat tubu (Mariner: tooboo) dieselbe
Bedeutung des Spriessens, als das Tagalische tóbo, bedeutet aber auch
aufspringen. bu findet sich im Tongischen als bubula, schwellen; tu
heisst: schneiden, trennen und stehen. Dem Tongischen tubu entspricht
das Neu-Seeländische tupu, sowohl in der Bedeutung, als der Ableitung.
Denn tu ist stehen, aufstehen und in pu liegt der Begriff eines
durch Schwellen rund gewordenen Körpers, da es eine schwangere
Frau bedeutet. Die Bedeutungen: Cylinder, Flinte, Röhre, welche Lee
zuerst setzt, sind nur abgeleitete. Dass in pu auch schon der Begriff des
Aufbrechens durch Anschwellung liegt, beweist das Compositum puao,
Tagesanbruch.
Beispiele aus der Neu-Seeländischen Sprache:
De los Santos Tagalisches Wörterbuch ist, wie die meisten, besonders
älteren Missionarien-Arbeiten dieser Art, bloss zur Anleitung, in der
Sprache zu schreiben und zu predigen, bestimmt. Es giebt daher von
den Wörtern immer die concretesten Bedeutungen, zu welchen sie
534durch den Sprachgebrauch gelangt sind, und geht selten auf die ursprünglichen,
allgemeinen zurück. Auch ganz einfache, in der That zu
den Wurzeln der Sprache gehörende Laute tragen also sehr häufig Bedeutungen
bestimmter Gegenstände an sich, so pay-pày die von Schulterblatt,
Fächer, Sonnenschirm, in welchen allen der Begriff des Ausdehnens
liegt. Dies sieht man aus sam-pày, Wäsche oder Zeug an der
Luft auf ein Seil, eine Stange u. s. w. aufhängen (tender), cá-pay, mit
den Armen in Ermangelung der Ruder rudern, beim Rufen mit den Händen
winken, und andren Zusammensetzungen. In dem vom Professor
Lee in Cambridge nach den schon an Ort und Stelle aufgesetzten Materialien
Thomas Kendall's mit Zuziehung zweier Eingebornen sehr einsichtsvoll
zusammengetragenen Neu-Seeländischen Wörterbuche ist es
durchaus anders. Die einfachsten Laute haben höchst allgemeine Bedeutungen
von Bewegung, Raum u. s.f., wie man sich aus der Vergleichung
der Artikel der Vocallaute überzeugen kann. 91 Man geräth dadurch
bisweilen über die specielle Anwendung in Verlegenheit und ist
auch wohl versucht, zu bezweifeln, ob diese Begriffsweite in der That in
der geredeten Sprache liegt oder nicht vielleicht erst hinzugeschlossen
ist. Indess hat Lee dieselbe doch gewiss aus den Angaben der Eingebornen
geschöpft und es ist nicht zu läugnen, dass man in der Herleitung
der Neu-Seeländischen Wörter bedeutend dadurch gefördert wird.
ora, Gesundheit, Zunahme, Herstellung derselben; o, Bewegung und
auch ganz besonders: Erfrischung; ra, Stärke, Gesundheit, dann auch:
die Sonne; ka-ha, Stärke, eine aufsteigende Flamme, brennen, Belebung
als der Act derselben und als kräftige Wirksamkeit; ha, das Ausathmen.
mara, ein der Sonnenwärme ausgesetzter Platz, dann eine dem Redenden
gegenüberstehende Person, wohl vom Leuchten des Antlitzes,
daher als Anrede gebraucht; ma, klar, wie weisse Farbe; ra das eben
erwähnte Wort für Sonne; marama ist das Licht und der Mond.
pono, wahr, Wahrheit, po, Nacht, die Region der Finsterniss, noa,
frei, ungebunden. Wenn diese Ableitung wirklich richtig ist, so ist die
Zusammensetzung der Begriffe merkwürdig sinnvoll.
mutu, das Ende, endigen, mu, als Partikel gebraucht, das Letzte, zuletzt,
tu, stehen.
Tongische sprache:
fachi, brechen, ausrenken; fa, fähig, etwas zu seyn oder zu thun; chi,
klein, das Neu-Seeländische iti.
loto bedeutet die Mitte, den Mittelpunkt, das innerlich Eingeschlossene,
unstreitig davon metaphorisch Gemüth, Gesinnung, Temperament,
Gedanke, Meinung. Das Wort ist dasselbe mit dem Neu-Seeländischen
535roto, das jedoch nur die körperliche, nicht die figürliche Bedeutung
hat, also nur das Innere und, als Praeposition in heisst. Ich glaube
beide Wörter richtig aus beiden Sprachen ableiten zu können. Das erste
Element scheint mir das Neu-Seeländische roro, Gehirn. Das einfache
ro wird in Lee's Wörterbuch bloss durch das vieldeutige matter, Materie,
übersetzt, das man aber wohl hier als Eiter, Materie eines Geschwüres
nehmen muss und das vielleicht allgemeiner jeden eingeschlossnen
klebrigten Stoff bedeutet. Von dem zweiten Element, to, ist, als Neu-Seeländischem
Worte schon bei tóbo gesprochen worden und ich bemerke
nur noch hier, dass es auch von Schwangerschaft, also von dem
innerlich, lebendig Eingeschlossenen gebraucht wird. Im Tongischen ist
es mir bis jetzt nur als Name eines Baumes bekannt, dessen Beeren ein
klebrigtes Fleisch haben, welches man zum Zusammenkleben verschiedener
Dinge braucht. Es liegt also auch in dieser Bedeutung der Begriff,
sich an etwas anderes anzuhängen. Im Tongischen liegt aber der Ausdruck
für Gehirn nur zum Theil in diesem Wörterkreis. Das Gehirn
heisst nemlich uto (Mariner: ooto). Das letzte Glied des Wortes halte
ich für das so eben betrachtete to, da die Klebrigkeit sehr gut auf die
Masse des Gehirnes passt. Die erste Sylbe ist nicht weniger ausdrucksvoll
zur Beschreibung des Gehirns, da u ein Bündel (a bundle), Paket
ist. Dieses Wort glaube ich auch in dem Tagalischen ótac und dem Malayischen
ūtak wiederzufinden, deren Wurzeln ich also nicht in diesen
Sprachen selbst suche. Das End-k kann sehr leicht, wie in andren Malayischen
Wörtern, nicht wurzelhaft seyn. Beide Wörter bedeuten zugleich,
offenbar von der Gleichheit der Materie, Mark und Gehirn und
werden daher oft oder sogar gewöhnlich durch Hinzufügung von Kopf
oder Knochen unterschieden. Im Madecassischen lautet dasselbe Wort
bei Flacourt oteche als Mark und als Gehirn otechendoha, Mark des
Kopfes, indem er das Wort loha, Kopf, nach einer ganz gewöhnlichen
Buchstabenvertauschung doha schreibt und dasselbe durch einen Nasenlaut
mit dem andren Worte verknüpft. Ein anders lautender Ausdruck
für Gehirn ist bei Challan tso ondola und auf ähnliche Weise für
Mark tsoc, tsoco. Ob ondola nothwendig zu tso gehören soll, ist schwer
zu entscheiden. Vermuthlich ist aber nur das Unterscheidungszeichen
weggelassen; denn im Madecassisch-Französischen Theile findet sich
das, mir übrigens bis jetzt unerklärliche ondola allein für Gehirn. In
dem handschriftlichen von Jacquet herausgegebenen Wortverzeichniss
heisst Gehirn tsokou loha und Jacquet bemerkt dabei, dass er kein entsprechendes
Wort in den andren Dialekten findet. 92 Ich halte aber tsokou
und die Varianten bei Challan bloss für eine Entstellung des Malayischen
ūtak durch Wegwerfung des Anfangsvocals und zischende
Aussprache des t und folglich gleichbedeutend mit Flacourt's oteche,
das noch mehr an das Tagalische ótac erinnert. Chapelier's handschriftliches
536Wörterbuch, welches ich der Güte des Herrn Lesson verdanke,
hat für Gehirn tsoudoa, worin wieder das endende doa, Kopf, für loa
steht. Sehr bedaure ich, das Wort nicht in der Gestalt zu kennen, wie es
nach den Englischen Missionaren heut zu Tage lautet. Allein das Gehirn
kommt in der Bibel nur in zwei Stellen des Buchs der Richter in der
Lateinischen Vulgata vor und die Englische Bibel, nach welcher die
Missionare übersetzen, hat dafür Schädel.
Die Zweisylbigkeit der Semitischen Stämme (um hier die geringe
Zahl der weniger oder mehr Sylben enthaltenden zu übergehen) ist von
durchaus anderer Art, als die bis hierher betrachtete, da sie untrennbarer
in den lexikalischen und grammatischen Bau verwachsen ist. Sie bildet
einen wesentlichen Theil des Charakters dieser Sprachen und kann,
so oft von dem Ursprunge, dem Bildungsgange und dem Einfluss derselben
die Rede ist, nicht ausser Betrachtung gelassen werden. Dennoch
kann man es als ausgemacht annehmen, dass auch dieses mehrsylbige
System sich auf ein ursprünglich einsylbiges, noch in der jetzigen Sprache.
an deutlichen Spuren erkennbares gründet. Dies ist von mehreren
Bearbeitern der Semitischen Sprachen, namentlich von Michaelis, allein
auch schon vor ihm anerkannt und von Gesenius und Ewald näher
entwickelt und beschränkt worden. 93 Es giebt, sagt Gesenius, ganze
Reihen von Stammverben, welche nur die zwei ersten Stammconsonanten
gemein, zum dritten aber ganz verschiedene haben und doch in der
Bedeutung, wenigstens im Hauptbegriffe übereinstimmen. Er nennt es
nur übertrieben, wenn der, im Anfange des vorigen Jahrhunderts in
Breslau verstorbene Caspar Neumann alle zweisylbigen Wurzeln auf
einsylbige zurückführen wollte. In den hier genannten Fällen liegen also
den heutigen zweisylbigen Stammwörtern einsylbige, aus zwei, einen
Vocal einschliessenden Consonanten bestehende Wurzeln zum Grunde,
welchen in einer späteren Niedersetzung der Sprache durch einen zweiten
Vocal ein dritter Consonant angehängt worden ist. Klaproth hat dies
gleichfalls erkannt und in einer eignen Abhandlung eine Anzahl solcher,
von Gesenius angedeuteter Reihen aufgestellt. 94 Er zeigt darin zugleich
auf merkwürdige und scharfsinnige Weise, wie die, von ihrem dritten
Consonanten befreiten, einsylbigen Wurzeln sehr häufig in Laut und
Bedeutung ganz oder grösstentheils mit Sanskritischen übereinkommen.
Ewald bemerkt, dass eine solche, mit Vorsicht angestellte Vergleichung
der Stämme zu manchen neuen Resultaten führen würde, setzt
aber hinzu, dass man sich durch solche Etymologie über das Zeitalter
der eigentlich Semitischen Sprache und Form erhebt. In dem Letzteren
stimme ich ihm durchaus bei, da gerade meiner Ueberzeugung nach mit
jeder wesentlich neuen Form, welche die Mundart auch des nemlichen
Volksstammes im Laufe der Zeit gewinnt, in der That eine neue Sprache
angeht.537
Bei der Frage über den Umfang dieses Ursprungs zweisylbiger Wurzeln
aus einsylbigen müsste zuerst factisch genau festgestellt werden,
wie weit wirklich hierin die etymologische Zergliederung zu gehen vermag.
Blieben nun, wie wohl kaum zu bezweifeln ist, nicht zurückzuführende
Fälle übrig, so könnte allerdings die Schuld hiervon doch am
Mangel der Glieder liegen, welche die Reihen vollständig zeigen würden.
Allein auch aus allgemeinen Gründen scheint es mir sogar
nothwendig, anzunehmen, dass dem Systeme der Ausdehnung aller
Wurzeln zu zwei Sylben nicht ein durchaus einsylbiges, sondern eine
Mischung ein- und zweisylbiger Wortstämme unmittelbar vorausgegangen
sey. Man darf sich die Veränderungen in den Sprachen nie so gewaltsam
und am wenigsten so theoretisch denken, dass ein neuer Bildungsgrundsatz,
für den es bisher an Beispielen fehlte, dem Volke
(denn das heisst doch der Sprache) aufgedrängt werden könnte. Es
müssen schon Fälle und in ziemlicher Anzahl vorhanden seyn, wenn
gewisse Lautbeschaffenheiten durch grammatische Gesetzgebung, die
überhaupt gewiss im Ausmerzen vorhandener Formen mächtiger, als in
der Einführung neuer ist, allgemein gemacht werden sollen. Bloss des
allgemeinen Satzes wegen, dass eine Wurzel immer einsylbig seyn muss,
möchte ich auf keine Weise auch ursprünglich zweisylbige läugnen. Ich
habe mich hierüber im Vorigen deutlich erklärt. Wenn ich hiernach
aber selbst die Zweisylbigkeit auf Zusammensetzung zurückführe, so
dass zwei Sylben auch die vereinte Darstellung zweier Eindrücke sind,
so kann die Zusammensetzung schon im Geiste desjenigen liegen, der
das Wort zum erstenmal ausspricht. Dies ist hier um so mehr möglich,
als von einem mit Flexionssinn begabten Volksstamme die Rede ist. Ja
es kommt bei den Semitischen Sprachen noch ein zweiter wichtiger
Umstand hinzu. Versetzt uns auch die Vernichtung des Gesetzes der
Zweisylbigkeit in eine über den jetzigen Sprachbau hinausgehende
Zeit, so bleiben in dieser doch zwei andere charakteristische Kennzeichen
übrig, dass nemlich die Wurzelsylbe, auf welche die Zergliederung
der heutigen Stämme führt, immer eine durch einen Consonanten geschlossene
war und dass man den Vocal als gleichgültig für die Begriffsbedeutsamkeit
ansah. Denn hätten die Mittelvocale wirklich Begriffsbedeutsamkeit
besessen, so wäre es unmöglich gewesen, ihnen diese
wiederum zu entreissen. Ueber das Verhältniss der Vocale zu den Consonanten
in jenen einsylbigen Wurzeln habe ich mich schon oben 95 geäussert.
Auf der andren Seite könnte aber auch schon die frühere
Sprachbildung auf den Ausdruck einer doppelten Empfindung in zwei
verknüpften Sylben geleitet worden seyn. Der Flexionssinn lässt das
Wort als ein Ganzes ansehen, das Verschiedenes in sich begreift, und
der Hang, die grammatische Andeutung in den Schooss des Wortes
selbst zu legen, musste dahin bringen, ihm mehr Umfang zu verleihen.
538Mit den hier entwickelten Gründen, die mir keineswegs gezwungen erscheinen,
liesse sich sogar die Ansicht auch ursprünglich grössentheils
zweisylbiger Wurzeln vertheidigen. Die gleichförmige Bedeutung der
ersten Sylbe von mehreren bewiese nur die Gleichheit des Haupteindrucks
verschiedener Gegenstände. Mir aber kommt es natürlicher vor,
das Daseyn einsylbiger Wurzeln anzunehmen, aber darum nicht, auch
schon neben ihnen, zweisylbige auszuschliessen. Zu bedauern ist es,
dass die mir bekannten Untersuchungen sich nicht auf die Erforschung
der Bedeutung des, zwei gleichen vorausgehenden Consonanten hinzugefügten
dritten einlassen. Erst diese, freilich gewiss höchst schwierige
Arbeit würde vollkommnes Licht über diese Materie verbreiten. Betrachtet
man aber auch alle zweisylbige Semitische Wortstämme als zusammengesetzte,
so sieht man doch auf den ersten Anblick, dass diese
Zusammensetzung von ganz anderer Art, als die in den hier durchgegangenen
Sprachen ist. In diesen macht jedes Glied der Zusammensetzung
ein eignes Wort aus. Wenn auch, wenigstens im Barmanischen und
Malayischen, die Fälle sogar häufig sind, dass Wörter gar nicht mehr für
sich allein, sondern bloss in solchen Zusammensetzungen erscheinen,
so ist dies doch nur ein Folge des Sprachgebrauchs. An sich widerspricht
in ihnen nichts ihrer Selbstständigkeit; sie sind sogar gewiss früher
eigne Wörter gewesen und nur darum als solche ausser Gewohnheit
gekommen, weil ihre Bedeutung vorzüglich passend war, Modificationen
in Zusammensetzungen zu bezeichnen. Die den Semitischen Wortstämmen
auf diese Weise hinzugefügte zweite Sylbe könnte aber nicht
allein und für sich bestehen, da sie bei vorausgehendem Vocal und
nachfolgendem Consonanten gar nicht die legitime Form der Nomina
und Verba an sich trägt. Man sieht hieraus deutlich, dass dieser Bildung
zweisylbiger Wortstämme ein ganz anderes Verfahren im Geiste des
Volkes zum Grunde liegt, als im Chinesischen und in den demselben in
diesem Theile seines Baues ähnlichen Sprachen. Es werden nicht zwei
Wörter zusammenengesetzt, sondern mit unverkennbarer Hinsicht auf
Worteinheit Eines erweiternd gebildet. Auch in diesem Punkte bewährt
der Semitische Sprachstamm seine edlere, den Forderungen des
Sprachsinnes mehr entsprechende, die Fortschritte des Denkens sicherer
und freier befördernde Form.
Die wenigen mehrsylbigen Wurzeln der Sanskritsprache lassen sich
auf einsylbige zurückführen und alle übrigen Wörter der Sprache entstehen
nach der Theorie der Indischen Grammatiker aus diesen. Die
Sanskritsprache kennt daher hiernach keine andere Mehrsylbigkeit, als
die durch grammatische Anheftung oder offenbare Zusammensetzung
hervorgebrachte. Es ist aber schon oben (VII 107.) erwähnt worden,
dass die Grammatiker hierin vielleicht zu weit gehen, so dass unter den
nicht auf natürliche Weise aus den Wurzeln abzuleitenden Wörtern ungewissen
539Ursprungs auch zweisylbige sind, deren Entstehung insofern
zweifelhaft bleibt, als weder Ableitung noch Zusammensetzung an ihnen
sichtbar ist. Wahrscheinlich aber tragen sie doch die letztere an
sich, nur dass sich nicht allein die ursprüngliche Bedeutung der einzelnen
Elemente im Gedächtniss des Volks verloren, sondern auch ihr
Laut nach und nach eine, sie blossen Suffixen ähnlich machende Abschleifung
erfahren hat. Zu Beidem musste selbst nach und nach der
von den Grammatikern aufgestellte Grundsatz durchgängiger Ableitung
führen.
In einigen ist aber die Zusammensetzung wirklich erkennbar. So hat
schon Bopp šarad, Herbst, Regenjahreszeit, als ein Compositum aus
śara, Wasser, und da, gebend, und andere Unâdi-Wörter als ähnliche
Zusammensetzungen angesehen. 96 Die Bedeutung der in ein Unâdi-Wort
übergegangenen Wörter mag auch in der Anwendung, wenn einmal
diese Form eingeführt war, so verändert worden seyn, dass die ursprüngliche
darin nicht mehr zu erkennen ist. Der allgemein in der
Sprache herrschende Geist der Bildung durch Affixa mochte zur gleichen
Behandlung dieser Formen hinleiten. In einigen Fällen tragen Unâdi-Suffixa
durchaus die Gestalt auch in der Sprache selbstständig vorhandener
Substantiva an sich. Von dieser Art sind anda und anga.
Substantiva würden sich nun zwar den Gesetzen der Sprache nach
nicht als Endglieder eines Compositum mit einer Wurzel vereinigen lassen
und insofern bleibt die Natur dieser Bildung immer räthselhaft. Allein
bei genauer Durchgehung aller einzelnen Fälle müsste sich die Sache
doch wohl vollkommen erledigen. Da, wo das Wort weder der
angegebenen noch einer andren Wurzel nach natürlicher Herleitung
beigelegt werden kann, löst sich die Schwierigkeit von selbst, da alsdann
keine Wurzel in dem Worte vorhanden ist. In andren Fällen kann
man annehmen, dass die Wurzel erst durch das Krit-Suffix a in ein Nomen
verwandelt ist. Endlich aber scheint es unter den Unâdi-Suffixen
mehrere zu geben, welche man mit grösserem Rechte den Krit-Suffixen
beizählen würde. In der That ist der Unterschied beider Gattungen
schwer zu bestimmen und ich wüsste keinen andren, als den, in der einzelnen
Anwendung gewiss oft schwankend bleibenden anzugeben, dass
die Krit-Suffixa durch einen sich in ihnen deutlich aussprechenden allgemeinen
Begriff auf ganze Gattungen von Wörtern anwendbar sind,
dagegen die Unâdi-Suffixa nur einzelne Wörter, und ohne dass sich diese
Bildung aus Begriffen erklären liesse, erzeugen. Im Grunde gesagt
sind die Unâdi-Wörter nichts andres, als solche, die man, da sie nicht
die Anwendung der gewöhnlichen Suffixa der Sprache erlaubten, auf
anomale Weise auf Wurzeln zurückzuführen versuchte. Ueberall, wo
diese Zurückführung natürlich von statten geht und die Häufigkeit des
erscheinenden Suffixes dazu veranlasst, scheint mir kaum ein Grund
540vorhanden zu seyn, sie nicht den Krit-Suffixen beizufügen. Daher hat
auch Bopp in seiner Lateinischen Grammatik, so wie in der abgekürzten
Deutschen, die Methode befolgt, die üblichsten und sich am meisten
als Suffixa bewährenden Unâdi-Suffixa in alphabetischer Ordnung,
vermischt mit den Krit-Suffixen, aufzustellen.
aṇḍa, Ei, selbst ein Unâdi-Wort aus der Wurzel an, athmen, und
dem Suffix ḍa ist wohl wenigstens ursprünglich ein und dasselbe Wort
mit dem gleichlautenden Unâdi-Suffix gewesen. Der aus dem Begriff
des Eies hergenommene der Ernährung oder der runden Gestalt passt
mehr oder weniger da, wo nicht an das Ei selbst zu denken ist, auf die
mit diesem Suffix gebildeten Wörter. In waraṇḍa, in der Bedeutung eines
offenen Laubenganges (open portico), liegt derselbe Begriff vielleicht
in einem Theile der Gestaltung oder Verzierung dieser Gebäude.
Am deutlichsten zeigen sich die durch die beiden Elemente des Worts
gegebenen Begriffe des Runden und des Bedeckens in der Bedeutung
einer in einem Gesichtsausschlage (pimples in the face) bestehenden
Hautkrankheit, welche es gleichfalls hat. In die andren Bedeutungen
der Menge und des oben bedeckten, zu den Seiten offenen Laubenganges
sind sie theils einzeln, theils vereint übergegangen. 97 Das UnâdiSuffix
aṇḍa verbindet sich nach den mir bekannten Beispielen bloss mit
Wurzeln, deren Endlaut das Vocal-r ist, und nimmt alsdann immer
Guna an. Man könnte also die erste Sylbe (war) für ein aus der Wurzel
gebildetes Nomen ansehen. Dass nun das End-a von diesem nicht mit
dem Anfangs-a von aṇda in ein langes â übergeht, widerspricht allerdings
dieser Erklärung. Es erscheint jedoch natürlich, da man diese Formation,
wenn dies auch ursprünglich wahr gewesen seyn mag, doch in
der späteren Sprache nicht als Zusammensetzung, sondern als Ableitung
behandelte, und immer lässt sich schwer annehmen, dass die
gleichlautenden Wörter Ei und dies Unâdi-Suffix völlig verschiedne
seyn sollten, weit eher begreifen, wie aus dem Substantivum nach und
nach in Bedeutung und grammatischer Behandlung ein Suffix gemacht
worden sey.
Von dem Unâdi-Suffix aṇga liesse sich ungefähr dasselbe, als von
aṇḍa sagen, ja vielleicht noch mit grösserem Rechte, da das Substantivum
anga, als Körper, Gehen, Bewegen u.s.f. eine noch weitere, sich
zur Bildung eines Suffixes mehr eignende Bedeutung hat. Ein solches
Suffix könnte nicht unrichtig mit unsrem Deutschen thum, heit u.s.f.
verglichen werden. Bopp hat indess auf eine so scharfsinnige und so
trefflich auf alle mir bekannte Wörter dieser Art anwendbare Weise dies
Suffixum indem er die erste Sylbe zur Accusativendung des Hauptwortes
macht und die letzte von gâ ableitet, zerstört, dass ich nicht im Widerspruche
mit ihm auf dessen Wiederherstellung bestehen möchte.
Dennoch findet sich aṇga, auf ähnliche Weise, als der gewöhnlichen
541Vorstellungsart nach im Sanskrit gebraucht, in der Kawi-Sprache und
auch in einigen heutigen Malayischen Sprachen so auffallend, dass ich
die Erwähnung hier nicht umgehen zu können glaube. Im Brata Yuddha,
dem Kawi-Gedichte, von welchem die Folge dieser Schrift ausführlich
handeln wird, kommen SanskritSubstantiva der ersten Declination
mit der hinzugegebenen Endung anga und angana vor: neben
sura (1. a.), Held (śûra), auch suranga (97. a.), neben rana (82. d.),
Kampf (raṇa), auch rananga (83. d.), ranangana (86. b.). Auf die Bedeutung
scheinen diese Zusätze gar keinen Einfluss zu haben, da die
handschriftliche Paraphrase sowohl die einfachen, als verlängerten
Wörter durch dasselbe heutige Javanische Wort erklärt. Die Kawi-Sprache
soll zwar, als eine dichterische sich sowohl Abkürzungen, als Hinzufügungen
völlig bedeutungsloser Sylben erlauben. Die Uebereinstimmung
dieser Zusätze mit den Sanskrit-Substantiven aṇga und aṇgana,
welches letztere auch eine sehr allgemeine Bedeutung hat, ist aber zu
auffallend, als dass man nicht genöthigt würde, in einer Sprache, die
ganz eigentlich aus dem Sanskrit zu schöpfen bestimmt war, hierbei an
dieselben zu denken. Diese Substantiva und das mit ihnen gleichlautende
Unâdi-Suffix konnten solche, dem Sylbenklange willkommene Endungen
hervorbringen. In der heutigen gewöhnlichen javanischen Sprache
wüsste ich sie nicht aufzuweisen. Dagegen findet sich in ihr, nur mit
kleiner Veränderung, als Substantivum und in der Neu-Seeländischen
und Tongischen ganz unverändert und zugleich als Substantivum und
als Endung anga auf eine Weise, welche wohl die Vermuthung geben
kann, dass auch hier an einen Sanskritischen Ursprung zu denken sey.
Javanisch ist hanggê: die Art und Weise, wie etwas geschieht, und der
Umstand, dass dies Wort der vornehmen Sprache angehört, weist von
selbst bei seiner Ableitung auf Indien hin. Im Tongischen ist anga: Stimmung
des Gemüths, Gewohnheit, Gebrauch, der Platz, wo etwas vorgeht;
im Neu-Seeländischen hat das Wort, wie man aus den Zusammensetzungen
sieht, auch diese letzte Bedeutung, allein hauptsächlich die
des Machens, besonders des gemeinschaftlichen Arbeitens. Diese Bedeutungen
kommen allerdings nur mit der allgemeinen des Bewegens in
dem Sanskritwort überein; doch hat auch dieses die Bedeutung von
Seele und Gemüth. Die wahre Aehnlichkeit scheint mir aber in der Weite
des Begriffs zu liegen, der dann auf verschiedene Weise aufgefasst
werden konnte. Im Neu-Seeländischen ist der Gebrauch von anga als
letztem Gliede einer Zusammensetzung so häufig, dass es dadurch fast
zur grammatischen Endung abstracter Substantiva wird: udi, sich herumdrehen,
herumwälzen, auch vom Jahre gebraucht, udinga, eine Umwälzung;
rongo, hören, rongonga, die Handlung oder Zeit des Hörens;
tono, befehlen, tononga, Befehl; tao, ein langer Speer, taonga, mit dem
Speer erworbenes Eigenthum; toa, ein herzhafter, kühner Mann, toanga,
542das Erzwingen, Ueberwältigen; tui, nähen, bezeichnen, schreiben,
tuinga, das Schreiben, die Tafel, auf die man schreibt; tu, stehen, tunga,
der Platz, wo man steht, der Ankerplatz eines Schiffes; toi, im Wasser
tauchen, toinga, das Eintauchen; tupu, ein Sprössling, hervorspriessen,
tupunga, die Voreltern, der Platz, an dem irgend etwas gewachsen ist;
ngaki, das Feld bebauen, ngakinga, ein Meierhof. Nach diesen Beispielen
könnte man glauben, dass nga und nicht anga die Endung wäre. Das
Anfangs-a ist aber bloss des vorhergehenden Vocals wegen abgeworfen.
Denn man sagt auch nach Lee's ausdrücklicher Bemerkung statt udinga
udi anga und die Tongische Sprache lässt das a auch nach Vocalen bestehen,
wie die Wörter maanga, ein Bissen, von ma, kauen, taanga, das
Niederhauen von Bäumen, aber auch (vermuthlich figürlich vom schlagenden
Ton des Taktes): Gesang, Vers, Dichtung, von ta, schlagen (in
Laut und Bedeutung übereinstimmend mit dem Chinesischen Worte),
und nofoanga, Wohnung, von nofo, wohnen, beweisen. Inwiefern das
Madecassische manghe, machen, mit diesen Wörtern zusammenhängt,
erfordert zwar noch eigne Untersuchung. Doch dürfte diese wohl auf
Verwandtschaft führen, da das Anfangs-m in diesem, selbst als Auxiliare
und Praefix gebrauchten Worte sehr leicht ein davon abzulösendes
Verbalpraefix seyn kann. Froberville 98 leitet magne, wie er schreibt, von
maha aigne oder von maha angam ab und führt mehrere Lautveränderungen
dieses Wortes an. Da unter diesen Formen auch manganou ist,
so gehört wohl auch das Javanische mangun, bauen, bewirken, hierher. 99
Wenn man also die Frage aufwirft, ob es nach Ablösung aller Affixe
im Sanskrit zwei- oder mehrsylbige einfache Wörter giebt? so muss
man sie, da allerdings solche Wörter vorkommen, in welchen das letzte
Glied nicht mit Sicherheit als ein, einer Wurzel angehängtes Suffix angesehen
werden kann, nothwendig bejahen. Indess ist die Einfachheit
dieser Wörter gewiss nur scheinbar. Sie sind unstreitig Composita, in
welchen sich die Bedeutung des einen Elementes verloren hat.
Abgesehen von der sichtbaren Mehrsylbigkeit fragt es sich, ob nicht
im Sanskrit eine andere, verdeckte vorhanden ist? Es kann nemlich
zweifelhaft scheinen, ob die mit doppelten Consonanten beginnenden,
besonders aber die in Consonanten auslautenden Wurzeln, die ersteren
durch Zusammenziehung, die letzteren durch Abwerfung des Endvocals,
nicht von ursprünglich zweisylbigen zu einsylbigen geworden sind.
Ich habe in einer früheren Schrift 100 bei Gelegenheit der Barmanischen
Sprache diesen Gedanken geäussert. Der einfache Sylbenbau mit auslautendem
Vocal, dem mehrere Sprachen des östlichen Asiens noch
grossentheils treu geblieben sind, scheint in der That der natürlichste
und so könnten leicht die uns jetzt einsylbig scheinenden Wurzeln eigentlich
zweisylbige einer früheren, der uns jetzt bekannten zum Grunde
543liegenden Sprache oder eines primitiveren Zustandes der nemlichen
seyn. Der auslautende Endconsonant wäre alsdann der Anfangsconsonant
einer neuen Sylbe oder eines neuen Wortes. Denn dies letzte Glied
der heutigen Wurzeln wäre dann nach dem verschiedenen Genius der
Sprachen entweder eine bestimmtere Ausbildung des Hauptbegriffes
durch eine nähere Modification oder eine wirkliche Zusammensetzung
von zwei selbstständigen Wörtern. In der Barmanischen Sprache z.B.
erhöbe sich also eine sichtbare Zusammensetzung auf dem Grunde einer
jetzt nicht mehr erkannten. Am nächsten führten hierauf die mit
dazwischen liegendem einfachen Vocale mit dem gleichen Consonanten
an- und auslautenden Wurzeln. Im Sanskrit haben diese, wenn man
etwa dad ausnimmt, mit welchem es überhaupt leicht eine verschiedene
Bewandtniss haben kann, eine zum Ausdruck durch Reduplication passende
Bedeutung, indem sie, wie kak, jaj, šaš heftige Bewegung, wie lal
Wunsch, Begierde oder wie sas, schlafen, einen sich gleichmässig verlängernden
Zustand bezeichnen. Die den Ton des Lachens nachahmenden
kakk, khakkh, ghaggh kann man sich ursprünglich kaum anders,
als mit Wiederholung der vollen Sylbe denken. Ob man aber durch Zergliederung
auf diesem Wege viel weiter kommen könnte, möchte ich
bezweifeln und sehr leicht kann ein solcher auslautender Consonant
auch wirklich ursprünglich bloss auslautend gewesen seyn. Selbst im
Chinesischen, das keine wahrhaften Consonanten, als auslautend, in
der Mandarinen- und Büchersprache kennt, fügen die Provinzial-Dialekte
den vocalisch endenden Wörtern sehr häufig solche hinzu.
In anderer Beziehung und wahrscheinlich auch in andrem Sinne ist
ganz neuerlich die Zweisylbigkeit aller consonantisch auslautenden
Sanskritwurzeln von Lepsius 101 behauptet worden. Die Nothwendigkeit
hiervon wird in dem in dieser Schrift aufgestellten consequenten und
scharfsinnigen Systeme daraus abgeleitet, dass im Sanskrit überhaupt
nur Sylbenabtheilung herrscht und die untheilbare Sylbe in der Weiterbildung
der Wurzel nicht einen einzelnen Buchstaben, sondern nur wieder
eine untheilbare Sylbe aus sich erzeugen kann. Der Verfasser dringt
nemlich auf die Nothwendigkeit, die Flexionslaute nur als organische
Entwicklungen der Wurzel, nicht aber als gleichsam willkührliche Einschiebungen
oder Anfügungen von Buchstaben anzusehen, und die Frage
läuft also darauf hinaus, ob man z. B. in bôdhâmi das â als den Endvocal
von budha oder als einen der Wurzel budh nur in der Conjugation
äusserlich hinzutretenden Vocal betrachten soll? Für den von uns hier
behandelten Gegenstand kommt es vorzugsweise auf die Bedeutung des
scheinbaren oder wirklichen Endconsonanten an. Da aber der Verfasser
sich in diesem ersten Theile seiner Schrift nur über den Vocalismus verbreitet,
so äussert er sich in ihr auch gar noch nicht über diesen Punkt.
Ich bemerke daher nur, dass, wenn man sich auch nicht des, doch nur
544bildlich scheinenden Ausdrucks einer eignen Weiterbildung der Wurzel
bedient, sondern von Anfügung und Einschiebung spricht, darum bei
richtiger Ansicht doch alle und jede Willkühr ausgeschlossen bleibt, indem
auch die Anfügung oder Einschiebung immer nur organischen Gesetzen
gemäss und vermöge derselben geschieht.
Wir haben schon im Vorigen gesehen, dass in Sprachen bisweilen
dem concreten Begriffe sein genetischer hinzugefügt wird, und da dies
einer der haupsächlichsten Wege ist, auf welchen in einsylbigen Sprachen
zweisylbige Wörter entstehen können, so muss ich hier noch einmal
darauf zurückkommen. Bei Naturgegenständen, die, wie Pflanzen,
Thiere u. s.w. sehr sichtbar in abgesonderte Classen fallen, finden sich
hiervon in allen Sprachen häufige Beispiele. In einigen aber treffen wir
diese Verbindung zweier Begriffe auf eine uns fremde Weise an und dies
ist es, wovon ich hier zu reden beabsichtige. Es ist nemlich nicht immer
gerade der wirkliche Gattungsbegriff des concreten Gegenstandes, sondern
der Ausdruck einer denselben in irgend einer allgemeinen Aehnlichkeit
unter sich begreifenden Sache, wie wenn der Begriff einer ausgedehnten
Länge mit den Wörtern: Messer, Schwerdt, Lanze, Brot,
Zeile, Strick u. s.f. verbunden wird, so dass die verschiedenartigsten
Gegenstände, bloss insofern sie irgend eine Eigenschaft mit einander
gemein haben, in dieselben Classen gesetzt werden. Wenn also diese
Wortverbindungen auf der einen Seite für einen Sinn logischer Anordnung
zeugen, so spricht aus ihnen noch häufiger die Geschäftigkeit lebendiger
Einbildungskraft; so, wenn im Barmanischen die Hand zum
generischen Begriff aller Arten von Werkzeugen, des Feuergewehrs so
gut, als des Meissels dient. Im Ganzen besteht diese Art des Ausdrucks
in einem, bald das Verständniss erleichternden, bald die Anschaulichkeit
vermehrenden Ausmalen der Gegenstände. In einzelnen Fällen
aber mag ihr eine wirkliche Nothwendigkeit der Verdeutlichung zum
Grunde liegen, wenn sie auch uns nicht mehr fühlbar ist. Wir stehen
überall den Grundbedeutungen der Wörter fern. Was in allen Sprachen
Luft, Feuer, Wasser, Mensch u. s. f. heisst, ist für uns bis auf wenige
Ausnahmen bloss ein conventioneller Schall. Was diesen begründete,
die Uransicht der Völker von den Gegenständen nach ihren, das Wortzeichen
bestimmenden Eigenschaften bleibt uns fremd. Gerade hierin
aber kann die Nothwendigkeit einer Verdeutlichung durch Hinzufügung
eines generischen Begriffes liegen. Gesetzt z. B. das Chinesischeji,
Sonne und Tag, habe ursprünglich das Erwärmende, Erleuchtende bedeutet,
so war es nothwendig, ihm tseoû, als Wort für ein materielles,
kugelförmiges Object hinzuzufügen, um begreiflich zu machen, dass
man nicht die in der Luft verbreitete Wärme oder Helligkeit, sondern
den wärmenden und erleuchtenden Himmelskörper meint. Aus ähnlicher
Ursach konnte dann der Tag mit Hinzufügung von tseù durch eine
545andere Metapher der Sohn der Wärme und des Lichts genannt werden.
Sehr merkwürdig ist es, dass die eben genannten Ausdrücke nur dem
neuern, nicht dem alten Chinesischen Style angehören, da die in ihnen
nach dieser Erklärungsart enthaltene Vorstellungsweise eher die ursprünglichere
scheint. Dies begünstigt die Meinung, dass diese in der
Absicht gebildet worden sind, Misverständnissen, die aus dem Gebrauche
desselben Wortes für mehrere Begriffe oder für mehrere Schriftzeichen
entstehen konnten, vorzubeugen. Sollte aber die Sprache noch,
gerade in späterer Zeit, auf diese Weise metaphorisch nachbildend seyn
und sollte sie nicht vielmehr zur Erreichung eines blossen Verstandeszweckes
auch ähnliche Mittel angewandt und daher den Tag anders, als
durch einen Verwandtschaftsbegriff unterschieden haben?
Ich kann hierbei einen Zweifel nicht unterdrücken, den ich schon
sehr oft bei Vergleichung des alten und neuen Styls gehegt habe. Wir
kennen den alten bloss aus Schriften und grossentheils nur aus philosophischen.
Von der geredeten Sprache jener Zeit wissen wir nichts. Sollte
nun nicht Manches, ja vielleicht Vieles, was wir jetzt dem neuern Styl
zuschreiben, schon im alten, als geredete Sprache im Schwange gewesen
seyn? Eine Thatsache scheint hierfür wirklich zu sprechen. Der ältere
Styl des koù wên enthält, wenn man die Zusammenfügungen mehrerer
abrechnet, eine massige Anzahl von Partikeln, der neuere, kouân
hoá, eine viel grössere, besonders solcher, welche grammatische Verhältnisse
näher bestimmen. Gleichsam als einen dritten, sich von beiden
wesentlich unterscheidenden muss man den historischen, wên
tchang, ansehen und dieser macht von den Partikeln einen sehr sparsamen
Gebrauch, ja enthält sich derselben fast gänzlich. Dennoch beginnt
der historische Styl zwar später, als der ältere, aber doch schon etwa
zweihundert Jahre vor unsrer Zeitrechnung. Nach dem gewöhnlichen
Bildungsgange der Sprachen ist diese verschiedenartige Behandlung eines,
im Chinesischen doppelt wichtigen Redetheils, wie die Partikeln
sind, unerklärbar. Nimmt man hingegen an, dass die drei Style nur drei
Bearbeitungen derselben geredeten Sprache zu verschiedenen Zwecken
sind, so wird dieselbe begreiflich. Die grössere Häufigkei der Partikeln
gehörte natürlich der geredeten Sprache an, welche immer begierig ist,
sich durch neue Zusätze verständlicher zu machen, und in dieser Hinsicht
auch das wirklich unnütz Scheinende nicht zurückstösst. Der ältere
Styl, schon durch die von ihm behandelte Materie Anstrengung voraussetzend,
schmälerte den Gebrauch der Partikeln in Absicht der
Verdeutlichung, fand aber in ihnen ein treffliches Mittel, durch Unterscheidung
der Begriffe und Sätze dem Vortrage eine, der inneren logischen
Anordnung der Gedanken entsprechende, symmetrische Stellung
des Ausdrucks zu geben. Der historische hat denselben Grund, die
Häufigkeit der Partikeln zu verwerfen, als jener, nicht aber den nemlichen
546Beruf, sie doch wieder zu anderem Zwecke in seinen Kreis zu ziehen.
Er schrieb für ernste Leser, aber in einfacherer Erzählung über
leicht verständliche Gegenstände. Von diesem Unterschiede mag es herstammen,
dass historische Schriften sich sogar des Gebrauchs der gewöhnlichen
Schlusspartikel (yè) bei Uebergängen von einer Materie zur
andren überheben. Der neuere Styl des Theaters, der Romane und der
leichteren Dichtungsarten musste, da er die Gesellschaft und ihre Verhältnisse
selbst darstellte und redend einführte, auch das ganze Gewand
ihrer Sprache und daher ihren ganzen Partikelvorrath annehmen. 102
Ich kehre nach dieser Abschweifung zu den vermittelst Hinzusetzung
eines genetischen Ausdrucks entstehenden, scheinbar zweisylbigen
Wörtern in einsylbigen Sprachen zurück. Sie können, insofern man
darunter Ausdrücke für einfache Begriffe versteht, an deren Bezeichnung
die einzelnen Sylben nicht als solche, sondern nur verbunden
Theil haben, auf zwiefachem Wege entstehen, nemlich relativ für das
spätere Verständniss oder wirklich absolut an und für sich. Der Ursprung
des generischen Ausdrucks kann aus dem Gedächtniss der Nation
entschwinden und der Ausdruck selbst dadurch zum bedeutungslosen
Zusatz werden. Dann ruht der Begriff des ganzen Wortes zwar
wirklich auf beiden Sylben desselben; es ist aber nur relativ für uns,
dass er sich nicht mehr aus den Bedeutungen der einzelnen zusammensetzen
lässt. Der Zusatz selbst aber kann auch bei bekannter Bedeutung
und Häufigkeit der Anwendung durch gleichsam gedankenlosen Gebrauch
zu Gegenständen hinzutreten, mit welchen er in gar keiner Beziehung
steht, so dass er in der Verbindung wieder bedeutungslos wird.
Dann liegt der Begriff des ganzen Wortes wirklich in der Vereinigung
beider Sylben, es ist aber eine absolute Eigenschaft desselben, dass die
Bedeutung nicht aus der Vereinigung des Sinnes der einzelnen hervorgeht.
Dass beide Arten dieser Zweisylbigkeit leicht durch den Uebergang
der Wörter von einer Sprache in eine andere entstehen können,
ergiebt sich von selbst. Eine besondere Gattung solcher theils noch erklärlicher,
theils unerklärlicher Zusammenfügungen legt der Sprachgebrauch
einiger Sprachen der Rede als nothwendig auf, wenn Zahlen mit
concreten Gegenständen verbunden werden. Vier Sprachen sind mir
bekannt, in welchen dies Gesetz in merkwürdiger Ausdehnung gilt: die
Chinesische, Barmanische, Siamesische und Mexicanische. Gewiss
giebt es aber deren mehrere und einzelne Beispiele finden sich wohl in
allen, namentlich auch in der unsrigen. Es vereinigen sich, wie es mir
scheint, zwei Ursachen in diesem Gebrauche: einmal die allgemeine
Hinzufügung eines generischen Begriffs, von der ich eben gesprochen
habe, dann aber auch die besondre Natur gewisser, unter eine Zahl gebrachter
Gegenstände, wo, wenn man nicht ein wirkliches Mass angiebt,
547die zu zählenden Individuen erst künstlich geschaffen werden
müssen, wie wenn man vier Köpfe Kohl zu ein Bund Heu u. s.f. sagt
oder wo man durch die allgemeine Zahl die Verschiedenheiten der gezählten
Gegenstände gleichsam vertilgen will, wie in dem Ausdruck:
vier Häupter Rinder Kühe und Stiere einbegriffen sind. Von den vier
genannten Sprachen hat nun keine diesen Gebrauch so weit, als die
Barmanische ausgedehnt. Ausser einer grossen Zahl für bestimmte
Classen wirklich festgesetzter Ausdrücke kann noch der Redende immer
jedes Wort der Sprache, welches eine, mehrere Gegenstände unter
sich befassende Aehnlichkeit andeutet, zu diesem Zwecke gebrauchen
und endlich giebt es noch ein allgemeines, auf alle Gegenstände jeglicher
Art anwendbares Wort (hku). Das Compositum wird übrigens so
gebildet, dass, von der Grösse der Zahl abhängende Unterschiede abgerechnet,
das concrete Wort das Anfangs-, die Zahl das Mittel- und der
generische Ausdruck das Endglied ausmacht. Wenn der concrete Gegenstand
auf irgend eine Weise dem Hörenden bekannt seyn muss, wird
der generische allein gebraucht. Bei dieser Ausdehnung müssen solche
Composita, da schon der blosse Gebrauch der Einheit, als unbestimmten
Artikels sie hervorruft, besonders im Gespräche sehr häufig vorkommen. 103
Indem mehrere der generischen Begriffe durch Wörter ausgedrückt
werden, bei welchen man gar keine Beziehung auf die
concreten Gegenstände errathen kann oder die auch wohl ausser diesem
Gebrauche ganz bedeutungslos geworden sind, so werden diese
Zahlwörter in den Grammatiken auch wohl Partikeln genannt. Ursprünglich
aber sind sie allemal Substantiva.
Aus dem hier Entwickelten ergiebt sich für die Andeutung grammatischer Verhältnisse durch besondere Laute, so wie für den Sylbenumfang
der Wörter, dass, wenn man die Chinesische und Sanskritsprache
als die äussersten Punkte betrachtet, in den dazwischen liegenden Sprachen,
sowohl den die Sylben aus einander haltenden, als den nach ihrer
Verbindung unvollkommen strebenden, ein stufenweis wachsendes
Hinneigen zu sichtbarer grammatischer Andeutung und zu freierem
Sylbenumfange obwaltet. Ohne nun hieraus Folgerungen über ein solches
geschichtliches Fortschreiten zu ziehen, begnüge ich mich, hier
dies Verhältniss im Ganzen angezeigt und einzelne Arten desselben dargelegt
zu haben.
Anmerkungen548
1voir Ich fasse unter diesem Namen mit der Bevölkerung von Malacca die Bewohner
aller Inseln des grossen südlichen Oceans zusammen, deren Sprachen
mit der im engeren Verstande Malayisch genannten auf Malacca zu einem
und ebendemselben Stamm gehören. Ueber die Aussprache des Namens s.
l.Buch. S. 12. Anm. 2.
2voir Der Name dieses Districts, der sehr verschieden geschrieben wird, findet
sich in obiger Schreibung in der Barmanischen Sprache. S. Judsons Lex.
h. v.
5voir Dieser Name hat dergestalt Sanskritische Form und Klang, dass man sich
nicht enthalten kann, ihn für eine von gebildeten Malayen-Stämmen ungebildet
gebliebenen gegebene Benennung zu halten. Schon dieser Umstand
dürfte wohl auf eine viel frühere Scheidung dieser zwiefachen Bevölkerung
hinweisen.
6voir Klaproth hat gründlich und gelehrt die Unrichtigkeit der Behauptung bewiesen,
dass es auf dem, Tibet und die kleine Bucharei abscheidenden Gebirge
Kuen lun unter dem 35sten Grade N. B. und auf den Bergen zwischen Anam
und Kamboja schwarze Völkerstämme gebe. Nouv. Journ. Asiat. XII. 232-243.
11voir Herr Dr. Meinicke in Prenzlow, von dessen gründlicher Forschung und seit
mehreren Jahren diesem Theile der Völkerkunde gewidmeten Studien sich
mit Recht etwas Bedeutendes erwarten lässt, richtet seine Untersuchungen
vorzugsweise auf den Punkt, ob nicht vielleicht die Negrito-Race die einzige
Grundlage der ganzen jetzigen Inselbevölkerung, nur allmählich verändert
durch Vermischung mit fremden Einwanderern und durch hinzugekommene
Cultur, ausmacht, so dass die Frage nach einem andren Ursprung des Malayischen
Völkerstammes von selbst in nichts zerfiele?
13voir Man vergleiche meine Abhandlung über die Aufgabe des Geschichtschreibers
in den Abhandlungen der historisch-philologischen Classe der Berliner
Akademie 1820 bis 1821. S. 322.
16voir Hieraus erklärt sich nun auch, warum in der Form der Sanskrit-Wurzeln keine
Rücksicht auf die Wohllautsgesetze genommen wird. Die auf uns gekommenen
Wurzelverzeichnisse tragen in Allem das Gepräge einer Arbeit der
Grammatiker an sich, und eine ganze Zahl von Wurzeln mag nur ihrer Abstraction
ihr Daseyn verdanken. Pott's treffliche Forschungen (Etymologische
Forschungen. 1833.) haben schon sehr viel in diesem Gebiete aufgeräumt,
und man darf sich noch viel mehr von der Fortsetzung derselben versprechen.
17voir Einige besonders merkwürdige Beispiele dieser Art finden sich in meiner
Abhandlung über das Entstehen der grammatischen Formen. Abhandlungen
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1822. 1823. Historischphilologische
Classe. S. 413.
18voir Den Einfluss der Zweisylbigkeit der Semitischen Wurzelwörter hat Ewald in
seiner Hebräischen Grammatik (S. 144. §. 93. S. 165. §. 95.) nicht nur ausdrücklich
bemerkt, sondern durch die ganze Sprachlehre in dem in ihr waltenden
Geiste meisterhaft dargethan. Dass die Semitischen Sprachen dadurch,
dass sie ihre Wortformen und zum Theil ihre Wortbeugungen fast ausschliesslich
durch Veränderungen im Schoosse der Wörter selbst bilden, einen
eignen Charakter erhalten, ist von Bopp ausführlich entwickelt und auf die
Eintheilung der Sprachen in Classen auf eine neue und scharfsinnige Weise
angewandt worden. (Vergleichende Grammatik. S. 107-113.)
19voir Bopp hat (Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 1834. II. Band. S. 465.)
zuerst bemerkt, dass der gewöhnliche Gebrauch des Potentialis darin besteht,
allgemein kategorische Behauptungen, getrennt und unabhängig von jeder
besondren Zeitbestimmung, auszudrücken. Die Richtigkeit dieser Bemerkung
bestätigt sich durch eine Menge von Beispielen, besonders in den moralischen
Sentenzen des Hitöpadesa. Wenn man aber genauer über den Grund
dieser, auf den ersten Anblick auffallenden Anwendung dieses Tempus nachdenkt,
so findet man, dass dasselbe doch in ganz eigentlichem Sinne in diesen
Fällen als Conjunctivus gebraucht wird, nur dass die ganze Redensart elliptisch
erklärt werden muss. Anstatt zu sagen: der Weise handelt nie anders,
sagt man: der Weise würde so handeln, und versteht darunter die ausgelassenen
Worte unter allen Bedingungen und zu jeder.Zeit. Ich möchte daher den
Potentialis wegen dieses Gebrauches keinen Nothwendigkeits-Modus nennen.
Er scheint mir vielmehr hier der ganz reine und einfache, von allen materiellen
Nebenbegriffen des Könnens, Mögens, Sollens u. s. w. geschiedne
Conjunctivus zu seyn. Das Eigenthümliche dieses Gebrauchs liegt in der hinzugedachten
Ellipse und nur insofern im sogenannten Potentialis, als dieser
gerade durch die Ellipse, vorzugsweise vor dem Indicativus, motivirt wird.
Denn es ist nicht zu läugnen, dass der Gebrauch des Conjunctivus, gleichsam
durch die Abschneidung aller andren Möglichkeiten, hier stärker wirkt, als
der einfach aussagende Indicativ. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil es nicht
unwichtig ist, den reinen und gewöhnlichen Sinn grammatischer Formen so
weit beizubehalten und zu schützen, als man nicht unvermeidlich zum Gegentheile
gezwungen wird.
20voir Von dieser Verwechslung einer grammatischen Form mit der andren habe
ich in meiner Abhandlung über das Entstehen der grammatischen Formen
ausführlicher gehandelt. Abhandl. d. Akad. d. Wissensch. zu Berl. 1822.
1823. Hist.-philol. Classe. S. 404-407.
21voir Ueber die Verwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen
Sprachen, in den Abhandlungen der historisch-philologischen Classe der
Berliner Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1829. S. 1-6. Man
vergleiche auch die Abhandlung über den Dualis, ebendaselbst aus dem Jahre
1827. S. 182-185.
22voir Ich entlehne die einzelnen in dieser Schrift über den Sanskritischen Sprachbau
erwähnten Data, auch wo ich die Stellen nicht besonders anführe, aus
Bopp's Grammatik und gestehe gern, dass ich die klarere Einsicht in denselben
allein diesem classischen Werke verdanke, da keine der früheren
Sprachlehren, wie verdienstvoll auch einige in andrer Hinsicht sind, sie in
gleichem Grade gewährt. Sowohl die SanskritGrammatik in ihren verschiednen
Ausgaben, als die später erschienene vergleichende und die einzelnen
akademischen Abhandlungen, welche eine ebenso fruchtbare, als talentvolle
Vergleichung des Sanskrits mit den verwandten Sprachen enthalten,
werden immer wahre Muster tiefer und glücklicher Durchschauung, ja
oft kühner Ahndung der Analogie der grammatischen Formen bleiben, und
das Sprachstudium verdankt ihnen schon jetzt die bedeutendsten Fortschritte
in einer zum Theil neu eröffneten Bahn. Schon im Jahre 1816. legte
Bopp in seinem Conjugationssystem der Indier den Grund zu den Untersuchungen,
die er später und immer in der nemlichen Richtung so glücklich
verfolgte.
23voir Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 1827. S. 281. Bopp macht diese
Bemerkung nur bei Gelegenheit der unmittelbar anfügenden Abwandlungen.
Das Gesetz scheint mir aber allgemein durchgehend zu seyn. Selbst die
scheinbarste Einwendung dagegen, die Verwandlung des r-Vocals in ur in
den gunalosen Beugungen des Verbum kri (kurutas), lässt sich anders erklären.
24voir Herr Dr. Lepsius erklärt auf eine die Analogie dieser Lautumstellungen sinnreich
erweiternde Weise ar und är für Diphthongen des r-Vocals. Man lese
hierüber seine, der Sprachforschung eine neue Bahn vorzeichnende, an
scharfsinnigen Erörterungen reichhaltige Schrift: Paläographie als Mittel für
die Sprachforschung. S. 46-49. §. 36-39. selbst nach.
25voir Bopp vertheidigt (Lateinische Sanskrit-Grammatik, r. 33.) die erstere dieser
Meinungen. Wenn es mir aber erlaubt ist, von diesem gründlichen Forscher
abzuweichen, so möchte ich mich für die letztere erklären. Bei der Boppschen
Annahme lässt sich kaum noch der enge Zusammenhang des Guna
und Wriddhi mit den allgemeinen Lautgesetzen der Sprache retten, da ungleiche
einfache Vocale, ohne dass es irgend auf ihre Länge oder Kürze ankommt,
immer in die, allerdings schwächeren Diphthongen des Guna übergehen.
Da die Natur des Diphthongen auch wesentlich nur in der Ungleichartigkeit
der Töne liegt, so ist es begreiflich, dass Länge und Kürze von dem
neuen Laute, ohne zurückbleibenden Unterschied, verschlungen werden.
Erst wenn eine neue Ungleichartigkeit in das Spiel tritt, entsteht eine VerStärkung
des Diphthongen. Ich glaube daher nicht, dass die Guna-Diphthongen
ursprünglich gerade aus kurzen Vocalen zusammenschmelzen.
Dass sie gegen die Diphthongen des Wriddhi bei ihrer Auflösung ein kurzes
a annehmen (ay, aw gegen äy, äw), lässt sich auf andre Weise erklären. Da
der Unterschied der beiden Lauterweiterungen nicht am Halbvocal kenntlich
gemacht werden konnte, so musste er in die Quantität des Vocals der
neuen Sylbe fallen. Dasselbe gilt vom Vocal-r.
26voir Dies hat vielleicht wesentlich beigetragen, Friedrich Schlegel zu seiner, allerdings
nicht zu billigenden Theorie einer Eintheilung aller Sprachen (Sprache
und Weisheit der Indier. S. 50.) zu führen. Es ist aber bemerkenswerth
und, wie es mir scheint, zu wenig anerkannt, dass dieser tiefe Denker und
geistvolle Schriftsteller der erste Deutsche war, der uns auf die merkwürdige
Erscheinung des Sanskrits aufmerksam machte, und dass er schon in einer
Zeit bedeutende Fortschritte darin gethan hatte, wo man von allen jetzigen
zahlreichen Hülfsmitteln zur Erlernung der Sprache entblösst war. Selbst
Wilkins Grammatik erschien erst in demselben Jahre, als die angeführte
Schlegelsche Schrift.
27voir In einer, von mir im Jahre 1828. im Französischen Institute gelesenen Abhandlung:
über die Verwandtschaft des Griechischen Plusquamperfectum,
der reduplicirenden Aoriste und der Attischen Perfecta mit einer Sanskritischen
Tempusbildung, habe ich die Uebereinstimmung und die Verschiedenheit
beider Sprachen in diesen Formen ausführlich auseinandergesetzt
und dieselbe aus ihren Gründen herzuleiten versucht.
28voir Was ich hier über diese Form des Praeteritum der Causalverba sage, habe
ich aus einer ausführlichen, schon vor Jahren über diese Tempusformen ausgearbeiteten
Abhandlung ausgezogen. Ich bin in derselben alle Wurzeln der
Sprache, nach Anleitung der zu solchen Arbeiten vortrefflichen Forsterschen
Grammatik, durchgegangen, habe die verschiedenen Bildungen auf
ihre Gründe zurückzuführen gesucht und auch die einzelnen Ausnahmen
angemerkt. Die Arbeit ist aber ungedruckt geblieben, weil es mir schien,
dass eine so specielle Ausführung sehr selten vorkommender Formen nur
sehr wenige Leser interessiren könnte.
29voir Die sogenannten accentlosen Wörter der Griechischen Sprache scheinen
mir dieser Behauptung nicht zu widersprechen. Es würde mich aber zu weit
von meinem Hauptgegenstande abführen, wenn ich hier zu zeigen versuchte,
wie sie meistentheils sich, als dem Accent des nachfolgenden Wortes vorangehende
Sylben, vorn an dasselbe anschliessen, in den Wortstellungen
aber, welche eine solche Erklärung nicht zulassen (wie ούκ in Sophocles.
Oedipus Rex. v. 334-336. Ed. Brunckii), wohl in der Aussprache eine
schwache, nur nicht bezeichnete Betonung besassen. Dass jedes Wort nur
Einen Hauptaccent haben kann, sagen die Lateinischen Grammatiker ausdrücklich.
Cicero. Orat. 18. natura, quasi modularetur hominum orationem,
in omni verbo posuit acutam vocem nee una plus. Die Griechischen
Grammatiker behandeln die Betonung überhaupt mehr wie eine Beschaffenheit
der Sylbe, als des Wortes. In ihnen ist mir keine Stelle bekannt, welche
die Accent-Einheit des letzteren als allgemeinen Canon ausspräche. Vielleicht
Hessen sie sich durch die Fälle irre machen, in welchen ein Wort wegen
enklitischer Sylben zwei Accentzeichen erhält, wo aber wohl das der
Anlehnung zugehörende immer nur einen Nebenaccent bildete. Dennoch
fehlt es auch bei ihnen nicht an bestimmten Andeutungen jener nothwendigen
Einheit. So sagt Arcadius (περὶ τόνων. Ed. Barkeri. p. 190.) von Aristophanes:
τὸν μὲν ὀξὺν τόνον ἐν ἅπαντι μέρει καϑαρῷ ἅπαο
ἐμφαίνεσϑαι δοκιμάσας.
30voir Dies nennen die Griechischen Grammatiker den schlummernden Ton der
Sylbe erwecken. Sie bedienen sich auch des Ausdrucks des Zurückwerfens
des Tones (ἀναβιβάξειν τὸν τόνον) . Diese letztere Metapher ist aber weniger
glücklich. Der ganze Zusammenhang der Griechischen Accentlehre zeigt,
dass das, was hier wirklich vorgeht, das oben Beschriebene ist.
32voir Ich erlaube mir hier eine Bemerkung über die Aussprache des Namens Mexico.
Wenn wir dem x in diesem Worte den bei uns üblichen Laut geben, so ist
dies freilich unrichtig. Wir würden uns aber noch weiter von der wahren
einheimischen Aussprache entfernen, wenn wir der Spanischen, in der neuesten,
noch tadelnswürdigeren Schreibung Mejico ganz unwiderruflich gewordenen
durch den Gurgellaut ch folgten. Der einheimischen Aussprache
gemäss ist der dritte Buchstabe des Namens des Kriegsgottes Mexitli und des
davon herkommenden der Stadt Mexico ein starker Zischlaut, wenn sich
auch nicht genau angeben lässt, in welchem Grade derselbe sich unserm sch
nähert. Hierauf wurde ich zuerst dadurch geführt, dass Castilien auf Mexicanische
Weise Caxtil, und in der verwandten Cora-Sprache das Spanische
pesar, wägen, pexuvi geschrieben wird. Noch deutlicher fand ich diese Muthmassung
bestätigt durch Gilij's Art, das im Mexicanischen gebrauchte x Italienisch
durch sc wiederzugeben. (Saggio cli storia Americana. III. 343.) Da
ich denselben oder einen ähnlichen Zischlaut auch in mehreren anderen
Amerikanischen Sprachen von den Spanischen Sprachlehrern mit x geschrieben
fand, so erklärte ich mir diese Sonderbarkeit aus dem Mangel des
se/z-Lauts in der Spanischen Sprache. Da die Spanischen Grammatiker in
ihrem eignen Alphabete keinen ihm entsprechenden fanden, so wählten sie
zu seiner Bezeichnung das bei ihnen zweideutige und ihrer Sprache selbst
fremde x. Späterhin fand ich dieselbe Erklärung dieser Buchstabenverwechslung
bei dem Exjesuiten Camano, der geradezu den in der Chiquitischen
Sprache (im Innren von Südamerika) mit x geschriebenen Laut mit dem
Deutschen sch und dem Französischen ch vergleicht und denselben Grund
für den Gebrauch des x angiebt. Diese Aeusserung findet sich in seiner sehr
systematischen und vollständigen handschriftlichen Chiquitischen Grammatik,
die ich der Güte des Etatsraths von Schlözer als ein Geschenk aus dem
Nachlasse seines Vaters verdanke. Um der einheimischen Aussprache nahe
zu bleiben, müsste man also die Hauptstadt Neuspaniens ungefähr wie die
Italiäner aussprechen, genauer genommen aber so, dass der Laut zwischen
Messico und Meschico fiele.
33voir Der Endlaut dieses Worts, der durch seine häufige Wiederkehr gewissermassen
zum charakteristischen der Mexicanischen Sprache wird, findet sich bei
den Spanischen Sprachlehrern durchaus mit tl geschrieben. Tapia Zenteno
(Arte novissima de lengua Mexicana. 1753. p. 2. 3.) nur bemerkt, dass die
beiden Consonanten zwar im Anfange und in der Mitte der Wörter wie im
Spanischen ausgesprochen würden, dagegen am Ende nur Einen, sehr
schwer zu erlernenden Laut bildeten. Nachdem er diesen sehr undeutlich
beschrieben hat, tadelt er ausdrücklich, wenn tlatlacolli, Sünde, und tlamantli,
Schicht, claclacolli und clamancli ausgesprochen würden. Da ich
aber, durch die gefällige Vermittlung meines Bruders, Herrn Alaman und
Herrn Castorena, einen Mexicanischen Eingebornen, über diesen Punkt
schriftlich befragte, erhielt ich zur Antwort, dass die heutige Aussprache des
tl allgemein und in allen Fällen die von cl ist. Der Cora-Sprache fehlt das l
und sie nimmt daher bei Mexicanischen Wörtern nur den ersten Buchstaben
des tl in sich auf. Aber auch die Spanischen Grammatiker dieser Sprache
setzen dann immer ein t (nie ein c), so dass tlatoani, Gouverneur, tatoani
lautet. Ich schrieb den Herren Alaman und Castorena noch einmal und stellte
ihnen die aus der Cora-Sprache hervorgehende Einwendung entgegen.
Die Antwort blieb aber dieselbe, als zuvor. An der heutigen Aussprache ist
daher nicht zu zweifeln. Man geräth nur in Verlegenheit, ob man annehmen
soll, dass die Aussprache sich mit der Zeit verändert hat, von t zu k übergegangen
ist, oder ob die Ursach darin liegt, dass der dem vorhergehende Laut
ein dunkler zwischen t und k schwebender ist? Auch in der Aussprache von
Eingebornen von Tahiti und den Sandwich-Inseln habe ich selbst erprobt,
dass diese Laute kaum von einander zu unterscheiden sind. Ich halte den
zuletzt angedeuteten Grund für den richtigen. Die Spanier, welche sich zuerst
ernsthaft mit der Sprache beschäftigten, mochten den dunklen Laut wie
ein t auffassen, und da sie ihn auf diese Weise in ihre Schreibung aufnahmen,
so mag man hierbei stehen geblieben seyn. Auch aus Tapia Zenteno's
Aeusserung scheint eine gewisse Unentschiedenheit des Lauts hervorzugehen,
die er nur nicht in ein nach Spanischer Weise deutliches cl ausarten
lassen will.
34voir John Eliot's Massachusetts Grammar, herausgegeben von John Pickering.
Boston. 1822. Man vergleiche auch David Zeisberger's Delaware Grammar,
übersetzt von Du Ponceau. Philadelphia. 1827. und Jonath. Edwards observations
on the language of the Muhhekaneew Indians, herausgegeben von
John Pickering. 1823.
35voir Den engen Zusammenhang zwischen der Volkstümlichkeit der verschiedenen
Griechischen Stämme und ihrer Dichtung, Musik, Tanz- und Geberdenkunst und
selbst ihrer Architektur hat Böckh in den, seine Ausgabe des Pindar
begleitenden Abhandlungen, in welchen dem Studium des Lesers ein
reicher Schatz mannigfaltiger und grossentheils bis dahin verborgener Gelehrsamkeit
in methodisch fasslicher Anordnung dargeboten wird, in klares
und volles Licht gestellt. Denn er begnügt sich nicht, den Charakter der
Tonarten in allgemeinen Ausdrücken zu schildern, sondern geht in die einzelnen
metrischen und musikalischen Punkte ein, an welche ihre Verschiedenheit
sich anknüpft, was vor ihm niemals auf diese gründlich historische
und genau wissenschaftliche Weise geschehen war. Es wäre ungemein zu
wünschen, dass dieser, die ausgedehnteste Kenntniss der Sprache mit einer
seltenen Durchschauung des Griechischen Alterthums in allen seinen Theilen
und nach allen Richtungen hin verbindende Philologe recht bald seinen
Entschluss ausführte, dem Einfluss des Charakters und der Sitten der einzelnen
Griechischen Stämme auf ihre Musik, Poesie und Kunst eine eigne
Schrift zu widmen, um diesen wichtigen Gegenstand in seinem ganzen Umfange
abzuhandeln. Man sehe seine Aeusserungen über ein solches Vorhaben
in seiner Ausgabe des Pindar. Tom. I. de metris Pindari. p. 253 nt. 14.,
besonders aberp. 279.
36voir Eine sehr geistvolle und von tiefer und gründlicher Lesung der Alten zeugende
Uebersicht des Ganges der Griechischen Literatur in Absicht auf Redefügung
und Styl giebt die Einleitung zu Bernhardy's wissenschaftlicher
Syntax der Griechischen Sprache.
39voir Unübertrefflich gesagt und mit eignem Dichtergefühl empfunden ist in der
Vorrede zu A. W. v. Schlegel's Râmâyana die Auseinandersetzung über die
früheste Poesie bei den Griechen und Indiern. Welcher Gewinn wäre es für
die philosophische und ästhetische Würdigung beider Literaturen und für
die Geschichte der Poesie, wenn es diesem, vor allen andren mit den Gaben
dazu ausgestatteten Schriftsteller gefiele, die Literaturgeschichte der Indier
zu schreiben oder doch einzelne Theile derselben, namentlich die dramatische
Poesie zu bearbeiten und einer ebenso glücklichen Kritik zu unterwerfen,
als das Theater anderer Nationen von seiner wahrhaft genialen Behandlung
erfahren hat.
40voir Ich habe diese Frage in Absicht der uns grammatisch bekannten Amerikanischen
Sprachen in einer eignen, in einer der Classensitzungen der Berliner
Akademie gelesenen Abhandlung zu beantworten versucht.
41voir Wenn ich es hier versuche, der Behauptung Haughton's (Ausg. des Manu. Th.
I. S. 329.) eine grössere Ausdehnung zu geben, so schmeichle ich mir, dass
dieser treffliche Gelehrte dies vielleicht selbst gethan haben würde, wenn es
ihm nicht an der angeführten Stelle, wie es scheint, weniger um diese etymologische
Muthmassung, als um die logische Feststellung des Verbum neutrum
und des Passivum zu thun gewesen wäre. Denn man muss offenherzig gestehen,
dass der Begriff des Gehens durchaus nicht gerade mit dem des Passivum
an sich, sondern erst dann einigermassen übereinstimmt, wenn man dies mehr
in Verbindung mit dem Begriff des Verbum neutrum als ein Werden betrachtet.
So erscheint es auch nach Haughton's Anführung im Hindostanischen,
wo es dem Seyn entgegensteht. Auch die neueren Sprachen, welchen es an
einem, den Uebergang zum Seyn direct und ohne Metapher ausdrückenden
Worte, wie es das Griechische yiveo-öcu, das Lateinische fieri und unser werden
ist, fehlt, nehmen zu dem bildlichen Ausdruck des Gehens ihre Zuflucht,
nur dass sie es sinnvoller, sich gleichsam an das Ziel des Ganges stellend, als
ein Kommen auffassen: diventare, divenire, devenir, to become. Im Sanskrit
muss daher immer, auch bei der Voraussetzung der Richtigkeit jener Etymologie,
die Hauptkraft des Passivum in der neutralen Conjugation (der des Atmanepadam)
liegen und die Verbindung dieser mit dem Gehen erst das Gehen
auf sich selbst bezogen, als eine innerliche, nicht nach aussen zu bewirkende
Veränderung bezeichnen. Es ist in dieser Hinsicht nicht unmerkwürdig
und hätte von Haughton für seine Meinung angeführt werden können, dass
die Intensiva nur im Atmanepadam die Zwischensylbe ya annehmen, was
eine besondere Verwandtschaft des ya mit dieser Abwandlungsform verräth.
Auf den ersten Anblick ist es auffallend, dass sowohl im Passivum, als bei dem
Intensivum das ya in den generellen Zeiten, auf welche der Classenunterschied
nicht wirkt, hinwegfällt. Es scheint mir aber dies gerade ein neuer
Beweis, dass das Passivum sich aus dem Verbum neutrum der vierten Verbalclasse
entwickelte und dass die Sprache, überwiegend dem Gange der Formen
folgend, die aus jener Classe entnommene Kennsylbe nicht über sie hinausführen
wollte. Das sy der Desiderativa, welches auch seine Bedeutung seyn
möge, haftet auch in jenen Zeiten an den Formen und erfährt nicht die Beschränkung
der Classen-Tempora, weil es nicht mit diesen zusammenhängt.
Viel natürlicher, als auf das Passivum passt der Begriff des Gehens auf die
durch Anfügung eines y geformten Denominativa, die ein Verlangen, Aneignen,
Nachbilden einer Sache andeuten. Auch in den Causalverben kann derselbe
Begriff vorgewaltet haben und es möchte daher doch vielleicht nicht zu
misbilligen seyn, sondern vielmehr für eine Erinnerung der Abstammung gelten
können, wenn die Indischen Grammatiker als die Kennsylbe dieser Verba
i und ay nur als die nothwendige phonetische Erweiterung davon ansehen.
(Vergl. Bopp's Lat. Sanskrit-Gramm. S. 142. Anm. 233.) Die Vergleichung
der ganz gleichmässig gebildeten Denominativa macht dies sehr wahrscheinlich.
In den durch kâmy aus Nominen gebildeten Verben scheint diese Zusatzsylbe
eine Zusammensetzung von kâma, Begierde, und i, gehen, also selbst
ein vollständiges eignes Denominativverbum. Wenn es erlaubt ist, Muthmassungen
weiter auszudehnen, so Hesse sich das sy der Desideratiwerba als ein
Gehen in den Zustand erklären, was zugleich auf die Etymologie des zweiten
Futurum Anwendung fände. Was Bopp (über das Conjugationssystem der
Sanskritsprache. S. 29-33. Annals of oriental literature. S. 45-50.) sehr
scharfsinnig und richtig zuerst über die Verwandtschaft des Potentialis und
zweiten Futurum ausgeführt hat, kann sehr gut hiermit vereinigt werden. Den
Desiderativen scheinen die Denominativa mit der Kennsylbe sya und asya
nachgebildet.
42voir Ich folge nemlich der, wie es mir scheint, mit Unrecht jetzt zu oft verlassenen
Theorie der Griechischen Grammatiker, nach welcher jedes Tempus aus
der Verbindung einer der drei Zeiten mit einem der drei Stadien des Verlaufs
der Handlung besteht und die Harris in seinem Hermes und Reitz in,
leider zu wenig bekannten akademischen Abhandlungen vortrefflich ins
Licht gesetzt haben, Wolf aber durch die genaue Bestimmung der drei
Aoriste erweitert hat. Das Verbum ist das Zusammenfassen eines energischen
Attributivum (nicht eines bloss qualitativen) durch das Seyn. Im energischen
Attributivum liegen die Stadien der Handlung, im Seyn die der Zeit.
Dies hat Bernhardy meiner Ueberzeugung nach richtig begründet und erwiesen.
45voir Zwischen dem selbstständigen Pronomen codde, ich, und der entsprechenden
Verbalcharakteristik que ist zwar der Unterschied scheinbar grösser.
Das selbstständige Pronomen aber lautet im Accusativ qua und aus der Vergleichung
von codde mit dem Demonstrativpronomen odde sieht man deutlich,
dass der Wurzellaut der ersten Person nur im fc-Laut besteht, codde
aber eine zusammengesetzte Form ist.
46voir Die Nachrichten von dieser Sprache hat uns der sorgsame Fleiss des würdigen
Hervas erhalten. Er hatte den lobenswürdigen Gedanken, die aus
Amerika und Spanien vertriebnen Jesuiten, die sich in Italien niedergelassen
hatten, zur Aufzeichnung ihrer Erinnerungen der Sprachen der Amerikanischen
Eingebornen, bei denen sie Missionare gewesen waren, zu veranlassen.
Ihre Mittheilungen sammelte er und arbeitete sie, wo es nöthig war, um,
so dass hieraus eine Reihe handschriftlicher Grammatiken von Sprachen
entstand, über die uns zum Theil alle sonstigen Nachrichten fehlen. Ich habe
diese Sammlung schon, als ich Gesandter in Rom war, für mich abschreiben,
allein diese Abschriften durch die gütige Mitwirkung des jetzigen Preussischen
Gesandten in Rom, Herrn Bunsen, noch einmal mit der, seit Hervas
Tode im Collegio Romano niedergelegten Urschrift genau vergleichen lassen.
Die Mittheilungen über die Yarura-Sprache rühren vom Ex-Jesuiten
Forneri her.
48voir Was ich von dieser Sprache kenne, ist aus Hervas handschriftlicher Grammatik
entnommen. Er hatte diese Grammatik theils aus schriftlichen Mittheilungen
des Ex-Jesuiten Domingo Rodriguez, theils aus der gedruckten
Grammatik des Franciscaner-Geistlichen Gabriel de S. Buenaventura (Mexico.
1684.) geschöpft, welche er in der Bibliothek des Collegio Romano
fand. Ich habe mich vergebens bemüht, diese Grammatik in der gedachten
Bibliothek wiederzufinden. Sie scheint verloren gegangen zu seyn.
49voir Adelung's Mithridates. Th. III. Abth. 3. S. 20., wo nur Vater das Pronomen
nicht richtig erkannt und die Deutschen Wörter unrichtig auf die Mayischen
vertheilt hat.
52voir Man vergleiche hierüber, so wie bei diesem ganzen Abschnitt, Diefenbach's
höchst lesenswerthe Schrift über die jetzigen Romanischen Schriftsprachen.
54voir Diese Sätze hat Lepsius in seiner Palaeographie auf das klarste und befriedigendste
dargestellt und den Unterschied zwischen dem Anfangs-ß und dem
h in der Sanskritschrift gezeigt. Ich hatte im Bugis und in einigen andren,
verwandten Alphabeten erkannt, dass das Zeichen, das von allen Bearbeitungen
der Sprachen, welchen diese Alphabete angehören, ein Anfangs-ö
genannt wird, eigentlich gar kein Vocal ist, sondern einen schwachen, dem
Spiritus lenis der Griechen ähnlichen, consonantischen Hauch andeutet.
Alle von mir dort (Nouv. Journ. Asiat. IX. 489-494.) nachgewiesene Erscheinungen
lassen sich aber durch das von Lepsius über denselben Punkt
im Sanskrit-Alphabet Entwickelte besser und richtiger erklären.
55voir Grimm drückt dies in seiner glücklich sinnvollen Sprache folgendergestalt
aus: die Consonanz gestaltet, der Vocal bestimmt und beleuchtet das Wort.
(Deutsche Gramm. II. S. 1.)
57voir Transactions ofthe Historical and Literary Committee ofthe American Philosophical
Society. Philadelphia. 1819. Vol. 1. S. 405. u. flgd.
58voir Zeisberger (a. a. O.) bemerkt, dass mannitto hiervon eine Ausnahme bilde,
da man darunter Gott selbst, den grossen und guten Geist, verstehe. Es ist
aber sehr gewöhnlich, die religiösen Ideen ungebildeter Völker von der
Furcht vor bösen Geistern ausgehen zu sehen. Die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes könnte daher doch sehr leicht eine solche gewesen seyn. Ueber
den Rest des Wortes finde ich bei dem Mangel eines Delaware-Wörterbuchs
keine Auskunft. Auffallend, obgleich vielleicht bloss zufällig ist die Uebereinstimmung
dieses Ueberrestes mit dem Tagalischen anito, Götzenbild, (s.
meine Schrift über die Kawi-Sprache. 1. Buch. S. 75.)
59voir So verstehe ich nemlich Heckewelder. (Transactions. I. 411.) Auf jeden Fall
ist ape bloss Endung für aufrecht gehende Wesen, wie chum für vierfüssige
Thiere.
61voir Der Name, den die Barmanen sich selbst geben, ist Mranmâ. Das Wort wird
aber gewöhnlich Mrammâ geschrieben und Byammâ ausgesprochen. (Judson.
h. v.) Wenn es erlaubt ist, diesen Namen geradezu aus der Bedeutung
seiner Elemente zu erklären, so bezeichnet er einen kräftigen, starken Menschenschlag.
Denn mran heisst schnell und mâ hart, wohl, gesund seyn. Von
diesem einheimischen Worte sind ohne Zweifel die verschiedenen für das
Volk und das Land üblichen Schreibungen entstanden, unter welchen Barma
und Barmanen die richtige ist. Wenn Carey und Judson Burma und
Burmanen schreiben, so meinen sie denselben, dem Consonanten inhaerirenden
Laut und bezeichnen diesen nur auf eine falsche, jetzt allgemein aufgegebene
Weise. Man vergleiche auch Berghaus. Asia. Gotha. 1832.1. Lieferung.
Nr. 8. Hinterindien. S. 77. und Leyden. (Asiat, res. X. 232.)
62voir A Grammar of the Burman language. Serampore. 1814. S. 79. §. 1. S. 181.
Vorzüglich auch in der Vorrede S. 8. 9. Diese Grammatik hat Felix Carey,
den ältesten Sohn des William Carey, des Lehrers mehrerer Indischen Sprachen
am Collegium in Fort William, dem wir eine Reihe von Grammatiken
Asiatischer Sprachen verdanken, zum Verfasser. Felix Carey starb leider
schon im Jahre 1822. (Journ. Asiat. III. 59.) Sein Vater ist ihm im Jahre
1834. gefolgt.
64voir In beiden Sprachen ändert sich wegen dieses Wechsels der Aussprache der
Buchstabe in der Schrift nicht, obgleich die Barmanische, was der Fall der
Tamulischen nicht ist, Zeichen für alle tönenden Buchstaben besitzt. Der
Fall, dass die Aussprache sich von der Schrift entfernt, ist im Barmanischen
häufig. Ich habe über die hauptsächlichste dieser Abweichungen in den einsylbigen
Stammwörtern, wo z. B. das geschriebene kak in der Aussprache
ket lautet, in meinem Briefe an Herrn Jacquet (Nouv. Journ. Asiat. IX. 500.)
über die Polynesischen Alphabete die Vermuthung gewagt, dass die Beibehaltung
der von der Aussprache verschiedenen Schrift einen etymologischen
Grund habe, und bin auch noch jetzt dieser Meinung. Die Sache scheint mir
nemlich die, dass die Aussprache nach und nach von der Schrift abgewichen
ist, dass man aber, um die ursprüngliche Gestalt des Wortes kenntlich zu
erhalten, diesen Abweichungen in der Schrift nicht gefolgt ist. Leyden
scheint dieselbe Ansicht über diesen Punkt gehabt zu haben, da er (Asiat.
res. X. 237.) den Barmanen eine weichlichere, minder articulirte und mit der
gegenwärtigen Rechtschreibung der Sprache weniger übereinkommende
Aussprache, als den Rukheng, den Bewohnern von Aracan (bei Judson: Rarin),
zuschreibt. Es liegt aber auch in der Natur der Sache, dass es nicht füglich
anders damit seyn kann. Wäre in dem oben angeführten Beispiele nicht
früher wirklich kak gesprochen worden, so würde sich auch diese Endung
nicht in der Schrift befinden. Denn es ist ein gewisser und auch neuerlich
von Herrn Lepsius in seiner an scharfsinnigen Bemerkungen und feinen Beobachtungen
reichen Schrift über die Palaeographie als Mittel für die
Sprachforschung S. 6. 7. 89. genügend ausgeführter Grundsatz, dass nichts
in der Schrift dargestellt wird, was sich nicht in irgend einer Zeit in der Ausspräche
gefunden hat. Nur die Umkehrung dieses Satzes halte ich für mehr
als zweifelhaft, da es nicht leicht zu widerlegende Beispiele giebt, dass die
Schrift, wie auch sehr begreiflich ist, nicht immer die ganze Aussprache darstellt.
Dass im Barmanischen diese Lautveränderungen nur durch flüchtiger
werdende Aussprache entstanden sind, beweist Carey's ausdrückliche Bemerkung,
dass die von der Schrift abweichenden Endungen der einsylbigen
Wörter durchaus nicht rein, sondern sehr dunkel und kaum dem Ohre recht
unterscheidbar ausgesprochen werden. Der palatale Nasallaut wird sogar
nicht ungewöhnlich in der Aussprache in diesen Fällen am Ende der Wörter
ganz weggelassen. Daher kommt es, dass die in mehreren grammatischen
Beziehungen gebrauchte geschriebene Sylbe thang in der Aussprache bei
Carey bald theen (neinlich so, dass ee für ein langes i gilt. Tabelle nach S.
20.), bald thee (S. 36. §. 105.), bei Hough in seinem Englisch-Barmanischen
Wörterbuche gewöhnlich the (S. 14.) lautet, so dass die Verkürzung bald
stärker, bald geringer zu seyn scheint. In einem andren Punkte lässt sich historisch
beweisen, dass die Schrift die Aussprache eines andren Dialekts und
vermuthlich eines älteren bewahrt. Das Verbum seyn wird hri geschrieben
und bei den Barmanen shi ausgesprochen. In Aracan dagegen lautet es hi
und der Volksstamm dieser Provinz wird für älter und früher civilisirt, als
der der Barmanen gehalten. (Leyden. Asiat. res. X. 222. 237.)
65voir Nemlich nach Hough; das r wird bald wie r, bald wie y ausgesprochen und es
scheint hierüber keine sichere Regel zu geben. Klaproth (Asia polyglotta. S.
369.) schreibt das Wort jî nach Französischer Aussprache, giebt aber nicht
an, woher er seine Barmanischen Wörter genommen hat. Da die Aussprache
oft von der Schreibung abweicht, so schreibe ich die Barmanischen Wörter
genau nach der letzteren, so dass man nach der, im Anfange dieser Schrift
gegebenen Erläuterung über die Umschreibung des Barmanischen Alphabets
jedes von mir angeführte Wort genau in die Barmanischen Schriftzeichen
zurückübertragen kann. In Parenthese gebe ich alsdann die Aussprache
da, wo sie abweicht und mir mit Sicherheit bekannt ist. Ein H. an dieser
Stelle deutet an, dass Hough die Aussprache so angiebt. Ob Klaproth in der
Asia polyglotta der Schrift oder der Aussprache folgt, ist nicht deutlich zu
sehen. So schreibt er S. 375. für Zunge la und für Hand lek. Das erstere
Wort ist aber in der Schrift hlyä, in der Aussprache shyä, das letztere in der
Schrift lak, in der Aussprache let. Das bei ihm für Zunge angegebene ma
finde ich in meinen Wörterbüchern gar nicht.
66voir Carey's Grammatik hebt diese Art der Composita nicht heraus und erwähnt
derselben nicht besonders. Sie ergiebt sich aber von selbst, wenn man das
Barmanische Wörterbuch prüfend durchgeht. Auch scheint Judson auf diese
Gattung der Zusammensetzung hinzudeuten, wenn er v. pañ bemerkt, dass
dies Wort nur in Zusammensetzungen mit Wörtern ähnlicher Bedeutung gebraucht
wird. Ich lasse, um die Thatsache genau festzustellen, hier noch einige
Beispiele solcher Wörter folgen:
chî: und chî-nañː, auf etwas reiten oder fahren, nañː (neñː H.) für sich: auf
etwas treten;
tup (tôk. Nach Carey wird o wie im Englischen yoke, nach Hough wie im
Englischen go ausgesprochen) und tupkwa, knieen, kwa für sich: niedrig
seyn;
nâ und nâ-hkaṅ (nâ-gaṅ), horchen, aufmerken, hkaṅ für sich: nehmen,
empfangen;
pañ (peñ H.) und pañ-panː, ermüdet, erschöpft seyn, panː für sich dasselbe.
Den gleichen Sinn hat pañ-hrâː; hrâː (shâː) für sich heisst: zurückweichen,
aber auch: in geringer Menge vorhanden seyn;
rang (yî), sich erinnern, auf etwas sammeln, beobachten, über etwas nachdenken,
rang-hchauñ, dasselbe mit noch bestimmterer Bedeutung des
Zielens auf etwas, des Heraushebens einer Sache, hchauñ für sich: tragen,
halten, vollenden, rang-pêː dasselbe als das Vorige, pêː für sich: geben;
hrâ (shâ) suchen, nach etwas sehen, hrâ-kraṅ (shâ-gyaṅ) dasselbe, kraṅ für
sich: denken, überlegen, nachsehen, beabsichtigen;
kan und kan-kwak, hindern, verstopfen, vereiteln, kwak (kwet) für sich: in
einen Kreis einschliessen, Gränzen festsetzen;
chang (chî) und chang-kâː, zahlreich, in Ueberfluss vorbanden seyn, kâː für
sich: ausbreiten, erweitern, zerstreuen;
ramː (ran, der Vocal wie im Englischen pan) und ramː-hcha, auf etwas
rathen, versuchen, forschen, hcha für sich: überlegen, zweifelhaft seyn.
Taû heisst auch für sich und mit hcha verbunden rathen, wird aber nicht
allein gebraucht;
pa und pa-tha, einem bösen Geiste darbieten, opfern, tha für sich: neu machen,
herstellen, aber auch: mitbringen, darbieten.
Ich habe in den obigen Beispielen Sorge getragen, immer nur mit gleichem
Accent versehene Wörter mit einander zu vergleichen. Wenn aber vielleicht,
worüber meine Hülfsmittel schweigen, auch Wörter verschiedenen Accentes
in etymologischer Verbindung stehen können, so würden sich viel mehr
Fälle dieser Zusammensetzung aufweisen, auch bisweilen die Herleitung
von Wurzeln machen lassen, deren Bedeutungen dem Compositum noch
besser entsprechen.
67voir So erklärt Judson (v. ma) das Wort ama. Bei diesem Worte selbst aber giebt
er nur die Bedeutung Weib, ältere Schwester oder Schwester überhaupt;
Mutter lautet bei ihm eigentlich ami.
68voir Carey. S. 144. §. 8. schreibt hkrañ und giebt dem Worte keinen Accent. Ich
bin Judson's Schreibung gefolgt.
69voir Hough schreibt a-kunː. Die Bedeutung dieses Worts kommt von der im Verbum
kun liegenden: zum Ende kommen, welche aber von Erschöpfung gebraucht
wird.
71voir Dies sagt Carey ausdrücklich an mehreren Stellen seiner Grammatik. S. 96.
§. 34. S. 110. §. 92. 93. Inwiefern aber seine noch weiter gehende Behauptung,
das Wort besässe gar keine Bedeutung für sich, gegründet ist, werden
wir gleich sehen.
72voir S. 115. §. 110. Die andren zu vergleichenden Stellen sind S. 67. 74. §. 75. S.
162. §. 4. S. 169. §. 24. S. 170. §. 25. S. 173.
81voir Ueber die Siamesische Sprache giebt zwar Low höchst wichtige Aufschlüsse,
die noch ungleich belehrender werden, wenn man damit Burnoufs vortreffliche
Beurtheilung seiner Schrift im Nouv. Journ. Asiat. IV. 210. vergleicht.
Allein über die meisten Theile der Grammatik ist er zu kurz und
begnügt sich zu sehr, statt der Regeln bloss Beispiele zu geben, ohne diese
einmal gehörig zu zergliedern. Ueber die Anamitische Sprache habe ich
bloss Leyden's schätzbare, aber für den jetzigen Standpunkt der Sprachkunde
wenig genügende Abhandlung (Asiat. res. X. 158.) vor mir.
84voir In meinem Briefe an Abel-Rémusat (S. 41. 42.) habe ich den Fall der Vervollständigung
als die Beschränkung eines Begriffs von weiterem Umfange
auf einen von kleinerem bezeichnet. Beide Ausdrücke laufen aber hier auf
dasselbe hinaus. Denn das Adjectivum vervollständigt den Begriff des Substantivum
und wird in seinem jedesmaligen Gebrauch von seiner weiten Bedeutung
auf einen einzelnen Fall beschränkt. Ebenso ist es mit dem Adverbium
und Verbum. Weniger deutlich erscheint das Verhältniss beim Genitiv.
Doch auch hier werden die in dieser Relation gegen einander stehenden
Worte als von vielen bei ihnen möglichen Beziehungen auf Eine bestimmte
beschränkt betrachtet.
87voir Herr Ampère (de la Chine et des travaux de M. Abel-Rémusat, in der Revue
des deux mondes. T. 8.1832. p. 373-405.) hat dies richtig gefühlt. Er erinnert
aber zugleich daran, dass jene Abhandlung in die ersten Jahre der Chinesischen
Studien Abel-Rémusat's fällt, bemerkt jedoch dabei, dass er auch später
diese Ansicht nie ganz verliess. In der That neigte sich Rémusat wohl zu sehr
dahin, den Chinesichen Sprachbau für weniger abweichend von dem andrer
Sprachen zu halten, als er wirklich ist. Hierauf mochten ihn zuerst die
abentheuerlichen Ideen geführt haben, die zu der Zeit des Beginnens seiner
Studien noch vom Chinesischen und von der Schwierigkeit, dasselbe zu erlernen,
herrschend waren. Er fühlte aber auch nicht genug, dass der Mangel
gewisser feinerer grammatischer Bezeichnungen zwar wohl im Einzelnen bisweilen
für den Sinn überhaupt, nie aber für die bestimmtere Nüancirung der
Gedanken im Ganzen unschädlich ist. Sonst aber hat er sichtbar zuerst das
wahre Wesen des Chinesischen dargestellt und man lernt erst jetzt den grossen
Werth seiner Grammatik wahrhaft kennen, da die in ihrer Art auch sehr
schätzungswürdige des Vaters Premare (Notitia linguae Sinicae auctore Patre
Premare. Malaccae. 1831.) im Druck erschienen ist. Die Vergleichung beider
Arbeiten zeigt unverkennbar, welchen grossen Dienst die Rémusatsche dem
Studium geleistet hat. Ueberall strahlt dem Leser aus ihr die Eigenthümlichkeit
der behandelten Sprache in leichter Anordnung und lichtvoller Klarheit
entgegen. Die seines Vorgängers bietet ein unendlich schätzbares Material dar
und fasst gewiss alle Eigenheiten der Sprache einzeln in sich; allein vom Ganzen
schwebte ihrem Verfasser schwerlich ein gleich deutliches Bild vor und
wenigstens gelang es ihm nicht, seinen Lesern ein solches mitzutheilen. Tiefere
Kenner der Sprache mögen auch manche Lücken in Rémusat's Grammatik
ausgefüllt wünschen; aber das grosse Verdienst, sich zuerst wahrhaft in den
Mittelpunkt der richtigen Ansicht der Sprache versetzt und ausserdem das
Studium derselben allgemein zugänglich gemacht und dadurch erst eigentlich
begründet zu haben, wird dem trefflichen Manne dauernd bleiben.
88voir St. Julien zu Paris hat zuerst auf diese Terminologie des poetischen Styls, wie
man sie nennen könnte, die ein eignes, weitläufiges Studium erfordert und
ohne ein solches zu den grössten Misverständnissen führt, aufmerksam gemacht.
89voir Ein solches, aber gegen die bis dahin in Europa bekannt gewesenen sehr ansehnlich
vermehrtes Verzeichniss hat Klaproth in den Supplementen zu
Basile's grossem Wörterbuche gegeben. Es zeichnet sich auch vor dem in
Premare's Grammatik befindlichen durch höchst schätzbare, über die Chinesischen
philosophischen Systeme Licht verbreitende Bemerkungen aus.
90voir Siehe meinen Brief an Herrn Jacquet. Nouv. Journ. Asiat. IX. 496. Das Tahitische
Wort für schreiben istpapai (Apostelgeschichte. 15, 20.) und auf den
Sandwich-Inseln palapala. (Marcus. 10, 4.) Im Neu-Seeländischen heisst
tui: schreiben, nähen, bezeichnen. Jacquet hat, wie ich aus brieflichen Mittheilungen
weiss, den glücklichen Gedanken gefasst, dass bei diesen Völkern
die Begriffe des Schreibens und Tattuirens in enger Verbindung stehen. Dies
bestätigt die Neu-Seeländische Sprache. Denn statt tuinga, Handlung des
Schreibens, sagt man auch tiwinga und tiwana ist der Theil der durch Tattuiren
eingeätzten Zeichen, welcher sich vom Auge nach der Seite des Kopfes
hin erstreckt.
91voir So beginnt z.B. der Artikel über a folgendergestalt: A, signifies universal
existence, animation, action, power, light, possession cet., also the present
existence, animation, power, light cet. of a being or thing.
93voir Gesenius hebräisches Handwörterbuch. I. S. 132. II. Vorrede. S. XIV. desselben
Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift. S. 125. ganz vorzüglich
aber in dessen ausführlichem Lehrgebäude der hebräischen Sprache.
S. 183. u. flgd. Ewald's kritische Grammatik der hebräischen Sprache.
S. 166. 167.
94voir Observations sur les racines des langues Sémitiques. Diese Abhandlung
macht eine Zugabe zu Merian's unmittelbar nach seinem Tode (er starb am
25. April 1828.) erschienenen Principes de l'étude comparative des langues
aus. Durch einen unglücklichen Zufall ist die Meriansche Schrift bald nach
ihrem Erscheinen aus dem Buchhandel verschwunden. Daher ist auch die
Klaprothsche Abhandlung in weniger Leser Hände gekommen und erforderte
einen neuen Abdruck.
97voir Man vergleiche Carey's Sanskrit-Gramm. S. 613. nr. 168. Wilkins SanskritGramm.
S. 487. nr. 863. A. W. v. Schlegel nennt (Berl. Kalender für 1831.
S. 65.) waranda einen Portugiesischen Namen für die in Indien üblichen offenen
Vorhallen, welchen die Engländer in ihre Sprache aufgenommen.
Auch Marsden giebt in seinem Wörterbuche dem gleichbedeutenden Malayischen
Worte barāndah einen Portugiesischen Ursprung. Sollte dies aber
wohl richtig seyn? Nicht abzuläugnen ist, dass waranda ein achtes Sanskritwort
ist. Es kommt schon im Amara Kösha (Cap. 6. Abtheil. 2. S. 381.) vor.
Das Wort hat mehrere Bedeutungen und der Zweifel könnte also darüber
obwalten, ob die eines Säulenganges acht Sanskritisch sey. Wilson und
Colebrooke, Letzterer in den Noten zum Amara Kösha, haben sie dafür gehalten.
Auch wäre der Fall zu sonderbar, dass ein so langes Wort in verschiedener
Bedeutung mit völliger Gleichheit der Laute in Portugal und Indien
üblich gewesen seyn sollte. Das Wort scheint mir daher aus Indien
nach Portugal gekommen und in die Sprache übergegangen zu seyn. Im
Hindostanischen lautet es nach Gilchrist (Hindoostanee philology. Vol. I. v.
Balcony. Gallery. Portico.) burandu und buramudu. Die Engländer können
allerdings die Benennung dieser Gebäude von den Portugiesen entlehnt haben.
Doch nennt Johnson's Wörterbuch (Ed. Todd.) dasselbe a word adoptedfrom
the East.
98voir Er ist der Verfasser der von Jacquet (Nouv. Journ. Asiat. XI. 102. Anmerk.)
erwähnten Sammlungen über die Madecassische Sprache, welche sich jetzt
in London in den Händen des Bruders des verstorbenen Gouverneurs Farquhar
befinden.
99voir Gericke's Wörterbuch. In Crawfurd's handschriftlichem wird es durch to
adjust, to put right übersetzt.
102voir Ich freue mich, hier hinzufügen zu können, dass Herr Professor Klaproth,
welchem ich die in dem Obigen enthaltenen Data verdanke, dem von mir
geäusserten Zweifel über das Verhältniss der verschiedenen Chinesischen
Style beistimmt. Nach seiner ausgebreiteten Belesenheit im Chinesischen,
namentlich in historischen Schriften, muss er einen reichen Schatz von
Bemerkungen über die Sprache gesammelt haben, von dem hoffentlich ein
grosser Theil in das neue Chinesische Wörterbuch überfliessen wird, dessen
Herausgabe er beabsichtigt. Sehr wünschenswürdig wäre aber alsdann
die Zusammenstellung auch seiner allgemeinen Bemerkungen über den
Chinesischen Sprachbau in einer besonderen Einleitung.
103voir Man vergleiche über diese ganze Materie Burnouf. Nouv. Journ. Asiat. IV.
221. Low's Siamesische Gramm. S. 21. 66-70. Carey's Barmanische
Gramm. S. 120-141. §. 10-56. Rémusat's Chinesische Gramm. S. 50. nr.
113-115. S. 116. nr. 309. 310. Asiat. res. X. 245. Wenn Rémusat diese
Zahlwörter bei dem alten Style abhandelt, so hat er sie wohl nur aus andren
Gründen dahin gezogen. Denn eigentlich gehören sie dem neueren
an.