 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
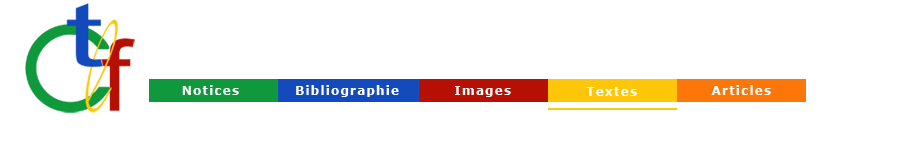
[Sprachtheorie]
Einleitung.
Die Sprachtheorie gestern und heute.
Die Menschheit denkt, seit Menschliches sie im Denken beschäftigt,
über das Wesen der Sprache nach und die wissenschaftliche
Sprachtheorie ist ebenso alt wie die anderen Zweige der
abendländischen Wissenschaft. Ein ausgeführter Quellennachweis
der tragenden Ideen dieses Buches müßte bei Platon und den
griechischen Grammatikern beginnen und Platz haben auch für
das Werk von Wundt; ebensowenig dürften W. von Humboldt,
Cassirer, Gomperz, die Meinongschule und Marty fehlen. Was
mich zurückführte zu der objektiven Sprachbetrachtung der Alten,
war die Einsicht in die Ergänzungsbedürftigkeit der gewollten und
eine Zeitlang gepriesenen Subjektivität der Neureren; es ist bequem und
einfach, gerade diesen Zug unseres Planes in Abhebung vom Gestern
als das heute Erforderliche hinzustellen und so eine erste Positionsbestimmung
zu gewinnen. Unser Gestern ist das 19. Jahrhundert.
Wollte man dem erstaunlichen Werk der Sprachforschung im
19. Jahrhundert ein Denkmal errichten, so dürften zwei Worte
auf der Inschrift nicht fehlen: Vergleich und Geschichte. Die reifsten
Prinzipienbücher aus der Zeit von Franz Bopp und W. von Humboldt
bis Hermann Paul entwickeln in Frage und Antwort die
spezifischen Voraussetzungen der Sprachforschung, welche in
diesen Forschungsrichtungen beschlossen liegen. Ich wähle Pauls
„Prinzipien der Sprachgeschichte” und stelle ihnen zwei andere
Werke an der Schwelle des Heute zur Seite, um den Ausgang des
eigenen Unternehmens anzugeben, nämlich die „Grundfragen” von
F. de Saussure und die „Logischen Untersuchungen” von E. Husserl
aus dem Jähre 1900 und 1901. Husserl ist nicht stehen geblieben,
sondern hat zuletzt 1931 die „Méditations Cartésiennes” geschrieben,
worin ein erweitertes Denkmodell des Gegenstands „Sprache”
vorbereitet ist. Ich sehe in Husserls Schritt einen Ruf der Sache
befolgt; das Schema im zweitgenannten Werke Husserls ist noch
nicht ganz unser Organon-Modell der Sprache, gestattet es aber
anzusetzen und führt darauf hin; und dieses Organon-Modell ist
auch in Platons Kratylos zu finden. Es war verkümmert im 19. Jahrhundert
und muß wieder hergestellt und anerkannt werden; ich
selbst habe es im Jahre 1918 nicht aus Platon bezogen, sondern
1noch einmal der Sache abgelesen und dem Husserl der Logischen
Untersuchungen entgegengehalten. Die objektive Sprachbetrachtung
fordert es und läßt sich kein Jota abstreichen aus der Erkenntnis:
„Dreifach ist die Leistung der menschlichen Sprache:
Kundgabe, Auslösung und Darstellung.” Wir machen also an drei
hervorragenden sprachtheoretischen Versuchen von gestern die
Sackgassen deutlich, in welche eine nichts als subjektivistische
Analyse der Sprache unvermeidlich einläuft. Zu zeigen, wie sie
vermeidbar sind, wird dann die Aufgabe des ganzen Buches sein,
1. Die Philosophie in H. Pauls Prinzipien ist der treffsichere
common sense eines in fruchtbarer empirischer Forschung bewährten
Mannes. Es ist nicht angelernt und nachgesprochen, sondern erlebt,
was dort über die Unentbehrlichkeit der Prinzipienforschung geschrieben
steht:
„Am wenigsten aber darf man den methodologischen Gewinn geringschätzen,
der aus einer Klarlegung der Prinzipienfragen erwächst. Man befindet sich in einer
Selbsttäuschung, wenn man meint, das einfachste historische Faktum ohne eine Zutat
von Spekulation konstatieren zu können. Man spekuliert eben nur unbewußt, und
es ist einem glücklichen Instinkte zu verdanken, wenn das Richtige getroffen wird.
Wir dürfen wohl behaupten, daß bisher auch die gangbaren Methoden der historischen
Forschung mehr durch Instinkt gefunden sind als durch eine auf das innerste Wesen
der Dinge eingehende allseitige Reflexion. Und die natürliche Folge davon ist,
daß eine Menge Willkürlichkeiten mit unterlaufen, woraus endloser Streit der
Meinungen und Schulen entsteht. Hieraus gibt es nur einen Ausweg: man muß
mit allem Ernst die Zurückführung dieser Methoden auf die ersten Grundprinzipien
in Angriff nehmen und alles daraus beseitigen, was sich nicht aus diesen ableiten
läßt. Diese Prinzipien aber ergeben sich, soweit sie nicht rein logischer Natur sind,
eben aus der Untersuchung des Wesens der historischen Entwicklung” (S. 5, die Hervorhebungen
von mir; ich zitiere nach der vierten Auflage von 1909).
Die Sprachforschung wird von H. Paul mehrfach eingeordnet
in den Kosmos der Wissenschaften. Sie gehört erstens zu einer
Gruppe, die er selbst mit eigenen Namen versieht, sie gehört zu den
„Kulturwissenschaften” und muß, wie er glaubt, das Fatum der
Gruppe, daß der Descartessche Zweisubstanzenschnitt mitten durch
ihren Gegenstand geht, auf sich nehmen. Physik und Psychologie
stoßen in der Linguistik wie in jeder anderen Kulturwissenschaft
zusammen; es gebe keinen Ausweg (kein Würfeln um das
ganze Gewand), der Schnitt sei da, und der Sprachforscher müsse
zusehen, wie er auf seinem Felde fertig werde mit jenem Zusammenpassen
der Stücke, das man seit Cartesius versucht. Die Neueren
haben, wie man weiß, eine eigene Bindestrichdisziplin, die sogenannte
Psychophysik erfunden, um die allgemeinen Zuordnungsprobleme
sachgerecht unterzubringen. Die Psychophysik wird
2gewöhnlich der Psychologie zugerechnet; Paul aber sieht die Verhältnisse
freier:
„Auch die Naturwissenschaften und die Mathematik sind (neben der reinen
Psychologie) eine notwendige Basis der Kulturwissenschaften. Wenn uns das im allgemeinen
nicht zum Bewußtsein kommt, so liegt das daran, daß wir uns gemeiniglich mit
der unwissenschaftlichen Beobachtung des täglichen Lebens begnügen und damit auch
bei dem, was man gewöhnlich unter Geschichte versteht, leidlich auskommen.”
„Es ergibt sich demnach als eine Hauptaufgabe für die Prinzipienlehre der
Kulturwissenschaft, die allgemeinen Bedingungen darzulegen, unter denen die
psychischen und physischen Faktoren, ihren eigenartigen Gesetzen folgend, dazu
gelangen, zu einem gemeinsamen Zwecke zusammenzuwirken” (S. 7). Ein solches
‚Zusammenwirken’ gehört nach Paul zum Phänomen der Sprache. Sein psychophysisches
Bekenntnis wäre vermutlich die Wechselwirkungslehre gewesen, wenn
er es eigens abgelegt hätte. Ob er es irgendwo faktisch getan hat, entzieht sich
meiner Kenntnis, es liegt auch wenig daran.
Eine zweite Einreihung vollzieht, wer die Linguistik zu den
‚Gesellschaftswissenschaften’ zählt. Paul spürt sehr gut die neue
Kategorie: denn er fährt an der gerade zitierten Stelle in einem neuen
Paragraphen fort: „Etwas anders stellt sich die Aufgabe der Prinzipienlehre
von folgendem Gesichtspunkt aus dar”. Mir scheint,
man darf sich in Prinzipienfragen, wo ein solcher Wechsel des Blickpunktes
stattfindet, nicht vertrösten mit dem Wissen, daß ihn die
Nachbarn auch vollziehen müssen. Wohl wahr, was zu lesen ist
bei Paul: „Die Kulturwissenschaft ist immer Gesellschaftswissenschaft.
Erst Gesellschaft ermöglicht die Kultur, erst Gesellschaft
macht den Menschen zu einem geschichtlichen Wesen.” Das alles
ist so wahr, daß sich das logische Gewissen umkehren und denjenigen
zur Rechenschaft ziehen muß, welcher das Individuum für primärer
ansieht als die Gemeinschaft: „erst Gesellschaft macht den Menschen…”
Woher in aller Welt nehmt Ihr grob gesprochen das
Rezept, das Individuum in Eurer Analyse vor die Gemeinschaft zu
stellen? Natürlich nur von Descartes oder aus der allgemeinen
Quelle des Individualismus in der neueren Philosophie.
Paul ist mit allen seinen Zeitgenossen ein entschiedener
Individualist und bemüht sich in den Prinzipien ehrlich auch um die
Aufgaben des Brückenschlagens, die keinem Monadenansatz erspart
bleibt. Man muß alles Soziale eigens ‚ableiten’, wenn man es
in der vorausgegangenen angeblich restfreien Aufgliederung der
Lebensangelegenheiten auf die Ressorts der Individuen unter den
Tisch fallen ließ. Paul hatte als Linguist das Vorbild der älteren
deutschen Völkerpsychologen Lazarus und Steinthal und setzt
sich in den Prinzipien mit ihnen auseinander; er findet, daß ihre
Rechnung lückenhaft war und in einer bestimmten Weise ergänzt
3werden muß. Wir übergehen diese an sich nicht uninteressante
eigene Note und nehmen nur das kaum einer Motivation bedürftige
Verlangen mit, das Thema ‚Individuum und Gemeinschaft’ in einer
modernen sprachwissenschaftlichen Prinzipienlehre von neuem und
vorurteilsfreier, als es bei den deutschen Fachgenossen Pauls
damals üblich war, gestellt zu sehen. F. de Saussure, ihr französischer
Zeitgenosse, verstand (von der französischen Tradition
in Sachen der Soziologie her) in diesem Punkte von der eigentlichen
Problematik beträchtlich mehr als Paul.
Ist dies gesagt, dann ziemt es sich zurückzukehren zu dem
Merkmal historisch, welches von Paul vor allen anderen und wie
ein character indelibilis am Gegenstande der Sprachwissenschaften
vorgefunden und herausgestellt wird. Er sagt es selbst und richtet
sich danach ein:
„Die Aufhellung der Bedingungen des geschichtlichen Werdens liefert neben
der allgemeinen Logik zugleich die Grundlage für die Methodenlehre, welche bei
der Feststellung jedes einzelnen Faktums zu befolgen ist” (S. 3).
Darum heben sich die wenigen Kapitel der Paulschen Prinzipien,
welche nicht von vornherein und durch und durch dem Schema
historischer Längsschnitte folgen, von den übrigen ab. Mittendrin
z. B. werden allgemein und entwicklungsfrei in VI „die syntaktischen
Grundverhältnisse” oder in XVIII das Thema „Sparsamkeit im
Ausdruck” behandelt. Der Leser erfährt darin keineswegs, daß und
wie sich die syntaktischen Grundverhältnisse oder das Moment der
Sparsamkeit herausgebildet, verändert, entwickelt habe in der
wissenschaftlich überschaubaren Geschichte der indoeuropäischen
Sprachfamilie. Nein, sondern hier geht Heraklit unter die Eleaten
und erfaßt völlig sachgerecht etwas anderes als nur den Strom, zu
dem man nicht zweimal hinabsteigen kann, er beschreibt etwas von
dem „in allem Wechsel der Erscheinungen ewig sich gleich Bleibenden”
(2); sein Objekt ist in diesen Kapiteln ‚die Sprache der Menschen’
im Singularis.
Wir griffen das zuletzt zitierte Wort aus dem Kontexte; doch
ist es nicht gesagt von Paul, um seine heute noch kaum übertroffenen
Kapitel sechs und achtzehn zu rechtfertigen, sondern um das zu
charakterisieren, was nach seiner Meinung nur den ‚Gesetzeswissenschaften’
nach Art der Physik als Erkenntnisziel vorschwebt und angeblich
auch nur ihnen vorschweben darf; keineswegs aber der
historischen Sprachforschung. Dagegen wende ich mich, weil
niemand aus dem Fließenden allein und ohne den Hintergrund
eines Konstanzmomentes im Wandel des Geschehens eine Wissenschaft
4gewinnen kann. Gewiß, der Ewigkeitswert syntaktischer
Strukturverhältnisse in den Menschensprachen will nicht in sensu
stricto verstanden sein; weder bei Paul noch später bei uns. Die
Exempel aus Paul sollen nur illustrieren wie der gesunde common
sense des Forschers, von dem wir sprechen, den Heraklit in seinem
Konzepte vorübergehend zum Schweigen verurteilt und dem Rezepte
der logisch unentbehrlichen Gegenpartei folgt. Dazu reichen sie aus.
Die Liste der syntaktischen Hilfsmittel, welche Paul in seiner Satzlehre
entwirft, ist sachgerecht am Modell der Menschensprache abgelesen;
und das ist methodisch betrachtet etwas ganz anderes, als
was sonst in dem Buche steht und empfohlen wird. Auch die lex
parsimoniae führt den Forscher über das Historische als solches
hinaus und nötigt ihm allgemeine Betrachtungen über die Sprechsituation
ab. Das logische Schema der Sprechsituation aber wiederholt
sich, wo immer zwei Menschen zusammentreffen.
Frei vom Zufall der von uns gewählten Belege erhebt sich aus
dem Konzepte Pauls die Gegenüberstellung: dort Gesetzeswissenschaften,
hier Geschichte. Paul steuert (vermutlich schon in der Erstauflage
seines Buches und das hieße vor Windelband) auf die Betonung
des idiographischen Charakters der Sprachwissenschaften hin:
„Aber mag man darüber denken wie man will, das geschichtliche Studium
verlangt nun einmal die Beschäftigung mit so disparaten Elementen als notwendiges
Hilfsmittel, wo nicht selbständige Forschung, so doch Aneigung der von anderen
gewonnenen Resultate. Man würde aber auch sehr irren, wenn man meinte, daß
mit der einfachen Zusammensetzung von Stücken verschiedener Wissenschaften
schon diejenige Art der Wissenschaft gegeben sei, die wir hier im Auge haben. Nein,
es bleiben ihr noch Aufgaben, um welche sich die Gesetzeswissenschaft, die sie als
Hilfsmittel benutzt, nicht bekümmern. Diese vergleichen ja die einzelnen Vorgänge,
unbekümmert um ihr zeitliches Verhältnis zueinander, lediglich aus dem Gesichtspunkte,
die Übereinstimmungen und Abweichungen aufzudecken und mit Hilfe
davon das in allem Wechsel der Erscheinungen ewig sich gleich Bleibende zu finden.
Der Begriff der Entwicklung ist ihnen völlig fremd, ja erscheint mit ihren Prinzipien
unvereinbar, und sie stehen daher in schroffem Gegensatze zu den Geschichtswissenschaften”
(S. 2).
Das ist die Windelband-Rickertsche Gegenüberstellung;
wir selbst werden das Konzept von Rickert am Quellpunkt seiner
logischen Überlegungen aufnehmen und die Linguistik freidenken
von dem zu engen Panzer einer nichts als idiographischen Wissenschaft.
Wo bliebe das Recht der Sprachforschung nach ‚Gesetzen’
des Lautwandels zu suchen, wenn ihr Blick auf das historisch Einmalige
als solches fixiert und beschränkt wäre? Wo bliebe das Recht
des Sprachforschers, ein Wort, das wir heute sprechen, zu identifizieren
mit einem Wort, das Luther sprach und das aus einem schon
5im Urindogermanischen nachweisbaren Wortstamm hervorgegangen
ist? Paul denkt als empirischer Forscher nicht im entferntesten
daran, sich solcher Begrenzung zu fügen.
Einfache Naturgesetze freilich wie die vom freien Fall der
Körper sind die ‚Lautgesetze’ nie und nimmermehr. Wer heute
darüber arbeitet, muß erst angeben, ob er die Fakta als Phonetiker
oder als Phonologe untersucht; die Substanz der Lautverschiebungsregeln
trifft phonologische Phänomene. Und wenn es richtig ist,
daß die Phoneme Diakritika, d. h. Zeichengebilde sind, so können
die Lautverschiebungen ihrer Natur nach keinen einfachen Naturgesetzen
folgen. Aber sie sind Kollektiverscheinungen und als solche
den Gesichtspunkten und Methoden der Kollektivforschung unterworfen.
Was man gefunden hat, sind prima vista statistische Regelmäßigkeiten,
wie sie an allen Kollektiverscheinungen zu finden sind;
gibt es doch sogar eine ‚Moralstatistik’ mit sehr beachtenswerten
Resultaten. Wir brechen hier den Zug der Gedanken ab; genug,
wenn Unruhe gestiftet und eine Dynamik des Weiterstrebens an
den Paulschen Prinzipien erregt ist. Die restfreie Einordnung der
Linguistik in die Gruppe der idiographischen Wissenschaften, wenn
es überhaupt solche gibt, ist unbefriedigend und muß einer Revision
unterzogen werden.
Fast wichtiger aber noch ist eine zweite Einsicht, die man an
Paul gewinnen kann, daß nämlich eine Art von Heimatlosigkeit
der Sprachforschung herauskommt, wenn man sie auf Physik und
Psychologie zugleich ‚reduziert’. Das ist ein verfehltes Unternehmen.
Der entscheidende Sündenfall, welcher daran schuld ist
und gutgemacht werden muß, trat ein, als sich (nicht das empirische
Werk wohl aber) die Prinzipienlehre der Sprachforscher
hineinreißen und, weiter als es nötig war, verstricken ließ in die Diskussionen
über den Descartesschen Zweisubstanzenschnitt und
damit in die moderne Psycho-Physik. Was ich im Auge habe, kommt
krasser und proteusartig wechselnd zum Vorschein in einem zweiten
Prinzipienwerk, welches heute erst die volle Beachtung, die ihm
gebührt, gefunden hat.
2. Pauls Prinzipien sind ein ausgezeichnetes Lehrbuch, reich
an wohlgeordneten Ergebnissen der Sprachforschung des 19. Jahrhunderts.
Die „Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft”
von Ferdinand de Saussure sind alles andere eher als ein Ergebnisbuch 1)1.
Doch dafür spiegeln sie durchgehend und aufregend die
6methodische Skepsis eines Forschers, der das Handwerk und Ergebnis
genau so gut versteht wie andere, aber es nicht unterlassen
kann, in seiner Weise die Reinigungsprüfung der Descartesschen
Meditationen am Befunde der Linguisten noch einmal vorzunehmen.
Es sind die greifbarsten und anscheinend trivialsten Erkenntnisse,
an die sich de Saussure mit Vorliebe hält. Wo wäre z. B. in seinem
Buche ein Aufstieg zu finden zu Perspektiven eines W. von Humboldt,
der von der Sprache aus das verschiedene Weltbild der Völker begreifen
will? Und doch ging de Saussure den Humboldtschen
Aspekten von ergon und energeia aus eigener Arbeitserfahrung
nach und hat die Angelegenheit einer ‚linguistique de la langue’
in Abhebung von einer ‚linguistique de la parole’ uns fast entscheidungsreif
vordiskutiert. Er zeigte, was gefunden werden
müßte, um eine ‚linguistique de la parole’ wirklich aus der Taufe
zu heben.
Aber das ist nur ein Punkt, ist nur eine der Skizzen im Studio
dieses ideenreichen Mannes. Seine Vorlesungen, die posthum zu
einem Buche abgerundet wurden, müssen wohl wie Führungen durch
die halbfertigen Entwürfe eines noch ringenden Gestalters großen
Formates gewesen sein. Ich bin überzeugt, daß wir erst am Anfang
der historischen Auswirkung des de Saussureschen Werkes, seiner
Skizzen zum Thema der Sprachtheorie, stehen. Mir wenigstens
geht es so, daß ich jedesmal ein neues Blatt entdecke, wenn ich
die Dinge noch einmal durchsehe. Schade fast, daß man kritisieren
muß; es geschieht hier nur, weil de Saussure als Kind seiner Zeit
auf halbem Wege, der aus dem einseitigen Stoffdenken des 19. Jahrhunderts
herausführt, einem Mitdenkenden die günstigste Position
zu Rück- und Vorblicken wie von selbst präsentiert.
F. de Saussure kümmert sich wenig darum, welcher Platz
und Rang seiner Wissenschaft bei der feierlichen Disputa gebührt,
sondern erzählt mit Vorliebe im Arbeitskittel und an konkreten
Beispielen von den Alltagsplackereien eines Methodikers der Sprachwissenschaften.
„Was ist ihr Gegenstand — wenn wir ihn vollständig
und konkret bestimmen wollten? Diese Frage ist besonders
schwierig; wir werden später sehen, warum; wir wollen uns hier
darauf beschränken, diese Schwierigkeit begreiflich zu machen” (9).
Und nun erscheint eine lange Liste; darin wird z. B. notiert: „Das
sprachliche Phänomen zeigt stets zwei Seiten, die sich entsprechen
und von denen die eine nur gilt vermöge der anderen.” Natürlich;
und das braucht man doch keinem Sachverständigen zu sagen,
daß Laut und Funktion zum Ganzen eines konkreten Sprachphänomens
7gehören. Doch sehen wir zu, wie es dem grübelnden
Methodiker zu einer ‚Schwierigkeit’ auswächst.
Er ordnet weit mehr der Zweiseitigkeitsthese unter, als man
zunächst vermuten sollte, kennt nicht weniger als vier Erscheinungsformen
des unaufhebbaren Janusgesichtes der sprachlichen Erscheinungen
: Greif die Silbe auf und du wirst erfahren, daß sie als
akustische und als motorische Einheit zugleich bestimmt werden
muß. Du kommst analytisch auf tieferer Stufe zum Laut und mußt
erkennen, er „existiert nicht für sich selbst” (sc. so wie du ihn erfassen
mußt), sondern „bildet seinerseits mit der Vorstellung eine
zusammengesetzte Einheit, die physiologisch und geistig (mental =
psychisch) ist.” Du betrachtest die Rede als Ganzes und findest
eine individuelle und eine soziale Seite an ihr. Und schließlich ist
die Sprache in jedem Zeitpunkt „eine gegenwärtige Institution”,
als solche ein „feststehendes System” und doch auch ein Produkt
der Vergangenheit, „eine Entwicklung”. Was folgt daraus? Immer
wieder, so sagt de Saussure, stehe der Sprachforscher vor demselben
Dilemma: entweder verfällt er der Einseitigkeit oder greift in dem
Bestreben, das Ergebnis der Zweiblickpunktsbetrachtung doch einheitlich
zu fassen, zum Syndetikon. Denn im zweiten Fall „erscheint
uns der Gegenstand der Sprachwissenschaften als ein wirrer
Haufen verschiedenartiger Dinge, die unter sich durch kein Band
verknüpft sind. Wenn man so vorgeht, tritt man in das Gebiet
mehrerer Wissenschaften ein” (10).
Das ist das Leitmotiv in der Methodenklage de Saussures:
membra disjecta aus gänzlich heimatverschiedenen Wissensbereichen
hab ich in meiner Hand und soll etwas Homogenes, was den Namen
einer einzigen, eben meiner Wissenschaft, trägt, daraus verfertigen.
Es gibt, wenn wir selbst ein Wort dazu sagen dürfen, formal gesehen
nur zwei Antworten auf diese Methodenklage: Entweder
das mit den disparaten Wissensbrocken ist richtig und die Klage
trotzdem unberechtigt, weil es einer wundervollen Fügegewalt
des Linguisten gelingt, aus heterogenen Wissensstücken faktisch
eine einheitliche Wissenschaft zu bauen. Oder die Voraussetzung
ist falsch, daß der Sprachforscher zuerst und primär überall aus
fremden Augen auf das zu Erforschende blickt; bald aus den Augen
des Physikers und Physiologen, bald wieder aus denen des Erlebnispsychologen
und dann des Soziologen, Historikers usw.… 1)2.8
Es hätte nicht viel Wert, aus dem Munde eines Beliebigen,
der selber keinen Ausweg weiß, die skizzierte Methodenklage anzuhören.
De Saussure ist kein Beliebiger; er ahnt nicht nur den
Irrtum der Sprachtheoretiker seines Zeitalters, der Stoffdenker,
welche es fertig brachten, das subtile Verfahren und Ergebnis
der erfolgreichen Könner zu mißdeuten, sondern er kennt und
nennt in seinen besten Stunden auch den Ausweg. Er weiß, daß
die Sprachwissenschaften das Kernstück einer allgemeinen Sematologie
(Semeologie) ausmachen und hier ihre Heimat haben, also
des Unterschlupfes bei anderen Wissenschaften entraten können.
Nur vermag er dieser erlösenden Idee noch nicht die Kraft abzugewinnen,
um schlank heraus zu erklären, daß schon in den Ausgangsdaten
der Linguistik nicht Physik, Physiologie, Psychologie,
sondern linguistische Fakta und gar nichts anderes vorliegen. Es
gehört ein Aha-Erlebnis z. B. an der Schwelle zwischen Phonetik
und Phonologie dazu, um sich aus dem Zauberkreis der stoffdenkerischen
Weltaufteilung ein und für alle Male zu befreien. Und zu
diesem und analogen Aha-Erlebnissen ist de Saussure noch nicht
gekommen, obwohl er sie vorbereiten half wie kaum ein anderer.
Die Sprachtheorie auf den folgenden Blättern steht oder fällt
mit dem Gelingen oder Mißlingen des Beweises, daß die Konzeption
der Prinzipienforscher am Ende des 19. Jahrhunderts durch etwas
Besseres abgelöst werden kann. Dazu ist es nötig, die Diskussionsbasis
zu verlegen. Wir gehen getreu dem Rezept des platonischen
Sokrates zurück in die Werkstätte der ‚Praktiker’; dorthin, wo
die intimste Kenntnis des Gegenstandes ‚Sprache’ zu finden ist.
Es gilt, die für einen echten empirischen Sprachforscher trivialen
Voraussetzungen des erfolgreichen Handwerks von neuem zu erfassen
und begrifflich, so scharf es gehen mag, zu fixieren. Das ist
die Aufgabe einer Axiomatik der Sprachwissenschaften. Das
Weitere wird sich daraus fast wie von selbst ergeben.
3. Husserl trat vor dreißig Jahren mit einem Einspruch
auf das Forum der Sachverständigen:
„Die moderne Grammatik glaubt ausschließlich auf Psychologie und sonstigen
empirischen Wissenschaften bauen zu müssen. Demgegenüber erwächst uns hier
die Einsicht, daß die alte Idee einer allgemeinen und sogar apriorischen Grammatik
durch unsere Nachweisung apriorischer, die möglichen Bedeutungsformen bestimmender
Gesetze ein zweifelloses Fundament erhält und zugleich eine bestimmt umgrenzte
Sphäre der Giltigkeit” 1)3.
Der Vorwurf einer psychologistischen Entgleisung trifft, wie
man leicht dokumentarisch nachweisen könnte, zwar die Theoretiker,
9aber kaum die empirischen Forscher des 19. Jahrhunderts. Es war
faktisch nur eine relativ kleine Gruppe von Grammatikern, welche
in der Phase von Steinthal bis Wundt dem Lockruf einer neubelebten
und vielversprechenden Sprachpsychologie soweit folgte,
daß sich daraus eine Verkennung der spezifisch grammatischen
Problemstellung ergab. Ich würde nicht einmal den Empiriker
Steinthal und noch weniger H. Paul bedingungslos dazurechnen,
weil man bei beiden verhältnismäßig leicht die psychologistische
Sprechweise abstreichen, ablösen kann und darunter einen Kern
instinktsicheren und unverbildeten grammatischen Denkens findet.
Doch mag dem sein wie immer, so bleibt Husserl gegen die
Denkweise der Theoretiker Steinthal, Paul und Wundt im
Recht. Was hat er selbst zu bieten? Man findet ganz am Schlüsse
des zitierten Abschnittes (in der zweiten von den drei nachgeschickten
Anmerkungen) einen Satz, der ganz nach Resignation klingt. Er
ist an die Adresse eines fiktiven empirischen Sprachforschers gerichtet,
der nach der Lektüre dieses neuen Programms einer „reinen
Grammatik” enttäuscht den Kopf schüttelt und gewillt ist, sie
„wegen ihrer vermeintlichen Enge, ihrer Selbstverständlichkeit und
praktischen Nutzlosigkeit” zu „diskreditieren”. Husserl gibt diesem
fiktiven Skeptiker zu bedenken,
„daß eine auch nur im Rohen zureichende Formenlehre bisher noch fehlt;
genauer zu reden, daß eine wissenschaftlich strenge und phänomenologisch geklärte
Unterscheidung der primitiven Bedeutungselemente und eine wissenschaftliche
Übersicht über die Mannigfaltigkeit abgeleiteter Formen in ihrer
Verknüpfung und Umbildung, bisher Niemandem gelungen ist, also jedenfalls
keine allzu leichte Aufgabe ist” (S. 321, die Hervorhebung der letzten Worte
von mir).
Der verehrte Autor schließt also sich selbst und seinen Aufriß
der Probleme einer reinen Grammatik in das von ihm festgestellte
Nichtgelingen einer Lösung der, sagen wir einmal „eigentlichen Endaufgabe”
mit ein. Wenigstens klingt es so nach dem Wortlaut.
Diese Resignation wäre nach meiner Auffassung heute, dreißig
Jahre nach dem Erscheinen der Logischen Untersuchungen, ebenso
wohlbegründet wie damals, wenn das Endziel der Bemühungen um
eine ganz allgemeine wissenschaftstheoretische Klärung und Fundierung
dessen, worum es in der Grammatik eigentlich geht, genau
das wäre, was Husserl damals vorschwebte und wenn es mit seinen
Mitteln erreicht werden müßte. Der erste Schritt in seiner Exposition,
in seinem Aufriß der Idee einer „reinen Grammatik” ist
vollkommen einwandfrei und lautet ganz banal gesagt: Überall,
wo es Kompositionen im echten Sinn des Wortes gibt, da müssen
10auch Kompositionsregeln und in ihrem Bereiche Strukturgesetze
aufzuweisen sein. Es sind bemerkenswerte Thesen, in denen er
dies festlegt:
„Alle Verknüpfung überhaupt untersteht Gesetzen, zumal alle materiale, auf
ein sachlich einheitliches Gebiet beschränkte Verknüpfung, bei welcher die Verknüpfungsergebnisse
in dasselbe Gebiet fallen müssen wie die Verknüpfungsglieder. Niemals
können wir alle und jede Einzelheiten durch alle und jede Formen einigen, sondern
das Gebiet der Einzelheiten beschränkt die Zahl möglicher Formen und bestimmt
die Gesetzmäßigkeiten ihrer Ausfüllung. Die Allgemeinheit dieser Tatsache entbindet
aber nicht von der Pflicht, sie in jedem gegebenen Gebiet nachzuweisen und
die bestimmten Gesetze, in denen sie sich entfaltet, zu erforschen” (307).
Das ist ebenso unbestreitbar, wie der Hinweis darauf Beachtung
verdient, daß „jeder Sprachforscher, ob er sich über die Sachlage
klar ist oder nicht”, mit den für das Gebiet der Sprachsymbole
gültigen Strukturgesetzen operiert (319). Es ist nur die Frage,
welches Minimum an Gegebenem man braucht, um diese Strukturgesetze
zu entwickeln. Und an diesem Punkte muß ich Husserl
oder gleich richtiger gesagt, muß ich dem Husserl der Logischen
Untersuchungen widersprechen. Wir werden uns zweimal im Texte
ausführlich mit Husserlschem Gedankengut befassen, das erstemal
mit seiner Abstraktionstheorie in dem Abschnitt über die
(sprachlichen) Begriffszeichen und dann noch einmal mit der hier
im Umriß schon skizzierten Idee einer reinen linguistischen Kompositionslehre.
Beide wären, so wie sie in den Logischen Untersuchungen
stehen, und wenn man darauf beschränkt bliebe, zu sprachtheoretischer
Sterilität verurteilt; beide aber werden fruchtbar, wenn man
die Wendung, welche Husserl selbst machte und am klarsten in
den „Méditations Cartésiennes” von 1931 darstellte, sachgemäß
auf das alte Programm anwendet. Es wäre ein sonderbares Vorgehen,
wenn heute jemand den alten und nicht auch den neuen Husserl
in der Sprachtheorie zu Worte kommen ließe. Das alte Husserlsche
Modell der Sprache enthält nur so viele Relationsfundamente, daß
es gerade ausreicht die Rede eines Monadenwesens, die Rede
eines zu höchsten Abstraktionen befähigten Diogenes im Faß zu
sich selbst, logisch zu explizieren; das neue Modell der Menschensprache
dagegen, welches nach den Zugeständnissen in den cartesianischen
Meditationen konsequent entworfen werden muß, ist
genau so reich, wie es die Sprachtheorie braucht und seit Platon
praktisch immer angesetzt hat; es ist das Organon-Modell der Sprache.
Mit ihm sei unsere eigene Darstellung der sprachwissenschaftlichen
Prinzipien begonnen.11
I. Die Prinzipien der Sprachforschung.
§ 1. Idee und Plan der Axiomatik.
Zwei Aufgaben liegen unbewältigt, ja in voller Klarheit kaum je
gesehen, am Eingang der Sprachtheorie; wir wollen die erste
skizzieren und als Aufgabe stehen lassen, die zweite lösen. Die
erste ist: den vollen Gehalt und Charakter der spezifisch linguistischen
Beobachtungen zu bestimmen, und die zweite: die höchsten regulativen
Forschungsideen, welche die eigenartigen sprachwissenschaftlichen
Induktionen leiten und beseelen, systematisch aufzuzeigen.
1. Daß die Linguistik überhaupt aufs Beobachten angewiesen
sei, bedarf keiner Erörterung; ihr Ruf als wohlbegründete Wissenschaft
hängt zum guten Teil an der Zuverlässigkeit und Exaktheit
ihrer Feststellungsmethoden. Wo geschriebene Dokumente fehlen
oder wo deren Zeugnis durch Beobachtungen in vivo ergänzt werden
kann, zögert denn die Forschung auch nicht am wahren Quellpunkt
und direkt zu schöpfen; sie zögert in unseren Tagen z. B. nicht,
Dialektaufnahmen an Ort und Stelle zu machen und die Laute in
vivo zu erfassen oder das seltene und schwer beobachtbare konkrete
Sprechereignis auf Schallplatten zu fixieren, um es zu wiederholter
Beobachtung präsent zu haben. Fixierbar auf Schallplatten ist freilich
nur das Hörbare am konkreten Sprechereignis und dieses erste
nur wiegt zentnerschwer in der Methodendiskussion. Denn zum
vollen, und das ist so viel wie ‚sinnvollen’ oder ‚bedeutungsvollen’
Sprechereignis, gehört weit mehr als nur das Hörbare. Wie aber
wird, was dazu gehört, miterfaßt und der exakten Beobachtung
zugänglich gemacht? Wie immer man die Sache auch drehen und
wenden mag, so muß der sprachforschende Beobachter ganz anders
wie der Physiker das mit Ohren und Augen Erfaßte (sei es von außen
oder innen, wie man zu sagen pflegt) verstehen. Und dies Verstehen
muß derselben Sorgfalt eines methodischen Vorgehens unterworfen
werden wie die Aufnahme der flatus vocis, der Schallwellen, des
Lautbildes.
Es wäre engstirnig und entspräche nicht der ganzen Mannigfaltigkeit
von Mitteln und Wegen, wenn man sich die Forderung des
Verstehens für jede der vielen sprachwissenschaftlichen Aufgaben
12gleich erfüllt und erfüllbar dächte; daß alles auf „Einfühlung” und
Selbstsprechen basiert sei, davon ist gar keine Rede. Die Tier- und
Kinderpsychologie unserer Tage hat eine zweite Art des Vorgehens
ausgebildet und unerhörte Erfolge auf ihrem Gebiete damit erzielt;
die Enträtseler der Hieroglyphen haben einen dritten Weg nicht
erst gefunden, wohl aber der Not gehorchend, in bewundernswerter
Art als den einzig erfolgreichen benützt. Verstehen und Verstehen
ist, der Natur der Sache nach, zum mindesten dreierlei in der
Sprachforschung.
Die ersten Hieroglyphenforscher hatten unverstandene Figuren
vor sich und nahmen an, es seien Symbole, die, aus einer menschlichen
Sprache gewachsen, auch von ferne wie unsere Schriftzeichen
zu lesen seien; sie nahmen an, die Gesamtbilder seien Texte. Und man
hat faktisch Schritt für Schritt die Texte entziffert und von da aus
die Sprache des Pharaonenvolkes erforscht. Diese Sprache hat Wörter
und Sätze wie unsere eigene, und jene anfangs unverstandenen
Figuren erwiesen sich als Gegenstands- und Sachverhalts-Symbole.
Wie man im einzelnen auf diese Symbolwerte kam, steht nicht zur
Diskussion; jedenfalls aber ist hier die Forderung eines ersten Verstehens
von dem Symbolwert her gelöst worden. Reihen wir des
Kontrastes wegen eine zweite, denkbar verschiedene Ausgangslage
der Forschung an. Es sind nicht Dokumente auf Stein und Papyros,
es sind im sozialen Leben uns fremder Wesen bestimmte Erscheinungen,
Vorgänge, von denen anzunehmen ist, daß sie fungieren
wie unsere menschlichen Verkehrs-Signale. Die fremden Wesen
könnten Ameisen, Bienen, Termiten, es könnten Vögel oder andere
soziale Tiere, es können auch Menschen und die „Signale” eine
menschliche Sprache sein. Höre ich Kommandos, so geht mir am
Benehmen der Empfänger das erste ahnende Verständis ihrer „Bedeutung”,
d. h. genauer ihres Signalwertes auf. Wesentlich anders
also wie im Falle der Entzifferung von Texten. Und ein drittes Mal
verschieden ist die Ausgangslage, wenn ich dazu gelange, das Wahrgenommene
als Ausdruck zu deuten. Ausdrücke sind sonst am Menschen
Mimik und Gesten, Ausdruck liegt auch beschlossen in Stimme
und Sprache; man gewinnt von daher einen noch einmal anderen
Verständnis-Schlüssel.
Wie erfolgreiche Pioniere der Sprachforschung mit diesen
Schlüsseln des Verstehens umgingen, davon ist da und dort in ihren
Berichten etwas zu lesen; wie man mitten im Zuge der fortgeschrittenen
Analyse einer Sprache dieselben Schlüssel benützt, ist
systematisch und hinreichend noch nie beschrieben worden. Die
13logische Rechtfertigung der Ausgangsdaten im Aufbau der Sprachwissenschaften,
das Anfangen, das Anknüpfen ihrer Sätze an Beobachtungen
am konkreten Sprechereignis, ist eine ungeheuer verwickelte
Aufgabe. Ganz verfehlt jedenfalls wäre es, der Sprachforschung
das völlig andere Methodenideal der Physik als Vorbild
vor Augen zu halten. Wer weiß, ob eine ansehnliche Wissenschaft
von der Sprache überhaupt gewachsen und hochgekommen wäre
ohne die Voranalyse, welche man geleistet fand in der optischen
Wiedergabe und Fixierung lautsprachlicher Gebilde durch die
Schrift? Ich glaube es nicht recht, sondern glaube positiv, daß man
der antiken und modernen Sprachforschung, welche von schriftmäßig
voranalysierten Sprachtexten ausging, mehr grundlegende und
unentbehrliche Einsichten verdankt, als es mancher unserer Zeitgenossen
wahrhaben will. Die Forderung, vom Buchstaben wieder
frei zu werden, ist ebenso verständlich wie zur Ergänzung und Verfeinerung
der Ergebnisse voll berechtigt. Allein es sollte unvergessen
bleiben, daß man das Schwimmen erst lernen mußte und faktisch
lernte am Buchstaben.
Als wir selbst vor kurzem erste Kinderworte aus konkreten Lebenssituationen
mit Schallplatten auffingen und diese Anfänge menschlichen Sprechens nach den
Regeln der sprachwissenschaftlichen Analyse begreifen wollten, ging mir und meinen
Mitarbeitern eine Ahnung auf, wie es mit dem analysierenden Erfassen gewesen sein
dürfte, als es noch keine Schrift gab. Denn weniger das Verstehen, die Deutung,
als die noch unsichere und schwankende phonematische Prägung dieser Gebilde
war es, was die größten Anforderungen an die Analyse stellte. Wenn man einigermaßen
paradox verkünden durfte, das Schiff hänge mehr am Steuer als das Steuer
am Schiff, so möchte ich gemilderter behaupten, daß wissenschaftspraktisch die
Phonetik ebensosehr an der Phonologie wie die Phonologie an der Phonetik hängt.
Es soll an anderer Stelle ausführlich über die ersten Kinderworte berichtet werden.
Doch mag dem sein, wie immer, so ist und bleibt es ein dringendes
Desiderat der linguistischen Wissenschaftslehre, die logisch
ersten Induktionsschritte des Sprachforschers freizulegen. Denn
es gilt für Physik und Sprachforschung gemeinsam das Wort,
mit welchem die Kritik der reinen Vernunft beginnt: „Daß alle
unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein
Zweifel: denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst erweckt
werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere
Sinne rühren…” Wir wollen das, was die Sinne des Sprachforschers
rührt, zu rühren imstande ist, das konkrete Sprechereignis
nennen. Es ist wie jeder Blitz und Donner und Cäsars Überschreiten
des Rubikon etwas Einmaliges, ein Geschehen hie et nunc, das
seinen bestimmten Platz im geographischen Raum und im gregorianischen
14Kalender hat. An konkreten Sprechereignissen macht der
Sprachforscher seine grundlegenden Beobachtungen und fixiert
ihr Ergebnis in Erstsätzen der Wissenschaft. Soweit stehen alle
Erfahrungswissenschaften gleich. Allein der Gegenstandscharakter
des Beobachteten ist grundverschieden in der Physik und in den
Sprachwissenschaften (worüber das Axiom von der Zeichennatur der
Sprache Aufschluß gibt); und mit dem Gegenstandscharakter die Art
des Beobachtens und der logische Gehalt wissenschaftlicher Erstsätze.
Das im Thema des „Verstehens” aufgeworfene Methodenproblem
der Sprachforschung wirkt sich praktisch so aus, daß das
spezifische Können des Philologen in keiner linguistischen Erstaufnahme
entbehrt werden kann. Wo es keine Texte herzustellen
und keine Echtheitsfragen zu beantworten gibt, am konkreten in
vivo erfaßten Sprechereignis, bleibt immer noch das mitzuleisten,
was man am Krankenbett vom Arzte erwartet und dort Diagnose
nennt, was man am Texte vom philologischen Takt erwartet und als
Auslegung (Hermeneutik) bezeichnet. Und wenn die Treffsicherheit
und Zuverlässigkeit der Interpretation (des hermeneutischen
Geschäftes) dort mehr vom historischen Wissen und Blick, hier mehr
vom Verständnis präsenter Lebenssituationen bestimmt sein mag,
so ist das, psychologisch gesehen, kaum ein großer Unterschied.
Doch das alles ist nur im Vorbeigehen bemerkt; die volle Eigenartigkeit
der mannigfaltigen linguistischen Beobachtungen ist
letzten Endes doch nur von der Eigenart des Gegenstandes der
Sprachforschung her zu begreifen.
Im Gange der späteren Kapitel wird da und dort, z. B. in
dem Abschnitt über die Phoneme, immer wieder Neues erscheinen,
wofür der linguistische Beobachter einen eigenen Blick haben muß,
d. h. daß immer wieder neuartige Ausgangsfeststellungen in vivo
an originären Sprachphänomenen oder an textlich fixierten gemacht
werden müssen. Es ist bis heute noch keinem gelungen, das praktisch
überall Betätigte auch nur einigermaßen so zu ordnen, daß
eine Übersicht des ganzen Induktionsverfahrens der Sprachforscher
möglich wäre; nur die Unruhe im logischen Gewissen von Männern
wie de Saussure verrät, daß ein J. St. Mill der Sprachforschung
de facto noch nicht geboren ist.
2. Man kann, um einen bequemen Namen zu haben, den Inbegriff
dessen, was die Sinne der Sprachforscher zu rühren vermag,
als den Ausgangsgegenstand der Linguistik bezeichnen. Selbstverständlich
wird nur ein verschwindendes Minimum von all dem,
was beobachtet werden könnte, im Interesse der Sprachforschung
15auch wirklich beobachtet und geht in die Protokollsätze der Linguistik
ein. Denn darin sind alle Erfahrungswissenschaften einander
gleich, daß jede von ihnen einen Ausgangsgegenstand, der
unerschöpflich reich ist an bestimmbaren konkreten Daten, zum
Vorwurf nimmt und aus dem Meere dieses Reichtums wie mit einem
Löffel nur geeignete Proben schöpft, um sie allein der subtilen wissenschaftlichen
Bestimmung und Analyse zuzuführen. Genau so wie
der systematisierende Botaniker nicht jedem Pflanzenexemplar
nachläuft und der Physiker nicht jeden vom Baum fallenden Apfel
beobachtet, um das Gravitationsgesetz zu verifizieren (obwohl der
Sage nach einst ein fallender Apfel den Anstoß zur Entdeckung des
Gravitationsgesetzes gab), so behält sich auch der Sprachforscher
vor, ganz nach den Forderungen seiner Wissenschaft eine eigensinnige
Auswahl dessen, was er beobachten will, zu treffen.
Vorausgesetzt wird dabei immer und überall, daß man mit
wenigem sehr vieles, daß man in den Proben das Ganze wissenschaftlich
mit erfassen kann. Und von da aus läßt sich die Endfrage
und die vom Endziel her programmbestimmende Frage der Sprachtheorie
parallel mit dem, was die Wissenschaftslehre bei allen anderen
Erfahrungswissenschaften zu ermitteln hat, genau so stellen, wie
es H. Rickert in den „Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung”
für die Naturwissenschaften und die Geschichte getan
hat: Wo immer durch die Tat des Begriffes eine vordem unbeherrschte,
unübersehbare Mannigfaltigkeit von Daten theoretisch beherrschbar,
übersehbar gemacht wird, da erwächst der Wissenschaftslehre
eine ihrer spezifischen Aufgaben, nämlich kurz gesagt das Wie und
Warum des Gelingens dieser Tat zu untersuchen. In das Wie mag
von vornherein auch das Wieweit, mag die Frage nach den innerlichen
„Grenzen” des Gelingens, die Rickert besonders unterstrichen
und nach der er den Titel seines Buches gewählt hat, mit einbezogen
sein. Wir stellen also nicht im Hinblick auf Rickerts Ergebnis
die viel zu enge Schülerfrage, in welche seiner beiden Gruppen von
Wissenschaften die Sprachforschung gehört, ob zu den nomothetischen
oder zu den idiographischen, wie er sie versteht; das
hieße von vornherein Scheuklappen aufsetzen. Sondern wir verlangen,
daß man unbefangen noch einmal zurückgehe an den Quellpunkt
der Rickertschen Untersuchung, daß man seine durchaus
klare, von der Logik legitimierte Ausgangsfrage für die Linguistik
von neuem stellt und beantwortet.
Es ist also letzten Endes die Begriffswelt des Sprachforschers
daraufhin zu untersuchen, wie und warum sie imstande ist, ein
16wohlumschriebenes, aber an konkreten Bestimmtheiten unausschöpfbares
Gebiet von Tatsachen, das Gebiet der konkreten Sprechereignisse,
für die wissenschaftliche Einsicht ebenso zu einem Kosmos
zu gestalten, wie das dem Physiker mit seinen Mitteln für seine,
wie das jeder geschlossenen Erfahrungswissenschaft oder Gruppe
von Erfahrungswissenschaften für ihren Ausgangsgegenstand mit
einem immer wieder etwas anderen, dem Gegenstand angepaßten
Begriffsapparat gelingt.
Das entspricht der Ausgangsfrage von Rickert. Wer sie
beantwortet, arbeitet an einem Teil der Wissenschaftslehre; die
Sprachtheorie ist ein Stück Wissenschaftslehre genau so wie die
Klassifikation von Windelband-Rickert samt ihrer Begründung
und viele ähnliche Arbeiten. Wenn wir die Klassifikationsaufgabe
nicht an den Ausgang stellen, sondern vorerst beiseite schieben, so
geschieht es aus der Erkenntnis daß es der sozusagen konstitutiven
‚Blickverschiedenheiten’ auf das Gegebene mehr gibt als nur die
zwei von Windelband und Rickert erfaßten. Das hat im Grunde
genommen H. Paul schon richtig verspürt; es wurde später von
Stumpf in seiner sehr umsichtigen Berliner Akademieabhandlung
„Zur Einteilung der Wissenschaften” (1907) noch einmal am faktischen
Bestände wohl ausgebauter Einzelwissenschaften demonstriert
und kehrt in der scharfsinnigen, wenn auch breiten Kritik
von Becher in „Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften”
(1921) wieder.
Es ist nicht der Ort, ausführlich Stellung zu nehmen etwa zu Stumpf und
Becher; doch sei im Vorbeigehen meine Meinung über ihre Beiträge zur Wissenschaftslehre
angedeutet. Was ihnen abgeht, ist das intime Verständnis für eine ganze Gruppe
von Wissenschaften, die uneinheitlich bleiben müssen, solange das Descartessche
oder spinozistische oder Leibnizsche oder Lotzesche Weltbild als Grundlage gewählt
wird., Stumpf hat darum auf seinem bevorzugten Forschungsgebiet und
in seinem reifsten Buche „Die Sprachlaute” (1926) den Weg zur Phonologie und
damit zu den spezifischen Aufgaben der Linguistik nicht gesehen. In meiner Abhandlung „Phonetik
und Phonologie” habe ich ihm dies an einem konkreten Beispiel
nachgerechnet. Als klare Konzeption dagegen erkenne ich seine für dieselbe
Wissenschaftsgruppe wichtige ‚Gebildelehre’ und darüber hinaus den ganzen Abschnitt
„Neutrale Wissenschaften” (Phänomenologie, Eidologie, Allgemeine Verhältnislehre)
an. Manches darin ist unentbehrlich, wie mir scheint, und nicht überholbar.
— Becher war, was sonst immer Treffliches in seinem Buche stehen mag,
doch kein Historiker von der Art, wie sie Rickert vor sich sieht, kein Biograph
zum Beispiel. Es wäre nicht allzu schwer, die Rickertsche Idee des idiographischen
Momentes der Wissenschaften als unerschüttert, wenn auch vielleicht gereinigt aus
der Polemik Bechers, und noch lebendiger und gewichtiger herauszuretten, als
er es selbst schon vorsieht. Was die Stellung der Sprachforschung im Kosmos der
Wissenschaften angeht, so würde ich die Grundlage, welche Becher ihr sowohl wie
17der Psychologie in den beiden Kapiteln S. 283-296 seines Werkes bereitet, als von
außen hineingetragen und nicht von innen herausgearbeitet bezeichnen. Trotz des
weiten Spielraumes, der beiden geöffnet und zugewiesen wird, dürfte kaum ein Sprachforscher
von heute ein rechtes Gefühl der Geborgenheit daraus mitnehmen; und
de Saussures Methodenklage erfährt nur die wenig tröstliche Antwort, es müsse
sein Bewenden damit haben, daß der Sprachforscher im Ausgang mit den Augen der
anderen auf das Gegebene blickt.
Bezeichnend ist, daß Rickerts Buch an den wenigen Stellen,
wo es exemplifizierend auf Sprachwissenschaftliches (im weitesten
Sinn des Wortes) eingeht, spezifisch philologische und nicht spezifisch
linguistische Aufgaben ins Auge faßt. Danach kommt es mir
ebenso natürlich vor, daß die Gegner der Rickertschen Zweiteilung
des globus scientiarum, wo sie Argumente aus dem Sprachgebiet
vorbringen, zu spezifisch Linguistischem greifen. Denn es gehört
nicht viel zu der Einsicht, daß an vielem Philologischen ebenso
leicht die Dominanz des idiographischen Momentes gezeigt werden
kann wie an linguistischen Tatbeständen von der Art der sogenannten
„Gesetze” der Lautverschiebung oder des Bedeutungswandels das
Nichtgenügen der idiographischen Wissenschaftsformel unverkennbar
deutlich wird. Es wäre voreilig, alles Nichtidiographische im
Sinne Rickerts, wie es oft getan worden ist, ohne weiteres dem
naturwissenschaftlich-nomothetischen Gebiet unterzuordnen. Denn
ein tertium non datur ist bis heute von niemand bewiesen oder auch
nur ernstlich zu beweisen versucht worden. Darin stimme ich Stumpf
und Becher zu. Ein geradezu klassisches Beispiel einer Wissenschaft,
die weder idiographisch noch naturwissenschaftlich-nomothetisch
verfährt und trotzdem ihre Existenzberechtigung und
Leistungsfähigkeit bewiesen hat, ist im Rahmen der Sprachforschung
alles, was zum Bereich der unentbehrlichen deskriptiven Grammatik
gehört. Ich denke nicht an die vielgeschmähte ‚Schulgrammatik’
dabei (für die ich nebenbei gesagt ganz gern einmal ein freundliches
Wort aufbringen möchte), sondern an alle schlichten Struktureinsichten,
die man seit den genialen Griechen an irgendeiner gegebenen
Sprache gewonnen hat. Es ist noch nie eine wissenschaftliche
Sprachaufnahme erfolgt ohne solche Strukturanalysen. Die Einsicht
in ihren Wissenschaftscharakter öffnet unser Abschnitt 3
im Axiom C.
So beginne man die Musterung der sprachwissenschaftlichen
Grundbegriffe mit de Saussure an dem, was ganz alltäglich von
Linguisten ausgesagt wird, von jedem über seine Sprache oder
Sprachgruppe. Da ist vom Nomen und Verbum die Rede im Indogermanischen
und von der Klasse der Pronomina; was ist denn das?
18Es gilt noch einmal im Geiste zu wiederholen die Entdeckungen
der Griechen, denen an ihrer Sprache die Phänomene so aufgefallen
sind, wie sie heute noch größtenteils heißen. Einiges mag uns verknöchert,
anderes zu eng anmuten in ihrer Terminologie, dies wird
abzustreifen sein; es bleibt des Erstaunlichen genug an Einsichten,
die damals taufrisch erfaßt wurden und bis heute im wissenschaftlichen
Wortschatz der Linguisten konserviert worden sind. Aber
eine sachgemäße Rechenschaft, die sich nicht auf die Tüchtigkeit
der Urahnen verläßt, muß man für alle Grundbegriffe in allen
Wissenschaften zu geben imstande sein. Eine Rechenschaft, wie
sie dem Besitzstand unserer Zeit entspricht; die Musterung darf,
noch einmal gesagt, auch das anscheinend Trivialste an sprachwissenschaftlichen
Behauptungen nicht unbesehen lassen.
Mir ist nicht bekannt, daß die Gesamtaufgabe der Sprachtheorie
als eines Teiles der Wissenschaftslehre je in diese Formel
gefaßt und sub specie einer systematisch angelegten Begriffsmusterung
und eines Vergleiches des spezifisch linguistischen mit
anderen Begriffsapparaten durchgeführt worden wäre. Das nächstgelegene,
ermunternde moderne Vorbild dazu stammt, wie gesagt,
von Rickert, das fernste von den Griechen, welche die theoretische
Tat des Begriffes entdeckt haben. Dazwischen und daneben aber
liegt an überschaubar viel an wissenschaftlicher Leistung, liegt
vor allem das erstaunliche Werk der Sprachforschung selbst, der
antiken und der modernen, ohne die der Wissenschaftstheoretiker
keinen Anhalt hätte zu der Frage nach dem Wie und Warum der
Fruchtbarkeit gerade dieses Begriffssystems.
3. Dasselbe von der anderen Seite her sehen heißt von den
Grundsätzen ausgehen. Man könnte versucht sein, sie durch die
bekannte Fortsetzung des Zitates aus der Kritik der reinen Vernunft
einzuführen: „Aber wenngleich alle unsere Erkenntnis mit der
Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle
aus der Erfahrung” usw. Allein dies würde uns in hier durchaus
vermeidbare Fragen verwickeln. Die Grundsätze einer Erfahrungswissenschaft
schöpfen ihre logische Dignität keineswegs aus dem
Nachweis ihrer Apriorität. Was ich sagen will, wird am deutlichsten
an den Naturwissenschaften. Man pflegt die Konzeption der Idee
von der durchgehenden quantitativen (mathematischen) Analysierbarkeit
der Naturvorgänge als die Geburtsstunde der modernen
Physik zu bezeichnen. Die Thesen Galileis, das ubi materia ibi
geometria Keplers, proponierten in allgemeinen Zügen ein Programm,
dem man treu geblieben ist und die Erfolge der Physik
19verdankt. Als klassische Versuche, das noch reichlich unbestimmte
ubi materia ibi geometria in ein System von Axiomen aufzugliedern,
kann man ebensowohl die philosophia naturalis Newtons wie die
Kritik der reinen Vernunft oder die. Theorie der Induktion von
J. St. Mill ansehen. Axiome gibt es auch für den entschiedenen
Empiristen. Von der Physik kann man sagen, sie sei sich seit der
Konzeption der Idee von der mathematischen Analysis der Naturvorgänge
des rechten Forschungsweges wohl bewußt gewesen und
habe sich auf eine mit der Einzelforschung selbst fortschreitende
Ausgestaltung ihrer explizit formulierten Axiomatik eingestellt.
In der modernen Form ihrer Darstellung, ihrer (man könnte
sagen: einfach logischen) Entfaltung wird die Frage, was wohl
a priori und was a posteriori an ihnen sei, nicht am Anfang
erhoben. Und genau dasselbe verlangen wir in dem hier vorgelegten
Versuch für das Gebiet der Sprachforschung. Wir proponieren
eine Art der Beschäftigung mit den Axiomen, die man meinethalben
als rein phänomenologische Explikation oder als eine erkenntnistheoretisch
(und ontologisch) neutrale Fixierung von
Grundsätzen bezeichnen kann. Es sind Grundsätze, die aus dem
Bestände der erfolgreichen Sprachforschung selbst durch Reduktion
zu gewinnen sind. D. Hilbert nennt dies Vorgehen axiomatisches
Denken und fordert es genau in unserem Sinne für alle Wissenschaften.
In allen Wissenschaften ist jenes mit der Forschung fortschreitende „Tief
erlegen der Fundamente” möglich und erforderlich,
das er und seine Freunde so erfolgreich auf dem Gebiete der
Mathematik betreiben 1)4. Bei Licht besehen ist dies schon in dem
20Rezepte des platonischen Sokrates, in der sogenannten sokratischen
„Induktion” enthalten: Geh zu den Sachverständigen, den erfolgreichen ‚Handwerkern’
einer Sache, du wirst in Diskussion mit ihnen
die Prinzipien finden, aus welchen ihre praktische Sachkenntnis
gespeist wird.
Wie steht es mit den Grundsätzen der Sprachforschung? Wir
formulieren im Folgenden eine Anzahl von Sätzen, die den Anspruch
erheben, entweder selbst schon als Axiome der Sprachforschung
angesehen zu werden, oder doch wenigstens fortschreitenden theoretischen
Bemühungen um ein geschlossenes System solcher Axiome
als Anhalt und Ausgang zu dienen. Dies Unternehmen ist seiner
Form nach neu: der Ideengehalt der Sätze dagegen ist keineswegs
neu und kann es der Natur der Dinge nach gar nicht sein. Denn
die Positionen, die man dem Gegenstand Sprache gegenüber einnimmt,
wenn man die Sätze anerkennt, sind und waren von Sprachforschern
bezogen, zum Teil solange es überhaupt eine Sprachwissenschaft
gibt. Fragen, die man nur von diesen Positionen aus
stellen kann, sind gestellt und beantwortet worden, andere, die man
nicht stellt, weil sie von dort aus sinnlos wären, sind unterblieben
usw. Man kann mit guten Gründen behaupten, auch die Sprachforschung
sei sich besonders in ihrer neuesten nun etwas mehr als
hundertjährigen Geschichte des rechten Forschungsweges wohl bewußt
gewesen. Was vom Wissenschaftstheoretiker so gedeutet
wird, daß vermutlich fruchtbare Konzeptionen von ähnlichem Range
wie die von der mathematischen Analysis der Natur Vorgänge, wenn
auch oft nur unvollkommen formuliert, die Forschung im großen
und ganzen gesteuert haben. Und das ist ja, was man im übrigen
auch von ihnen halten möge, die Funktion der Axiome im Forschungsbetrieb
der einzelnen Erfahrungswissenschaften. Axiome sind die
konstitutiven, gebietsbestimmenden Thesen, es sind einige durchgreifende
Induktionsideen, die man in jedem Forschungsgebiete
braucht.
4. Ein Vorblick auf das Folgende zeigt dem Leser, daß es
vier Sätze sind, die wir formulieren, erläutern, empfehlen. Sollte
ein Kritiker bemerken, sie seien (um ein Wort von Kant zu wiederholen)
aufgerafft, es gäbe vermutlich noch mehr derartiger axiomatischer
oder axiomnaher Sätze über die menschliche Sprache,
dann findet er in diesem Punkte unseren vollen Beifall; die Sätze
21sind in der Tat nur aufgelesen aus dem Konzepte der erfolgreichen
Sprachforschung und lassen, wie sie dastehen, Raum frei für andere.
Daß Kant damit nicht zufrieden wäre und sich selbst ein höheres
Ziel steckte, wo es um die Axiomatik der mathematischen Naturwissenschaften
ging, weiß man aus seinem eigenen Bekenntnis und
aus der Entstehungsgeschichte der Vernunftkritik. Nur weiß man
heute noch das andere dazu, daß nämlich die schöne Architektonik
der Kantschen Zwölfertafel von Kategorien und Grundsätzen ein
historisches Eintagsphantom gewesen ist; ich kann mich der Befürchtung
nicht erwehren, daß einem Parallelversuch in der sprachwissenschaftlichen
Prinzipienlehre dieselbe Prognose, ein Eintagsphantom
zu werden, gestellt werden müßte. Man geht heute nicht
mehr ganz so vor wie Kant und vielleicht liegt dem, was man darüber
vergleichbaren modernen Unternehmungen allgemein ablesen kann,
eine letzte Weisheit zugrunde. Männer wie Russell und Hilbert
stellen sich die Prinzipienforschung im Bereich der empirischen
Wissenschaften so vor, daß man vorhandene Ergebnisse, Theorien,
aufgreift und einem Verfahren der logischen Reduktion unterwirft;
das ist der erste Schritt des „axiomatischen Denkens”. Ihn nicht
nur faktisch zu machen und das Konzept seines Vollzuges im Papierkorb
verschwinden zu lassen, sondern Rechenschaft darüber abzulegen,
gehört zu der Wendung, die ich im Auge habe. Das ‚Aufraffen’,
welches von jeher stattfand, wird heute in weiterem Ausmaß
als früher der Öffentlichkeit übergeben und einer Nachprüfung zugänglich
gemacht. Dem aber, der das Wagnis des Aufraffens ausführt,
werden Mitstrebende vor allem einen offenen Blick und eine
glückliche Hand wünschen; vielleicht ergibt sich, wenn er sie hat,
post festum doch eine innere Ordnung der Axiome.
Zwei von den vier Grundsätzen gehören so eng zusammen,
daß man sich fragen kann, ob ihr Inhalt nicht in einem einzigen
Satze Platz hat: es- ist der erste und zweite. Mir selbst ist erst spät
und nachträglich klar geworden, warum man zwei braucht. Das
Organon-Modell der Sprache bringt jene Ergänzung der alten Grammatik,
die Forscher wie Wegener, Brugmann, (Gardiner und vor
ihnen in gewissem Ausmaß auch andere wie H. Paul als notwendig
empfunden haben; das Organon-Modell bringt die volle Mannigfaltigkeit
der Grundbezüge, welche nur am konkreten Sprechereignis
aufzuweisen ist. Wir stellen den Leitsatz von den drei
Sinnfunktionen der Sprachgebilde an den Anfang. Der interessanteste
Versuch, in welchem etwas ähnliches konsequent durchgeführt
wird, ist das Buch von Gardiner „The theory of speech
22and language” (1932) 1)5. Gardiners Analyse steuert auf eine
Situationstheorie der Sprache hin.
Soll es also endgültig zur Parole erhoben werden, daß die alte
Grammatik faktisch im Sinne einer entschlossenen Situationstheorie
der Sprache reformbedürftig ist? Meine Antwort lautet:
es gibt eine immanente Grenze, die von allen Reformfreudigen
respektiert werden muß. Denn genau so unleugbar wie die konkrete
Sprechsituation ist die andere Tatsache, daß es weitgehend situationsferne
Reden, daß es in der Welt z. B. ganze Bücher gibt, die
mit situationsfernen Reden gefüllt sind. Und wer diesem Faktum
der weitgehend situationsfreien Rede ebenso unbefangen auf den
Grund geht, findet, falls er aus dem Hörsaal eines entschlossenen
Situationstheoretikers kommt, zuerst Anlaß zu philosophischem
Staunen über die Möglichkeit des Faktischen. Und dann, wenn er
nicht eigenwillig auf dem Dogma besteht, daß diejenige Kausalanalyse,
welche er drüben gelernt hat, ausreichen muß, sondern
von der Sache geleitet, daran geht, situationsferne Sätze wie ‚Rom
liegt auf sieben Hügeln’ oder ‚zweimal zwei ist vier’ zu betrachten,
so wird er unfehlbar wieder auf das Geleise der altehrwürdigen
deskriptiven Grammatik geschoben. Deren logische Rechtfertigung
erfolgt in unserer Lehre vom Symbolfeld der Sprache und auch diese
Lehre muß axiomatisch fundiert sein. Sie ist es wenn man B und
D zusammen anerkennt.
Das Axiom C endlich gibt Aufschluß über eine im Schöße der
Sprachwissenschaften längst vollzogene Differenzierung der Forschungsaufgaben.
Philologen und Linguisten, Psychologen und
Männer der Literaturwissenschaft werden dies und das, was spezifisch
ist in ihrem Interesse an der Sprache begrifflich erfaßt
finden in unserem Vierfelderschema. Natürlich greift jeder zu guter
Letzt nach dem Ganzen: auch der Literarhistoriker muß Grammatiker
sein. Daß es der Psychologe der Sprache nicht weniger sein
muß, daß die Gebildelehre des Grammatikers allem anderen logisch
vorgeordnet sei und warum sie es sein kann, ist der Aufschluß, den
das Axiom C bringt. Der Grundsatz D mag für sich selbst sprechen.
23Das Ganze der Axiomatik noch einmal überblickt, so sind die
vier Leitsätze über die menschliche Sprache auf derart wichtige
Aufschlüsse hin zugeschnitten; ihre „Ableitung” macht einsichtig,
daß sie unentbehrlich sind, wenn die gegebene Ordnung im
Großbetrieb der Sprachforschung verstanden werden soll. Oder
umgekehrt ausgedrückt: sie rechtfertigen logisch und von der Sache
her das Gerüst, das die Forschenden um das zu Erforschende errichtet
haben.
§ 2. Das Organonmodell der Sprache (A).
Das Sprechereignis hat vielerlei Ursachen (oder Motive) und
Standorte im Leben des Menschen. Es verläßt den Einsamen in
der Wüste und den Träumenden im Schlafe nicht völlig, verstummt
aber dann und wann sowohl in gleichgültigen wie in entscheidenden
Augenblicken. Und zwar nicht nur beim einsam Reflektierenden
und sprachlos Schaffenden, sondern manchmal mitten im Zuge
eines Geschehens zwischen Ich und Du oder im Wirverbande, wo
man es sonst ganz regelmäßig antrifft. Gleichweit von der Wahrheit
eines Gesetzes entfernt sind alle summarischen Regeln der Weisheitslehrer,
die sich mit diesem wetterartig wechselnden Auftreten
des menschlichen Sprechens beschäftigen. „Spricht die Seele, so
spricht schon, ach, die Seele nicht mehr”; ebenso hört man: die tiefste
Antwort des befragten Gewissens sei Schweigen. Wogegen andere ins
Feld führen, Sprechen und Menschsein komme auf ein und dasselbe
hinaus oder es sei das Medium, die Fassung der Sprache (genauer
der Muttersprache), in der allein uns Außenwelt und Innenwelt
gegeben und erschließbar werden; zum mindesten soll *Denken und
Sprechen dasselbe, nämlich Logos, und das stumme Denken nur ein
unhörbares Sprechen sein.
Wir suchen am Ausgang keinen Konflikt mit den Weisheitslehrern,
sondern ein Modell des ausgewachsenen konkreten Sprechereignisses
samt den Lebensumständen, in denen es einigermaßen
regelmäßig auftritt. Ich denke, es war ein guter Griff Platons, wenn
er im Kratylos angibt, die Sprache sei ein organum, um einer dem
andern etwas mitzuteilen über die Dinge. Daß solche Mitteilungen
vorkommen, ist keine Frage, und der Vorteil, von ihnen auszugehen,
liegt darin beschlossen, daß man alle oder die meisten anderen
Fälle aus dem einen Hauptfall durch Reduktion gewinnen kann;
denn die sprachliche Mitteilung ist die an Grundbezügen reichste
Erscheinungsform des konkreten Sprechereignisses. Die Aufzählung
einer — dem andern — über die Dinge nennt nicht weniger
24als drei Relationsfundamente. Man zeichne ein Schema auf ein
Blatt Papier, drei Punkte wie zu einem Dreieck gruppiert, einen
vierten in die Mitte und fange an darüber nachzudenken, was dies
Schema zu symbolisieren imstande ist. Der vierte Punkt in der
Mitte symbolisiert das sinnlich wahrnehmbare, gewöhnlich akustische
Phänomen, welches offenbar zu allen drei Fundamenten an den
Ecken in irgendeiner Relation stehen muß, sei es nun eine direkte
oder eine vermittelte Relation. Wir ziehen gestrichelte Linien von
dem Zentrum zu den Eckpunkten unseres Schemas und überlegen,
was diese gestrichelten Linien symbolisieren.
1. Was heute jedem unbefangenen Ausdeuter dieser Punkt-Strich-Figur
zuerst einfällt, ist eine direkte Kausalbetrachtung.
Der „eine” erzeugt das Schallphänomen und auf den „andern”
wirkt es als Reiz, es ist also effectus und efficiens. Um auch der
dritten gestrichelten Linie einen Sinn zu
verleihen, kann man verschieden vorgehen.
Das Einfachste ist, man deutet sie als einen
komplexen, durch Zwischenfundamente vermittelten
Kausalzusammenhang von Ereignissen
um das Sprechen herum. Gesetzt,
das Produzieren des Schallphänomens sei
im Sprecher angeregt durch einen zeitlich
vorausgehenden Sinnesreiz, der von einem
Ding im Wahrnehmungsfelde herkommt, und
image die Dinge | organum | einer | der andere
Fig. 1.
das Hören des sprachlichen Schallphänomens stimuliere den Hörer
zur Hinwendung der Augen auf dasselbe Ding. Also zum Beispiel:
Zwei Menschen im Zimmer — der eine beachtet ein Prasseln, blickt
zum Fenster und sagt: es regnet —- auch der andere blickt dorthin,
sei es direkt vom Hören des Wortes oder sei es vom Blick auf den
Sprecher dazu verleitet 1)6. Das kommt vor und dabei ist der Zirkel
25ja in der schönsten Weise geschlossen. Wem's beliebt, der kann nun
das Geschehen in dem so geschlossenen Kreise sogar fortlaufen lassen
wie auf einer Schraube ohne Ende. Ist das Ding oder Ereignis reich
genug für immer neue Anregungen, die abwechselnd der eine oder
andere Partner aufnimmt, spricht der Vorfall die beiden ausgiebig
an (wie man markant zu sagen pflegt), so werden sie sich eine
Zeitlang im beobachtenden Abtasten und Bereden des Dinges oder
der Affäre in Dialogform ergehen.
Vom illustrierenden Beispiel weg nunmehr wieder an das
Modell gedacht, so wäre die Kausalkette in der primären, noch wahrnehmungsgestützten
Mitteilung durch Laute im Schema der Fig. 2
image Reizquelle | Reaktionsprodukt und Zwischenreiz | Psychophysisches System α | Psychophysisches System β
Fig. 2.
festzuhalten. Was sagt die
Sprachtheorie dazu? Eine
Kausalbetrachtung, irgendeine
Kausalbetrachtung ist
im Gesamtrahmen der linguistischen
Analyse der konkreten
Sprechvorgänge ebenso
unvermeidlich, wie z. B.
in der Rekonstruktion eines
Verbrechens. Der Richter
muß im Strafprozeß nicht
nur die Tat als dies Verbrechen, sondern auch den Angeklagten
als Täter bestimmen, um ihn zu verurteilen. Das Zuschreiben der
Tat wäre ohne den Kausalgedanken in irgendeiner Form ein (rein
logisch gesehen) sinnloses Unterfangen. Allein das Zuendedenken
der Kausalidee stößt in der Rechtssphäre auf wohlbekannte Schwierigkeiten.
Ich behaupte, daß auf Schwierigkeiten derselben Art auch
die zu primitive Vorstellung der alten Psychophysik vom „Kreislauf
des Sprechens” (de Saussure) stößt; es sind noch einmal dieselben,
wie sie im Kerngebiet der Psychologie ganz allgemein manifest
werden. Wir beginnen heute zu ahnen, wo der Rechenfehler liegt: die
Systeme α und β in der Kette fungieren als weitgehend autonome
Stationen. Der Reizempfang gleicht im einfachsten Falle schon einer
echten ‚Meldung’ und die eigene Sendung ist stets eine ‚Handlung’.
Das Forschungsprogramm, welches der robuste Behaviorismus mit jugendlichem
Elan zuerst an Tieren und am menschlichen Säugling zu verifizieren begann,
enthielt noch, die alte Formel und versuchte das Gesamtgeschehen in Reflexe aufzulösen;
doch heute ist auf der ganzen Linie ein Umschwung im Gange. Ich formuliere
26hier einen einzigen Satz darüber, der genügt, um unsere Aufforderung, den
Dingen ihr wahres Gesicht abzugewinnen, auch von dieser Seite her vollauf zu
rechtfertigen. Gleichviel, ob man die nach meiner Auffassung besten Ausgangswerke
des amerikanischen Behaviorismus von Jennings und Thorndike oder den
modernsten zusammenfassenden Bericht von Ichlonski über die Erfolge der Russen
um Pawlow und Bechterew oder die ausgeführte behavioristische Sprachtheorie
der Philosophin G. A. de Laguna aufschlägt, so springt dem, der den Blick für das
eigentliche Problem nicht verloren hat, sofort in die Augen, daß die Forscher
von Anfang an und bis heute von der Sache her zu der entscheidenden Programmentgleisung
gezwungen waren.
Sie konnten und können nicht vorwärts kommen ohne einen sematologischen
Grundbegriff in ihrer Rechnung, ohne den Begriff des Signals. Er wurde von
Jennings theoretisch unbeschwert in Gestalt der „repräsentativen Reize” (unser:
aliquid stat pro aliquo, über das in B Rechenschaft abgelegt wird) eingeführt, er
erscheint bei Ichlonski wieder eingekleidet in eine als-ob-Betrachtung und ist bei
de Laguna von Anfang an und unabgeleitet im Konzept enthalten. Und dieser
echte Zeichenbegriff hat seinen logischen Ort im Programm der Behavioristen nicht
etwa irgendwo an der Peripherie des Erforschten, sondern ganz im Zentrum, derart,
daß er z. B. zum Inventar jedes Theoretikers, der die Tatsachen des tierischen
Lernens begreiflich machen will, faktisch gehört oder gehören sollte. Denn wo er
nicht vorkommt, da wird eine Lücke oder ein Sprung sichtbar an der Stelle, wo er
stehen müßte. Das ganze Steckenbleiben der behavioristischen Theorie, ihre Aufsplitterung
in mehr als sieben Regenbogenfarben am Lernprozeß, über den die
Bücher und Zeitschriften der amerikanischen Psychologen gefüllt sind, hätte vielleicht
von einer umsichtigen Sematologie aus vorausgesagt werden können. Jedenfalls
aber ist das bequemere Prophezeien post festum und etwas mehr noch, nämlich
eine durchsichtige logische Ordnung der Meinungsdifferenzea über den Lernprozeß
von hier aus möglich. Was ich da sage, muß einstweilen ohne detaillierte Belege stehen
bleiben; die Sprachtheorie muß ein eigenes Kapitel über die Signalfunktion der
Sprache enthalten, dort ist der Ort für Einzelheiten. Dort wird auch zu zeigen sein,
daß im Schöße der Biologie selbst wie eine Art Hegel sehe Antithesis zum mechanistischen
Behaviorismus der Uexküllsche Ansatz entstanden ist, welcher von
vornherein in seinen Grundbegriffen „Merkzeichen” und „Wirkzeichen” sematologisch
orientiert ist. Paradigmatisch rein wird der Umschwung, von dem ich spreche, vollzogen
in dem ausgezeichneten Werke von E. C. Tolman „Purposive behavior” (1932).
Das Kleingedruckte ist, so wie es dasteht, für europäische
Sprachforscher nicht aktuell und hätte wegbleiben können; doch
galt es am systematischen Ort, den konsequentesten Vorstoß des
modernen Stoffdenkens zu erwähnen und die Schwierigkeiten,
in denen er vorläufig stecken blieb, zu notieren. Sein Vorläufer
in der Psychologie und Sprachforschung des ausgehenden 19. Jahrhunderts
ist nur ein inkonsequentes und stammelndes Baby im
Vergleich mit dem Programm des physikalistischen Behaviorismus,
der den flatus-vocis-Nominalismus des beginnenden Mittelalters
in moderner Form erneuert hat. Das einfachste und wahrhaft
durchschlagende Argument eines Sprachforschers gegen ihn bietet
2. B. der Tatbestand der Phonologie. Die psychologischen Systeme
27der Sprechpartner produzieren und verarbeiten faktisch die flatus
vocis in ganz anderer Art und Weise, als es die zu einfache alte
Formel voraussetzt. Die psychophysischen Systeme sind Selektoren
als Empfänger und arbeiten nach dem Prinzip der abstraktiven
Relevanz, worüber das Axiom B Aufschluß bieten wird, und die
psychophysischen Systeme sind Formungsstationen als Sender.
Beides gehört zur Einrichtung des Signal Verkehrs.
2. Wir respektieren diese Tatsachen und zeichnen das Organon-Modell
der Sprache ein zweites Mal in derFigur3. Der Kreis in der Mitte
symbolisiert das konkrete Schallphänomen. Drei variable Momente
an ihm sind berufen, es dreimal verschieden zum Rang eines Zeichens
image Gegenstände und Sachverhalte | Darstellung | Ausdruck | Appell | Sender | Empfänger
Fig. 3.
zu erheben.
Die Seiten des eingezeichneten
Dreiecks symbolisieren
diese drei Momente.
Das Dreieck umschließt
in einer
Hinsicht weniger
als der Kreis (Prinzip
der abstraktiven
Relevanz). In anderer
Richtung wieder
greift es über
den Kreis hinaus,
um anzudeuten, daß
das sinnlich Gegebene stets eine apperzeptive Ergänzung erfährt.
Die Linienscharen symbolisieren die semantischen Funktionen des
(komplexen) Sprachzeichens. Es ist Symbol kraft seiner Zuordnung
zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen,
Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit
es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an den
Hörer, dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere
Verkehrszeichen.
Dies Organon-Modell mit seinen drei weitgehend unabhängig
variablen Sinnbezügen steht vollständig, wie es ausgeführt werden
muß, zum erstenmal in meiner Arbeit über den Satz (1918), der
mit dem Worte beginnt: „Dreifach ist die Leistung der menschlichen
Sprache, Kundgabe, Auslösung und Darstellung”. Heute
bevorzuge ich die Termini: Ausdruck, Appell und Darstellung, weil
‚Ausdruck’ im Kreise der Sprachtheoretiker mehr und mehr die hier
28geforderte präzise Bedeutung gewinnt und weil das lateinische Wort
‚appellare’ (englisch: appeal, deutsch etwa: ansprechen) treffend ist
für das zweite; es gibt, wie heute jeder weiß, einen sex appeal, neben
welchem der Speech appeal mir als ebenso greifbare Tatsache erscheint.
Jedenfalls aber muß, wer zur Erkenntnis von der Zeichennatur
der Sprache vorgedrungen ist, auf Homogenität seiner Begriffe
sehen; alle drei Grundbegriffe müssen semantische Begriffe
sein. Warum und wie ein Begriffs-Cocktail vermieden werden muß,
ist instruktiv an der Lautlehre zu erkennen. Nach dem Fortschritt,
den die Phonologie brachte, muß in Zukunft dem schlichten Terminus
‚Sprachlaut’ immer aus dem Kontext oder durch ein Beiwort
anzusehen sein, ob das Gemeinte ein Laut-Zeichen, ein Laut-Mal,
d. h. eine bestimmte Einheit aus dem System der Phoneme einer
bestimmten Sprache oder ob es etwas aus dem Tatbestand der
Phonetik sein soll. Denn wir wissen jetzt, daß ein Phonem im Singularis
an zwei Stellen derselben Sprache, wo es vorkommt,
phonetisch verschieden „realisiert” und eine Lautmaterie im Singularis,
die in zwei verschiedenen Sprachen vorkommt, phonologisch
verschieden „ausgewertet” sein kann. Jenes also (noch einmal
gesagt) im Bereich derselben, dieses im Bereich verschiedener
Sprachen. Ein Gemisch aus Begriffen, die teils der (physikalischen)
Kausalbetrachtung und teils der Zeichenbetrachtung angehören,
müßte die symbolische Ausdeutung unseres Dreifundamentenschemas
so gründlich verwirren, daß niemand mehr recht ein- noch
ausfände und lauter Scheinprobleme entstünden. Die Parole „getrennt
marschieren!” gehört zur selbstverständlichen Voraussetzung
der Homogenität von Begriffen, die man an einem Relationsmodell
synoptisch behandeln will. Die Ergänzungsparole „und vereint
schlagen!” ist eine Angelegenheit, die im Schöße der Wissenschaft in
anderer Art erfüllt werden muß. Und zwar durchaus nach klaren,
angebbaren logischen Regeln, über die man sich ebenfalls exemplarisch
am Verhältnis von Phonetik und Phonologie die ersten Auskünfte
holen kann.
Was also symbolisieren die Linienscharen des Organon-Modells?
Platon hat nur eine von ihnen zu deuten versucht, die Laut-Ding-Relation,
und sich im Kratylos, wenn auch ein bestimmter Antrieb
zu neuem Zweifel in dem Dialoge vorbereitet wird, doch übergewichtig
für das νόμῳ oder ϑέσει seiner disjunktiven Frage
entschieden. Es steht also an jenem Platze des Schemas, modernmathematisch
gesprochen, eine Zuordnung der Lautzeichen zu
Gegenständen und Sachverhalten. Die historische Präambel dieser
29Zuordnung ist dem Sprecher von heute unbekannt. Die Sprachforschung
vermag zwar die Zuordnung in vielen Fällen erstaunlich
weit zurück in die Vergangenheit zu verfolgen und nachzuzeichnen;
schließlich aber reißt überall der Faden ab. Sprecher und Sprachforscher
bekennen beide: Wenn wir „heute” den Laut und das Ding
hin und her vergleichend betrachten, so ergibt sich keine „Ähnlichkeit”
zwischen beiden, wir wissen auch in den meisten Fällen nicht,
ob je eine bestanden hat und ob um dieser Ähnlichkeit willen die
Zuordnung ursprünglich vollzogen worden ist. Das ist alles und
eigentlich schon mehr als wir vorerst brauchen. Denn Zuordnungen
„bestehen”, wenn man auf letzte Begriffsschärfe sieht, gleichviel
wie immer sie motiviert sein mögen, immer nur kraft einer Konvention
(Vereinbarung im rein logischen Sinn des Wortes) und für
die Kontrahenten 1)7. Kurz, es kann bei der Entscheidung des Kratylos
bleiben: die Lautbilder einer Sprache sind den Dingen zugeordnet
und das Lexikon einer wissenschaftlich aufgenommenen Sprache
löst die Aufgabe, die sich als erste aus der Antwort des Kratylos
ergibt, die Namen (wie es dort heißt) der Sprache systematisch
mit ihren Zuordnungsrelationen zu den „Dingen” darzustellen. Daß
in einem Zweiklassensystem von Darstellungsmitteln vom Typus der
Sprache zu den lexikalischen Zuordnungen noch Syntax-Konventionen
gehören, erweitert nur den Bereich der Zuordnungsrelationen,
die wir in ihr finden. Wir schrieben, um dem gerecht zu
werden, an die Stelle des Schemas, wo „die Dinge” stand, jetzt die
doppelte Bezeichnung: „Gegenstände und Sachverhalte”.
3. Was nun folgt, ist geeignet und dazu bestimmt, die von uns
unbestrittene Dominanz der Darstellungsfunktion der Sprache
einzugrenzen. Es ist nicht wahr, daß alles, wofür der Laut ein
mediales Phänomen, ein Mittler zwischen Sprecher und Hörer ist,
durch den Begriff „die Dinge” oder durch das adäquatere Begriffspaar,
Gegenstände und Sachverhalte getroffen wird. Sondern
30das andere ist wahr, daß im Aufbau der Sprechsituation sowohl
der Sender als Täter der Tat des Sprechens, der Sender als Subjekt
der Sprechhandlung, wie der Empfänger als Angesprochener, der
Empfänger als Adressat der Sprechhandlung eigene Positionen
innehaben. Sie sind nicht einfach ein Teil dessen, worüber die
Mitteilung erfolgt, sondern sie sind die Austauschpartner, und darum
letzten Endes ist es möglich, daß das mediale Produkt des Lautes
je eine eigene Zeichenrelation zum einen und zum anderen aufweist.
Wir deuten also die spezifische Relation des wahrnehmbaren
Lautes zum Sprecher in demselben Sinne, wie es uns bei anderen
Ausdrucksphänomenen geläufig ist. Wie steht es mit der dritten
Relation? Sie ist die dritte nur in unserer Aufzählung; denn in
natura rerum, d. h. im Zeichenverkehr der Menschen und der Tiere,
wird der Appell dem Analytiker zuerst und am exaktesten greifbar,
nämlich am Benehmen des Empfängers. Wenn man statt
Menschen Bienen, Ameisen, Termiten vor sich hat und deren Kommunikationsmittel
erforscht, so wird das Augenmerk des Forschers
zuerst und überwiegend den Reaktionen des Empfängers gelten.
Ich spreche von Signalen als Tierpsychologe und erfasse ihre kommunikative
Valenz am Verhalten derer, die sie aufnehmen und
psychophysisch verarbeiten. Wir werden auch, als Theoretiker der
menschlichen Sprache diese Seite der Sache nicht vernachlässigen.
Die Analyse der Zeigzeichen z. B. wird uns deutlich machen, daß
Männer wie Wegener und Brugmann auf dem rechten Geleise
waren, als sie die Funktion der Demonstrativa beschrieben und dabei,
wenn nicht das Wort, so doch den Oberbegriff ‚Signale’ faktisch verwendet
haben. Denn so ist es, daß die Demonstrativa im Grenzfall
(die reinen Demonstrativa) wie sie als undeklinierte Partikeln nicht
nur im Urindogermanischen, sondern bis auf den heutigen Tag in
unserer Sprache vorkommen, und wieder am klarsten in ihrer sympraktischen
Verwendungsweise, genau so dastehen wie irgendwelche
anderen Verkehrssignale der Menschen oder der Tiere. Von den
reinsten Exempeln soll der Sprachtheoretiker ausgehen, um den
Begriff der sprachlichen Lautsignale zu definieren. Mit dem so
definierten Begriff wird er dann die ganze Sprache absuchen und
finden, daß dabei nicht nur Einzelnes, sondern noch einmal das
Ganze von einer neuen Seite her gesehen wird.
Dasselbe gilt, um es gleich zu sagen, von jeder der drei Betrachtungsweisen.
Man müßte aus dem Leben konkrete Sprechereignisse
herausgreifen, in denen das erstemal sichtbar wird, daß
so gut wie alles abgesteckt und zugerüstet sein kann auf die Darstellungsfunktion
31der Sprachzeichen allein; das gilt sicher am ausgesprochensten
für die wissenschaftliche Sprache und erreicht einen
Höhepunkt im Darstellungssystem der modernen Logistik. Was
kümmert sich der reine Logiker um die Ausdrucksvalenzen der
Zeichen, die er mit Kreide auf die Tafel malt? Er soll sich auch gar
nicht darum kümmern; und doch würde vielleicht an dem und jenem
Kreidestrich oder am Duktus der ganzen Zeilen ein geübter Graphologe
seine Freude haben und seine Deutekunst nicht vergebens
bemühen. Denn ein Rest von Ausdruck steckt auch in den Kreidestrichen
noch, die ein Logiker oder Mathematiker an die Wandtafel
malt. Man muß also nicht erst zum Lyriker gehen, um die Ausdrucksfunktion
als solche zu entdecken; nur freilich wird die Ausbeute
beim Lyriker reicher sein. Und wenn es ein ganz eigenmächtiger
Lyriker ist, so schreibt er manchmal über seine Pforte, der Logiker
soll draußen bleiben. Das ist dann wieder eine jener Übertreibungen,
die man nicht ernst zu nehmen braucht. Auf das dritte hin, auf eine
exakte Appellfunktion, ist alles zugerüstet, z. B. in der Kommandosprache;
auf Appell und Ausdruck im Gleichgewicht bei Kose- und
Schimpfwörtern. So wahr es ist, daß diese oft Köstliches und Häßliches
nennen, so offenkundig greifen wenigstens die intimsten Kosewörter
manchmal in den andern Topf; und der Appell ‚Sie Ehrenmann!’
kann eine Beleidigung sein. Ein Bonner Student soll einmal,
so geht die Fama, im Wettkampf das schimpf tüchtigste Marktweib
mit den Namen des griechischen und hebräischen Alphabetes allein
(‚Sie Alpha! Sie Beta!…’) zum Schweigen und Weinen gebracht
haben. Eine psychologisch glaubwürdige Geschichte, weil beim
Schimpfen wie in der Musik fast alles auf den ‚Ton’ ankommt.
Doch das sind, um es noch einmal hervorzuheben, nur Dominanzphänomene,
in denen wechselnd einer von den drei Grundbezügen
der Sprachlaute im Vordergrund steht. Die entscheidende
wissenschaftliche Verifizierung unserer Konstitutionsformel, des
Organon-Modells der Sprache, ist erbracht, wenn es sich herausstellt,
daß jede der drei Relationen, jede der drei Sinnfunktionen der
Sprachzeichen ein eigenes Gebiet sprachwissenschaftlicher Phänomene
und Fakta eröffnet und thematisiert. Und so ist es. Denn „der
sprachliche Ausdruck” und „der sprachliche Appell” sind Teilgegenstände
der ganzen Sprachforschung, die verglichen mit der
sprachlichen Darstellung, eigene Strukturen aufweisen. Die Lyrik
kurz gesprochen und die Rhetorik haben jede etwas Eigenes an
sich, was sie unter sich und — sagen wir, um nicht aus dem Konzept
zu fallen, von Epik und Drama unterscheidet; und noch auffallender
32verschieden sind ihre Strukturgesetze natürlich von dem
Strukturgesetz der wissenschaftlichen Darstellung. Dies ist in
schlichteste Worte gefaßt der Inhalt der These von den drei Sprachfunktionen.
Verifiziert wird sie im Ganzen sein, wenn alle drei
Bücher über die Sprache, die das Organon-Modell verlangt, geschrieben
sind.
§ 3. Die Zeichennatur der Sprache (B).
Die sprachlichen Phänomene sind durch und durch zeichenhaft.
Als Zeichen und zum Zeichen konstruiert ist schon das Klangbild
eines Wortes; das Wort Tische als Klang enthält vier Elementarcharakteristika,
an denen wir es von klangähnlichen Gebilden
unterscheiden. Diese Charakteristika, die Phoneme des
Wortes, fungieren wie notae, Merkmale; es sind die Unterscheidungszeichen
am Klangbild. Weiter: das ganze Klangbild ‚Tische’ fungiert
in der sinnvollen Rede als Gegenstandszeichen; es repräsentiert
ein Ding oder eine Klasse (Art) von Dingen. Endlich hat das Wort
‚Tische’ im Kontexte einen Stellenwert und wird manchmal phonematisch
bereichert um ein s am Ende; wir nennen dies allgemein die
Feldwerte, welche ein Wort im synsemantischen Umfeld erhalten
kann. Im Prinzip dasselbe gilt für die Wörter hier, jetzt, ich; sie
sind phonematisch genau so geprägt wie Tische, verhalten sich aber
zum Gegenständlichen ein wenig anders, sie zeigen auf etwas hin
und dementsprechend sind auch ihre Feldwerte im Kontexte ein
wenig anders wie die der sprachlichen Begriffszeichen; aber Zeichen
sind es auch.
Ist dies notiert, so darf darüber das Ergebnis von A nicht vergessen
werden: es ist so mit allen Wörtern, daß einige in eigener
phonematischer Prägung (wie die Imperative veni, komm), sonst in
bestimmter musikalischer Modulation oder auch einfach in der
gegebenen Sprechsituation ins Rollenfach der Kommandos oder
Ausrufe und Ausdruckszeichen übergehen. In irgendeinem Grad
und Ausmaß haben sie das schon immer in sich. Man darf also behaupten,
daß die Sprachphänomene nach der Belehrung am Organon-Modell
als mehrseitig und nach den neuen Überlegungen als
mehrstufig zeichenhafte Gebilde anzusehen sind.
Merkwürdig solche Vielfalt an ein und demselben Phänomen
der menschlichen Rede! Man wird die zwei Differenzierungsgesichtspunkte
begrifflich sehr sorgfältig erfassen und durchdenken müssen.
Die Mehrstufigkeit wird zum Thema erhoben im vierten Axiom und
ausgeführt im vierten Kapitel vom Aufbau des Sprachwerkes; ich
33will dies Spätere hier vorbereiten durch eine einfache Mannigfaltigkeitsüberlegung.
Wir fassen die Lautmaterie ins Auge und stellen
beim Übergang aus der reinsten Materialbetrachtung phonetischer
Lautanalyse zu den Silben und zu den mehrsilbigen Lautgebilden
eine durchsichtige Treppe der Vermannigfaltigung fest.
Aus der vieldimensionalen, kontinuierlichen Mannigfaltigkeit
von Klängen und Geräuschen, die der menschliche Stimmapparat
zu erzeugen imstande ist, prägt unser modernes Deutsch diskontinuierlich
rund 40 Lautmale (Phoneme) aus-, die überall als Diakritika
verwendet werden; das zweisilbige Gebilde ‚Tische’ enthält
vier von ihnen. Die Anzahl der deutschen Sinnssilben ist sicher
größer als 2000 und in meinem Rechtschreibwörterbuch, dem kleinen
Duden, stehen großgedruckt ca. 34 000 sagen wir 30 000 optische
Wortbilder verzeichnet; die Stufen sind also 40 ‖ 2000 ‖ 30 000.
Die Zahlen beanspruchen nicht mehr als der Größenordnung nach richtig zu
sein. Ob es genauer 40 oder 45 Phoneme sind, ist hier gleichgültig; die Zahl der
autosemantisch oder synsemantisch mit einem Bedeutungspuls ausgestatteten
deutschen Silben haben wir auf den ersten 30 Seiten der Goetheschen Wahlverwandtschaften
genau ausgezählt und die gefundene Zahl 1200 nach dem Verlauf
der in einem besonderen statistischen Verfahren erhaltenen Kurve abgeschätzt;
es sind sicher mehr als 2000, vielleicht gegen 4000 in den Wahlverwandtschaften.
Im Duden stehen nicht alle klanglich differenten Wortbilder, steht bei Tisch nicht
Tisches und bei lieben nicht liebt und liebte; die Zahl 30000 ist also sicher nicht zu
hoch, sondern zu tief gegriffen für eine Übersicht, in der es vorerst nur auf die klanglich
unterschiedenen Wortbilder der deutschen Sprache ankommt.
Daß wir erzeugend und auffassend eine Mannigfaltigkeit von
differenten Gebilden, die nach Zehntausenden zählen, ohne allzuviele
Entgleisungen treffsicher beherrschen, ist psychologisch nach
unserem sonstigen Können nicht selbstverständlich. Das Schema
der Mannigfaltigkeitsstufen aber macht das empirische Faktum vom
Klang her begreiflich. Vorsichtiger gesagt: noch ist ein weiter Weg
zurückzulegen, um die nächste und aufdringlichste Ausdeutung der
Mannigfaltigkeitstreppe als falsch zurückzuweisen und sie durch
eine bessere zu ersetzen. Es sind nicht einfach mehrere Baustufen
(Erzeugungsstufen) des Klanglichen, die wir damit aufgezeigt hätten;
diese Parallele mit einem Backsteinbau wäre falsch. Sondern es
sind psychophysisch viel raffinierter ineinandergreifende Prägungsbereiche,
worüber im Abschnitt über die Silbe Genaueres
zu sagen sein wird.
Der sematologische Blick auf denselben Tatbestand entdeckt
(nicht ganz parallel dazu) drei Zeichenfunktionen; er entdeckt zum
Klangbild des Wortes gehörig die gegenständliche Bedeutung (Zuordnung)
34und am Klangbild des Wortes selbst das phonematische
Signalement; er entdeckt noch einmal verschieden davon in Kontexten
die Feldzeichen. Die Lautmale (Phoneme) im Klangbild sind
für unsere Auffassung und Unterscheidung der verschiedenen Wörter
die vorbestimmten Erkennungszeichen; sie fungieren als eingegebene,
am Klangbild herausgearbeitete Diakritika, sie fungieren wie jene
Erkennungszeichen eines Menschen, die man in seinem (polizeilichen)
Signalement zusammenzustellen pflegt. Die Silbe als solche
dagegen hat keine gesonderte Zeichenfunktion zwischen den Phonemen
und dem klangbildlichen Gegenstandszeichen. Die Silbe,
die Einsilbigkeit, Zweisilbigkeit usw. eines Wortes charakterisiert
das Klangbild, gewiß; es kann auch so sein, daß die Silbengliederung
mit den Bedeutungspulsen eines komplexen Wortes zusammenfällt.
Doch muß es nicht so sein; denn liebt ist einsilbig
und verrät dem Grammatiker zwei Momente, während Wolle zweisilbig
ist und sich für unser Sprachgefühl einer Bedeutungszerlegung
widersetzt. Was die wissenschaftliche Wortforschung in Wolle
historisch nachwirkend findet, ist schlicht phänomenologisch nicht
maßgebend.
Für die begrifflich reine Bewältigung dieser Tatbestände entsteht
als erstes die Frage, ob man so Verschiedenes wie die Funktion
der Phoneme und den Symbolwert der Wörter unter ein und demselben
Oberbegriff ‚Zeichen’ zusammenfassen darf. Und wenn dies
sich als erlaubt und terminologisch zweckmäßig herausstellen sollte,
wie ist es mit der Mehrseitigkeit im Organon-Modell? Dasselbe
konkrete Phänomen ist Gegenstandszeichen, hat einen Ausdruckswert
und spricht den Empfänger bald so, bald anders an, es hat
Appell-Werte. Ist es zweckmäßig, die Symbole, Symptome, Signale
zusammenzufassen in einem genus-proximum ‚Zeichen’? Daß diese
Vielfalt Wahrheit ist, unterliegt keinem Zweifel; wohl aber erhebt
sich die Frage, ob das oberbegriffliche Wort ‚Zeichen’ zur leeren
Worthülse wird (wie angeblich so viele Wörter der wissenschaftlich
ungeklärten Umgangssprache), wenn man es für all das Genannte
festhält; einige behaupten, daß Symbol der einheitliche Oberbegriff
ist, der für alle eintritt bei exaktester logischer Analyse. Diese Entscheidung
gehört zur wissenschaftlichen Mentalität der modernen
Logistik. Ich beuge mich vor ihrem Scharfsinn in Sachen der Logik,
muß aber darauf hinweisen, daß im Schutzbereich der „exakten”
Logistik (hoffentlich vorübergehend) eine erkenntnistheoretische
Grundhaltung den Sprachtatsachen gegenüber aufgekommen ist,
die ich für eine der ungeheuerlichsten Verkennungen halte, welche
35je der natürlichen Sprache angetan worden sind. Im Ausdruckssymptom
allgemein, im sprachlichen Ausdruckszeichen im einzelnen
wird nach meiner eigenen Auffassung der Dinge ein Zusammenhang
manifest; im wirksamen Signal des tierischen und menschlichen
Gemeinschaftslebens wird nach meiner Auffassung ein realer
Steuerungsfaktor wissenschaftlich greifbar. Die Sprachphänomene
selbst sind eingebettet in die „Wirklichkeit”; man darf sie in diesem
entscheidenden Punkte nicht für abgeleiteter, wirklichkeitsferner
ansehen als die Phänomene des Physikers. Wenn dies der rein
physikalistischen Weltauffassung widerspricht, dann um so schlimmer
für sie und nicht für die Tatsachen.
Es gibt zwei Stellen in diesem Buche, wo sich die Diskussion
auf ja und nein zuspitzt. Die eine im Kapitel über die Zeigzeichen,
worin uns deutlich wird, daß die künstliche Sprache der Logistik
ohne Zeigzeichen genau so wenig auskommt und ‚logisch aufgebaut’
werden kann wie irgendeine andere Sprache. Die zweite Stelle im
Paragraphen über die sprachlichen Begriffszeichen beweist, daß der
konsequente Ausklang des modernen Physikalismus in einen radikalen
flatus-vocis-Nominalismus nichts anderes als ein wissenschaftlicher
Selbstmord ist. Dort setze man an, wenn Kritik an unserer
Sematologie geübt werden soll; dort heißt es: hic Rhodus, hic salta.
Stellen wir also vorerst nur zusammen, was über die einzelnen
Zeichenfunktionen zu sagen ist, und lassen die Frage offen, ob einer
oder mehrere Oberbegriffe endgültig nötig sein werden.
1. In einer Sprachtheorie ist es stilgemäß, zum mindesten
nebenbei auch die Etyma der gebräuchlichen Zeichenwörter um
Informationen anzugehen. Was bedeuten also Wörter wie Zeichen,
σημα, δειξς, Signum, seign? Im Bereich der indogermanischen
Sprachen und unter diesen besonders im Griechischen, Lateinischen
und Deutschen weisen die Etyma der zwei Hauptgruppen von
Zeichenwörtern auf das Gebiet des Sichtbaren hin. Die beiden ursprünglich
erfaßten Momente sind hierbei ‚Helligkeit, Sichtbarkeit’
bzw. ‚hell und sichtbar machen’ und andererseits ‚vor Augen stellen’;
die ‚Erhellung’ lenkt die Aufmerksamkeit auf sich, das ‚vor Augen
Gestellte’ kommt in den Bereich der Wahrnehmung. Es ist wohl
(kurz deutsch angedeutet) das Vorführen (Aufdecken) der Dinge
für den Beschauer oder umgekehrt das Führen des Beschauers (beschauenden
Blickes) zu den Dingen hin, was die mehrstämmige
Sippe der indoeuropäischen Zeichen-Wörter in der Regel trifft 1)8.36
Ist dies ungefähr der vormagische und hausbackene Bedeutungskern
der im Indogermanischen weitest verbreiteten Zeichenwörter,
so muß ich sagen, daß er am allerbesten paßt zu der Funktion
unserer Zeigpartikeln; auch die zwiefache Möglichkeit des Zustandebringens
einer entscheidenden und klärenden Wahrnehmung,
ich meine das Vorführen der Dinge oder das Hinlenken des Beschauers
zu ihnen ist (falls ich sie nicht mehr hinein- als herausdeute) vom
common sense dieser Etyma gut getroffen. Hand und Finger sind
den Sprachschöpfern auf dieser Stufe wohl noch viel zu stark mit
fangen und greifen befaßt, als daß sie (erkennbar im Etymon) mit
der Zeigpraxis beschäftigt wären. Wenn das griechische Wort
‚deixis’ und seine lateinische Wiedergabe durch „demonstratio”
auch den logischen Beweis bedeuten und damit auf gleiche Stufe
mit der vom Etymon getroffenen demonstratio ad oculos stellen,
so verstehen wir auch dies aus eigenem Sprachgefühl recht gut:
der Geführte soll, wie es gehen mag, eben zur sinnlichen oder logischen
‚Einsicht’ kommen. Doch wetterleuchtet in dem lateinischen
Worte ‚demonstratio’, insofern es etwas vom Wahr- und Mahnzeichen
der ‚monstra’ (d. h. der außerordentlichen Erscheinungen)
mitbringt, die frühmenschliche Art sich verwundernd und reflektierend
mit den zeichenhaften Phänomenen zu beschäftigen und
alles als zeichenhaft zu deuten; es wetterleuchtet die sogenannte
magische Geisteshaltung. Von ihr berichten die Untersuchungen
H. Werners und anderer; wir werden am systematischen Ort
darauf zu sprechen kommen. Im übrigen verdient noch einmal
unterstrichen zu werden, daß der römische Augur und der römische
Logiker für ihr sachlich verschiedenes Vorgehen dasselbe Wort
demonstratio verwendet haben.
2. Man kann nach dem Wort über die (von linguistischer Seite
leider noch nicht vollendete) Bedeutungsgeschichte unserer Zeichenwörter
die sachlichen Aufklärungen in zwei Richtungen suchen,
je nach dominierendem Interesse an den behavioristisch erfaßten
semantischen Erscheinungen im sozialen Leben der Tiere oder an
denen in den Einrichtungen des menschlichen Gemeinschaftslebens.
Isoliert birgt jede dieser einseitigen Interessenrichtungen
37die Gefahr einer verkrüppelten Sematologie in sich. Ich habe 1927
in der „Krise der Psychologie” eine einfache Beschreibung der
semantischen Tatsachen im behavioristischen Aspekte angegeben
und seither die Freude erlebt, daß ganz unabhängig davon zu wesentlich
derselben Basis einer der ingeniösesten Experimentatoren in
Amerika vorgedrungen ist, nämlich E. C. Tolman in seinem Buche
„Purposive behavior in animals and men” 1932 1)9. Es gibt nach
seiner und meiner Auffassung von den Infusorien bis zum Menschen
kein Lernen, in welchem neben allem anderen nicht das Reagieren
auf Signale enthalten und objektiv nachzuweisen wäre; ja es charakterisiert
und definiert geradezu das psychophysische System der
Tiere, daß es auf tieferer oder höherer Stufe als Signalempfänger
und Signalverwerter fungiert. Gehen wir einen Schritt weiter und
fassen die von Artgenossen im sozialen Verkehr nicht nur benutzten,
sondern oft raffiniert für einen fremden Empfänger zugerüsteten
und -produzierten Signale ins Auge. Hier erst, z. B. im Zeichen verkehr
der Insekten, gibt es die volle Einrichtung, nämlich Sender und
Empfänger, und es zeigt sich, daß der biologische Quellpunkt der
Zeichenproduktion zu finden ist überall dort und nur dort im höheren
Gemeinschaftsleben der Tiere, wo eine soziale Situation die Erweiterung
des Horizontes der gemeinsamen Wahrnehmungen verlangt.
Was eines der an der Kooperation beteiligten Individuen
mehr hat an situationswichtigen Wahrnehmungs- oder Erinnerungsdaten,
aus diesem Fonds wird die Mitteilung bestritten.
Man denke sich, was hier mit menschlichen Worten beschrieben
werden muß, nur variabel genug, man denke es sich für die einfachsten
Fälle besonders des tierischen Lebens primitiv und für
die verwickeltsten Fälle des raffinierten menschlichen Gemeinschaftslebens
sublim genug aus, dann trifft die Formel restlos alles,
was die vergleichende Psychologie über die zeichenartigen Kommunikationsmittel
der Tiere erforscht hat. Sie trifft vor allem auch jene
für die Ursprungsfrage aufschlußreichsten Fälle, wo wir neuaufkommende
Zeichen in statu nascendi beobachten können. Menschliche
Wesen, die heute noch leben und auf unseren belebten Straßen
Kraftwagen lenken, haben vor einigen Jahren ihre bekannten
Fahrtrichtungszeichen erfunden und eingeführt für genau die
Situationen, die unsere Formel beschreibt und nur für sie. Die
Lenkung der Wagen im Verkehrsgetriebe der Straßen erfolgt zeichenlos,
solange und soweit die unentbehrliche Rücksicht, die jeder auf
die anderen nehmen muß, aus der Wahrnehmung dessen, was vorgeht,
38direkt bestimmt werden kann. Geht aber einer daran,
plötzlich zu stoppen oder abzubiegen aus seiner Fahrtrichtung,
immer dann und nur dann muß er ein Zeichen geben. Warum?
Weil das Benehmen der Verkehrspartner vorzeitig von dem, was
kommen wird, bestimmt werden muß. Was noch im Schöße der
Zukunft liegt, unwahrnehmbar für die Partner aber vorgewußt vom
Täter, muß dem gemeinsam Wahrnehmbaren eingefügt werden.
Oder ein Beispiel aus dem Tierreich: Wenn unter Herdentieren
ein Individuum kraft seiner lokalen Position oder kraft erhöhter
Wachsamkeit als einziges den gefahrdrohenden Geruch oder Gesichtseindruck
aufnimmt und außer der eigenen Flucht mit einem
„Schreckruf” reagiert, so ist das Benehmen seiner Herdengenossen,
das wir daraufhin beobachten können, dasselbe, wie wenn sie alle
denselben originären Gefahreindruck erhalten hätten. Es ist „als
ob” ihr eigener Wahrnehmungshorizont erweitert worden wäre,
der Zusatzreiz des Schreckschreies, der in ihren Wahrnehmungsbereich
einbricht, erfüllt die Funktion eines lebenswichtigen Signals 1)10.
Auch der in Kooperation mit seinesgleichen praktisch tätige,
schaffende Mensch bleibt oft stumm, solange jeder das Tun des
anderen vollständig versteht und sich sachgerecht benimmt. Dann
aber kommt eine Konstellation, für welche unsere formelhafte Beschreibung
zutrifft, und der Mund eines Partners öffnet sich. Es
ist manchmal nur ein Wort nötig, ein beliebiges Sprachzeichen wie
‚rechts’, ‚geradeaus’ oder ‚mies’ oder ‚Parkett sechste bis neunte
Reihe’ und die Zusatzsteuerung, welche das Benehmen des Empfängers
benötigt, ist erreicht. Das sind menschliche Reden, die
wir später als empraktisch eingebaut beschreiben werden. Im Bilde
gesprochen ist es so mit ihrem Auftreten wie mit den ordentlich
gesetzten Wegweisern auf menschlichen Pfaden; solange es nur einen
eindeutig erkennbaren Weg gibt, braucht man keine Wegzeichen.
Aber an den Kreuzstellen, wo die Situation vieldeutig wird, sind sie
sehr willkommen. Hier werden wir im zweiten Kapitel mit der Analyse
der Zeigwörter einsetzen; die soziale Konstellation, aus welcher sie
entspringen, ist überall schon im Tierreich produktiv, aber Wörter
gleich den menschlichen produzieren die Tiere noch nicht. Sie
produzieren noch nicht einmal Analoges zu der Arm- und Fingergeste,
mit welchen wir unsere Zeigwörter begleiten.39
3. Noch sind keine Merkmale des Zeichenbegriffs angegeben.
Sehen wir uns dazu im Gemeinschaftsleben des Kulturmenschen
nach zeichenhaften Gebilden und zeichenhaftem Geschehen um.
Die Scholastiker, welche von der Sprache her philosophierten, heben
ein genus proximum des Zeichenbegriffes hervor in ihrer berühmten
Formel aliquid stat pro aliquo 1)11, die Gomperz in seiner Semasiologie
in modernem Gewände erneuert und begrifflich auszuschöpfen
begonnen hat. Es ist faktisch so, daß rein relationstheoretisch am
allgemeinen Modell der Stellvertretung nicht unwichtige Einsichten
zu gewinnen sind. Wo immer eine Stellvertretung vorliegt, da gibt
es wie an jeder Relation zwei Fundamente, ein etwas und noch etwas,
was die Betrachtung auseinanderhalten muß. Wenn nun hie et
nunc ein Konkretum als Vertreter fungiert, so kann stets die Frage
erhoben werden, kraft welcher Eigenschaf ten es die Vertretung erhielt
und in die Vertretung eingeht, sie erfüllt. Es muß also stets eine
zwiefache Bestimmung dieses Konkretums möglich sein, von denen
die eine absieht von der Funktion des Vertretenden Vertreter zu
sein, um es so, um es als das zu bestimmen, was es für sich ist oder
wäre 2)12. Die zweite Auffassung dagegen sucht und findet an ihm
diejenigen Eigenschaften, an welche die Vertretung gebunden ist.
Im Falle des Zeichenseins sind es immer nur abstrakte Momente,
kraft derer und mit denen das Konkretum „als” Zeichen fungiert.
Ich habe diesen sprachtheoretisch grundlegenden Tatbestand als
das Prinzip der abstraktiven Relevanz bezeichnet und am Unterschied
von Phonetik und Phonologie erläutert 3)13.
Es seien, bevor ich das Gesagte illustriere und greifbar mache,
noch zwei Bestimmungen getroffen, die näherer Ausführung in
unserem Zusammenhang nicht bedürfen. Das „stare pro” gehört,
was sonst es auch sein mag, in allen aus dem Leben bekannten Beispielen
zu den nicht-umkehrbaren Relationen. Der Gesandte
ist ein Stellvertreter seines Staates, aber nicht umgekehrt, der Rechtsanwalt
steht vor Gericht für seinen Klienten, aber nicht umgekehrt.
Das gilt auch von den Zeichen, und man kann hinzufügen, daß hier
40aus bestimmten Gründen das stellvertretende Glied des Gefüges
(id quod stat pro aliquo) stets dem Bereich des Wahrnehmbaren
angehört, während dies von dem anderen Gliede nicht behauptet
werden kann. Zu dem letzteren braucht, wer die Zeichen allgemein
und von vornherein als intersubjektive Vermittler (mediale Gebilde
in Gemeinschaften) ansieht, kein weiteres Wort zu verlieren, weil
es aus seiner Definition hervorgeht. Die Sache könnte noch allgemeiner
gefaßt werden; doch sei hier kein Wert darauf gelegt,
weil die Behauptung für die Sprache jedenfalls keines Beweises
bedarf. Die Unterscheidung eines sinnlich Wahrnehmbaren im
Sprachphänomen (der Laute) von dem anderen, wofür sie stehen,
ist hier allen Sachverständigen durchaus geläufig 1)14.
Was niemand heute plastischer zugleich und begrifflich schärfer,
als es Gomperz (an einer absichtlich bunt zusammengestellten
Schar von Beispielen) getan, erläutern könnte, ist der Tatbestand
der überall durchführbaren zwiefachen Art der Auffassung und Bestimmung
des ersten Gliedes im Relationsgefüge der Stellvertretung.
Wenn ich z. B. den Schauspieler betrachte (so überlegt Gomperz),
den Schauspieler vor mir auf der Bühne, so ist der jetzt
Wallenstein und doch nicht Wallenstein selbst in persona, sondern
er ist Herr Bassermann, der ihn spielt. Nun ja, das ist ein Spiel
und ein spectaculum, man könnte mancherlei daran beobachten und
darüber aussagen. Wir konzentrieren uns aber mit Gomperz auf
das Faktum der merkwürdigen Zwiespältigkeit, die in den Worten
„er ist es und er ist es doch nicht” zum Vorschein kommt. Es hat
einen guten Sinn, dafür die Formel zu gebrauchen: die wahrnehmbaren „Akzidentien”
des Schauspielers Bassermann werden einer
fremden „Substanz”, werden dem Wallenstein des Dichters inhärierend
zugedacht. Der Zuschauer nimmt die Maske und Gesten,
die Worte und Taten des Individuums Bassermann als etwas hin,
durch das hindurch er den Wallenstein des Dichters zu erleben vermag.
Oder von der anderen Seite her bestimmt: Dem Wallenstein
des Dichters stellt Bassermann das Genannte zur Verfügung, so
daß die Figur des Dichters in Erscheinung treten kann. Das scholastische
Begriffspaar „Substanz und Akzidentien” ist m dieser
Gomperzschen Formel seiner ontologischen Bedeutung entzogen
41und zu einer bequemen ersten Deskription verwendet worden 1)15.
Man kann dies Denkmodell mit der nötigen Umsicht auch auf die
sprachlichen Gegenstands- und Sachverhaltssymbole anwenden.
Doch wollen wir uns dabei nicht aufhalten.
4. Ich will vielmehr von dem seit Gomperz erzielten positiven
Fortschritt, den die Sprachtheorie aus der „Phonologie” gewinnt,
und von dem Prinzip der abstraktiven Relevanz berichten.
Es ist ein für alles Zeichenhafte und darüber hinaus gültiges Prinzip,
mit dem aber, gerade weil es auch auf anderes übergreift, die differentia
specifica des Zeichenbegriffes noch nicht entdeckt sein kann.
Eine fingierte Verabredung, die in „Phonetik und Phonologie”
steht und auf einem dort diskutierten Tatbestand der Phonologie
zugeschnitten ist, mag als Ausgang dienen: Angenommen zwei
Menschen wollen sich durch Flaggensignale verständigen und sie
verabreden, es soll, dabei nicht auf Form und Größe, sondern nur
auf die Farbe der Signale ankommen. Und zwar wird (gleich zugeschnitten
auf den Fall eines bestimmten Vokalsystems) verabredet,
es sollen drei Sättigungsstufen der Farben bedeutungsrelevant
sein. Also im einzelnen: Erstens, die vollkommen ungesättigten
Nuancen der Schwarz-Weiß-Reihe haben einheitlich die Bedeutung A.
Ob im konkreten Fall Schwarz, Grau oder Weiß benützt wird,
ist irrelevant. Zweitens, die Flaggen einer mittleren Sättigungsstufe
haben einheitlich die Bedeutung B. Ob im konkreten Fall
ein Himmelblau, Rosarot oder Tabakbraun benützt wird, macht
keinen Unterschied, ist bedeutungs-irrelevant. Drittens, die
Flaggen aus dem höchsten Sättigungsbereiche der Farben haben einheitlich
die Bedeutung C. Ob im konkreten Fall ein gesättigtes
Rot, Blau, Grün, Gelb benützt wird, macht keinen Unterschied,
ist bedeutungs-irrelevant. Ich nehme an, daß diskussionslos die
Möglichkeit des anstandsfreien Funktionierens einer solchen Verabredung
zugestanden wird. Natürlich muß jeder Beteiligte die Verabredung
kennen, sich einprägen und im konkreten Fall imstande
sein, die gerade benützte Nuance einer der drei Sättigungsstufen
richtig zuzuordnen; dann kann er sich fehlerfrei am Geschäft des
Signalgebens und Signalempfangens beteiligen.
Es sei noch eine geringfügige, aber theoretisch wichtige Modifikation
an dem fingierten Signalverfahren angebracht, die den
exakten Vergleich mit den Verhältnissen, wie sie für die Einzellaute
42im Verband des Lautstromes der Rede bestehen, erleichtert.
Wir können uns die Wahl der Nuance im Freiheitsbereiche einer
Sättigungsstufe in jedem konkreten Fall eines Signalisierens gesetzmäßig
milieubestimmt vorstellen. Angenommen, die Verabredung
wird zwischen einer heimlichen Braut und ihrem heimlichen
Bräutigam oder sonst zwischen zwei Menschen getroffen, die Wert
darauf legen, daß der Signalverkehr möglichst unauffällig und
milieuangepaßt vonstatten geht. Die Frau signalisiert z. B. einfach
durch die Farbe ihres Kleides. Nun gut, dann mag sie, wenn drei
Kleider von ungesättigter Farbe, Schwarz, Grau und Weiß vorhanden
sind, im gegebenen Fall vor dem Spiegel ausprobieren, was ihr heute
am besten zu Gesichte steht, oder sie mag es sich vom Wetter und
anderen konkreten Milieuumständen diktieren lassen, ob sie das
Graue, Weiße oder Schwarze nimmt. Genau so verhält es sich im
Prinzip überall im Lautstrom der Rede mit den Umgebungseinflüssen.
Sie sind da und erfolgen in einem irrelevanten Variationsbereiche.
In „Phonetik und Phonologie” wird dies an linguistisch
gut aufgenommenen Tatbeständen erhärtet. Da gibt es z. B. unter
den westkaukasischen Sprachen eine (das Adyghische), die auf den
ersten Blick eine ähnliche Mannigfaltigkeit von Vokalklängen wie
das Deutsche aufweist; es kommen unter anderen Nuancen auch
u-ü-i vor. Allein es zeigt sich, daß dort niemals wie bei uns in Tusche
und Tische zwei Wörter durch die Vokaldifferenz u-i geschieden
werden können; die Nuancen u-ü-i haben keine „diakritische”
Valenz in jener Sprache. Ebensowenig o-ö-e oder a-ä, die zwar alle
vorkommen, gesetzmäßig milieubedingt vorkommen, aber nicht
diakritisch relevant werden können. Um diesen Kerntatbestand
der Phonologie begrifflich exakt zu fassen, habe ich die Fiktion
mit den Flaggensignalen erdacht. An ihr wird durchsichtig, was
vorliegt, nämlich die Gültigkeit des Prinzips der abstraktiven Relevanz
für das Gebiet der sogenannten Einzellaute der Sprache.
Wenn wir damit auf dem rechten Wege sind, dann gibt es
deshalb zwei Betrachtungsweisen der menschlichen Sprachlaute,
weil man erstens ihre Materialeigenschaften rein für sich und zweitens
das an ihren Eigenschaften, was für ihren Beruf, als Zeichen
zu fungieren, maßgebend ist, zum Gegenstand der wissenschaftlichen
Bestimmung machen kann. Über das Verhältnis dieser beiden Betrachtungsweisen
zueinander ist aus dem erdachten Vergleichsmodell,
dem Signalverkehr mit Flaggen, die grundlegende Erkenntnis,
welche wir brauchen, zu gewinnen. Dies Modell ist mit Absicht so
einfach gewählt, daß an ihm das Prinzip der abstraktiven Relevanz
43einsichtig abgelesen werden kann. Schwarz, Grau, Weiß sind verschiedene
Farben; niemand wird daran rütteln. Aber sie können
(wie in der fingierten Verabredung) dasselbe bedeuten, bedeutungsidentisch
sein, weil für ihren Beruf, als Zeichen zu dienen,
einzig und allein jenes abstrakte Moment der niedersten Sättigungsstufe,
das ihnen gemeinsam ist, als maßgebend gesetzt wurde.
Dies ist etwas, was man als Faktum jedem Kinde klarmachen
kann. Und steht dies Faktum einmal fest, dann sind es nur noch die
Philosophen und Psychologen, die sich darüber verwundern und
sinnvoll weiter fragen. Der Philosoph wird reflektierend sagen: Mit
den Zeichen, die eine Bedeutung tragen, ist es also so bestellt, daß
das Sinnending, dies wahrnehmbare Etwas hie et nunc nicht mit
der ganzen Fülle seiner konkreten Eigenschaften in die semantische
Funktion eingehen muß. Vielmehr kann es sein, daß nur dies oder
jenes abstrakte Moment für seinen Beruf, als Zeichen zu fungieren,
relevant wird. Das ist in einfache Worte gefaßt das Prinzip
der abstraktiven Relevanz. Soweit das Zitat aus „Phonetik und
Phonologie”.
Eine historische Bemerkung: Was die Sprachzeichen angeht, so war ich vor
meinem Kontakt mit der Phonologie mit der eigenen Arbeit an den Problemen der
Sprachtheorie auf dem Punkte, daß sich Folgerungen aus vielen Tatbeständen zur
Formulierung des Schlüsselsatzes von der Zeichennatur der Sprache zuspitzten.
Nur der ganze Block der Lautlehre schien sich der Erkenntnis nicht zu fügen, daß
der Gegenstand der Sprachwissenschaften restlos in derselben Art zur Sematologie
gehört, wie der Gegenstand der Physik zur Mathematik. Das ubi materia ibi geometria
Keplers reguliert und bestimmt restfrei das Vorgehen und die Ergebnisse
der Physik; dagegen schien die Lautlehre der Linguisten ein anderes Gepräge aufzuweisen
als die übrige Grammatik. Das philosophische (wissenschaftstheoretische)
Erstaunen darüber erwies sich als fruchtbar und wurde gelöst, als mir die programmatische
Abhandlung von N. Trubetzkoy, „Zur allgemeinen Theorie der
phonologischen Vokalsysteme” 1)16 in die Hand kam. Da stand auf einmal ein wohlbegründeter
Beitrag zur Lautlehre mit dem Horizont einer abgerundeten neuen
sprachwissenschaftlichen Disziplin um sich, die nicht den Charakter der Phonetik
hatte, und mit ihr das, was ich suchte. Man kann also und muß die wissenschaftliche
Behandlung der Sprachlaute genau so aufspalten, wie es die logische Einsicht
verlangt. Sie können das eine Mal als das betrachtet werden, was sie „für sich”
sind, und das zweite Mal sub specie ihres Berufes als Zeichen zu fungieren; die
Phonetik tut das eine und die Phonologie das andere. Der Begriff „Lautelemente”,
unter den man die Vokale und Konsonanten zu subsumieren pflegt, wird erst durch
die Konzeption der Phonologie brauchbar definiert, so daß man einsieht: es gibt
in jeder Sprache nur eine abzählbare Mannigfaltigkeit, ein durchsichtiges System
(vokalischer, konsonantischer u. dgl. m.) diskreter Lautzeichen. Ihre semantische
Funktion ist, nach dem terminologischen Vorschlag, den ich den Phonologen gemacht
habe, die, als Diakritika der komplexen Phänomene, die man Wörter nennt,
44zu dienen. Die Phoneme sind die natürlichen „Male” (Kennzeichen), woran im
Lautstrom der Rede die semantisch entscheidenden Einheiten dieses Lautstroms
erkannt und auseinandergehalten werden.
5. Das Phänomen der Abstraktion bedeutet eine Schlüsselposition
der Sematologie, auf die wir immer wieder zurückkommen
müssen; vorangezeigt sei solche Heimkehr z. B. für die Analyse
der Metapher und für die Lehre von den Nennwörtern. Die Formel
von der abstraktiven Relevanz ist, so wie sie im Texte steht, zugeschnitten
auf die Entdeckung der modernen Phonologie. Da
kamen europäische Sprachforscher und hatten die Laute der kaukasischen
Sprachen aufzunehmen; sie mußten sich einhören, d. h.
erfassen lernen, was diakritisch relevant ist im Reiche der fremden
Lautbilder. Genau so muß sich der Wortforscher eindenken in ein
fremdes Lexikon und der Syntaktiker in fremde Symbolfelder.
Daß er das kann, ist zuzuschreiben seiner Ausbildung als Sprachforscher
und zuletzt seiner allgemeineren Fähigkeit, als sprechender
Mensch Konventionen wie die unserer Signalpartner mitzumachen.
Die darin beschlossene Abstraktionsleistung läßt sich so bestimmen,
wie das Husserl unter Wiederaufnahme scholastischer Erkenntnisse
durchgeführt hat, sie läßt sich auch gleichsam von außen her am
Erfolge des sprachforschenden Sicheinhörens und Eindenkens bestimmen.
Unser Forscher wird allmählich aufnehmend und (soweit
er damit gelangt) selbstsprechend die Relevanzgesetze etwa der
kaukasischen Sprachen besser und fehlerfreier respektieren lernen.
Und was er davon linguistisch korrekt fixiert, ist der Ertrag seiner
Studien.
Daß man, um heute die Probleme der Abstraktion erfolgreich
dort aufzunehmen, wo der scholastische Vorstoß erschöpft war,
das Konzept der J. St. Millschen und der Husserlschen Logik
zugleich, und zwar beide zu ihrer gegenseitigen Korrektur und
Ergänzung benützen muß, will ich im Paragraphen von den Namen
verdeutlichen. Mills „objektiver” Weg ist als solcher auch derjenige
der Logistik. Hier in der Axiomatik bleibt anzugeben, welche
Klärung das Prinzip der abstraktiven Relevanz dem Organon-Modell
der Sprache verspricht oder bereits zu bieten vermag. Es
ist leicht hingeschrieben, dasselbe konkrete Sprachphänomen sei
mehrseitig sinnvoll oder mehrseitig in Anspruch genommen als Vermittler
zwischen Sender und Empfänger. Vermag denn dies Konkretum
etwas zu leisten, was man dem menschlichen Individuum
abspricht in dem Satze ‚Niemand kann zwei Herren dienen’? Das
Prinzip der abstraktiven Relevanz gibt an nicht nur daß, sondern
45auch wieweit eine mehrseitige kommunikative Dienstleistung des
Schallphänomens ohne Sonderbedingungen möglich ist. Überall
dort und soweit nämlich, als z. B. der Ausdruck an Momenten des
Lautes manifest wird, die für die Darstellung irrelevant sind und
umgekehrt.
Das deutsche Wort ‚es regnet’ trifft aus jeder konkreten Situation
gesprochen das uns allen bekannte meteorologische Ereignis;
trifft es kraft seiner phonematischen Prägung, die musikalische
Modulation ist irrelevant. Darum kann der Sprecher im Musikalischen
seiner Seele die Zügel schießen lassen, kann den Ärger oder
die Freude, wenn es sein muß, Jubel oder Verzweiflung erklingen
lassen, ohne den reinen Darstellungssinn des Wortes im mindesten
zu tangieren. Und wenn die umsichtige Gattin zum aus dem Haus
gehenden Professor sagt ‚es regnet’, dann mag sie jene aufrüttelnde
Appell-Melodie hineinlegen, welche das Benehmen des Zerstreuten
erfolgreich derart steuert, daß er das sonst vergessene Schutzdach
gegen den Regen mitnimmt. C'est le ton qui fait la musique; dies gilt
in den indogermanischen Sprachen weitgehend (aber nicht restlos)
in dem Sinne, daß der Ton dem Ausdruck und Appell frei steht und
irrelevant ist für die Darstellung. Ist ferner die Wortstellung im
Satze so frei wie im Lateinischen, dann wird sie Cicero kunstvoll
rhetorisch verwerten usw.
Fast überflüssig daran zu erinnern, daß wir von variablen
Momenten und nichts anderem sprechen; Aspektauflösungen einer
Sache sind stets etwas anderes als das Schachtelverfahren, und für
das Ganze einer sprachlichen Äußerung gilt als Regulativ ein Wort
von Engel,
„daß in der Seele die Vorstellung des Objekts und die der Rührung, welche
das Objekt hervorbringt, so ganz ungetrennt, so innig verschmolzen, so Eins sind,
und daß der Mensch diese Vorstellungen, auch in ihrer Bezeichnung, gleich innig
will verschmelzt, gleich genau will vereinigt, wissen. Ein einziges Zeichen, welches
in einem Nu beyden Zwecken und gleich vollkommen Genüge tut, muß ihm daher
ohne alle Vergleichung lieber seyn, als mehrere abgesetzte Zeichen, die dasjenige
zerreißen und vereinzeln, was er in seiner Seele selbst so gar nicht zu sondern, so
gar nicht aus einander zu finden weiß” 1)17.
6. In mehr loser Form seien nun über das Axiom von der
Zeichennatur der Sprache noch ein paar Glossen angefügt. Grundsätze
sollen, wie man weiß, nicht nur den rechten Weg bestimmen,
sondern auch vor Irrwegen und Sackgassen bewahren. Wovor
bewahrt das Axiom die Sprachforschung? Vor dem Fehler der
Stoffentgleisung auf der einen Seite und vor magischen
46Theorien auf der anderen. Angenommen es kommt ein aufgeklärter
Europäer zu einem Indianerstamm und findet über ein Idol,
das dort verehrt wird, nichts zu erforschen, als daß es durch und
durch aus Holz gemacht ist. Ein geisteswissenschaftlich geschulter
Freund mag eine Diskussion mit ihm darüber so einleiten, daß er
mit Kreide Zeichen auf eine Tafel malt und die Frage stellt, was das
und das „sei”. Wenn die verstockten Antworten lauten, das sei Kreide
und nichts als Kreide, obwohl die Gesamtfigur etwa so image
aussieht, dann nenne ich das in sachlicher Übereinstimmung
mit Gomperz eine konsequente Stoffentgleisung. Demgegenüber
pflegt man, was die Indianer und ähnliche Denker, wenigstens soweit
wir sie verstehen, über ihre Idole zu sagen und was sie mit
ihnen zu machen pflegen, als Offenbarungen eines magischen Denkens
zu bezeichnen. Eigentlich steht es vom Denken des radikalen Aufklärers
nicht in jeder Hinsicht so weltenweit ab, als man auf den
ersten Blick vermuten sollte; denn auch jedes „magische” Denken,
wie immer es im einzelnen operieren mag, vergreift sich wie er am
Axiom von der Zeichennatur von Zeichenhaftem und antwortet
mit physikalischen Kausalbetrachtungen (im weitesten Wortsinn)
an Stellen, wo der Sematologie oder einer der Sematologie verwandten
Gebildelehre das Wort gebührt. Das ist, glaube ich, die exakteste
Umschreibung des Tatbestandes der magischen Geisteshaltung,
soweit wir sie begreifen. Es ist eine interessante und höchst wichtige
Frage aus dem Gebiet der Tatsachen, die man am prägnantesten
mit der Überschrift ‚Die innere Sprachform’ versieht, was an Momenten
solch magischer Geisteshaltung am Bestände solcher oder
jener gegebenen Sprache (auch derjenigen, die wir sprechen) offenbar
wird. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als solche Geisteshaltung
selbst in das sprachtheoretische Denken aufnehmen. Im
übrigen kommt es mir vor, als habe man das Gewicht solcher Züge
in dieser und jener Menschensprache in Relation zu dem Nicht-Magischen,
das ja ebensowenig irgendwo fehlt und fehlen durfte,
wo die Sprache das Verkehrsmittel auch im Alltagsleben außerhalb
der magischen Kreise war, gewaltig überschätzt. Dazu sollen an
einem anderen Orte die Argumente, die ich glaube gefunden zu haben,
geboten werden.
Zu allem Zeichenhaften in der Welt gehören der Natur der
Sache nach Wesen, die es dafür halten und mit ihm als Zeichenhaftem
umgehen. Man muß also physikalisch gesprochen im objektiven
Verfahren die geeigneten psychophysischen Systeme wie Detektoren
verwenden, um zeichenhaft Wirkendes zu entdecken. Wo
47die Konkreta, welche Zeichenfunktionen erfüllen, von handelnden
Wesen produziert oder hergerichtet werden, wo diese Konkreta
zu jenen Wesen im Verhältnis des Werkes zum Schöpfer oder
(nur anders gesehen) im Verhältnis der Tat zum Täter stehen, da
kann man diese auch die Zeichengeber nennen. Signalgeber und
Signalempfänger gibt es im Tierreich in all jenen Situationen, die
wir durch die Formel auf S. 38f. umschrieben haben. Daß. die menschliche
Sprache schon von daher gesehen zu den „Geräten” gehört
oder platonisch gesprochen, daß sie ein organon sei, heißt nichts
anderes, als sie in Relation zu denen betrachten, die mit ihr umgehen
und ihre Täter sind. Die Sprachforschung stößt also im Axiom von
der Zeichennatur der Sprache auf das Denkmodell des homo faber,
eines Machers und Benutzers von Geräten. Wir werden dieses
Modell im Auge behalten und ihm Schritt für Schritt aus jedem
neuen Axiom neue Bestimmungen einzeichnen. Einstweilen aber
kann man das Zeichenhafte, welches im intersubjektiven Verkehr
verwendet wird, als ein Orientierungsgerät des Gemeinschaftslebens
charakterisieren.
§ 4. Sprechhandlung und Sprach werk; Sprechakt und
Sprachgebilde (C).
Es sind nicht zwei, sondern vier Momente (Seiten), vier Fronten
sozusagen, am Gesamtgegenstand der Sprachwissenschaft, die im
Axiom C aufgezeigt und erläutert werden müssen. Vier, weil es die
Sache so verlangt und irgend zwei aus der Schar nicht scharf genug
definierbar sind. W. von Humboldt sagte energeia und ergon,
de Saussure griff die im Französischen lebendige Opposition von
la parole und la langue (englisch speech und language) auf, um sie als
Sprachforscher in einer linguistique de la parole parallel zur herkömmlichen
linguistique de la langue zu thematisieren. Seit Humboldt
gab es so gut wie keinen Sachverständigen von Format,
der nicht verspürt hätte, es sei etwas sehr Beachtenswertes mit
energeia und ergon berührt, und keinen seit de Saussure, der sich
nicht schon Gedanken gemacht hätte über la parole und la langue.
Aber weder das alte noch das neue Paar ist richtig produktiv geworden
im Reich der sprachwissenschaftlichen Grundbegriffe. Da
und dort wird heute noch versucht, bald psychologisch, bald erkenntnistheoretisch,
dem einen von beiden Gliedern des Paares energeia
und ergon eine Priorität zu vindizieren; die Sprachtheorie muß solche
Unternehmungen als (ihr) transzendent erkennen und als empirische
Wissenschaft in ihrem eigenen Hause das Quadrifolium als solches
48hinnehmen, wie sie es vorfindet; die Ergebnisse der Sprachforschung
selbst sind Zeugen dafür, daß es im Fingerspitzengefühl der Forscher
lebendig ist und nur der begrifflichen Fassung harrt.
Da es in gleichem Maße auf die Relationen, welche zwischen
den vier Begriffen bestehen, wie auf die Definition jedes einzelnen
ankommt, sei erst rein formal an einem Strichsymbol verdeutlicht,
daß es in einer Vierergruppe wie H, W, A, G nicht weniger und nicht
mehr als sechs Grundrelationen gibt; ob man sie räumlich in einem
Tetraeder oder an einem Viereck veranschaulicht, ist gleichgültig.
Ich schlage das Viereck vor, an dem wir den ersten entscheidenden
Bestimmungsschritt aus der höchsten Formalisierung zur greifbaren
Realität hin vornehmen können. Also:
image H | W | A | G
Die Anordnung ist zunächst willkürlich, doch gestalten wir
sie zu einem Vierfelderschema aus mit der Absicht, zwei sich kreuzende
Dichotomien auszudeuten:
tableau H | W | A | G
Welches ist der Gesichtspunkt, von dem aus Sprechhandlungen
und Sprechakte zu I und Sprachwerke mit den Sprachgebilden
zu II gehören? Was ist der zweite Gesichtspunkt, unter dem Sprechhandlungen
und Sprachwerke unter 1 und Sprechakte und Sprachgebilde
zu 2 gehören? Das Endergebnis lautet, daß man die Sprachphänomene
bestimmen kann:
I. Als subjektsbezogene Phänomene.
II. Als subjektsentbundene und dafür intersubjektiv fixierte
Phänomene.
Beides ist möglich und vonnöten; wir werden dies exemplarisch
in einer Konfrontation der Aktlehre Husserls mit der J. St. Millschen
Logik im Abschnitt über die sprachlichen Begriffszeichen, die
Nennwörter, beweisen.
Und was die andere Dichotomie angeht, so kann der Sprachforscher,
was seine ‚Sinne zu rühren’ imstande ist, bestimmen:
1. Auf einer niederen Formalisieriingsstufe als Handlungen und
Werke.
2. Auf einer höheren Formalisierungsstufe als Akte und Gebilde.49
Denken wir an die Sprachgebilde. Was z. B. über den accusativus
cum infinitivo (das Wort im Singularis) in der lateinischen
Grammatik steht, trifft selbst dann noch, wenn es am Beispiel
Carthaginem esse delendam verdeutlicht wird, ein logisch formalisiertes
Etwas, ein Etwas der höheren Stufe. Daß das als Beispiel
zitierte ‚Wort’ (= Parole) in einer bestimmten Senatssitzung von
Cato dem Älteren zum erstenmal und dann in anderen bestimmten
Senatssitzungen immer wieder realisiert worden ist, weiß jeder
Grammatiker aber keine Grammatik; es interessiert sie nicht und
darf sie als Grammatik nicht interessieren.
Genau so wenig darf die hohe und die niedere Arithmetik
Notiz davon nehmen, daß das Paar Schuhe und das Paar Strümpfe
hier oder das Paar Augen und das Paar Ohren am Kopfe dieses
Menschen dort das Ergebnis vier „sozusagen” anschaulich gewinnen
half und immer wieder hilft dem Adepten des Rechenunterrichts.
Denn die Arithmetik ist keine Lehre von Augen, Ohren, Bäumen,
Rechenkugeln, sondern die Wissenschaft von den Zahlen; ihre
Gegenstände sind daher im Hinblick auf die Eigenschaften von
Gruppen von Dingen und nicht der Dinge selbst als Klassen von
Klassen definiert worden. Zu entscheiden, ob diese Bestimmung
ausreichend ist, überlassen wir den Mathematikern, ich selbst
glaube es nicht recht. Aber daß sie ein wichtiges Moment am Zahlbegriff,
das in der angewandten Mathematik von Wichtigkeit ist,
hervorhebt, erscheint mir unbestreitbar. Wir ziehen eine Parallele
zwischen Zahlen und Sprachgebilden und finden, daß die Bestimmung
„Klassen von Klassen” analogisch auf sie übertragen werden
kann. Statt des spezifisch grammatischen Exempels vom accusativus
cum infinitivo hätten wir ebensogut ein Beispiel aus dem Lexikon
durchsprechen können und werden dies nachholen.
Wir haben die nominalistische Sprechweise der einfachen Vergleichbarkeit
halber verwendet; der entscheidende Bestimmungsschritt
ändert sich nicht, wenn man jedes Sprachgebilde als echte
species im Sinne der (scholastischen und) Husserlschen Logik ansieht;
begriffliche Gegenstände (Klassen) gibt es überall, aber daß
als Klassen von Klassen in der Physik die Zahlen und in der Linguistik
die Sprachgebilde wichtig werden, ist eine äußerst bemerkenswerte
Tatsache, welche auf die Zeichennatur der Sprachphänomene
zurückverweist. Jedenfalls ist und bleibt es so, daß Sätze über das
konkrete Sprechereignis ebensowenig in die reine Phonologie, die
Wortlehre (Morphologie) und Syntax gehören wie Sätze über Bäume
und Äpfel in eine reine Arithmetik. Genau so wenig gehören denkpsychologische
50Protokollsätze in die scholastische und Husserlsche
Aktlehre, über deren Unentbehrlichkeit im Systeme einer vollendeten
Sprachtheorie am systematischen Orte manches zu sagen ist. Doch
wir wollen nach dieser Übersicht die Besprechung von H, W, A, G
selbst beginnen.
1. Zuerst die Sprechhandlung und das Sprachwerk. Ob Cäsar
wirklich in einem gewissen Augenblick alea jacta est gesprochen,
ob Luther in Worms geschlossen hat mit dem hier steh ich, ich kann
nicht anders, entzieht sich meinem Wissen; doch scheint mir, daß
diese Worte den beiden Männern exemplarisch mit dem Interesse
für ihren Parolecharakter nachgesagt werden. Biographisch ungefähr
so, wie das Experiment mit dem Kolumbusei dem Entdecker Amerikas.
Was die cäsarische Parole angeht, so erzählt Plutarch von einem
Haltmachen und innerem Schwanken am Flusse Rubico und darauf
wörtlich: „und nachdem er jenen bei Ungewissen und gewagten
Unternehmungen gewöhnlichen Ausruf: So mag denn der Wurf
getan sein — gebraucht hatte, entschloß er sich zum Übergang,
legte den übrigen Weg in größter Geschwindigkeit zurück und drang
noch vor Anbruch des Tages in Ariminum ein, welche Stadt er
sogleich besetzte.” Cäsar war also nicht sehr erfinderisch, sondern
gebrauchte einen „gewöhnlichen Ausruf”, der seither freilich von
allen ehemaligen Lateinschülern kaum mehr vom Fluß Rubico
und cäsarischem Wagemut freigedacht werden kann. Was für eine
Art von Sprachlehre müßte die linguistique de la parole sein,
wenn feststeht, daß die cäsarische und lutherische Parole an systematischer
Stelle darin vorkommen?
Beide Aussprüche dürften im Büchmann verzeichnet und mit
den wissenswerten biographischen (historischen) Erläuterungen versehen
sein, und der Büchmann steht im Sachkatalog der Bibliotheken
unter den sprachwissenschaftlichen Büchern. Doch kann
man, um von einem Außenwerk ins Hauptquartier zu kommen,
auch gründlicher zufassen und allgemein zum Thema wählen, wie
Worte im Menschenleben stehen, wie sie manchmal Entscheidungen
bedeuten, wie sie dem Sprecher und anderen zum Schicksal ausschlagen,
wie sie Diplomaten zur Ehre gereichen, Hohlköpfe stigmatisieren
und „geflügelt” werden. Das geflügelte Wort hat Parolecharakter
gleichviel, ob es eine Vokabel oder ein Satz, eine modenhafte
Redensart (idiom) oder ein Sprichwort ist. Von da aus ist
nur noch eine leichte Akzentverschiebung weg vom Menschenschicksal
auf die Worte selbst vonnöten und wir sind am Ziele.
Es kann jedes geflügelte und nichtgeflügelte Wort sub specie einer
51menschlichen Handlung betrachtet werden. Denn jedes konkrete
Sprechen steht im Lebensverbande mit dem übrigen sinnvollen
Verhalten eines Menschen; es steht unter Handlungen und ist
selbst eine Handlung. In gegebener Situation sehen wir, daß ein
Mensch das eine Mal mit den Händen zugreift und das Greifbare,
die körperlichen Dinge, behandelt, sich an ihnen betätigt. Ein
andermal sehen wir, daß er den Mund auftut und spricht. In beiden
Fällen erweist sich das Geschehen, das wir beobachten können, gesteuert
auf ein Ziel hin, auf etwas, was erreicht werden soll. Und
genau das ist es, was der Psychologe eine Handlung nennt. Die
deutsche Umgangssprache hat den wissenschaftlichen Terminus
„Handlung” vorbereitet und nahegelegt. Wir verallgemeinern schon
im täglichen Leben, wir nennen nicht nur die Manipulationen, worin
die Hände tatsächlich im Spiele und tätig sind, Handlungen, sondern
auch andere, wir nennen alle zielgesteuerten Tätigkeiten des ganzen
Menschen Handlungen. Die vergleichende Psychologie verwendet
den Terminus sogar für die Tiere, doch interessiert uns das vorerst
nicht besonders.
Mich dünkt, es sei so etwas wie ein Ariadnefaden, der aus
allerhand nur halb begriffenen Verwicklungen herausführt, gefunden,
wenn man das Sprechen entschlossen als Handlung (und
das ist die volle Praxis im Sinne des Aristoteles) bestimmt. Im
Vorblick auf Späteres sei angemerkt, daß der Einbau des Sprechens
in anderes sinnvolles Verhalten einen eigenen Namen verdient;
wir werden empraktische Reden, die unvollendet anmuten, als eine
Hauptgruppe der sogenannten Ellipsen kennen lernen und von da
aus die ganze Ellipsenfrage ordentlich bereinigen. Ist man aber
überhaupt einmal auf das Faktum des Einbaus aufmerksam geworden,
so empfiehlt es sich, die möglichen und bald so, bald anders
relevanten Umfelder der Sprachzeichen systematisch aufzusuchen;
das geschieht in § 10. Hier aber ist die Stelle, wo das Sprechen selbst
als Handlung betrachtet werden muß. Dem antiken Denken, welches
Sprache und Logos völlig oder fast völlig identifizierte, ist die
Fruchtbarkeit gerade dieses Gesichtspunktes entgangen; abgesehen
vielleicht von einem Restchen in der berühmten ‚Zustimmung’
(συνκατάϑεσις) der Stoiker. Doch lassen wir das Historische beiseite.
Zu einer begrifflich scharfen Abhebung der Sprechhandlung
vom Sprachwerk liefert Aristoteles die Kategorien und das
spielende Kind die durchsichtigsten Beobachtungsdaten. Aristoteles
denkt uns im ersten Schritt einer wichtigen Begriffsreihe die
Scheidung menschlichen Verhaltens in Theoria und Praxis vor, um
52dann im zweiten Schritt von der Praxis im engeren Sinn die Poesis
abzusondern; was wir brauchen, ist die zweite Scheidung. Das Kind
von 2-4 Jahren und darüber übt uns spielend erst Praxis und dann
Poesis vor; das Kind kommt langsam Schritt für Schritt und abgestuft
an verschiedenem Materiale zur Herstellung, zur „Werkreife”
nach Ch. Bühler. Die ersten Illusionsspiele des Kindes
haben zum Thema das Handeln der Erwachsenen, die späteren
Werkspiele des Kindes haben zum Thema die Herstellung von
dem, was Menschen machen. Es ist ein großer, greifbarer Unterschied
zwischen Handlungsspielen und Werkspielen; denn bei jenen
wird am Material nur flüchtig und symbolisierend angedeutet, was
mit ihm and an ihm geschehen sollte. Dann aber kommt das Kind
weiter und lernt (was gar nicht selbstverständlich ist) das Produkt
seines Tuns als Werk zu sehen. Erste Andeutung, daß es geschehen
wird, ist jenes erhebende Betrachten, Bestaunen und Bestaunenlassen
post festum dessen, was beim Hantieren entstand; wobei das
Kind (auf seiner Stufe natürlich) die Feiertagshaltung der Schillerschen
Glocke einnimmt: ‚den schlechten Mann muß man verachten,
der nie bedacht, was er vollbringt’. Es ist noch gar kein Mann oder
schaffender Mensch, wer dies überhaupt nicht tut. Die Rückschau
aufs Fertige, zufällig fertig Gewordene ist beim spielenden Kinde
ein Anstoß, es folgt die entscheidende Phase, wo das in einer Konzeption
vorweggenommene Resultat des Tuns schon prospektiv
die Betätigung am Material zu steuern beginnt und wo dann schließlich
das Tun nicht mehr zur Ruhe kommt, bevor das Werk vollendet
ist.
Genau so im Prinzip redet der Schaffende an einem Sprachwerk
nicht wie der praktisch Handelnde redet; es gibt für uns alle
Situationen, in denen das Problem des Augenblicks, die Aufgabe
aus der Lebenslage redend gelöst wird: Sprechhandlungen. Und es
gibt andere Gelegenheiten, wo wir schaffend an der adäquaten
sprachlichen Fassung eines gegebenen Stoffes arbeiten und ein
Sprachwerk hervorbringen. Dies also ist das Merkmal, welches im
Begriff ‚Sprechhandlung’ unterstrichen werden muß und nicht
wegzudenken ist, daß das Sprechen „erledigt” (erfüllt) ist, in dem
Maße, wie es die Aufgabe, das praktische Problem der Lage zu
lösen, erfüllt hat. Aus der Sprechhandlung ist demnach die Creszenz
(im Weinberg des praktischen Lebens) nicht wegzudenken, sie gehört
dazu. Beim Sprachwerk dagegen ist es anders.
Das Sprachwerk als solches will entbunden aus dem Standort
im individuellen Leben und Erleben seines Erzeugers betrachtbar
53und betrachtet sein. Das Produkt als Werk des Menschen will
stets seiner Creszenz enthoben und verselbständigt sein. Man verstehe
uns recht: ein Produkt kommt stets heraus, wo ein Mensch
den Mund auf tut; ein Produkt entsteht auch im reinsten Handlungsspiel
des Kindes. Doch sehe man sich diese Produkte näher an;
es sind in der Regel Fetzen, die das Spielzimmer erfüllen, solange
noch Praxis gespielt wird; erst wenn Poesis gespielt wird, dann sind
die Produkte „Bauten” u. dgl. m. Genau so sind es nicht selten nur
Redefetzen, die bei der rein empraktischen Rede herauskommen,
Ellipsen, Anakoluthe usw. Sie erfüllen ihren Zweck vorzüglich;
ein Dummkopf, wer sie ausrotten wollte. Sie blühen auf in jeder
dramatischen Rede, die ihren Namen verdient. Anders aber
werden die Dinge (wieder wie im kindlichen Spiel), wenn diese
Produkte auf Entbindbarkeit aus ihrer individuellen praktischen
Creszenz hin gestaltet werden. Genau an diesem Punkte wird unsere
Lehre vom Satz beginnen und nachweisen, wie die Erlösung des
Satzsinnes aus der Sprechsituation vonstatten geht.
2. Man muß die Dinge nach den höchsten Ordnungsgesichtspunkten
von Praxis und Poesis einmal soweit aufgespalten haben,
um danach das faktische Ineinander der Leitfäden im Falle des
hochgeübten kultivierten Sprechens nicht zu leugnen, sondern als
ein eigenes Problem und Thema allererst richtig zu sehen. Es gibt
eine Kunst des schlagfertigen und treffsicheren Fassens und Gestaltens
im praktisch fruchtbaren Augenblick. Doch bleiben wir
wissenschaftlich abstrakt und einseitig, um zuzusehen, wohin im
weiten Reich der Sprachtheorie die Werkbetrachtung und wohin
die Analyse der Sprechhandlung führt.
Hervorragende Sprachwerke sind wie andere Geschöpfe des
Menschen, wie die neunte Symphonie und die Brooklynbridge und
das Kraftwerk am Walchensee der Forschung bedeutsam in einmaligen
Zügen von besonderer Qualität. Man kann am Werk
Züge des Schöpfers und seines Schaffens, man kann noch vieles
andere an ihm studieren. Wenn einem Kinde aus ungeheurer innerer
Spannung zum erstenmal die sprachliche Fassung von dem und
jenem, z. B. die Erzählung eines eindrucksvollen Vorgangs aus der
Vergangenheit gelingt wie in daten lalala (Soldaten haben gesungen) 1)18,
so sieht der Erforscher der Menschwerdung des Kindes eine bedeutsame
Leistung in diesem „Sprachwerk”. Es gibt einen Dichter,
der einen bestimmten Stoff so faßte:54
Ich ging im Walde
So für mich hin.
Und nichts zu suchen.
Das war mein Sinn.
Ob der Stoff ein äußeres Ereignis, Erlebnis oder sonst etwas
ist, jedenfalls zielt die sprachliche Werkbetrachtung in allen Fällen
auf die Fassung und in vielen Fällen minutiös auf die einmalige
Fassung und Gestaltung als solche ab. Man sollte aber auch für die
Erfassung des Einzelnen geeignete Kategorien haben; denn jede
Wissenschaft ist auf „Prinzipien” fundiert. Eine umsichtige Sprachtheorie
muß Platz haben in ihrem Systeme auch für diesen Zweig
der Sprachforschung. Die neuen Bewegungen im Hause der Wissenschaft
vom Sprachwerk sind, soweit ich sehen kann, einer Wiederaufnahme
dessen, was die Alten begonnen und schon sehr weit
geführt hatten, geneigter als die Forscher im 19. Jahrhundert. Aus
guten Gründen, wie mir scheint. O. Walzel läßt in seinem Buche
„Gehalt und Gestalt” (S. 190) Wilamowitz zu Worte kommen,
der schon 1905 den „unbestreitbar hohen und dauernden Wert
der Stilistik des Hellenismus und ihrer viel älteren griechischen
Vorarbeiten” rühmt. „In dem Buch über den sprachlichen Ausdruck
habe Theophrast auf dem Boden des wunderbar feinen aristotelischen
Buches, das wir jetzt als drittes der Rhetorik lesen, ein festgefügtes
System erbaut, namentlich durch die Anerkennung verschiedener
Prosastile.” Die Dinge liegen nicht auf unserem Wege;
doch möchte ich in der Voranzeige schon darauf hinweisen, daß uns
die Analyse der darstellenden Sprache völlig ungesucht an Stellen
führen wird, wo zu sehen ist, wie die alten „genera dicendi oder
orationis” in erweitertem Horizonte neu erstehen können. Es ist
dort nicht die Lyrik und nicht die Rhetorik im engeren Wortsinn,
es ist der Unterschied der dramatischen und der epischen
Sprache, auf den ein erstes Streiflicht fällt; vorbereitet ist das
dramatische Moment in jeder anschaulich präsentierenden Rede und
begrifflich faßbar wird etwas von ihm in der ‚Deixis am Phantasma’,
die in etwas verschiedener Form vom Dramatiker und vom Epiker
eingesetzt und ausgenützt wird. Soviel hier von Sprachwerk.
In ein anderes Geleise führt die Aufgabe, eine Theorie der
Sprechhandlung aufzubauen; überschlagen wir summarisch, was die
Psychologie von heute dafür vorbereitet, aber noch nicht vollendet
hat. Die neueste Psychologie ist drauf und dran, die tierische
und menschliche Handlung wieder einmal mit neuen Augen zu
sehen, und wird auf alle Fälle mit einem umfassenden und sorgfältig
vorbereiteten Apparat von Fragen, Gesichtspunkten, Untersuchungsmöglichkeiten
55diese Aufgabe bewältigen. Denn alle die
sonst soweit auseinanderstrebenden Richtungen der modernen
Psychologie konvergieren im Faktum der Handlung und tragen
heute schon faßbar jede das ihre zu seiner Aufhellung bei. In meiner
Fassung der Axiomatik in den Kant-Studien sind einige Belege
zu dieser These erbracht; ich will sie hier nicht reproduzieren, sondern
nur das eine daraus unterstreichen, daß ‚Handlung’, wie immer man
das Gemeinte wissenschaftlich fassen mag, ein historischer Begriff ist
und auch in der Psychologie nichts anderes werden kann. Es gibt
in jeder Handlung ein Feld; ich habe es vor Jahren schon Aktionsfeld
genannt und in den Kant-Studien noch einmal die zwei Determinationsquellen
jeder Handlung als Bedürfnis und Gelegenheit bestimmt.
Daß es zwei sind, haben Aristoteles und Goethe gewußt; derselbe
Zweifaktoren-Ansatz, den ich für nötig halte, steht plastisch greifbar
in Goethes physiognomischen Studien 1)19. Doch es bedarf neben
der Aufgliederung des Aktionsfeldes in seine zwei präsenten Bestimmungsmomente
(der inneren und äußeren Situation) einer
hinreichenden historischen Kenntnis des Handelnden selbst, um
einigermaßen präzis vorauszusagen, was geschehen wird oder nachher
wissenschaftlich zu begreifen, was geschehen ist. Die Duplizität
im Aktionsfeld und die Tatsache der nur historisch faßbaren
Reaktions- oder Aktionsbasis, das sind die zwei wichtigsten Einsichten,
die ich prinzipienmonistischen Neigungen gegenüber für
unentbehrlich halte. Ich habe vor allem die Berliner Gestaltspsychologie
im Auge.
Ist die Handlung eine Sprechhandlung (Parole), so weiß
der Sachverständige sofort, was in diesem Fall unter dem Titel des
individuell Erworbenen zu bringen ist: der gesamte Lernerwerb
des Sprechenkönnens natürlich bis zu der Stufe von Fertigkeit
(oder Unfertigkeit), auf der man ihn im Moment des Handelns
antrifft. Was alles dazu gehört, gibt man im ersten Aufriß am besten
per exclusionem an. Das letzte vor allem muß ausgenommen sein,
was außerdem noch in die (historische) Exposition hineingehört.
Jede menschliche Handlung (wenn man genau zusieht, wohl auch
auf anderem Entwicklungsplateau die tierische) hat, was man in
einem spezifischen Sinn des Wortes ihre Aktgeschichte nennen
kann. Versteht sich bald eine lange und reiche, bald eine kurze und
arme Aktgeschichte. Raskolnikow braucht Wochen vom ersten
Auftauchen der Idee bis zur Handlung, eine lange und reichbewegte
56Aktgeschichte. Die Kriminalarchive, Romane und Dramen sind
voll von anderen. Was es zu erfassen gilt, ist, daß von der Theorie
Sekunden oder Bruchteile von Sekunden nicht vernachlässigt
werden dürfen, wenn sie die denkbar kürzeste Aktgeschichte umschließen.
Gleichviel, ob sie in der schlagfertigen Rede nach Bruchteilen
von Sekunden oder sonstwo länger zu bemessen ist, so ist
die Aktgeschichte ein Faktum, das die Denkpsychologen in ihren
Protokollen so präzis als möglich zu fixieren und wissenschaftlich
zu begreifen versuchten. In der Linguistik hatte man vor der Denkpsychologie
nur ganz schematische Vorstellungen, z. B. von der
Aktgeschichte eines Satzes, und formulierte dies schematische Wissen
aus der unkontrollierten Alltagserfahrung so, wie es noch bei Wundt
und H. Paul zu lesen ist. Die Diskussion zwischen beiden darüber,
ob dies Geschehen eine Ausgliederung (Analysis) oder ein Aufbau
(Synthesis) sei, entsprang aus einer sehr mangelhaften Kenntnis
von der faktischen Mannigfaltigkeit, der Aktgeschichten in konkreten
Fällen.
3. An dritter Stelle etwas von dem ältesten Besitz der Sprachwissenschaft,
von der Gebildelehre. Der logische Charakter der
Sprachgebilde ist von keinem neueren Linguisten und direkt aus
der eigenen erfolgreichen Forschungsarbeit heraus so treffend beschrieben
worden wie von F. de Saussure. Nur ist es bei der „Beschreibung”
geblieben und keine konsequente begriffliche Erfassung
daraus entstanden. Geordnet aufgezählt sind es folgende
Angaben über den Gegenstand der linguistique de la langue, die
von de Saussure gemacht werden. Erstens, methodisch voran
steht die Erkenntnis von der reinlichen Ablösbarkeit des „Objektes”
der linguistique de la langue. „Die Wissenschaft von der
Sprache (la langue) kann nicht nur der anderen Elemente der menschlichen
Rede entraten, sondern sie ist überhaupt nur möglich, wenn
diese anderen Elemente nicht damit verquickt werden.” Da spricht
die Weisheit des erfolgreichen empirischen Forschers und harrt nur
einer logisch scharfen Auslegung, um des Scheins von Paradoxie,
den sie mitbringen mag, entledigt zu werden; es ist die Erkenntnis
von der Erlösung der Sprachgebilde (ihrem Funktionswerte nach)
aus den Umständen der konkreten Sprechsituation. Das zweite
ist die Anwendung des Schlüsselsatzes von der Zeichennatur der
Sprache: „Die Sprache (Ja langue) ist ein System von Zeichen, in
dem einzig die Verbindung von Sinn und Lautzeichen wesentlich
ist.” Man ersetze die unbrauchbare Deutung dieser „Verbindung”
als einer Assoziation durch etwas Besseres, und die Verstrickung in
57unlösbare Scheinprobleme wird behoben, ein wahres Rattennest
von Unzulänglichkeiten wird getilgt sein. Bestehen bleibt die
Erkenntnis, daß die semantischen Relationen in der Tat den Gegenstand
‚Sprache’ konstitutieren. Es fehlt auch drittens nicht an
einer konsequenten Durchführung dieses regulativen Grundsatzes
an allen Sprachgebilden. De Saussure ist seiner Zeit vorausgeeilt
und einer Konzeption der Phonologie so nahe gekommen, daß eigentlich
nur noch eines in seinem Konzepte fehlte, nämlich die Angabe,
wie sich die Phonologie zur Phonetik verhält. Warum die Phonetik
daneben bestehen bleiben muß und warum sie den Weg einer exakten
Naturwissenschaft zu seiner Zeit schon eingeschlagen hatte, das
blieb de Saussure verborgen. Doch weiter: er hat viertens den
intersubjektiven Charakter der Sprachgebilde und im Zusammenhang
damit ihre Unabhängigkeit vom einzelnen Sprecher einer Sprachgemeinschaft
scharf, in einigem vielleicht sogar überspitzt herausgearbeitet.
La langue „ist unabhängig vom Einzelnen, welcher für
sich allein sie weder schaffen noch umgestalten kann; sie besteht
nur kraft einer Art von Konvention zwischen den Gliedern der
Sprachgemeinschaft”. Das gilt überall nur bis an gewisse Grenzen;
es gilt nicht mehr in jenen Freiheitsgraden, worin eine echte „Bedeutungsverleihung”
an das Sprachzeichen stattfindet; es gilt nicht,
wo Neuerungen von sprachschöpferischen Sprechern angeregt und von
der Gemeinschaft angenommen werden. Davon später mehr in dem
Abschnitt vom Sprechakte. Vorerst stehen noch die Sprachgebilde
zur Diskussion.
Die Synopsis und ein Ausdenken der vier Angaben de Saussures
muß die Frage nach dem logischen Charakter der Sprachgebilde
befriedigend zu beantworten imstande sein. Ausgeschlossen
ist die von de Saussure noch nicht überwundene Metzgeranalyse,
nach welcher la langue ein „Gegenstand konkreter Art” sei und
daß er „lokalisiert” werden könne „in demjenigen Teil des Kreislaufs,
wo ein Lautbild sich einer Vorstellung (= Sachvorstellung)
assoziiert” (17). Schroff gegen diese verhängnisvollste aller Stoffentgleisungen
wird von uns erstens die These von der Idealität
des Gegenstandes ‚Sprache’, wie er von der üblichen Sprachwissenschaft
gefaßt und behandelt wird, zu vertreten und zweitens
wird der prinzipielle Mißgriff aufzudecken und als Mißgriff
zu entlarven sein, den all jene getan haben, die im Banne der klassischen
Assoziationstheorie die zweifelsfrei nachzuweisenden Komplexions-
und Verlaufsverkettungen in unserem Vorstellungsleben
verwechseln mit dem Bedeutungserlebnis.58
Wenn, um dies gleich anzubringen, das Bedeutungserlebnis (A bedeutet B)
mit irgendeinem Innigkeitsgrad (Festigkeitsgrad) der Verkittung von zwei Vorstellungen
α und β identisch wäre, so müßte in allen Assoziationsketten, die uns Gelerntes
wie am Schnürchen und sogar im Halbschlaf reihenhaft zu reproduzieren
gestatten wie das Vaterunser und das Alphabet und die Zahlenreihe, die bei Definitionsgleichungen
immer wieder vernachlässigte logische Prüfung auf Umkehrbarkeit
durchzuführen sein. „Bedeutet” in der Assoziationskette des Alphabets
z. B. „kraft” inniger Assoziation, die zweifelsfrei besteht, jedes vorausgehende
Glied jedes folgende? Bedeutet die Vorstellung α das folgende β oder bedeutet
der Gegenstand von α den Gegenstand von β usw.? Wenn nicht, dann ist die angesetzte
Identität ein Nonsens und nichts anderes. Kein Wunder, daß selbst ein
Denker vom Formate eines J. St. Mill, der sich aus der Verstrickung der faktisch
so einfachen Grundthese der klassischen Assoziationstheorie nicht zu lösen vermochte,
nach langen Erörterungen über die z. B. im Urteil S ist P zwischen σ und π
(den Vorstellungen von S und P) bestehende assoziative Verkettung, zum Eingeständnis
kam: Es müsse zwar so sein, daß diese Verkettung das Spezifische im
Urteilserlebnis enthält, allein das Ganze käme ihm wie das „tiefste Mysterium der
menschlichen Natur” vor 1)20.
Nach der Kritik das Positive: Wo die Linguisten eine schlichte
Strukturaufnahme von lingua latina oder „den” Bantusprachen
machen, einen Lautschatz mit Nummern, einen Wortschatz anlegen
und eine Grammatik schreiben, da geht es zuletzt um Systeme
von Sprachgebilden. Was immer auch an Wichtigem, ja sogar
Unentbehrlichem dazu und drum herum bestimmt werden mag
z. B. in der Phonetik, so ist die Gebildelehre der Kern dazu. De
Saussure behauptet, dieser Kern sei ablösbar aus der Fülle des
Irrelevanten an den konkreten Sprechereignissen hie et nunc, und
kein Linguist wird ihm darin widersprechen. Man kann ja z. B.
Gräzisten oder Latinisten sagen hören, es liege eigentlich ganz
an der Grenze ihres Interessengebietes, wie die Laute aus dem Munde
der homerischen Griechen oder Ciceros wirklich geklungen haben.
Denn der wahre Gehalt der Wissenschaft von der griechischen und
lateinischen Sprache sei nicht wesentlich verstümmelt durch den
Umstand, daß er nur aus geschriebenen Dokumenten abgelesen
werden müsse. Die Ägyptologen werden dem für ihr Gebiet gewiß
nur maßvoll widersprechen, wenn sie es für nötig halten. Es trägt,
59so spekuliert de Saussure weiter, das also Bestimmte einen überindividuellen
Charakter und sei die Quintessenz dessen, was angibt,
wie man spricht oder sprach in einer gegebenen Sprachgemeinschaft.
Auch das sind Behauptungen, die von keinem Sachverständigen
bestritten werden. Alles zusammen: Die Sprachgebilde sind platonisch
gesprochen ideenartige Gegenstände, sie sind logistisch
gesprochen Klassen von Klassen wie die Zahlen oder Gegenstände
einer höheren Formalisierungsstufe des wissenschaftlichen Denkens.
Nur muß, wer die platonische Darstellungsweise wählt, die
Annahme der Ewigkeit und Unveränderlichkeit dieser „Ideen”
ein wenig umdenken oder weglassen; wer die logistische Sprechweise
wählt, darf den Vergleich mit den Zahlen nicht pressen, um Konflikte
mit greifbaren Tatsachen zu vermeiden. Gemeinsam aber
wird von jeder objektiven Sprachanalyse seit Platon, wird auch
von der logistischen unseres Zeitalters die Eignung der Sprachgebilde
für den intersubjektiven Verkehr unterstrichen. Legen wir
den Finger darauf, um an Vergleichbarem deutlich zu machen, was
damit getroffen ist.
Das Pendant zum Zeichenverkehr ist der Güteraustausch.
Machen wir uns an einem schematischen Vergleiche deutlich, wie
es bestellt ist mit der Formalisierung der drei Verkehrsdinge: Markenware,
Münzen, Wörter. Die Fabriken versehen Zigaretten, Schokolade,
Seife mit bestimmten Marken und versichern z. B. „Khedive
ist Khedive”, es sei ein Stück wie das andere. Der Verbraucher
sagt: „in einer bestimmten Toleranzzone ja, subtiler beurteilt
nein”. Denn eine Zigarette wird zuletzt geraucht, ein Stück Schokolade
gegessen und ein Stück Seife verbraucht, wobei es subtil auf
ihre Stoffeigenschaften ankommt und individuelle Differenzen
zwischen Stück und Stück ins Gewicht fallen können. Der Dollar
rollt, und dabei verlassen sich die Verkehrspartner, weil sie ihn
nicht essen und nicht rauchen müssen, weitergehend auf die Abmachung
‚Dollar ist Dollar’. Die Wörter fungieren im Sprechverkehr
in einer Hinsicht noch stoffgleichgültiger (entstofflichter,
abstrakter) wie der Dollar und sie sind in anderer Hinsicht wieder
mit verkehrsrelevanten von Fall zu Fall variierenden Qualitäten
ausgestattet, für welche die Verkehrspartner sehr sensibel sind;
was ich im Auge habe, sind die Ausdrucks- und Appellvalenzen der
Wörter. Doch blicken wir zuerst auf ihren Symbolwert allein. Die
Münze hat ein Gepräge, das ihr vom Münzstock verliehen ist; beim
unbesorgten Kaufakt prüft man nicht lange, sondern verläßt sich
auf das Erkennen des ersten Blickes. Aber wenn Echtheitszweifel
60aufsteigen, ist es doch geratener, das Stück zu prüfen oder abzulehnen.
Im unbesorgten Sprechverkehr riskiert man im allgemeinen
keinen späteren Verlust und wenn ich nur genügend sicher weiß,
was eine phonematisch schlecht geprägte Wortmünze sein soll nach
der Intention des Sprechers, darf ich sie hinnehmen; wenn nötig,
präge ich sie meinerseits richtig, sei es zur Sicherung gegen Mißverständnisse
oder zur Belehrung des Sprechers, wie das alle Sprachlehrer
ihren Schülern gegenüber berufsmäßig tun.
Es ist das phonematische Gepräge am Klangbild eines Wortes,
woran vergleichbar der Warenmarke und dem Münzgepräge eine
Verkehrskonvention geknüpft ist; diese (rein logisch gemeinte)
Konvention fixiert den Symbolwert des Wortes, der in einer Sprachgemeinschaft
konform dem Satze ‚Dollar ist Dollar’ in allen Realisierungsfällen
gleichgestellt ist. Vieles ist wahr und wird uns beschäftigen,
was zu dieser ersten Parallele hinzugefügt werden kann
und hinzugefügt werden muß, um die Eigenart der sprachlichen
Verkehrszeichen ganz zu erfassen; vor allem ist (um wieder von dem
Vergleiche frei zu werden) das konkrete Wort ein Zeichending und
der Dollar ist und bleibt, so sehr er sich in seiner Papierform den
Zeichendingen nähern mag, den Gütern verhaftet. Denn wenn man
ihn auch nicht essen kann, so erhält man im Kaufakt etwas für ihn,
was im allgemeinen von den „Sprachmünzen” nicht behauptet
werden kann.
Die Sematologie ist nicht berufen, nebenbei den Geldtheoretikern ins Konzept
hineinzusprechen. Doch wird sie, wenn einer das Geld schlankweg den zeichenhaften
Produkten des homo faber einordnen wollte, Bedenken vorbringen dürfen.
Eine Dollarnote liegt vor mir auf dem Tisch; sie ist mit individuellen Erkennungszeichen
versehen, sie trägt nach allem andern eine Nummer, die nur diesem Stück
hier eigen ist. Wozu das ganze (polizeiliche) Signalement? Damit dies Stück Papier
im Bedarfsfalle seine Echtheitsprüfung bestehen kann. Die Note und die Münze
muß stofflich das Stück sein, welches dem offiziellen Druck- oder Prägeverfahren
unterworfen war und aus ihm hervorgegangen ist. Davon ist bei reinen Zeichendingen
nur dort die Rede, wo sie z. B. physiognomisch ausgewertet als Anzeichen
fungieren, oder wo der Pegasus „Symbol” ins Joch gespannt und angeheftet wird
dem symbolisierten oder eines Echtheitszeichens (Eigentums-, Herkunftszeichens)
bedürftigen Ding. Sonst gibt es für Symbole keinen offiziellen und privilegierten
Prägstock, aus dem das Stück hervorgehen muß. Das alles scheint mir von der
Sematologie her gesehen die Gründe derer zu stützen, welche die unerläßliche Verhaftung
auch der sekundär und tertiär mit einem Geldwert versehenen Papierstücke
(also des sogenannten Zeichengeldes im engeren Wortsinn), ihre Verhaftung im Reiche
der Güter theoretisch stark unterstreichen und zum Definitionsmerkmal des Geldbegriffs
erheben. Doch dies nur nebenbei.
Aber alles später sonst noch Hinzugefügte hebt die Erkenntnis
nicht auf, daß die Sprachwissenschaft in ihrer Wortlehre Einheiten
61erfaßt, die logisch auf derselben Formalisierungsstufe stehen, wie
z. B. die Einheit ‚der Dollar’ oder die Einheit ‚Warenart Khedive’.
Wenn der Linguist sagt: ‚das Wort Vater’ und den Singularis
dabei gebraucht, so meint er, bezogen auf das, was seine Sinne zu
rühren imstande ist, eine Klasse von Phänomenen. Das Ergebnis
der historischen Sprachforschung ist dabei nicht aus-, sondern
einzuschließen. Denn was immer z. B. in der indogermanischen
Sprachfamilie mit dem Worte, das bei uns Vater geschrieben wird,
geschehen sein mag, so dürfte niemals weder sein phonematisches
Gepräge noch sein Symbolwert sprunghaft und gesetzlos gewechselt
haben. Im Hinblick auf solche Genidentität wird sprachhistorisch
die Einheit Vater gebildet und hat ihren Platz im Wortschatz
der deutschen Sprache für Vergangenheit und Gegenwart
und alle Dialekte; darum ist ‚Vater’ ein Wort für den Linguisten.
Solche Einheiten im Wortschatz sind im Hinblick auf das, was die
Sinne des Sprachforschers zu rühren vermag, natürliche Klassen.
Der Grammatiker aber kommt und erfaßt am Wort ‚Vater’ und
an vielen anderen Einheiten des Lexikons zugleich z. B. die Wortklasse
Substantiva und befindet sich damit in seinem Reich, nämlich
in der sprachwissenschaftlichen Gebildelehre. Man wird genau
zusehen müssen, worin rein logisch der Formalisierungsschritt des
Mathematikers von den wahrnehmbaren Dingpaaren zur Zahl
‚zwei’ gleich und verschieden ist von dem hier beschriebenen Formalisierungsschritt
des Grammatikers. Zunächst aber muß er als
Schritt erkannt und anerkannt sein. Im Axiom D erfolgt die Scheidung
der Sprachgebilde in Wörter und Sätze und im vierten Kapitel
wird ihr Aufbau untersucht.
Zu dem Namen ‚Sprachgebilde’ als Terminus bleibt nur hinzuzufügen, daß
dem Wort der Umgangssprache gegenüber vielleicht ein Zwang angetan wird durch
unsere Definition. Denn lax verstanden kann ‚Gebilde’ auch einmal das Individuum
(mit Eigennamen) als solches treffen. Die Regel ist dies keineswegs, sondern ‚Gebilde’
unterstreicht auch im gewöhnlichen Sprachgebrauch schon irgendein Strukturmoment
am Sinnending. Und wir verlangen nur, daß das linguistisch Strukturhafte
an den Zeichendingen als solches gemeint sein soll; dasjenige, was den Gegenstand
der linguistique de la langue ausmacht. Nicht wesentlich anders, wie ‚das rechtwinklige
Dreieck’ zu den ‚Gebilden’ der elementaren Geometrie, gehört das Verbum,
der Artikel und der Akkusativ zu den sprachwissenschaftlichen Gebilden.
4. Am wenigsten ausgebaut und noch sehr umstritten ist die
Lehre von den Sprechakten in dem spezifischen und scharf zu definierenden
Sinn des Wortes, wie ihn unser Vierfelderschema verlangt.
Doch gehen wir einmal zu Husserl und holen aus seinen
Logischen Untersuchungen das einzig uns hier Interessierende
62heraus; es sind seine subtilen Erörterungen über die sinnverleihenden
Akte. In unserem bereits vorangezeigten Abschnitt
über die sprachlichen Begriffszeichen wird genauer darzulegen sein,
daß man den Sprechverkehr mit den Wortmünzen unserer Nennwörter
theoretisch nicht vollständig begreifen kann ohne eine Übernahme
der wichtigen Unterscheidungen von Husserl. Ob in einem
Texte das Wort ‚Pferd’ ein Individuum oder ob es die Spezies der
Zoologen trifft, ist gewiß nicht gleichgültig und wird weder im artikellosen
Latein noch in den indogermanischen Artikelsprachen morphologisch
erkennbar. Man muß es detektivisch gleichsam dem
Kontexte oder den Umständen der Sprechsituation entnehmen,
ob der Sprecher das eine oder das andere im Auge hat und meint.
Was geht daraus hervor? Für uns, die Empfänger der Rede, ergibt
sich, daß wir dem Sender irgendwie ins innere Konzept zu
schauen vermögen; und für ihn, den Sprecher, ergibt sich, daß er
teilweise wenigstens der gebrauchten Wortmünze einen präziseren,
bestimmteren Sinn verleiht, als der beste Kenner der Sprache dem
isolierten Wort ‚Pferd’ anmerkt. In keinem Lexikon sind die Aktcharaktere
Husserls mitverzeichnet, es sei denn, das Wort wird
in der Sprache einseitig als Eigenname verwendet wie Sokrates.
So wie das dasteht, überrascht es gewiß keinen Sachverständigen,
sondern gehört zu den Trivialitäten. Doch verdient
diese Trivialität sehr genau und sorgsam bedacht zu werden, und
zwar in mehreren Richtungen. Wo findet das Detektivverfahren,
von dem die Rede ist, seine Indizien? Wenn ein deutscher Text
vorliegt, der ins Lateinische übersetzt werden muß, hat der Schüler
den Sachverhalt und seine deutsche Fassung verstanden und ich
kann ihm nach einem Verbum dicendi das ut mit dem Konjunktiv
sowohl „nachfühlen”, wie als unlateinisch korrigieren; die Bedeutungsverleihung,
welche der Schüler dem gebrauchten Sprachmittel angedeihen
ließ, widerspricht der Norm des klassischen Latein, ein
Sprechakt des Schülers fiel aus dem festen Rahmen der lateinischen
Gebildekonventionen. Ich reihe einen kleinen Hexensabbat korrigierter
Verfehlungen aus einem Werke an, das seine historische Mission
in der Sprachforschung des 19. Jahrhunderts erfüllt hat, obwohl
es nur ein kühner Husarenritt gegen die engstirnige und verknöcherte
Sprachlogik derer um Becker gewesen ist; ich meine Steinthals
„Grammatik, Logik und Psychologie” (1855). Dort steht:
„Es tritt jemand an eine runde Tafel und spricht: diese runde Tafel ist viereckig;
so schweigt der Grammatiker vollständig befriedigt; der Logiker aber ruft:
Unsinn! jener spricht: diese Tafel ist rund, oder hie tabulam sunt rotundum; der
63Logiker an sich versteht weder Deutsch noch Latein und schweigt, der Grammatiker
tadelt. Gibt man aber dem Logiker zu seinem allgemeinen logischen Maßstäbe
noch das besondere grammatische Gesetz der Kongruenz, so würde auch er tadeln.
Ein solcher Logiker, der zu den logischen Gesetzen noch ein grammatisches hinzubringt,
ist eben der Grammatiker. Denn dieser ist, außerdem, daß er Grammatiker
ist, noch überdies Logiker, d. h. nach logischen Gesetzen denkend und beurteilend;
aber der Logiker ist nicht auch Grammatiker. Würde nun der obige Satz korrigiert:
hoc tabulum est rotundum, so wäre der Logiker selbst mit Kenntnis der Kongruenzregel
befriedigt. Der Grammatiker aber hat eine fernere Kenntnis der Sprache und
verbessert: tabula. Dies genügt dem Logiker, um das Übrige zu korrigieren; d. h.
nun ist der Grammatiker gezwungen, eine logische Anwendung der Regel der Kongruenz
zu machen. Also die Kongruenzregel und das bestimmte Genus des Wortes
tabula sind Verhältnisse, die ausschließlich der Grammatik gehören, und sie mit
ihresgleichen machen den Gegenstand der Grammatik, die Sprache aus. In dem formalen
Verfahren aber, in der Anwendung der sprachlichen Gesetze auf sprachliche
Stoffe tritt notwendig die Logik ein” (S. 220f.).
Wohin sind wir geraten? Zu einem Sonderproblem, das, sachgerecht
behandelt, auf die Unterscheidung von Sprechakten und
Sprachgebilden zurückführen wird; wir scheuen den Umweg nicht.
Wie also ist die von Steinthal vorgeschlagene Arbeitsteilung
zwischen dem Censor grammaticus und logicus zu verstehen?
Sind es wirklich verschiedene Tintenfässer, aus welchen die roten
Striche an den korrupten Texten bezogen werden? Nehmen wir,
um nicht unbesonnen zu urteilen, Husserls Auffassung aus den
logischen Untersuchungen hinzu. Auch da steht, die grammatische
Zensur sei unempfindlich für den Widersinn sprachlicher Gefüge
vom Typus des viereckigen Kreises und hölzernen Eisens. Äußerst
empfindlich dagegen sei sie für den Unsinn unvereinbarer Worthaufen;
weil diese überhaupt keinen Sinn, also auch keinen Widersinn
ergeben, wird die grammatische Korrektheit der logischen
vorgeordnet und die Grammatik im ganzen als Basis der Logik
charakterisiert.
„Wir können abschließend sagen: Innerhalb der reinen Logik grenzt sich als
eine, an sich betrachtet, erste und grundlegende Sphäre, die reine Formenlehre der
Bedeutungen ab; das ist die Lehre von den reinen Bedeutungskategorien und den
a priori in ihnen gründenden Gesetzen der Komplexion bzw. Modifikation. Sie legt
das ideale Gerüst bloß, das jede faktische Sprache, teils allgemein menschlichen,
teils zufällig wechselnden empirischen Motiven folgend, in verschiedener Weise
mit empirischem Material ausfüllt und umkleidet. Wie viel vom tatsächlichen Inhalt
der historischen Sprachen, sowie von ihren grammatischen Formen in dieser
Weise empirisch bestimmt sein mag, an dieses ideale Gerüst ist jede gebunden;
und so muß die theoretische Erforschung desselben eines der Fundamente für die
letzte wissenschaftliche Klärung aller Sprachen überhaupt ausmachen. Mit Rücksicht
darauf, daß in diesem unteren logischen Gebiete die Fragen nach der Wahrheit,
Gegenständlichkeit, objektiven Möglichkeit noch außer dem Spiele bleiben,
und mit Rücksicht auf die eben charakterisierte Funktion dieses Gebietes zur Verständlichung
64des idealen Wesens aller Sprache als solcher, könnte man dieses fundierende
Gebiet der reinen Logik als „reine Grammatik” bezeichnen” (319f.).
Es ist sehr die Frage, ob diese Schichtung mit der Grammatik
als Erdgeschoß und der Logik als höherem Stockwerk nicht ebensogut
umgekehrt angesetzt werden kann. Komplexionsgesetze von
der Art, wie sie Husserl als Kerngebiet der „reinen Grammatik”
vorschweben, müßten z. B. am nominalen Kompositum und an
der Metapher, die wir studieren werden, zu finden sein. Allein, was
wir wirklich dort finden, hat einen ganz anderen Charakter, es
zeigt uns, daß die Sprache in ihren Gefügen stets an das Sachwissen
der Empfänger appelliert; Gefüge wie Backstein, Backofen,
Schlangenfraß können nur vom Sachwissen her im letzten Schritte
so vollzogen werden, wie dies das Deutsche von den Gebrauchern
dieser Komposita verlangt, und das Metaphorische in der Sprache
wird uns offenbaren, wie tief und unmittelbar die sachgesteuerten
Selektionen jeden Bedeutungsaufbau mitbestimmen; man kann
ebensogut die Sachsteuerung als erstes, wie mit Husserl als letztes
ins Auge fassen. Umstände, wie die später bei der Analyse der
Kontextfaktoren besprochenen verlangen geradezu die gemeinte Umkehr.
Im übrigen macht Husserl selbst an einer bestimmten Stelle
das Tor auf und gibt uns die Handhabe zu dem Nein, das wir aussprechen.
Denn er rechnet zu den zu erforschenden Erscheinungen
auch die „Bedeutungsmodifikationen” und sieht ein, „daß Bedeutungen
bei Erhaltung eines wesentlichen Kerns in neue Bedeutungen
umzuwandeln sind” (311) und „daß gewisse Bedeutungsänderungen
sogar zum grammatisch normalen Bestände jeder Sprache gehören”
(309). Das wird dann freilich nur an dem Falle der suppositio
materialis der Scholastiker erläutert: ‚der Centaur ist eine Fiktion
der Poeten, und ist eine Konjunktion’ und die Sache mit der folgenden
Erledigung ad acta gelegt:
„Durch den Zusammenhang der Rede kann die modifizierte Bedeutung
immerhin leicht verständlich sein, und sind die Motive der Modifikation von durchgreifender
Allgemeinheit, wurzeln sie z. B. im allgemeinen Charaker der Ausdrücke
als solcher oder gar in der reinen Natur des Bedeutungsgebietes an sich, so werden
die betreffenden Klassen von Abnormitäten überall wiederkehren, das logisch Abnorme
erscheint dann grammatisch als sanktioniert” (309f.).
Und hier wiederholen und präzisieren wir unser Nein. Was
dem Logiker verwunderlich vorkommt, gehört zu den Grundeinrichtungen
der natürlichen Sprache. Gewiß ist es so, daß die
gemeinten Velleitäten „im allgemeinen Charakter der Ausdrücke
als solcher” wurzeln; nur eben in einem anderen Sinn, als es der
65Diogenes im Fasse wahrhaben will. Denn alles, was wir an Zugeständnissen
brauchen, ist mit einem Schlage zu treffen: die sprachliche
Darstellung läßt allenthalben Spielräume der Bedeutungsunbestimmtheit
offen, die auf keine andere Weise wie durch den
Hinblick auf die „objektiven Möglichkeiten” geschlossen werden
können und in jeder menschlichen Rede auch faktisch geschlossen
werden. Wäre dem nicht so, dann hätten es die Lexikographen
leichter; das ist wahr. Aber die natürliche Sprache wäre um das
Erstaunlichste und praktisch Wertvollste, was ihr eignet, verarmt.
Verarmt um die erstaunliche Anpassungsfähigkeit an den unerschöpflichen
Reichtum des im konkreten Falle sprachlich zu Fassenden;
und dies macht, von der anderen Seite gesehen, die Freiheitsgrade
der Bedeutungsverteilung möglich und damit die Husserlsche
Aktlehre allererst notwendig und unentbehrlich auch für eine im
ersten Anlauf „objektive” Sprachanalyse.
Es ist nach meiner Meinung etwas viel Greifbareres, was wir
aus dem von Steinthal vorgesprochenen und von Husserl akzeptierten
Satz von der Unempfindlichkeit der Sprache gegen den
Widersinn und ihrer Empfindlichkeit gegen den Unsinn ableiten
können. Steinthal hebt an mit der Einführung: „es tritt jemand
an eine runde Tafel und spricht”. Er gibt also eine Umschreibung
der Sprechsituation, aus der wir als Zensoren der sprachlichen Bocksprünge
von Anfang an unsere Überlegenheit beziehen. Weiter:
Der korrekte lateinische Satz ist in diesem wie in allen anderen Fällen
reichlich, ja überreichlich ausgestattet mit Kontexthilfen. Und das
gehört zu den bemerkenswertesten Einrichtungen jeder natürlichen
Sprache, daß sie ihre Fassungen verschiedenartig und mehrfach
gegen Mißverständnisse sichert. Gerade darum, weil sie mit weitgehend
vieldeutigen Symbolen operiert und eine Präzisierung oder
Modifikation dieser Bedeutungen von der Sache her erwartet, muß
sie auf der anderen Seite mehrfache Korrekturhilfen vorsehen; sie
liegen für die situationsferne Rede beschlossen in einem reichen
Inbegriff von Momenten, die wir in der Lehre vom Symbolfeld der
Sprache systematisch untersuchen. Und genau so wie unter gewissen
Umständen die „Stoffhilfen” in flüchtigen und nur halb
durchdachten Reden vernachlässigt werden, so bestimmen sie in
anderen Fällen dominierend den Sinn der Rede; einen allgemein
gültigen Trennungsstrich zwischen Grammatik und Logik hier
durchzulegen, geht deshalb nicht an, weil die Sprachen des Erdkreises
in wechselndem Ausmaß das eine und das andere von ihren
Sprechern verlangen. Man erhielte in jeder Sprache einen etwas
66anderen Trennungsstrich, wenn man das, wofür sie empfindlich
und das, wofür sie (scheinbar) unempfindlich ist, zum Kriterium
erheben wollte.
Im übrigen scheint mir die Phänomenologie Husserls in der
Tat berufen, eine bestimmte Schwierigkeit jener „objektiven”
Sprachanalyse, die wir im Abschnitt über die Sprachgebilde Männern
wie de Saussure und so gut wie der gesamten Grammatik seit
dem Altertum nachgezeichnet haben, zu entwirren und ergänzend
zu lösen. Husserl wird nur deshalb nicht recht fertig damit, weil
er die ganze Welt der Bedeutungen subjektsbezogen aufbaut. Es
ist korrekter Weise, genau wie es unser Vierfelderschema verlangt,
nicht das in jedem Einzelfall erlebte, psychologische und nur
deiktisch erreichbare Subjekt oder Ich, nicht jenes Ich, das uns im
zweiten Kapitel beschäftigt, sondern es ist ein Subjekt der zweiten
Formalisierungsstufe (das logische oder transzendentale Ich), d. h.
ein Gegenpol zu dem „intendierten Gegenstand”, zwei Grundbegriffe,
welche Husserl dabei vonnöten hat. Denn alles individuell Zufällige
wird „eingeklammert”, wo es gilt, die grundlegenden Aktcharaktere
oder genera significandi (wie man sie bezeichnen könnte)
zu entwickeln. Es sei einsichtig zu erfassen, meint Husserl, nicht
daß ich in diesem Augenblick beim Sprechdenken ein Individuelles
als solches und ein andermal wieder die Spezies als solche intendiert
habe (was wenig interessant ist), sondern daß diese und andere
Aktcharaktere zur Welt der Bedeutungen gehören. Wäre nun das
System dieser Aktcharaktere vollständig aufgestellt, so könnte sich
die Sprachtheorie darauf stützen und nicht nur die Angelegenheit
der empirisch in den bekannten Sprachen nachgewiesenen Eigennamen
und Artnamen und deren wechselnden Gebrauch, sondern
noch vieles andere als vorgezeichnet im Reiche der allgemeinen
genera significandi einführen. Alles, was zusammenhängt mit dem
Phänomen der Abstraktion, ist durch Husserls Phänomenologie
gereinigt und entscheidend gefördert worden. Auch alles, was zusammenhängt
mit der Freiheit des Bedeutungsverleihens.
Man vertraue sich also der echt phänomenologischen Grundhaltung
der logischen Untersuchungen an und übe das Einklammern.
Dann werden dem Monadenwesen, welches alle Tentakeln eingezogen
hat, im Felde der Descartesschen Cogitatio Schritt für Schritt
Strukturgesetze des Bedeutens aufgehen. Woran eigentlich? Natürlich
an den Modellen, die dieser Diogenes im Faß gewinnt an der von
Kindheit auf von ihm gelernten und gesprochenen Sprache. Sie
hat er mitgenommen und seine Sinne (Augen und Ohren) hat er
67auch noch und seine Erinnerungen; im ganzen ein genügendes
Material von Erlebnissen, um daran das Einklammern und die
Modellschau zu vollziehen. Die neueren Méditations Cartésiennes
haben besonders in der fünften Meditation den Irrtum zerstört, als
sei durch den Rückzug auf die Cogitatio das Cogitatum und das Du
(ein alter ego als Empfänger von Sprachzeichen) der Modellschau
entzogen. Nein, sie werden in bewundernswerten Gedankengängen
als mitgegeben, sie werden innerhalb des fensterlosen Monadenraumes
der subjektsbezogenen Bedeutungen einwandfrei logisch konstituiert.
Der Verfasser dieses Buches zweifelt weder an der Möglichkeit
noch an der Fruchtbarkeit der phänomenologischen Methode
und ist überzeugt, daß mit manchem andern die „reine” Sematologie
dadurch gefördert werden kann; die reine Sematologie, welche ähnlich
der reinen Mathematik konstruktiv aufgebaut werden muß.
Es gehört eine vollständige und systematische Entwicklung der
Aktcharaktere oder (vom Zeichen aus bestimmt) der modi (genera)
significandi, der möglichen Weisen des Zeichensetzens, dazu.
Allein, um von da zu einem System wie ‚die deutsche Sprache’
oder ‚lingua latina’ zurückzukehren, gehört erstens nach dem Einklammern
das ebenso notwendige Wiederausklammern und das Verlassen
des Monadenraums mit seiner nichts als intendierten (vorgestellten)
Welt. Es gehört zweitens positiv dazu ein Koordinatensystem,
welches die objektive Sprachanalyse und in ihm den Ansatz
des Organon-Modells der Sprache erlaubt; es gehört mit einem Wort
neben die Aktlehre und zu ihrer Ergänzung eine Gebildelehre, die
nur so, wie das die Grammatik aller Zeiten getan hat, aufgebaut
werden kann.
Man befrage mit uns noch einmal die Griechen, welche der
abendländischen Wissenschaft mit unbestechlichem Blick für das
Wesentliche und noch unbeirrt von bändereichem Tatsachenwissen
bestimmte Denkmodelle unübertrefflich sicher vorgedacht haben.
Platon erläutert im Kratylos, man müsse zum Weber gehen, um
die Prinzipien des Webens, und zum Zimmermann, der die Webelade
verfertigt hat, um die „Prinzipien” des Organons ‚Webelade’ zu
erkunden. Sollte dem, der die Prinzipien der Sprachforschung
finden will, ein Lehrgang beim Weber genügen und der Gang zum
Zimmermann erspart bleiben? Das ist es, was ich nicht glaube.
Das korrekte Analogon zum Lehrgang beim Zimmermann ist das
Studium der intersubjektiv geregelten Sprachkonventionen. Wohl
wahr, daß wie alles andere, was wir ererbt von den Vätern haben,
so auch „die Sprache” rezipiert sein will und ihre Auferstehung
68erleben muß im Monadenraum des Sprechers. Allein Rezeption
und Selbstschaffen (Entnahme und Setzung) ist zweierlei; gehört
zum Setzen die Husserlsche Freiheit der bedeutungsverleihenden
Akte, so gehört als Grenze dieser Freiheit und korrelativ zu
ihr die Bindung des Entnehmens, beim Entnehmen. Sprachgebilde
gebrauchen im intersubjektiven Verkehr oder zum Aufbau
eines einmaligen Sprachwerkes, sie gebrauchen wie alle anderen
Sprachgenossen ist das eine; und ihnen die im Sprachbau selbst
vorgesehene Bedeutungspräzision von Fall zu Fall und darüber
hinaus ihnen da und dort eine einmalig modifizierte Bedeutung verleihen,
ist das andere. Und weil es zweierlei ist, so kann man nicht,
wie es die logischen Untersuchungen versuchen, vom Akt her das
Ganze der Bedeutungslehre bewältigen. Auch dann nicht, wenn
man in Parenthese und von Zeit zu Zeit immer wieder versichert,
die empirischen Züge der einzelnen Sprachen seien „historisch zufällig”
so, wie sie gefunden werden. Ich sage nein; nicht so sehr
zu dem Begriff des historischen Zufalls, obwohl auch der noch zu
„klären” wäre, sondern ich sage nein zu der Annahme, daß alles,
was nicht zur Aktlehre gehört, eines Prinzipienhaltes entbehre.
Das ist so falsch, daß man umgekehrt die aus dem echten
Organon-Modell der Sprache und damit aus der objektiven Sprachbetrachtung
in alter Weise gewonnene Gebildelehre und mit ihr das
soziale Moment der Sprache als logisch vorgeordnet oder mindestens
als logisch gleichgeordnet einer subjektsbezogenen Akttheorie bezeichnen
muß. Alles andere wäre ein der Sprache gegenüber insuffizienter
Individualismus und Subjektivismus. Es wäre entweder
eine Monadenkonstruktion oder ein Subjektsuniversalismus, Auffassungen,
die man vielleicht (vielleicht auch nicht) in den höchsten
Regionen philosophischer Annahmen rechtfertigen kann, die aber
abgewiesen werden müssen in den Niederungen der greifbaren
Phänomene, mit denen sich die Sprachtheorie befaßt. Die Dinge
werden aktuell in einer Theorie der sprachlichen Begriffszeichen;
dort mehr davon.
§ 5. Wort und Satz. Das S-F-System vom Typus Sprache (D).
Die Logik unserer Tage hat ein System künstlicher Zeichen
für sehende Menschen geschaffen und nennt es ‚Sprache’; die Sachverständigen
auf dem Gebiet der Mimik und Pantomimik, die Ausdruckstheoretiker,
wußten von jeher, sie wissen präziser seit Engel
und Bell nichts Achtungsvolleres und, wie sie meinen, Treffenderes
über die Gebärden vorzubringen, als daß sie ‚Sprache’ seien, und
69zwar die allgemeinste Sprache der Menschen und höheren Tiere.
Man erlasse uns aufzuzählen, was sonst noch alles bald im flüchtigen
Vergleiche und bald mit dem Beiton philosophischen Ernstes der
Sprache beigesellt und zugerechnet worden ist; irgendwo im Wortschatz
braucht man eben einen gemeinsamen ‚Nenner’ für vieles,
was in dem oder jenem Punkte vergleichbar ist mit der eigentlichen
Sprache, der Sprache ohne Beiwort und Bindestrich. Was bleibt,
so lautet die Frage, nach allem Vergleichen und Analogisieren als
eigenes, einmaliges Gesicht der Sprache ohne Beiwort und Bindestrich
erhalten? Über ihre Mehrseitigkeit als Organon, ihre Mehrstufigkeit
als Zeichengerät und wie sie uns erscheint sub specie
Praxis und. Poesis, ist gesprochen. Es bleibt ein viertes zu fixieren,
was den Alten das erste war und uns selbst durch dies ganze Buch
am meisten beschäftigen soll: die Sprachgebilde sind Wörter und
Sätze. Nicht der eine oder der andere Terminus ist zum Range einer
Kategorie zu erheben, sondern beide gehören zusammen und sind
nur korrelativ zu definieren.
Geprüft an diesem letzten Kriterium allein besteht der Anspruch
der modernen Logik, eine künstliche „Sprache” geschaffen
zu haben; geprüft an den anderen Kriterien besteht er nicht. Umgekehrt
besteht der Anspruch von Mimik und Gebärden, eine natürliche
„Sprache” vor und außerhalb der menschlichen Lautsprache
zu sein, gerade die letzte Prüfung nicht. Vorsichtiger und richtiger
gesagt: dieser Anspruch ist nur dort berechtigt, wo man die natürliche
Beredsamkeit des menschlichen Körpers zu einem Symbolsystem
nach dem Muster der gewachsenen Sprache aus- und umgebildet
hat, wie in der Gebärdensprache der Taubstummen, der
Zisterziensermönche usw. Dies trifft von vornherein für die Kunstsprache
der Logiker zu; denn ihre Zeichen sind Symbole und werden
in ein Symbolfeld gesetzt. Prinzipiell genau so, wie die Wörter der
gewachsenen Sprache Symbole sind und im Symbolfeld der Sprache
ihre syntaktischen Funktionen erfüllen. Es dürfte zweckmäßig sein,
durch Abhebung der Sprache von einem anderen Systeme leistungsfähiger
Verkehrszeichen den Unterschied von Systemen ohne und
mit Symbolfeld zu erläutern.
1. Vor Einführung der drahtlosen Telegraphie waren im Schiffsverkehr
zur See auf Grund internationaler Konvention einige
Systeme von Flaggenzeichen im Gebrauch. Eines von ihnen, das
nur drei elementare Formen (kreisrunder Ball, dreieckiger Wimpel
und viereckige Flagge) enthielt, sei hier als Beispiel herangezogen.
Es bedeutete:70
○△ Sie begeben sich in Gefahr,
△○ Mangel an Proviant, Hunger leidend,
○□ Feuer oder Leck. Haben augenblickliche Hilfe nötig,
□○ Auf Grund. Haben augenblickliche Hilfe nötig,
△○□ Stoppen Sie oder drehen Sie bei. Es sind wichtige Mitteilungen zu machen,
□○△ Haben Sie Telegramme oder Nachrichten für mich?
○□△ Ja,
○△△ Nein
und so weiter. Das gab für die häufigsten Fälle schon eine genügende
Anzahl von Zeichen. Jeder Komplex ist von links nach rechts, bei
senkrechter Anordnung von oben nach unten zu lesen 1)21.
Wir beginnen mit dem Hinweis auf zwei Punkte: es sind da
erstens die drei Elementarformen, welche in allen Komplexionen
wiederkehren. Keine von ihnen, weder der Einzelball, der Einzelwimpel,
die Einzelflagge, noch irgendeine Untergruppe aus ihnen
hat für sich genommen einen Signalsinn, vielmehr erschöpft sich
ihre ganze Funktion darin, an einer bestimmten Komplexstelle
stehend den wahrnehmbaren Komplex mit zu konstruieren und
diakritisch abzuheben von den anderen. Diese Elementarformen
sind also elementare Merkzeichen genau so wie die Phoneme der
Sprache. Zweitens: nur die Komplexion als solche, jeder Flaggensatz,
hat einen Signalsinn. Die Wiedergabe dieses Sinnes in kurrenter
Lautsprache erfordert oft mehrere, und zwar verschiedenartige
Sätze (Aussagen, Befehle, Appelle, Fragen). Wir verstehen: es
handelt sich jeweils darum, in einem einzigen Flaggensatz die Eigensituation
des Zeichengebers samt einem Appell an den Empfänger
oder eine Aufforderung, eine Frage samt Begründung zu symbolisieren.
Man könnte schon von hier aus versucht sein, dies als eine
globale Symbolisierung zu bezeichnen. Allein nicht darauf kommt
es an, daß bei der Übersetzung in die Lautsprache eine Menge von
Wörtern und Sätzen benötigt werden; denn das wäre keine immanente,
sondern eine von außen herangetragene Charakteristik des
Systems. Vielmehr ist das entscheidende Merkmal des Systems
darin zu erblicken, daß nichts von irgendeiner Gliederung
des Signalsinnes an den sinnlich wahrnehmbaren Zeichen in Erscheinung
tritt. So wollen wir den Terminus globale Symbolisierung
verstanden wissen. Es wäre ebenso verfehlt, die Flaggen „sätze”
71den Sprachsätzen wie sie den Namen gleichzustellen; sie sind weder
das eine noch das andere. Was sich sagen läßt, ist nur, daß jede
Flaggenkomplexion berufen ist, in einer typischen Verkehrssituation
als ungegliedertes Kommunikationsmittel zu fungieren. Das ganze
System enthält nur Sinneinheiten dieser einen Art oder Klasse;
das System ist nichts als eine Kollektion aus ihnen, es ist ein einklassiges
Zeichengerät. Die Sprache dagegen, von der Seite der
Sprachgebilde her gesehen, ist ein zweiklassiges System 1)22.
Zwischendurch sei ein Wort über eine Entwicklungsphase des
Kindes gesagt, die man mit diesem einklassigen globalen Signalsystem
der Schiffer vergleichen kann. Solange das Kind nichts
anderes als seine jedem Beobachter wohlbekannten, bequemen
„Einwortsätze” verwendet, verfährt es damit ungefähr ebenso global
wie ein Kapitän oder Signalmaat mit seinen Flaggen; soweit nämlich,
als man von der musikalischen Modulation dieser Verkehrszeichen
absieht und absehen darf. Natürlich, das Kind hat keinen
Code zur Hand, aus dem es entnehmen könnte, wie es sich im Augenblick
international verständlich ausdrücken muß. Aber darauf
kommt es für das Kind ja auch gar nicht an. Denn die Empfänger
seiner Botschaften sind keine fremden Schiffskapitäne, sondern die
Genossen einer viel engeren Sprachgemeinschaft, in der man aus
täglichem Umgang die paar typischen Situationen, in denen es mit
Sprachlauten zu signalisieren pflegt, und den mehr oder minder
eigenartigen Sondercode des Kindes kennt. Aber dann: je nun,
manchmal ist auch da das Schiff auf Grund geraten und augenblickliche
Hilfe vonnöten oder der vorübersegelnde Erwachsene soll
stoppen und beidrehen, weil wichtige Mitteilungen zu machen sind
u. dgl. m. Und all das wird jeweils durch einen einzigen aus ein
paar Dutzend dem Kinde bereits geläufigen, nicht gerade kodifizierten,
aber kodifizierbaren „Einwortsätzen” zum Ausdruck gebracht
und an den Empfänger signalisiert. Der Terminus ‚Einwortsätze’
ist nichts als ein Verlegenheitsausdruck der Kinderpsychologen,
ein Ausdruck, der andeuten soll, man könne die Phänomene
so gut zu den Wörtern wie zu den Sätzen rechnen, sie seien
eigentlich „noch” beides in eins. Dies wird dahin zu korrigieren
72sein, daß sie „noch nicht” das eine und noch nicht das andere
sind; denn es vollzieht sich eine Systemänderung, es erfolgt der
Schritt von einem Einklassensystem zu dem S-F-System unserer
fertigen Sprache, wenn das Kind zu den echten Sätzen mit Wörtern
übergeht. Bemerkenswert ist nur noch, daß jedes Kind unseres
Kulturkreises, auch das sprachlich bestgepflegte, ungefähr ein
Dreivierteljahr lang ein solches Einklassensystem lautlicher Ordnungszeichen
benutzt und nach Ausweis der Versuche, die der
Amerikaner Major beschrieben hat, vom eingreifenden Erwachsenen
nicht vorzeitig davon abgebracht und zur Verwendung von mehr als
einem seiner Lautgebilde in einem Atemzuge veranlaßt werden kann.
Das Schlußwort ist kurz: Ein Einklassensystem globaler
Symbole vom Typus der Schiffssignale ist wissenschaftlich erschöpfend
bestimmt, wenn erstens der Aufbau der Signale festgelegt
und zweitens für jedes Signal die typische Verwendungssituation
und in ihr der Kommunikationszweck, den es zu erfüllen hat, beschrieben
ist. Das besorgt im Falle der künstlich verabredeten
Flaggenzeichen der Code, ein Buch mit zwei Kapiteln.
2. Ein System dagegen vom Typus der Sprache beruht nicht
auf einer, sondern (mindestens) auf zwei Klassen von Setzungen
(Konventionen) und enthält dementsprechend zwei Klassen von
Sprachgebilden. Ein System vom Typus der Sprache baut jede
vollendete (und situationsentbindbare) Darstellung in zwei abstraktiv
zu sondernden Schritten auf, sagen wir einmal kurz, wenn auch
unscharf und mißverständlich: in Wortwahl und Satzbau. Da
gibt es eine erste Klasse von Sprachgebilden und zugehörigen
Setzungen, die so verfahren, als gälte es, die Welt in Fetzen zu zerschneiden
oder in Klassen von Dingen, Vorgängen usw. aufzugliedern
oder in abstrakte Momente aufzulösen und jedem von ihnen ein
Zeichen zuzuordnen, während die zweite darauf Bedacht nimmt,
einer Durchkonstruktion derselben Welt (des Darzustellenden)
nach Relationen die zeichenmäßigen Mittel bereitzustellen. Das
sind, darstellungstheoretisch gesehen, zwei durchaus zu trennende
Schritte und Weisen des Vorgehens. Darüber muß vollkommene
Klarheit geschaffen werden und keiner soll sich täuschen lassen
durch das psychologische Faktum einer glatten und reibungslosen
Kooperation bei der Verwendung dieser zwei Klassen von Sprachgebilden.
Keiner soll sich täuschen lassen durch das linguistische
Faktum eines fast unbeschränkten Hinüber- und Herüberwandeins
der Elemente beider Systeme. Man kann grob gesprochen wohl in
jeder Sprache ursprünglich Syntaktisches in den Wortschatz und
73Lexikalisches in die syntaktische Klasse von Sprachgebilden übergehen
sehen und übergehen lassen. Das deutet auf eine bewundernswerte
Souveränität in der Nutzung der korrelativ aufeinander angewiesenen,
aufeinander abgestimmten Momente hin, mehr nicht.
Jedes für sich genommen ist durchaus verschieden vom anderen.
Der Abschluß unseres Vergleiches lautet: Die wissenschaftliche
Bestimmung eines Systems vom Typus der Sprache erfordert
etwas anderes als ein Buch von der Art des Code. Man kann nur
die Phonologie im engsten Sinn des Wortes teilweise mit dem ersten
Kapitel des Code parallelisieren. Der Wortschatz dagegen und die
Grammatik, welche die beiden Klassen von Setzungen und Gebilden
im Bereich der Sprache spiegeln, sind erstens unter sich und
zweitens vom Code wesensverschieden.
Wir werden am systematischen Ort Prinzipielles über das
merkwürdige Zusammengehen der beiden hier abstraktiv unterschiedenen
Momente, wir werden über den Symbolbegriff, über
den Symbolwert und die Feldwerte der Sprachzeichen Fragen und
Antworten bieten. Die dabei nachdrücklich ins Auge zu fassende
Tatsache, daß erst das Sinngefüge des Satzes dem Wort die höchste
von ihm überhaupt erreichte Bedeutungsfülle und Bedeutungspräzision
verleiht, hat Psychologen und Linguisten im 19. Jahrhundert
zur Aufstellung der These veranlaßt: Am Anfang war der
Satz und nur der Satz, nicht das Wort. Oder nur der Satz nicht
das Wort sei die wahre, die greifbare Bedeutungseinheit oder Sinneinheit
der Sprache u. dgl. m. 1)23. Darin kann bei schärferer Interpretation
Richtiges, es kann aber auch völlig unhaltbar Behauptetes
zum Vorschein kommen. Darstellungstheoretisch gilt es nur das
eine zu sagen, daß, wo immer diese teilweise sehr emphatisch vorgetragene
These die Sprache als ein Einklassensystem konstitutiver
Sinneinheiten aufgefaßt wissen will, ein Mißverständnis oder Irrtum
vorliegen muß. Der Satz kann ebensowenig vor dem Wort, wie das
Wort vor dem Satz gewesen sein, weil beides korrelative Momente
an ein und demselben (vielleicht fortgeschrittenen) Zustand der
menschlichen Sprache sind.
Man kann sich allerhand Einklassensysteme ausdenken, die
menschliche Kommunikationszwecke zu erfüllen vermögen, nur
solche nicht, in denen es Sätze im strengsten Wortsinn ohne Wörter
74oder umgekehrt gegeben hätte. Das reine Satzschema ohne Worterfüllung
ist ein genau so bestandsunfähiges Moment wie irgendeine
Relation ohne Fundamente. Übrigens kann man den Beweisgang
auch umdrehen und zeigen, daß und wie im Synthema nicht nur
die isoliert betrachtet vage, oft schwer faßbare Bedeutung der Wörter
von dem „anderen”, sondern wie auch umgekehrt jenes andere
von hier aus in gewissen Grenzen mitbestimmt und präzisiert wird.
Die „vage” syntaktische Anweisung des indoeuropäischen Kompositums
z. B. oder die mehrdeutige syntaktische Anweisung des
lateinischen Genitivs oder Akkusativs — wie sie zu erfüllen seien
wird weitgehend und in vielen Fällen schon durch die in das Schema
eingehenden „Wörter” (wird von den bezeichneten Gegenständen,
vom „Stoff” her) bestimmt, ohne daß man auf andere, umfassendere
Kontexthilfen warten müßte 1)24. Dazu wird später noch viel Wichtiges
zu sagen sein.
Und last not least: wer das in Rede stehende Zweiheitsmoment
aus der Struktur der Sprache zu eliminieren versucht, der vergreift
sich aus theoretischem Unverstand an einem, vielleicht an dem für
sie bezeichnendsten Strukturgesetz. Der vergleichende Blick mag
suchen, wo er will, es gibt z. B. weder in der Musik, noch am optischen
Bilde, noch an irgendeinem der vielfältigen, in der modernen
Wissenschaft und darüber hinaus für diese und jene Darstellungszwecke
erfundenen Symbolsysteme ein exaktes Analogon zu den
zwei komplementären Gebilden der Sprache, zu Wort und Satz,
kurz gesprochen. Nur -— und das ist ebenso verständlich wie aufschlußreich
— diejenigen darstellenden Symbolsysteme, welche in
gewissen Grenzen dieselbe volle Darstellurgsfunktion wie die Sprache
zu erfüllen berufen sind, z. B. die mathematische Gleichung und
das Symbolsystem der modernen Logistik, kopiererf auch das Lexikon
und die Syntax. Die theoretisch reflektierenden Logistiker
(z. B. Carnap) haben diesen Zusammenhang erkannt: ich lege Wert
darauf zu betonen, daß ich selbst unabhängig von und wohl auch
vor ihnen in meinen sprachtheoretischen Vorlesungen das „Dogma
vom Lexikon und von der Syntax” aufgestellt und begründet habe 2)25.75
3. Was gibt es da noch zu begründen? Man stelle noch einmal
das Einklassensystem kommunikativer Symbole vom Typus der
Schiffssignale mit der Sprache zusammen und frage ganz naiv,
warum wohl die Sprache, wenn sie je, wie viele glauben, die Phase
des globalen deiktischen Rufes in ihrem Entwicklungsgang passierte,
nicht stehen geblieben ist auf ihr. Unter Mithilfe eines Schatzes
diakritisch wirksamer Phoneme konnte man praktisch ausreichend
viele (bleiben wir bei dem Worte) „Signale” in Verkehr setzen, das
Verfahren ist bequem und denkbar lakonisch. Gewiß, es bietet
sogar noch andere Vorteile, die den Feldsystemen fehlen. Aber eines
kann es nie und nimmer, was sofort mit einem Feldsystem erreicht
wird, nämlich: mit einem beschränkten Schatz von Konventionen
und dementsprechend von Sprachgebilden unbeschränkt Mannigfaltiges
hinreichend differenziert und exakt zur Darstellung
bringen. Man stelle sich den Benutzer eines Einklassensystems in
„neuen” Situationen vor. Wollte er, weil die alten nicht ausreichen,
neue Symbole erfinden, so wären diese vorerst nicht intersubjektiv
verständlich. Was soll er anstellen, um aus dem Schatz bestehender
Konventionen definiert neue Ausdrücke zu gewinnen? Die menschlichen
Sprachen, die wir heute kennen, erheben alle den Anspruch,
solch „produktive”, ja geradezu universelle Symbolsysteme zu sein.
Und sie sind es auch in erstaunlichem Grade. Teile der Bibel
sind ich weiß nicht in wieviel tausend Sprachen übersetzt. Man
frage nicht, ob schlecht oder recht, sondern, warum das nicht ab
ovo in 90 Prozent der Fälle ein aussichtsloses Unternehmen war.
Doch offenbar deshalb, weil mit Geduld und Findigkeit überall
in irgendeinem Annäherungsgrad der genannte Anspruch aller
Sprachen auch erfüllbar ist. Versteht sich in Stufen und aus vielen
Gründen. Wir stellen nichts fest als dies, daß er prinzipiell aussichtsreich
nur erhoben werden kann von einem Feldsystem.76
Ein Code globaler Symbole, ob geschrieben oder ungeschrieben,
muß wie das geschriebene oder ungeschriebene Lexikon einer gesprochenen
Sprache und aus denselben Gründen beschränkt sein,
aus Gründen einfach der beschränkten Kapazität des menschlichen
Gedächtnisses. Besonders dort, wo es sich darum handelt, Einzelzuordnungen
einer Vielheit von Menschen derart einzuprägen,
daß sie im intersubjektiven Verkehr diakritisch hinreichend scharf
und flüssig genug verwendet werden können, stößt man auf gar nicht
sehr weit gespannte Kapazitätsgrenzen. Ich glaube, man könnte
sie für näher angegebene Bedingungen im Massenexperiment zahlenmäßig
bestimmen. Dabei denke ich zuerst und vor allem an wirklich
streng isolierte Einzelzuordnungen, wie sie z. B. beim Einprägen
der Schiffssignale, solange nicht irgendein immanentes oder
künstlich hinzugebrachtes Hilfssystem vorhanden wäre, geleistet
werden müßten. Und das ist es ja, worauf es ankommt: jede
Systemhilfe erweitert die Kapazitätsgrenzen. Die Sprache aber hat
das Problem dieser Erweiterungen mit einigem, was wir in ihr finden,
gelöst und im entscheidenden Punkte kurz herausgesagt umgangen,
d. h. aus der Welt geschafft. Denn wir alle können nicht darum
praktisch ins Unabsehbare Neues und immer wieder Neues intersubjektiv
verständlich sprachlich zur Darstellung bringen, weil wir
und die anderen Akrobaten der Mnemotechnik wären, sondern weil
dies bei einem Feldsystem vom Typus der Sprache gar nicht verlangt
wird. Wir können auch Zahlen ins Unbegrenzte mit nur zehn
Elementarzeichen und einer sehr einfachen, konventionell festgelegten „Syntax”
symbolisieren. Die Konvention des dekadischen
Ziffernsystems lautet: Die Ziffern erhalten von rechts nach links
den Wert von Einern, Zehnern, Hundertern… Was wir hier das
Mitverwerten, Mitausnutzen der Reihenfolge leisten sehen, dasselbe
und noch weit Subtileres liegt nach Anlage und Leistung in der
Syntax der Sprache beschlossen.
4. Beim Zuendedenken des derart vorgezeichneten Gedankenganges
trennen sich vielleicht zeitweilig die Interessen des Logikers
und des Linguisten. Am Ende aber kommen sie sicher wieder zusammen
in der Frage, ob man beweisen kann, daß ein Darstellungsgerät
vom Typus der Sprache, zu dem ja z. B. auch das Symbolgerät
der Logistik gehört, das einzige ist, was den Anspruch als
universelles Darstellungsmittel betrachtet zu werden, prinzipiell zu
erfüllen vermag. Man kann, glaube ich, diesen Beweis führen,
wenn man auf der einen Seite voraussetzt, daß alles Darzustellende
hinreichend aufgliederbar ist nach dem logistischen Schema der
77Relation mit zwei Fundamenten, und auf der anderen Seite sieht
und von den besten Analytikern der Sprache erfährt, daß im Grunde
fast alles binär und dichotomisch in „Oppositionen” schon im System
der Phoneme und dann einfach und gestuft binomisch im Aufbau
ihrer verwickelten Gebilde zugeht. So wie es anfängt mit Subjekt:
Prädikat, so geht es nach der Auffassung dieser Analytiker konsequent
weiter 1)26. Der Schluß ist einfach genug: Dann ist vermutlich,
wenn irgendeines, ein Darstellungsgerät vom Typus der Sprache
bei der Konkurrenz um die Weltmeisterschaft im Grade der Universalität
der Leistung begünstigt. Hier breche ich ab. In unserem
Zusammenhang genügte der Nachweis, daß eine praktisch ausreichende
Produktivität und Anpassungsfähigkeit unter den
Grenzbedingungen des gegebenen Materials und der Gedächtniskapazität,
die wir fixiert haben, nur von einem Feldsystem vom Typus
der Sprache erwartet werden kann 2)27.78
II. Das Zeigfeld der Sprache
und die Zeigwörter.
Die Arm- und Fingergeste des Menschen, der unser Zeigefinger
den Namen verdankt, kehrt nachgebildet im ausgestreckten
„Arm” der Wegweiser wieder und ist neben dem Sinnbild des Pfeiles
ein weit verbreitetes Weg- oder Richtungszeichen. Moderne Denker
wie Freyer und Klages haben dieser Geste verdiente Beachtung
geschenkt und sie als spezifisch menschlich charakterisiert. Es gibt
mehr als nur eine Art gestenhaft zu deuten; doch bleiben wir beim
Wegweiser: an Wegverzweigungen oder irgendwo im weglosen Gelände
ist weithin sichtbar ein ‚Arm’, ein ‚Pfeil’ errichtet; ein Arm
oder Pfeil, der gewöhnlich einen Ortsnamen trägt. Er tut dem Wanderer
gute Dienste, wenn alles klappt, wozu vorweg nötig ist, daß
er in seinem Zeigfeld richtig steht. Kaum mehr als diese triviale
Einsicht soll mitgenommen und die Frage erhoben werden, ob es
unter den lautsprachlichen Zeichen solche gibt, welche wie Wegweiser
fungieren. Die Antwort lautet: ja, ähnlich fungieren Zeigwörter
wie hier und dort.
Allein das konkrete Sprechereignis unterscheidet sich vom
unbewegten Dastehen des hölzernen Armes im Gelände in dem einen
wichtigen Punkte, daß es ein Ereignis ist. Noch mehr: es ist eine
komplexe menschliche Handlung. Und in ihr hat der Sender nicht
nur wie der Wegweiser eine bestimmte Position im Gelände, sondern
er spielt auch eine Rolle, die Rolle des Senders abgehoben von der
Rolle des Empfängers. Denn es gehören zwei nicht nur zum Heiraten,
sondern zu jedem sozialen Geschehen und das konkrete
Sprechereignis muß am vollen Modell des Sprechverkehrs zuerst
beschrieben werden. Wenn ein Sprecher auf den Sender des aktuellen
Wortes „verweisen will”, dann sagt er ich, und wenn er auf den
Empfänger verweisen will, dann sagt er du. Auch ‚ich’ und ‚du’
sind Zeigwörter und primär nichts anderes. Wenn man den üblichen
Namen Personalia, den sie tragen, zurückübersetzt ins Griechische
Prosopon gleich ‚Antlitz, Maske oder Rolle’, verschwindet etwas von
dem ersten Erstaunen über unsere These; es ist primär nichts anderes
als die Rolle des Senders im aktuellen Signalverkehr, was den jeweils
79mit ich getroffenen Menschen charakterisiert, und primär nichts
anderes als die Rolle des Empfängers, was den du charakterisiert.
Das haben die ersten griechischen Grammatiker mit voller Klarheit
erfaßt und die Personalia unter die deiktischen Sprachzeichen
eingereiht.
Die ältesten Dokumente der indogermanischen Sprachgeschichte
fordern genau so wie die Sache selbst von uns, daß wir
beim Klassennamen ‚deiktische Sprachzeichen’ zuerst an solche
Wörter denken, die ob ihres Widerstandes gegen eine Aufnahme
unter die beugsamen (z. B. deklinierbaren) Nennwörter von den
Sprachgelehrten ‚Zeigpartikeln’ mehr gescholten als genannt worden
sind; was man nicht deklinieren kann, das sieht man als Partikel
an. Die sematologische Analyse ist keineswegs blind für die Funktion
der schließlich doch deklinierten, im Symbolfeld der Sprache
pro nominibus zu stehen und damit in den Rang der Pronomina
aufzurücken. Der Vorschlag des Sprachtheoretikers, eine distinctio
rationis vorzunehmen und zuerst das deiktische Moment, das ihnen
auch als deklinierten Wörtern noch verbleibt, ins Auge zu fassen,
findet seine definitive Rechtfertigung in der Tatsache, daß alles
sprachlich Deiktische deshalb zusammengehört, weil es nicht im
Symbolfeld, sondern im Zeigfeld der Sprache die Bedeutungserfüllung
und Bedeutungspräzision von Fall zu Fall erfährt; und
nur in ihm erfahren kann. Was ‚hier’ und ‚dort’ ist, wechselt mit
der Position des Sprechers genau so, wie das ‚ich’ und ‚du’ mit dem
Umschlag der Sender- und Empfängerrolle von einem auf den anderen
Sprechpartner überspringt. Der Begriff Zeigfeld ist berufen, diesen
uns ebenso vertrauten wie merkwürdigen Tatbestand zum Ausgang
der Betrachtung zu machen.
Daß es in der Sprache nur ein einziges Zeigfeld gibt und wie
die Bedeutungserfüllung der Zeigwörter an sinnliche Zeighilfen
gebunden, auf sie und ihre Äquivalente angewiesen bleibt, ist die
tragende Behauptung, die ausgelegt und begründet werden soll.
Die Modi des Zeigens sind verschieden; ich kann ad oculos demonstrieren
und in der situationsfernen Rede dieselben Zeigwörter
anaphorisch gebrauchen. Es gibt noch einen dritten Modus, den
wir als Deixis am Phantasma charakterisieren werden. Phänomenologisch
aber gilt der Satz, daß der Zeigefinger, das natürliche
Werkzeug der demonstratio ad oculos zwar ersetzt wird
durch andere Zeighilfen; ersetzt schon in der Rede von präsenten
Dingen. Doch kann die Hilfe, die er und seine Äquivalente leisten,
niemals schlechterdings wegfallen und entbehrt weiden; auch nicht
80in der Anaphora, dem merkwürdigsten und spezifisch sprachlichen
Modus des Zeigens. Diese Einsicht ist der Angelpunkt unserer
Lehre vom Zeigfeld der Sprache.
Was ich Neues in diesen Dingen zu bieten vermag, soll als eine
Vollendung dessen, was Wegener und Brugmann begonnen haben,
betrachtet werden. Vor ihnen schon und von den verschiedensten
Erscheinungen her sind moderne Sprachforscher auf das Faktum
gestoßen, daß die adäquate Analyse des konkreten Sprechereignisses
ein weitgehendes Miterfassen der gegebenen Situationsmomente
fordert. Aber erst Wegener und Brugmann haben die Funktion
der Zeigwörter sachentsprechend unter dem obersten Gesichtspunkt,
daß sie Signale sind, beschrieben. Der Gattungsname ist diesen
Forschern nicht, wohl aber der Bestirnmungsgesichtspunkt geläufig.
Doch verhält es sich mit ihrer neuartigen Beschreibung wie mit allem
begrifflich zu Ordnenden, daß erst die Grenze des Verfahrens scharf
erkennen läßt, was es zu bieten vermag. Genau so wie die Zeigwörter
fordern, daß man sie als Signale bestimmt, verlangen die
Nennwörter eine andere, den Signalen inadäquate Bestimmung;
nämlich die herkömmliche. Die Nennwörter fungieren als Symbole
und erfahren ihre spezifische Bedeutungserfüllung und -präzision
im synsemantischen Umfeld; ich schlage den Namen Symbolfeld
für diese andere, keineswegs mit den Situationsmomenten zu verwechselnde
Ordnung vor. Es ist also rein formal bestimmt eine
Zweifelderlehre, die in diesem Buche vorgetragen wird.
Es ist das Kernstück, es ist die bevorzugte Technik der anschaulichen
Sprache, was wir als Zeigfeld beschreiben; ich beginne mit
einer psychologischen Erläuterung des sprachhistorischen Befundes
im Bereich des Indogermanischen, wie ihn Brugmann geschildert
hat in seiner programmatischen Abhandlung über die Demonstrativa 1)28.
Die Personalia sind dort nicht behandelt; sie parallel dazu
aufzureihen und die unentbehrliche Zeighilfe, deren sie in der konkreten
Sprechsituation teilhaftig werden, nachzuweisen, ist das
zweite. Dann folgt die phänomenologische Scheidung von Zeigwörtern
und Nennwörtern, eine Trennung, weiche grundständig ist
und sachgemäß unterstrichen werden muß; es war mir eine Ermutigung
nachträglich zu finden, daß sie von den ersten griechischen
Grammatikern genau so und an derselben Stelle wie es mir notwendig
erschien, bereits gezogen worden war. Später kam eine gewisse Verdunkelung
und Verwischung auf durch die Dominanz des Interesses
81an der Mischklasse der Pronomina; niemand wird ihre Existenz bestreiten,
aber daß sie semantische Mischlinge sind, den Nachweis
müssen sie sich gefallen lassen. Besonders aufklärend über den
Bereich des Indogermanischen hinaus wird die Angelegenheit, wenn
es vergleichbar zu unseren Pronomina in anderen Sprachfamilien
Wortklassen gibt, die man phänomenologisch korrekt nicht als Pronomina,
sondern als Prodemonstrativa auffassen muß, weil sie kurz
gesagt nicht ein zeigendes Nennen, sondern ein nennendes Zeigen
vollbringen. Davon handelt der Schlußabschnitt des Kapitels.
Den Anfang mit dem Schluß zu verbinden ist die Psychologie
berufen; ich traute meinen Augen kaum, als sich die Schlußfolgerungen,
welche vom Tatbestand der Linguistik her gezogen werden
mußten, bei genauerem Zusehen als identisch erwiesen mit einem
mir längst vertrauten Ergebnis der Vorstellungslehre. Die Dinge
stehen ungefähr so, wie wir sie brauchen, gedruckt in der von mir
besorgten vierten Ausgabe des Ebbinghausschen Lehrbuches.
Nur der Modus des anaphorischen Zeigens nicht, den man außerhalb
der Sprache kaum entdecken kann. Im übrigen hatten weder die
Autoren, auf die ich mich damals stützte, noch ich selbst eine Ahnung
davon, daß die beschriebenen Phänomene bei der Sprachwerdung
von Mitteilungsbedürfnissen wichtig, ja grundlegend sind.
Die gemeinten Phänomene sollen den Namen ‚die Deixis am Phantasma’
erhalten. Sie waren, wie ich noch einmal später erkannte,
vor uns von Engel und Piderit entdeckt und an zentraler Stelle
in der Ausdruckstheorie (von Engel in der Pantomimik und von
Pinerit in der Minik) zur Deutung der Tatsachen herangezogen
worden 1)29. Freilich alles nur so halb geklärt und halb verstanden,
daß man begreifen kann, warum weder Psychologen noch Linguisten
auch nur die spärlichste Notiz von ihrer Erstentdeckung
genommen haben.
§ 6. Die psychologischen Grundlagen der indogermanischen
Positionszeigarten.
Um an der Schwelle schon erkenntlich zu machen, was die
klassische Arbeit von Brugmann für die Sprachtheorie bedeutet,
sei ein Zitat an die Spitze gestellt:
„Und gerade bei dieser Wortklasse, wo sich von urindogermanischer Zeit
bis zur Gegenwart ein so rascher Wechsel in den Ausdrucksmitteln vollzogen hat
und wie kaum bei einer anderen und deshalb so zahlreiche etymologische und formgeschichtliche
Fragen hineinspielen, hat der „Sprachvergleicher” nicht länger auf
die noch zu leistenden semasiologischen Arbeiten der Spezialisten zu warten, um
erst dann, wenn diese vorliegen, den ganzen geschichtlichen Zusammenhang aufzuweisen.
82Er hat vielmehr jenen Forschern auch zuvorzukommen, indem er ihnen
zeigt, von welcher historischen Grundlage auszugehen ist und um welche entwicklungsgeschichtlichen
Probleme es sich handelt. — Schon jetzt ließe sich an vielen
Stellen im Verfolg dieser Untersuchung zeigen, wie Spezialisten bei Versuchen,
Erscheinungen, die die Demonstrativa betreffen, historisch zu erklären, aus dem
Grunde in die Irre gegangen sind, weil sie die größeren Zusammenhänge, denen diese Erscheinungen
angehören, zu wenig beachtet haben” (S. 17f., die Hervorhebung von mir).
Ich denke, das „Zuvorkommen” und das vom „größeren
Zusammenhang” ist ein gutes Wort und appelliert an den Sprachtheoretiker,
der es aufgreifen soll. Wenn nötig, so käme ein zweiter
Sprachhistoriker, nämlich H. Paul zu Hilfe mit dem anderen guten
Wort, es sei eine Selbsttäuschung, „wenn man meint, das einfachste
historische Faktum ohne einen Zusatz von Spekulation konstatieren
zu können”. Brugmann selbst ist auf dem Wege zu einem theoretischen
Modell; es fällt ihm ein, daß die moderne Lehre vom Verbum
Aktionsarten kennt und er will analog dazu die Zeigarten (Demonstrationsarten)
der indogermanischen Sprachen finden. Es sind
vier, die er sorgsam herausarbeitet, und alle vier sind Positionszeigarten
im Sinne unseres Schemas. Man darf sich nicht irreführen
lassen durch die Namen Ich-Deixis und Du-Deixis für die zweite
und dritte; Wackernagel hat diesen terminologischen Fehlgriff
Brugmanns schon korrigiert und vorgeschlagen, die zweite und dritte
als hic-Deixis und istic-Deixis zu führen. Denn es ist nicht das Ich
und das Du, sondern der Ort des Ich und der Ort des Du, was die
Zeigwörter der zweiten und dritten Brugmannschen Klasse hinweisend
treffen. Die erste und vierte Zeigart heißen bei Brugmann
der-Deixis und jener-Deixis; Namen, die exemplarisch scharf aus
dem Deutschen gewählt sind.
So stehen die vier Zeigarten da. Wer hat sie hingestellt, was
hat sie viermal verschieden hervorgetrieben im Indogermanischen?
Das Bedürfnis der Sprecher natürlich; aber was wir als Sprachtheoretiker
fragen, zielt weiter, zielt ab auf eine Einsicht in den
Systemgedanken, auf ein Modell, aus dem nicht nur die indogermanischen,
sondern die Zeigarten aller Sprachen, das Zeigen der
menschlichen Sprache im Singularis überblickbar wird. Die Lösung
dieser Aufgabe ist viel einfacher, als man von vornherein denken
sollte. Und zwar deshalb einfach, weil sprechende Menschen gar
nicht auf unendlich viele Weisen zeigen können, sondern immer wieder
auf dasselbe verfallen; sie können nicht anders als ausnützen, was
ihnen das Zeigfeld an Möglichkeiten bietet, versteht sich mehr oder
weniger davon, aber nichts, was derjenige, der das Zeigfeld kennt,
nicht vorauszusagen oder, wo es da ist, einzuordnen vermöchte.83
Merkwürdig, wie nahe Brugmann an die Konzeption des Zeigfeldes
herangekommen ist, ohne sie zu vollziehen. Er hat den Quellpunkt
seiner eigenen allgemeinen Überlegungen, zu denen er sich
gezwungen sieht, um den komplexen historischen Tatbestand der
indogermanischen Demonstrativa zu bewältigen, mit einem (oder
richtiger einigen) Namen versehen, die man nur ernst genug zu
nehmen und scharf genug zu interpretieren braucht, um darin die
Lehre vom Zeigfeld der Sprache mit dem meisten, was dazu gehört,
angedeutet zu finden. Es sei, so heißt es im ersten Satz, beim „Alltagsverkehr”
so, daß das, was der Sprechende sagt, vom Angeredeten
weitgehend „aus der Situation, in der die Äußerung geschieht,
das heißt aus der Örtlichkeit, wo das Gespräch stattfindet, den
umgebenden Gegenständen, dem Beruf und Geschäft des Redenden,
die dem Angeredeten bekannt sind, usw.” verstanden wird. Wir
fügen von uns aus nur das eine hinzu, daß es an erster Stelle Gesten
und psychologisch äquivalente sinnliche Daten sind, welche dieses
Verständnis der Rede aus den Situationsumständen vermitteln.
Alles andere Wissen und Verstehen kann und muß vorerst in den
Hintergrund geschoben werden, um die Angelegenheit der Gesten
theoretisch in Ordnung zu bringen. Wer diese Parole ‚eins nach
dem anderen und die Gesten voraus’ mitmacht, hat den Schlüssel
in der Hand und muß das Zeigfeld finden.
Brugmann selbst fährt fort: Das Beredete gehöre oft in ein
‚Anschauungsbild’, „aus welchem und durch welches die gehörte
Rede in Hinblick auf ihren Zweck ihre mehr oder minder notwendige
Ergänzung erfährt”. Das entscheidende Wort ist damit bereits
gesagt. Wir übersetzen: Es ist also mit den Sprachzeichen so, daß
sie im „Alltagsverkehr” in das Feld der Sprechsituation eingesetzt
bestimmte Feldwerte erhalten. Es kommt sprachtheoretisch nur
darauf an zu ergründen, von welcher Tragweite dies gewiß unbestrittene
und auch von anderen (z. B. Wegener) schon unterstrichene
Faktum ist. Aufgezeigt wird es von Brugmann an dem
„Alltagsverkehr”. Ist dem „Nichtalltagsverkehr” und der „hohen”
Sprache billig, was für die profane Schwester recht ist? Wie weit
erstreckt sich in den ganzen Bau der Sprache hinein das „Anschauungsbild”
und seine Ausnützung für den Darstellungszweck
der Sprache? Das ist gewiß eine vernünftige und legitime Frage des
Sprachtheoretikers 1)30.84
Brugmann sieht sich danach um, wo sonst noch die Demonstrativa
blühen, und erwähnt das Drama. „Der dramatische Gebrauch
der Demonstrativa, um ihn kurz so zu nennen, ist jedenfalls
der ursprünglichste [von mir gesperrt], und gewisse Pronomina
und Pronominalverbindungen, die in dieser Sprachverwendung aufgekommen
sind, sind auch, auf sie beschränkt geblieben” (6). Brugmann
kommt später noch einmal auf den „dramatischen Gebrauch”
zu sprechen, und dort ist deutlicher zu erkennen, was ihn daran
besonderes interessiert. Ich zitiere (mit eigenmächtiger Unterstreichung
des für uns Wichtigen):
„Es ändert an der Natur der ichdeiktischen Pronomina nichts, daß sie zum
Teil auch in der Erzählung vergangener Ereignisse gebraucht werden. Wenn
nämlich Demonstrativa räumlicher oder zeitlicher Bedeutung, wie sie für die Anwesenheit
und Gegenwart vom Standpunkt des Sprechenden aus gelten,
in der Erzählung auftreten, so ist dies dramatische Gebrauchsweise, ähnlich, wie
wenn in der Erzählung das Präsens statt eines Vergangenheitstempus angewendet
wird. So: er saß den ganzen Abend traurig da; er hatte heute (statt: an dem Tage)
zwei Hiobsposten erhalten — er fuhr nach Rom; hier (statt: da oder dort) blieb er zwei
Tage — er kam rasch her (statt: dar, vgl. Luther, als er dar gekommen war)” (S. 41 f.).
Auch dies sind wieder durchaus bekannte Tatsachen. Man
wird versuchen müssen, den Punkt zu finden, von dem aus all das
Gesagte und noch vieles andere, was dazu gehört, systematisch
überschaubar wird. Wo liegt in der Wurzel der darstellenden Sprache
die Anlage zum Drama, zur ‚dramatischen’ und dicht daneben die
Anlage zur ‚epischen’ Rede, und wie entfaltet sich das dramatische
Verfahren? Wir wollen uns diese Frage vormerken, ohne geraden
Weges auf ihre Beantwortung auszugehen. Die Untersuchung
Brugmanns gestattet und verlangt einige allgemeinere sprachtheoretische
Erwägungen, die richtig angelegt und zu Ende gedacht
wie von selbst auf die formulierte Frage zurückführen. Sie soll
dann erst in den folgenden Paragraphen von der Psychologie her
beantwortet werden. Der dramatischen Rede wird sich dabei die
epische Rede als zweite Modifikation gegenüberstellen. Zunächst
aber gilt es, geführt von Brugmann, das Wissen der Sprachhistoriker
über die Zeigwörter in genügendem Ausmaß aufzunehmen;
denn dazu ist letzten Endes die Sprachtheorie da, daß sie entgegennimmt
und wieder gibt. Entgegennimmt in Ehrfurcht vor den
Tatsachen; ich lege den größten Wert darauf, die sprachtheoretisch
entscheidenden Gesichtspunkte induktiv aus dem Befunde der
historischen Sprachforschung herauszuarbeiten. Das ist einigermaßen
umständlich und erfordert einige Druckbogen mehr in diesem
Buche, als ein deduktives Verfahren erfordert hätte; allein es bringt
85den großen Vorteil mit sich, daß der Kontakt der Sprachtheorie
mit den Alltagsproblemen der Linguisten gewahrt bleibt.
1. Eine Vorbemerkung. Man begegnet heute da und dort
einem modernen Mythos über den Sprachursprung, der sich entweder
ausgesprochen oder unausgesprochen auf die Denkweise
Brugmanns und anderer stützt und das Thema von den Zeigwörtern
so aufnimmt und weiterspinnt, daß sie als die Urwörter der Menschensprache
schlechthin erscheinen. Vorausgegangen sei die stumme
Deixis, das Hinweisen mit dem ausgestreckten Arm und Zeigefinger
und ähnliche hinweisende Gebärden mit Kopf und Augen.
Dies stumm oder schreiend und rufend vollzogene Deuten auf Gegenständliches
und Vorgänge im Wahrnehmungsbereich (auch die Tiere
schreien und rufen, aber deuten noch nicht) sei zuerst unterstrichen
und dann weiter und weiter ausgestattet worden mit und weitergeführt
durch mitdemonstrierende Lautzeichen. Und schließlich
sei die Geste überflügelt und teilweise ersetzt worden durch Lautzeichen
allein. Das spezifisch Menschliche beginne, so sagt man,
schon mit der echten Zeiggeste und aus ihr gehe das übrige gesetzmäßig
hervor 1)31. Einige betrachten den Wegweiser an Straßenkreuzungen
als (abgeleitetes) Bild und Gleichnis der urmenschlichen
Fingergeste. Man kann alle Varianten zusammengenommen das
Ganze als den Mythos vom deiktischen Quellpunkt der darstellenden
Sprache bezeichnen.
Mythen müssen nicht falsch sein, dieser moderne so wenig
wie die Schäferidylle im Stile des 18. Jahrhunderts, die einst Herder
über den Ursprung der Sprache geschrieben hat, wo das nützliche
Tier vor des Menschen Auge tritt und dieser ihm einen Laut nach
dem Merkmal des Blöckens oder des Wollichten als Namen beilegt.
Herder denkt eben mit allen alten Sprachtheoretikern bis zurück
auf Platon und die ansprechende Erzählung in der Genesis zuerst
an die Nennfunktion der Wörter und fixiert die in ihnen aufscheinende
Thesis als den schöpferischen Akt kat' exochen der Sprachbildung.
Es muß aber betont werden, daß Deixis und Nennen zwei zu sondernde
Akte, Zeigwörter und Nennwörter zwei scharf zu trennende
Wortklassen sind, von denen man z. B. für das Indogermanische nicht
anzunehmen berechtigt ist, die eine sei aus der anderen entstanden 2)32.
86Die Hypothese von der zeitlichen Priorität eines nennungsfreien
Hinweisens, ist an sich eine widerspruchsfreie Annahme, die man
machen kann. Doch erschöpft sie nicht, was als gegeben und
(zum mindesten bis heute) als unableitbar hingenommen werden
muß von jedem, der über den Sprachursprung nachsinnt. Das ist
an den erläuternden Beispielen, die Brugmann für seine vier indogermanischen
Demonstrationsarten bietet, eindeutig abzulesen.
Brugmann legt keinen Wert darauf, diese Exempel aus ältesten
Dokumenten zu entnehmen, sondern greift sie mit Vorliebe aus dem
modernen Deutsch, das er selber spricht. Wenn einer von uns auf
etwas in seinem Wahrnehmungsbereiche faktisch mit dem Finger
deutend die Lautfolge der Hut ausspricht, so ist das ein Fall der
ersten Demonstrationsart im Sinne Brugmanns, für welche in der
indogermanischen Sprachfamilie unter anderem die Stämme *to-
und *so- verwendet worden sind. Wer uns nun zuvor den genannten
modernen Mythos erzählt hat, versuche sich einmal analytisch
an diesem Exempel. Er findet drei Momente, von denen keines
entbehrlich sein dürfte, nämlich die Fingergeste, das Wort dér
und das Wort Hut. Gewiß kann man sich auch eine Zweierkomplexion
von Zeichen aus Geste + *to- (Demonstrativum) oder Geste
+ (Wort) Hut oder *to- + Hut ausdenken. Allein man muß sich
genau überlegen, ob die einzige von diesen Zweierkomplexionen, die
das Nennwort Hut nicht enthält, ob Fingergeste + to, also das Hinzufügen
eines demonstrierenden Lautzeichens zu der Fingergeste
allein den entscheidenden Fortschritt hätte bringen können.
Hindeuten ist Hindeuten und nie etwas mehr, ob ich es nun
stumm mit dem Finger oder zwiefach mit dem Finger und einem die
Geste begleitenden Laute tue. Nein, der Fortschritt ist einzig und
allein an die Bedingung geknüpft, daß der Laut etwas hinzubringt,
etwas Neues an Leistung. Und wie immer man die Dinge auch
drehen und wenden mag, so kann dieses Plus aus keiner anderen
Quelle kommen als aus der Nennfunktion des Lautes. Auch eine
stumme Gebärde kann das „Bedeutete” charakterisieren, indem sie
es nachbildet; der Laut symbolisiert es. In beiden Fällen ist der
sohlichte Hinweis auf ein da und da im Wahrnehmungsbereich zu
Findendes durchaus zu trennen von der andersartigen Angabe, daß
es ein so und so Beschaffenes sei. Diese beiden Angaben und Bestimmungsweisen
sind in Ewigkeit nicht auseinander abzuleiten,
wohl aber sind sie berufen, einander zu ergänzen. Und wer der
Meinung ist, daß die eine vor der anderen dagewesen sei, nun der
mag seine Gründe dafür haben, über die man diskutieren kann;
87aber einen hinreichenden Ansatz für den Ursprung der Sprache
oder für die Menschwerdung an der Sprache hat er damit allein
noch nicht gefunden. Man muß, anders gesagt, rein phänomenologisch
Zeigwörter und Nennwörter voneinander trennen und ihr
Unterschied kann durch keine Ursprungsspekulation aufgehoben
werden.
2. Wir stehen mitten in der Erörterung derjenigen Zeigart,
welche Brugmann mit Recht als die nächstliegende und am wenigsten
entbehrliche auffaßt; es ist seine Der-Deixis, Wackernagel
schlägt im Hinblick auf die häufigste Wurzelsilbe den Namen to-Deixis
vor. Das Musterbeispiel in Brugmanns eigenem Text lautet
der ist es gewesen, wir stellten daneben der Hut. Das zweite sieht
sprachlich unvollendet aus, es ist nach der herkömmlichen Auffassung
kein ganzer Satz, sondern „nur” eine Ellipse. Brugmann
weiß wie jeder andere, der sich einmal mit der Umgangssprache und
mit der hochkultivierten Sprache des Dramas beschäftigt hat, daß
„die sogenannten Ellipsen… nicht nur gelegentlich vorkommen,
sondern allgemein üblich sind und geradezu die Regel bilden” (4).
Wir werden diese Tatsache später genauer ins Auge fassen.
Jedenfalls aber lenkt die allgemeine Tatsache, daß Überflüssiges,
Entbehrliches weggelassen wird im knappen Sprechverkehr,
die Aufmerksamkeit auf den Grenzfall, mit dessen Betrachtung
man beginnen muß, um das volle Gewicht der Situationshilfen
theoretisch richtig zu erfassen. Daß es auch einen restlos stummen
seelischen Verkehr zwischen Menschen gibt und daß in ihm nur dann
und wann einmal ein Lautzeichen wie eine Insel im Meer auftauchen
kann, dies Faktum ist es, von dem man ausgehen muß. Solch lautarmer
Verkehr darf nicht summarisch und für alle Umstände
als armseliges, primitives, unvollendetes Sprechen gekennzeichnet
werden. Denn das wäre genau so falsch, wie wenn man z. B. den bargeldlosen
und bargeldarmen Güterverkehr summarisch als den Ausdruck
einer primitiven und unvollkommenen Wirtschaftsordnung
betrachten wollte. Sondern es kann höchstes Raffinement in beiden
liegen. Es gibt auch eine Hochkultur des „elliptischen” Sprechens,
wobei zur Erfüllung und Präzisierung des Sinnes der Lautinseln
die Feldwerte der Situation ausgenützt werden.
Angenommen das Exempel der Hut gehöre zu den präzisen
Äußerungen dieser Art, so kann man ob seiner Prägnanz besonders
einfach analytisch an ihm das Folgende verdeutlichen. Die hinweisende
Geste, welche in der lebendigen Wahrnehmungssituation
beobachtet wird, ist unentbehrlich, kann höchstens durch Äquivalente
88vertreten werden. Wozu dann aber das der, allgemein das
demonstrierende Wort der *to-Deixis? Es leistet dem Anschein
nach nichts Neues, sondern wiederholt nur, was die Geste auch schon
bietet. Doch gerade dies dürfte eine Täuschung sein. Man könnte
sagen, das demonstrierende Lautzeichen kopuliere die Fingergeste
mit dem Namen Hut und mache das Ganze erst zu einem ordentlichen
Gefüge. Eine derartige Vermittlerrolle vermöge es deshalb
zu spielen, weil es auf der einen Seite dem Material nach mit dem
Namen zu den Lautzeichen und auf der anderen Seite der Funktion
nach mit der Geste zu den hinweisenden Zeichen gehört.
Doch müßte diese analytische Betrachtung problematisch
bleiben, wenn das nur konstruktiv erschlossene indogermanische
to tatsächlich formlos geblieben wäre und keine grammatische (oder
logische) Funktionen übernommen hätte. Faktisch hat es aber
solche Funktionen übernommen, denn das deutsche dér zeigt das
grammatische Geschlecht des folgenden Namens, im Lateinischen
kommt es zur Erscheinung der Kongruenz dabei. Derartiges mag
man im gebräuchlichen Sinn des Wortes als rein „grammatische”
Funktionen betrachten. Viel durchgreifender und entscheidender
aber ist es, daß die geformten Demonstrativa ganz allgemein bestimmte
und unzweifelhaft logische Funktionen übernommen haben.
Wir stellen eine von ihnen in den Vordergrund und werden in der
Lehre vom Artikel noch andere angeben. Im Deutschen können
Ausdrücke wie das Maiglöckchen und der Baum im hinweisfreien
Kontexte Artnamen sein, das heißt die species oder Klasse als solche
treffen, während Ausdrücke wie dies Maiglöckchen oder jener Baum
Individuen treffen. Das demonstrierende Wort individualisiert
also in diesen Fällen das durch das Nennwort Genannte und das
ist eine von seinen logischen Funktionen. Man wird sorgfältig untersuchen
müssen, wieweit diese Regel gültig ist. Jedenfalls aber lassen
sich an Derartigem die Eigenfunktionen der Zeigwörter, welche zu
der ersten der von Brugmann unterschiedenen Klassen gehören,
aufsuchen und genauer angeben. Wir werden beim ‚Artikel’ darauf
zurückkommen. Durchaus parallel zur ersten liegen die Verhältnisse
in dieser Hinsicht für die vierte Brugmann sehe Zeigart.
Er nennt sie die Jener-Deixis, Wackernagel setzt das lateinische
‚ille’ beispielhaft in ihren Namen. Man wird an denen, die zur zweiten
und dritten Klasse gehören, leichter als an denen der ersten und
vierten Klasse noch andere Funktionen systematisch aufweisen
können. Und all das gehört zu einer ordentlich aufgebauten Lehre
vom Zeigfeld der Sprache.89
Ist man so weit, dann gilt es in einem letzten Denkschritt den
ersten Ansatz, den man gemacht hat, zu korrigieren: die Zeigwörter
hätten die logischen Funktionen, von denen wir sprechen, nie übernehmen
können, wenn sie nicht von vornherein das Zeug dazu in
sich getragen hätten. Auch sie sind Symbole (nicht nur Signale);
ein da und dort symbolisiert, es nennt einen Bereich, nennt den geometrischen
Ort sozusagen d.h. einen Bereich um den jeweils Sprechenden
herum, in welchem das Gedeutete gefunden werden kann; genau
so wie das Wort heute den Inbegriff aller Tage, an denen es gesprochen
werden kann, faktisch nennt und das Wort ich alle möglichen Sender
menschlicher Botschaften und das Wort du die Klasse aller Empfänger
als solcher. Doch ein Unterschied dieser Namen von den übrigen
Nennwörtern der Sprache bleibt trotzdem bestehen; er liegt darin
beschlossen, daß sie ihre Bedeutungspräzisierung von Fall zu Fall
im Zeigfeld der Sprache erwarten und in dem, was das Zeigfeld den
Sinnen zu bieten vermag.
3. Ähnliches wie die erste und vierte, so gehören die zweite und
dritte Zeigart Brugmanns enger zusammen. Seine Termini sind
unzweckmäßig: man soll nicht Ich-Deixis und Du-Deixis sagen,
wenn man den Hinweis auf den Ort des Senders und auf den Ort des
Empfängers meint. Wackernagel schlägt korrekter ‚hic’ und ‚istic’
als namengebende Exempel vor und hilft damit, vermeidbare Mißverständnisse
auszuschließen. Im Deutschen gibt es kein Analogon
zu ‚iste’, kein Zeigwort, das einigermaßen ebenso scharf wie ‚istic’
die Position des Empfängers im Zeigfeld träfe. ‚Hier’ und ‚hic’ entsprechen
sich, während ‚istic’ in den theoretisch maßgebenden
Fällen nicht einfach mit ‚da’, sondern, soweit Brugmann im Recht
ist, mit ‚da bei dir’ übersetzt werden muß 1)33.
Beginnen wir mit den psychologisch eindeutigen und klaren
Verhältnissen des Hie und Hier. Brugmann schreibt:
„Der Sprechende lenkt den Blick des Angeredeten geflissentlich auf sich selbst,
den Sprechenden, und seine Sphäre oder darauf, daß er selbst den betreffenden
Gegenstand vor Augen hat: sieh her auf mich oder auf das, was mein Wahrnehnehmungsobjekt
ist.” Dazu sind Wörter, wie nhd. hier, her, gr. öde, lat. hic berufen.
„Zu einem Pronomen der ersten Person hinzugefügt oder geradezu an dessen Stelle
tretend, hebt diese Gattung von Demonstrativa das Ich als solches hervor, z. B.:
90… tu si hic sis, aliter sentias” (10); für das letztere sagt man drastisch im
Deutschen etwa: wenn du in meiner Haut stecktest.
Es dürfte wieder lehrreich sein, kontextarme „elliptische”
oder ganz kontextfreie Verwendungsfälle aus dem Alltagsverkehr
an die Spitze zu stellen. Wenn z. B. zum Zweck der Präsenzkontrolle
in einer Versammlung die Mitgliederliste verlesen wird, antwortet
jeder auf die Verlesung seines Eigennamens mit hier. Manchmal
antwortet es auch aus unsichtbaren Bereichen, aus Finsternis
oder durch geschlossene Türen auf die Frage wo bist du? mit hier
und auf die Frage wer da? mit ich. Der Anschein einer unzulänglichen
Antwort verschwindet in den letzten Fällen oder wird verstärkt,
je nachdem es dem Empfänger möglich ist oder nicht, die
erwünschte Ortsbestimmung oder Personalbestimmung aus dem
Klange durchzuführen. Und es lohnt die Mühe, dieses Faktum psychologisch
zureichend zu analysieren, weil man gewisse Fingerzeige
zu einer allgemeinen und fruchtbaren Problemstellung dabei gewinnt.
Wo Klänge und Geräusche als Verkehrszeichen fungieren, da
wird erfahrungsgemäß so gut wie immer erstens ihr Klangcharakter
und zweitens die räumliche Herkunftsqualität dieser Klänge und
Geräusche verkehrstechnisch ausgewertet; ich behaupte, das sei
im Sprechverkehr genau ebenso. Ein Hupensignal auf der Straße
z. B. ist kraft bestehender Polizeivorschriften als gewöhnliches
Autohupen erkenntlich und von den Signalen der Radfahrer und
der privilegierten Feuerwehrfahrzeuge unterscheidbar am Klang
der Signalhörner. Außerdem aber hört es der einzelne Empfänger
(sagen wir Fußgänger) als von vorn oder hinten, rechts oder links
herkommend und benimmt sich entsprechend. Produkte des menschlichen
Stimmapparates haben ebenso für jeden Hörer eine räumliche
Herkunftsqualität und werden als menschliche Stimmprodukte in
der Regel leicht von allen sonstigem Lärm unterschieden. Mehr
noch; sie haben einen Individualcharakter, den wir kraft vitaler
Interessen und lebenslanger Übung kennen und einigen Dutzend
oder Hundert bestbekannter Sprecher um uns individuell richtig
zuordnen. Wir erkennen unsere nächsten Bekannten und sonst noch
allerhand Leute leicht und sicher an ihrer Stimme.
Unser Sprecher aus unsichtbarem Orte verläßt sich darauf,
daß sein hier aus der Herkunftsqualität und sein ich aus dem personalen
Stimmcharakter eindeutig sei und tut dies, weil er aus normalen
Sprechsituationen daran gewöhnt ist. Wer mitten in einer
Menschengruppe hier ruft, sobald sein Eigenname verlesen wird,
darf erwarten, daß der Lautempfänger den Lautsender mit den Augen
91aufzufinden vermag nach der Herkunftsqualität dieses hier. Der
Hörer blickt dahin, woher kommend er den Laut vernimmt und erkennt
dort den Sprecher optisch. Blinde können das nicht, sie müssen
sich auf ihr Ohr allein verlassen, um zu ähnlichen Ergebnissen zu
kommen; und das ist es, was der Rufer aus dem Unsichtbaren auch
vom normalen Hörer erwartet. Nicht immer vergeblich, wie man
weiß, und zwar deshalb nicht, weil wir alle aus dem Alltagsverkehr
eine große Fertigkeit für derartige Leistungen, die immer wieder
von uns verlangt werden, besitzen.
4. Danach behaupte ich, daß an der Wurzel der Hic-Deixis
die Herkunftsqualität der Klänge zu finden ist und daß sie eine
ähnliche Rolle spielt wie die Finger-Geste an der Wurzel der Der-Deixis.
Genau so wie in dem Gesamtausdruck der ist es gewesen
die Fingergeste unentbehrlich ist, so ist in dem Gesamtausdruck hier
ist es trocken das anschauliche ortsbestimmende Moment der Klangherkunft
unentbehrlich. Ein kleiner Unterschied liegt darin, daß
Fingergeste + der zwei faktisch isolierbare Teile des Gesamtausdurcks
sind, während die Herkunftsqualität und die Wortform des
hier nur als abstraktiv unterscheidbare Momente an ein und demselben
physischen Phänomen vorkommen. Doch darf man diesem
Unterschiede deshalb kein zu großes Gewicht beilegen, weil jeder, der
sich durch ein hier besonders energisch, dauerhaft, eindeutig bemerklich
und auffindbar machen will, auch allerhand optisch wahrnehmbare
Deutehilfen benützt. Man kann aufstehen oder die Hand aufheben
in einer Versammlung, man kann auch mit dem Finger auf
seinen eigenen Standort hinab- oder auf sich selbst (gleichsam zurück-)
verweisen, durch eine Art reflexiver Zeigegeste. Diese Geste steht
in natürlicher Opposition zu der Der-Geste und allem anderen, was
sonst noch dem Modell des einfachen Wegweisers unterzuordnen
ist, weil es sowohl ‚den Weg’ wie ‚weg’ weist. Der Appell des Her,
die Her-Lenkung, hebt sich zunächst einmal ab von jedem Appell
des Hin, der Hin-Lenkung.
Wir wollen dieser Opposition zuerst das Augenmerk schenken.
Sie wurde von Brugmann im wesentlichen richtig gesehen und bestimmt,
weil der Befund der indogermanischen Sprachvergleichung
gerade diese Opposition unverkennbar hervortreten läßt. Denn
ähnlich wie der *£o-Stamm im Bereich der ersten, so dominiert der
*£o-Stamm im Bereich der zweiten Brugmannschen Zeigart. Der
ko-Stamm hat „Anspruch darauf, als urindogermanische Bezeichnung
dieser Zeigart angesehen zu werden” (51). Fügen wir sofort
hinzu, daß er sowohl die Schar der Hier-Wörter wie die Schar der
92isolierten Ich-Wörter in den indogermanischen Sprachen führt;
der ko-Stamm „erscheint in sämtlichen Sprachzweigen außer dem
Arischen”. Wir werden darauf zurückkommen und später eine,
wie mir scheint, nicht ganz unwichtige Beobachtung der Kinderpsychologie
dazu in Parallele stellen. Unterstrichen wird das Gewicht
dieser Dominanz durch die Tatsache, daß im Bereich der
dritten und vierten Zeigart Brugmanns beträchtlich andere Verhältnisse
bestehen. Dort verteilen sich die Zeigwörter viel weiter auf
verschiedene Stämme. Mag man für die Jener-Deixis den l-Stamm
und n-Stamm zusammen (ille, jener) noch ein gewisses Übergewicht
zuschreiben, so läßt sich die iste-Deixis lautlich überhaupt nicht mehr
als eine Einheit fassen. Ja, um es schlank herauszusagen, im modernen
Deutsch, das ich spreche, vermag ich auch von der Funktion
her keine iste-Deixis zu erkennen. Und was die isolierten Du-Wörter
angeht, so sind sie, wie Brugmann und mit ihm alle anderen Sachverständigen
wissen, in den meisten indogermanischen Sprachzweigen
genau so aus dem to-Stamm oder so-Stamm hervorgegangen,
wie die Schar der der-deiktischen Zeigwörter.
5. Es sei aus all dem nicht mehr für unsere Diskussion entnommen,
als das im ganzen doch recht deutliche Hervortreten der
Opposition to gegen ko. Ist psychologisch etwas darüber zu sagen,
was Hand und Fuß hat? Antwort: ja, wenn der Leitgedanke richtig
ist, dem wir uns anvertraut haben. Ich, sage noch einmal: es gibt
kein lautliches Zeigzeichen, das der Geste oder eines der Geste
äquivalenten sinnlichen Leitfadens oder schließlich einer an deren
Stelle tretenden Orientierungskonvention entbehren könnte. Das
ist eine vielleicht fürs erste Hören noch umständlich anmutende
Fassung; sie hat aber den Vorteil, daß sie restfrei alles einbegreift,
was sprachliches Zeigen genannt werden darf. Es geschieht nur aus
Gründen der Übersichtlichkeit, daß vorerst die Anaphora und die
Deixis am Phantasma beiseite geschoben und einzig das lautliche
Zeigen im Wahrnehmungsfelde besprochen werden soll. Hier liegen
die Dinge so einfach, daß sie mit ein paar Sätzen hinreichend erläutert
sind. Wir rufen noch einmal den Wegweiser zur Hilfe.
Der stumm mit dem Finger zeigende Mensch nimmt vorübergehend
die Haltung eines Wegweisers an. Laßt ihn die Fingergeste
mit einem to-Demonstrativum lautlich bereichern, so ist dieser Laut,
wie alles Akustische, was von seinen Lippen kommt, mit einer
Herkunftsqualität ausgestattet. Der Hörer braucht dem sinnlichen
Leitfaden der Herkunftsqualität nur zu folgen und findet den Standort
des Sprechers im Gelände. Ein geformtes, eigenes Lautzeichen
93dafür ist und bleibt so lange das überflüssigste Gebilde in der Welt,
als der Hörer es nicht vergißt, dem Leitfaden der Herkunftsqualität
des Lautes zu folgen. Wo immer im lebendigen Sprechverkehr ein
Hier-Wort in die Luft geschickt wird, geschieht es, weil das eigentlich
Selbstverständliche nicht mehr selbstverständlich ist und unterstrichen
werden muß. Ein Hupensignal schreckt den unachtsamen
Verkehrspartner auf und braucht nicht (eigens und geformt) hier
zu sagen, weil sein ungeformter Leitfaden, die Herkunftsqualität
des Lautes, unmittelbar wirksam wird. Wann und warum sagen
wir (im direkten Verkehr von Mund zu Ohr) eigentlich ‚hier’? Weil
die menschliche Sprache über das Stadium der Tierrufe hinausgekommen
ist und der Empfänger manchmal eigens wieder zur Beachtung
der Herkunftsqualität, die er an der vom Zeigfeld entbundenen
Rede unbeachtet lassen durfte und lassen mußte, aufgefordert
werden soll. Was er nach der akustischen oder (was bei
uns Sehtieren die Regel ist), nach der optischen Ortsfindung, sei es
praktisch oder denkend, weiter machen soll, besprechen wir noch nicht.
Damit das Gesagte ein gewisses Relief gewinnt, sei parallel
dazu ein erstes Wort über den psychologischen Quellpunkt der
lautlichen Ich-Zeichen gesagt und damit vorbereitet, was auf breiterer
Basis und mit einem Blick auf bestimmte Ergebnisse der indogermanischen
Sprachvergleichung erst im folgenden Paragraphen
ausgeführt wird. Ungefähr so, wie das Hier-Wort zur Herkunftsqualität,
verhält sich, das Ich-Wort zum individuellen Stimmcharakter
der Sprechlaute. Jedem von uns ist aus seiner Lebenserfahrung
geläufig, daß individuelle (oder typische) Eigentümlichkeiten an
gehörter Stimme und Rede Zuordnungen und Deutungen einer
anderen Klasse als die der Herkunftsqualität erlauben und dazu
herausfordern. Wenn aus dem Unsichtbaren auf wer da? ein ich
ertönt, dann soll der Empfänger eine personale Diakrise vollziehen,
ähnlich als wäre ihm ein Eigenname geboten worden. Nun, ein
Name ist ein Nennwort und kein Zeigwort; das ich aber ist ursprünglich
ein Zeigwort und kein Name, wir werden darauf zurückkommen.
Wären wir nicht alle lebenslang aufs feinste geübt, personale
Diakrisen an Sprechlauten zu vollziehen, so bliebe jenes ich,
aus dem Unsichtbaren eine sinnlose Reaktion. Wieviel man der
Übung in diesen Dingen verdankt, ist mir selbst in einer Reihe von
Arbeiten über den Ausdruck (die physiognomische und pathognomische
Ausdeutung) der Sprechstimme deutlich geworden. Ich
will im Vorbeigehen auf eine andere Tatsache hinweisen, die gewiß
mit mir vielen Eltern von heute an ihren Kindern aufgefallen ist.94
Wir gewöhnlichen Erwachsenen von heute erfassen kraft
polizeilicher Vorsorge das typische Autohupen als solches auf der
Straße und kaum mehr daran. Unsere Jungens dagegen, welche
innerlich ganz anders mit dem Autowesen befaßt sind, unterscheiden
mehr. Sie erkennen am Klange z. B. das Bosch-Horn und andere
Markenhörner. Wenn das noch weiter geht mit dem übenden und
differenzierenden Interesse, dann kann es kommen (und ist schon
manchmal so), daß auch der Wagen des Herrn N. N. an seinem
individuellen Hupen erkannt wird. Was Stimme und Rede angeht,
so ist es jedenfalls bei uns allen schon lange soweit, daß wir nicht
nur Männer, Frauen und Kinder an ihren typischen Stimmen,
sondern darüber hinaus noch vieles andere aus der Stimme erkennen
und daß wir die Nächsten um uns an ihrem eindeutig ‚individuellen
Hupen’ unterscheiden.
Die Stimme aus dem Unsichtbaren, welche auf wer da? mit
ich reagiert, erwartet dies und nichts anderes vom Empfänger.
Und derartige Fälle stehen nach meiner Auffassung dem psychologischen
Quellpunkt des geformten Ich-Wortes sehr nahe. Es ist
also mit dem ‚hier’ und ‚ich’ ungefähr so: Brugmann gibt sehr
treffend die ‚Herlenkung in erster Linie des Blickes auf den Standort
des Redenden’ als die Kernfunktion des Hier-Wortes an. Das
Ur-Ichwort (wenn man kurz so sagen darf, wo nichts als eine rein
psychologische Reduktion versucht wird) fordert den Empfänger
im ersten Schritt zu ähnlichem und im zweiten Schritt zu anderem
heraus. Unbestritten richtig ist, was Brugmann, der sonst in der
zitierten Abhandlung nur die Positionszeigwörter zum Vorwurf
nimmt, zwischendurch auch vom Ich-Wort sagt. - Es fordert in
den einfachsten Fällen genau so wie das ‚hier’ zum Aufsuchen des
Sprechers mit den Augen auf. Allein das ist nur die erste Phase
dessen, wozu es den Hörer herausfordert. Mein Partner soll hersehen,
wenn er kann, sonst wenigstens herhorchen auf mich. Aber
nicht, wie beim ‚hier’, um meine örtliche Position oder etwas,
was mit ihr zusammenhängt, zu finden, sondern er soll den
Sprecher treffen mit physiognomischem Blick kurz gesagt. Es gilt
etwas wahrzunehmen an dem, der im lebendigen Verkehr ‚ich’
sagt; kann sein, es sind sichtbare Ausdrucksgebärden oder ausdruckshaltige
Momente an dei Stimme, die beachtet werden wollen,
kann sein, es ist nur die Diakrise zu vollziehen, zu der man sonst
die Eigennamen verwendet. Es kann noch manches andere und
Differenzierteres sein. Wir formulieren: Das reine ‚hier’ fungiert
als Positionssignal und das reine ‚ich’ als Individualsignal des
95Senders einer sprachlichen Botschaft. Die Form der Wörter ist
bei allen Sendern einer Sprachgemeinschaft für alle Positionen,
die sie einnehmen mögen, bzw. für alle Erlebnislagen, aus denen
heraus sie sprechen, eine und dieselbe, nämlich das eine Mal ‚hier’
und das andere Mal ‚ich’. Die Erfüllung dessen aber, wozu sie auffordern,
muß beim reinen ‚hier’ im Herkunftscharakter und beim
reinen ‚ich’ im Individualcharakter der Stimme gefunden werden.
6. Im Sprechverkehr spielen also (logisch vor jeder Ausformung
von Zeigwörtern) die Fingergeste und die genannten zwei
Stimmattribute eine Rolle. Ohne sie hätten Demonstrativa wie
der, hier und ich (das wir aus guten Gründen mit dazu rechnen)
nicht entstehen können, sie fänden auch, nachdem sie einmal da
sind und verwendet werden, keine letzte Sinnerfüllung ohne die
genannten Situationshilfen. Eine auf systematische Vollständigkeit
angelegte Untersuchung muß nun an dem Punkt, bis zu dem
wir vorgedrungen sind, zwei Fragen stellen. Die eine von ihnen
zielt ab auf die istic-Deixis und die andere auf eine endgültige Übersicht
aller anderen natürlichen Hinweise, die sonst noch in der
konkreten Sprechsituation enthalten sein mögen und von den Partnern
für die Zwecke des Zeichenverkehrs mehr oder minder unmittelbar
ausgenützt werden. Wir stellen diese letzte und umfassendste
Frage zurück und wenden uns der ersten zu.
Was die psychologischen Grundlagen der iste-Deixis angeht,
so gilt es, eine allgemeine Antwort auf die Frage zu finden, ob es
natürliche Hinweise auf den Ort und die Person des Angeredeten
gibt. Der Ausdruck ‚Hinweis’ ist hier sowohl im wörtlichen wie im
übertragenen Sinne zu verstehen. Gibt es in der natürlichen Sprechsituation
direkt gestenähnliche oder indirekte Umstandsmomente,
die adressenhaft fungieren und den Angesprochenen als solchen
treffen und aufrufen, bevor er durch geformte Wörter getroffen und
aufgerufen wird? Das ist die sinngemäße Parallelfrage, die wir hier
stellen und beantworten müssen. Denn so war es doch mit der
Fingergeste und den zwei Stimmeigenschaften, daß sie vor jedem
Formwort etwas treffen, daß jedes von ihnen ein Leitseil ist, dem
man nur zu folgen braucht, um etwas in der konkreten Sprechsituation
Präsentes aufzufinden. Gibt es analoge Hinweise, denen
man nur zu folgen braucht, um den Ort des Angeredeten zu finden
oder auf irgend etwas zu treffen, was seiner personalen Sphäre angehört?
Denn auch das personale du gehört zu den Zeigwörtern.
Die allgemeine Antwort auf diese Frage lautet, daß es in der
konkreten Sprechsituation eine Fülle von indirekten Anzeichen der
96in Frage stehenden Klasse gibt, kaum aber ein einziges direktes
Indizium, das so ausgezeichnet und allgemein ausnützbar wäre wie
die Fingergeste und jene Stimmeigenschaften. Wer alles durchmustert,
was wechselnd von Fall zu Fall den Standort und die Person
des Angeredeten tatsächlich kennzeichnet, hat schließlich ein Aggregat
von Umständen beisammen, die das Herz eines Detektivs
erfreuen mögen; aber irgendein konstantes Moment, das überall
vorhanden wäre, ist nicht darunter. Ich will versuchen, das Greifbare
zu ordnen:
a) Am nächsten verwandt mir der dér-zeigenden Fingergeste ist alles, was
der Sprechende tun kann, um an der Haltung seines eigenen Körpers sichtbar und
ablesbar zu machen, wohin seine Anrede zielt. Gesamtkörper und Kopf und Augen
können sich daran beteiligen und ein Schauspieler versteht, wo es ihm darauf ankommt,
aus diesen Mitteln vor allem dynamische Bewegungsgesten, Wendungen
herauszuarbeiten, die einen Zielcharakter haben. Im Alltag findet man dasselbe
in grober oder feiner Form wieder; auch die gehaltene Fixation des Blickes auf
ein Etwas im Gesichtsfeld ist im stummen Verkehr zwischen Menschen ein geläufiges,
generelles Zielzeigemittel das nicht nur dér-deiktisch, sondern auch adressenhaft
(ich meine istic-deiktisch) verwendet wird. Natürlich muß ein derart Angezielter
vom Verhalten des Zielenden optisch Kenntnis nehmen, um sich auch
getroffen oder betroffen vorzukommen. Optischer Kontakt und optisches Notiznehmen
gehören zu den Voraussetzungen jedes Gesten Verkehrs. Warum nicht auch
die Fingergeste hier einreihen? Auch sie wird unter Umständen iste-deiktisch
verwendet; man braucht nur den Sprechtext, nicht die Fingergeste zu verändern
beim Übergang von dér ist es gewesen in du bist es gewesen. Es sei eigens
festgestellt, daß es bei uns keine für die iste-Deixis spezifisch ausgeformte Fingergeste
gibt und hinzugefügt, daß eine beiläufige Bemerkung Brugmanns darüber,
warum dem so ist, als unbefriedigend betrachtet werden muß.
Diese Bemerkung lautet: „Die Der-Deixis führt vom Sprechenden hinweg
in dessen Anschauungsbild hinein, ohne Rücksicht auf Nah- oder Fernsein des gewiesenen
Gegenstandes. Sie trifft geradeaus gehend, wenn der Sprechende dem,
an den seine Worte sich richten, zugekehrt ist, naturgemäß auch diesen. So erklärt
sich diese Anwendung der Dér-Demonstrativa einfach” (74). Erklärt soll damit sein
der historische Befund, daß man kein Pronomen findet, welches von urindogermanischer
Zeit her „ausschließlich oder auch nur vorwiegend der iste-Deixis, d. h. dem
Hinweis auf die Person des Angesprochenen und seine Sphäre” gedient hätte, wohl
aber in mehreren indogermanischen Sprachen Pronomina der Der-Deixis, die eine
engere und schließlich „durchaus feste und unveräußerliche Beziehung” auf den
Angeredeten erhalten haben. So im Arischen, Armenischen, Griechischen, Lateinischen
und Südslawischen (z. B. Bulgarischen).
Das ist gewiß eine interessante historische Tatsache. Allein die phänomenologische
Analyse, die zu ihrer „Erklärung” herangezogen wird, ist unhaltbar. Denn
schon eine einfache geometrische Überlegung lehrt, daß eine dér-deiktische Fingergeste
nur in dem einzigen ausgezeichneten Falle, wo gemeintes Ding und Angeredeter
in einer und derselben Ziellinie vom Sprecher weg liegen, „naturgemäß
auch diesen trifft”. Sonst aber (und das ist die statistische Regel) trifft sie ihn
durchaus nicht.97
Was die Geste angeht, so kann man oft einen Wettstreit zwischen der Hinwendung
des Senders auf den Empfänger und auf den zu zeigenden Gegenstand
beobachten. Denn der Sender ist zwiefach beansprucht, wenn er beides zeigen
soll, und löst die Aufgabe entweder sukzessiv oder indem er sich gleichsam
teilt. Sukzessiv, indem er mit Finger oder Augen zuerst den Empfänger attackiert
und dann dessen Blick mitreißend auf den Gegenstand deutet. Sich teilend z. B.
so, daß er seine Augen dem Partner und seinen Arm mit ausgestrecktem Zeigefinger
dem Gegenstand widmet, eine Gesamthaltung, die jedem Maler wohlvertraut ist.
b) Soviel vom Optischen. Man kann aber auch Veranstaltungen treffen, um
die Stimme mit einem Zielcharakter auszustatten. Das Faktum scheint mir unbestreitbar,
wenn es psychologisch auch noch weitgehend unaufgeklärt ist. Unter
meinen Mitarbeitern ist ein Blinder, Herr Dr. Friedrich Mansfeld. Wir haben
in einfachen Versuchen festgestellt, daß er sich im geselligen Kreise, wo die Rede
unregelmäßig kreuz und quer von einem zu den anderen geht, mit großer Regelmäßigkeit
angesprochen fühlt, wenn immer sich irgendeiner speziell an ihn wendet.
Versteht sich ohne die Hilfe eines namentlichen oder sonst sprachlich nur auf ihn
gemünzten Appells, sondern rein stimmlich. Die Sache ist so, daß er feiner als wir
Sehenden achtet auf ein leicht verwertbares Diakritikon. Wenn der Kopf (die
Augen) und mit ihm der sprechende Mund eines Tischgenossen auf den Blinden gerichtet
sind, treffen ihn die Schallwellen dieses Sprechers hinsichtlich ihrer Lautheit
optimal günstig. Und er hat gelernt, darauf zu achten und darauf zu reagieren.
Wieweit dies auch für andere Blinde gilt, entzieht sich meiner Kenntnis und noch
weniger weiß ich, ob wir Sehenden ohne eigene Übung auf dieses oder andere
akustische Momente in der Lebenspraxis regelmäßig reagieren.
Es kommt, wenn man die Dinge genau überlegt und auf das achtet, was der
Sender tut, um einen bestimmten Empfänger mit seiner Stimme zu „treffen” und
aufhorchend zu machen, wie bei der Artillerie auf Richtungseinstellung und Entfernungsdosierung
hinaus. Und daß alles, was der Sender dazu tun kann, richtig
erfaßt wird vom Empfänger, hat mich veranlaßt, eine zentrale Annahme zu machen.
Wir müssen damit rechnen, daß auf dem Gebiet der Phonorezeption ein auffallendes
Konstanzgesetz besteht, ein Phänomen, das man in Analogie zu wohlbekannten
optischen Konstanzfaktoren die ‚angenäherte Lautheitskonstanz der Töne und Geräusche
im Entfernungswechsel’ nennen wird. Ähnlich wie wir die Größe der
Sehdinge freisehen von ihrer perspektivischen Schrumpfung, hören wir vermutlich
die Hördinge (f. v. v.!) frei von ihrer perspektivischen Lautheits-Schrumpfung;
und vermutlich ist dies Gesetz für die Rezeption des Lautheitscharakters menschlicher
Sprachlaute im Sprechverkehr von grundlegender Bedeutung 1)34.98
Was die Dosierung angeht, so spricht jeder von uns leiser zu einem Tischnachbarn
als zu einem Partner über den Tisch hinweg, lauter noch, wenn er alle
erreichen will, die an einer langen Tafel sitzen und am lautesten, wenn seine Sprechlaute
im Freien die Grenzen ihrer normalen Tragfähigkeit übersteigen müssen,
um vom Angeredeten noch erfaßt zu werden. Wer auf diesem Intensitätsregister
nicht situationsgerecht zu spielen vermag und entweder zu laut oder zu leise spricht,
fällt unter Umständen und besonders an Orten, wo viele Menschen beisammen sind,
bald dem Angeredeten, bald den Unbeteiligten recht lästig. Lästig ist der überlaute
Sprecher an Nachbartischen im Gasthaus oder in einem fernen Abteil desselben
Eisenbahnwagens; lästig fällt auch derjenige, welcher entfernungsrelativ zu leise
spricht. Das alles wird durch die interessanten Ergebnisse der genannten Untersuchung
von Mohrmann psychologisch verständlich; es fällt durch sie auch einiges
Licht auf die merkwürdige Erfahrung, die wohl jeder schon einmal gemacht hat,
daß man sich bestimmt angesprochen fühlt und nicht zu sagen vermag, warum
eigentlich. Doch genug davon.
Ich wiederhole zum Abschluß den einleitenden Satz: es gibt
verschiedenartige natürliche Hilfsmittel, einen Anzusprechenden
gestenhaft oder stimmlich zu treffen und aufhorchen zu lassen.
Unter Sehenden dominieren, wo es die Umstände gestatten, adressenhafte
optische Wendungen des Senders zum Empfänger hin. Sonst
stehen auch akustische Möglichkeiten offen, über deren Funktion
und Gebrauchsfähigkeit wir noch nicht ganz im klaren sind. Wo alle
anderen Stricke reißen, gibt es allgemein gebräuchliche ungeformte
Appellmittel wie pst! he! halloh! und geformte Nennwörter, darunter
last not least die Eigennamen. Es fehlt also zur Ausbildung einer
lautsprachlichen Zeigart, welche istic-Deixis heißt, nicht an verwertbaren
sinnlichen Leitfäden. Trotzdem will mir scheinen, es
sei kein historischer Zufall, sondern nach der Lage der Dinge psychologisch
verständlich, daß sie (im Bereich der indogermanischen
Sprachen jedenfalls) nicht allgemein und in den bekannten Fällen
erst als ein vielleicht relativ spätes und keineswegs scharf abgegrenztes
Phänomen aufgetreten ist. Denn die natürlichen Hilfsmittel
sind entweder ziemlich kompliziert wie die akustischen oder
sie stehen den Mitteln der der-Deixis zu nahe wie die optischen.
Und außerdem, was wohl das wichtigste ist, hat das Du-Wort
dieselben Mittel in Anspruch genommen und der istic-Zeigart neben
sich keine rechte Entfaltungsmöglichkeit übrig gelassen.
7. Um unsere psychologische Durchmusterung der indogermanischen
Positionszeigarten gewissenhaft zu beenden, noch ein
Wort zu der Jener-Deixis im Brugmannschen Schema. Es wird
99hervorgehoben, daß durch die Wörter dieser Klasse meist untrennbar
zweierlei gezeigt werden soll, nämlich etwas Ferneres und etwas
auf der anderen Seite einer Grenze, die zwischen dem Zeigenden
und dem Gezeigten liegt.
„Der Hinweis auf das anderseitig Befindliche ist vermutlich die Grundbedeutung
der Pronomina der Jener-Deixis gewesen und das Bedeutungselement
der größeren Entferntheit durch die Gruppierung der Pronomia der Ich-Deixis
und der Der-Deixis entsprungen” (12).
Ich knüpfe an das letzte an. Es ist eine sonst im Bereiche der
Gesten nicht ungewöhnliche Erscheinung, daß sie sich paarweise
in gegensätzlicher Abhebung hochtreiben 1)35. Dies dürfte zutreffen
für die Fingergesten der hier- und der der-Deixis; doch wüßte ich
nichts anzugeben, was als einigermaßen konstante und spezifische
Geste der Jener-Deixis zuzuordnen wäre. Oppositionen von Fall
zu Fall können sich natürlich immer einstellen. Wenn ein Kranker
am eigenen Körper dem Arzt eine schmerzende Stelle zeigen will,
so wird er mit da berühren, was er erreichen kann und unter Umständen
mit dort fortfahren auf eine ihm im Augenblick unerreichbare
eigene Körperstelle hinzuweisen. Um objektiv große Fernen
geht es gewiß nicht bei derart verwendetem ‚jener Fleck dort’
oder ‚dort’. Also ‚da’ und ‚dort’ können im Deutschen okkasionell
und relativ in dem angedeuteten Sinn opponiert werden. Umgekehrt
kann zum Hier-Bereich die ganze Erde gerechnet werden, wenn
irgendein Jenseits mit ‚dort’ angedeutet wird. Wenn die Geste
dabei manchmal in die Höhe geht, so ist das lokalbedingt; denn das
Jenseits des Erdenlebens ist für uns irgendwo in der Höhe untergebracht.
Wenn ein Fluß oder Lattenzaun die Grenze zwischen
dem Diesseits und Jenseits bildet, so geht die Geste sinngemäß nicht
in die Höhe, um das Drüben zu zeigen. Es geht also offenbar alles
sehr relativ und okkasionell zu bei diesen Oppositionen und darum
auch bei den entsprechenden Gesten.
Unser da in der gegenwärtigen Umgangssprache wird, wenn ich meinem
eigenen Sprachgefühl vertrauen darf, mit Vorliebe für das sofort Erreichbare, sei
es mit der Hand oder mit ein paar Schritten oder unter Überwindung von Ortsentfernungen,
die man für nichts rechnet, gebraucht; einer ist da kann heißen,
er sei in Wien (zurück von den Ferien) 2)36, es kann auch heißen ‚in Sprech- oder
Greifweite’, ‚in meiner Hand’. Wenn ich einem Gesprächspartner etwas zuschiebe,
100sage ich da (oder da) nimm dies! Das dort in der Umgangssprache von heute hebt
sich von dem da als Hinweis auf etwas nicht mehr im augenblicklichen Greifbereich
oder Schrittbereich oder Blickbereich oder Straßenbahnbereich des Sprechenden
Befindliches ab. Es kommt mir vor, als wäre so etwas wie der gerade in Rede stehende
räumliche Aktionsbereich des Sprechers der geometrische Ort, worin man mit da
zu zeigen pflegt und von dem sich das dort entsprechend abhebt.
Wie es mit dem Worte ‚jener’ bestellt sei in meiner Umgangssprache, vermag
ich noch weniger scharf anzugeben. Der anaphorische und anamnestische Gebrauch
von ‚jener’ ist vielleicht noch am klarsten umrissen; da entspricht es ungefähr dem
lateinischen ille und deutet auf etwas, was nicht unmittelbar präsent ist, aber wie
ein psychoanalytischer Komplex an der Schwelle meines Bewußtseins lauert. Ein
jener im Wahrnehmungsfeld befindet sich auch heute noch in vielen Fällen deutlich,
in anderen wenigstens einigermaßen spürbar über einer Grenze oder über einer
Zwischenstation oder über einem als solchen erlebten Zwischenraum hinweg von
mir aus gesehen.
8. Man gerät bei derart subtilen Bedeutungsanalysen, die oft zu
keinerlei festem Ergebnis führen, in Zweifel darüber, ob die Jener-Deixis
eine eigene, besondere Zeigart sei im lebendigen Sprachgefühl
der Gegenwart. Und muß, wenn der Zweifel fruchtbar werden
soll, der Frage nachgehen, welches die wissenschaftlichen Kriterien
bei der Aufstellung und Umgrenzung der Brugmannschen Zeigarten
gewesen sind. Zugegeben, das System der vier indogermanischen
Positionszeigarten war ein imponierender Wurf; es steckt
nicht nur gewissenhafteste sprachhistorische und vergleichende
Materialkenntnis, sondern auch eine feine Fingerspitzen-Psychologie
darin, eine Psychologie, wie sie den Philologen als solchen geradezu
definiert. Denn Linguistik, universale Bildung und Menschenkenntnis
dürften doch wohl die Ingredienzien sein, aus denen der große
Glockengießer die genialen Philologen zu bilden pflegt. Die vier
Zeigarten Brugmanns sind geschaut und hingesetzt von einem
genialen Philologen. Geschaut, aber nicht begrifflich definiert.
Der Autor, dem wir folgen, will den Terminus ‚Zeigarten’ ungefähr
so verwendet wissen, wie man von ‚Aktionsarten’ in der Lehre vom
Verbum spricht: „man unterscheidet punktuelle, kursive usw.
Aktion. Entsprechend kann man die verschiedenen Anwendungsweisen
unserer Pronominalklasse ihre Demonstrationsarten oder
Zeigarten nennen” (9). Damit sind, wie man leicht einsieht, keine
Kriterien angegeben, an denen z. B. geprüft werden könnte, wohin
heute unser deutsches dort gehört, ob zur Der-Deixis oder zur Jener-Deixis.
Und wo einmal der Zweifel erwacht ist, ob die vier ein non
plus ultra, ein irgendwie festes System bilden, dem man keinen
Stein ausbrechen darf oder hinzuzufügen vermag, wird guter Rat
teuer. Wir werden sehen, ob die Psychologie etwas dazu sagen kann.101
§ 7. Die Origo des Zeigfeldes und ihre Markierung.
Zwei Striche auf dem Papier, die sich senkrecht
schneiden, sollen uns ein Koordinatensystem andeuten,
O die Origo, den Koordinatenausgangspunkt:
image
Fig. 4.
Ich behaupte, daß drei Zeigwörter an die Stelle
von O gesetzt werden müssen, wenn dies Schema
das Zeigfeld der menschlichen Sprache repräsentieren
soll, nämlich die Zeigwörter hier, jetzt und ich. Der
Sprachtheoretiker soll weder aus philosophischen Abgründen esoterisch
zu sprechen anfangen, noch ein ehrfürchtiges Schweigen
vorziehen, wenn ihm diese lautlich harmlosen Gebilde im Lexikon
begegnen und eine Funktionsbestimmung verlangen. Sondern er
soll nur bekennen, es sei zwar höchst merkwürdig, aber doch exakt
angebbar, wie sie im konkreten Sprechfall fungieren. Wenn ich
als Spielleiter eines Wettlaufs das Startsignal zu geben habe,
bereite ich die Beteiligten vor: Achtung! und kurz darauf sage ich
los! oder jetzt! Das astronomische Zeitzeichen im Radio ist nach
geeigneter sprachlicher Vorbereitung ein kurzer Glockenschlag.
Das geformte Wörtchen jetzt an Stelle des Kommandos los! oder des
Glockenschlages fungiert wie irgendeine andere Augenblicks-Marke;
es ist die sprachliche Augenblicksmarke. So sprechen Wörter sonst
nicht zu uns, sondern im Gegenteil: sie lenken uns ab von allem
Lautstofflichen, aus dem sie gebildet sind, und vom Akzidentiellen
ihres Auftretens; ihr Auftreten wird weder als Zeitmarke noch als
Ortsmarke in den Sprechverkehr eingesetzt. Bleiben wir bei dem
Begriffspaar Form und Stoff, das sich wie von selbst angeboten
hat. An der Lautform der Wörtchen jetzt, hier, ich, an ihrem phonematischen
Gepräge, ist nichts Auffallendes; nur das ist eigenartig,
daß jedes von ihnen fordert: schau auf mich Klangphänomen und
nimm mich als Augenblicksmarke das eine, als Ortsmarke das
andere, als Sendermarke (Sendercharakteristikum) das dritte.
Und der naive Sprechpartner hat es gelernt und nimmt sie
auch so. Problemlos; was sollte denn auch Besonderes dabei sein?
Nur der Logiker stutzt, weil solche Verwendungsweise seine Zirkel
wirklich oder nur scheinbar stört; der Logiker ist eben so, daß
ihm dies und das an der Welt in die Quere kommt. Aber auf
dem Umweg über die Koordinatenidee hoffen wir seine Bedenken
zu zerstreuen; denn mit der „Setzung” eines Koordinatensystems
hat es ja überall seine besondere Bewandtnis, wie der Logiker weiß.
In unserem Falle ist es einfach hinzunehmen, das Koordinatensystem
der „subjektiven Orientierung”, in welcher alle Verkehrspartner
102befangen sind und befangen bleiben. Jeder benimmt sich wohlorientiert
in dem seinigen und versteht das Verhalten des anderen.
Wenn ich, Nase gegen Nase als Kommandant vor einer ausgerichteten
Front von Turnern stehe, wähle ich konventionsgemäß die Kommandos ‚vor,
zurück, rechtsum, linksum’ adäquat nicht meinem eigenen,
sondern adäquat dem fremden Orientierungssystem, und die Übersetzung
ist psychologisch so einfach, daß jeder Gruppenführer sie
beherrschen lernt. Daß das klappt, und zwar ohne Denkakrobatik
klappt, ist Faktum, und daran wird keine Logik etwas ändern
können; wenn sie ihre wahre Aufgabe versteht, versucht sie es auch
gar nicht. Nehmen wir, was gute Logiker über die Zeigwörter gesagt
haben, voraus und schicken die linguistischen Befunde nach.
1. Eigenartig, wie zwanglos sich im Hauptpunkt zusammenfügt,
was die Logik der antiken Grammatiker und die moderne
Logistik über die Zeigwörter lehren. Jene stellte fest, daß die
deiktischen Wörter nicht wie die Nennwörter eine Wasbestimmtheit
(ποιότης) angeben, und diese bestreitet, daß sie ebenso einfach
objektiv definierbare Begriffszeichen sind wie die anderen Wörter.
Mit vollem Recht, und beides gehört innerlich zusammen. Ein für
den intersubjektiven Austausch brauchbares „Begriffszeichen” muß
die Eigenschaft haben, daß es im Munde jedes und aller als Symbol
für denselben Gegenstand verwendet wird, und das ist (wenn wir
vorerst von den Eigennamen absehen) nur dann der Fall, wenn das
Wort eine Wasbestimmtheit des Gegenstandes trifft; d. h. wenn es
dem Gegenstand beigelegt, für ihn verwendet wird, sofern er die und
die nicht grundsätzlich mit dem Gebrauchsfall wechselnden Eigenschaften
hat. Das gilt für kein Zeigwort und kann auch gar nicht
gelten. Denn ich kann jeder sagen und jeder, der es sagt, weist auf
einen anderen Gegenstand hin als jeder andere; man braucht so
viele Eigennamen als es Sprecher gibt, um in der Weise, wie das
Nennwörter vollbringen, die intersubjektive Vieldeutigkeit des
einen Wortes ich in die vom Logiker geforderte Eindeutigkeit sprachlicher
Symbole überzuführen. Und genau so ist es im Prinzip mit
jedem anderen Zeigwort auch.
Wo es anders zu sein scheint, wie bei dem Worte hier, mit dem
alle Wiener auf Wien und alle Berliner auf Berlin hinweisen, da
liegt das nur an einer leicht durchschaubaren und den Logiker nicht
befriedigenden Laxheit oder Unbestimmtheit der erweiterten Bedeutung
dieses Positionszeigwortes. Streng genommen wird mit
hier die momentane Position des Sprechers angezeigt und diese
Position kann mit jedem Sprecher und mit jedem Sprechakt wechseln.
103Ebenso ist es völlig dem Zufall anheim gegeben, ob ein zweimal verwendetes
du zweimal auf den Träger desselben Eigennamens hinweist
oder nicht; in dem Verwendungsstatut des Wortes du ist
jedenfalls keine Garantie für ein derartiges Zusammentreffen enthalten.
Und darauf allein kommt es bei der vom Logiker geforderten
Zuordnungskonstanz von Sprachsymbolen und Gegenständen an.
Wo sie vorhanden ist, liegen Nennwörter, wo sie nicht vorhanden
ist, liegen keine Nennwörter vor. Das ist in der Tat eine klare Trennung
und eine inappellable Entscheidung der Logik in der Frage,
ob ich und du und alle anderen Zeigwörter zu den Sprachsymbolen
im Sinne des Logikers gerechnet werden dürfen oder nicht. Die
Logistik ist im Recht, wenn sie im ersten Anlauf die Zeigwörter aus
der Liste der im intersubjektiven Verkehr brauchbaren Begriffszeichen
(und damit aus der Liste der sprachlichen ‚Symbole’) ausstreicht.
Verachtet mir die Meister nicht! Zum Beckmesser braucht
man dar ob noch lange nicht zu werden.
Es gibt in jeder Kunst und Wissenschaft Beckmessereien;
ich will hier eine berühren, die im Schöße der neuesten Logik entstanden
ist und rasch wieder von ihr abgestoßen werden sollte.
Die neueste Entwicklung hat in der Logik imponierende Fortschritte
gezeitigt; man hat (ich denke vor allem an Russell) eine Reinigung
und Verallgemeinerung und damit eine Leistung vollbracht, die des
Vergleiches mit der Schöpfung der Logik durch Aristoteles würdig
ist. Die Dinge sind auch für die Sprachtheorie von hohem Interesse,
wie wir sehen werden. Aber folgendes bedarf der Ausmerzung.
Einige verdienstvolle Logistiker (nicht Russell selbst) sind geneigt,
nach der Entscheidung, die wir besprochen und gebilligt haben, dem
ich und du (und, wenn sie konsequent genug sind, auch allen anderen
Zeigwörtern) zum mindesten, soweit die Wissenschaft mit ihrer
Höchstkultur der sprachlichen Darstellung reicht, so etwas wie eine
Ausrottungsabsicht anzukündigen. Sogar die Psychologie müsse
diese ‚sinnleeren’ Wörter entbehren lernen, um eine echte Wissenschaft
zu werden, das wird heute von einigen Psychologen und vielen
Nichtpsychologen mit Pathos und Überzeugungskraft gelehrt. Ja
sogar die Umgangssprache, angefangen von der Kinderstube, wo
sie gelernt wird, sollte letzten Endes gereinigt werden von diesen
vermeintlichen Überbleibseln aus einer überwundenen Phase der
Menschheitsgeschichte; denn sie seien Schlupfwinkel der Metaphysik.
Wozu denn noch das ich und du, wenn das sprechenlernende Kind
selbst anfangs seinen Eigennamen an Stelle des viel schwierigeren
ich verwendet?104
Versteht sich, daß kein Denker von wissenschaftlichem Gewicht
und einiger Menschenkenntnis, wenn er solche Gedanken über die
Sprache im Busen hegt und gelegentlich auch laut werden läßt, sich
einer Täuschung über den vorerst rein akademischen Charakter seiner
Zukunftswünsche hingibt. Allein sie sind doch da, und es liegt ihnen
eine im Grunde so einfache, aber radikale Verkennung der Mannigfaltigkeit
praktischer Bedürfnisse, denen die Umgangssprache gerecht
werden muß und faktisch gerecht wird, zugrunde, daß man es
einem Psychologen und Sprachtheoretiker nachsehen muß, wenn er
am systematischen Ort d. h. eben bei der Betrachtung der Zeigwörter
eine Bemerkung einfügt, die wie ein Plädoyer für sie aussehen
mag. Letzten Endes wird auch diese Bemerkung etwas zur Förderung
der Sprachtheorie beitragen können.
Wo steht geschrieben, daß eine intersubjektive Verständigung
über die Dinge, so wie sie die Menschen brauchen, nur auf dem einen
Weg über Nennwörter, Begriffszeichen, sprachliche Symbole möglich
ist? Ein solches Axiom ist das proton Pseudos der Logiker, die ich
im Auge habe. Es soll hier kein Wort über die wissenschaftliche
Sprache und ihren Aufbau gesagt sein; darin stimme ich weitgehend
mit ihnen überein und will nur anmerken, daß sie sich die Sache
mit dem ‚Ich’ in der Psychologie doch wohl zu einfach vorstellen.
Doch hier nicht mehr darüber; es geht nur um das Wörtchen ich
und seine Artgenossen in der Alltagssprache. Die Neuzeit hat im
Unterschied von den besten Sprachtheoretikern des Altertums
faktisch in das Sprachzeichen ich etwas zu viel an philosophischen
Spekulationen hineingedacht. Befreit davon steckt gar keine Mystik
mehr darin. Die Theorie muß von der schlichten Tatsache ausgehen,
daß eine demonstratio ad oculos und ad aures das einfachste und
zweckmäßigste Verhalten ist, das Lebewesen einschlagen können,
die im sozialen Kontakt eine erweiterte und verfeinerte Berücksichtigung
der Situationsumstände und dazu Zeigwörter brauchen.
Wenn A, der Partner von B, auf einer Jagd zu zweien das Wild
nicht rechtzeitig sieht, was könnte da einfacher und zweckmäßiger
sein als eine to-deiktische Geste des B und das dazugehörige Wort,
welches den A akustisch erreicht? Wenn A den B aus dem Auge
verloren hat, was könnte ihm dienlicher sein als ein hier aus dem
Munde von B mit klarer Herkunftsqualität? usw.
Kurz gesagt: die geformten Zeigwörter, phonologisch verschieden
voneinander wie andere Wörter, steuern den Partner in
zweckmäßiger Weise. Der Partner wird angerufen durch sie, und
sein suchender Blick, allgemeiner seine suchende Wahrnehmungstätigkeit,
105seine sinnliche Rezeptionsbereitschaft wird durch die
Zeigwörter auf Hilfen verwiesen, gestenartige Hilfen und deren
Äquivalente, die seine Orientierung im Bereich der Situationsumstände
verbessern, ergänzen. Das ist die Funktion der Zeigwörter im
Sprechverkehr, wenn man darauf besteht, diese Funktion auf eine
einzige allgemeine Wortformel zu bringen. Diese Formel gilt für
alle Zeigarten Brugmanns und für alle Modi des Zeigens; für
das anaphorische und die Deixis am Phantasma genau so gut wie
für die ursprüngliche Art, die demonstratio ad oculos.
Es gibt zum mindesten eine Zeigart, von der man sich kaum
vorstellen kann, daß sie in irgendeiner Menschensprache ganz und
gar fehlen sollte. Das ist die Der-Deixis im Sinne Brugmanns. Im
logistischen Symbolsystem, das ja auch eine Sprache ist, fehlt zwar
die demonstratio ad oculos mit Hilfe to-deiktischer Zeichen, nicht
aber deren anaphorischer Gebrauch. Denn Wörter wie demnach, also
u. dgl. m. zurückverweisende Zeichen, die in jedem Beweisgang vorkommen,
sind Zeigzeichen. Man kann irgendwelche optische Symbole
für sie einführen, das ändert nichts an der Tatsache ihrer Unentbehrlichkeit.
Und wenn man an irgendeine illustrative geometrische
Figur, sagen wir an die Ecken eines Polygons, wie üblich,
Buchstaben schreibt, so ist das eine echte Deixis ad oculos. Denn
der Symbolwert dieser dann im Texte verwendeten Buchstaben
kann immer nur durch einen Hinblick auf die Figur, also wahrnehmungsmäßig
festgestellt werden. Jeder Buchstabe sagt ‚sieh
her! ich meine dies’.
Die Umgangssprache demonstriert häufiger, mannigfaltiger,
sorgloser als die Wissenschaft, das ist wahr. Aber sie erfüllt damit
ohne allzuviele Mißverständnisse und auf kürzestem Wege die elementarsten
praktischen Mitteilungsbedürfnisse der Menschen. Der
Vorwurf einer unheilbaren Subjektivität, den man immer wieder
gegen Wörter wie ich und du machen hört und konsequent von ihnen
auf alle Zeigwörter ausdehnen darf, beruht auf einem mißverstandenen
Anspruch, den man von den Nennwörtern her auch an die Zeigwörter
stellt. Sie sind subjektiv in demselben Sinne, wie jeder Wegweiser
eine ‚subjektive’, d. h. nur von seinem Standort aus gültige
und fehlerfrei vollziehbare Angabe macht. Die Wegweiser rund um
eine Stadt zeigen alle eine objektiv (geographisch) verschiedene
Richtung an unter Verwendung eines und desselben Zeichens, nämlich
eines ausgestreckten Armes. Und wenn sie hier sagen könnten,
gäbe dies eine Wort wieder ebensoviele verschiedene Positionen an
wie das hier aus Menschenmunde. Mit dem ich ist es genau so.106
Wer kritisch gegen Wörter wie hier und ich und jetzt als Verkehrszeichen
den Einwand einer unheilbaren Subjektivität vorbringt,
muß von den Verkehrsvereinen auch die Entfernung sämtlicher
Wegweiser alten Stils verlangen; oder er muß einsehen, daß er sich
von einem unhaltbaren, weil zu engen Axiom eine voreilige Meinung
über den Sinn jener Wörter hat eingeben lassen. Das sprachtheoretische
Axiom, daß alle Sprachzeichen Symbole derselben Art sein
müssen, ist zu eng; denn einige darunter wie die Zeigwörter erweisen
sich als Signale. Und von einem Signal darf man nicht dasselbe
verlangen wie von einem (reinen) Symbol, weil zwischen beiden ein
sematologischer Unterschied besteht. Die Zeigwörter sind eine
eigene Klasse von Signalen, nämlich Rezeptionssignale (verschieden
von den Aktionssignalen, zu denen der Imperativ gehört). Ein der
oder ich löst eine bestimmte Blickwendung u. dgl. und in ihrem
Gefolge eine Rezeption aus. Der Imperativ komm dagegen ist berufen,
eine bestimmte Aktion im Hörer auszulösen. Psychologisch
Subtileres über die Ordnung, das Koordinationssystem, in welchem
die Zeigwörter als Signale klaglos fungieren, folgt im nächsten
Paragraphen.
2. Von der Origo des anschaulichen Hier ans werden sprachlich
alle anderen Positionen gezeigt, von der Origo Jetzt aus alle anderen
Zeitpunkte. Es ist vorerst von nichts als vom Zeigen die Rede;
selbstverständlich können Positionen, wie alles andere in der Welt,
auch durch sprachliche Begriffszeichen angegeben werden. Eine
Rede wie ‚die Kirche neben dem Pfarrhaus’ bestimmt die Position
des einen Dinges vom anderen aus und verwendet dazu ein waschechtes
Begriffswort, die Präposition neben; die Präpositionen im
Indogermanischen sind selbst keine Zeigwörter, gehen aber häufig
eine Wortehe mit Zeigwörtern ein. So entstehen Komposita vom
Typus ‚daneben, danach, hiebei’ und freie Gruppen vom Typus
‚von jetzt an, auf mich zu’. In diesen Fügungen wird häufig eine
Deixis am Phantasma vollzogen oder sie fungieren zeigend im Modus
der Anaphora; es ist zweckmäßig, ihre Behandlung an die Stelle
zu verschieben, wo nach einer psychologischen Untersuchung der
Zeigmodi die Frage allgemein genug beantwortet werden kann, in
welchen Formen sich Zeigen und Nennen zugleich, sei es durch ein
einfaches Wort oder durch ein zusammengesetztes, vollbracht wird.
Wir denken nach dieser wichtigen Abscheidung wieder an die
Grundzeigwörter hier, jetzt, ich in ihrer sozusagen absoluten Funktion
als sprachliche Ortsmarke, Zeitmarke, Individualmarke. Die Kenner
des Indogermanischen belehren uns, daß die Personalsuffixe am
107Verbum und die isolierten Personalia wie ich und du im allgemeinen
abgehoben sind von den (örtlichen) Positionszeigwörtern. Doch
gibt es semantische und Form-Tatsachen genug, an denen eine Abstammungsgemeinschaft
und vielfache Kreuzungen der beiden
Klassen hervortreten. Noch deutlicher kommt ein solches Hinüber
und Herüber in der Geschichte der für das Indogermanische äußerst
charakteristischen ‚dritten’ Person zum Vorschein; ich zitiere aus
dem Standardwerk der vergleichenden Grammatik von Brugmann-Delbrück:
„Zwischen diesen beiden Gruppen bestehen deutliche Zusammenhänge und
Übergänge. Zunächst sind die Pronomina der dritten Person von den Demonstrativa
nicht rein zu trennen und fallen begrifflich nicht selten mit ihnen zusammen
(von mir gesperrt). Sie sind, wie man sagen dürfte, Demonstrativpronomina
in substantivischer Funktion, die auf in Rede Stehendes, auf Ausgesprochenes
oder sofort Auszusprechendes, hinweisen [Zeigwörter in anaphorischem Gebrauch
also], z. B. franz. il aus lat. ille, oder got. is = nhd. er, mit lat. is identisch. Aber
auch die Ich- und Du-Pronomina scheinen wenigstens zum Teil ursprünglich Demonstrativa
gewesen zu sein, indem z. B. griech. έμον usw. etymologisch mit ai.
áma-h, der hier, dieser hier, oder ai. te griech. τοι lat. tibi usw. etymologisch mit ai.
tá-m griech. τόν (Hinweis auf Angeredetes als auf etwas nicht zur Ichsphäre Gehöriges,
aber geradeaus vor dem Sprechenden Befindliches) zusammengehören
dürfte” (2. Bd., 2. Teil in 2. Aufl., S. 306f.).
Das ist psychologisch bedacht alles eher denn überraschend;
ich stelle einen historischen Sonderfall, der mir psychologisch aufschlußreich
zu sein scheint, dazu; es ist der sogenannte persönliche
Artikel im Armenischen:
Brugmann berichtet darüber im Anschluß an W. von Humboldt und
Meillet das Folgende: „Der Armenier gebraucht… kein demonstratives Pronomen,
ohne daß sich damit zugleich mehr oder minder deutlich die Vorstellung der ersten,
der zweiten oder der dritten Person verbände. Die betreffenden drei Elemente sind
s, d und n. Einem Nomen, Personalpronomen oder Verbum angehängt, fungieren
sie als sogenannter persönlicher Artikel, ter-s ‚der Herr hier, dieser Herr’ kann auch
sein ‚ich der Herr’.” „tēr-d ‚der Herr da’ kann auch sein ‚du der Herr’” „Wo keine
Beziehung zur ersten oder zweiten Person vorliegt, tritt ein -n ein, welches die
häufigste Artikelform ist.” „Als selbständige Formen gehören dazu ai-s für die erste
Person, ai-d für die zweite, ai-n für die dritte” (S. 43).
Diesem Bericht über das Armenische muß, wie ich von einem Kenner mündlich
erfahren habe, hinzugefügt werden, daß überall, wo es darauf ankommt, geformte
Diakritika anderer Art zwischen ‚ich der Herr’ und ‚der Herr hier’ usw. zur
Verfügung stehen 1)37; es wäre ja auch einigermaßen verwunderlich, wenn eine moderne
indoeuropäische Sprache ohne solche Diakritika auskommen sollte. Immerhin gibt
es Konjekturen über dies und das im Bestände der Zeigwörter des Urindoeuropäischen,
die das Fehlen solcher Diakritika anzunehmen scheinen.108
Eine der lehrreichsten Hypothesen dieser Art, die ich bei Brugmann gefunden
habe, ist die über die Herkunft des lateinischen hic, das unbestritten zwei
Bestandteile enthält, die uritalisch *hĕ-ke oder *hŏ-ke oder *Kă-ke gelautet haben
dürften. Ist der zweite Bestandteil ein allgemeines Hinweis-Zeichen, so dreht sich
die weitere Diskussion um die Frage: „Wie ist nun *ho- etymologisch unterzubringen?”
Und da kann man nun sehen, wie in einer der beiden Hypothesen, die Brugmann
ernst nimmt, aus einem offenbar noch undifferenzierten Zeigwort *ğho zwei Übergänge
konstruiert werden, von denen der eine zu dem griechischen έγώ έγών und
lateinischen ego, der andere zu dem *ho- in hic führt. Das lateinische hic neben ego
am Ende der Entwicklung kann wohl nicht wesentlich anders als unser hier neben
ich ausgelegt werden, d. h. so, daß es hauptamtlich den Positionshinweis neben dem
davon getrennten Personalhinweis des ego erfüllt. Mag sein, daß es seinen ursprünglichen
Gebrauch am nächsten kommt in Sätzen wie ‚tu si hie sis aliter sentias’.
Und dieses hie übersetzt Brugmann mit ‚ich hier’.
Das psychologisch Relevante in dieser interessanten Hypothese (von Windisch,
J. Schmidt, Brugmann) wäre also im Sinne unserer phänomenologischen
Analyse sehr kurz so zu fassen, daß ein vermutlich ambivalentes *ğho zu den zwei
differenzierten Wörtern hic und ego fortgebildet wurde. Auf dem einen Weg durch
Verbindung mit einer allgemeinen Hinweis-Partikel -ce, die auch sonst im Lateinischen
noch lebendig ist, und auf dem anderen Weg durch eine „analogische Neuerung”
(Schmidt). Ich bringe diese Bemerkung nur, um an einem Beispiel zu zeigen, daß
und wie man linguistisch arbeiten kann mit dem Modell, das wir durch schlichte
phänomenologische Analyse der Verhältnisse gefunden haben. Was ich allgemein
sagen will, hängt nicht davon ab, ob die als Beispiel verwendete Hypothese richtig
ist oder nicht. Jedenfalls findet die Sprachvergleichung eine Stammverwandtschaft
der indogermanischen Wörter, die der Brugmannschen ‚Hier-Deixis’ dienen und
den Pronomina der ersten Person.
Wozu der Psychologe das Wort ergreift, um zu sagen, das sei
phänomenologisch so sehr verständlich, daß man es nahezu rückwärts
prophezeien könnte. Denn es sei an der Verwendung jedes
akustischen Verkehrssignals abzulesen, daß zwei Momente an ihm
relevant werden, nämlich erstens seine (räumliche) Herkunftsqualität
und zweitens sein akustischer Gesamtcharakter. Und die
Lautzeichen der Sprache gehören doch psychologisch zu den akustischen
Verkehrssignalen. Für einen sehenden Signalempfänger ist
nichts natürlicher, als daß er sich der Schallquelle zuwendet. Die
ist bei sprachlichen Verkehrszeichen der Sprecher und steht am Ort
des Sprechers. Das hier und das ich verlangen diese Reaktion gemeinsam
oder legen sie zum mindesten nahe. Soweit geht das Identische
in ihrer Funktion als Zeigwörter. Dann aber spaltet sich die
Intention (das Interesse), das sie empfehlen, um das eine Mal die
Position und Milieuumstände des Senders und das andere Mal den
Sender selbst mit physiognomischem oder pathognomischem Blick
zu erfassen. Ein hier enthält die Aufforderung, an der Wegscheide
die erste, und ein ich enthält die Aufforderung, an der Wegscheide die
109zweite Interessenrichtung zu verfolgen. Das ist die voraussetzungsärmste
und allgemeinste Analyse, die man zu bieten vermag. Es
ist (nebenbei gesagt) eine möglichst objektivistisch gehaltene
Analyse, die auf das Erlebnis des Sprechers noch gar nicht näher
eingeht.
Nichts natürlicher demnach als das Faktum, daß es Phasen
in der Sprachentwicklung gibt, wo die Differenzierung an dieser
Wegscheide noch nicht eingetreten ist. Vielleicht wissen die Sachverständigen
von ganzen Sprachstämmen zu berichten, für die das
zutrifft. Jedenfalls aber gehört im Bereich des Indogermanischen
das nachgewiesene armenische ter-s und das hypothetisch vermutete
urindogermanische *ğho dazu. Ich weiß von einem deutschen
Kinde zu berichten, das in dem Stadium, wo es sich um die Rezeption
und richtige Verwendung des Ich-Wortes bemühte und in einer
Situation, wo es wieder einmal hier und ich verwechselt hatte und
von dem erwachsenen Gesprächspartner lachend korrigiert worden
war, ärgerlich diese Schrulle der Erwachsenen abwies. Wenn die
Entwicklungsregel eines Fortschritts aus weniger differenziertem
zu reicherem Formenschatz sinngemäß angewendet werden darf,
so ist der historische Befund eines indogermanischen Hauptstammes
*ko-*ki- (*kio-), aus welchem nach der Auffassung der Sachverständigen
die meisten Zeigwörter der Hier-Deixis (und doch wohl
auch der Ich-Deixis) hervorgegangen sind, parallel zu der Beobachtung
an jenem Kinde zu interpretieren. Der *ko-Stamm „erscheint
in sämtlichen Sprachzweigen außer dem Arischen” stellt
Brugmann fest 1)38.110
3. Wenn die immer wieder geforderte gegenseitige wissenschaftliche
Handreichung zwischen Psychologie und Linguistik
Früchte zeitigen soll, so müssen die Fachmänner auf beiden Seiten
den Mut aufbringen, jeder dem anderen ins Konzept zu sprechen.
Keiner vermag sich selbst dem Gesetz von der beschränkten menschlichen
Fassungskraft zu entziehen. Ein Psychologe hat hier dargelegt,
wie er bestimmte linguistische Tatbestände psychologisch
zu interpretieren vorschlägt. Sollte dies und das schief oder unvollständig
von ihm aufgegriffen sein aus der Linguistik, dann wird
von drüben her eine fachmännische Korrektur am Platze sein und
die Diskussion um einen Schritt weiter bringen. Am besten die
Antwort spricht umgekehrt gleich selbst in das Konzept des Psychologen
hinein, wie es vorbildlich von Brugmann geschehen ist.
Seine phänomenologische Analyse der allgemein menschlichen
Sprechsituation und der Faktoren, die in ihr das einzelne Sprachzeichen
oder ganze Komplexionen von Sprachzeichen aufnehmen
und sinnbestimmend determinieren, ist vorzüglich. Es fehlt ihr nichts
als die letzte sprachtheoretische Konsequenz, die daraus zu ziehen
ist. Ich zitiere:
„Sie (die Positionszeigwörter) sind nicht nur, wie jeder beliebige Bestandteil
der Rede, im allgemeinen eine Aufforderung an den Angeredeten, der betreffenden
Vorstellung seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, sondern sie sind zugleich (von mir
gesperrt) lautliche Fingerzeige, hörbare Winke, sie enthalten (wie es Wegener,
Grundfragen des Sprachlebens, S. ioo, ausdrückt) immer ein sieh her! oder ein
hier gibt es etwas zu sehen” (5).
Auffallend und des Nachdenkens wert ist in dieser Bestimmung
vor allem anderen das von mir hervorgehobene Wort ‚zugleich’
und hinzuzufügen ist, daß genau dieselbe Bestimmung und wiederum
mit dem merkwürdigen ‚zugleich’ auch für die Personalia, die
Rollenzeigwörter, von Brugmann gemacht wird. Wir behaupten:
beide sind in ihrer ursprünglichen Form nichts anderes als Zeigwörter;
das ist für den Anfang genug. Sie sind nicht nebenbei
und von ungefähr auch noch Nennwörter. So etwas kann man nicht
nebenbei und wie zur linken Hand auch noch sein. Ein paar Sätze
vorher steht im Texte Brugmanns: „Mit den anderen Pronomina
haben sie gemein, daß sie einen Gegenstand nicht seiner besonderen
Qualität nach bezeichnen.” Das ist die alte Angabe, daß ihnen die
Bestimmung der Poiotes zunächst fehlt. Damit mache man ernst
und es ist alles in Ordnung. Brugmann sagt ferner:
„Die Frage, ob von Anfang an die Demonstrativa, wenn sie auf das gegenwärtig
Wahrnehmbare gingen, immer und notwendig mit hinweisenden Gesten verbunden
gewesen sind, läßt sich mit den Mitteln der geschichtlichen Forschung nicht
entscheiden” (7f.).111
Auch mit den Mitteln der psychologischen Forschung läßt sich
das dann nicht entscheiden, wenn unter ‚Geste’ nur die Fingergeste
verstanden wird. Versteht man darunter aber sachgemäß etwas
mehr als nur die Fingergeste, dann läßt sich psychologisch sogar
noch mehr entscheiden als nur die Streitfrage, wie es am Anfang
gewesen sein mag. Es läßt sich nämlich zeigen, wie es heute noch
ist und nie anders gewesen sein oder einmal werden kann. Statt der
Fingergeste können andere optische oder akustische Leithilfen verwendet
werden und statt aller zusammen können indirekt Situationsindizien
oder konventionelle Deuthilfen eintreten. Aber etwas
von dem damit Aufgezählten darf nirgends fehlen.
Und zwar einfach deshalb nicht, weil jedes Zeigwort ohne
solche Leitfäden dem Sinn nach unbestimmt ins Blaue hineingeschickt
wäre; es gäbe uns nichts anderes an als eine Sphäre,
einen „geometrischen Ort”, der uns nicht genügt, um das Etwas
darin zu finden. Man denke sofort an diejenige Verwendungsweise
der Zeigwörter, von der her der erste Widerspruch gegen unsere
These zu erwarten ist, nämlich an den anaphorischen Gebrauch.
Wo soll denn ein solcher sinnlicher Leitfaden zu finden sein, wenn
ich im Deutschen mit dieser und jener auf kurz zuvor in derselben
Rede Genanntes hinweise? Antwort: Zugegeben, ein sinnlicher
Leitfaden ist in diesem Falle nicht vorhanden. Aber an seiner Stelle
tritt die Konvention in Kraft, daß der Hörer rückblickend das zuletzt
Genannte als das nächste bei dieser und das zuerst Genannte
als das fernere bei jener wieder aufnehmen soll in seinem Denken.
Diese Konvention könnte ebensogut umgedreht werden. Dann wäre
das in der Rede schon Dagewesene noch einmal in der natürlichen
Reihenfolge zu durchlaufen und mit dieser das zuerst und mit
jener das zuletzt Genannte gemeint. Man möchte es fast vor jeder
Untersuchung für wahrscheinlich halten, daß auch diese umgedrehte
Konvention hier oder dort in Sprachgemeinschaften
usuell ist.
Auf jeden Fall wird deutlich, was zum Ersatz sinnlicher Leitfäden
der Deixis dienen kann. Es ist, wo phonematische Hilfen
wie die Kongruenz u. dgl. m. fehlen, ein Ordnungsschema aus
dem Bereich des Zeigfeldes. Dieser Begriff wird später noch im
Detail zu erläutern sein. Wenn ich einem Fremden auf der Straße
sage: ‚Gehen sie gerade aus, die zweite Querstraße rechts ist, was
sie suchen’ — dann verfahre ich im Prinzip genau so, wie bei der
Benützung eines derartigen Ordnungsschemas an Stelle eines sinnlichen
Leitfadens der sprachlichen Deixis. Denn ich benütze das
112vor uns beiden liegende Straßennetz als Ordnungsschema und darin
die zufällige oder von mir absichtlich hergestellte Raumorientierung
des Fragenden; in diesem Koordinationssystem spreche ich zu ihm.
Die Wörter ‚gerade aus’ und ‚rechts’ in meiner Rede wären gar
nicht eindeutig, wenn der Fremde nicht mit der Nase schon dahin
gerichtet wäre, wohin er gehen soll.
4. Dann das ich und das du. Es ist ein gesunder und fruchtbarer
Grundsatz der Wortforschung, die Ausgangsbedeutung in
der sinnlichen Anschauung zu suchen. Jeder Mensch kann mich
ansprechen und ich sagen. Ich werde ihn ansehen oder, wo dies
unmöglich ist, nur hinhorchen auf den Sprecher. Daß es geschehe
mit physiognomischem oder pathognomischem Blick, dies und nichts
anderes ist die Ausgangsbedeutung von ich, ist seine Urfunktion.
Die Wörter ich und du weisen kurz gesagt auf die Rollenträger im
aktuellen Sprechdrama, auf die Rollenträger der Sprechhandlung
hin. Die Griechen hatten in dem Worte Prosopon einen ausgezeichneten
Namen dafür und die Lateiner meinten mit persona auch
nichts anderes als die Rolle im Sprechakt. Auf diese antike Bedeutung
des Namens persona muß die Sprachtheorie mit voller
Klarheit und Konsequenz zurückgreifen. An Brugmann-Delbrück
ist an diesem Punkte nichts auszusetzen, sondern nur die
Forderung nach Konsequenz zu erheben. Die Personalia, z. B. ich
und du, bezeichnen im Hauptberuf und von allem Anfang an nicht
den Sender und Empfänger der Sprachbotschaft wie die Namen
Bezeichnungen sind, sondern sie weisen nur hin auf diese Rollenträger
in dem Sinne, wie das treffend schon bei Apollonius steht.
Gewiß, wenn ein Bekannter ich zu mir sagt, klingt mehr an,
und wenn einer vor der Türe draußen auf meine Frage ‚wer da’
mit ich antwortet, so verläßt er sich darauf, daß ich ihn am Klange
seiner Stimme aus der Schar meiner näheren Bekannten heraus
individuell erkenne. Das phonologisch geprägte und von allen
anderen Wörtern der deutschen Sprache genügend scharf abgehobene
Formgebilde ich erklingt phonologisch gleichförmig aus Millionen
von Mündern. Nur die Stimmaterie, das Klanggesicht, individualisiert
es und das ist der Sinn der Antwort ich meines Besuchers
vor der Türe, daß das phonematische Gepräge, das sprachliche
Formmoment an seinem ich mich, den Fragenden, auf den Stimmcharakter
hinweist. Zugegeben, daß dies eine sehr merkwürdige
Relation ist; die Form eines Etwas ist dazu da, auf die Besonderheit
des Stoffes, an dem die Form realisiert ist, hinzuweisen. Doch steht
diese Relation nicht ganz so isoliert in der Welt, wie man denken
113könnte. Es sei hier aber der Kürze halber auf die Erörterung illustrierender
Parallelbeispiele verzichtet.
Noch einmal: die Funktion dieses geformten Sprachgebildes
als Verkehrsmittel erschöpft sich in dem einfachen und durchsichtigen
Fall, den wir fingiert haben, der Hauptsache nach darin, daß es den
physiognomischen ‚Blick’ des Empfängers auf den Stimmcharakter
lenkt. Gleichviel ob mit Auge und Ohr zugleich oder nur mit dem
Ohr, der Empfänger soll wahrnehmend den Sender erfassen. Nichts
also von dem Wer oder Was des zu Erfassenden ist der Wortform
als solcher bedeutungsmäßig zugeordnet. Darum ist ich fürs erste
kein Name. Aber der Klangmaterie, durch die das der Form nach
identische Wort ich jetzt so und dann aus einem anderen Munde
wieder anders realisiert wird, ist allerhand abzuhören. Unser Sender
vor der Türe verläßt sich darauf, daß er individuell an dieser Materie
erkannt wird. Was diesem Zeigwort ich an neuen Funktionen im
Satzzusammenhang aufgegeben wird und was Psychologen und
Philosophen daraus machen, wenn sie es zum wissenschaftlichen
Begriffswort erwählen, gehört nicht hierher.
Man denke zum Vergleich noch an die Funktion des Eigennamens,
der wirklich ein Name ist; mein Besucher vor der Türe
produziere, wenn er an der Stimme nicht erkannt wird, seinen Eigennamen.
(Das ganze Vorspiel mit dem ich hat er überhaupt nur, so
sei zu seiner Rechtfertigung angenommen, zur Belehrung der
Sprachtheoretiker aufgeführt). Der Eigenname ist ein Sprachgebilde,
das im Kreise derer, die es kennen und verwenden, seiner
Form nach berufen ist, als Individualzeichen zu fungieren. J. St.
Mill illustriert die Funktion der Eigennamen an der berühmten
Räubergeschichte aus Tausend und eine Nacht, wo einer aus der
Bande einen Rötelstrich an dem Stadthaus anbringt, um es, wenn
er mit seinen Genossen zurückkäme, aus der Schar der Häuser
wieder zu erkennen. Genau so wie dieser Rötelstrich erschöpft sich
die Funktion des Eigennamens nach J. St. Mill als Diakritikon,
als reines Individualzeichen, während der Artname eine „connotation”
enthält. Das letztere geht uns noch nichts an. Jedenfalls
aber erkennt man den Charakter des Eigennamens als eines Nennwortes
daran, daß dies Sprachzeichen aus irgend welchen Sprechers
Munde kommen kann, die Lautmaterie in ihm ist irrelevant für
seine Nennfunktion. Nicht an dem Stimmcharakter, sondern an
der phonematischen Prägung haftet die Funktion des Eigennamens
als Individualzeichen. Situationsmäßig äquivalent ist ihm das
ich meines Besuchers vor der Türe nur dann, wenn man in der
114Äußerung ich den diakritischen Wert des Stimmcharakters dazurechnet.
Genug, wenn die primäre Bedeutungserfüllung des ich an
einem einzigen Beispiel begrifflich erläutert ist. Mit dem du ist
es ähnlich. Nur muß man bei ihm theoretisch von vornherein auch
die Fälle ins Auge fassen, wo es als so gut wie reines Appellwort
verwendet wird: du (paß mal auf), ich will dir was sagen. Das ist
ein Auftakt im Nahverkehr, der mit einem Appellwort beginnt und
dann die Rollen der angekündigten Sprechhandlung verteilt. Man
kann einfach genug mit dem Ton eines solchen appellierenden du
auch ein Ausdrucks- und Aufforderungsregister ziehen, wie man es
im Prinzip mit dem Ton und anderen Modifikationen bei jedem
Worte ziehen kann. Das gehört in ein anderes Kapitel der Sprachtheorie
und soll uns hier nicht beschäftigen. Die einigermaßen reine
Zeigfunktion des du scheint in solchen Wendungen des Gespräches
auf, wo sich der Sender versucht fühlt, das Wort mit einer Fingergeste
oder anderen anschaulichen Zielmitteln eindeutig zu machen.
Ein du da; du dort u. dgl. m. unterscheidet sich in solchen Fällen
von dem dér da, dér dort nur durch das Prosopon im Sinne der griechischen
Grammatiker. Daß es überhaupt ein drittes Prosopon gibt
und daß ihm sowohl in den reinen, d. h. von Positionszeigwerten
freien Personalzeigwörtern wie er, sie, es als auch in den Positionszeichen
wie dér, die, dás das Diakritikon des grammatischen Geschlechtes
verliehen wird, ist eine Angelegenheit der indogermanischen
Sprachen, die nicht mehr zu dem engeren Thema der Zeigwörter
gehört, wie wir es uns hier abgegrenzt haben. Das ich und du
könnten ebenso behandelt werden und das dritte Prosopon könnte
ganz fehlen. Die Positionszeigwörter der Brugmannschen Der-Deixis
wären dann sowohl in der demonstratio ad oculos wie im
anaphorischen Gebrauch rein „unpersönliche” Zeigwörter, wie sie
es vielleicht faktisch einmal in den indogermanischen Sprachen,
als sie noch den Charakter indeklinabler ‚Partikeln’ hatten, gewesen
sind.
5. Über die Herkunft der heute in mehreren Wortklassen anzutreffenden
deiktischen Wörter ist man im Kreise der Historiker,
soweit ich sehen kann, derselben Meinung. Bei Brugmann-Delbrück
wird die übliche Lehre so gefaßt:
„Vielleicht sind alle Demonstrativa einmal deiktische Partikeln, also indeklinable
Wörter gewesen. Sie traten, wenn der Gegenstand zugleich genannt
war, vor oder hinter seine Bezeichnung. Dergleichen Partikeln finden sich in attributiver
Verbindung mit Substantiva auch noch vielfach in den historischen
Perioden der indogermanischen Sprachen, z. B. nhd. der mensch da, da der mensch,
115du da. Für diesen Ursprung der deklinierten Pronomina läßt sich mehreres geltend
machen” (311).
Gewiß, und die von Brugmann selbst angeführten Gründe
scheinen mir sehr gewichtig zu sein (s.. bes. S. 307ff.). Die Frage des
Systematikers aber lautet, ob solche indeklinable deiktische Partikeln
auch schon für Namen stehen und darum mit Recht Pronomina
genannt werden dürfen oder nicht. Wer diese Frage, verneint, muß
konsequent genug sein und anerkennen, daß die ganze Klasse nicht
durch das Merkmal der pronominalen Verwendung, sondern durch
das Merkmal der deiktischen Funktion zusammengehalten wird. Am
deutlichsten wird dies, wenn man die Konjunktionen daneben hält.
Um den wohl nie verkannten deiktischen Gehalt der Konjunktionen
mit den Worten eines Sachverständigen festzulegen,
sei ein Zitat aus der lateinischen Grammatik von Stolz-Schmalz
eingefügt:
„Die Bindewörter (Konjunktionen) lassen sich einteilen in ursprünglich hinweisende
(deiktische, sowohl bei- als unterordnend) und in rein verknüpfende (der
Fortsetzung [und], Steigerung [auch] oder dem Gegensatz [jedoch] dienende, meist
beiordnend); ein scharfer Gegensatz besteht zwischen beiden Gruppen schon deswegen
nicht, weil viele rein verknüpfende Konjunktionen (vgl. nam, tarnen u. a.)
aus demonstrativer Grundlage unter Verflüchtigung ihres deiktischen
Sinnes erwachsen sind”. 5. Aufl. von J. B. Hofmann, S. 653, die Sperrung
am Ende und die deutschen Beispiele in […] von mir; den deiktischen Gehalt
der Konjunktionen erkennt auch Kalepky, Neuaufbau der Grammatik (1928),
S. 55ff.; er nennt sie ‚Markierwörter’.
Auch dies steht in völliger Harmonie mit der schlichten phänomenologischen
Analyse. Man braucht mit dem Autor nicht einmal
darüber in Streit zu geraten, ob er wirklich im Lateinischen Konjunktionen
nachweisen kann, die nicht ursprünglich deiktische
Partikeln waren, wenn nur das mit der ‚Verflüchtigung’ so verstanden
werden darf, daß die schärfste Analyse heute immer noch
etwas von dem Verflüchtigten verspürt und feststellt.
Schließlich wird, wenn man bei Brugmann-Delbrück alle
Sonderklassen, die dem Oberbegriff ‚Pronomina’ eingeordnet sind,
einzeln daraufhin durchsieht, immer wieder irgendwo gesagt, sie
seien einmal Zeigwörter gewesen oder seien es jetzt noch nebenbei:
So heißt es z. B. über die Relativa:
„Als Relativum fungiert seit urindogermanischer Zeit der Stamm *i̯o-,
*i̯o-s, *i̯a, *i̯o-d”. „i̯o-s war dann ursprünglich ein anaphorisches Demonstrativum
(von mir hervorgehoben), das auf einen nominalen oder pronominalen Substantivbegriff
des vorausgehenden Satzes hinwies” (347).
Schön; und die phänomenologische Analyse würde von einem
weit und exakt genug gefaßten Begriff des Anaphorischen ausgehend
116feststellen, daß die Relativa ihren deiktischen Beruf niemals eingebüßt
haben, sondern ihn bis heute erfüllen, unbeschadet der
logischen Differenzierung, die eingetreten ist zwischen ihnen und
den übrigen satzverbindenden Partikeln.
Schließlich sieht sich ein Theoretiker um nach den entscheidenden
Ordnungsgesichtspunkten der Gesamtklasse ‚Pronomina’ und
findet Sätze, die er nicht unwidersprochen hinnehmen kann:
„Die Pronomina sondern sich zunächst in zwei Hauptgruppen, i. Die Demonstrativ-
und Fragepronomina mit dem Relativum und dem Indefinitum, die
irgend welche Begriffe stellvertretend andeuten. Den Hauptbestandteil dieser Gruppe
bilden die hinweisenden Pronomina, die mit zu den ältesten Bestandteilen jeder
Sprache gehören. 2. Die Personal- und Possessivpronomina, die den Begriff der
Person zu ihrer selbständigen Grundlage haben. Sie bezeichnen die Personen der
Unterredung, das Ich und Du, Wir und Ihr und die sogenannten dritten Personen,
auf die sich die Rede bezieht. Die herkömmliche Bezeichnung Possessiva ist zu
enge, da außer dem Besitz auch andere Beziehungen durch diese adjektivistischen
Formen ausgedrückt werden, z. B. odium tuum nicht nur ‚Haß, den du hast’, sondern
auch ‚Haß gegen dich’ (2. Bd., 2. Teil in 2. Aufl. [1911], S. 302ff.).”
Man braucht auf Klassifikationen keinen übertriebenen Wert
zu legen; allein die von mir hervorgehobenen Definitionen enthalten
oder verbergen eine Unklarheit von weittragender Bedeutung, an
welcher ein Logiker nicht achtlos vorübergehen darf. Den modernen
Sprachhistorikern konnte die enge Verwandtschaft der beiden
Gruppen nicht verborgen bleiben; allein dieser Fund wurde durch
die in Rede stehenden Definitionen nicht aufgeklärt, sondern eher
zu einem Rätsel gemacht. Wie kommt es, daß Wörter, die angeblich
berufen sind, ‚irgendwelche Begriffe stellvertretend anzudeuten’
und andere, die eine so spezifische Funktion haben wie die Personalia,
stammverwandt sind und im Lauf der Sprachgeschichte
vielfach hinüber und herüber ihre Funktion gewechselt haben?
Kurz und bündig: die erste der beiden Brugmannschen Definitionen
ist unhaltbar; die Demonstrativa sind ursprünglich und ihrer Hauptfunktion
nach keine Begriffszeichen, weder direkte noch stellvertretende,
sondern es sind, wie ihr Name richtig sagt, ‚Zeigwörter’,
und das ist etwas ganz anderes als die echten Begriffszeichen, nämlich
die ‚Nennwörter’. Auch die Personalia sind Zeigwörter und daher
die Stammverwandtschaft der beiden Gruppen. Man muß das deiktische
Moment zum Merkmal des Gattungsbegriffes erheben, dann
wird eine Reihe klassifikatorischer Schiefheiten aus der Terminologie
der Grammatiker verschwinden und das natürliche Gesamtsystem
der Zeigwörter sichtbar werden.
6. Wenn man von der Lektüre der Monographie Brugmanns über
die Demonstrativa zu Brugmann-Delbrück kommt, versteht man
117zunächst gar nicht, warum das überall gefundene und anerkannte
deiktische Moment nicht resolut, so wie wir es fordern, zum Merkmal
der ganzen Klasse erhoben wird. Eine Besinnung auf die
Grundlagen der tradierten Terminologie, die von den antiken
Grammatikern geschaffen worden ist, würde vielleicht in dem,
wogegen unsere Kritik sich, richtet, ein interessantes Überbleibsel
jener Art Verquickung von Grammatik und Logik erkennen,
gegen die Steinthal und seine Zeitgenossen im 19. Jahrhundert
zuerst Sturm gelaufen sind. Der Logiker ist berufsmäßig
geneigt, in den Wörtern nichts anderes als Begriffszeichen zu sehen.
Findet er eine ganze Klasse von Wörtern, die keine direkten Begriffszeichen,
keine Nennwörter sind, so hebt er an ihnen etwas
hervor, was doch noch gestattet, sie irgendwie mit den Namen in
eine Reihe zu bringen. Sie sind ihm dann zwar selbst keine echten
Namen mehr, wohl aber Stellvertreter von Namen, Pronomina.
So dürfte (schematisch geschildert) im Geiste der antiken Grammatik,
die programmgemäß als ein Stück der Logik behandelt wurde, der
Oberbegriff Pronomina entstanden sein.
Zugegeben, daß darin nicht nur ein Körnchen, sondern ein
dicker Kern von Wahrheit enthalten ist. Und wenn auch ebenso
zugegeben werden muß, daß die Hand der Logiker manchmal unglücklich
in die Angelegenheiten der Sprachtheorie eingegriffen hat,
so wäre ich trotzdem bereit, den Beweis anzutreten, daß alle bis
heute in der Linguistik erfolgten Tempelaustreibungen der Logik
so geendet haben, daß man das bekannte lateinische Sprichwort
umdichten möchte: logicam expellas furca… Deshalb ist es
wichtig, Entgleisungen aus mißverstandener Anwendung logischer
Einsichten auf das vorbestimmte und natürliche Gerät des menschlichen
Denkens, die Sprache, schon auf dem Boden der Logik selbst
aufzudecken und unschädlich zu machen. So haben wir die Verwendbarkeit
von Zeigzeichen im intersubjektiven Verkehr rein
„logisch” zu erweisen versucht und gewissen übereifrigen Sprachreinigern
vordemonstriert, daß sie selbst in ihrer künstlichen Sprache
der Zeigzeichen faktisch nicht entraten können.
Die Angelegenheit der ‚Pronomina’ ist viel verwickelter, interessanter
und aufschlußreicher, als es die ziemlich robusten Tempelaustreiber
vom Geiste Steinthals wahrhaben mögen. Denn es ist
dokumentarisch zu beweisen, daß die genialen ersten griechischen
Grammatiker eine unübertrefflich klare Einsicht in den sematologischen
Unterschied von Zeigen und Nennen gehabt haben. Die
Stoiker und Apollonios Dyskolos haben nach dem Ausweis von
118Steinthal 1)39 die Scheidung von Nennwörtern und Zeigwörtern
treffend vollzogen, Apollonios in etwas anderer ontologischer Einkleidung
als die Stoiker. Doch kommt es selbstverständlich auf
die ganze Metaphysik, die da mit hineinspielt, nicht an. Entscheidend
ist die Erkenntnis, daß nur die Nennwörter ihren Gegenstand
als ein so und so Beschaffenes charakterisieren, daß nur sie ihren
Gegenstand als ein Etwas, unterschieden von anderem, nach seiner
Wasbestimmtheit (ποιότης) fassen, während die Pronomina sich
nach Apollonios mit einer Deixis auf das Etwas hin, das sie treffen
wollen, begnügen.
„Ihr Wesen ist… Hinweisung auf gegenwärtige Gegenstände, oder άναφορά,
Rückbeziehung auf Abwesendes, aber schon Bekanntes. Durch die δεϊξις auf τά
ύπό ὄψι ὄντα entsteht eine πρώτη γνῶσις, durch άναφορά eine δετέρα γνῶσις.”
Und die Personalpronomina werden darin den übrigen durchaus gleichgestellt.
„Die Pronomina der ersten und zweiten Person sind δεικτικαί, die der dritten
Person teilweise deiktisch und anaphorisch zugleich, teilweise anaphorisch
allein” (316).
Das ist, wie gesagt, die eine Seite des Tatbestandes. Es
fehlt aber die Konsequenz, die der Logiker daraus ziehen muß
und die wir explizite ziehen werden. Den Griechen fehlte der Einblick
in die historischen Zusammenhänge der Dinge; sie wußten
nicht wie Brugmann-Delbrück, daß alle indogermanischen Demonstrativa
vermutlich einmal ‚deiktische Partikeln’ gewesen sind.
Schon der wegwerfende Name ‚Partikeln’, d. h. Schnitzeln der Rede,
die übrig bleiben, nachdem man die edleren und tragenden Bestandteile
systematisch behandelt hat, paßt heute nicht mehr recht in
die Terminologie. Aber sie waren doch da, diese Partikeln, und haben
offenbar auch zu einer Zeit schon ihre Funktion erfüllt, wo sie noch
nicht die spätere Rolle der Pronomina übernommen hatten. Ich
behaupte, diese älteste Funktion, die nicht verloren gegangen ist,
müsse zum Range des Klassenmerkmals erhoben werden.
Sie kann logisch einwandfrei dazu erhoben werden von einer
Zweifelderlehre und nur von ihr. Die Zeigwörter bedürfen nicht des
Symbolfeldes der Sprache, um ihre volle und präzise Leistung zu
erfüllen; sie bedürfen aber des Zeigfeldes und der Determination
von Fall zu Fall aus dem Zeigfeld oder, wie Wegener-Brugmann
noch sagten: der anschaulichen Momente einer gegebenen Sprechsituation.
Mit den Nennwörtern verhält es sich in diesem Punkte
ganz anders; sie können zwar empraktisch (oder wie man früher
119sagte: elliptisch) in einem Zeigfeld stehend ihren vollendeten Sinn
erfahren. Allein das ist nicht unerläßlich; sondern im vollendeten
Darstellungssatze vom Typus S → P erscheint die sprachliche Darstellung
in hohem Maße erlöst aus konkreten Situationshilfen. Und
diesen Musterfall allein hatten die griechischen Grammatiker vor
Augen. Hier wird die Frage nicht nur sinnvoll, sondern unerläßlich
an jede Wortart gerichtet: was leistet ihr im Satze, was ist dort
eure Funktion? Die Antwort fällt den „Partikeln” schwer oder ist
sogar unmöglich. Die Zeigwörter antworten zum größten Teil
(aber durchaus nicht alle): wir vertreten die Nomina. Und faktisch
wurden die urindogermanischen Partikeln im Lauf der Sprachgeschichte
mehr und mehr und differenzierter dazu herangezogen
und dafür ausgestattet. Aber es ist ihnen nach Ausweis der Sprachgeschichte
schwer genug gefallen, sich einigermaßen und mehr
schlecht als recht dem Kasussystem der von ihnen vertretenen Nennwörter
einzufügen und anzupassen.
Soweit sie es getan haben, müssen sie in einer ordentlich aufgebauten
Syntax behandelt werden; und so ist es seit zweitausend
Jahren üblich. Nur darf man sich dann in einer solchen syntaktischen
Theorie nicht wie es üblich ist, mit semantischen Angaben
wie der aus Brugmann-Delbrück, daß sie „irgendwelche Begriffe
stellvertretend andeuten” zufrieden geben. Wir selbst werden im
letzten Paragraphen dieses Buches die Rolle der Anaphora im
Satzgefüge zum Thema erheben; das ist, wie mir scheint, die sachgemäße
syntaktische Analyse der Zeigwörter.
Vorerst aber ging es nur um ihre korrekte sematologische Bestimmung
und dabei hat jede Wortklasse ein Recht darauf, vom
Theoretiker in ihrer Eigenart erfaßt zu werden; wenn sie wie die
Zeigwörter im Lauf der Sprachgeschichte anerkannt jüngere Funktionen
übernimmt und Verbindungen mit anderen Wortarten eingeht,
so muß das notiert werden, darf aber nicht dazu führen, daß
man das nie aufgegebene Wesensmoment in ihrer Funktion aus dem
Auge verliert. Das übliche Verfahren führt zu begrifflichen Überschneidungen
und Plackereien. Wenn man der Klasse, wie üblich,
den Taufnamen ‚Pronomina’ verleiht, so melden sich die ungetauften
und untaufbaren ‚Partikeln’, die nach dem Ausweis der Sprachgeschichte
mit zur Familie gehören, und erheben Einspruch dagegen;
es melden sich ebenso die Konjunktionen, die keine Pronomina
sind. Und was beide zu sagen haben, lautet bestimmt und vornehmlich
genug: demonstrare necesse est, stare pro nominibus non
est necesse.120
§ 8. Die Deixis am Phantasma und der anaphorische Gebrauch
der Zeigwörter.
Man weist mit dieser und jener (oder hier und dort u. dgl. m.)
auf- soeben in der Rede Behandeltes zurück, man weist mit dér
(derjenige) und anderen Zeigwörtern auf sofort zu Behandelndes
voraus. Das heißt von alters her Anaphora. Wer sie in ihrem ganzen
Bereich ausmessen will, darf nicht vergessen, das Moment des Zeigens
auch in solchen Wörtern noch aufzusuchen, wo es mit spezielleren
grammatischen Funktionen verquickt ist. So enthalten nicht nur
die Relativpronomina im engeren Sinn des Wortes, sondern auch die
indogermanischen Konjunktionen ein Moment des Zeigens, und zwar
eines Zeigens auf etwas, was nicht an Plätzen des Wahrnehmungsraumes,
sondern an Plätzen im Ganzen der Rede aufgesucht und
vorgefunden werden soll. Ich verweise zur Illustration etwa auf
das deutsche da in den verschiedenen Funktionen, die es allein und
in Verquickung mit anderen Partikeln erfüllt. Es ist im Wahrnehmungsfeld
ein Positionszeigwort; es wird anaphorisch in darum
= deshalb und in dem (sowohl sachzeitlich wie anaphorisch verwendeten)
danach; und schließlich erscheint es isoliert wieder als Konjunktion
in Begründungssätzen (= weil), womit ihm aber das anaphorische
Moment (zurück oder vorwärts) keineswegs verloren gegangen ist.
So weit, glaube ich, muß man im ersten Anlauf den Begriff
des Anaphorischen fassen, um historisch Zusammengehörendes
nicht auseinanderzureißen und sachlich dem Gesamttatbestand des
Zeigens gerecht zu werden. Einfach genug: es gibt auch ein Zeigen
auf Plätze im Aufbau der Rede, und die indogermanischen Sprachen
benützen für dieses Zeigen zum guten Teil dieselben Wörter wie für
die demonstratio ad oculos. Einfach (wie wir es nannten) ist, wenn
nicht mehr, so zum mindesten die Beschreibung des Tatbestandes:
eine Ordnung dort im Räume und Stellen darin — eine Ordnung hier
im Abfluß der Rede und Plätze darin, oder Redeteile, auf die ververwiesen
wird, um das Gemeinte zu treffen; und der Verweis erfolgt
im großen und ganzen mit Hilfe desselben Apparates von Zeigwörtern.
Psychologisch betrachtet setzt jeder anaphorische Gebrauch
der Zeigwörter das eine voraus, daß Sender und Empfänger den
Redeabfluß als ein Ganzes vor sich haben, auf dessen
Teile man zurück- und vorgreifen kann 1)40. Sender und Empfänger
müssen also dies Ganze soweit präsent haben, daß ein Wandern
121möglich ist, vergleichbar dem Wandern des Blickes an einem optisch
präsenten Gegenstand. Das alles überrascht den Psychologen nicht;
denn er weiß, daß nicht nur der Redefluß, sondern auch andere
geformte akustische Reihen ein solches Wandern, Wiederaufnehmen
und Vorkonstruieren verlangen und gestatten. Die adäquate Produktion
und Aufnahme jedes Musikstückes z. B. verlangt nicht
gerade dasselbe, aber Ähnliches. Setzen wir also derartige Operationen
im Bereich des sogenannten unmittelbaren Gedächtnisses
oder richtiger gesagt am unmittelbar Behaltenen als bekannt voraus,
dann ist die psychologische Grundlage des anaphorischen Zeigens
angegeben; wir brauchen darüber nichts Spezielles zu ermitteln.
Es sei denn, ein scharfer Analytiker komme schon hier dahinter,
daß der zur Erläuterung angesetzte Vergleich des sprachlich anaphorischen
Verfahrens mit dem, was man bei der detaillierten Aufnahme
eines musikalischen Ganzen oder eines optisch ausgebreiteten
Gegenstandes beobachten kann, auf einem Beine hinkt. In der Tat
bestehen einige bemerkenswerte Unterschiede. Vor allem: weder
auf einem Gemälde noch im Gefüge eines Musikstückes gibt es
eigene Zeichen, die ausschließlich oder hauptsächlich dazu berufen
sind, als Wegweiser des Blickes zu fungieren, vergleichbar
den anaphorischen Zeigwörtern. Wir erkennen dies an und merken
es vor zu einer befriedigenden Erledigung im Schlußparagraphen.
Es ist so, daß uns diese einfache Erkenntnis dort zum Schlüssel
wird für das Verständnis einer der merkwürdigsten Eigenschaften
sprachlicher Gefüge. Einstweilen aber genügt der Vergleich, soweit
122er nicht hinkt, es genügt die Feststellung, daß die sprachliche Darstellung
eben in gewissem Ausmaß eigene Mittel aufwendet, um das
Vor- und Zurückgreifen zu veranlassen und zu steuern, Operationen,
die anderwärts ohne solche Mittel erfolgen. Wie reich oder arm das
anaphorische Zeigen durch geformte Mittel erfolgen mag, ist eine
Spezialangelegenheit der einzelnen Sprachen. Restlos läßt sich das
psychologisch erforderliche Vor- und Zurückgreifen nirgends ganz
an wohlgeregelte Kommandos binden und auf sie allein einschränken.
Es wäre aus mehreren Gründen undurchführbar und außerdem höchst
überflüssig, den Empfänger einer verwickelten sprachlichen Botschaft
freiheitslos am Gängelband der anaphorischen Zeigwörter
zu führen. Genug, daß es in gewissem Ausmaße geschieht. Soviel
vorerst über die psychologische Grundlage des Vor- und Rückverweisens.
Mit der Anaphora allein aber ist noch nicht alles gesagt.
Wenn der Psychologe irgendwo auf Leistungen im Bereich
des sogenannten unmittelbaren Behaltens stößt, dann forscht
er nach ähnlichen Leistungen im Bereich des nicht mehr unmittelbaren,
sondern mittelbaren Behaltens, d. h. im Bereiche der ausgewachsenen
Erinnerungen und der konstruktiven Phantasie. Seine
Erwartung, auch dort den Zeigwörtern zu begegnen, wird nicht
enttäuscht, sondern in einem ungeahnten Ausmaß erfüllt. Erfüllt
auch die Vorahnung, die wir aus Brugmanns hingeworfenen Bemerkungen
gewonnen haben, daß ein in der Wurzel der sprachlichen Darstellung
angelegtes dramatisches Moment dort besonders rein und
wissenschaftlich leicht greifbar zum Vorschein kommen dürfte.
Wir wollen diesen dritten Modus des Zeigens die Deixis am Phantasma
nennen 1)41. Zu unterscheiden ist also von der demonstratio
ad oculos die Anaphora und die Deixis am Phantasma.
Es ist zweckmäßig, die psychologische Analyse mit einer
Gegenüberstellung des ersten und dritten Modus zu beginnen und
die Anaphora abzutrennen. Sie hebt sich, wie wir sehen werden,
in entscheidenden Punkten von den beiden anderen Modi des Zeigens
ab und wäre unverständlich, wenn es neben dem Zeigfeld nicht noch
ein zweites, nämlich ein Symbolfeld der Sprache, d. h. eine Syntax
gäbe. Man kann dies auch so ausdrücken, daß die Anaphora in
eminentem Maße gerade dazu berufen erscheint, das Zeigen mit dem
eigentlichen Darstellen zu verknüpfen. Es ist zweckmäßiger, sie
123systematisch erst nach der Lehre vom Symbolfeld der Sprache,
und zwar im vierten Kapitel, zu behandeln. Dort wird dann deutlich
werden, daß der werdende Kontext einer Rede selbst zum Zeigfeld
erhoben wird, wenn wir anaphorisch zeigen; ein höchst merkwürdiges
und für die sprachliche Darstellung außerordentlich
charakteristisches Phänomen. Die zwei Felder: (sachliches) Zeigfeld
und Symbolfeld der Sprache werden also durch ein drittes
(wenn man so will) zusammengeschlossen, nämlich durch das kontextliche
Zeigfeld. Logisch korrekter aber erscheint es mir, dies
dritte nicht als ein neues Feld, sondern als eine Unterart des einen
Zeigfeldes zu charakterisieren; denn neu und eigenartig ist nur
das Moment der Reflexion, durch welche es gewonnen wird. Die
werdende Rede wendet sich sozusagen auf sich selbst zurück oder
voraus im Phänomen der Anaphora; im übrigen aber sind es (abgesehen
von gewissen spezifischen Reflexionswörtern) dieselben
Zeigwörter, die dort und hier verwendet werden.
1. Man muß, um die psychologischen Fragen über die Deixis
am Phantasma reinlich zu beantworten, etwas weiter ausholen.
Wenn einer einem anderen etwas zeigen will, so müssen beide, der
Führer und der Geführte, ein hinreichendes Maß harmonischen
Orientiertseins besitzen. Des Orientiertseins in einer Ordnung,
worin das zu Zeigende seinen Platz hat. Grob erläutert muß ein
Städteführer in der Stadt und der Museumsführer in dem Museum,
worin er dies und das zeigen will, orientiert sein. Und der Geführte
resp. der Hörer? Es soll bewiesen werden, daß auch er im Falle der
sprachlichen Demonstrationen besonders des zweiten und dritten
Modus eine gute Portion eigener Aktivität und einen bestimmten
Grad von Orientiertheit in der Ordnung des zu Zeigenden mitbringen
muß. Solange es nur darauf ankommt, durch Wörter wie
hier und dort, ich und du mit dem äußeren Auge und Ohr Auffindbares
zu treffen, weil es im gemeinsamen Wahrnehmungsfelde präsent
ist, braucht man sich um die feinere Analyse des harmonischen
Orientiertseins der Partner in diesem Felde nicht eingehend zu
bekümmern. Wir meinen mit unserem gesunden Menschenverstände
die gegebenen Bedingungen hinreichend zu - durchschauen, wir
glauben zu begreifen, wie und warum der Empfänger trifft, was der
Sender intendiert. Die natürlichen (vorsprachlichen) Hilfsmittel,
die ihnen dabei zur Verfügung stehen, wurden angegeben und analysiert,
soweit wir sie kennen. Dazu ist hier nichts nachzutragen.
Die Verhältnisse ändern sich aber mit einem Schlage, wie es
scheint, wenn ein Erzähler den Hörer ins Reich des abwesend Erinnerbaren
124oder gar ins Reich der konstruktiven Phantasie führt
und ihn dort mit denselben Zeigwörtern traktiert, damit er sehe
und höre, was es dort zu sehen und zu hören (und zu tasten, versteht
sich, und vielleicht auch einmal zu riechen und zu schmecken) gibt.
Nicht mit dem äußeren Auge, Ohr usw., sondern mit dem, was man
zum Unterschiede davon in der Umgangssprache und wohl auch aus
Bequemlichkeit in der Psychologie das „innere” oder „geistige”
Auge und Ohr zu nennen pflegt. Die Verhältnisse müssen dort
anders werden, wie es scheint, weil jene vorsprachlichen Zeighilfen,
die für die demonstratio ad oculos unentbehrlich sind, beim Zeigen
am Phantasma wegfallen. Der am Phantasma Geführte kann nicht
dem Pfeile eines vom Sprecher ausgestreckten Armes und Zeigefingers
mit dem Blicke folgen, um das Etwas dort zu finden; er
kann nicht die räumliche Herkunftsqualität des Stimmklanges ausnützen,
um den Ort eines Sprechers zu finden, welcher hier sagt; er
hört in der geschriebenen Sprache auch nicht den Stimmcharakter
eines abwesenden Sprechers, welcher ich sagt. Und doch werden
ihm diese und andere Zeigwörter in reicher Mannigfaltigkeit auch
in der anschaulichen Erzählung von abwesenden Gegenständen
und von abwesenden Erzählern geboten. Man schlage eine beliebige
Reiseschilderung oder einen Roman auf, um das Gesagte im Groben
auf der ersten Seite bestätigt zu finden. Das psychologisch Feinere
daran erfordert freilich etwas mehr an Überlegungen, um es wissenschaftlich
zu begreifen.
Die psychologische Kernfrage lautet also, wie ein derartiges
Führen und Geführtwerden am Abwesenden möglich ist. Doch wie
es in der Wissenschaft vielfach zu gehen pflegt, so wird der Forscher,
der dies Fernerliegende erfahren will, von der Sache selbst zunächst
gründlich zurückverwiesen auf etwas, was er schon durch und durch
zu kennen glaubte, nämlich auf das Zeigen am Anwesenden. Hier
muß er sich die Verhältnisse noch einmal mit neuen Augen ansehen,
um für die weitere Forschung gerüstet zu sein. Wir sprachen bisher
völlig naiv von einem gemeinsamen Wahrnehmungsraum als einer
Ordnung, in welcher alles beisammen ist: Zeigobjekte, Sender und
Empfänger der Zeiganweisungen, und worin sich die beiden Kontaktpartner
harmonisch-sinnvoll benehmen. Das Ineinanderspielen, die
Harmonie dieses Benehmens ist nicht so ganz selbstverständlich,
wie der psychologisch Naive denken mag. Doch wollen wir die
letzten erkenntnistheoretischen Probleme, die von den Tatsachen
aufgegegeben werden, hier nicht behandeln, sondern uns mit einer
möglichst schlichten Beschreibung des Orientiertseins von A und B,
125der beiden Gesprächspartner in ihrem Wahrnehmungsraum begnügen.
Das ist deshalb notwendig, weil es sich herausstellt, daß dies
Orientiertsein in toto hineinspielt und hinübergenommen wird in
den ‚Phantasieraum’, in das Reich des Irgendwo der reinen Phantasie
und in das Reich des Da-und-da der Erinnerung. Die Voraussetzung,
aus der das Erstaunen über die Möglichkeit der Deixis
am Phantasma entsteht, ist zum guten Teil falsch. Es ist gar nicht
so, daß die natürlichen Zeighilfen, auf welchen die demonstratio
ad oculos beruht, der Deixis am Phantasma restlos mangeln. Sondern
es ist so, daß Sprecher und Hörer einer anschaulichen Schilderung
von Abwesendem die Gaben und Mittel besitzen, welche es dem
Schauspieler auf der Bühne gestatten, Abwesendes präsent zu
machen und dem Zuschauer des Spieles, das auf der Bühne Präsente
als eine Mimesis des Abwesenden zu deuten 1)42. Die ‚anschauliche’
Sprache ist durch und durch auf dieses Fiktionsspiel eingerichtet
und nur soweit die Sprache es ausnützt, sollte man sie als
anschaulich bezeichnen. Nur muß es nicht in jeder Hinsicht
genau dasselbe sein, was der Schauspieler macht; sondern es gibt
daneben eine zweite Möglichkeit, die vom Epiker kultiviert wird.
Quod erit demonstrandum.
2. Wer immer im Wachzustand und „bei sich” ist, befindet
sich orientiert in seiner gegebenen Wahrnehmungssituation und
das heißt zunächst einmal, daß alle Sinnesdaten, die ihm zufließen,
eingetragen sind in eine Ordnung, ein Koordinationssystem, dessen
Origo (Koordinationsausgangspunkt) das ist, worauf die Zeigwörter
hier, jetzt, ich hindeuten. Diese drei Wörter müssen zusammen
an den Fixpunkt der Ordnung, die wir beschreiben wollen,
gesetzt werden. Das Faktum des wachen Orientiertseins wird in der
Erlebnispsychologie in verschiedenen Kapiteln behandelt, die man
synoptisch ausziehen muß, um sich die für jede gründliche Sprachtheorie
unentbehrlichen Informationen aus dem Schatz des wissenschaftlich
Festgestellten zu verschaffen. Es gehört nicht allzuviel
Buchwissen dazu und das Gröbste kann jeder phänomenologisch
Geschulte mit jener Unbefangenheit, die dann und wann mitten
in einer Wissenschaft am Platze ist, auch offenen Auges an Alltagserscheinungen
selbst ablesen. Er mache sich z. B. den Unterschied
des wachen Bei-sich-seins von der uns allen wohlbekannten Form
des Entrücktseins im Traume klar. Es gibt noch andere Formen des
126‚Entrücktseins’ (der Ekstase), auf die wir hier gar nicht einzugehen
brauchen.
Nur eine von ihnen wollen wir im Vorbeigehen noch streifen,
weil man methodisch aufschlußreiche Erläuterungen an ihr zu bieten
vermag; es sind die Störungen des Beisichseins der Kranken und
Verletzten. Wenn einer je wie der Arzt am Krankenbette in die
Lage kommt, nachzuforschen, ob ein anderer bei sich ist, so
gehört nur ein gewisses Maß von natürlicher Geschicklichkeit oder
Praxis in solchen Dingen dazu, um ihm die üblichen ersten Testfragen
einzugeben. Wie immer man das im einzelnen anstellen mag, so
wird im Groben festgestellt, ob man mit dem Geprüften überhaupt
in einen Sprechkontakt gelangen kann, und im Feineren, ob er auf
vorsprachliches und sprachliches Zeigen in der uns allen geläufigen
Weise anspricht und reagiert. Dabei wird sich herausstellen, ob
der Geprüfte die Wahrnehmungsdaten, auf die wir ihn hinlenken,
oder die wir ihm künstlich verschaffen, in das Hier-Jetzt-Ich-System
wie ein Beisichseiender einträgt oder nicht. Es muß aus seinen
sprachlichen oder anderen Reaktionen hervorgehen, ob er das Weiße
um sich als Bett und Zimmerwände und sich selbst an einem bestimmten
Ort in diesem Raumganzen befindlich erfaßt oder nicht.
Es muß hervorgehen, ob er von einem Jetzt aus das Nächstvergangene
und das Kommende geordnet überblickt oder nicht. Es muß hervorgehen,
ob er ich nicht nur sagen, sondern auch denken kamvund was
und wieviel von seinen Erinnerungsdaten er geordnet an dieses
Augenblicksich anknüpft. Nur eines noch: Es gehört zu solcher Prüfung,
daß man die Ansprüche situationsgerecht zu reduzieren vermag.
Man kommt mit rein behavioristischen Prüfungsmitteln schon
beim menschlichen Säugling und bei Tieren ins Klare darüber,
ob sie die ihrer Entwicklungsstufe entsprechende Orientierung in
der Wahrnehmungssituation besitzen oder nicht. Ein praktisches
Orientiertsein besitzen selbstverständlich auch menschliche Säuglinge
und Tiere auf ihrer Stufe und für ihr Aktionssystem.
3. Nun etwas Subtileres über die räumliche Komponente in
dieser Gesamtorientierung des wachen Menschen, der bei sich ist. Wir
sind ja „Sehtiere”, d. h. der Sehraum ist zwar nicht alles, aber steht
doch im Vordergrund der räumlichen Orientierung bei uns sehenden
Menschen. Auch im Zeigverfahren des Sprechverkehrs, wie wir im
Anschluß an Brugmann ‚gesehen’ haben. Wie gehen die Psychologen
vor, wenn der (erlebte) Sehraum beschrieben werden soll?
Die älteren Sehraum-Phänomenologen wie Hering und Hillebrand,
Helmholtz, Bourdon, Witasek u. a. m. kannten dabei
127nur einen Ausgang und eine Richtung des Fortschreitens der wissenschaftlichen
Analyse. Angenommen alles ruht, die Dinge um uns
ebenso wie wir selbst (der ganze Körper, der Kopf und die Augen)
und es werde nicht mit zwei, sondern vorerst nur mit einem unbewegten
Auge geschaut; es werde nicht „geblickt”, sondern nur
aufgenommen, was sich diesem Auge bietet und aufdrängt an Raumdaten
aus einem so und so hergerichteten Gesichtsfeld. Dies schien
den Älteren der einzig sachgerechte Ausgang der Untersuchung
zu sein. Zweiauge und Bewegungen aller Art wurden dann erst
sekundär und schrittweise als komplizierende Bedingungen des
Raumsehens eingeführt. Nun, wir verdanken jenen Pionieren wahrhaftig
genug, um sicher zu sein, daß dieser Ausgang nicht falsch war.
Wir wissen aber ebenso gut, daß die Analyse methodisch genau
so einwandfrei am anderen Ende beginnen kann, zur Kontrolle
und Vervollständigung der Befunde vielleicht sogar beginnen muß.
Angenommen also, einer, der uns Aufschluß geben soll, wandert
frei und unbekümmert umher, sagen wir vom Bahnhof einer fremden
Stadt ein Stück hinein in das Gewinkel und lebendige Getriebe der
Straßen. Er vermag uns nach einiger Zeit Angaben zu machen, von
denen wir im Kapitel „Raumorientierung” ebensogut ausgehen
können. Mag sein, unser Wanderer besinnt sich, weil er zurück muß,
und hat die Orientierung zum Bahnhof verloren; oder aber er vermag
die Richtung und Entfernung des Bahnhofs mit praktisch ausreichender
Genauigkeit anzugeben. Beides ist, wenn richtig aufgenommen
und durchdacht, von wissenschaftlichem Interesse. Blieb er orientiert,
dann liegt eine Leistung vor, die wir potenziert aus Berichten
über menschliche Steppenführer und eindrucksvoller, theoretisch
vielleicht auch leichter durchsichtig noch, von anderen gut
orientierten Lebewesen kennen; Pferde finden zurück und Vögel,
auch Ameisen, Bienen und Wespen.
Ich stelle diese bunte Liste von Könnern hier zusammen, um
damit anzudeuten, daß der Sprachtheoretiker, welcher sich ernstlich
informieren will, nicht versinken und sich verlieren sollte in das
physiologische Detail, das hundertmal anders ist, wenn man die
ganze Tierreihe und das menschliche Raumorientierungsvermögen
durchgeht. Denn gleichviel, wie es geleistet werden mag, so bleibt
dies in allen Fällen ein zentrales Faktum, daß ein Registrierapparat
fungiert und dem also ausgestatteten Lebewesen eine Art von
Orientierungstafel für sein praktisches Verhalten bereit stellt.
Jedes von ihnen mag sich bewegen in seiner Art, nach seinem Aktionssystem,
so konstatieren wir in schlichten Beobachtungen
128das Faktum, daß all die genannten Lebewesen bei ihren Aktionen
mehr oder minder weitgehend richtig orientiert bleiben auf bestimmte
objektive, für das Tier oder den Menschen lebenswichtige Ortsdaten
oder Raumrichtungen hin.
Und wenn eines von den derart orientierten Lebewesen, nämlich
der Mensch, den Mund auftut und deiktisch zu sprechen anfängt,
so sagt er z. B. dort! muß der Bahnhof sein, und nimmt dabei vorübergehend
die Haltung eines Wegweisers an. Das Lexikon von
Wörtern, die aus demselben Orientiertsein ihre Feldwerte erhalten,
ist mit dem dort noch keineswegs erschöpft. Wenn derselbe Mensch
Wörter wie vorn-hinten, rechts-links, oben-unten verwendet, so wird
eine neue Tatsache offenbar, die Tatsache nämlich, daß er in Relation
zu seiner optischen Orientierung auch seinen Körper verspürt
und zeigend einsetzt. Sein (bewußtes, erlebtes) Körpertastbild
steht in Relation zum Sehraum. Die Raumorientierung kann nirgendwo
bei Tier oder Mensch eine Angelegenheit des isoliert gedachten
Gesichtssinns allein sein. Sonst verständen wir eine Menge wohlbekannter
Tatsachen nicht. Wir wissen vom Menschen, daß Daten des
Gesichts-, Tast- und Gehörsinns zusammen von jenem bereits genannten
Registrierapparat aufgenommen und verwertet und daß
von bestimmten Eigenbewegungen unseres Kopfes und Körpers
her noch einmal eigene Beiträge, Beiträge der sogenannten Kinästhesis
dort mit verbucht werden. Es ist neben anderem der große
Regulator des „statischen” Apparates der Bogengänge, den man
bei der Aufzählung nicht vergessen darf. Und was im Speziellen
die Verbindung von Sehrichtungen und Körpertastbild, auf die
wir gestoßen sind, angeht, so ist über einige wohlbekannte Tatsachen
zu berichten, die für ein analytisches Verständnis des sprachlichen
Zeigverfahfens von hervorragender Bedeutung sind. Ich werde sie
im folgenden Abschnitt so prägnant als möglich wiedergeben.
4. Man weiß vor allem, daß die Origo, der Koordinatenausgangspunkt
der Sehrichtungen, im Körpertastbild wandert.
Das anschauliche Hier, selbst wenn es vorwiegend optisch gemeint ist,
liegt kurz gesagt im Körpertastbild nicht immer an derselben Stelle.
Eine grundlegende Verschiebung erfolgt bereits, wenn man vom
Sehfeld des Einauges zu dem einheitlichen Sehfeld des Zweiauges
übergeht. Das ist eine Tatsache, die schon den älteren Raumphänomenologen
bekannt war; Hering hat, um sie zu fixieren, die theoretische
Konstruktion eines Zyklopenauges an der Nasenwurzel
vorgeschlagen. Wir sehen faktisch die binokular einheitlichen Sehrichtungen
„von dort aus”, wir sehen sie so, als ob jeder von uns
129ein Polyphem mit nur einem Zyklopenauge wäre. Woran ein lehrhafter
Verehrer der Griechen demonstrieren mag, wie menschlich
sinnvoll sie ihre Phantasiegestalten geschaffen haben, während ein
moderner Mediziner zu ebenso wichtigen Überlegungen in anderer
Richtung kommt. Das Faktum ist von viel größerer Tragweite, als
man beim ersten Hören zu ahnen vermag 1)43.
Vor allem ist, so fühlt man sich versucht die Dinge kurz zu
schildern, mit diesem ersten Schritt schon die engste Organgebundenheit
des „Anschauungsbildes” oder „Wahrnehmungsbildes”
im Sinne von Brugmann, jener Endordnung, wie man sie
in der Sprachtheorie erfassen muß, gelockert. Und diese Befreiung
geht weiter und kann Schritt für Schritt verfolgt werden. Nur wer
diese Befreiungsschritte einmal ordentlich durchdacht hat, vermag
die anscheinend willkürliche und bunte Mannigfaltigkeit der Zeigwörter
und des Zeigverfahrens, von denen die Erforscher uns fremder,
exotischer Sprachen so viel zu berichten haben, von sich selbst aus
zu verstehen. Die Sprecher jener Sprachen sind gar nicht so verschieden
von uns, wie es den Anschein hat. Das relativ Wenige,
wovon ich selbst literarisch Kenntnis nehmen konnte, z. B. die merkwürdigen
Zeigarten in vielen Indianersprachen, lassen sich psychologisch
restfrei und, was das Wichtigste ist, systematisch unterbringen
in dem, was wir alle da und dort an uns selbst beobachten
und verfolgen können. Die Psychologen haben es gefunden und beschrieben,
ohne eine Ahnung davon zu haben, daß es Sprachen gibt,
die dies, und Sprachen, die etwas anderes zum generellen Zeigverfahren
erhoben haben. Ich werde mich in meiner Schilderung
darauf beschränken, die genannten Befreiungsschritte des Raumbewußtseins
von seiner engsten und engeren Organgebundenheit
im Schema zu zeichnen und bringe nur, was durch zuverlässige
Psychologen in den verschiedensten Untersuchungen entdeckt und
protokollarisch festgehalten worden ist.
Man hat Erscheinungen gefunden noch fast ganz im Bereich
der sogenannten reinen Wahrnehmung, die am einfachsten fixiert
130werden, wenn man die theoretische Konstruktion von der Wanderung
des optischen Hier im Körpertastbild fortsetzt und beendet.
Es gibt Fälle, wo wir das vorn-hinten usw. überhaupt nicht mehr
direkt vom Auge aus, sondern in Relation zum Globus des Kopfes
bestimmen und „wahrnehmen”. Der Kopf hat auch in unserem
eigenen Körpertastbild sein vorn-hinten, rechts-links, und es ist nun
dies System auch für das Optische maßgebend geworden. G. E.
Müller nennt es einfach das System der Kopfkoordinaten.
Noch einmal anders, wenn auch der Kopf sozusagen freigegeben
und die Brustkoordinaten relevant, werden und schließlich,
wenn Kopf und Oberkörper freigegeben und der Bein-Beckenteil
des Körpertastbildes die Rolle eines Koordmatenträgers übernimmt.
Dann ist vorn, wohin das Becken und das Knie und der Schritt
„sinnet”, während es irrelevant bleibt, wohin Augen, Kopf und
Oberkörper gedreht sein mögen. Das ist das wichtigste System der
Standpunktskoordinaten.
Wir brauchen uns um das Detail der psychologischen Beobachtungen,
die dazu gehören, nicht weiter zu bekümmern; es ist ja
deutlich, daß nach und nach dies und das im Körpertastbild führend
wird und die optischen Daten sich einordnen. Mehr brauchen
wir eigentlich nicht. Es sei, daß man hier sofort den Hinweis auf
einen noch weiter gehenden Sprung der anschaulichen Raumorientierung
anfügt, den Sprung aus der egozentrischen in die topomnestische
Orientierung, wie man sie genannt hat. Als eine Art
von Übergang dazu darf der wichtige Fall betrachtet werden, wo
man z. B. an einem Fahrzeug (Wagen, Schiff, Lokomotive, Auto)
die Orientierung sofort und nicht nur gedanklich, sondern durchaus
zwangsmäßig anschaulich nach der geläufigen Bewegungsrichtung
des Dinges vornimmt. Genau so natürlich wie am Tier und am anderen
Menschen. Wenn ein Turnlehrer vor der Front und Nase gegen
Nase mit der ausgerichteten Reihe der Turner Kommandos gibt,
dann wird verabredungsgemäß das Kommando rechts und links
in der Orientierung der Turner gegeben und verstanden. Das ist
ein Musterfall, den man sich zur Erläuterung der ungemein leichten
Übersetzbarkeit aller Feldwerte des räumlichen Orientierungsund
des sprachlichen Zeigsystems aus einer in eine andere Orientierungstafel
vormerken muß.
Diese leichte Übersetzbarkeit enthält schon die Vorbedingungen
zum Übergang in die sogenannte „topomnestische” Raumorientierung.
Und diese lebt sich überall dort aus, wo usuell z. B. in alles
die Himmelsrichtungen (Nord-Süd, Ost-West) u. dgl. m. eingetragen
131werden. Eine exakte Verfolgung der topomnestischen Orientiertheit
über diese von der egozentrischen her am leichtesten verständlichen
Fälle hinaus wäre nach dem Stande unserer heutigen Kenntnisse
auf Spekulationen angewiesen, die wir vermeiden wollen. Wir
schließen also damit den Bericht über die psychologische Analyse
der normalen räumlichen Orientierung des wachen Menschen in
seiner gegebenen Wahrnehmungssituation ab.
5. Über die zeitliche Komponente, die mit darin liegt und
die vom anschaulichen Jetzt aus erfolgt, ist aus exakten Beobachtungen
nur wenig an bemerkenswerten Details bekannt. Wenn einmal
die Linguisten aus dem ihnen vertrauten Material das Psychologische
ausziehen, wird weit mehr zum Vorschein kommen, als die Psychologen
bis heute gefunden haben. Daß das anschauliche ‚Jetzt’ von
der Sprache normalerweise zum Ausgangspunkt der Zeitbestimmungen
verwendet wird, ist einfach genug, z. B. aus dem System
der indogermanischen Konjugationen abzulesen. Das isolierte Wort
jetzt zeigt wie das hier seinen Stellenwert selbst an, wenn es ausgesprochen
wird. Es braucht ebensowenig wie das hier als ausdehnungsloser
(mathematischer) Punkt, als Grenze im strengen Wortsinn,
gedacht zu sein, sondern kann, je nach dem mitgedachten
Nichtmehrjetzt eine kleinere oder auch beliebig große Ausdehnung
annehmen. So wie ein gläubiger Christ hier sagt und das ganze Diesseits
(die Erdoberfläche oder mehr noch) einschließt, mag einer,
der in geologischen Zeitmaßen denkt, in ein ‚jetzt’ die ganze Periode
nach der letzten Eiszeit einschließen. Und genau so wie das Hier
kann auch das Jetzt im Phantasma an eine beliebige Stelle versetzt
werden, was nicht mehr hierher, sondern zum Gegenstand des
folgenden Abschnitts gehört. Die indogermanischen Sprachen demonstrieren
uns mit ihrer Vorvergangenheit und dem Futurum exactum
eine Möglichkeit im Gebiet der Zeiten, deren Analogon auf dem
Raumgebiet wir kennen lernen werden (s. unten den dritten Hauptfall).
Ob es irgendwo in fremden Sprachen viel anders ist mit dem
normalen Zeitschnitt durch das Jetzt, ist mir unbekannt. Rein konstruktiv
könnte ein Psychologe die Kenner danach fragen, ob irgendwie
eine Parallele zu der topomnestischen Raumorientierung vorkommt.
Das müßte dann eine Zeitorientierung sein, die an einem oder
einigen objektiven Fixpunkten im Jahreslauf (Sonnwenden u. dgl.)
oder im Tageslauf (Sonnenaufgang, -Untergang u. dgl.) ihre Nullpunkte
hätte, von denen aus vor- und zurückbestimmt wird. Daß
in den Zeitrechnungen, z. B. im römischen Kalender, dergleichen
vorkommt, weiß ich wohl; die Frage war anders gemeint, nämlich,
132ob viel primärer und vor der Aufstellung eines Kalenders schon
in den sprachlichen Zeigarten und Zeigwörtern etwas Vergleichbares
manifest wird.
Über das Ich als natürlichen Koordinatenausgangspunkt der
‚Weltanschauung’ im wörtlichen Sinne des Namens und wie er
sprachliche Form gewinnt, ist einiges bereits gesagt, was im folgenden
noch vertieft und erweitert werden muß.
6. Wir stellen nach dieser unerläßlichen Vorarbeit nun erneut die
Frage nach den psychologischen Grundlagen der Deixis am Phantasma.
Genau genommen müßte man zuvor noch angeben, daß nicht alle sogenannten
Erinnerungs- und Phantasievorstellungen hierher gehören, die unser Selbstsprechen
und Sprachverstehen stützen, begleiten und zum Teil erfüllen. Vielmehr gibt
es ‚Bilder’ und ‚Bildchen’ (wie man sagen könnte), die ihrer ganzen Beschaffenheit
nach abgetrennt werden müssen von den geschlossenen Situationsvergegenwärtigungen
(so wollen wir die zweite Gruppe nennen). Im zweiten Falle treten
Erinnerungs- und Phantasiesituationen von wahrnehmungsähnlichem Charakter
auf und ersetzen die primäre Gegebenheit von Wahrnehmungssituationen. Jene
anderen, die Bilder und Bildchen, welche eingestreut in den Gedankenzug da und
dort auftauchen und wieder verschwinden wie momentane Illustrationen zu dem
und jenem Wort oder Gedanken, leisten keine Zeighilfen. Sie gehören sprachlich
gesehen in den Bereich der anschaulich vollziehbaren Bestimmungen genannter
Gegenstände und können nur im Rahmen einer Lehre vom Symbolfeld der Sprache
ihrer Erscheinungsweise und ihrer Funktion nach psychologisch erfaßt und begriffen
werden. Auch von Metaphern und sprachlichen Gleichnissen ist hier nicht
die Rede; das alles steht auf einem anderen Blatt.
Uns sollen hier die Situations-Phantasmata, an denen ‚gezeigt’
wird, beschäftigen. Um rasch zum Ziele zu kommen, will ich nur
die eine Frage beantworten, wie es ist, wenn ein wacher und bei sich
bleibender Mensch (also nicht ein Träumender) selbst sprechend
und schildernd oder als Hörer (Leser) in Erinnerungen ‚versinkt’
oder Phantasiereisen unternimmt und Phantasiekonstruktionen ausführt 1)44.
Wie ist es mit dem sprachlichen Zeigen, das er selbst vollbringt
oder dem er folgt im Phantasma? Er soll dabei unserer Verabredung
gemäß nicht im wahren Sinn des Wortes entrückt werden aus
seiner gegenwärtigen Wahrnehmungssituation. Und ein Normaler
wird es in der Regel auch gar nicht; man erlebt z. B. den Übergang zurück
in die Angelegenheiten des Alltags und zu dem, was der Augenblick
erfordert, durchaus nicht als ein echtes Aufwachen wie aus
einem Traum, wenn man irgendwann am Tage etwa eine anschauliche
133Reiseschilderung oder Romanszene aufgenommen hat. Dies und
einige andere Kriterien, gestatten es, das wirkliche Entrücktsein
von einer noch so lebhaften ‚Versetzung’ bei durchaus gewahrtem
Beisichbleiben scharf genug zu unterscheiden.
Ich sagte Versetzung und habe damit schon den zweiten Hauptfall,
welcher eintreten kann, vorweg genommen. Gleichnishaft
gesagt, ist es entweder so, daß Mohammed zu dem Berg geht oder
der Berg zu Mohammed kommt. Wobei sich der Berg, nebenbei
bemerkt, in sehr vielen Fällen des Lebens viel williger benimmt als
in der Fabel. Oft kommt das Vorgestellte, besonders wenn es sich
um bewegliche Dinge wie Menschen handelt, zu uns, das heißt in die
angegebene Wahrnehmungsordnung hinein und kann dort, wenn nicht
geradezu „gesehen”, so doch lokalisiert werden. Es gibt die mannigfaltigsten
Abschattungen, wie man heute aus den Befunden zur
Eidetik weiß, zwischen dem gewöhnlichen Wahrnehmen mit dem
leiblichen Auge und dem gewöhnlichen Auftauchen des Vorstellungsdinges
vor dem sogenannten geistigen Auge. Doch diese Abschattungen
interessieren uns hier programmgemäß weniger als die
schlichte Tatsache, daß auch das in gewöhnlicher (nichteidetischer)
Art vor dem geistigen Auge auftauchende Vorstellungsding einen
Platz vor, neben oder hinter mir, und direkt unter den Dingen des
Zimmers, in dem ich mich befinde, den Dingen, die ich teilweise
wahrnehme, teilweise vorstelle, erhalten kann. Wer die Probe darauf
machen will, versuche z. B., ob er ein vertrautes Möbelstück im
leeren Wahrnehmungsraum, wo es nie gestanden ist, vorstellungsmäßig
da oder dort unterbringen kann; ob er dorthin blickend
entscheiden kann, wie weit es in die Höhe und Breite reichen und wie
es sich ausnehmen würde im Gesamtmilieu.
Nach den Ergebnissen einer Arbeit von L. Martin können
dies viele Menschen; und wenn es ihnen im Experimente nicht
gelang, z. B. einen vorgestellten Blumentopf anschaulich vor sich
auf den Wahrnehmungstisch zu stellen, so wußten doch die allermeisten
von deutlicher Lokalisation in anderen Fällen, wo der Berg
in irgendeiner der möglichen Erscheinungsweisen zu ihnen gekommen
war, zu berichten. Solche, die in derartigen Fällen gar nichts Optisches
bei sich vorfinden, wissen doch z. B., daß die innerlich gehörte
Stimme des Freundes, um den es sich bei der Erinnerung handeln
mag, jetzt von rechts oder links vor ihnen herzukommen schien.
Man vergegenwärtigt sich ein Gesprächswort, hört es innerlich im
Stimmcharakter des Bekannten und ertappt sich dabei, daß es
erklang, als wäre er, der Sprecher dieses Wortes, hier bei uns am
134Schreibtisch gestanden und hätte es von dort aus an uns gerichtet.
Genug davon. Dieser erste Hauptfall kommt in vielen Varianten
vor und ist als typisch anzusehen.
Genau das Entgegengesetzte liegt vor im zweiten Hauptfall,
wo Mohammed zum Berge geht. Man ist nach einem charakteristischen
Erlebnisvorspiel oder unvermittelt und plötzlich hinversetzt
in der Vorstellung an den geographischen Ort des Vorgestellten,
man hat das Vorgestellte vor dem geistigen Auge von
einem bestimmten Aufnahmestandpunkt aus, den man angeben
kann und an dem man selbst sich befindet in der Vorstellung. Wenn
man sich umdreht in der Vorstellung, dann sieht man, was zuvor
im Rücken war, wenn man wandert, sieht man vorstellungsmäßig
die Dinge wieder wie einst bei der wirklichen Wanderung. Doch ist
es viel bequemer und geht rascher, sich wie im Märchen sprunghaft
versetzen zu lassen an neue Standorte, wohin immer der Gedanke
vorauseilt. Eine Erzählungstechnik, die der kindlichen Leistungsfähigkeit
angepaßt ist, und das moderne Kino suchen manchmal die
Vorstellung als solche zu unterstützen; in Tausend und einer Nacht
erhebt man sich mit einem Wundervogel in die Luft, das Kino
führt rasch durch ein paar überlagerte Bilder von einem zum anderen
Standort über. Die Analyse J. Segals, auf dessen sorgfältige Arbeit
ich mich hier neben anderem stütze, fand zu all dem Analoga im
Erlebnis seiner erwachsenen und geübten Beobachter.
Nun eines noch, was beim ersten Hören sehr merkwürdig klingt,
aber durchaus gesichert und theoretisch konstruierbar ist. Es gibt
einen Zwischenfall zwischen Hierbleiben und Hingehen; Berg und
Mohammed bleiben jeder an seinem Ort, aber Mohammed sieht den
Berg von seinem Wahrnehmungsplatz aus. Dieser dritte Hauptfall
ist meist ein labiles und unbeständiges Eingangserlebnis. Sein
Erkennungszeichen liegt darin, daß der Erlebende imstande ist,
die Richtung, in welcher das Abwesende vom geistigen Auge gesehen
wird, mit dem Finger anzugeben. Ungefähr so, wie unser Stadtwanderer
die Richtung nach dem Bahnhof angibt. Ich frage z. B.
500 Hörer in der Vorlesung ‚wo ist der Stephansdom?’ und schätzungsweise
300 Zeigefinger erheben sich und deuten (mit allerhand interessanten
Abweichungen) im Raum des Hörsaals. Sehr häufig ist,
wie gesagt, dieser dritte Hauptfall nicht bei einigermaßen verwickelten
und in sich abgeschlossenen Phantasieschilderungen. Das Märchenland
liegt psychologisch gesprochen im Irgendwo, das mit dem
Hier nicht angebbar verbunden ist. Doch kann es auch anders sein
und der dritte Hauptfall fixiert bestehen bleiben.135
Alles zusammen macht uns viele von Segal sorgfältig beschriebene
Züge am Wandern in der Vorstellung verständlich. Man
versteht auch, um es noch einmal zu sagen, vieles in der Erzählungstechnik
und der einfachen Funktionslust des Vorstellens,
die das Märchen bereitet, erst, wenn man, was hier nur andeutend
geschildert wurde, genauer studiert. Und von dem
Grimmschen Märchen mit seiner einfachen, psychologisch leicht
durchschaubaren Führungstechnik muß es allerhand Wege und
Übergänge zu raffinierteren Erzählungstechniken geben, die wir
Psychologen freilich im einzelnen wissenschaftlich nicht kennen.
Aber wie verschieden diese raffinierten Schilderer auch vorgehen
mögen, so wage ich bis zum Beweis des Gegenteils die Behauptung,
daß unter die angegebenen drei Hauptfälle schematisch alles zu
bringen ist, was sie an Phantasiesteuerungen und an Deixis am Phantasma
fertig bringen.
7. Nun ist es an der Zeit, sich darauf zu besinnen, daß in der
Wissenschaft auch die treffendsten Bilder, die vorübergehend unvermeidlich
sind und gute Dienste leisten, schließlich durch Begriffe
ersetzt werden müssen. Die Fabel von Mohammed und dem
Berg lieferte der Beschreibung ein bequemes Bild, auch die Rede
von ‚Versetzungen’ in der Vorstellung ist bildhaft. Können diese
Bilder aufgelöst und durch Begriffe ersetzt werden? Ich glaube
ja. Denken wir noch einmal an die Tatsache, daß die Origo der
Sehrichtungen, das anschauliche Hier, in Verbindung mit dem Körpertastbild
„wandert”. Der Fußgänger, Reiter oder Fahrer pflegt in
einer Landschaft so orientiert zu sein, daß die erlebte Bewegungsrichtung
maßgebend ist und sein ‚Vorn’ bestimmt. Schon diese
Orientierung enthält, wenn man genauer zusieht, die entscheidende
Befreiung von der momentanen Körperlage und erfordert unter
Umständen die Versetzung in eine fiktive Haltung, wenn der Bewegte
das ‚Rechts und Links’, in das die Landschaft von seiner Bewegungsrichtung
zerschnitten wird, angeben soll. Man wird sich
ähnlicher Einstellungen deutlich bewußt, wenn in der Erzählung
z. B. vom rechten und linken Rheinufer oder Seineufer die Rede
ist; jeder weiß, daß solche Angaben des Erzählers dem Leser mitunter
Schwierigkeiten bereiten. Der Leser muß sich manchmal besinnen
und eigens innerlich einstellen oder umstellen, um sie richtig
zu vollziehen, und es gibt mehr als nur eine Technik, um das zustande
zu bringen. Jedenfalls aber spürt jeder, dem es kraft einer Versetzung
gelingt, daß zu guter Letzt sein momentanes Körpertastbild
daran beteiligt ist. Köln: Deutz = linksrheinisch : rechtsrheinisch —
136wenn ich mir dieses Sachverhaltes auf eine Besinnung hin deutlich
bewußt werde, verspüre ich die Bereitschaft meiner Arme, hie et
nunc als Wegweiser zu fungieren. Die Tatsachen der Versetzung
in der Vorstellung müssen, wenn mich nicht alles täuscht, von derartigen
Beobachtungen aus ihre wissenschaftliche Aufklärung erfahren.
Es ist so, wenn sich Mohammed zum Berge ‚versetzt’ vorkommt,
daß sein präsentes Körpertastbild mit einer phantasierten
optischen Szene verknüpft wird. Deshalb vermag er als Sprecher
die Positionszeigwörter hier, da, dort und die Richtungsangaben
vorn, hinten, rechts, links genau so am Phantasma wie in der primären
Wahrnehmungssituation zu verwenden. Und dasselbe gilt für den
Hörer.
Der Hörer versteht sie, wenn er selbst in ähnlicher Weise
‚versetzt’ ist, d. h. wenn sein eigenes präsentes Körpertastbild mit
einer korrespondierenden optischen Phantasieszene verknüpft ist.
Text: ‚Du gehst in Wien über den Graben an der Pestsäule vorbei
auf den Stock im Eisen zu und plötzlich steht halb links der Stephansdom
vor dir’. Nun ja, wer dort war, wandert mit und sieht die Dinge
aus seiner Erinnerung. Wer nicht dort war, wandert in einer Ersatzstadt,
die er kennt, in Straßburg oder Freiburg i. Br. Das erforderliche
Minimum an Harmonie zwischen Führer und Geführtem
variiert nach dem, was an Details gezeigt werden soll. Das ärmste
Schema einer Gasse mit einem Ausblick an der Ecke genügt immer
noch, um den nackten Sinn der Zeigwörter zu vollziehen und (was
die Hauptsache ist): die Koordinaten des ganzen Zeigfeldes sind
deshalb konstant, weil sie den eisernen Bestand der Orientierung
jedes wachen Menschen in seiner präsenten Wahrnehmungssituation
bilden.
Hier wird deutlich, was wir meinten mit der Feststellung,
es sei eine Täuschung anzunehmen, daß dem Zeigen am Phantasma
die natürlichen Zeighilfen abgingen. Sie gehen ihm deshalb und
soweit nicht ab, als Versetzungen stattfinden und jeder Versetzte
das präsente Körpertastbild ‚mitnimmt’, bildlich gesprochen. Er
nimmt es mit im zweiten Hauptfall (Versetzung); er behält von
vornherein das präsente Körpertastbild samt seiner optischen Wahrnehmungsorientierung
im ersten Hauptfall und ordnet das Phantasierte
ein. Der dritte Hauptfall erweist sich als ein additives Ganzes
oder anders ausgedrückt als eine Superposition aus zwei Lokalisierungen,
deren eine dem ersten, deren andere dem zweiten Hauptfall
begrifflich einzuordnen sind. Wieweit man zu superponieren
oder sonstwie zu kombinieren vermag, bleibt vom rein Psychologischen
137her eine offene Frage. Wir erwarten Aufklärungen darüber
von den Kennern der Sprachen und der zentralen Sprachstörungen.
8. Es ist kaum nötig zu beweisen, daß ein Horizont von weiteren
Fragen durch das Gesagte für die Sprachpsychologie erschlossen ist.
Man müßte, um dem skizzierten Tatbestand, den die Psychologen
festgestellt haben, systematisch am Sprechdenken nachzugehen, alle
sprachlichen Erscheinungen daraufhin prüfen, ob und wieweit sie
einen der drei Hauptfälle, Abwesendes zu präsentieren, einschließen
oder voraussetzen. Letzten Endes ist es aber, gleichviel welcher
Hauptfall vorliegen mag, immer so, daß das Abwesende an die
für den geordneten Sprechverkehr unentbehrliche Orientierung der
Partner in ihrer Wahrnehmungssituation angeschlossen oder in
sie aufgenommen wird. Es ist ein ungemein feines und von uns Erwachsenen
kaum noch bemerktes Spiel von Versetzungen im Gange,
wo immer wir sprachlich am Phantasma demonstrieren. Man verfolge
z. B., um aufs Geradewohl irgendwo sich selbst das Unbemerkte
wieder sichtbar zu machen, die Positionszeigwörter Brugmanns
in einem geeigneten Text, einer anschaulichen Schilderung. Angenommen
der Held wird nach Rom geschickt und der Autor steht
vor der Wahl, ob er erzählend mit einem dort oder hier fortfahren
soll. ‚Dort stapfte er den lieben langen Tag auf dem Forum
herum, dort…’. Es könnte ebensogut hier heißen; was ist der
Unterschied? Das hier impliziert eine Versetzung Mohammeds
zum Berge, während ein dort an solcher Kontextstelle den dritten
Hauptfall fingiert.
Ob jeder Leser die sprachlichen Anweisungen exakt befolgt
oder nicht, ist eine andere Frage. Einem mindestens durch seine
Märchenzeit hindurchgegangenen und ‚dort’ vorgeübten Hörer
oder Leser fällt das eine so leicht wie das andere. Er vollzieht die
Fernschau von seinem Wahrnehmungsort oder von einem Phantasieort
aus ebenso leicht und unbemerkt, wie er z. B. die Anweisungen
des Präteritums und Futurums der indogermanischen Sprachen
entweder von seinem anschaulichen Jetzt oder einem anderen
Fixpunkt der phantasierten Zeitlinie aus vollzieht. Das Plusquamperfektum
und das Futurum exactum ‚necaverat oder necaverit eum’
bestimmen den Vorgang so, als könne der Sprecher und seine Hörer
ihn vom Jetzt aus über eine Zwischenversetzung hinweg als vollendet
erkennen. Ob der zuvor oder nachträglich im Texte angegebene
Versetzungspunkt in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt,
macht in Hinsicht auf die Phantasieanforderungen nicht den mindesten
Unterschied aus. Wieweit die Sprachen überhaupt zu gehen
138vermögen mit derart kombinierten und gehäuften Versetzungsanforderungen,
ist einstweilen psychologisch nicht abzusehen 1)45.
Wohl aber erkennt der Theoretiker die zentrale Bedeutung
der Versetzungen und Versetzungstechniken hinüber und herüber.
Der Mensch vermag nur deshalb mit sprachlichen Mitteln Abwesendes
einem anderen im Phantasma zu präsentieren, weil es
Versetzungen gibt. Handelt es sich bei einer Erzählung (im einfachsten
Grenzfall, den man sich ausdenken kann) um nichts anderes
als um die Wiedererweckung einer vom jetzigen Sprecher und jetzigen
Hörer gemeinsam erlebten Szene, die noch frisch in beider Gedächtnis
haftet, dann bedarf es nicht vieler Worte. Vor allem können
Nennwörter, welche die Wasbestimmtheit der Dinge und Ereignisse
angeben, gespart werden. Es bedarf nur einer Aufstellungsskizze,
um den präsenten Wahrnehmungsraum zur Bühne umzugestalten,
auf welcher der Sprecher mit sinnlichen Gesten Anwesendes zu
zeigen vermag. Der mitwissende Hörer wird ‚dort’ jetzt mit geistigem
Auge wiedersehen, was er damals mit leiblichem gesehen hat.
Kaum anders, wenn der Hörer zwar diesmal nicht mit dabei
war, aber eine ihm dem Typus nach geläufige Handlung, sagen wir
eine homerische Rauferei, geschildert wird. ‚Ich hier — er dort —
da ist der Bach’, so beginnt der Erzähler mit hinweisenden Gebärden
und die Bühne ist fertig, der präsente Raum ist zur Bühne umgestaltet.
Wir Papiermenschen greifen bei solchen Gelegenheiten
zum Bleistift und skizzieren die Lage mit ein paar Strichen. Ich
will z. B. den Verlauf der Entscheidungsschlacht zwischen Cäsar
und Pompeius, wie ihn Plutarch schildert, anschaulich und mit
Zeighilfen nacherzählen und entwerfe eine Strichskizze: ‚Dies ist
Cäsars Schlachtlinie — hier die zehnte Legion —hier die Reiterei —
hier er selbst. Dies ist die Schlachtlinie des Pompeius usw.’ Von
Derartigem muß man ausgehen, um psychologisch die elementarste
sprachliche Deixis am Phantasma zu studieren. Wenn keine Zeichenfläche
vorhanden ist, kann ein lebhafter Sprecher auch den eigenen
Körper mit zwei ausgestreckten Armen vorübergehend zum Schema
der Schlachtlinie ‚verwandeln’.
Doch ich muß abbrechen, weil dazu vorerst nichts Geschlossenes
und sorgsam Beobachtetes zu sagen wäre. Mir persönlich
steht lebhaft in Erinnerung eine Nacht in San Francisco, wo uns
139ein chinesischer Student als Cicerone in ein chinesisches Theater
führte. Was da vorging auf der Bühne, war geradezu paradigmatisch
auf schlichteste Deixis am Phantasma abgestellt. Zum Beispiel:
zwei Heere (geführt das eine vom Prinzip des Bösen in schwarzer
Maske, das andere vom lichten Prinzip des Guten) mimen eine
Schlacht. Auf der Bühne stehen faktisch zwei lange Tische in kleinem
Abstand, das Spatium zwischen ihnen bedeutet einen Fluß; ein
Brett darüber: die Brücke; ein nicht mitspielendes Faktotum entfernt
das Brett: die Brücke ist abgebrochen; eine Gruppe von Spielern
mit Wedeln aus Pferdeschweifen in der Hand: die Reiterei;
die Wedel auf den Boden geworfen: die Reiter sind abgesessen usw.
Psychologisch gesehen ist das gar nichts anderes als ein systematisiertes,
von tausend Konventionen getragenes Fiktionsspiel, das
ohne solche Konvention und mit souveräner Willkür aber zu guter
Letzt doch mit ähnlichen Mitteln in allen Kinderstuben der Welt
tagtäglich gespielt wird. Das Kind und das chinesische Theaterspiel
— vielleicht wären das gutgewählte Beobachtungsbeispiele;
Endpunkte in vieler Hinsicht einer Entwicklungslinie und nahe
benachbart in anderer Hinsicht. Jedenfalls belehrt beides uns
faßlich an den hin- und hergeschobenen, sinnlich konkreten Dingen
über das, was im Falle des dramatischen Verfahrens mit und im Falle
des epischen Verfahrens ohne solch gröbere Hilfen überall, wo einer
den anderen am Phantasma führt, vonstatten geht. Ausgewertet wird
überall das Orientierungsfeld der gegenwärtigen Wahrnehmungssituation
und gearbeitet wird mit Versetzungen wie im Epos oder Zitierungen
von Abwesendem in den Präsenzraum hinein wie im Drama.
Wer einmal das Gesamtgebiet der von der anschaulich erzählenden
Rede supponierten Versetzungen bestimmen und
beschreiben will, vergesse die oft recht merkwürdigen Erscheinungen
der ‚direkten’ und ‚indirekten’ Rede und ihre Mischungen nicht;
er denke auch an die ‚Nebensätze’, wenn er schildern will, wieweit
hinein in den Herrschaftsbereich des Symbolfeldes der Sprache
das Zeigfeld und mit ihm das ‚dramatische’ Verfahren und das
‚epische’ Verfahren greift. An diesem Punkt sei das Thema hier
verlassen und später wieder aufgenommen.
§ 9. Das egozentrische und topomnestische Zeigen
in den Sprachen.
Nacheinander kamen in unserer Darstellung das Ergebnis der
indogermanischen Sprachvergleichung und das Ergebnis indogermanischer
Psychologen zum Wort, um Zeigarten und Modi des lautsprachlichen
140Zeigens aufzuklären. Die Sprachtheorie hat ein vitales
Interesse an der Frage, ob damit nur Indogermanisches, vielleicht
in dem und jenem Punkte Allzu-Indogermanisches, geschildert
wurde. Denn das Unternehmen der Sprachtheorie, wie ich es sehe,
steht oder fällt mit der Durchführbarkeit oder Undurchführbarkeit
der Forschungsidee, etwas Belangreiches über die Struktur der
Menschensprache im Singularis zu ermitteln und die bekannten
Unterschiede im Bau der Sprachen verschiedener Sprachfamilien
als mögliche Varianten aufzufassen. Mit Abstammungsfragen hat
diese Forschungshypothese zunächst und unmittelbar noch nichts
zu tun; denn es konnte dieselbe Grundstruktur ebensogut vielstämmig
wie einstämmig erreicht worden sein.
Wer die Beweise für die Entstehungen gleich strukturierter Gebilde auf getrennten
Entwicklungslinien, wie sie im Bereiche der ethnologischen Tatsachen
vielfach versucht worden sind, nicht als gelungen ansieht, mag sich bei den vergleichenden
Zoologen und Botanikern umsehen. Und wenn er auch dort nichts Entscheidendes
zu finden glaubt, nun so ist es seine Sache, eine nachgewiesene Gleichheit
der Grundstruktur aller Menschensprachen in Parallele zu stellen mit dem heute
kaum bezweifelten Befunde einer weitgehenden Übereinstimmung des Körperbaues
der Menschen in Abhebung von den nächstverwandten Tieren. Sprechen und Menschsein
ist ein Thema von bestrickendem Reize, zu dem das Schicksal der Forschungsidee
von der Strukturgleichheit der Sprachen wohl den entscheidendsten Beitrag
liefern wird. Allein zu guter Letzt wäre auch ein einheitliches Menschsein sowohl
polyphyletisch wie monophyletisch begreifbar; der Unterschied liefe, wenn die generelle
Entwicklungsidee bestehen bleibt, ja nur darauf hinaus, ob das neue Blatt ‚Mensch’
in der Geschichte animalischer Lebewesen mehrmals oder nur einmal aufgeschlagen
worden ist. Wozu vor allem definiert sein müßte, was zum Menschsein gehört.
Die Angelegenheit des Zeigfeldes der Sprache ist einfacher
zu erledigen als die des Symbolfeldes; ich sehe auch greifbarer
hier als dort die rückfließende empirische Fruchtbarkeit der Sprachtheorie.
Zuerst aber gilt es, volle Klarheit darüber zu gewinnen,
wo der Bereich des Möglichen offen bleibt und von keiner Sprachtheorie
als solcher zur Zeit geschlossen werden kann. Dann erst
sollen die zwei von Psychologen im Bereich des Vorstellungslebens
gefundenen Arten des Vorgehens beim Zeigen im Hinblick auf bestimmte
Sprach tat Sachen behandelt werden.
1. Wo Wegener und Brugmann, die Pioniere einer sachgerechten
Lehre von den sprachlichen Zeigsignalen, die Umstände
aufzählen, welche in konkreter Sprechsituation mitbestimmend
werden können für den Verkehrswert der Lautzeichen, da erwähnen
sie mit Recht gar vielerlei; z. B. auch, den gegenseitig bekannten
Beruf (und das Geschäft) der Gesprächspartner. Wer dies liest,
denkt zunächst an die Tatsache, daß Jäger ihre Jägersprache
und Studenten ihre Studentensprache mit teilweise eigenem Lexikon
141und Sprachgewohnheiten haben. Das gehört im ganzen nicht hierher.
Doch sei an einem einzigen Beispiel verdeutlicht, wie selbst Zeigwörter
noch durch soziale Umstände beeinflußt werden können.
Nach W. Schmidt gibt es in Australien streng exogame Gemeinschaften,
bei denen die Frauen stets aus fremden Stämmen geholt
werden und dann in der neuen Umgebung ihre eigene Sprache
weitersprechen auch in Wechselrede mit den anders sprechenden
Männern. Man versteht sich gegenseitig, aber nimmt selbst das
Fremde nicht an. Dabei kommt es z. B. zu der merkwürdigen Erscheinung,
daß das wir aus dem Mund der Männer anders lautet,
wenn es die angeredete Frau aus der fremden Sippe das eine Mal
einschließt und das andere Mal ausschließt; es gibt ein inklusives
und ein exklusives ‚wir’. Ich habe die einleuchtende Interpretation
von Schmidt gleich mit eingeflochten; man kann aber die merkwürdige
Erscheinung eines inklusiven und exklusiven Pronomens
der ersten Person Pluralis auch freidenken von solch ganz spezifischen
Verhältnissen und die Frage nach dem Durchscheinen
sozialer Ordnungen in den Zeigarten der Sprache verallgemeinern.
Die Mannigfaltigkeit des Möglichen in dieser Hinsicht kann
die Sprachtheorie bestimmt nicht überblicken; sie wünscht sich
statt dessen konkrete Untersuchungen, die das Wirkliche abschreiten
und mehr davon, als heute bekannt ist, sichtbar machen.
Doch überlegen wir einmal genau, was vorliegt in der Doppelform
des inklusiven und exklusiven ‚wir’ Der Funktion nach scheiden
sich auch in unserem Sprechen die Fälle, wo ein Sender bei ‚wir’
den Empfänger einschließt, von den Fällen, wo er ihn ausschließt
und vielleicht geradenwegs zu einer anderen, zur Ihr-Partei rechnet.
Nur differenziert unsere Sprache beide Fälle nicht phonologisch
(‚phonematisch’ möchte man lieber sagen). ‚Unsere Sprache’ ist la
langue allemande; denn der Sprechakt (la parole) eines deutschen
Senders von ‚wir’ ist oft und mit Erfolg darum bemüht, keinen Zweifel
über den Einschluß oder Ausschluß aufkommen zu lassen. Und wenn
es der Laut nicht tut, so wird die Diakrise auch einmal der Geste
aufgetragen; man deutet irgendwie den Kreis der in das Wir Eingerechneten
mit der zeigenden Hand an oder markiert die Scheidelinie
zwischen der Wir-Partei und den anderen. Oder, wenn alle
Stricke reißen und ein naheliegendes Mißverständnis verhindert
werden muß, so zählt man eben erläuternd auf: ‚Wir sc. ich und du’
oder ‚wir sc. ich und meine Frau zu Hause’.
Kein Zweifel, daß das Aufkommen und die Befriedigung derartiger
Unterscheidungsbedürfnisse im Rahmen einer umsichtig
142ausgeführten Lehre vom lautlichen Zeigen Platz haben muß. Doch,
um es noch einmal zu sagen, erschöpfend aufzuzählen, was sonst
noch an verwandten Erscheinungen dazu gehören mag, ist unmöglich.
Im Vorbeigehen nur noch ein allgemeines Wort über das ‚wir’.
Wie das ‚ich’, so setzt natürlich auch das ‚wir’ zu seiner Erfüllung
eine Zeighilfe voraus; aber es scheint von vornherein schon um einen
Schritt weiter als das ‚ich’ vom Grenzwert eines reinen Zeigzeichens
entfernt zu sein. Denn es fordert doch irgendwie zur Bildung einer
Klasse von Menschen auf; das inklusive ‚wir’ z. B. verlangt eine
andere Gruppenbildung als das exklusive. Und Klassenbildung ist
nun einmal das Vorrecht der nennenden Wörter, der sprachlichen
Begriffszeichen. Wohl möglich, daß das Moment der Einzahl,
welches demgegenüber auf unserer Sprachstufe in dem ‚ich’ enthalten
ist, erst durch Opposition prägnanter hervorkam. Durch
Opposition mit einem dazugetretenen Dual- und Plural-Senderzeichen.
Und dieses prägnante Singularmoment ist dann logischerweise
ebenso keine Angelegenheit des reinen Zeigens mehr, sondern
der erste Schritt eines Nennens; wenn hundert deutsche Sprecher
‚ich’ sagen, so ist dieses Singularmoment nicht von Fall zu Fall
ein anderes, sondern gehört zu jenem von uns bereits umschriebenen
Minimum, worin die logische Grundbedingung eines Begriffszeichens
auch für das ich-Wort noch erfüllt erscheint.
Verwunderlich könnte das nur dem vorkommen, der die
sachgerechten Abstraktionen nicht zustande bringt. Gewiß kann
jedes Zeigzeichen eine Nennfunktion übernehmen; denn sonst gäbe
es ja keine Pronomina.
Die zweifelnde Zwischenfrage, ob das alles nicht dazu angetan
sei, die Scheidung von Zeigen und Nennen wieder aufzuheben oder
zu durchlöchern, muß kategorisch verneint werden. Sonst war das
bis hierher Gesagte vergebens aufgewendete Mühe und Beckmesser
logisticus kann das kaum verstummte Hohnlied über ganze Klassen
„sinnloser Wörter” in der gewachsenen Sprache von neuem anstimmen.
Die Linguistik aber wird auf dem rechten Geleise sein
und bleiben, wenn sie sich volle Rechenschaft darüber abverlangt,
was sematologisch gesehen eintrat, als die deiktischen Partikeln
zu deklinierten Wörtern in den indogermanischen Sprachen umgewandelt
worden sind. Damals nahm ein ihnen zum Zeigen hinzu
aufgegebenes Nennen eine Lautgestalt an. Nicht alles sematologisch
Aufgetragene muß phonematisch manifest werden; das
zeigt unser Beispiel von dem inklusiven und exklusiven ‚wir’ im
Deutschen und ließe sich tausendfach anders auch noch belegen.
143Wo Emil Winkler dies im Auge hat und unterstreicht in seinen
„Sprachtheoretischen Studien”, stehe ich auf seiner Seite. Aber
es kann doch sein, ja es muß im ausreichenden Maße der Fall sein,
daß die Sprache (la langue) das Stadium einer amöbenhaften Plastizität
von Sprechsituation zu Sprechsituation in einigem aufgibt,
um auf höherem Niveau mit teilweise festgewordenem, erstarrtem
Gerät dem Sprecher in neuer Hinsicht Produktivität zu gestatten.
Das „reine” Zeigsignal ist, war oder wäre, wenn es vorkommt,
vorkam oder vorkäme, ein Wegpfeil ohne aufgeschriebenen Namen
und sonst nichts; man löscht die Pfeilfunktion am Wegweiser nicht,
wenn man einen Ortsnamen aufmalt und genau so wenig wurde sie
gelöscht, als aus den Partikeln der to-Deixis Wörter wie das deutsche
der hervorgegangen sind. Diesem ‚der’ ist zum mindesten soviel
an Nennfunktion aufgegeben, daß es im Symbolfeld der übrigen
Nennwörter Platz nehmen kann; daher der korrekte Name Pronomina.
2. Ein anderer Hauptfall, wie reine Zeigpartikeln oder Zeigsignale
eine Nennfunktion mit übernehmen können, ist an den
lateinischen Positionszeigwörtern abzulesen, wo diese Möglichkeit
systematisch ausgestaltet wurde. Wie ist sematologisch zu beschreiben,
was wir an bekannten Dreiergruppen wie hie, hinc, huc;
istic, istinc, istuc; illic, Mine, illuc vor uns haben? Das ist, so denke
ich, anzugeben präzis nach dem Rezepte, das uns die Übersetzungen
aus dem Lateinischen in solche Sprachen, welche jenen Reichtum
nicht aufweisen, vorlegen. Wir bilden deutsch (außerhalb der abgeblaßten
und mehrdeutig gewordenen Analoga ‚her’ und ‚hin’ zu
‚hier’) Zweiwort-Gruppen wie von hier und von dort. Präpositionen
wie von, in, auf sind echte (zeigfreie) Nennwörter und das
jenen lateinischen Bildungen außer dem Positionszeigen mit Aufgetragene
ist auch nichts anderes als eine Nennung. Begrifflich
bezeichnet werden die drei einfachsten und zugleich allgemeinsten
Relationen, die ein Etwas, z. B. ein Geschehen, zu einem zeigend angegebenen
Ort haben kann. Das Geschehen kann an dem zeigend
bestimmten Platz, von ihm weg, auf ihn zu verlaufen. Auch das
ist eine Angelegenheit begrifflicher Bestimmung und muß aus der
Lehre vom Zeigfeld ausgeschieden werden. Wollte einer anfangen
aufzuzählen, was einem Zeigwort sonst noch an Derartigem aufgegeben
werden kann durch diese oder jene phonematische Modulation,
so wäre das ein aussichtsloses Unterfangen Man verweise
den Draufgänger auf gewisse exotische Sprachen, um seine Phantasie
zu beflügeln, aber zugleich die Einsicht in ihm vorzubereiten, daß
144solche Vorkonstruktionen in Ermangelung anderer Daten, die man
dazu nötig hätte, unausführbar, d. h. unvollendbar sind.
Eine Randbemerkung über das deutsche her und hin. Daß sie zu hier gehören,
ist bekannt; ich denke jetzt nicht an Morphologisches, sondern frage als
Sematologe, wie das deutsche System heute sich verhält zu dem geschlossenen System
des lateinischen hie, huc, hinc. Recht merkwürdig und zwiespältig verhalten sich
her und hin semantisch. ‚Er kommt her’ trifft den Zielpunkt der Reise im hier;
aber in Wendungen wie ‚von Berlin her nach Breslau hin’ fängt unser Sprachgefühl
an schwankend zu werden. Wo muß hier (der wirkliche oder fiktive Standort
des Sprechers) sein im letzten Fall? Wenn zwischen Berlin und Breslau, ist die
Sache noch relativ einfach. Allein er muß gar nicht unbedingt dort gesucht werden,
sondern kann weitgehend unbestimmt sein. So gut wie ganz gelöst vom hier,
empfinde ich persönlich ein hin in Verwendungen wie ‚der Wind streicht über den
See hin’. Sonst ist viel stärker für mein Sprachgefühl die Koppelung des her an
den Ausgangspunkt der Bewegung und korrelativ dazu die des hin an den Zielpunkt;
es dürfte also in diesem Punkte heute eine Umorientierung des Sprachgefühls gegenüber
der älteren Sprache vorliegen. Die Zusammensetzungen ‚dahin, dorthin, hierhin’
deuten als solche schon an, daß das System gewiß nicht mehr so fest ist wie das lateinische
hie, huc, hinc. Das hierhin neben hie(r)her enthält eine deutliche Aufforderung
zu einer Versetzung; mein fiktiver Standpunkt als Sprecher fällt bei hierhin nicht
zusammen mit dem faktischen. Ausländern bereiten diese merkwürdigen Verhältnisse
bekanntlich ebenso große Schwierigkeiten, wie uns anfänglich etwa die lebendige
iste-Deixis neben einer der-Deixis (man denke an das Italienische als Beispiel).
Ein weiteres (noch nicht das letzte) Beispiel einer interessanten
Superposition eines Nennens über das Zeigen bieten in allen Sprachen
die Konjunktionen; davon einiges im Paragraphen von der Anaphora.
3. Und nun etwas, was uns auf die Scheidung egozentrischer
und topomnestischer Zeigarten vorbereiten soll. Jemand könnte
sich zum Scherze oder als fanatischer Bevorzuger des Nennens die
Aufgabe stellen, alle Zeigwörter aus dem Lexikon zu streichen und
doch im Verkehr mit Gesinnungsgenossen den Sprechbedürfnissen,
die das Gestrichene in unserer gewachsenen Sprache erfüllt, gerecht
zu werden. Einfachster Vorschlag: wir sagen nicht mehr ‚hier’,
sondern ‚Fuß’ und nicht mehr ‚ma oder dort’ unter Mitbenützung
der Zeigegeste, sondern wir führen Namen für Körperteile wie
‚Stirn’, ‚Rücken’, ‚Herz’ und ‚Leber’ ein und richten uns nach der
Konvention, daß ‚Rücken’ vom Sender nach hinten, ‚Stirn’ soviel
wie ‚vom Sender nach vorn’ bedeutet. Es könnte natürlich auch der
Empfänger zum Koordinatenträger gemacht oder diese Rolle irgendwie
erkennbar auf beide Gesprächspartner verteilt sein. Was dann?
Ich schlage der neuen Gemeinschaft als Parole vor: die Zeigwörter
in unserem Sprachverkehr sind tot, es lebe das Zeigen. Denn man
hätte nur bestimmte Wörter, aber nicht das Zeigen selbst gestrichen
aus der Liste der Kommunikationsmittel.145
Nun, die ganze Fiktion wäre eine müßige Seifenblase in diesem
ernsten Buch, wenn es nicht bestimmte gewachsene Menschensprachen
gäbe, die von fern nach dem fingierten Rezepte faktisch
Zeigbedürfnisse lautsprachlich befriedigen; ob alle Zeigbedürfnisse
auf einmal, ist eine andere Frage, aber einige jedenfalls. Das ‚ich’
und ‚du’ wären natürlich ebenso einfach zu bewältigen durch die
Konvention, daß etwa ‚Mund’ das Senderzeichen und ‚Ohr’ das
Empfängerzeichen sein soll; oder aber man verwendet statt ‚ich’
und ‚du’ die Eigennamen wie tatsächlich manche unserer sprechenlernenden
Kinder.
Es wäre vorteilhaft, einen guten Namen zu haben für die vorerst
nur fiktiv geschilderte Art und Weise, Zeigbedürfnisse des
Sprech Verkehrs zu befriedigen. Sie ist sprach theoretisch deshalb
von hohem Interesse, weil in ihr exakt die Umkehrung der Pronomina-Genese
aus reinen Zeigpartikeln vorliegt. Denn machen
wir uns (wieder rein fiktiv) das Folgende deutlich: Sender
und Empfänger A und B (sagen wir der Romantik wegen zwei
Bärenhäuter auf der Jagd) müssen sich durch Zeichen aufmerksam
machen auf Dinge im Wahrnehmungsfelde. Die Urindogermanen
scheinen eindeutig zuerst gezeigt und dann mit ihren Zeigwörtern
auch genannt zu haben. Zuerst das to mit Fingergeste; und dann
aus dem to das Brugmannsche Musterbeispiel der. In der kommt
näher vertritt das Zeigwort in der Tat das in konkretem Fall vielleicht
überflüssige Nennwort ‚Bär’ oder ‚Büffel’. Das alles erscheint uns so
natürlich, als ob es gar nicht anders sein und irgendwo einmal
gewesen sein könnte. Warum ‚Nase’ oder ‚Rücken’ sagen, wenn
man sich des zeigenden Armes bedienen kann? Das wüßte ich,
offen gestanden, auf Anhieb auch nicht zu beantworten.
Aber etwas anderes halte ich für leicht begreifbar und psychologisch
ebenso einfach wie das Fingerzeigen, nämlich ein topomnestisches
Verfahren. Kennen A und B ihren Jagdgrund und sind sie
in ihm nach vertrauten Landmarken orientiert, so können als Richtungsangaben
die Namen der Landmarken dienen. So gibt man ja,
wenn ich mich recht erinnere, bei der Kavallerie Befehle wie ‚Richtung
Waldspitze’ oder ‚Pappelbaum’. Und wo Landmarken fehlen
wie in der Steppe, da empfiehlt sich die Himmelsorientierung wie
bei Seefahrern; auch wohlbekannte Windrichtungen sind für einen,
der sie sich auf unabsehbar ebenem Plane als lebenswichtig gemerkt
hat, gar nicht ungeeignet als Leitfäden zu fungieren. Letzten Endes
kommt es ja nur darauf an, daß der Empfänger irgendeinem
Leitfaden folgen kann und mit seinen Augen den Gegenstand
146findet, auf den er hingelenkt werden soll. Jedenfalls aber sind die
Psychologen, sogar solche Psychologen, die ihr Lebtag keine Jäger
und Bärenhäuter waren, mit der Nase darauf gestoßen, daß es auch
in unserem Vorstellungsleben etwas gibt, was den eigenen Namen
topomnestisches Verfahren verdient. Und bei allen Kommunikationsmitteln,
die auf topomnestische Orientierung basiert sind
und an sie appellieren, steht das Nennen obenan und geht voraus.
Warum sollen also, wenn bei uns Zeigzeichen pro nominibus stehen,
unter anderen Verhältnissen nicht Nomina für Zeigzeichen eingetreten
sein? Das ist eine psychologisch jedenfalls ausdenkbare
Möglichkeit und man müßte sie terminologisch fixieren durch eine
Neubildung wie Prodemonstrativa 1)46.
Indogermanisten mögen das alles beiseite schieben; es geht
andere an, z. B. die Kenner der Indianersprachen und in einigem,
wie es scheint, die Kenner des Japanischen. Ich schlug Herrn Dr.
Sonneck und Herrn Dr. Locker vor, sich einmal ernstlich und
quellenmäßig nach dem Vorkommen der von mir rein als möglich
erfaßten Prodemonstrativa umzusehen. Sie taten es und berichten
über ihre Ausbeute so:
Wir wollen an Beispielen die Möglichkeit des topomnestischen Prinzips in
der Sprache zeigen. Mag sein, daß Fachkenner entlegenerer Sprachen klarere und
vollständigere Beispiele geben könnten — die Anregung einer umfassenderen vergleichenden
Untersuchung dieser Erscheinungen wäre natürlich ein erfreulicher
Erfolg unserer theoretischen Bemühungen; mag sein, daß einzelnes an unseren Belegen
und ihrer Auswertung korrekturbedürftig ist; aber es kommt uns hier nur auf
illustrierende Beispiele, nicht auf einen Nachweis der genauen Ausdehnung dieser
Erscheinungen an.
a) Für das Japanische stützen wir uns auf das Lehrbuch der japanischen
Umgangssprache von Rudolf Lange, Berlin 1906. Diese Sprache besitzt (Lange,
S. 43) ein System von Demonstrativen (im engeren Sinn), das dem lateinischen hic,
iste, ille völlig entspricht; kóno (subst.) und kóre (adj.) beziehen sich auf Personen
bzw. Gegenstände, die sich vor der redenden Person, sóno und sóre auf solche, die
sich vor der angeredeten Person befinden, áno und áre auf solche, die von beiden
entfernt sind. Während hier also wie übrigens auch bei gewissen Dubletten von
Verben (Lange, S. 161) die „Rollen” der Gesprächspartner, die „Personen” als
differenzierendes Moment vorausgesetzt sind, gibt es auffallenderweise keine oder
fast keine primären Personalpronomina, keine ursprünglich für diesen Zweck
geschaffenen Rollenzeigwörter (Lange, S. 33). Dafür treten als Prodemonstrativa
in unserem Sinn Substantiva ein, deren Zuordnung zu den Personen vor allem nach
dem Prinzip der sozialen Stellung erfolgt, wobei noch die Forderungen der Höflichkeit
147des Sprechenden gegenüber dem Angesprochenen zu berücksichtigen sind 1)47. In
diesem Sinn finden wir für die erste Person wörtliche Bedeutungen wie wertlose,
nichtssagende Person, Diener, für die zweite Person Herr, Fürst, geehrter „Zustand”,
wobei freilich zu beachten ist, daß der gegenwärtige Verkehrswert dem etymologischen
manchmal nicht mehr entspricht. Doch besagt dies nichts gegen die Gültigkeit
des erwähnten Prinzips. Die Personen werden also genannt, nicht durch Zeigwörter
„gezeigt”; die Zuordnung erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten, die sich aus der
Situation der Gesprächspartner ergeben.
Daneben steht ein anders geartetes, lokales und implizit-personales System,
das Ableitungen vom, wie erwähnt, personal differenzierten Demonstrativum verwendet,
Ableitungen freilich nicht durch Suffixe, sondern durch Zusatz des Substantivums
Kō Seite; also kóno hō diese (hic!) Seite = ich, sōno hō diese (iste!)
Seite = du. Findet sich nun noch ein ti-mae wörtlich vor der Hand, diesseits, das
sowohl ein bescheiden-untertäniges ich als ein verächtliches du sein kann, so läßt
sich diese auffallende Erscheinung als Kontamination des lokalen mit dem sozialen
Prinzip verstehen. Zur zunächst nur lokal bestimmten Bedeutung gesellt sich die
des sozial tiefer stehenden Partners, und je nach der Situation kann dies auch der
Angesprochene sein.
Außerhalb dieser Systeme steht wátak' shi wörtlich privates Interesse, privat,
und wáre (nach Hofmann wörtlich Mittelpunkt) für ich; beide Wörter zeigen deutlich
denselben prodemonstrativen Charakter, wie wir ihn oben für die erste Art
der Ersatz-Personalpronomina nachweisen konnten, wenn auch die Grundlage der
Zuordnung hier eine andere ist.
b) Für ein anderes Gebiet, das der lokalen Demonstration, sei auf die
sogenannten Körperteilpräfixe gewisser Indianersprachen verwiesen. Im Takelma,
das in Boas' Handbook durch Sapir bearbeitet wurde (Bd. II, S. 1-296), liegen die
Verhältnisse folgendermaßen: Die Körperteilpräfixe (S. 73) kommen nur innerhalb
des Verbalkomplexes als allgemeine Bestimmung des beteiligten Körperteils vor,
neben ihnen stehen noch die -gewöhnlichen Substantiva der entsprechenden Bedeutung;
sie sind also nicht schlechthin als Nomina aufzufassen. Dies ändert aber
nichts am prodemonstrativen Charakter ihres übertragenen Gebrauchs, in welchem
sich entsprechen: Kopf — über, Mund — gegenüber, Ohr — entlang, Nacken —
hinten, Rücken, Taille — zwischen, Brust — gegenüber, Gebärorganismus — in,
Bein —unter, Auge, Gesicht — zu. Die lokale Beziehung wird genannt, nicht „gezeigt”;
das egozentrische Moment kommt nur insofern zur Geltung, als die Lageverhältnisse
am eigenen Körper die Basis für die Übertragungen abgeben.148
III. Das Symbolfeld der Sprache
und die Nennwörter.
Das Zeigfeld der Sprache im direkten Sprech verkehr ist das hier-jetzt-ich-System
der subjektiven Orientierung; Sender und
Empfänger leben wachend stets in dieser Orientierung und verstehen
aus ihr die Gesten und Leithilfen der demonstratio ad oculos. Und
die Deixis am Phantasma, die wir geschildert haben, nützt, wenn
nennend Versetzungen mobilisiert sind, dasselbe Zeigfeld und dieselben
Zeigwörter wie die demonstratio ad oculos. Das sprachliche
Symbolfeld im zusammengesetzten Sprachwerk stellt eine zweite
Klasse von Konstruktions- und Verständnishilfen bereit, die man
unter den Namen Kontext zusammenfassen kann; Situation und
Kontext sind also ganz grob gesagt die zwei Quellen, aus denen in
jedem Fall die präzise Interpretation sprachlicher Äußerungen
gespeist wird. Es gilt nun das Symbolfeld der Sprache im Ganzen
zu erfassen und systematisch aufzugliedern. Der Sprachtheorie
stehen zwei Wege zu diesem Endziele offen: der Weg einer immanenten
Analyse und der Weg eines übergreifenden Vergleichs der Sprache
mit anderem Darstellungsgerät, der Vergleich mit nicht-sprachlichen
Darstellungssystemen.
Ich schlage eine kombinierte Erkundung vor und brauche
deren Vorteile wohl kaum ausführlich zu erörtern. Bei dem immanenten
Verfahren bleibt man mit den Füßen auf festem Grund,
doch weiß man oft nicht mehr, wo ein und aus vor „Tatsachen”.
Es ist wahr, daß Teile der Sprachwissenschaft einem wohldurchforsteten
Parke gleichen, aber ebenso wahr, daß man mit der Gesamtheit
der Menschensprachen einfach noch nicht fertig geworden
ist 1)48. Damit es gelinge, daneben unsere Idee vom Organon-Modell
149der Sprache und in seinem Rahmen die Dominanz ihrer Darstellungsfunktion
für die Sprachtheorie fruchtbar zu machen, ist zunächst
einmal der Wagemut zu übergreifenden Vergleichen aufzubringen.
Wundt hat vor einem Menschenalter die menschliche Lautsprache
mitten hineingestellt unter alles, was bei Tieren und Menschen zum
„Ausdruck” gehört; ich habe die Grundgedanken dieser Ausdruckstheorie
aus der Perspektive vom Heute und als Glied einer bemerkenswert
einheitlichen Bewegung, die, im 18. Jahrhundert in
Gang gebracht, heute im lebendig Neuen als Einschlag immer noch
nachwirkt, auf frischem Blatt nachgezeichnet und eingehend
gewürdigt 1)49. Wer sich zur Einsicht durchgerungen hat, daß Ausdruck
und Darstellung verschiedene Strukturen aufweisen, sieht
sich unabweisbar vor die Aufgabe gestellt, eine zweite vergleichende
Betrachtung durchzuführen, um die Sprache mitten hineinzustellen
unter alles andere, was mit ihr zur Darstellung berufen ist.
Der moderne Mensch kennt und benützt verschiedenartige
Darstellungsmittel; es ist nicht allzuschwer, jedes von ihnen nach
Aufbau und Leistung mit der Lautsprache zu vergleichen und auf
diesem Wege Schritt für Schritt Aufschluß über die Eigenart der
Systeme vom Typus der Sprache zu gewinnen. Lehrreich sind wie
bei jedem derartigen Vergleichsverfahren aufgefundene Ähnlichkeiten
und Unterschiede im gleichen Maße. Soll ein ermunterndes
historisches Vorbild größeren Stiles zu dem hier durchgeführten
Vergleiche genannt werden, so denke ich aus mehr als einem Grunde
zuerst an Lessings Vergleich der Poesie mit der Malerei. Denn
zugegeben, daß dort nicht Sprach- sondern Kunstprobleme zur
Diskussion standen und daß es bei dem Vergleiche noch sehr summarisch
zuging, so wurde doch das eine deutlich, was seither nicht
mehr übersehen worden ist. Daß nämlich die mißverstandene oder
mißbrauchte Horazische Anweisung ‚ut pictura poesis’ an der
Strukturverschiedenheit des sprachlichen vom malerischen Darstellungsgeräte
scheitern muß oder doch jedenfalls auf unüberschreitbare
Grenzen stößt.
Die Sprache malt nicht in dem Ausmaß, wie es mit menschlichen
Stimmitteln möglich wäre, sondern symbolisiert; die Nennwörter
sind Gegenstandssymbole. Aber ebenso wie die Farben des Malers
einer Malfläche, so bedürfen die sprachlichen Symbole eines Umfeldes,
in dem sie angeordnet werden. Wir geben ihm den Namen
150Symbolfeld der Sprache. Dieser zweite Feldbegriff, den ich vorschlage
und im folgenden erläutere, erfüllt seine wichtigste Mission
durch eine allgemeinere und schärfere Erfassung der Relation, welche
besteht zwischen dem syntaktischen und lexikalischen Momente
der Sprache. Man pflegt diese beiden korrelativen Momente
vielfach wie Form und Stoff einander gegenüberzustellen und ist
dabei trotz aller Erneuerungsversuche, die da und dort einmal
gemacht wurden, aber ohnmächtig geblieben sind, über die aristotelische
Denkweise kaum hinausgekommen. Die Psychologie aber hat
im Zuge ihrer Denkuntersuchungen und ihrer Gestaltdiskussion
das Form-Stoffproblem neu durchdacht; es gilt, den Fortschritt
in der Sprachtheorie fruchtbar zu machen.
Der Plan des Folgenden ist so zu verstehen: Immanent
werden die Kontextfaktoren gefunden und durchgesprochen. Der
übergreifende Vergleich, welcher nachfolgt, hilft im ersten Anlauf,
die zwei Komponenten ‚Feld und Symbol’ schärfer zu unterscheiden.
Es wird uns übergreifend zur Einsicht, daß das immanent Gefundene
zu jedem produktiven System von Darstellungsmitteln gehört;
angefangen von der Bühne des Schauspielers und der Malfläche
des Malers bis zu den Koordinatensystemen der „analytischen”
Geometrie gibt es überall Felder und Eingesetztes. Und mitten in
all das hinein gehört die darstellende Sprache. Allein es muß dieser
ersten Einsicht aus der vergleichenden Betrachtung eine zweite
folgen, damit das Ganze praktisch anwendbar wird für die empirische
Linguistik. Und diese zweite Einsicht lautet in prägnantester
Einkleidung so: das sprachliche Därstellungsgerät gehört
zu den indirekt Darstellenden, es ist ein mediales Gerät, in welchem
bestimmte Mittler als Ordnungsfaktoren eine Rolle spielen. Es ist
nicht so in der Sprache, daß die Lautmaterie kraft ihrer anschaulichen
Ordnungseigenschaften direkt zum Spiegel der Welt erhoben wird
und als Repräsentant auftritt, sondern wesentlich anders. Zwischen
der Lautmaterie und der Welt steht ein Inbegriff medialer Faktoren,
stehen (um das Wort, zu wiederholen) die sprachlichen Mittler, steht
z. B. in unserer Sprache das Gerät der indogermanischen Kasus.
Wir fassen im folgenden das „Eingesetzte”, die sprachlichen Begriffszeichen
ins Auge und bringen die Analyse vorläufig zu Ende
mit einem einzigen, der Wissenschaft best bekannten Exempel eines
sprachlichen Feldgerätes. Es ist das schon genannte Kasussystem
der indogermanischen Sprachen.
Daß unserem Vorwitz, der aufs Ganze abzielt und erst mit der
Übersicht aller ähnlichen Feldgeräte befriedigt wäre, ein Riegel
151vorgeschoben wird, sei vorausgesagt. Es springt an der Stelle, bis
zu der wir gelangen, die weltanschaulich bedingte Verschiedenheit
der Menschensprachen auf; jene Verschiedenheit, die W. von
Humboldt als erster innerlich vor sich sah und mit dem seither oft
geschickt und öfter kurzsichtig neu ausgelegten Begriff der inneren
Sprachform ausgezeichnet hat. Das ist nach meiner Meinung neben
den (korrelativ dazugehörenden) Etymondifferenzen, über die von
der Psychologie her einiges in § 14 zu bringen ist, der Kern der
inneren Sprachform, daß verschiedene Sprachfamilien verschiedene
Mittler- und Symbolfelder bevorzugen, weil sie das Darzustellende,
die Welt, in der alle Sprechenden leben, mit verschiedenen Augen
sehen. Vergleichbar ist das Ganze der Verschiedenheiten vielleicht
am nächsten mit den uns gut bekannten Unterschieden im Blick
des Malerauges. Weniger ist es sicher nicht, es dürfte aber auch
nicht mehr sein. Und es ist und bleibt nach meiner Meinung auch
nicht mehr als eine Bevorzugung. Denn unmöglich ist uns Indogermanen
das Nachdenken fremder Symbolfelder keineswegs; sondern
im Gegenteil; es werden sich so gut wie für alle fremden Feldgeräte
auch Anklänge in unserer Sprache finden. Das kann ich nicht mehr
beweisen; doch glaube ich es nach den Einsichten am Zeigfeld und
einigen Auflösungen, die mir auch im Symbolfeld gelungen vorkommen.
Sie sind in § 15 besprochen.
Diese selbsterlebten Erfahrungen sind es, die mir die Hoffnung
begründen, es werde jüngeren Kräften auf der Basis des Erreichten
gelingen, ein wirkliches System der Feldgeräte aus den
Sprachen des Erdkreises zu erarbeiten; am Modell zunächst wie
alles, was man wirklich Entdeckungen nennen kann im Reiche der
Sprachtheorie. Aber dann muß, was ebenso wichtig ist, aus vielen
Systemmodellen eines im gesicherten Umblick auf das Bestehende
induktiv verifiziert werden. Denn die Modellschau allein genügt
nicht, weder in der theoretischen Physik, wo es z. B. galt, nicht
irgendein mögliches, sondern das empirisch fruchtbare Atommodell
zu finden, noch in der Sprachtheorie, die in Verifizierungsangelegenheiten
hinter den strengsten anderwärts üblichen Anforderungen an
Beweise nicht zurückstehen darf. Ich habe selbst, um nichts Unfertiges
vorzulegen, eine eigene Skizze unterdrückt, in welcher etwas
Derartiges versucht war. Es kam mir vor, als ließen sich einige
Züge an den Symbolfeldern etwa von daher verstehen, daß z. B.
die Eskimosprachen als weitgehend impressionistisch mit den Bantusprachen
als weitgehend kategorial und das Chinesische mit seiner
bekannten Vorliebe für das dinglich Individuelle mit den indogermanischen
152Sprachen, die samt und sonders das Universale wie
etwas Zeigbares behandeln, kontrastiert werden können. Doch
mußte ich einsehen, daß mir persönlich die wirkliche Kenntnis der
empirischen Daten, die zu solch einem vergleichenden Unternehmen
nötig wären, unerreichbar sind. Und darum wird der Versuch
hier nur erwähnt, um unverbindlich die Richtung anzudeuten,
in welcher ich die Fortsetzung einer sprachtheoretischen Analyse
der Symbolfelder menschlicher Sprachen für möglich halte.
Wie in einem Zwischenspiel wird in § 13 erkundet, ob die
Sprache, wie wir sie kennen, außer dem Symbolfeld ein echtes Malfeld
besitzt. Das Ergebnis ist negativ und weist den unbestrittenen
Lautmalereien eine strukturanalytisch sekundäre und verkümmerte
Existenzweise nach. Das anschauliche Moment der Sprache im
Sinne des tiefdurchdachten Wortes von Kant, daß die Begriffe
leer bleiben ohne Anschauung, ist nicht zu suchen in den Malpotenzen,
sondern im Bereich des Zeigfeldes der Sprache. Ich selbst habe lange
in meinen Vorlesungen zur Sprachtheorie beides zwar schon getrennt,
sprach aber immer noch von einem primären Darstellungsfeld,
das als Malfeld charakterisiert wurde. Heute aber sehe ich,
daß die Malfleckchen, welche faktisch vorkommen, isoliert bleiben
und nicht einer kohärenten Ordnung angehören, die wirklich den
Namen Malfeld verdienen würde. Es gibt also nicht drei Felder in
der Sprache, nämlich Malfeld, Zeigfeld und Symbolfeld, sondern
nur zwei, nämlich Zeigfeld und Symbolfeld. Vielleicht sind die
malenden Lautcharakteristiken, die man in vielen Wortern findet,
Urphänomene, welche der Entstehung der Phoneme vorausgingen.
Das ist eine Vermutung, die später durchgesprochen wird und als
Ergänzung zu unserer Würdigung der Lautmalerei gehört; eine Vermutung,
nichts anderes und dort mehr als fiktive Basis und zur
abhebenden Schilderung der wirklichen Verhältnisse eingeführt.
Genau so mag man auch die etwas breit geratene Analyse des lautmalenden
Verfahrens als ein Präludium zur Lehre vom Symbolfeld
der Sprache betrachten; als solches mußte sie ausführlich sein.
Wir gehen in diesem Abschnitt analysierend zu Werke. Wer
irgendwo Gebilde in wissenschaftlicher Absicht zerlegt, der sehe zu,
daß er die Trennungen strukturgerecht vornimmt. Zerschneiden
wie es der Metzger tut, hat auch einen Sinn, aber nur einen praktischen
für die Küche. Der Anatom sondert nach anderen Richtpunkten,
und die großen Linguisten waren von jeher bemüht, gute
Anatomen der komplexen Sprachgebilde zu sein und sie morphologisch
korrekt zu zerlegen; mehr als dies soll und braucht man nicht
153zu erstreben als Analytiker der ‚Sprache’, das Wort im Sinne von
‚la langue’ genommen. Daß es Leichname sind, die der Anatom
analysiert, hindert nicht, sein Ergebnis am Lebenden zu verwenden;
daß es erstarrte Produkte oder ‚Hülsen’ des lebendigen Sprechaktes
sind, die der Grammatiker zerlegt, hindert ihn nicht, sein Ergebnis
als wissenschaftlicher Interpret des einmalig Lebendigen oder
lebendig Gewesenen, d. h. als Philologe im weitesten Wortsinn zu
verwerten. Darüber sollten keine Meinungsverschiedenheiten aufkommen.
Was man im Rahmen einer Strukturbestimmung von la
langue tun kann, um der Einseitigkeit des zerlegenden Verfahrens
zu begegnen, ist eine Umkehr des Weges. Der vierte Abschnitt des
vorliegenden Buches ist wieder aufbauend gedacht. Wer bauen
will, sieht sich um nach den Elementarien und ihren Gefügemitteln;
nach Steinen und Mörtel -beim Hausbau, nach dem Lautsystem,
dem Wortschatz und dem Inbegriff syntaktischer Fügemittel als
Linguist. So ist es von jeher gehalten worden und es war sachgemäß.
Den Sprachtheoretiker interessiert daran am brennendsten die
Frage, warum es sachgemäß gewesen ist. Natürlich kann und darf
das Fazit des Zerlegens mit dem synthetischen Blick auf dieselbe
Sache nicht in Widerspruch geraten, wenn alles in Ordnung ist.
Die Verteilung der Fragen und Antworten auf zwei Kapitel wäre
überflüssig am Ende der Forschung. Weil wir mitten in ihr stehen
und noch lange kein Ende abzusehen ist, empfiehlt es sich, das
fragmentarische Wissen zweimal durchzugehen.
§ 10. Das sympraktische, das symphysische und das
synsemantische Umfeld der Sprachzeichen.
Ausdruck und Begriff Umfeld, wie sie hier verwendet werden,
stammen aus der Lehre von den Farben. Es waren Schüler Ewald
Herings, welche das wichtige Phänomen des Farbenkontrastes
in einfacher Art beschrieben und exakt bestimmt haben durch die
Angabe, daß jedes Fleckchen Farbe auf einer Fläche dem Eindruck
nach mitbeeinflußt wird von dem ‚Umfeld’ des Fleckchens. Der
Einfluß von ‚Infeld’ und ‚Umfeld’ ist, was kaum betont zu werden
braucht, wechselseitig. Erweitert und übertragen auf vieles andere
wurde diese Erkenntnis in all den Ganzheitsbetrachtungen, die man
heute summarisch mit dem Titel Gestaltpsychologie versieht. Es
gehört zu den nie ganz übersehenen oder geleugneten, heute aber
viel sorgfältiger als früher herausgearbeiteten Tatsachen, daß die
Sinnesdaten nicht isoliert, sondern eingebettet oder eingebaut in
154wechselnde „Ganzheiten” des psychischen Geschehens aufzutreten
pflegen und von dorther wechselnde Modifikationen erfahren.
Dafür bot sich der Name ‚Umfeld’ wie von selbst an und hat sich
eingebürgert.
Daß die Sondergruppe der Sinnendinge oder sinnlich wahrnehmbarer
Vorgänge, die wir Sprachzeichen nennen, keine Ausnahme
macht, versteht sich fast von selbst. Bleibt nur zu überlegen, was
bei ihrem Auftreten als relevantes, nachweisbar wirksames ‚Umfeld’
zu betrachten ist. Denn das muß in jedem neuen Anwendungsbereich
der allgemeinen Regel von den Umgebungseinflüssen neu
bestimmt werden. Und von den Zeichendingen gilt, was man vom
Blut gesagt hat, es sei ein ganz besonderer Saft. Man braucht
keinem Sachverständigen zu beweisen, daß das wichtigste und interessanteste
Umfeld eines Sprachzeichens sein Kontext ist; das Einzelne
erscheint mit anderen Seinesgleichen im Verbände, und der Verband
erweist sich als wirksames Umfeld. Außer diesem Hauptfall
aber gibt es noch zwei andere Fälle; es gibt Fälle eines zwar kontextfreien,
aber keineswegs umfeldfreien Auftretens von Sprachzeichen.
Ich schicke sie in der Darstellung voraus, um bei der Behandlung
des synsemantischen Umfelds der Sprachzeichen alles beisammen zu
haben und nach begrifflich scharfen Kriterien scheiden zu können,
was geschieden werden muß, wenn z. B. die Angelegenheit der
sogenannten sprachlichen Ellipsen endgültig bereinigt werden soll.
Die Ellipsen sind eine alte crux der Sprachtheoretiker; die Beschäftigung
mit ihnen gab mir den ersten Impuls zu den Untersuchungen,
über die ich im folgenden berichte. Das Ergebnis ist dann aber,
wie das zu gehen pflegt, über die erste Fragestellung hinausgewachsen.
1. Wer unbefangen Umschau hält im Bereiche aller Verwendungen
von Sprachzeichen, die das tägliche Leben hervorbringt,
wird schnell eine lange Liste kontextarmer und völlig kontextfreier
Fälle beisammen haben und dann herausfinden, daß sie sich ungezwungen
und wie von selbst in zwei Klassen ordnen. Da sind
erstens die empraktischen Nennungen und Hindeutungen mit Hilfe
isolierter Sprachzeichen. Tatsache ist, daß ein wortkarger Gast im
Kaffeehaus zum Kellner ‚einen schwarzen’ oder der Passagier im
Straßenbahnwagen zum Schaffner ‚gerade aus’ oder ‚umsteigen’
sagt, womit beide eine praktisch ausreichende Rede aus dem Gehege
der Zähne entlassen haben. In Wien blieb früher dem Passagier
sogar das ‚umsteigen’ erspart, weil es nur eine Art von Fahrscheinen
gab. Wer hier den bekannten Verkehrsakt des Billetkaufens klaglos
155zwischen schweigenden Partnern ablaufen sah, der wußte auch,
von welchem Grenzfall aus die meisten der sogenannten ‚elliptischen
Reden’ begriffen werden müssen: Sprachinseln tauchen im Meere des
schweigsamen aber eindeutigen Verkehrs an solchen Stellen auf,
wo eine Differenzierung, eine Diakrise, eine Entscheidung zwischen
mehreren Möglichkeiten getroffen werden soll und bequem durch
ein eingestreutes Wort getroffen werden kann. Sie tauchen auf und
sind willkommen wie Namen und Pfeile auf Wegweisern willkommen
sind an den Kreuzungspunkten der Pfade, denen man
entlang geht.
In der aus dem Alltag gesammelten Beispielgruppe, welche
vor mir liegt, kommen abgebrochene und lückenhafte Sätze in
vielen Graden und Nuancen der Unvollständigkeit und schließlich
auch restlos kontextfrei gebrauchte oder nur mit ganz spärlichem
Kontext versehene Wörter vor. Ob solche Wörter Zeigpartikeln
sind oder Nennfunktionen haben, erscheint bei unbefangener Musterung
der Fälle weitgehend gleichgültig. Der Fahrgast im Straßenbahnwagen
kann, wenns ihm beliebt, statt ‚umsteigen’ zu sagen
auch durch Fingergesten auf einen der beiden Fahrscheinblöcke
in der Hand des Schaffners eindeutig machen, was er haben will.
Sonst steht die vielleicht (vielleicht auch nicht) als ‚Adverb’ zu
deutende Partikell ‚geradeaus’ auf einer Stufe mit dem Verbum
‚umsteigen’. Es sieht so aus, als stehe ebenso der Akkusativ ‚einen
schwarzen’ mit einem Nominativ gleich; manchmal genügt auch ein
Kopfnicken oder ein ‚ja’, wenn der andere sich fragend anschickt,
von selbst das Rechte zu tun, oder man sagt ‚heute den anderen’,
wenn sichs gerade so gibt. Die Nennwörter bleiben auch in solcher
Verwendung, was sie sind, sie nennen etwas. Daß sie manchmal
in Reih und Glied marschieren mit beliebigen anderen sprachlichen
und nichtsprachlichen Zeichen, die imstande sind, die erforderliche
Diakrise zu bieten, verführt den Theoretiker leicht zu einer summarisch
gleichen Auslegung aller Fälle. Allein er sollte mit Bedacht
vorgehen.
Wo gar kein Kontext steht, muß sich der Sprachtheoretiker
besonders hüten vor übereilten allgemeinen Subkonstruktionen.
Kann sein, der Sprecher reproduziert auch hier ein Satzstück und
schenkt sich und dem Hörer das andere; kann sein, der Linguist
erkennt an diesem oder jenem Formmoment eine syntaktische Platzbestimmtheit
des Sprachzeichens. Was hat das auf sich? Kaum
viel mehr, als daß das Sprachzeichen, so wie es hier geäußert wurde,
auch an einer bestimmten Kontextstelle stehen könnte und regulär
156zu stehen pflegt. Kurz, es wäre nichts als eine gründliche Verkennung
der psychologischen Bedingungen, wollte man dies als eine für alle
Fälle ausreichende und notwendige Deutung betrachten. So verfuhr
ich zuerst, bis ich einsehen mußte, wie willkürlich und gezwungen
oft meine Ergänzungen ausfielen. Manchmal kommt man sich dabei
wie ein dummer Schulbub oder (vielleicht richtiger gesagt) wie ein
pedantischer Schulmeister vor, wenn man, wo die naive Praxis
völlig unzweideutig ist, mit Satzergänzungen zu theoretisieren
beginnt.
Wenn der wortkarge Kaffeehausgast ‚einen schwarzen’ sagt,
so reproduziert er aus dem Inventar seiner sprachlichen Gedächtnisdispositionen
einen nächstgelegenen Brocken und verhält sich dabei
ungefähr so wie ein Praktiker, der einen Nagel einklopfen
will, und zum nächstbesten Gegenstand greift, der ihm gerade in
die Hand kommt. Das braucht nicht ein echter Hammer, sondern
kann auch ein Bergschuh, eine Beißzange oder ein Backstein sein.
In der fingierten Verkehrssituation im Kaffeehaus muß eine Wahl
zwischen den paar gleich wahrscheinlichen Getränken getroffen
werden und dazu genügt das Nennwort ‚schwarz’ oder auch die
isolierte Präposition ‚ohne’. Der Satzbrocken ‚einen schwarzen’
war im Augenblick dispositionell bequem greifbar; damit ist, wie
mir scheint, psychologisch alles gesagt, was zu sagen ist. Warum
er näher lag, ist kein Rätsel. Wird er ausgesprochen, dann bringt
er für beide Gesprächspartner wie eine Aura um sich ein Satzschema
mit; das ist wahr. Aber weiter ausgefüllt als durch das eine faktisch
geäußerte Wort braucht dies Satzschema nicht zu sein.
Ein unbekehrbarer Anhänger der generellen Ellipsenidee wird
darauf hinweisen, daß man doch in allen Fällen einen Satz um die
empraktische Nennung herumkonstruieren kann. Die Antwort
lautet, das sei zwar unbestreitbar, beweise aber nichts. Denn ein
sprachlich geschickter Interpret kann auch zu jeder Phase eines
völlig stummen Verkehrsaktes einen mehr oder minder treffenden
Text liefern; der aufgehobene rechte Arm mit dem Geld des Passagiers
im Straßenbahnwagen „sagt” zum Schaffner: ‚bitte, geben Sie
mir einen Fahrschein!’ Gewiß, die Geste ‚sagt’ das ungefähr ebenso
eindeutig wie die aufgehobene Vorderpfote eines winselnd bettelnden
Hundes zum essenden Herrn sagt ‚Bitte, gib mir doch auch einen
Brocken’. Wenn der Fahrgast stumm oder ein Engländer ist, der
kein Wort deutsch spricht, was sagt denn dann die Geste? Spricht
sie alle Sprachen zugleich oder keine Sprache? Nein, Geste ist
Geste und Sprache ist Sprache; es wäre schlimm bestellt um die
157mimischen Gebärden und Gesten im menschlichen Verkehr, wenn
alles lautsprachlich unterbaut und adäquat lautsprachlich übersetzbar
(interpretierbar) sein müßte. Ein Elliptiker hätte den Beweis
zu erbringen, daß die empraktisch verwendeten isolierten Nennungen
ohne ein irgendwie mitgedachtes (vom Sender und Empfänger mitgedachtes)
Satzschema unfähig wären, als eindeutige Verkehrszeichen
zu fungieren.
Und dieser Beweis wird ihm weder aus dem Bereich der Vorgänge
im psychophysischen System gesunder Sprecher noch aus dem
Bereich der Vorgänge im psychologischen Systeme von Patienten
mit zentralen Sprachstörungen gelingen. Von den letzteren aus
wäre wohl, wenns nötig und lohnend sein sollte, der treffendste
Gegenbeweis zu erbringen. Genauer gesagt: es wäre zu beweisen,
daß in Fällen, wo die Fähigkeit, grammatisch wohlgebaute Sätze
zu bilden, weitgehend gestört ist, die empraktische Verwendung von
Nennwörtern nicht in gleichem Ausmaße herabgesetzt sein
muß. Es gibt Aphasien und Apraxien, wie man weiß, und die Störungen
gehen keineswegs derart parallel, sie kovariieren nicht so
gesetzmäßig einfach, wie es die generelle Ellipsenidee voraussetzt.
Bequemer und ebenso zwingend ist der Gegenbeweis, den man in
der Kinderstube gewinnen kann. Das Kind gebraucht lange, bevor
ihm ein einziger Mehrwortsatz gelingt, durchaus sinnvoll und für
uns verständlich Gesten und die bequeme empraktische Nennung.
Also muß diese ontogenetisch älter sein.
Der erwachsene Mensch ist zwar ein sprechendes Wesen, aber
nicht in dem Grade, wie die Elliptiker stillschweigend anzunehmen
scheinen, eine homo loquax. Wozu auch sprechen, wenns ohne dies
ebensogut oder besser geht in der Lebenspraxis? Wo ein diakritisches
Wortzeichen eingebaut wird in die Handlung, da bedarf es
in vielen Fällen keines Hofes von weiteren Sprachzeichen um sich.
Denn statt der stellvertretenden Zeichen hat es das sonst Vertretene
selbst um sich und kann sich darauf stützen. Daß ein Kaffeehausgast
die Absicht hat, etwas zu konsumieren, daß ein Mann, der sich
an der Theaterkasse anstellt und vortritt an den geöffneten Schalter,
wenn er an der Reihe ist, kaufen will und welche Warengattung, ist
längst verstanden von seinem Partner (hinter dem Schalter); der
Käufer braucht am mehrdeutigen Punkte (dem Kreuzweg bildlich
gesprochen) seines stummen sinnvollen Verhaltens ein Sprachzeichen
nur als Diakritikon. Er setzt es ein, und die Mehrdeutigkeit ist
behoben; das ist ein empraktischer Gebrauch von Sprachzeichen.
Das relevante Umfeld, in welchem es steht, ist in diesem Falle eine
158Praxis; wir sagen darum (des Gleichklanges wegen) auch, es trete
auf: sympraktisch eingebaut. Soviel vorerst zur einfachen Erläuterung
der vorgeschlagenen Namen ‚empraktisch oder sympraktisch’;
wir werden die sachliche Diskussion später noch einmal und
dann synoptisch für alle Hauptfälle aufnehmen.
2. Wesentlich anders liegen die Umstände in einer zweiten
Klasse von Verwendungsfällen isolierter, d. h. kontextfreier Namen.
Sie können dingfest angeheftet an das durch sie Benannte auftreten.
Man druckt Markennamen auf Waren, schreibt Ortsnamen auf Wegweiser
und ‚signiert’ Gegenstände durch Eigennamen der Besitzer
oder Erzeuger. Auch Buchtitel und Kapitelüberschriften, lakonisch
nennende Bild- und Denkmalsunterschriften und -aufschriften sind
dingfest verbunden mit und angebracht auf dem Benannten.
Richtig verstanden gilt diese Bedingungsformel auch für die
Ortsnamen auf Wegweisern und die Eigentums- oder Erzeugernamen
auf dinglichen Gebilden aus Menschenhand. Denn der dingliche
Zeiger am Wege hat einen festen Standort im Gelände und
trägt den Ortsnamen, der zwar nicht ihn, wohl aber den Ort benennt,
auf den er hinweist. Er trägt diesen Ortsnamen wie ein Fernanhefter.
Und nur um eine Nuance verschieden davon trägt das dingliche
Eigentum oder Produkt aus Menschenhand den Eigennamen des
Eigentümers oder Erzeugers. Erzeuger- und Eigentumsmarken
treffen zwar nicht die Wasbestimmtheit (ποιότης) der markierten
Gegenstände, wohl aber nennen sie einen, der zu ihnen in der uns
wohlbekannten Relation des Eigentümers oder Erzeugers steht.
Und wenn die bildliche aber kurze Ausdrucksweise ‚Fernanhefter’,
die wir für die Funktion des Wegweisers als Ortsnamenträger gewählt
haben, von einem verstehenswilligen Leser verstanden und
hingenommen wird, so darf man demselben Leser wohl auch eine
analoge (freilich nicht ganz identische) Interpretation der Nennung
des Eigentümers oder Erzeugers durch dingfeste Namen auf Gegenständen
zumuten 1)50. Gemeinsam ist jedenfalls der ganzen Klasse
von Namensverwendungen, die wir im Auge haben, die dingliche
Anheftung; wir schlagen den Namen symphysisch für diesen Einbau
vor 2)51.159
Es gibt einige Grenzfälle, die man zwanglos mit einrechnen kann. So macht
z. B. die raffinierte moderne Reklame gelegentlich eine merkwürdige Attacke auf
wehrlose Leser, indem sie isolierte Warennamen in Zeitungen, auf Plakatflächen am
Straßenrande, auf Häuserwänden oder gar an der blauen Himmelsfläche aufscheinen
läßt. Die Namen und sonst nichts. Dabei setzt man entweder voraus, daß die also
attackierten psychophysischen Systeme von sich aus die Ergänzung vollziehen und
sich die Ware hinzu vorstellen, oder aber, daß sie wie nach einer unerledigten Aufgabe
in einem der Reklame günstigen Zustand des Fragens geraten und bei der
nächsten Gelegenheit, wo der Name angeheftet wieder vorkommt, ihn aus psychischer
Nötigung und mit ihm die Ware ‚beachten’. Ein psychologisch interessanter Trick
— weiter nichts.
Lohnt es denn, einen eigenen Terminus für diese Klassse
von Verwendungsfällen einzuführen? Gewiß; denn die angehefteten
Namen fungieren vielfach als Marken. Marken und Male aber
interessieren den umsichtigen Sprachtheoretiker aus mehr als
einem Grunde; Male und Marken an Dingen, die natürlichen und
künstlich angebrachten, sind sematologisch sehr interessant und
offenbaren dem Sematologen manches, was auch für die Sprachtheorie
aufschlußreich ist. Man bedenke z. B. nur, daß die Phoneme
Male sind am Gesamtklang der flatus vocis, die wir als Wörter
bezeichnen; die Phoneme sind Lautmale am Wortklang. Auch die
Gegenstände (das Benannte der Nennwörter) müssen erkennbare
und unterscheidende Eigenschaften an sich haben, wo immer sie
einem Sprecher vor die Sinne kommen und benannt werden sollen
‚ein jedes nach seiner Art’. Man hält sich oft an Momente dabei,
die der naive Sprecher des Deutschen als richtige ‚Male oder
Marken’ bezeichnen würde. Der abstrahierende Logiker geht summarischer
vor und sagt ‚Merkmale’ für schlechthin alle Bedingungen,
die ein Gegenstand erfüllen muß, damit ihm ein Nennwort
als Begriffszeichen beigelegt werden darf. Es ist terminologisch
zweckmäßig, das Simplex ‚Mal’ und das Simplex ‚Marke’
nur für sinnlich leicht isolierbare Sonderzeichen zu verwenden.
Natürliche oder künstliche, versteht sich; Muttermale sind solche
Sonderzeichen. Ganz scharf wird aber die Gruppenbildung nicht
zu vollziehen sein.
Werden nun Nennwörter als Warenmarken verwendet, so
geraten sie in die bunte Gesellschaft anderer, nichtsprachlicher Warenmarken
(Bilder und symbolische, manchmal wappenartige oder den
Wappen entlehnte und nachgebildete Elementarzeichen) und unterliegen
in dieser Atmosphäre eigenartigen Umwandlungen, über die
160in anderem Zusammenhang ausführlich berichtet werden soll. Die
gesetzlichen Bestimmungen über Namen, die als Warenmarken
eingetragen und geschützt werden sollen, sind sematologisch leicht
und systematisch begründbar; man kann einige von ihnen, die schon
da sind, post festum theoretisch rechtfertigen und den Sachverständigen
auf diesem Gebiete Ratschläge erteilen in Fragen, die
noch nicht ganz einheitlich und zweckmäßig beantwortet sind.
Sprach theoretisch entscheidend ist die Tatsache, daß die angehefteten
Wörter als Warenmarken keinen Kontext um sich haben und keinen
Kontext brauchen. Sie stehen angeheftet mit den sachlichen Kennzeichen
einer Ware auf gleich und gleich, haben aber den Vorteil,
daß sie außerdem einfach abzulesen und wieder als normale Nennwörter
in Kontexte gestellt werden können; eine sematologisch
höchst merkwürdige Zwitterstellung, deren Auswirkungen aufschlußreich
sind.
Zu den Namen auf Wegweisern, allgemeiner: zu angehefteten
Namen, die vom Leser die Befolgung einer deiktischen Vorschrift
verlangen, damit er das Genannte findet, ist noch folgendes anzumerken.
Man denke, um das eintönige Schema ein wenig zu beleben,
an die Eintragungen auf ehernen Tafeln, die den ‚Rundblick’
auf Aussichtswarten erläutern. Da gibt es Pfeile in allen Windrichtungen,
lange und kurze, und geographische Namen an ihnen;
auf einem photographischen Rundblick im Bädecker stehen die
Namen im Himmel und sind durch senkrechte Linien mit Berggipfeln
und Gehöften verbunden. Auch das ist eine (deiktische)
Zuordnung. Diese ausgebauten Demonstrationsmittel wiederholen
nur in Fülle, was die gewöhnliche Brugmannsche Der-Deixis,
wenn sie in das Gefüge der Geste und des Zeigwortes ein Nennwort
aufnimmt, auch schon bietet: dér Hut. Das Nennwort steht gleichmäßig
sowohl im Falle einer lebendigen Rede wie im Falle einer
Verbindung des optischen, lesbaren Wortbildes mit den pfeilartigen
Zeigzeichen im Gefüge einer demonstratio ad oculos.
3. Ein Wort zum Abschluß. Richtig besehen hat jedes im
konkreten Fall erzeugte und als Sprachzeichen verwertete Sinnending
(wozu der Einfachheit halber gleich auch die ‚Vorgänge’ gerechnet
werden mögen) seinen wohldefinierten Platz im physischen
Raum und damit eine dingliche Umgebung. Selbst die gedruckten
Symbole der papierenen Sprache, die wir in Bibliotheken anhäufen,
stehen als sinnlich wahrnehmbare Dinge irgendwo und irgendwie
auf der weißen Papierfläche und sind dort dingfest verhaftet. Es
kommt im Zuge unserer Analyse darauf an, ob diese Verhaftung
161als solche relevant wird für den Beruf der Zeichendinge oder
irrelevant bleibt. Das Papier der Bücher ist nichts als ein (freilich
unentbehrlicher) Träger, der sich indifferent verhält und, wie man
sprichwörtlich weiß, genauso willig und geduldig ist, alles zu tragen,
wie die Druckerschwärze willig ist, alle Formen sichtbar zu machen.
Ganz anders aber wie das Papier der Bücher zu den getragenen
Schwarzfiguren verhält sich z. B. die Ware zu dem aufgedruckten
Warennamen, verhält sich jeder Träger zum Sprachzeichen, wenn er
das Getragene als s e i n e n Namen usw. zur Schau stellt. In diesem Falle
wird die Anheftung zum physischen, sinnlich manifesten Kriterium der
Zuordnung. Dies Anheftungsverfahren sei nun noch an einem historisch
interessanten Vergleichsfall erläutert, nämlich an dem Wappen.
Vornehmer als die moderne Warenmarke wucherte im symbolfreudigen,
symbolbesessenen Mittelalter das Wappenzeichen. Marke
und Warenzeichen sind wahrscheinlich uralt und teilweise stammverwandt.
Denn der Eigentum schaffende und schützende homo
socialis hat Eigentumsmale respektiert und erfunden, hat Marken
hervorgebracht; und derselbe in sozialen Verbänden kooperierende
Mensch hat, wo es nötig wurde, Zusammengehörigkeitszeichen, Verbandszeichen
geschaffen. Die mittelalterlichen Wappenfiguren
sind nachweislich zuerst auf den Bannern der Kriegsscharen entstanden
und haben erst vom 13. Jahrhundert an als erbliche Besitzund
dann hauptsächlich Familiensymbole eine Ausgestaltung erfahren,
die sematologisch betrachtet, für gewisse Fragen aufschlußreich
ist. Man denke z. B. daran, wie das Ritterwappen auf der
Höhe seines historisch kurzfristigen Daseins (durch drei oder vier
Jahrhunderte) bei den Prunkfesten des ritterlichen Waffenspiels
auftrat. Angebracht und ausgeführt vor allem auf dem Schild des
Wappenträgers, machte es diesen als den und den Kämpfer kenntlich.
Das Wappen begnügte sich aber nicht mit der Funkton eines einfachen
Diäkritikons, sondern fing preisend zu erzählen an von den
Familien, und ein wenig auch von den Individualtugenden und
-Schicksalen des Gewappneten. Und dazu brauchte es sofort, was
jedes komplexere Darstellungsmittel braucht, nämlich ein Darstellungsfeld.
Die Schildfläche war der natürliche Standort des
Mannigfaltigen; sie wurde zum Darstellungsfelde erhoben und als
Zeichenfeld hergerichtet. Es gab ein Oben und Unten, Rechts und
Links am Schilde, und die verschiedensten Unterteilungen seiner
Fläche sorgten für einen kleineren oder größeren Reichtum syntaktisch
relevanter Plätze für die elementaren Symbole. Das Ganze
hieß auch korrekt ‚das Feld’ oder ‚die Felder’.162
Es lag gewiß nicht an den äußeren Mitteln, nicht an fehlendem Reichtum von
Einzelsymbolen und Feldwerten, wenn daraus kein einheitliches Darstellungsverfahren
entstanden ist. Weder die Wappenregeln der berufsmäßigen Herolde
älterer Zeit, die als Ausleger und Reinheitswächter dieses Zeichenwesens bestellt
waren, noch die Professoren der Heraldik an Universitäten vermochten das noch
lebendige Wesen in den Bahnen einer klaren Systementfaltung zu halten. Das
preußische Oberheroldsamt (seit 1706) hat sich im wesentlichen wohl nur um die
korrekte Registrierung bemüht und der sematologisch ausgezeichnet gedachte Erneuerungs-
und Reformversuch Napoleons, welcher die Hierarchie seines Beamtenadels
im Wappen konsequent und durchsichtig widerspiegeln wollte, hielt sich nicht.
Das muß andere als sematologische Gründe gehabt haben 1)52.
Das ganze Wappen ist also ein Symbolfeld mit Einzelzeichen,
die darin stehen und Feldwerte erhalten; denn es ist durchaus nicht
gleichgültig, wie das Gesamtfeld aufgeteilt ist und auf welchem Platze
das Einzelzeichen steht. Das Ganze sei ein im Wappenregister eingetragenes
Familienwappen. Im praktischen Gebrauche erscheint
es in einem symphysischen Umfeld; es wird vom Wappenherrn
getragen z. B. im Turnier, oder es ist am Burgtor, dem Stammsitz
der Familie, und schließlich als Eigentumszeichen auf beliebigen
beweglichen Dingen angebracht. Und diese Verhaftung ist in allen
Gebrauchsfällen relevant; was den Sprachzeichen nur sekundär
widerfährt, ist für das Wappen der reguläre Verwendungsfall.
Noch ein Vergleichspunkt, und zwar des Wappens mit sprachlichen
Inschriften auf Grabmälern u. dgl. m. Solche sprachlichen
Inschriften enthalten oft Zeigwörter, welche das Anheften unterstützen
und näher ausführen. Wer fungiert als Sender und wer als
Empfänger in diesem Zeigfeld? Manchmal spricht der Stein oder
einer, der daneben steht: Hier ruht in Gott Herr N. N. Doch kann
auch der Tote sprechen zum Besucher des Denkmals: Wanderer,
kommst Du nach Sparta… hier uns liegen gesehen… Klarer
als im ersten Fall spricht nicht der Stein, sondern ein Cicerone, der
vor ihm steht, in: ‚diesen Turm aus Stein… hoc monumentum
erexit Carolus Theodorus’; anders jedenfalls, als wenn die Glocke
sagt; ‚vivos voco, mortuos plango, fulgura frango’. Ich weiß nicht,
ob darüber hinaus noch verwickeitere Sprechsituationen fingiert
werden; vielleicht wäre davon etwas, wenn es vorkommt, auf den
erfindungsreichen alpenländischen Marterln zu entdecken.
Das Wappen hat keine eigenen Zeigzeichen; es müßte sie aus
der Sprache entlehnen, wie das nicht ganz selten auf alten Münzenumschriften
vorkommt. Die Angelegenheit ist insofern eines beachtenden
163Blickes wert, als sie eine allgemeine Frage vorbereitet:
Wie war es bei den historisch frühesten Fixierungen des gesprochenen
Wortes auf Rinden, Holz oder Stein? Die Hilfe des lebendigen Zeigefingers,
die Hilfe des Stimmcharakters und der Herkunftsqualität
der Laute fallen weg; mußte solch ein Ausfall nicht zu erheblichen
Anfangsschwierigkeiten führen? Antwort: Dort jedenfalls nicht,
wo die demonstratio ad oculos schon in der gesprochenen Sprache
überholt war; überholt in der Art, wie es uns der epische Hauptfall
der höher entwickelten menschlichen Rede lehrt. Wohl aber mußte
die optische Wiedergabe der höher entwickelten dramatischen menschlichen
Rede auf Anfangsschwierigkeiten stoßen. Ich denke mir, ein
echter Schauspieler und mit ihm jeder dramatisch Redende hätte
in der Vorzeit einigermaßen hilflos vor der Steinfläche stehen müssen,
wenn er auf den Gedanken gekommen wäre, seine Schöpfung
optisch zu fixieren. Der blinde Homeros dagegen hätte ohne Übergangsschwierigkeiten
den Griffel benützen können; auch der Gesetzgeber
kann es, weil er sich in anderer Richtung vom gestenhaften
Zeigen freigedacht hat.
Eine begriffliche Notiz: Ideell zugeordnet dem Genannten ist jedes Wort,
wie es im Lexikon steht; d. h. zugeordnet im Konventionsbereich der Sprachgemeinschaft,
für die das Lexikon aufgestellt wurde, in der ‚man’ das Wort gebraucht.
Zugeordnet in ähnlichem Sinne, wie das Familienwappen einer Familie zugeordnet
ist. Psychophysisch verknüpft erweisen sich im Bereiche der Sprechdispositionen eines
Individuums (kurz ausgedrückt) das Lautbild und Sachbild eines Wortes. Intentional
erzielt und mehr oder minder auch intentional erreicht wird der genannte
Gegenstand eines Namens in konkreten Sprecherlebnissen; jedesmal dann nämlich,
wenn ein Mitglied jener Sprachgemeinschaft den Namen sinnvoll und korrekt selbst
gebraucht als Sender oder korrekt versteht als Empfänger einer sprachlichen Mitteilung,
worin er vorkommt.
Wenn man diese drei wohlbegründeten Behauptungen nicht reinlich auseinanderhält,
wo immer es auf Begriffsschärfe in diesen Dingen ankommt, muß eine
heillose Verwirrung entstehen; und ist faktisch vorhanden, z. B. noch in dem
sonst so verdienstvollen Werke von de Saussure. Gewiß gehören alle drei Tatbestände
irgendwie zusammen; aber bestimmt nicht in der Weise, daß man die
Sätze, welche wir darüber formulierten, durch Gleichheitszeichen oder ein d. h.
schlankweg verbinden dürfte. Besonders aber sündigt himmelschreiend jeder, der
an entscheidender Kontextstelle explizite oder implizite durch ein d. h. die Aussage
über ein Erlebnis (und die darin enthaltene Intention) verbindet mit der Aussage
über die psychophysischen Voraussetzungen für das Eintreten dieses Erlebnisfalles
(und die darin enthaltene Annahme einer Assoziation ‚Lautbild — Sachbild’).
Im Falle einer dingfesten Verknüpfung des optischen Namensbildes mit dem genannten
Sinnending, einer Verknüpfung, die nach den Umständen im Sinne eines
wirksamen symphysischen Umfeldes ausgelegt werden muß, wird diese sichtbare
Anheftung zum Indizium einer (ideellen) Zuordnung. Nichts anderes haben wir
festgestellt.164
4. Die Erläuterungen zum Begriff des synsemantischen Umfeldes,
das im folgenden Abschnitt eigens und eingehend untersucht
wird, seien kurz gehalten. Nicht nur im Sprachlichen, sondern überall
dort, wo Zeichendinge (die Vorgänge wieder eingeschlossen) eine
sinnliche unitas multiplex bilden, sind die einfachsten Voraussetzungen
für das Aufscheinen eines synsemantischen Umfeldes gegeben.
Dies sei auf einem scheinbar von der Sprache weit abliegenden
Gebiete erläutert. Das Reich der Farben war das erste, in das man
den Begriff des Umfeldes eingeführt hat. Halten wir das Beispiel
der Farben fest, um die Unterscheidung eines symphysischen vom
synsemantischen Umfeld auch außersprachlich zu illustrieren und
verständlich zu machen.
Der Farbenkontrast ist, wie wir heute wissen, eine relativ
periphere Angelegenheit, er ist so gut wie vollständig eine einfache
Funktion der Nachbarschaft gereizter Netzhautstellen. Er ist, wie
wir in unserem Zusammenhang auch sagen können, zum mindesten
der Hauptsache nach eine Erscheinung, die abzulesen ist dem symphysischen
Umfeld der Farbflecken. Wesentlich anders dagegen
steht es mit dem ‚Kontext’ der Bildwerte im Ganzen eines Gemäldes.
Wenn ein Maler auf der Palette dreimal dasselbe Grau mischt und
dreimal physisch denselben Graufleck einsetzt in ein werdendes
Bild, so kann dieser Fleck dreimal (oder noch öfter) einen verschiedenen
Bildwert im Kontexte des Gemäldes erhalten; er kann
z. B. als Schatten oder Lichtreflex oder als Gegenstandsfarbe (als
ein Schmutzfleck z. B. auf weißem Tischtuch) imponieren. Durchaus
gesetzmäßig und zwingend für den Betrachter in normaler Aufnahmebereitschaft.
Das Strukturgesetz der Bildwerte eines Gemäldes ist
ganz und gar etwas anderes wie der Farbenkontrast; diese Bildwerte
stehen in einem synsemantischen Umfeld und erhalten in
ihm bestimmte Feldwerte. Damit solche Strukturen in Erscheinung
treten, müssen die Farbflecken (allgemein: die Sinnesdaten) einen
Zeichenwert erhalten. Den erhalten Farbflecke in hervorragendem
Maße und systematisch, wenn nicht der Anstreicher, sondern der
Maler mit dem Instrument des Pinsels Farbmaterie aufträgt, und
etwas durch Farben „zur Darstellung bringt”. Der Kontext von
Bildwerten in einem Gemälde ist das Analogon zum Kontext der
Sprachzeichen; dort und hier gibt es ein synsemantisches Umfeld 1)53.165
Vielleicht ist es zweckmäßig, das eine noch zu unterstreichen,
daß sich die Zeichen der Lautsprache im lebendigen Verkehrsakt
des Alltags keineswegs exklusiv verhalten. Der Sprecher produziert
sorglos Gesten, Mimik und Laute zusammen auf einmal; darin
kommt als synsemantisches Umfeld des einzelnen Sprachzeichens
der ganze Inbegriff der mitproduzierten Verkehrszeichen zur Geltung.
Der Theoretiker aber muß sich, um das alles wissenschaftlich reinlich
aufzulösen, zunächst nach relativ einfachen Fällen umsehen und
Schritt für Schritt vorgehen. Wenn der Sprachforscher die ‚Syntax’
einer gegebenen Sprache aufbaut, dann faßt er zuerst das Zusammen
der phonematisch geprägten Lautzeichen allein ins Auge. Das
ist eine sachgerechte Abstraktion, die sich als fruchtbar erwiesen
hat. Nur an bestimmten Stellen macht sich das Bedürfnis nach
einer Erweiterung des Gesichtskreises geltend und wird unabweisbar.
Wir sahen dies bei der Behandlung der Zeigwörter, die ihrer Natur
nach im Zeigfeld der Sprache stehen und dort der sinnlichen Leithilfen
oder eigener Konventionen bedürfen, um eindeutig zu sein.
Wir fanden es wieder in der bereits angeschnittenen Ellipsenfrage
der Philologen, zu der hier noch eine Bemerkung angebracht erscheint.
5. Natürlich gibt es Ellipsen. Es gibt unvollendete Bauten
(man denke an die Dome aus dem Mittelalter) und sonst noch allerhand
in der Ausführung stecken gebliebenes Menschenwerk, darunter
auch unvollendete Reden. Weit entfernt, daß ich den Tatbestand
der sprachlichen Ellipsen im weitesten Wortsinn oder den spezielleren
Tatbestand der elliptischen Sätze bestreiten wollte. Ursachen, Anlässe
und Gründe gibt es genug dafür, daß einem Sprecher von
innen her der Faden abreißt, oder der Atem ausgeht oder daß ihm
jedes weitere Wort überflüssig und überholt erscheint oder daß ihm
von außen her das Wort mitten im Satze abgeschnitten wird. Das
alles bleibt solange sprachtheoretisch uninteressant, bis Produkte
aufgezeigt werden, die, kurz gesagt, gewaltlos von einer Seite gesehen,
unvollendet und von der anderen doch wieder geschlossen
und vollendet anmuten. Gelingt es in dieser immer noch großen
Klasse, das sympraktisch und das symphysisch Vollendete als solches
zu charakterisieren und abzuheben, dann wird vermutlich ein
einigermaßen homogener Rest von Fällen verbleiben, in denen wirklich
eine echt syntaktische Vollendung innerlich erfordert, aber
166äußerlich nicht geleistet wird, weil sie kontextlich überflüssig erscheint.
Die Gründe solch entbehrlicher Vollendung liegen manchmal
offenkundig in redensartlicher Geläufigkeit oder werden philologisch
d. h. aus der individuellen Textstelle zu ermitteln sein. Ausdrücke
wie ‚ire ad Jovis’ bereiten der Interpretation keine Schwierigkeit.
Wer sich an die kurze Definition von G. Herrmann hält ‚ellipsis est omissio
vocabuli, quod et si non dictum tarnen cogitatur’, wird in jedem Einzelfall überlegen,
ob die Annahme eines Mitgedachtseins unausweichlich ist. Das verlangt korrekt
auch B. Maurenbrecher in seinem Aufsatz „Die lateinische Ellipse, Satzbegriff
und Satzformen” 1)54. Maurenbrecher formuliert am exegetischen Material der
Latinisten einige Regeln, nach denen man der Landplage übereifriger Ellipsenseher
Herr werden kann. So weit in der Annahme von Ausfällen wie die alten Grammatiker
aus der Schule der Stoa wird ja heute kein Philologe mehr gehen; immerhin
mag im Sinne von Maurenbrecher noch einiges einzudämmen sein. Mir scheint,
auf unserem Wege sei das wesentlich einfacher und befriedigender zu erreichen als
mit Hilfe der drei Regeln, die Maurenbrecher formuliert. Keine Ellipse liegt
danach vor:
„1. Wenn Bestandteile der Gesamtvorstellung (des Satzes) überhaupt nicht
sprachlich ausgedrückt werden, sondern unausgedrückt im Bewußtsein des Sprechenden
und Hörenden (Lesenden) vorhanden sind und sachlich gut verstanden werden.
2. Wenn dieselben durch andere Ausdrucksbewegungen als durch sprachliche
(Gesten, Mienen, optische u. dgl. Zeichen, durch andere Töne usw.) zum Ausdruck
kommen.
3. Wenn die Ergänzung aus anderen Sätzen (meist vorhergehenden), und
zwar a) desselben Sprechers, b) aus der Rede des anderen, geschieht (letzteres z. B.
in jeder Antwort)” (236).
Der zweite Punkt dieser Liste trifft, was alle seit Wegener, die sich mit den
Zeighilfen beschäftigt haben, z. B. auch H. Paul und Brugmann, meinten. Darüber
ist nach einer subtileren Analyse des Zeigfeldes und der Funktion der Zeigwörter
kaum mehr etwas Belangreiches zu sagen. Der dritte Punkt lenkt die Aufmerksamkeit
speziell auf die wichtige Tatsache der Anaphora (sowohl auf das sprachlich geführte,
als auf das nicht sprachlich geführte Zurückgreifen, Vorgreifen im Kontexte).
Hier wird unsere Betrachtung des Haupt-Nebensatz-Gefüges anknüpfen. Nur der
erste Punkt könnte Veranlassung zu kritischen Bemerkungen bieten. Die Psychologen
um Wundt und H. Paul waren nach unserer heutigen Auffassung viel zu sorglos
in ihren erlebnispsychologischen Subkonstruktionen. Woher kennt denn Maurenbrecher
die ‚Vorstellungen’ der Gesprächspartner so genau, daß er entscheiden
kann: Das und das sei zwar mit vorgestellt gewesen, aber sprachlich nicht manifest
geworden? Mit solchem bestreitbaren Wissen darf man heute nicht mehr opetieren;
selbst dort nicht, wo man einem wohlbegründeten philologischen Bedürfnis folgend
die Ellipsenflut eindämmen will. Wie wenig an Sachvorstellungen im Erlebnis
der Sender und Empfänger von Sprachzeichen wirklich nachzuweisen ist, davon
erhält jeder, der sich die Mühe nimmt, die sorgfältigen Protokolle der Denkpyschologie
daraufhin anzusehen, einen starken Eindruck. Die Ellipsenflut aber wird
vor ihrem Anschwellen bewältigt, wenn man zu zeigen vermag, daß die Voraussetzung
167falsch ist: alle sinnvoll verwendeten Wörter müssen in einem synsemantischen
Umfeld stehen, müssen kontextgetragen sein. Das allein ist die wirksame
Radikalkur gegen die zweimal tausendjährige Ellipsenplage.
§ 11. Kontext und Feldmomente im einzelnen.
Es ist kein Zufall, daß uns das sprachliche Zeigfeld an der
Sprechhandlung und das Symbolfeld am entbundenen Sprachwerk
am klarsten in die Augen fällt. Denn originär mit dem ausgestreckten
Zeigefinger treffen kann man mir, was sinnlich wahrnehmbar ist
und der ausgestreckte Zeigefinger ist nur dann ein brauchbares Verkehrsmittel,
wenn der Empfänger ihn sehen und die Signalanweisung
erfolgreich vollziehen kann. Die Deixis am Phantasma erfolgt,
wenn der Berg zu Mohammed gekommen oder Mohammed zum Berge
gegangen ist, d. h., wenn der Empfänger sein „inneres” Auge auftun
und wieder die Zeiganweisungen befolgen kann. Zeigen ist das
sprechhandelnde Verhalten kat' exochen und bleibt es auch, wenn
es in den Dienst der Poesis gestellt wird; der Leser nehme „Poesis”
im weiten Sinne, ganz so wie Aristoteles und die moderne Kinderpsychologie.
Die Entbindung des Sprachwerks aus den originären Zeighilfen
ist ein Thema unserer Satzlehre. Man nehme es hier als ausgeführt
an und suche eine Antwort auf die Frage: was dann? Entbundene
Reden in dem Wortsinn, wie wir ihn brauchen, sind (nach
dem später erbrachten Ausweis) in irgendeiner Gradabstufung alle
selbständigen Sätze. Schieben wir jetzt die Übergangserscheinungen
beiseite, um an selbständigen Sätzen die Kontextfaktoren aufzusuchen.
Wir denken z. B. an die weitest abgelösten Reden, die
auf Steinen oder schwarz auf weiß fixiert in Schriftwerken zu finden
sind. Die Kenner der „toten” Sprachen haben ihren Gegenstand
nie in anderer Form gesehen oder gehört. Es ist in geringem Ausmaß
das symphysische und in weit höherem das synsemantische
Umfeld dieser Sprachzeichen, was jenen Forschern fort und fort den
Anhalt bietet zu neuen Fragen und Antworten über ihren „toten”
Gegenstand. Denn die synsemantischen Umfeldfaktoren sind weitgehend
mitkonserviert in dem Erhaltenen. Es gilt jetzt, sie restfrei
und systematisch zu erfassen, wobei der vorübergehende Hinweis
auf die reduzierten Forschungsmöglichkeiten an den toten
Sprachen von selbst wieder unter den Tisch fallen kann.
Es war Franz Xaver Miklosich, der in seiner „Vergleichenden
Grammatik der slawischen Sprachen” die bestrickend einfache
Formel vorlegte, Syntax sei die Lehre von den Wortklassen und
Wortformen. Wir werden kritisch einiges zur Ergänzung und viel
168mehr Zustimmendes vorzubringen haben; benützen wir das klare
Wort als Ausgangsthese, nicht um in ihr stecken zu bleiben, sondern
um vorwärts und weiterzukommen. Es ist den Sachverständigen
besonders nach dem Buch von John Ries „Was ist Syntax?”
deutlich geworden, daß es mit einem Anlauf allein und in einem Zuge
überhaupt nicht geht mit dem Aufbau der Syntax. Primär sind
mindestens die zwei Hauptgänge, die Ries korrekt als den Weg von
außen (mit Miklosich) und den Weg von innen (aber besser als
Becker) charakterisiert hat, und sekundär sind noch andere möglich
und erwünscht.
Warum das letztere? Die Syntax als Teil der Grammatik wird zwar stets
unter dem regierenden Oberbegriff der Gebildelehre stehen und stehen bleiben; doch
vergegenwärtige man sich am Vierfelderschema noch einmal den Reichtum innerer
Beziehungen einer Theorie der Sprachgebilde zu dem, was in anderen Büchern über
die Sprache stehen kann und stehen muß. Warum nicht z. B. eine Syntax des
Altfranzösischen und Neufranzösischen schreiben, die sich möglichst eng an die
Dokumente hält und Zug für Zug eine Syntax an den Belegstellen herausarbeitet?
Eine solche Syntax muß verwachsen bleiben mit Interpretationen, muß mitberichten
von inneren und äußeren Situationen, sie muß, wie das Ettmayer unterstreicht,
den Charakter einer „psychologisch” (d. h. erlebnispsychologisch) unterbauten
Lehre tragen. — Ein anderer mag kommen und den Schöpfer suchen, die schaffende
Gestaltung in den Vordergrund seines Interesses schieben, wo er syntaktische
Probleme verfolgt. Ihm wird zur Beantwortung von Stilfragen die Husserlsche
Aktlehre viel zu bieten haben auch dort, wo er Grammatik treibt. Das sind sachgerechte
Beleuchtungen bald von hier und bald von dort; das heißt man Syntax
vom Standpunkt des Sprechhandelnden der Umgangssprache oder Syntax vom
Standpunkt des Schöpfers auserlesener Sprachwerke her beleuchten; und beides
gehört zu einer allseitigen Strukturerfassung der Sprache.
Die Analyse im Sinne von Miklosich ist unvermeidbar; sie
wurde nach ihm in großem Stile von Delbrück, sie wurde noch
einmal von Wackernagel als Ausgang der Syntax gewählt. Was
Ries als Ergänzung fordert, eine Satzlehre und Theorie der Wortgruppen,
wird aus guten Gründen an zweite Stelle gerückt; doch
sollte es nicht vergessen werden und unausgeführt bleiben. Wir suchen
als Sprachtheoretiker aus der Vogelschau eine Ordnung der Faktoren
des synsemantischen Umfeldes der Sprachzeichen und wissen,
daß wir sachgerecht zuerst in die Bahn von Miklosich geraten, den
Weg ‚von außen nach innen’ gehen müssen. Das Ergebnis lautet,
daß das Inventar von Miklosich erweitert werden muß. H. Paul,
J. Ries und andere haben korrekt die Klasse der musikalischen
Modulationen und den Stellungsfaktor zur Anerkennung gebracht;
wir holen noch einmal aus und unterstreichen ganz am Anfang
den Faktor der Stoffhilfen. Wer ihn richtig sieht und nicht davor
zurückschreckt, sein volles Gewicht in der Gesellschaft der
169übrigen Kontextfaktoren anzuerkennen, gewinnt eine beträchtlich
veränderte Meinung vom Wesen der Sprache. Es geschieht zum
Teil um der Kürze willen, daß die Stoff hilf en und Wortklassen in
einem Atemzug genannt und behandelt werden.
1. Stoff und Wortklassen. Philologen haben oft verstümmelte
und verdorbene Texte wiederherzustellen und lösen die Aufgabe
mitunter so, daß Nachkommende bekennen, die Konjektur gleiche
dem Ei des Kolumbus. Kontrollierbare Lösungen dieser Art hat
Ch. Bühler im psychologischen Experiment provoziert mit künstlich
und systemgerecht verstümmelten Texten: Literarisch einigermaßen
erfahrenen Versuchspersonen (Studenten) werden unbekannte
prägnante Aussprüche (Sentenzen), längere Texte bis zu zehn,
fünfzehn Wortzeichen vorgelegt; aber diese Texte sind gänzlich
entformt und zu Worthaufen in sinnloser Reihe entstellt. Man soll
zusehen, ob eine Restitution gelingt. Ich zitiere vier Beispiele aus
der Sammlung, welche 62 Nummern enthält:
1. Bibliothek — Bände — Gehirn — Fächer — Gedanken — 100 000 — Generationen
— riesig — ähnlich — verschwunden — aufreihen.
2. Edelstein — Fassung — Preis — Wert — erhöhen — nicht.
3. Häuser — Jahrmarkt — Stadt — alt — klein — herumhocken.
4. Ozean — Schiffe — Nacht — Dunkelheit — Leben — Menschen — Schweigen
— Stimme — Signal — Ruf — Blick — einander — entfernt — sprechen —
vorüberziehen — begegnen — dann — wieder.
Eine im wesentlichen sinngetreue Wiederherstellung gelang
in vielen Fällen und dabei kamen Ordnungstechniken des Sprechdenkens
zum Vorschein, die offenkundig aus lebenslanger Übung
im Operieren mit Sprachzeichen stammen. Ungefähr so wie auch
sonst Scherben und andere membra disjecta zu probierendem
Wiederaufbau reizen und ihn nicht selten eindeutig zu vollenden
gestatten, so stellt sich bei unseren Versuchspersonen ein sprachlicher
Konstruktionsdrang ein. Und der Text ist nicht selten unerwartet
rasch in den Hauptlinien richtig hergestellt. Die unverdorbenen
Ausgangstexte lauten:
1. Wie in den Fächern einer riesigen Bibliothek in 100000 Bänden die Gedanken
verschwundener Generationen aufgereiht sind, ähnlich in unserem Gehirn
(Strindberg).
2. Die Fassung des Edelsteins erhöht zwar seinen Preis, aber nicht seinen Wert.
3. Wie auf einem Jahrmarkt hocken die alten Häuser der kleinen Stadt herum
(Rilke).
4. Ships that pass in the night, and speak each other in passing
Only a signal shown, and a distant voice in the darkness;
So, on the ocean of life we pass and speak one another,
Only a look and a voice, then darkness again and a silence (Longfellow).170
Es kommt uns hier nicht an auf die Schilderung der Wege,
Umwege, Abwege, welche die einzelnen Versuchspersonen näher
oder weniger nah an eine sinnvolle Rekonstruktion gebracht haben.
Darüber muß der Interessierte die beiden Arbeiten selbst befragen 1)55.
Sondern wir stellen viel elementarer fest, daß hier das Morphologische
und die Reihungshilfen weitgehend vernichtet waren; es fehlen
so gut wie vollständig die Kasuszeichen der Nomina, die Flexionsendungen
der Verba und die meisten Partikeln. Dagegen blieb
(im Deutschen) die Wortklasse erkennbar, der jedes Sprachsymbol
zugehört, und es sprang jener andere Faktor mit ein, den ich kurz
durch den Namen ‚Stoff’ andeute. Wenn irgendwo das Wort
‚Radieschen’ vorkommt, dann ist der Leser sofort an den Eßtisch
oder in den Garten versetzt; in eine ganz andere ‚Sphäre’ also (der
Terminus ist in der zitierten Arbeit denkpsychologisch definiert),
wie wenn z. B. das Wort ‚Ozean’ vorkommt. Jeder zum Worthaufen
zerschlagene und entformte charaktervolle Text hat noch
seinen Sphärengeruch, und man braucht gar nicht besonders sensibel
dafür zu sein, um aus ihm Phantasiehilfen und damit einen Ariadnefaden
zu gewinnen. Eines gibt das andere; wenn ein einzelner
Kristallisationspunkt gewonnen ist, um den sich alles übrige herumgruppiert
(„Gesetz der Zentralisation”) oder wenn ein reicheres
Beziehungsschema (Gegensatzpaar, Steigerungsreihe, Viererschema
wie zu einer Analogie a:b = c:d) rein stofflich angedeutet ist und
aufscheint dem Suchenden, dann ist die Rekonstruktion in der Regel
schon in vollem Zuge.
Was ergibt sich sprachtheoretisch, daraus? Aus dem Phänomen
der stofflichen Ordnungshilfen ist nicht mehr und nicht weniger
abzulesen, als daß es zur Lebensgewohnheit der gewöhnlichen Gebraucher
von Sprachzeichen gehört, dem, wofür sie als Symbole
stehen, die ganze Aufmerksamkeit und eigene innere, schaffende
oder nachschaffende Aktivität als Sprecher oder Hörer zuzuwenden.
Man ist dort bei den Dingen, von denen gesprochen wird, und läßt
die konstruktive oder rekonstruierende innere Tätigkeit zum guten
Teil vom Gegenstand selbst, den man schon kennt oder soweit er
durch den Text bereits angelegt und aufgebaut ist, gesteuert werden.
Die gewachsene Sprache verhindert dies Verfahren nicht, sondern
verlangt es geradezu und ist darauf eingerichtet; die übliche Art
des Sprechens rechnet damit, läßt allenthalben Spielräume offen.
Unsere darstellende Alltagssprache und die des Dichters oft in gesteigerten!
171Grade, aber auch die Sprache in wissenschaftlichen Werken
zielt im einzelnen Satze meist nicht auf höchsterreichbare logische
Eindeutigkeit und Lückenlosigkeit ab. Ein Einfangen des vollen
Gegenstandes und Lückenlosigkeit seiner sprachlichen Darstellung
ist in weit geringerem Grade ein Ideal als die meisten ahnen. Ja,
es wird auch dann von der natürlichen Sprache nur erbärmlich
unvollkommen erreicht, wenn man es ihr z. B. in logisch geschärften
Beweisgängen aufnötigt. Der Sprachtheoretiker notiert das Phänomen
der stofflichen Steuerung des Sprechdenkens und behält
sich vor, darüber z. B. mit Husserl und seiner Idee einer reinen
Grammatik in Diskussion zu geraten.
Hier aber mußte es Erwähnung finden, weil es den Theoretiker
der sprachlichen Darstellung vernehmlicher als vieles andere auf die
prinzipielle Offenheit sprachlicher Fassungen von Gegenständen und
Sachverhalten hinlenkt. Die stoffliche Steuerung des Sprechdenkens
ist ein Phänomen, welches mit einigen anderen Tatsachen
zusammen den wichtigen Satz zu beweisen gestattet, daß das Andeuten,
welches der zeigende Finger vollbringt, nicht nur die Leistung
der Zeigwörter charakterisiert, sondern weit darüber hinaus auch
im Funktionsbereich der Begriffswörter zu finden ist und zu den
Struktureigenheiten der menschlichen Sprache gehört. Das wohldosierte
Senden von Sprachzeichen, auch dann, wenn sie in geschlossenem
Kontexte trocken darstellen, gleicht mehr oder minder
den Hilfen, die ein Reiter seinem Pferde und sonst geschickte Lenker
dem gelenkten Lebewesen geben. Ist das Selbstdenken des Hörers
in Gang gebracht, dann lockert eine sprachtechnisch vollendete
menschliche Rede die Zügel und setzt nur sparsam ganz neue Impulse.
Daß es Grade und Abschattungen darin gibt, ist eine triviale
Weisheit; wir behaupten, das konstruierende Eigendenken des Empfängers
sei uneliminierbar und in weiten Grenzen unschädlich; sogar
den meisten Sprachzwecken höchst förderlich. Jedenfalls aber muß
es in der Sprachtheorie als vollgewichtiger Faktor, mit dem zu
rechnen ist, gewürdigt werden. Bis jetzt am besten gesehen hat es
Wegener; doch bedürfen seine immer noch aphoristischen Belege
einer systematischen Ergänzung.
Das andere sind die Wortklassen. Ich weiß nicht, wie alt sie
sind in der Menschensprache und welches die ersten waren; noch
weiß ich, welche unentbehrlich sind und überall vorkommen. Aber
wenn sie vorkommen wie im Deutschen und erfaßt werden, sei es
ohne besondere Klassenzeichen oder an Klassenzeichen (wie unsere
Infinitive), dann bieten sie dem Textaufbau fundamentale Anweisungen.
172Nicht nur beim Rätselraten ist es so und im Angesicht
von entformten Worthaufen, sondern selbstverständlich auch mitten
unter den listfrei angesetzten und unverdorbenen anderen Kontextfaktoren.
Es bestehen in jeder Sprache Wahlverwandtschaften;
das Adverb sucht sein Verbum und ähnlich die anderen. Das läßt
sich auch so ausdrücken, daß die Wörter einer bestimmten Wortklasse
eine oder mehrere Leerstellen um sich eröffnen, die durch
Wörter bestimmter anderer Wortklassen ausgefüllt werden müssen.
Es ist der wichtige, schon den Scholastikern bekannte Tatbestand
der Connotatio, den wir im Auge haben. Er ist neben den Stoffhilfen
das zweite wichtige und generelle Kontextmittel. Man könnte
sich, wie ich glaube, eine menschliche Sprache denken, die im wesentlichen
mit Stoff hilf en und einer genügenden Anzahl wohlcharakterisierter
und passend ausgesuchter Wortklassen auskommt. Man
kann sich freilich ebensogut vorstellen, daß andere Kontextfaktoren
(z. B. die Reihung) äußere Wortklassenmerkmale weitgehend überflüssig
machen; ich denke an die Verhältnisse im Chinesischen und
an Einbußen, die das Englische in seinem historischen Werdegang
unbeschadet erlitten hat.
Unter den nichtsprachlichen Darstellungsgeräten, die wir zum
Vergleich heranziehen werden, fällt die Notenschrift der Musiker
auf ob ihres besonders einfachen Klassensystems. Es gibt dort zwei
Grundklassen von Symbolen, Noten und Pausenzeichen, die im
Kontext verbunden werden. Die Kunstsprache der Logistiker ist
viel reicher an Symbolklassen; die bekannten natürlichen Sprachen
sind es auch. Doch ist es niemand bis heute gelungen, die Wortklassen
der natürlichen Sprachen im umfassenden Umblick auf alle Menschensprachen
völlig durchsichtig zu ordnen.
2. Es gibt eine Liste der Kontextfaktoren von H. Paul, worin
der Wortklassen keine Erwähnung geschieht, während die klassisch
einfache Definition des Begriffes Syntax bei Miklosich sie ausdrücklich
anführt: „Syntax ist die Lehre von der Bedeutung der Wortklassen
und der Wortformen”. Den das ganze Unternehmen der
Syntax begrenzenden Vordersatz von den Stoffhilfen kennt Paul
nicht dem Namen nach, bringt ihn aber als negativen Satz im zweiten
Abschnitt unseres nächstfolgenden Zitates. Doch hängt, wie wir
immer wieder sehen werden, außerordentlich viel daran, ihn positiv
und exakt zu formulieren; wir sagen; ‚er hat den Schnupfen’ —
‚er hat ein Haus’ — ‚er hat Unglück’ und variieren dabei dreimal
den Charakter des dargestellten Sachverhaltes; der Freund, von dem
wir sprechen, hat den Schnupfen gewiß nicht so, wie er sein Haus
173und wieder anders, als er seine Frau oder Unglück hat. Aber die
Spezifikation bleibt jeweils der Stoffhilfe überlassen. ‚Backstein —
Backofen — Backholz’ variieren dreimal die sachliche Relation der
gefügten Glieder; die Spezifikation bleibt jeweils der Sachkenntnis
(= Stoffhilfe) überlassen. Es ist nicht an dem, daß man nur zugibt,
solch sachlich gesteuertes Ausdenken transzendiere die Mittel der
sprachlichen Darstellung. Gewiß, aber es muß von vornherein Platz
sein neben allem andern für dies Miteingreifen solch angeblich
„sprachfremder” Faktoren. Nicht mehr, als daß die Sprache keineswegs
überrumpelt und beiseite geschoben wird, sondern darauf angelegt
und eingerichtet ist, allenthalben eine gewisse Distanz zu
wahren und Spielraum für solche Spezifikationen freizulassen, ist
der Inhalt unserer These von den Stoffhilfen in jedem Kontexte.
Miklosich trifft im zweiten Gliede seiner Liste zu wenig;
vermutlich zum Teil deshalb, weil er vor allem die slawischen
Sprachen und nicht etwa das moderne Französisch oder Englisch
vor sich sah. Denn Wortformen sind es nicht, die z. B. den zwei
englischen Sätzen ‚gentlemen prefer blonds’ und ‚blonds prefer
gentlemen’ eine verschiedene „Bedeutung” verleihen. Darin ist
Pauls Liste unvergleichbar weitsichtiger; ja sie ist, wenn man zuvor
die Angelegenheit der Stoffhilfen und der Wortklassen bereinigt
hat, sogar nachweisbar vollständig, erschöpfend. Denn die syntaktischen
Mittel der Systeme vom Typus Sprache sind nicht
beliebig zu vermehren, sondern aufzählbar den Klassen nach; sie
stellen ein geschlossenes System vor, dessen Dimensionen man angeben
kann. Es sind sieben Gruppen bei Paul; wir werden sie auf
drei natürliche Klassen bringen, ohne etwas wesentlich Neues hinzuzufügen
und ohne etwas von Paul schon Genanntes wegzulassen.
Der § 86 der Paulschen Prinzipien lautet sehr schlicht und anspruchslos:
„Zum sprachlichen Ausdruck der Verbindung von Vorstellungen gibt
es folgende Mittel: i. die Nebeneinanderstellung der den Vorstellungen entsprechenden
Wörter an sich; 2. die Reihenfolge dieser Wörter; 3. die Abstufung
zwischen denselben in bezug auf die Energie der Hervorbringung, die stärkere oder
schwächere Betonung (vgl. Karl kommt nicht — Karl kommt nicht); 4. die Modulation
der Tonhöhe (vgl. Karl kommt als Behauptungssatz und Karl kommt? als
Fragesatz); 5. das Tempo, welches mit der Energie und der Tonhöhe in engem Zusammenhange
zu stehen pflegt; 6. Verbindungswörter wie Präpositionen, Konjunktionen,
Hilfszeitwörter; 7. die flexivische Abwandlung der Wörter, und zwar a) indem
durch die Flexionsformen an sich die Art der Verbindung genauer bestimmt wird
(patri librum dat); b) indem durch die formelle Übereinstimmung (Kongruenz) die
Zusammengehörigkeit angedeutet wird (anima candida). Es ist selbstverständlich,
daß die beiden letztgenannten Mittel sich erst allmählich durch längere geschiehtliehe
174Entwicklung haben bilden können, während die fünf erstgenannten von Anfang
an dem Sprechenden zur Verfügung stehen. Aber auch 2-5 bestimmen sich nicht
immer bloß unmittelbar nach dem natürlichen Ablauf der Vorstellungen und Empfindungen,
sondern sind einer traditionellen Ausbildung fähig.
Je nach der Menge und Bestimmtheit der angewendeten Mittel ist die Art
und Weise, wie die Vorstellungen miteinander zu verbinden sind, genauer oder ungenauer
bezeichnet. Es verhält sich in bezug auf die Verbindungsweise gerade so
wie in bezug auf die einzelne Vorstellung. Der sprachliche Ausdruck dafür braucht
durchaus nicht dem psychischen Verhältnisse, wie es in der Seele des Sprechenden
besteht und in der Seele des Hörenden erzeugt werden soll, adäquat zu sein. Er
kann viel unbestimmter sein” (123f.).
Wir betrachten das erste Mittel Pauls, den Kontaktfaktor
schlechthin, als erläutert und feiner differenziert durch das, was
im Anschluß an die Versuche Ch. Bühlers gesagt worden ist.
Über die syntaktische Funktion der Reihenfolge in den verschiedenen
Sprachen ist am Beispiel des Kompositums im Anschluß an die
kühne Theorie von W. Schmidt beispielhaft einiges zu erörten, was
wir eben dort unterbringen wollen. Dann bleiben weiter die musikalischen
und die phonematischen Modulationen. Denn daß die
beiden Gruppen Pauls eng zusammengehören, bedarf nur eines
Hinweises auf die Sprachgeschichte; während ‚Energie, Tonhöhe,
Tempo, Pausen’ Gestaltungen erzeugen, die nicht genau so, aber
doch vergleichbar auch in der Musik vorkommen und darum musikalische
Modulationen heißen sollen. Ihre Zugehörigkeit zur Liste
der Kontextfaktoren ist erbracht, wenn nur in einigen Sprachen
wie im Deutschen der Satzakzent oder die Satzmelodie entscheidet,
ob ein Gefüge als Aussage, Frage, Befehl u. dgl. m. zu fassen ist.
In der kindlichen Sprachentwicklung sind musikalische Modulationen
außerordentlich früh; vielleicht sind sie ebenso früh und allgemein
verbreitet in den „Sprachkreisen und Sprachfamilien der Erde”;
nur weiß ich das nicht.
W. Schmidt behandelt die Vor- oder Nachstellung an einem
sehr charakteristischen Fall, nämlich im attributiven Gefüge
und stellt im Umblick auf alle bekannten Menschensprachen die
Regel auf, daß eine durchgehende Affinität besteht zwischen Voranstellung
des bestimmenden Gliedes wie in ‚Hausschlüssel’ und Suffixbildungen
einerseits und Nachstellung mit Präfixbildungen andererseits.
Das ist eine sehr interessante (auch innerlich plausible) Korrelation,
die selbst dann noch sehr beachtenswert wäre, wenn sie nicht
alles umfaßte und nicht ausnahmslos gültig wäre in allen Sprachen.
Doch lassen wir die Korrelationen der verschiedenen Fügemittel
auf sich beruhen und beweisen den Satz, daß es keine anderen
gibt und geben kann als die aufgezählten. Man denkt beim Worte
175„phonematische Modulationen” nicht nur an die selbständigen Formwörter
(Präpositionen, Postpositionen u. dgl. m.) und an die Formsilben,
als welche die Suffixe und Präfixe häufig auftreten, sondern
natürlich auch an zugefügte und weggelassene Phoneme allein, die den
Silbenbestand nicht vermehren oder verringern; man denkt auch an
Erscheinungen wie den deutschen Umlaut und Ablaut oder an die
viel systematischer durchgeführten Vokalisationen in den semitischen
Sprachen. Hier wird nichts hinzugefügt oder weggelassen und doch
phonematisch moduliert; auch die sogenannten Infixe muß man
irgendwo unterbringen. Damit aber ist man so gut wie am Ende.
Und hat bereits mitzitiert die entscheidende Voraussetzung, die
gemacht wird von einem, der nichts überraschend Neues mehr erwartet
an neu zu entdeckenden Sprachen.
Es wäre, wenn z. B. der Phonetiker allein das Wort erhielte,
nicht zu erfahren und von vornherein gar nicht abzusehen, wie viele
und welche Modulationen eines gegebenen Lautstroms ausgewertet
werden können von sprechenden Menschen zu dem Ende, syntaktische
Funktionen manifest zu machen. Die Problemlage wird aber
anders, wenn nach dem Phonetiker der Phonologe das Wort ergreift.
Denn er schließt mit dem einen Satz, daß jede Sprache nur ein
wohlcharakterisiertes System von Lautmalen zur Diakrise bestimmter
Stücke des Lautstroms voneinander verwertet, sofort
einen Großteil denkbarer und praktisch erzeugbarer, ja sogar
vorkommender Modulationen aus. Das heißt nicht, sie seien, wo
sie vorkommen, schlechthin irrelevant im Sprechverkehr, sondern
es heißt nur, sie seien irrelevant für die Darstellungsfunktion der
Sprache. Vibrationen der Sprechstimme z. B. und Modulationen
des Timbre sind pathognomisch sehr wichtig; aber grammatisch
relevant sind sie, soweit mir bekannt, in keiner Menschensprache.
Freilich: der fingierte Phonologe muß umsichtig genug sein
und ein offenes Auge behalten, belehrbar bleiben für Winke, die
er von rechts und links erhält. Ich stelle mir den Grammatiker zu
seiner Rechten und den Psychologen zu seiner Linken plaziert vor,
weil das sich so gehört. Es ist nicht die Phonologie, sondern die
Grammatik oder sagen wir: die Wortlehre, welche bestimmte
Stücke des Lautstroms einer Rede als Wörter und Wortbestandteile
charakterisiert. Und das gehört mit zu den Voraussetzungen unserer
Liste. Es ist weiter die moderne Psychologie, welche nachdrücklich
darauf hinweist, daß zum Lautcharakter dieser Gebilde außer den
Lautmalen = Phonemen auch bestimmte Gestaltqualitäten gehören.
Ähnlich wie es die Großformen der sogenannten Satzmelodie, des
176Satzrhythmus und der Zeitgestalten des Satzes gibt, so gibt es dieselben
Gestalten im Kleinformate auch am Worte schon. Es gibt
Wortakzente und Wortmelodien; sie dürfen natürlich nicht vergessen
werden und sind es auch nicht in der aufgestellten Liste.
Sie gehören zu den musikalischen Modulationen, die entweder
direkt syntaktisch relevant werden können (z. B. als sogenannte
Satzmelodie) oder auf dem Umweg über eine Modulation, die sie
am einzelnen Wortklang vollbringen; übersetzen und übersetzen
sind im Deutschen verschiedene Wörter, beides Verba freilich.
Doch könnten solche Modulationen genau so gut wie Umlaut und
Ablaut auch die Wortklasse ändern und direkt als Fügemittel
fungieren; man denke z. B. an das Akzentgesetz der deutschen
Komposita. Noch einmal anders ausgedrückt, so hat jedes Wort
ein Klanggesicht, das nicht restlos vom Ausdruck bestimmt wird,
sondern teilweise auch den Symbolwert und die syntaktische
Valenz des Wortes angibt.
Werden die aufgezählten allgemeinen Gestaltungsbedingungen
des Lautstroms der menschlichen Rede anerkannt, dann sieht man
ein, daß unsere Liste vollständig und abgeschlossen ist. Genauer
gesagt, man findet keine Variationsbereiche mehr, die nicht als
relevant aufgezählt oder als irrelevant ausgeschlossen wären. Wichtiger
als der Beweis ihrer Vollständigkeit aber wäre, wie mich dünkt,
der Versuch, aus dem Tatsachenmaterial der allgemeinen Sprachvergleichung
erstens eine Typologie des verschieden kombinierten
Gebrauchs der aufgezählten konstitutiven Feldzeichen in den Sprachfamilien
der Erde zu gewinnen und zweitens dazu überall die
Funktionen dieser Mittel systematisch anzugeben. Denn die Funktion
desselben Mittels in verschiedenen Sprachen kann sehr verschieden
sein.
3. Es galt als eine Forderung des induktiven Forschungsverfahrens,
als man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem
sinnlich manifesten Moment auch in der Syntax den Vortritt einräumte.
Zum Beispiel: bestimme zuerst die Erscheinungsweisen
der Kasus des Nomens, bevor Du über ihre semantischen Funktionen
sprichst! Genauer besehen aber war es vielleicht noch mehr eine
gewisse Unsicherheit, um nicht zu sagen, Ratlosigkeit dem zweiten
Teil der Aufgabe gegenüber, was damals dem Weg ‚von außen
nach innen’ die wohlbekannte Bevorzugung verschaffte und bis in
unsere Tage sicherte; John Ries hat in seinem wichtigen Buche
„Was ist Syntax?” die Dinge faßlich geschildert. Der Weg von
außen, den wir hier wählten, läßt sich gegen die Riesschen Bedenken
177verteidigen. Warum sollte ein Forscher der Gruppe
Miklosichs die Liste der manifesten syntaktischen Momente nicht
sachgemäß erweitern über die Wortklassen und Wortformen hinaus?
Das Symbolfeld muß, wenn es im sprachlichen Verkehrsakt,
wenn es zwischen Sender und Empfänger eine sprachliche Botschaft
erfüllen soll, wozu es berufen ist, sinnlich manifest werden.
Darum kann und muß für die Aufnahme einer Syntax der Weg
Miklosichs (der Weg von außen im Sinne von Ries) gangbar sein.
Ich habe die Riesschen Einwände und Schwierigkeiten Punkt für
Punkt durchdacht und an dem klarsten und sprachtheoretisch aufschlußreichsten
Versuch einer modernen Syntax, nämlich an dem
Buch von Wackernagel nachzuprüfen versucht, soweit das einem,
der nicht von der Picke auf gedient hat, möglich ist 1)56. Eingeordnet
in das Schema von John Ries wird der Aufbau des Buches von
Wackernagel in die Nähe von Miklosich-Scherer-Erdmann
zu stehen kommen; jedenfalls bietet Wackernagel keine (geschlossene)
Satzlehre, sondern etwas Verwandtes dem mehr oder
minder konsequent durchgeführten Programm derer im 19. Jahrhundert,
die den Weg ‚von außen nach innen’ bevorzugten. Es
sind die Wortklassen und Wortformen, welche in einigermaßen unbekümmert
sorgloser Auswahl im Ganzen aber doch nach der Devise
von Miklosich durchgesprochen werden. Daß es ein Meister des
Wortes ist, der dies tut, sei nebenbei gesagt. Einiges von dem, was
die ersten griechischen Grammatiker, noch unbelastet von Bibliotheken
des Wissens, mit staunendem Blicke der Sprache ablasen
und als frische Erkenntnis niederlegten in der werdenden Terminologie,
wird neben dem jüngsten Erkenntnisbesitz der vergleichenden
Sprachforschung dem Hörer Wackernagels zum Erlebnis.
Man verspürt als Theoretiker den Anreiz, nach dem bekannten
sokratischen Rezept gerade in dieser Werkstätte eines Sachverständigen
in die Diskussion der Frage einzutreten: ‚Was ist also
Syntax?’
Wackernagels Vorlesungen sind ein gutes Stück echter
Syntax. Daß sie eklektisch vorgehen, fällt nicht ins Gewicht; ein
anderer (wie Delbrück) konnte auf dem gleichen Wege systematischer
178verfahren. Und doch hat Ries recht mit seiner Behauptung,
daß ein zweiter Gang notwendig ist, der Gang von innen nach außen.
Stückweise wird er von den vergleichenden Sprachforschern auch
überall gegangen; jeder weiß und kann angeben, wie z. B. das von
der Funktion her als Genitiv Bezeichnete gebildet wird in den einzelnen
Sprachzweigen und Einzelsprachen der großen indogermanischen
Sprachfamilie oder wie das ‚Verbum’ abgewandelt wird. Selbstverständliche
und vielfach unerörterte Voraussetzung ist dabei
zum mindesten, daß es im Vergleichsbereich Verba als eine Wortklasse
und unter den ‚Formen’ des Nomens eine oder einige gibt,
die von der Funktion oder einer ganzen Schar von Funktionen her
als Genitive zu bewerten sind. Kann ich ebenso unbefangen alle
Menschensprachen danach befragen, wie sie den Akkusativ, den
sogenannten Objektskasus bilden? An diesem Punkte wird die
Problemlage spannend für die Sprachtheorie. Wir müssen ein wenig
weiter ausholen, um an dem gewählten Exempel vorzudringen bis
an den kritischen Punkt. Ich werde versuchen, am Kasussystem
der indogermanischen Sprachen zu erläutern, was erforderlich wäre,
aber keineswegs geleistet ist, um beim Aufbau der allgemeinen
Syntax den ‚Weg von innen’ nicht nur stückweise, sondern vollständig
zu gehen.
§ 12. Symbolfelder in nicht-sprachlichen Darstellungsgeräten.
Es gibt Vergleiche im Großen, die man ausführt, um die Vergleichsglieder
gegenseitig zu erhellen. Wir zielen hier nicht auf
Derartiges ab, nicht auf die systematische Miterforschung von
außersprachlichen Darstellungsgeräten. Wo wir uns mit einigen
von ihnen beschäftigen, da wird eine eigensinnige Auswahl getroffen,
weil die außersprachlichen Darstellungsgeräte hier einzig und allein
als Analysatoren kurz gesagt benützt werden sollen, mit deren
Hilfe man imstande ist, Strukturmomente an der darstellenden
Sprache sichtbar zu machen. Wir gehen im Großen ungefähr so
vor, wie die Metapher im Kleinen: Wer von einem Menschen sagt,
er sei ein ‚Salonlöwe’, der streift den zoologischen Kollegen dieses
Menschen nur deshalb und dazu mit einem vergleichenden Blick,
weil es ihm so auf einfache Weise gelingt, bestimmte Züge im Verhalten
des Gemeinten zu unterstreichen und ihn dadurch zu charakterisieren.
Ähnlich wollen wir mit vergleichendem Blicke einige
nichtsprachliche Darstellungsarten streifen, um die sprachliche zu
charakterisieren. Es gibt gar viele Darstellungsarten; sie systematisch
zu behandeln, liegt uns nahezu ebenso fern, wie es dem Gebraucher
179der Metapher vom Salonlöwen liegt, eine Tierpsychologie
zu schreiben. Wir wollen nur einige nichtsprachliche mit der Sprache
konfrontieren. Züge und Strukturen, zu denen man Analoges in
der Sprache kennt oder zu erkennen erwarten darf, sind jeweils
an dem nichtsprachlichen Vergleichsgliede so klar, daß man sie wie
auf einem Präsentierteller vor sich hat.
Merkwürdig genug, daß, soweit mir bekannt, die damit angedeutete
Erkenntnisquelle eines übergreifenden Vergleichens nie
ernstlich erschlossen und ausgenützt wurde. Denn die Umwege
sind lohnend und das fremdartige Geräte, das man vorübergehend
in die Sprachtheorie hineinzieht, fällt von selbst wieder heraus,
wenn es seinen Dienst getan hat. Gerade seine Verschiedenartigkeit
schützt vor der Gefahr, daß man vor lauter Ähnlichkeiten, näheren
und ferneren, die aufscheinen mögen, zu guter Letzt den Blick verliert
für das einmalig Unwiederholbare im Darstellungsverfahren der
Sprache. Wer ebenso sorgfältig auf die Kontraste wie auf die
Analogien achtet, wird um diese Enderkenntnis keineswegs betrogen.
Entscheidend für das Verfahren spricht, daß es zu einigen
Struktureinsichten am Modelle, zur Definition wichtiger Begriffe
und exakten Problemstellungen führt.
1. Wir denken nebeneinander an das Notenpapier der Musiker
und an die geographische Karte. Dort läuft das Band der fünf
Parallelen und harrt der Noten- und Pausenzeichen, die auf ihm
eingetragen werden sollen. Hier das Atlasblatt, welches ich aufgeschlagen
habe, ist schon bedeckt mit einer Fülle von Eintragungen.
Doch sehe ich auch da ein bestimmtes Gerüst, die Längen- und
Breitengrade als gerade oder gekrümmte Linien; erst als diese da
und bezeichnet waren in der bekannten Art, war das Blatt, war die
Fläche, welche eine Karte werden sollte, geeicht und eindeutig
einem Stück Erdoberfläche zugeordnet. An den Anfang des Notenbandes
gehört (weil das in den Konventionen vorgesehen ist) der
eichende Schlüssel samt den Tonartmerkmalen, die uns nicht näher
interessieren; ebenso enthält die geographische Karte manches,
was unbeachtet bleibt. Das Eingetragene auf dem Notenblatt und
das Eingetragene auf der Karte sind sehr verschieden, aber das
tertium comparationis kann im wesentlichen jedem Schulkinde deutlich
gemacht werden.
Der Musiker hat ein kleines abgeschlossenes Inventar von
Symbolen, die ganzen, halben, Viertelnoten usw. bis zur 32tel
oder 64tel Note und parallel dazu die Reihe der Pausenzeichen.
Das ist sein Lexikon; alles was sonst noch auf dem Notenblatt vorkommt,
180z. B. die dynamischen Zeichen und Tempozeichen, die
Zeichen für Staccato und Legato u. dgl. m., ist für den Zweck unseres
Vergleiches vorerst irrelevant. Weiter: Am Fuße der geographischen
Karte steht unter dem Titel „Zeichenerklärung” eine kleine oder
größere Liste von Symbolen, die verwendet werden z. B. für Städte
mit über 100000 Einwohnern, Städte mit 10-100000, unter 10000,
für Dörfer und irgendwie charakterisierte Einzelsiedlungen. Ein
Punkt mit daraufgesetztem Kreuzzeichen symbolisiert eine Kirche
oder Kapelle im Gelände. Da wird ferner erklärt, daß die und die
Strichverschiedenheiten diakritisch sind für Fußsteige, Fahrwege,
Straßen dritter, zweiter, erster Ordnung und für Eisenbahnen. Auch
das, was am Fuße der Karte unter ‚Zeichenerklärung’ steht, ist
ein Lexikon.
Eingesetzt an bestimmte Plätze des Feldes erhalten solche
Symbole im Notenblatt und auf der Karte ihre Feldwerte. Auf dem
Notenblatt ist es so, daß das Nacheinander der Töne abgebildet
wird durch die Reihenfolge von links nach rechts, wozu gehört,
daß senkrecht untereinander die Symbole für gleichzeitige Töne
stehen. Die andere Dimension des Feldes verleiht jedem eingetragenen
Notenzeichen einen Tonhöhenwert entsprechend der
diskreten Tonleiter. Die Feldwerte der Karte sind natürlich ganz
andere, aber auch sie sind Feldwerte. Man kann sowohl die absoluten
geographischen Positionen der eingetragenen geographischen
Gebilde wie ihre Entfernungen voneinander, man kann Richtungen
und Richtungsverschiedenheiten, die zwischen ihnen bestehen,
mit Zirkel und Winkelmesser aus der Karte entnehmen.
Das genügt vorerst als Erläuterung des tertium comparationis vom
Notenfeld und Kartenfeld.
2. Zur Vorbereitung eines fehlerfrei und fruchtbar angesetzten
Vergleichs der leicht durchschaubaren Verhältnisse im Noten- und
Kartenfeld mit dem viel schwerer zu erfassenden sprachlichen
Symbolfeld gehört, daß man bestimmte allgemeine Einsichten gewinnt,
die ein sematologisches Gewicht haben. Ein leeres Blatt
Papier vor mir ist noch kein Feld. Genau so wenig ist das rohe
Nacheinander im Lautstrom der menschlichen Rede schon ein Feld,
sondern es gehört auch in die Lautreihe etwas hinein oder dazu, was
dem Netz von geographischen Zuordnungslinien und dem Streifen
der Fünferparallelen auf Notenblättern entspricht, um ein Feld
oder Felder aus der Zeitreihe zu gewinnen. Genau so verhält es
sich prinzipiell sogar mit dem ‚Feld’ des Malers, der Malfläche, in
die er seine Farbflecke einsetzt.181
Das ist ein drittes Beispiel, was vorübergehend zum Vergleiche
herangezogen wird. Auch der Maler eines Gemäldes muß seiner
physischen Malfläche genau Entsprechendes zum Liniensystem des
Kartographen und Notenschreibers zuerst verleihen, damit sie
ein Darstellungsfeld wird, in das er seine Daten einsetzen kann. Es
genügt, darauf zu achten, daß der Maler manchmal wie ein rechter
Kartograph ein paar Orientierungsmarken, ein paar Umriß- oder
Skelettlinien als das erste aufs Papier setzt, womit und worin der
Maßstab enthalten und die Zuordnungsthesis getroffen ist. Wenn
nicht, so laßt ihn anfangen mit irgendeinem Detail oder mit dem
Entwurf des Kolorits, mit der Stellung und Abwägung von Farbwerten
an Flecken. Nur wenn diese Daten und in dem Maße, wie
sie einen Bildwert (= Darstellungswert) erhalten, ist auf der
physischen Fläche das Darstellungsfeld des Bildners mit Farben
entstanden. Sollte er sich nicht zu diesem Schritt entschließen,
was wir seinem freien Ermessen selbstverständlich vollkommen überlassen,
dann mag er sein Können z. B. als genialer Anstreicher einer
Oberfläche oder er mag es im Wettbewerb mit anderen Farbfleck und
Lichtmusikern zeigen, jedenfalls gehört sein Produkt dann nicht
mehr in die Gesellschaft dessen, was wir mit der sprachlichen Darstellung
konfrontieren können. Im übrigen darf man sich durch
die Parallele, welche Lessing ansetzte, nicht zu voreiligen Konsequenzen
verleiten lassen. Wohl wahr, daß sich die Mannigfaltigkeit
der Gemäldedaten im Raum und die der sprachlichen Daten eines
Kontextes in der Zeitreihe entfaltet. Aber die Sprache, wie wir sie
kennen, ist kein Tonfilm in dem (ungebräuchlichen) Sinne des
Wortes, den wir im folgenden Paragraphen definieren.
Der Sprachtheoretiker muß an diesem kleinsten Punkt die
größte Kraft sammeln, muß imstande sein zu zeigen, wie einer,
der sich anschickt, mit Sprachzeichen darzustellen, überhaupt ein
Feld oder Felder im Pluralis braucht und was sie leisten. Daß man
sie haben muß, um darzustellen, ist eine sematologische Grundeinsicht.
Prinzipiell genommen, ist es nirgends anders wie mit den
Noten, der Karte oder dem Gemälde; so oder anders, ein Feld muß
sich auftun, wo und womit immer eine wohlgebaute und gegliederte
Darstellung als Sprachwerk entstehen soll.
Ich will, um nichts zu versäumen, im Vorbeigehen zwei weitere
Fälle erwähnen, wo Menschen sich anschicken darzustellen. Wir
bringen sie in der Absicht zusammen, das eine Identische am scheinbar
Disparatesten sichtbar zu machen. Die Situation des darstellenden
Schauspielers nämlich und das heute in den verschiedensten
182Wissenschaften mit Recht so beliebte graphische Darstellen. Daß
man, um eine darstellende Kurve exakt lesbar zu machen, ein
Koordinatensystem auf der physischen Zeichenfläche entwerfen und
es ‚eichen’ muß, bedarf keines weiteren Wortes. Doch differenziert
man hier die eingetragenen Markierungen in der Regel nur
dann symbolisch, wenn man z. B. mehrere Kurven zusammen
auf demselben Blatt herstellen will; sonst ist dies meist überflüssig.
Man markiert die Punkte einer Kurve nur irgendwie und alle gleichförmig,
um sie hervorzuheben und miteinander zu verbinden; die
graphische Darstellung ist ein Grenzfall unserer Liste.
Und wie ist es mit dem Schauspieler? Der Schauspieler tritt
auf die Bühne, d. h. allgemeiner ausgedrückt, er erscheint in einem
irgendwie hergerichteten physischen Raum und — sei es nun mit
oder ohne weitgehende äußere Illusionshilfen — der Schauspieler
nützt diesen physischen Raum aus als Darstellungsfeld; er muß ihn
glaubhaft und zwingend zum Felde umgestalten, umschaffen muß
er den physischen Raum, damit er als „Bühne” fungiert. Es gelingt
ihm unter Mitwirkung von allerhand Illusionsmitteln und der
Konvention, die zwischen ihm und dem Zuschauer besteht. Daß
der dort oben auftritt, schauspielerisch darstellen wird, ist die selbstverständliche
Voraussetzung, mit welcher der Zuschauer ins Theater
geht. Dieser Fall und die Situation des Schauspielers ist wichtiger
für die sprachtheoretische Analyse, als man beim ersten Hören ahnen
mag. Wir konnten genau hier ansetzen, um den Existenzbeweis
eines Zeigfeldes der Sprache zu führen und die Funktion einer
ganzen Klasse von Wörtern, der Zeigwörter, zu erläutern. Jetzt
aber handelt es sich um das Symbolfeld der Sprache.
Aus dem Symbolfeld entspringen die Feldwerte der Sprachzeichen.
Das formale Analogon zu ihnen vermag man am Notenblatt
und an der geographischen Karte exemplarisch einfach abzulesen.
Die Verhältnisse liegen hier so, daß alle Notenzeichen und die unter
der Rubrik „Zeichenerklärung” aufgeführten Symbole der Karte
einen feldfremden Darstellungswert mitbringen, der ergänzt wird
durch feldeigene Bestimmtheiten. Die Noten der Musiker, um mit
ihnen zu beginnen, die isolierten Noten, wie sie im Lexikon stehen,
haben keinerlei Kennzeichen der Tonhöhe an sich. Es gibt im
Lexikon nur ein Zeichen für alle ganzen Noten, die in dem Musikstück
vorkommen, nur eines für alle halben Noten usw., gleichviel,
wie verschieden hoch und tief die damit symbolisierten Töne sein
mögen. Im Notenblatt ist es eben eine reine Feldangelegenheit, die
Tonhöhe anzugeben, während umgekehrt das Feld -licht beteiligt
183ist an den Angaben der (relativen) Tondauer. Denn diese relative
Tondauer wird einzig und allein durch die Gestalt der Noten
symbolisiert 1)57.
Ein Beispiel aus der Karte, um auch sie heranzuziehen: Das
Kennzeichen für „Kirche oder Kapelle im Gelände” ist isoliert, wie
es im Lexikon steht, für Christen leicht verständlich und geht feldfremd
in die Karte ein. Denn die zwei Kreuzbalken haben nichts
zu tun mit Nord-Süd und Ost-West und den geographischen Strecken
der Karte. Dies Zeichen liegt zwar auf dem Kartenblatt und nimmt
dort einen Raum ein, bleibt aber frei von Feldwerten bis auf die
Ortsmarke am Fuß des Kreuzzeichens, dem Punkt, der natürlich
aus den Feld werten bestimmt wird. Mit anderen Worten: nur die
Positionsangabe, nicht aber die Angabe „Kirche” ist eine Angelegenheit
der Feldwerte. Die Zeichenform Kreuz ist unter den Küstenlinien,
Flußläufen und allem, was sonst noch an derartigen abbildenden
Formen vorkommen mag, ein Fremdling. Ähnlich im
Prinzip ist im Felde der grammatischen (syntaktischen) Bestimmtheiten
dasjenige, was das (Stoff-)Wort an ‚Bedeutung’ aus dem
Lexikon mitbringt, ein „Fremdling”. Doch (ich muß den Leser
um Geduld bitten) so weit sind wir noch lange nicht.
3. Wo die Trennung der Feldwerte von feldfremden Bedeutungsmomenten
eines Zeichens derart glatt durchzuführen ist,
wie an den ausgesuchten Vergleichsbeispielen, da greift, wer den
Symbolbegriff definieren will, zu und gewinnt eine klare Begriffsgleichung
für das Adjektivum symbolisch. Symbolisch ist am Notenzeichen
die Bedeutung der isolierten Notenform, symbolisch ist das
Kreuzzeichen im Kartenfeld. Beides in Abhebung von den Feldwerten
an denselben Zeichen und in Relation zu diesem Felde
hier, wo es steht. Was symbolisch sei, kann jeweils nur in Relation
zum Felde bestimmt werden. Man beachte z. B., daß die Kreuzform
auf einem Malerbilde durchaus nicht symbolisch in unserem
Sinn sein muß, sondern ein Bild sein kann, das Bild eines Kreuzes
im Gelände; dann steht dieselbe Kreuzform ganz anders im Kontext
der übrigen Formen, wie sie auf dem Kartenblatt liegt. Wenn weiterhin
die Wage in der Hand und die Binde vor den Augen einer gemalten
Justitia wie üblich „symbolische” Attribute genannt werden,
so ist das nichts als eine Wiederholung desselben Definitionsmotivs
184auf höherer Stufe. Gewiß, die genannten sinnlichen Dinge sind gemalt
und fallen nicht aus dem Darstellungsfelde des Malers heraus,
sie liegen nicht feldfremd in ihr wie die besprochene Kreuzform in
der geographischen Karte. Aber es mag sein, daß sie aus dem Reigen
der anderen „Attribute”, die ein Maler seinen Gegenständen zu
verleihen pflegt, herausfallen wie Fremdlinge. Und das nennt dann
einer, der es theoretisch beschreiben will, symbolisch. Die Stärke,
Entschlossenheit, Schönheit der Göttin des Rechtes sind anders
wiedergegeben als wie das Attribut der Gerechtigkeit. Damit ist, wie
mir scheint, im Rahmen der Sematologie ein Ansatz gefunden zu
einer ordentlichen Definition des Symbolbegriffs. Nicht mehr; die
logischen Fragen zum Symbolbegriff sind damit bei weitem noch
nicht erschöpft. Wir wollen eine von ihnen, die den Sprachtheoretiker
am meisten interessiert, sofort erörtern.
Der Symbolbegriff der Wissenschaften hat eine lange Vergangenheit und doch
keine ordentlich thematische Geschichte. Die Bedeutungsentwicklung dieses Wortes
schon innerhalb des Griechischen läßt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen.
Es wurde wahrscheinlich zu verschiedenen Bedeutungen von συμβάλλειν bzw.
συμβάλλεσϑαι ein σύμβολον (auch συμβολή) mit entsprechend etwas verschiedenen
Bedeutungen gebildet. So ordnet auch der Thesaurus Linguae Graecae diese
ein. Die ein wenig differenten Bedeutungen beeinflußten sich wohl gegenseitig
nivellierend und man gelangte schließlich zur Bedeutung ‚Zeichen schlechthin’.
Das Etymon des Wortes war so verflüchtigt, daß nachträglich Verschiedenes von
verschiedenen Denkern hineingelegt und drum herum gedacht werden konnte.
Soweit war ich, als mir die sorgfältige Arbeit von Walter Müri über die
antike Bedeutungsgeschichte des Wortes in die Hand kam 1)58. Auch Müri sondert die
zwei frühen Äste im Entwicklungsstammbaum des Wortes in a) ούμβολον Zusammenfügsel,
dinglicher Ausweis (zur Erkennung des Gastfreundes), Legitimation; b) συμβολαί
Rechtshilfevertrag unter griechischen Staaten. Das zweite Etymon ist: Zusammenkunftsort,
Treffpunkt, conventio. — Sematologisch ist daran bemerkenswert, daß
die Linie a) zum Begriff Anzeichen (Erkennungszeichen, Symptom, Indizium) führt,
während die Linie b) den Vereinbarungscharakter unterstreicht. Ein Staatsvertrag
als solcher ist weit entfernt davon, zu den schlichten Zeichendingen zu gehören;
unterstreicht man aber das Moment der Konvention, dann wird der Übergang verständlich
und es sind hier nicht die Anzeichen, sondern die Ordnungszeichen, welche
ihrer Entstehung nach in Reih und Glied mit dem Staatsvertrag stehen.
Wenn Aristoteles die menschliche Sprache unter das Symbolische zählt
(de interpr. cap. 1), so vereinigt er eigenartig beide Richtungen der Bedeutungsentwicklung.
Denn seine Erläuterung lautet, die Sprache sei Zeichen für seelische
Vorgänge und die seelischen Vorgänge Abbilder der Dinge, die Sprache also indirekt
auch Zeichen für die Dinge. Dies Merkmal einer ‚indirekten’ Repräsentation dürfte
richtig getroffen sein; nur ist die Frage, ob die Relation V ‖ D nicht viel zu primitiv
charakterisiert ist durch das Parallelenzeichen; ich erläutere die aristotelische Auffassung
185schematisch so: L ⇄ V ‖ D (Laut, Vorstellung, Ding). In der Geschichte
der Sprachtheorie und der Logik waren durch Aristoteles jene zwei Betrachtungsweisen,
welche wir als die subjektivistische und objektivistische Analyse auseinanderhalten,
vereinigt. Es ist die (freilich zu einfache) antike Abbildungsidee des Erkennens,
welche eine derartige Vereinigung ermöglicht. Fällt mit der Konstruktion
der species sensibiles und intelligibiles die Entsprechung V j| D, dann geht der
synchytische aristotelische Symbolgebriff aus den Fugen. Die englische Logik hielt
sich von Hobbes an in der Bahn einer Symptombetrachtung und war eine subjektivistische
Sprachtheorie, bis J. St. Mill (ebenso einseitig) wieder die platonische,
d. h. objektivistische Analyse bevorzugte. Der Versuch einer Wiedervereinigung
muß heute, wie mir scheint, den Weg über die von den Scholastikern begonnene
und von Husserl ausgebaute Aktlehre gehen.
Aus der modernen Geschichte des Symbolbegriffes sei das Folgende notiert:
Jedenfalls liebten die Romantiker und hätschelten den Symbolbegriff in einer
Bedeutungsfülle, die dem bedeutungsschwangeren „Bild und Gleichnis” ganz nahe
steht, während die Logiker (berufsmäßig möchte man sagen) für Abmagerung und
Formalisierung des Begriffs-Inhaltes eintraten. Derart, daß am Ende nichts übrig
blieb als die beliebige verabredete Zuordnung von irgend etwas als Zeichen zu irgend
etwas als dem Bezeichneten.
Man braucht diesen zwei leicht nachfühlbaren Definitionsmotiven eigentlich
nur noch ein Wort über den weiten Anwendungskreis des Begriffes beizufügen, um
das, was uns aus der Geschichte des Symbolbegriffes angeht, beisammen zu haben.
Gibt es außer den symbolisch genannten „Zeichen”, die einen Darstellungswert
haben, nicht auch symbolische Handlungen allenthalben und sind nicht auch
einmalig vorhandene Dinge wie die Insignien der Könige (die Stephanskrone und
der Reichsapfel) „Symbole”, sei es der Herrscherrechte und Herrscherwürde selbst
oder sei es ihrer Verleihung und ihres Besitzes genannt worden? Natürlich ist dem
so, und die Liste der Anwendungsfälle ist damit noch keineswegs erschöpft. Erheiternd
fast wirkt die Beobachtung, die man dabei machen kann, daß die Geschmacksverschiedenheit
von Nichtromantikern und Romantikern auch auf diesen
Gebieten zum Vorschein kommt. Denn eine Handlung, dem realen Zweckgetriebe
entrückt, von grob physischem Erfolge abgeschnitten, gilt dem einen als symbolisch,
weil sie eben nicht mehr effektvoll, sondern „nur noch symbolische” Geste ist,
während ein anderer dieselbe Handlung symbolisch nennt, weil sie nach ihrer Erlösung
aus dem niederen (z. B. animalischen) Zweckverbande eine höhere menschliche
Funktion übernommen hat und nun gleichnishaft dasteht oder weil die Rechtsgültigkeit
eines Aktes oder andere Gewichte gerade an ihrem „Symbolcharakter”
hängen.
Es wäre reine Kraftvergeudung, wollte man eine Apologie für das eine oder
andere Definitionsmotiv schreiben. Romantiker und Nichtromantiker wird es immer
geben; sie müssen in der Wissenschaft nur versuchen, sich gegenseitig zu verstehen.
Die Konzession von zwei Symbolbegriffen ist, wie mir scheint, vorerst nicht aufzuheben
und zurückzuziehen. Gelänge es, dann käme derselbe Mentalitätsunterschied
anderswo und an anderem doch wieder zum Vorschein. Der Verfasser dieses
Buches bekennt sich als Sprachtheoretiker zur Partei der Nichtromantiker und wird
deshalb z. B. das lautmalende Verfahren in der Sprache nicht als „Lautsymbolik”,
sondern als „Lautabbildung” bezeichnen.
Unbefriedigend ist die Angabe der Logiker, die Symbolisierung
beruhe auf einer willkürlichen Zuordnung. Denn das Merkmal
186‚willkürlich’ gehört wie das Merkmal ‚zufällig’ zu den negierenden
Bestimmungen. Wenn statt dessen die Erkenntnis durchdringt,
daß alle Symbole eines Feldes und jedes Feld der Symbole bedarf,
um brauchbare Darstellungen zu erreichen, so ist, wie mir scheint,
schon viel gewonnen. Die zwei genannten Momente sind dann
prinzipiell als korrelative Faktoren erkannt und werden auch korrelativ
definiert werden müssen. Daß das symbolische Moment der
Notenzeichen feldfremd ist, wurde gezeigt. Es gilt aber, sofort die
positive Angabe hinzuzufügen, daß diese feldfremden Zeichen offen
sein müssen für Feldwerte, die ihnen verliehen werden sollen; sie
müssen feldfähig sein. Ich könnte selbstverständlich die lexikalischen
Einheiten der Notenschrift nicht in die geographische Karte und
die geographischen Symbole nicht auf mein Notenblatt verpflanzen,
um sie dort mit Feldwerten auszustatten. Das Notensymbol ist nicht
feldfähig im Kartenfeld, weil es kein geographisches Gebilde symbolisiert,
das einen Ortswert erhalten kann. Diese triviale Einsicht
wird wichtig bei dem Versuch, den Wortbegriff zu definieren; denn
ein Merkmal des Wortbegriffes ist die (syntaktische) ‚Feldfähigkeit’
der Lautzeichen, die wir als Wörter bezeichnen.
Es sei zum Schluß noch einmal hervorgehoben, daß wir all
die nicht-sprachlichen Darstellungsgeräte nur als Analysatoren der
sprachlichen heranziehen und nicht im entferntesten daran denken,
sie selbst hinreichend analytisch zu behandeln. Es wäre z. B. eine
ganz andere Aufgabe, anzugeben, wie anders, als es die historisch
gewordene Notenschrift tut, man sonst noch Musikstücke darstellen
könnte, wenn man es darauf abgesehen hätte, etwas Neues vorzuschlagen.
Was man mit Lauten machen könnte, aber nicht macht,
davon berichtet unsere Analyse der lautmalenden Sprache. Doch
sollte, wie mich dünkt, in unserer schlichten Beschreibung ein Impuls
gesehen und gefunden werden, die Analyse der Darstellungsgeräte
des Menschen um einige Schritte über das hinaus, was seither
vorliegt, zu fördern. Daß das möglich ist, glaube ich einzusehen;
wie es zu geschehen hätte, weiß ich noch nicht. Die Tatsachen
der sprachlichen Darstellung geben, wie wir weiter zeigen wollen,
Probleme auf, die von den Mathematikern überhaupt noch nicht
gesehen worden sind.
4. Es erweist sich eine Klärung des logischen Verhältnisses
von Bild zu Symbol als notwendig und gehört zum Dringendsten,
was die Logik für die Analyse der Sprache zu leisten und bereitzustellen
hat. Die meisten Sprachtheoretiker verwenden, wie wir,
bedenkenlos das Kompositum Sprach-Symbole in Opposition zum
187Begriff der bildhaften Darstellung. Wir stehen noch einmal vor der
Frage Lessings im Laokoon, ob die Sprache bildhaft darstellt, und
schlagen, bevor in späteren Paragraphen das Detail besprochen ist,
folgende allgemeine Überlegungen dazu vor.
Ausgangsbeispiele für „Bilder” sind jedenfalls das Photogramm
und das Gemälde, Ausgangsbeispiele für Darstellungen, die mit
Symbolen operieren, sind z. B. das Notenblatt der Musiker und die
Darstellung eines Fieberverlaufes durch eine Fieberkurve. Wir
könnten leicht beweisen, daß es allerhand Übergänge und Zwischenformen
gibt und stellen uns eine lineare Ordnung der Darstellungsarten
vor, die vom höchst denkbaren Grade der Bildhaftigkeit bis
zur reinsten Symbolik (im nichtromantischen Sinn des Wortes)
geht. Die sprachliche Darstellung wird dann, vom Grenzfall der
reinen Bildhaftigkeit weit abgerückt, dem anderen Grenzfall nahe
oder jedenfalls näher stehen. Um die Sache kurz zu machen: es
ergibt sich, daß weder der eine noch der andere Grenzfall praktisch
realisierbar und brauchbar wäre, sondern daß alle bekannten Darstellungsmittel
in wechselnder Dominanz das Abbildungsmoment
gepaart mit dem Moment der „willkürlichen” (leeren) Zuordnung
verwenden.
Vielleicht von den meisten Lesern dieses Buches am wenigsten erwartet ist,
was in dieser Hinsicht von der Photographie gesagt werden muß. Doch sei dies
vorerst zurückgestellt, weil einige Detailkenntnisse dazu gehören, um deutlich zu
sehen, worauf es ankommt bei der Verifizierung unseres Satzes am Photogramm.
Nicht darauf nämlich, daß das gewöhnliche Photogramm die farbenbunte Welt
nur in eindimensionaler Differenzierung wiedergibt, daß es Grau in Grau malt und
dabei sogar die ganze Ausdehnung der Grauwerte der Dinge auf eine kürzere Strecke
von Grauwerten auf dem abtönbaren Papier reduziert auf dem Kopierblatt nämlich,
das weder so schwarz wie der photographierte Sammet noch so weiß wie der
photographierte frischgefallene Schnee werden kann. Das alles ist noch nicht, was
ich meine und später angeben will. Doch lassen wir vorerst die Photographie beiseite
und betrachten die körperlich darstellende Statue, an der das, worauf es ankommt,
ebenso zwingend und viel einfacher zu erkennen ist.
Was die Statue angeht, so wäre eine absolute Treue der Wiedergabe
schon aus materialtechnischen Gründen nicht zu erreichen.
Selbst mit Wachs und echten Haaren ist die Erscheinung des lebenden
menschlichen Körpers nicht restlos erscheinungstreu wiederzugeben.
Ja, man muß die Forderungen nur einmal auf die Spitze
treiben, um einzusehen, daß und warum der Grenzwert absoluter
Treue überhaupt kein Darstellungsideal sein kann, weder für den
‚frei’ schaffenden Künstler noch für einen auf höchst erreichbare
Treue abzielenden Porträtisten. Es ist so, daß der ganze Sinn, d. h.
der Zweck des Verfahrens, aliquid pro aliquo zu setzen und zu
188nehmen, (etwas als darstellenden Vertreter von etwas anderem)
entscheidend gefährdet wird, wenn man zu nahe an den Grenzwert
herankommt. Man stellt ebenso aus guten Gründen nicht die
physische Person Hindenburg oder denjenigen deutschen Staatsbürger,
welcher ihm anthropologisch und psychologisch am ähnlichsten
ist, auf die Bühne, um den Heros schauspielerisch wiedergeben
zu lassen. Dies sei, obwohl es psychologisch einsichtig gemacht
werden kann, hier nur nebenbei und ohne nähere Begründung gesagt.
Es gibt also, das sei als Lehre mitgenommen, Gradabstufungen
der Erscheinungstreue und unter ihnen durch das Material und sonstwie
bestimmte unerreichbare oder darstellerisch ungünstige
Grenzwerte, die nicht erstrebt werden. Aber eine für unseren Zweck
noch viel wichtigere Erkenntnis muß gewonnen werden, nämlich
die, daß es im Bereich der ‚Treue’ nicht nur die zunächst besprochene
Materialtreue, sondern noch etwas anderes gibt, was wir Relationstreue
nennen wollen. Die Sprache, so werden wir sehen, legt
ihrer ganzen Struktur nach den Akzent auf eine bestimmte Art und
Weise nicht der materialtreuen (oder: erscheinungstreuen), wohl
aber (durch Zwischenkonstruktionen hindurch) der relationstreuen
Wiedergabe.
Was ist Relationstreue? Ich stelle eine Vorfrage; enthält die
richtig aufgenommene Fieberkurve, enthält die Notenschrift Abbildungsmomente
in sich oder nicht? Vielleicht wird mancher
zögern, mit einem ‚ja’ zu antworten, weil die Materialtreue dort und
hier, wenn man so sagen darf, von Null nicht sehr verschieden ist 1)59.
Allein das darf der Analyse letztes Wort nicht sein. Denn es ist
ebenso sicher, daß sowohl bei der Notenschrift wie bei der Fieberkurve
ein bestimmter Grad von „Relationstreue” der Wiedergabe
besteht. Das Notenzeichen steht höher und tiefer in der diskreten
Skala der Fünferlinie entsprechend dem Höher und Tiefer des symbolisierten
Tones in der Skala der diskreten Tonleiter. Die markierten
Hauptpunkte meiner Fieberkurve, von denen je einer nach
jeder Thermometerablesung eingetragen wurde, stehen höher und
tiefer auf dem Papier entsprechend dem Höher und Tiefer der Quecksilbersäule
des Thermometers und fortschreitend weiter nach rechts
mit den kalendarisch fortschreitenden Ablesungsterminen. Es gilt
189für Notenschrift und Kurvenpunkte gemeinsam die Konvention:
je „höher” das Zeichen, desto „höher” das Symbolisierte, und je
weiter nach rechts, desto später in der Zeitordnung der symbolisierten
Reihenglieder. Und das ist es, was wir die Relationstreue einer
Darstellung nennen und was Physiker und Techniker heute ganz
unbefangen auch zu den „Abbildungen” rechnen.
Eine Rechtfertigung dieser Sprechweise ist einfach genug:
Abbildung heißt hier nichts anderes als „die Wiedergabe durch
Feldwerte”. Daneben aber ist ein engerer Bildbegriff im Gebrauch,
der anschauliche Gleichheit des Bildes mit dem Abgebildeten oder
(wie man auch sagen kann) erscheinungstreue Wiedergabe vom Bilde
verlangt; in Stufen und Graden natürlich, die nicht ausgeschlossen
werden müssen.
Nachdem dies erläutert ist, sei das versprochene Wort über das Photogramm
hinzugefügt. Man schreibt ihm sprichwörtlich einen bestimmten Höchstgrad von
Treue zu, die photographische Treue, und wir sind weit davon entfernt, dem Sprichwort
seinen Maßstab entreißen zu wollen. Allein auch im Photogramm noch ist ein
bestimmter Spielraum von Untreue und Willkür angelegt und wird ausgenützt.
Man lasse von vornherein jeden Gedanken an die Formenwiedergabe beiseite und
denke an nichts als die Grauwerte (Albedowerte) der Dinge auf der einen und an
die Grauwerte des Papiers auf der anderen Seite. Wenn man dasselbe unter denselben
Umständen mit zwei Platten verschiedener „Sorte” aufgenommen hat, oder
selbst dann noch, wenn man es von derselben Platte auf verschiedenes Papier kopiert,
zeigt sich, daß die Skalen der beiden Bilder nicht übereinstimmen. Man erhält
z. B. einen Abzug, ein erstes Bild, das in der Nähe des Schwarzpols mehr unterscheidbare
Abstufungen von Grauwerten hat und ein zweites Bild, das in der Nähe
des Weißpols mehr Stufen aufweist. Man kann durch besonders harte Platten
Graudetails auf dem Bilde sichtbar werden lassen, die das Auge am Gegenstande
nicht unterscheiden kann, und umgekehrt. Wir haben also verschiedene Treppen
und an ihnen wird das Willkürliche, die innere Untreue des Photogramms manifest,
die man nur streckenweise ausgleichen kann.
Nun, ein rasch weiterdenkender Sprachforscher kann kommen und sagen:
‚aha! Das ist das Analogon zu dem, was man seit W. von Humboldt die Verschiedenheit
der Sprachen nach ihrer inneren Sprachform nennt’. Wir werden ihm nicht
ins Wort fallen, sondern ruhig zugeben, es sei die sorteneigene Treppe in der Tat alles,
was man von einer lichtempfindlichen Platte an sympathisierender Ähnlichkeit
mit der Sprache verlangen kann. Trotz allem aber bleiben beide Bilder, die sie
liefern, relationstreue Abbildungen des Aufgenommenen in dem Sinne, den wir
fixiert haben: Wo immer auf dem Bild eine zweite Stelle weißer ist als die erste, da
sind auch die Albedowerte der Objektstellen in demselben Sinn (wenn auch nicht
um denselben Treppenschritt) verschieden 1)60.
5. Doch Schluß mit dem Aufsuchen des überall Wiederkehrenden.
Der übergreifende Vergleich darf nicht in Gleichseherei
190ausarten; die Betrachtung ist nun reif für eine mitvorgesehene
Peripetie. Wie ist es bestellt um die Treue sprachlicher Darstellungen?
Es ist relativ leicht nachzuweisen, daß Spuren einer erscheinungstreuen
Wiedergabe des Wahrnehmbaren vorkommen, daß aber
weitergehende Erscheinungstreue durch das Strukturgesetz der
Sprache ausgeschlossen bleibt. Dies ist das Thema des nächsten
Paragraphen. Zusätzliche Einschränkungen lassen sich spezieller
in Sachen einer vermuteten Relationstreue formulieren, indem
man die manifesten Feldmomente direkt mit den sprachlich erfaßten
Gegenständen und Sachverhalten konfrontiert. Relevant
ist z. B. in manchen Sprachen das manifeste Moment der Reihenfolge
oder allgemeiner: die Platzordnung der Wörter im Satze.
Allein nirgendwo ist die Rede davon, daß mit Hilfe dieser Platzordnung
der Wörter im Satze eine anschauliche Ordnung der sprachlich
erfaßten Dinge und Ereignisse wiedergegeben, relationstreu
abgebildet würde. Man findet da und dort die Wortfolge oder Satzfolge
„stilistisch” geschickt und wirkungsvoll ereignismalend eingesetzt
wie in dem bekannten „veni, vidi, vici” und den übrigen
Musterbeispielen, die später in einem etwas anderen Zusammenhang
durchgesprochen werden. Aber gerade die dort unterstrichene
Erkenntnis, daß ein eigener vorgegebener Rahmen erforderlich ist,
um in solchen Fällen das Nacheinander der Sprachzeichen zur
Wiedergabe einer Ereignisfolge auszunützen, bewiese, wenn es nötig
wäre, unsere Behauptung. Nein, die menschliche Sprache malt nicht,
weder wie der Maler noch wie der Film malt, sie „malt” nicht einmal
wie das Notenblatt der Musiker.
Und trotzdem muß in irgendeinem Sinne auch in ihren Wiedergaben
Treue möglich sein. Denn ohne Treue gibt es überhaupt
keine „Darstellung”, die diesen Namen verdient. Mir kommt es
vor, als seien einige bedeutende Sprachtheoretiker der Gegenwart
(darunter Cassirer) in ihrer wohlbegründeten Stellungnahme
gegen die antiken und mittelalterlichen Auffassungen von der
‚Abbildungsfunktion’ der Sprache zu weit gegangen und in Gefahr,
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wenn ich beliebige Sätze
vornehme wie: ‚Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in
der Mitte’; ‚der Kölner Dom hat zwei erst in der Neuzeit ausgebaute
Türme’; so sind durch diese Sätze außersprachlich greifbare Sachverhalte
sprachlich gefaßt und werden dem, der Deutsch versteht,
mit praktisch genügender Eindeutigkeit präsentiert. Die Sprachtheorie
darf sich mitten im Alltag der Verkehrssprache nicht hinter
letzte erkenntnistheoretische Überzeugungen verschanzen und auf
191die schlicht gemeinte Frage nach der Darstellungstreue solcher
Sätze eine philosophische Anwort geben. Denn das wäre ein Mißbrauch,
es wäre eine Metabasis es allo genos, es wäre ein Epistemologismus,
wie er im Buche steht. Goethe und die zwei Propheten,
der Kölner Dom mit seinen Türmen gehören zu den Dingen, die
ein Maler ebensogut auf seine Weise darstellen könnte wie ein
anderer, der sie sprachlich wiedergibt. Und nur im Rahmen derartig
mehrfacher Präsentationsmöglichkeiten ist die Frage nach der
Art und Treue sprachlicher Darstellungen gestellt. Daß keine direkte
Feldabbildungen zwischen den sinnlich manifesten Feldmomenten
und dem Darzustellenden vorliegen, ist gesagt; nicht aber, wie es
mit den indirekten, vermittelten Zuordnungen bestellt ist.
Ich will, bevor wir diese Frage getrennt an die sprachlichen
Symbolwerte und Feldzeichen richten, schematisch von der Psychologie
her einen Hauptfall vermittelter Zuordnung unter dem Stichwort
‚das n-Eck und das Alphabet’ einführen und durchsprechen.
Angenommen, es seien die Ecken eines Vielecks so, wie das
in der Geometrie üblich ist, mit Buchstaben zu versehen. Wie
könnte man dabei verfahren und wie verfährt man wirklich?
Man schreibt im Prinzip völlig willkürlich einen Buchstaben als
Bezeichnung an jede Ecke, um (wie Plato sagt) in bequemer Art
einander sprachlich etwas mitteilen zu können über das „Ding”
und seine Eigenschaften, z. B. über die geometrischen Relationen
in der Figur. Ich wähle ein Sechseck; im Bilde sind zwei Lösungen,
die wir vergleichen können, nebeneinander gestellt; was ist ihr
Unterschied?
I.
image N V X K R Z
II.
image A B C D E F
Die I. Lösung repräsentiert eine möglichst willkürliche Zuordnung
ohne „Abbildung” und ist unzweckmäßig; die II. Lösung
repräsentiert eine eingeschränkt willkürliche Zuordnung mit einem
Ansatz von „Abbildung” und ist darum leistungsfähiger. Man hält
sich im II. Falle bei der Namensverteilung an die allen Beteiligten
wohlbekannte Assoziationsreihe der Buchstaben im Alphabet, man
bildet ab die Eckenreihenfolge auf die Assoziationsfolge der Buchstaben.
Und diese Abbildung bringt außerordentliche Vorteile für
die Besprechung mit sich. Man kann z. B., wenn nur einmal darauf
192hingewiesen ist und alle sich die Sache gemerkt haben (was in II
viel leichter ist als in I), den Gegenstand aus dem Wahrnehmungsbereich
entfernen und doch noch mancherlei sofort an der Assoziationsreihe
allein Kontrollierbares über ihn sagen. So kehren,
um nur ein Minimum herauszuholen, alle Punktnachbarschaften von
A bis F in den Nachbarschaftsverhältnissen der Assoziationsreihe
wieder; ich sage in der Besprechung ‚die Linie CD’ und der Hörer
weiß, daß dies eine der Sechseckseiten ist; ich sage ‚die Linie C E’
und der Hörer weiß, daß ein Eckpunkt übersprungen ist; ich sage
‚A D oder B E’ und der Hörer konstruiert am Phantasiebild eine
Hauptdiagonale usw.
Das Alphabet ist eine Assoziationskette (eine blinde Anordnung)
und sonst nichts; aber jeder hat sie gelernt und verfügt
über sie. Darum sind Abbildungen irgendwelcher Objektserien auf
die Alphabetkette hilfreiche Zuordnungen; wir verwenden sie für
praktische Ordnungszwecke immer wieder. Es wäre ein leichtes,
zu beweisen, daß innerhalb des Systems von Zeichen, aus welchen
eine gesprochene Sprache besteht, sehr viele Assoziationsketten und
Assoziationsgeflechte vorkommen, die, psychologisch gesehen, mit
der Alphabetkette auf einer Stufe stehen und uns bei der großen,
umfassenden Angelegenheit der Ordnung unseres Wissens von den
Dingen und der Vermittlung dieses Wissens an andere ähnliche
Dienste leisten; wir lernen und reproduzieren nicht überall, aber oft
und immer wieder Reihen von Sprachzeichen (Wörter) und behalten
und beherrschen damit in der mannigfachsten Weise Gegenständliches.
Die Alphabetkette fungiert in unserem praktischen Besprechungsbeispiel
als ein Mittler; und ihre Funktion als Mittler
ist die eines Ordners, eines Ordnungs- oder Zuordnungsgerätes. Wir
werden also damit rechnen müssen, in der Sprache ähnliche ‚Mittler’
und ‚Ordner’ aufzufinden; sie heißen Mittler, weil sie dazwischen
geschoben sind, und sie heißen Ordner, weil ihre Leistung vergleichbar
ist mit der Leistung dinglicher Ordnungsgeräte, wie dem Briefordner,
den Katalogen u. dgl. m. Nur darf man wieder nicht zu
voreilig die sprachlichen Mittler und Ordner in jeder Hinsicht den
dinglichen gleichstellen.
Wichtig ist für unseren Gedankengang, ein zweites Beispiel
daneben zu halten und von dem ersten abzuheben. Ich wähle als
Modell die ebenso einfache wie leistungsfähige räumliche Anordnung
der geschriebenen Zahlzeichen, der Ziffern in unserem dekadischen
Darstellungssystem. Wenn ich eine bestimmte Zahl durch den
Ziffernkomplex 3824 (so, wie er hier auf dem Papier steht) symbolisiere,
193dann gehört dazu die Konvention, daß die Zeichen von rechts
nach links das Gewicht von Einern, Zehnern, Hundertern usw.
haben sollen. Das muß sich natürlich jedes Schulkind einmal einprägen,
wozu auch Assoziationen nötig sind. Allein, wenn es geschehen
ist, dann werden Struktur einstehlen möglich und beim
Umgehen mit den Ziffern verwertbar, die keiner blinden Assoziationskette
als solcher zu entlocken sind. Die Stellenfolge von
rechts nach links ist die Platzfolge einer einfachen (anschaulichen)
Ordnung und der Wertsprung der Ziffern ist bei jedem Schritt
relativ derselbe (das Zehnfache). Hier ist also eine konstruierbare
Ordnung auf die andere konstruierbare Ordnung (und zwar
ohne Mittler) abgebildet. Und daraus entspringen für jeden
„Rechner”, der die Verhältnisse in irgendeinem praktisch ausreichenden
Maße durchschaut und das Verfahren technisch beherrscht,
unvergleichlich höhere Vorteile wie aus irgendeiner Zuordnung,
sei es der Glieder zweier blinder Assoziationsketten oder
aber der Glieder einer Ordnungsreihe zu den Gliedern einer blinden
Assoziationskette.
Wir hatten bis hieher nichts als die Ziffern, d. h. die optischen
Symbole der Zahlen im Auge; beachten wir im Vorbeigehen noch
die akustischen Zahlzeichen. Die Zahlennamen als solche von eins
bis zwölf sind genau wie das Alphabet eine blinde Assoziationskette;
darüber hinaus aber sind, abgesehen von einigen Inseln, die
Namen größerer Zahlen sprachlich zusammengesetzt und konstruierbar
aus der blinden Einerkette und wenigen Zusatzmodifikationen,
die systematisch gebildet werden. Parallel im großen und ganzen zu
der völlig durchsichtigen und äußerst einfachen optischen Darstellung
der Zahlen im dekadischen System. Was hier vorliegt, ist ein einfaches
Modell der viel komplizierteren Verhältnisse in anderen Bereichen
der Namengebung und in der Syntax menschlicher Sprachen.
Denn es ist die Konvention darin enthalten, daß ich alle zu zählenden
Mengen aufteile auf Gruppen von Tausendern, Hundertern, Zehnern;
für die letzteren habe ich im Deutschen das Formans zig in vierzig,
fünfzig usw. Das ist im Bereich der Zahlennamen das Analogon
zu den syntaktischen Mittlern; es gehört im Sinne Humboldts zu
der inneren Sprachform. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht
überall so, daß man auskommt mit einer einzigen oder ganz wenigen
und ausnahmsfrei durchgeführten syntaktischen Konventionen, sondern
es gibt deren gar viele. Aber wie komplex die Dinge auch
liegen mögen, zu guter Letzt muß sich der Kernbestand sprachlicher
Syntax (soweit sie der Darstellungsfunktion der Sprache dient)
194auflösen lassen, teils nach dem Modell der zweckmäßigen n-Ecksbenamsung,
teils analog dem Schema der (optischen) Ziffernsyntax
und teils nach dem Schema der konstruierbaren (akustischen) Zahlennamen.
Wir werden darauf zurückkommen.
Daß vieles konstruierbar und anderes wieder nicht konstruierbar
ist in einer Sprache, gehört zu den trivialsten Tatsachen; die
Schulgrammatiken unterstreichen das einfach Konstruierbare und
rücken es in den Vordergrund. Worauf das nicht oder weniger einfach
Konstruierbare wie ein lästiger Ballast von ‚Ausnahmen’ nachgetragen
werden muß. Eine historische Betrachtung der Dinge ist
danach oft imstande, die isolierten Bildungen als Reste früher
konstruierbarer Systeme zu erkennen; einige von ihnen sind übrig
geblieben und imponieren unter den jüngeren wie Inseln einer versunkenen
reicheren Formenwelt. Oder es ist umgekehrt so, daß
früher eine größere Gleichförmigkeit bestand, die da und dort lokale
Einbußen erfahren hat. Über diesem in groben Zügen und im einzelnen
wohlbekannten Gesamttatbestand aber schwebt das Bedürfnis
des sprachlichen Darstellungsgerätes nach Ordnern, seien
es nun blinde Vermittler wie die Alphabetkette oder seien es
einsichtig aufgebaute wie im Falle der komplexen Zahlennamen
oder der Konjugationsformen eines „regelmäßigen” Verbs im
Griechischen oder Deutschen. Der mediale Charakter dieser Ordnungsgeräte
wird uns an einem einzigen wohlerforschten Beispiel,
am Kasussystem der indogermanischen Sprachen, eingehend beschäftigen.
Das zwischengeschobene Feldgerät der Kasusformen
wird nur dadurch zu einem brauchbaren Ordner, daß das Darzustellende,
die Sachverhalte, welche im Sprachwerk der indogermanischen
Sätze wiedergegeben werden, unter dem Schema einer
(menschlichen oder tierischen) Handlung gedacht und gesehen
werden. Das ist das dominierende Sachverhaltschema der indogermanischen
Sprachen. Wo es gesetzt ist, bildet das Feldgerät der
sogenannten Kasus der inneren Determination den Sachverhalt
feldmäßig ab, es zeichnet ihn nach.
§ 13. Die lautmalende Sprache.
Maltendenzen gibt es nicht nur bei Dichtern, sondern allenthalben
in Sprach werken. Sie sind manchmal harmlose Spielereien
und Arabesken; und wo sie aus der Tiefe kommen, da dürften sie
letzten Endes ein Ausfluß sein des menschlichen Bestrebens, das
Indirekte und Umwegige, was die Sprache mit anderem Kulturgerät
gemeinsam hat, wieder aufzuheben. Der Anschauungshunger und
195die Sehnsucht nach einem direkten Kontakt und Verkehr mit den
Sinnendingen ist eine psychologisch durchaus begreifliche Haltung
des Sprechenden. Der Mensch, welcher lautierend die Welt zu lesen
und zu deuten gelernt hat, sieht sich durch das Zwischengerät
Sprache und dessen Eigengesetze abgedrängt von der unmittelbaren
Fülle dessen, was das Auge zu trinken, das Ohr zu erlauschen, die
Hand zu ‚begreifen’ vermag, und sucht den Weg zurück, sucht zu
einer vollen Erfassung der konkreten Welt zu gelangen unter
Wahrung des Lautierens, soweit es gehen mag. Das ist der schlichte
Motivationsbericht zum Phänomen der sprachlichen Lautmalerei.
Die Sprachtheorie muß erkennen und deutlich machen, wo
und wie ein solches Zurück gelingen kann, ohne daß die Sprache selbst
vernichtet wird. Kein Zweifel: wer die Sprache beiseite schiebt,
kann laütmalen nach Herzenslust; die Frage ist einzig und allein,
ob und wie man es innerhalb der Sprache zu tun vermag. Es gibt
bestimmte Fugen und Spielräume in der Struktur der Sprache, wo
dies geschehen kann; aber das eine kann nicht geschehen, daß diese
zerstreuten, sporadischen Fleckchen, wo Freiheitsgrade bestehen,
durch Fusion zu einem kohärenten Darstellungsfelde werden.
Damit ist in ein einziges Wort gefaßt, was in diesem Abschnitt
bewiesen werden soll. Er gehört systematisch wie ein Zwischenspiel
zwischen das Kapitel vom Zeigfeld und das vom wirklichen Darstellungsfeld,
dem Symbolfeld der Sprache. Denn sein Thema ist
der Nachweis, wie es sein könnte, aber nicht ist in der sprachlichen
Darstellung. Die Sprache wäre nicht, was sie ist, wenn es ein
kohärentes, leistungsfähiges Malfeld in ihr gäbe. Die Sprache ist
aber tolerant genug, an bestimmten Grenzen, wo ihre eigengesetzlichen
Mittel erschöpft sind, das andersartige Malprinzip zuzulassen.
Sonst schiebt das Strukturgesetz der Sprache, wie sie ist, gegen
jeden Versuch ausgiebig zu malen bestimmte Riegel vor. Wir
wollen diese Riegel aufzeigen, schicken aber als Auftakt einen Blick
auf das jüngste Buch von Heinz Werner voraus, wo man in modernem
Gewände den alten Versuch, als Theoretiker die Sprache
anschaulich mit den Dingen direkt zu verbinden, erneuert findet.
In einer originellen Weise, nämlich durch ein Vorspannen des Ausdrucks
vor die Darstellung; ungefähr in demselben Sinne, wie
dies Aristoteles versuchte. So wenigstens kann man das Unternehmen
von Werner verstehen. Ist die Kritik, die wir vorhaben,
durchschlagend, dann bleibt im übrigen unbeanstandet, was Werner
zum Thema „Die Sprache im Dienste eines (im Laboratorium hochgezüchteten)
Ausdruckswillens” zu bieten hat.196
1. Heinz Werner hat in seinem interessanten Buch „Grundfragen
der Sprachphysiognomik” (1932) die großen Stammväter
seiner eigenen Lehre und damit die Hocheinschätzer des Malprinzips
in der Sprache zusammengestellt: es sind einige chinesische
Philosophen und Platon; Platon freilich nur dann (wie wir hinzufügen
wollen), wenn man etwas im Kratylos nicht ganz Abgelehntes
stark unterstreicht. Weiter gehören dazu deutsche Barockdichter
und Sprachdeuter aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die in einem
Artikel von Paul Hankamer bearbeitet sind 1)61, und Jakob Böhme;
dann Herder, Hamann und andere Romantiker bis herunter auf
W. von Humboldt, von dem Werner freilich berichten muß: „es
ist bedauerlich (von mir hervorgehoben), daß Humboldt, wie so
viele seiner Vorgänger und Nachfolger, das Prinzip der geistigschöpferischen
Ausdruckssprache an einer für unsere Problematik
entscheidenden Stelle fallen läßt” (S. 23 Anm.). Nachfolger Humboldts,
die zu der bedauerten Sorte von Denkern gehören, sind fast
alle Linguisten des 19. und 20. Jahrhunderts mit den paar Ausnahmen,
die Werner sorgsam und hilfreich unserer eigenen Betrachtung
ausführlich zitiert. Doch weit vornehmer und gewichtiger
noch in diesem Stammbaum thront als Urvater ‚mie archaische
Logik’, deren „Sprache” Ernst Hoffmann klärend geschildert
hat 2)62. Und dieser sagenhafte Urvater ist, wie mir scheint, ein Wesen,
über dessen Existenz und Einfluß ein Sprachtheoretiker sich ernste
Gedanken machen sollte.
Wie wäre es mit einem indirekten Beweisverfahren der Antithese,
daß er zwar irgendwie existiert haben dürfte, weil er schattenhaft
noch heute geistert nicht nur im Bereiche der Sprachen jener
kulturarmen Rassen, die man die primitiveren zu nennen pflegt,
sondern auch bei uns; daß er aber durchaus nicht der maßgebende
Urzeuger des menschlichen Sprachdenkens schlechthin sein kann.
Warum nicht? Weil erstens er allein und reinen Blutes die Menschen
lebensunfähig gemacht hätte; weil zweitens die Pygmäen
von heute die Erwartung enttäuschen, daß sie unter den Primitiven
eigentlich am meisten und reinsten der „archaischen Logik” verfallen
sein müßten; weil drittens die Menschensprache, wie sie
heute ist, nach einer gut zu stützenden Wahrscheinlichkeitsüberlegung
am Scheidewege, wo links geschrieben stand: „archaische
197Logik und malend zupackendes Darstellen mit Lauten”, rechts
aber: „symbolisierende Sprache”, so wie weiland Herakles den
Weg zur Rechten eingeschlagen hat. Nach unserer Auslegung des
Mythos stand es dem menschlichen Umgehen mit Lauten frei, den
Weg nach links zu wählen; nicht aber wäre es möglich gewesen,
nach einer erheblichen Strecke links den Weg zurückzufinden
und die Spuren der Erstentscheidung derart radikal zu tilgen,
wie es nach dem Zeugnis der rezenten Sprache geschehen sein müßte.
Die Gelegenheiten zu Urentscheidungen sind einmalig, wie jeder
ordentliche Mythos weiß.
Es liegt wohl an dem Thema, daß man dazu verführt wird,
die These, die man vertreten will, in eine Legende einzukleiden.
Das Meritorische an der Sache ist durchaus nüchtern; es gilt mit
brauchbaren Erwägungen zu entscheiden, ob das Fingerspitzengefühl
der Sachverständigen von Humboldt bis heute im Kern
recht behalten wird. Damit muß, wenn man der Sache ordentlich
nahe gekommen ist, auch. Platz geschaffen sein für das, was die
Gegenpartei faktisch gesehen hat. Denn so ist es heute in der
Wissenschaft gewöhnlich nicht mehr, daß ein sieghaftes Dogma die
Lehre der Gegendogmatiker als reinen Irrtum entlarven könnte. Das
Malbedürfnis sprießt in den weiten Fugen, die der andersartige,
malfremde Aufbau der Sprache frei und unbekümmert offen läßt;
es hat sogar, um im Bilde zu bleiben, ein Fleckchen Erde für sich
selbst und last not least fungiert es in eigenartiger Weise im Gebiete
des sprachlichen Ausdrucks, was noch einmal eigens anerkannt
werden soll. Ich glaube, die Befunde von Werner bedürfen nur
einer Platzversetzung aus der Darstellung in die Lehre vom sprachlichen
Ausdruck. Dann kann sogar der Name Physiognomik stehen
bleiben. Wir werden darauf zurückkommen und eine Kritik an
Werner ausgeführt vorlegen. Erst aber bringen wir als Stütze
die eigene Auffassung.
2. Griechische Grammatiker nannten die Erscheinung, um
deren Tragweite im Aufbau der Sprache schon manche Diskussion
geführt worden ist, nicht wie wir Lautmalerei schlechthin, sondern
spezieller Wortmalerei (Onomatopöie), worin vielleicht eine beschränkende
Weisheit enthalten ist. Seien wir weniger maßvoll
und fassen die Aufgabe so weit als möglich. Könnte man mit Stimmlauten
die Welt malend abbilden, wenn es sein müßte? Angenommen,
die menschlichen Stimmittel seien ungefähr so, wie wir sie kennen,
gegeben, und wir hätten zu erwägen, ob und wie mit ihnen die Ansprüche
an ein einigermaßen universelles Darstellungsgerät erfüllt
198werden können. Unter vielem anderen taucht auch die Möglichkeit
auf, daß mit den erzeugten Lauten im wesentlichen gemalt werden
solle. Lessing kam zu dem Ergebnis, es werde im wesentlichen nicht
gemalt, Herder und andere behaupten, es sei einmal gemalt worden
und die wahren Könner der Sprachkunst täten es immer noch. Nun
gut, wir zielen zuerst auf eine Einschätzung der in den Stimmitteln
beschlossenen Malpotenzen ab. Das sieht wie ein ziemlich vages
Unternehmen aus, ist es aber gar nicht; jedenfalls braucht es nicht
ins Vage zu gehen, wenn man sich vornimmt, bei jeder neuaufgedeckten
Möglichkeit die Struktur der Sprache, wie sie nun einmal
ist, vor sich zu haben, um zu entscheiden, ob das Bestehende eine
Ausnützung des allgemein Möglichen gestattet oder nicht. So wird,
was mir vorschwebt, zu einer Art von Abrechnung, in welcher
zum mindesten die Hauptposten mit wünschenswerter Genauigkeit
bestimmbar sind. Wer noch einmal den Mythos aufgreifen will,
weil er derartiges liebt, kann diese Abrechnung auch als eine Liste
der versäumten Gelegenheiten ansehen.
Wie ist es also bestellt mit den malerischen Potenzen der
menschlichen Stimmittel? Laßt uns exemplarisch den akustischen
Tatbestand der Vokalisation und den motorischen Tatbestand
der Artikulation unsere Frage erwägend zusammenhalten. Es
gibt einen erstaunlichen Reichtum von Klangfarben an den Stimmtönen;
denn alle Vokalunterschiede sind, akustisch betrachtet,
Klangfarbenunterschiede. Ein Geigenton klingt geigenhaft, ein
Trompetenton trompetenhaft kraft des den Tönen jedes Instrumentes
eigenen Zusammensetzungscharakters aus Grundton und Obertönen.
Ganz anders bei der menschlichen Sprechstimme, wo dieser
Aufbaucharakter von Vokal zu Vokal wechselt. Wenn ich mit
musikalischen Instrumenten irgend etwas klangfarblich mit dem
Wechsel von i—e—o wie in Ingeborg oder u—a wie in Fruchtsaft
Vergleichbares nachmachen wollte, so ginge dies gar nicht mit einem
von den gebräuchlichen Musikinstrumenten wie Flöte und Geige.
Sondern ich müßte für Ingeborg drei, für Fruchtsaft zwei Instrumente
nacheinander ertönen lassen. Um etwas von ferne mit der
vox humana Vergleichbares künstlich herzustellen, braucht man
etwa den Reichtum einer Orgelklaviatur mit ‚Registern’ oder man
müßte ganz andere als die gebräuchlichen Eintoninstrumente wie
Flöte und Trompete erfinden 1)63, Instrumente, welche wie das Saxophon
199(wenn ich mich nicht täusche) einen ausgiebigeren Wechsel
der Klangfarben bieten.
Man bedenke, was das bedeutet, wenn man die ganze kontinuierliche
Mannigfaltigkeit dieser Klangfarben, wie sie von dem
bekannten Vokaldreieck selbstverständlich nur im Kerne wiedergegeben
wird, in die Rechnung einstellt; die „Alltagswelt” kann an
Klangfarben gewiß nicht sehr viel über den Bereich des mehr oder
minder genau Kopierbaren enthalten. Dazu das Reich der (akustisch
überhaupt noch nicht bewältigten) Begleit-, Initial- und Abschlußgeräusche
der Konsonanten. Auch die musikalischen Instrumente
imprägnieren und umhüllen die Töne, die sie liefern, mit charakteristischen
Geräuschen: die Flöte bläst, die Geige streicht, die Harfe
klingt gezupft, das Klavier klopft, die Trommel knallt. Der menschliche
Stimmapparat aber bläst, zischt, knallt usw. in vielen, außerordentlich
fein dosierbaren Nuancen.
Und das alles in schnellem Wechsel und in geordnetem Verbände
mit der Vokalisation. Darin liegt eben die Sonderleistung
jenes ungemein labilen und wendigen Einstellungsmechanismus,
den man unter „Artikulation” zu verstehen pflegt, beschlossen.
Ob jede derartige wendige Lautierung auch das Phänomen der
Silbengliederung aufweisen müßte, mag füglich dahingestellt bleiben.
Wer neben dem Sprechen auch an das Singen denkt, wird
die im Lautrohmaterial selbst gelegenen Syllabierungstendenzen
nicht unsachlich stark und für alles gültig annehmen. So war schon
dem (nach meinem Empfinden) feinsten Kenner der Silbe unter
den Phonetikern, war es Sievers wohlbekannt, daß man die Sprechsilbe
von einem Dauerminimum an, das nicht viel weniger als
0,1 Sekunden betragen mag, zeitlich beliebig dehnen kann, soweit
eben der Atem reicht. Das heißt wirklich beliebig dehnen kann
man dabei natürlich nur das Dehnbare, die Dauerlaute. Und man
darf (das ist der Kern der Sieversschen Silbentheorie) zwar einsinnige
Änderungen in allen Dimensionen des Klangphänomens eintreten
lassen, aber keine Wendepunkte im Verlaufe dieser Änderungen.
Jede bemerkte Richtungswendung im Verlaufe der Intensitätsoder
Höhen- oder Klangfarbenkurve wird in der Auffassung des
Hörers zum Motiv eines Silbenschnittes; genau so im Prinzip wie
das robustere Abschneiden des Klangstromes durch Verschlußlaute
200oder wie die Intervention bestimmter nicht-abschneidender Geräusche.
Phonetisch ausgedrückt: genau so, wie die konsonantischen
Wendepunkte Silbenschnitte markieren. Ein zentraler Gedanke
in der Sieversschen Silbenlehre ist mit einem Worte gesagt: Die
akustische Wendepunktstheorie der Silbe; wir werden am systematischen
Ort darauf zurückkommen.
Noch etwas ist wichtig für die richtige Einschätzung der
malerischen Potenzen menschlicher Stimmittel. Ich will es kurz die
weitgehend unabhängige Variabilität des Klangstromes in all seinen
Dimensionen nennen. Man kann eine Vokalstärke unabhängig
von der Höhe und der Klangfarbe variieren, d. h. man kann alle
diese Momente weitgehend beliebig wählen und ihre Änderung im
Klangverlaufe unabhängig voneinander vollziehen. Warum z. B.
die Stimme nicht gleichzeitig steigen und stärker oder schwächer
und außerdem noch vokalisch heller oder dunkler werden lassen?
Das letztere hieße, daß man z. B. von u nach i, von o nach e oder
umgekehrt variiere; ebenso ginge es von u nach a oder von i nach a
hin oder umgekehrt. Natürlich kann das jeder von uns in gewissen
Grenzen, die ja für alles in der Welt gelten; und das öffnet dem
Kopieren Horizonte von Möglichkeiten. Dem hier in Frage stehenden
‚Kopieren’ genau so wie dem Ausdruck, welcher der eigentliche
und durchaus legitime Nutznießer vieler Variationsmöglichkeiten,
die phonematisch irrelevant bleiben, geworden ist. Daß und wie man
diesen Vokalstrom in Begleitgeräusche hüllen und wie man andere
Geräusche wenigstens sukzessive weitgehend beliebig einmischen
kann in den Klangstrom, sei ohne nähere Erläuterung einfach
als ein der Phonetik wohlbekanntes Faktum gebucht.
Was wäre mit all dem an Malerei nicht möglich gewesen?
Die Welt, in der wir leben, hat ebenso ein akustisches wie ein optisches
Antlitz. Geräusche und Töne umhallen uns; sie sind für ungezählte
Ereignisse und Dinge, die uns interessieren, charakteristisch
und fungieren diakritisch. Wir brauchen unsere Augen nicht aus
dem Fenster zu stecken, sondern vernehmen durch das Ohr, was
sich auf der Straße und in den Nachbarzimmern an Alltäglichem
abspielt. Wenn unter den Sachverständigen eine Abstimmung
stattfände darüber, wer reicher ausgestattet sei mit Malmitteln:
der Farbmaler oder ein Stimmaler, so gäbe ich unbedenklich dem
zweiten meine Stimme. Und würde nach allem schon Gesagten
noch ausführen, daß die Silbengliederung als solche ein ganz eigenartiges
Malverfahren ermöglichen müßte, das (wenn der Name nicht
schon vergeben wäre) ‚Tonfilm’ heißen sollte. Nicht, weil etwas
201Optisches hinzukommt, sondern weil kleine Tonbilder sukzessive
darin abrollten. Nicht Sprachsilben natürlich, sondern echte Lautbildchen,
Miniaturaufnahmen der tönenden Welt; es unterliegt für
mich keinem Zweifel, daß ein darin Geübter komplexe Geschehnisse
ebenso systematisch abfahren und malend wiedergeben könnte,
wie heute einer, der geübt ist, einen optischen Film zu „drehen”.
Darum soll man sich auch gar nicht über das wundern, was uns da
und dort einmal auf der Varietebühne Akrobaten in solchen Dingen
vorführen. Und noch etwas: wenn überhaupt malende Musik gemacht
werden muß (am gescheitesten allerdings ohne weitgehende
Ansprüche auf Musikalität als solche), dann bitte setzt euch nicht
erst ans Klavier. Denn jeder Stimmakrobat auf der Bühne und
manche ganz modern-amerikanischen Gesangsvirtuosen können das
alles viel besser ohne Saiten- und Blasinstrumente, sondern einfach
mit ihrem Brustkorb als Blasebalg, ihrem Kehlkopf und Ansatzrohr.
Hier sieht man, was an Malpotenzen in unseren Stimmitteln faktisch
enthalten ist.
3. Fragen wir einmal ganz naiv: Warum, wenn die Dinge so
stehen, ist noch nie ein Linguist auf die Idee verfallen, eine Sprachlehre
von daher, aufzubauen? Das hätte ein Buch werden müssen,
worin die Regeln des lautmalenden Verfahrens als das erste und
wichtigste, was man lernen muß, um eine Sprache zu verstehen
und zu sprechen, allem anderen vorausgingen. Man braucht diese
Frage nur zu erheben, um sofort von jedem Sachverständigen die
richtige Antwort zu erhalten, daß in der Sprache ein ganz anderes
als das lautmalerische Strukturgesetz in erster Linie gültig ist.
Angenommen irgendein Sprechender beabsichtigt etwas relativ so
Einfaches wie das Ganggeräusch von Pferden oder die Geräusche
einer anfahrenden Lokomotive stimmlich zu schildern. So ist und
bleibt ihm unbenommen, dabei auf die Verwendung der Sprache
überhaupt zu verzichten; und dann wird er mitunter verblüffenden
Erfolg haben. Fängt er aber an, regelrecht zu sprechen, so kann im
Prinzip nichts anderes dabei herauskommen, als was uns Dichter
aller Völker von Homer bis Schiller und Richard Wagner bei dieser
oder jener Gelegenheit geboten haben:
Und hohl und hohler hört man's heulen…
Es wallet und siedet und brauset und zischt…
Das heißt: es entstehen wohlgeformte Wörter, Wortfolgen, Sätze,
die allem anderen voraus dem Bildungs- und Kompositionsgesetz
der Sprache unterstehen. Und darüber hinaus erst weisen sie so
etwas wie den sekundären Hauch eines Lautgemäldes auf. Das kann
202eine einzige Malkomposition oder ein Lautfilm (in dem von uns ins
Auge gefaßten ungebräuchlichen Sinn des Wortes) d. h. eine Serie von
Lautbildchen sein. Die Dichter haben da und dort einmal in einigen
Versen solche kurze Lautfilme gedreht, und es ist ihnen gelungen, im
Bereiche des Sprachlichen zu bleiben, weil sie nur bestimmte Fugen
und Freiheitsgrade, die das eigentliche Kompositionsgesetz der
Sprache nicht tangieren, ausnützten. Ich will ihre Kunstfertigkeit
nicht in Frage stellen; aber Hand aufs Herz! Was wäre das
Sturm- oder Brandungsgebrause in Schillerschen Versen für ein
armseliges Nachmachen im Vergleich zu dem, was ein Kopier virtuose
hervorbringt? Ich spreche im Irrealis und fahre fort: Wenn Schiller
keinen anderen Ehrgeiz gehabt hätte, als auf gleich und gleich mit
solchen Kopiermeistern in Konkurrenz zu kommen.
Faktisch war und blieb er Sprachkünstler und gab nur einen
Hauch oder Anklang stofflichen Hörens in seine sprachlich-anschauliche
Schilderung hinein. Auseinandergelegt und schärfer gefaßt,
was damit angedeutet ist, ergeben sich einige wichtige Grenzbedingungen,
in welche alles Lautmalerische eingeschlossen bleibt:
Wo immer die Sprache als Darstellungsmittel benutzt wird, kann
man nur „trotzdem” malen und soweit es erstens die Syntax der
Sprache zuläßt. Es gibt am Tore zur lautmalenden Sprache einen
Syntax-Riegel, der leichter oder schwerer zu umgehen ist. Wenn in
einer Sprache z. B. die Wortfolge im Satze weitgehend syntaktisch
relevant ist wie im modernen Französischen oder Englischen, dann
sind dadurch dem Aufbau einheitlicher Lautgemälde von vornherein
engere Grenzen gezogen als etwa im Griechischen, Lateinischen oder
auch noch im Deutschen.
Sind die Ansprüche der Satzbildung befriedigt, so bleiben
Wortwahl und Wortbildung als kleinere Freiheitsgebiete, worin
sich Maltendenzen auswirken können. Die alten Grammatiker
waren auf dem rechten Weg, wenn sie statt des weiteren deutschen
Kompositums Lautmalen das engere des Namen-malens als Stichwort
für das ganze Verfahren eingeführt haben. Allein auch dabei gibt
es noch einmal neue Beschränkungen. Der einzelne Sprecher kann
das Lexikon nicht beliebig malend erweitern; es wird immer die
Frage sein, ob er im Lexikon vorfindet, was er braucht, oder ob
das Ganze der Sprache diese und jene Neubildung, die ihm gelegen
wäre, gestattet oder nicht. Wir notieren also ohne weitere Diskussion
als zweite Grenzbedingung des Lautmalens, daß der Wortschatz
einer Sprache geschickt ausgeschöpft aber nicht wesentlich durch
Neubildungen erweitert werden kann. Wie es mit der Ausschöpfung
203des Wortschatzes und wie mit seinen historisch verfolgbaren
Veränderungen im Hinblick auf das malende Verfahren
bestellt sein mag, sind vorerst offene Fragen. Geräuschnamen sind
offenkundig mehr oder minder erscheinungstreue Lautbildchen;
wieviel des Vergleichbaren vom Anbeginn in anderen Wörtern
stecken mag oder hineingeraten ist im Lauf der Wortgeschichte,
wird eigens und einzeln zu prüfen sein.
Weiter: eine dritte Grenze wird sichtbar, wenn man den Tatbestand
der Phonologie ins Auge faßt. Ich wiederhole: Die Lautmaterie
einer Sprache ist ungeheuer reich an Malpotenzen. Doch
wenn es wahr ist, was die Phonologen sagen, daß jede Sprache nur
ein ausgewähltes System von Lautzeichen (Phonemen) benützt,
was folgt daraus? Es ist außerordentlich klärend, wenn man sich die
Mühe nimmt, eine detaillierte und systematische Antwort auf diese
Frage zu finden. Eine solche Antwort muß mehreres enthalten:
die Angabe von Freiheitsgraden und von neuen Verschließungen
zugleich. Denn so ist es, um programmgemäß mit dem letzteren,
mit dem malerisch prohibitiven Moment im Tatbestand der Phonologie
zu beginnen, daß das Malbedürfnis zunächst einmal vom
Wortganzen weg auf noch kleinere Entfaltungsspielräume verwiesen
wird. Es wird regelrecht verzettelt auf die Einzellaute und mag sich
in deren phonologisch irrelevanten Variationsbereichen ausleben.
Nur darf es sie nicht ohne weiteres überschreiten.
4. Um rasch zu einer exemplarischen Verdeutlichung dessen,
was ich im Auge habe, zu gelangen, ist es zweckmäßig, direkt auf
die Befunde Werners und anderer, die in unseren Tagen das Gewicht
des Malerischen in der Sprache wieder höher einschätzen als es
seither üblich war, einzugehen. Die Versuchspersonen Werners holen
z. B. an dem Wortklang Seife Zug für Zug heraus, was nach ihrer
Auffassung den Gegenstand ‚Seife’ malend charakterisiert. Bestimmte
Eigenschaften des Dinges wie das Schlüpfrige, Schaumige u. dgl. m.
sollen getroffen sein durch was? Die Protokolle, wie sie schwarz
auf weiß im Buche stehen, können gar nicht anders als Laut für
Laut das Wort abwandern, um jeweils zu sagen, es liege etwas von
der malenden Schilderung des Gesamtcharakters in dem S, etwas
in dem ei, etwas in dem f. Daß man so vorgeht, ist kein Zufall,
sondern im Hinblick auf den Tatbestand der Phonologie zu erwarten.
Denn jedes Phonem (Lautzeichen) läßt einen Spielraum der Realisierung
offen und in diesen Spielräumen können Malpointen angebracht,
herausgearbeitet werden; die Dauergeräusche in S und F
können überlaut und überlang herausgearbeitet werden, von einem
204Sprecher; das ei kann meinethalben schaummalerisch moduliert
werden. Darum das Zug-für-Zug-Verfahren jener Beschreibung.
Alles nachträgliche theoretische Wettern gegen einen gefürchteten
„Atomismus”, den man doch vermeiden wolle und vermeiden
müsse, hebt das Faktum nicht auf, daß die genannten Diakritika
des Wortes in der genannten Reihenfolge herauskommen und zunächst
einmal vor Verwechslung geschützt sein müssen, wenn
unverwechselt ‚dieses’ deutsche Wort vom Sprecher produziert
und vom Hörer aufgenommen werden soll. Malend hineinlegen durch
pointiertes Aussprechen kann man nur soviel, als es die Erstansprüche
der Diakrise gestatten. Gesetzt das a klinge schaumiger
als das e, so kann ein Sprecher Werners den ohnehin im Deutschen
nach ai klingenden Diphthong noch a-haltiger als gewöhnlich herauspräparieren.
Gesetzt weiter ein au klinge noch schaumiger (kommt
es doch im deutschen Wort ‚Schaum’ vor), was dann? Da erhebt
sich der Phonem-Riegel, von dem wir sprechen. Denn ein Saufe
statt Seife müßte mit einem Schlag zu bedenklichem Vorbeitreffen
an dem genannten Dinge führen. Und genau so jeder andere ‚Phonem-Sprung’.
Dagegen innerhalb befriedigter Ansprüche der Diakrise,
das muß anerkannt werden, mag der Sprecher die Lautmaterie
modeln wie er will und kann, um dem sinnlichen Dingcharakter
malend auf den Leib zu rücken. So oder so, d. h. nach den von
Sprechsituation zu Sprechsituation wechselnden Malbedürfnissen
der Sprecher, welche das deutsche Wort Seife in den Mund nehmen,
wozu später noch ein Wort zu sagen ist.
Offen aber bleibt wieder eine Frage, nämlich die gar nicht
unwichtige Frage, wieweit la langue, die Wortschöpfung und die
Wortgeschichte des deutschen Wortes ‚Seife’ schon ein derartiges
Verfahren vorgesehen oder nicht vorgesehen habe. Die von den
Versuchspersonen Werners protokollarisch niedergelegten Beobachtungen,
sind prima vista Aussagen im Gebiete von la parole
und nicht im Gebiete von la langue.
Das Ergebnis unserer Überlegungen lautet also: wie die
Sprache nun einmal ist, so schiebt die Respektierung des Anspruches,
den jedes Wort erhebt, daß es phonematisch genügend scharf geprägt
und dadurch von ähnlich klingenden abgehoben sein will,
jedem ungebändigten Malbedürfnis einen letzten Riegel vor, den
Phonem-Riegel. Die Lautmale am Wort, die Phoneme, müssen
mit genügender Schärfe und in der richtigen Reihenfolge realisiert
werden; jedes Phonem aber läßt der Realisierung einen Spielraum
offen, und in diesen Spielräumen mag die Lautmateric malend gemodelt
205werden. Vollkommen frei ist diese Behandlung der Lautmaterie
nur in jenen Dimensionen, die in der gegebenen Sprache
von vornherein phonologisch unbesetzt, irrelevant sind. Wenn eine
Sprache, z. B. Intonationsdifferenzen nicht als Diakritika im Aufbau
ihres Volkalsystems verwendet, dann mag der Stimmaler hier eingreifen
und melodisch frei wiedergeben, was immer ihm beliebt.
Der deutsche Stimmaler kann jeden Vokal während seines Verlaufes
hinauftreiben oder herabgleiten lassen der Tonhöhe nach. Das birgt
keine Verwechslungsgefahren. In einigen südslavischen und in
anderen Intonationssprachen dagegen heißt es auf der Hut sein,
daß man mit solchen Malgelüsten nicht unversehens (kurz und analogisch
ausgedrückt) aus der Seife in die Saufe gerate. Die großen
melodischen Züge der Satzmelodie und Wortmelodie dürften, wenn
ich recht vermute, auch in ‚Tonsprachen’ phonologisch weitgehend
frei sein und nur die Einzelvokale in ihrem Verlauf den spanischen
Stiefel tragen. Nun dann, so mag ein Malbedürftiger auch in jenen
Sprachen wortmelodisch und satzmelodisch das Genannte und Dargestellte
klingen lassen. Ich weiß natürlich nicht, ob das bei Dichtern
tatsächlich vorkommt; es wäre interessant zu erfahren, ob
in Tonsprachen das Lautmalerische anders beschaffen ist, wie bei uns.
Man müßte, um den melodischen Reichtum, der an einem einzigen Vokalphonem
eines einzigen Wortes manifest werden kann, objektiv zu fixieren, z. B.
englische Wörter wie ‚yes’ und ‚no’ (in: yes sir, no sir) oder ‚bad’ (its to bad) einmal
umsichtig aus der Alltagssprache auflesen und kurvenmäßig darstellen. Der Amerikaner
läßt mitunter seine ganze Seele in einem solchen Vokal ausklingen.
5. Es dürfte an der Zeit sein, daß wir die Sache von der anderen
Seite her betrachten. Bleibt entschieden, daß das einzig direkte Darstellungsfeld
der Sprache, das Malfeld, so gut wie belanglos ist, dann
erst sollen und können die Phänomene, welche mit Fug und Recht
unter dem Gesichtspunkt des Lautmalens begriffen werden müssen,
sachgemäß behandelt werden. Die Fälle des echtesten und unmittelbarsten
Lautmalens an der Spitze: Das Gebiet der Geräuschnamen
ist unbestritten wohl in allen bekannten Sprachen eine Domäne des
malenden Verfahrens. Wer im deutschen sprachlich schildernd
im Begriff steht, ein Wort wie klappern in seinen Text zu setzen,
kann bei genauerer Vergegenwärtigung des zu schildernden Geräuschs
probierend eine Menge von ähnlichen Geräuschnamen systematisch
abtasten, um die treueste Wiedergabe herauszufinden. Eine Änderung
des malenden Vokales a in e — i — o — u— au — ei usw. oder des
malenden pp in der Mitte in tt — kk — oder bb— dd — gg — oder
des Anfangskonsonanten in fast beliebige andere einfache oder zusammengesetzte
206Anlaute wird nicht immer, aber oft zu gebräuchlichen
anderen Geräuschnamen führen. Wenn nicht, so stünde der
textlich geschickten Einführung eines neugebildeten Geräuschnamens
nicht allzuviel im Wege. Denn wer klappern versteht, wird
bei gutem Willen auch eine Neubildung wie kleppern oder klaggern
oder ruppern verstehen und ohne allzuviel Kopf schütteln hinnehmen.
Auf diesem Gebiet ist man weitgehend tolerant nicht nur
gegen Wilhelm Busch und dessen meist köstlich eingebaute einfache
Spielereien, sondern auch gegen weit dilettantischere Produkte.
Man ist als Leser tolerant, weil man als Sprecher selbst verspürt,
daß hier jedem, der das Zeug hat, für Neubildungen Tür und Tor
geöffnet sind.
Allein ebenso wichtig und beachtenswert ist das Faktum, daß
auf diesem Wege selbst in die saloppeste Umgangssprache keine
phonemfremden Modifikationen der Lautmaterie eingeführt werden.
Viele Geräusche, welche uns alltäglich umschwirren und Beachtung
finden, werden z. B. durch Schnalzlaute am treuesten wiedergegeben;
auch das Heulen des Windes und der Signalsirene wird
leicht von jedermann, der sich darum bemüht, kopiert. Aber die
Aufnahme solcher dem deutschen Phonembestande fremder Momente
in die Geräuschnamen ist, soviel ich weiß, nirgendwo beobachtet
worden. Ich erinnere mich, daß wir als Schulbuben Schnalzlaute
als Sport geübt und in deutsche Wörter wie ‚Schnaps’ eingebaut
haben; das „a” dort schnalzend beginnen zu lassen, geht
nach einiger Übung ganz leicht. Aber nirgends mutet uns, soviel
ich weiß, z. B. Wilhelm Busch derartiges zu. Die Trennung des
Sprachlichen vom Nichtsprachlichen, die dem entgegensteht, ist
bemerkenswert scharf vollzogen und die Produktion neuer Geräuschnamen
hält sich in den Grenzen des Bereiches, der durch den Phonem-Riegel
als sprachlich charakterisiert ist. Dasselbe gilt für die
Aufnahme von „Lautgebärden” unter die Wörter, wodurch Gebilde
wie ächzen, jauchzen, kichern entstehen; es gilt auch für das
Kopieren von Tierschreien und Tierrufen, woraus Verba wie blocken
und wiehern oder Tiernamen wie Kuckuck gebildet sein dürften.
Vom Standpunkt des Stimmalens aus betrachtet, imponieren alle
diese Kopien durchaus nicht wie weitgehend naturalistische (impressionistische),
sondern im Gegenteil wie hochgradig symbolistische
Wiedergaben. Es ist mit ihrer Ähnlichkeit zum Bezeichneten
ungefähr so wie mit derjenigen von Wappentieren und allem,
was sonst in der Heraldik vorkommt, zu den entsprechenden Vorlagen.
Und wenn man den Kuckucksruf in zehn Sprachen mit zehn
207verschiedenen Phonemsystemen malend wiedergibt, entstehen zehn
und nicht ein und dasselbe Lautgemälde.
Trotzdem sieht sich der Systematiker gezwungen, den Rest
von Erscheinungstreue, der auch darin noch enthalten ist, zu unterstreichen
und das bisher Angeführte, d. h. die ganze Gruppe von
Geräuschnamen im weitesten Sinn des Wortes von hier aus begrifflich
zu fassen. In all diesen Geräuschnamen kommt mehr oder
weniger von erscheinungstreuer Wiedergabe zum Vorschein. Im
Gegensatz zu einer dem Umfang nach weit größeren Klasse von
Phänomenen, bei denen es sich der Natur der Sache nach von vornherein
um nicht mehr als um relationstreue Wiedergaben handeln
kann. Wörter wie baumeln, bummeln, schlendern, torkeln, schlottern
oder flimmern, huschen, wimmeln oder kribbeln, krabbeln treten
ebenfalls schildernd ihrem Gegenstand nahe. Doch wird durch sie
nicht Akustisches auf Akustischem abgebildet, sondern Nichtakustisches
auf Akustisches. Das Flimmern z. B. ist ein optisches
Phänomen, in kribbeln handelt es sich um Tasteindrücke. Es sind
Bewegungsarten und dynamische Gestalten, die hier wiedergegeben
werden. Sie gehören nicht zu den spezifischen Sinnesqualitäten,
sondern zu den überspezifischen, d. h. mehreren Sinnesorganen
zugleich verdankten Daten; es sind die αίσδητά κοινά des Aristoteles
und darum nennen wir, was hier vorliegt, auch nicht eine
erscheinungstreue, sondern „nur” eine relationstreue (oder gestalttreue)
Wiedergabe. Jede erscheinungstreue schließt auch ein Mehr
oder Weniger von relationstreuer Wiedergabe ein, aber nicht umgekehrt.
Was wir da sagen, ist nicht neu, es wurde von Wundt
schon vollkommen korrekt erfaßt. Nur stehen bei Wundt noch die
Termini „Schallnachahmungen” und „Lautbilder”. Seitdem ist
viel über Synästhesien gearbeitet worden von den Psychologen;
wer die Übergangserscheinungen zwischen relationstreuer und erscheinungstreuer
Wiedergabe genau verfolgen will, muß diese Befunde
mit zu Rate ziehen.
6. Was lehrt die Sprachgeschichte? Bis vor kurzem war es
so, daß die Einschätzung des Lautmalens nach Gewicht und Ausdehnung
in erheblichem Maße von der Mentalität der Forscherpersönlichkeiten
diktiert zu werden schien. Die Romantiker folgten
Herder, die Klassiker Lessing. Heute sollte es gelingen, die Angelegenheit
in einigen entscheidenden Punkten sachlich zu fördern
und damit einem Urteilsspruch aus der Tiefe des Gemütes zu entziehen.
Und zwar in beiden extrem verschiedenen Fragen zugleich,
die man. gestellt hat und stellen muß, wie es heute ist und wie es
208am Anfang war mit der malenden Sprache. Wer die Sachlage von
dem Punkte aus sieht, wo er sich heute noch selbst als Sprecher
am freiesten als Wortschöpfer versuchen darf, vom Punkte der
Geräuschnamen aus, hat kaum einen Einspruch zu erwarten, wenn
er zunächst einmal der Vermutung Raum gibt, dies Verfahren der
Wortschöpfung sei sehr natürlich und darum wohl uralt. Denn
motivlos wählt, soweit wir wissen, kein menschliches Wesen;
warum sollten die Urwahlen der Sprachschöpfer prinzipiell motivlos
gewesen sein? Und was liegt näher als das Nachmachen irgendwelcher
Art, wenn man Neues mit neuen Stimmreaktionen zu beantworten
und zu charakterisieren Veranlassung hat?
Den Spott der Kritiker der „wauwau Theorien” kann, wer
so denkt, ruhig mit der Frage parieren, ob der andere ihm etwas Gescheiteres
zu sagen vermag. Die allgemeinen Erwägungen, welche
wir bis hierher durchgeführt haben, sprechen nicht gegen diesen
Ansatz als solchen, wohl aber gegen die überaus naive Meinung
einiger antiker und moderner Denker, als habe man damit mehr als
etwas ganz Äußerliches über den „Ursprung der menschlichen
Sprache” angegeben und dürfe sich ohne Nachprüfung darauf verlassen,
daß alle Nennwörter auf diesem Wege entstanden sind. Im
Gegenteil: wenn man die Malpotenzen der menschlichen Stimmittel
zusammenhält mit dem Strukturgesetz der Sprache, wie sie nun
einmal ist, und mit den Riegeln, die diese Struktur einem ausgebauten
Malverfahren vorschiebt, dann erwächst einem weisen Ausspruch
von Lazarus Geiger, den wohl auch heute noch viele
Sprachhistoriker unterschreiben, eine neue Art von Auslegung
und Begründung zu. Geiger stellt im Bereich des Indogermanischen
fest, die Wörter besäßen „erst in ziemlich späten Schichten eine
gewisse Neigung, den Objekten schildernd nahezutreten.”
Gemeint ist damit der umfangreiche Tatbestand, daß „Wörter
wie ‚Rabe, Krähe, Kuckuck, donnern, schwirren’ zwar im Laufe der
Zeit zu Lautnachahmungen geworden sind, daß ihren Wurzeln aber
eine solche Beziehung fern liegt” 1)64. Was folgt daraus? Es ist fast
erheiternd in älteren Diskussionen oft dasselbe Argument von Anhängern
und Gegnern der „Wau-wau-Theorie” vorgebracht zu
hören. Im Anschluß an Geigers Befund wäre leicht ein platonischer
Dialog mit literarisch belegten Gedanken zu füllen, ein Hin und Her,
wo jedes Faktum aufgegriffen und gegensätzlich interpretiert erscheint.
Wenn Geiger z. B. in der jüngeren Sprachgeschichte eine
209Neigung der Wörter findet, den Objekten schildernd nahezutreten,
so wird man ihn fragen, ob denn diese Neigung vom Himmel geflogen
kam oder uralt, aber für uns in vielem nicht mehr erkennbar
sei. Gewiß, so fährt der andere fort, allein du kannst nicht richtig
denken. Denn gerade die Entfremdung beweist mir, was ich beweisen
will. Faktum ist, daß die „Wurzeln”, wie wir sie kennen und
nach den Regeln der sorgfältigsten Rekonstruktion z. B. für das
Urindogermanische annehmen müssen, ihren besten Kennern als
nichtmalend imponieren. Diese Wurzeln selbst werden Entwicklungsprodukte
sein, natürlich; aber was in der Entwicklung hätte sie
entfremden können ihrer uranfänglichen Maltendenz, wenn nicht
dieselben oder ähnliche Riegel wie heute auch damals schon die
freie Entfaltung des Lautmalens versperrten und einschränkten?
Käme alles aufs Malen an, so wäre es nicht wieder verschwunden,
wo es schon da war. Wir brechen ab, weil dies Hin und Her den
Scharfsinn übt, aber die Gegner einander nicht näher bringt. Ich
will statt retrospektiv fortzufahren, einen modernen Linguisten zu
Worte kommen lassen, der den Mut hat, uns vorzudemonstrieren,
wie es ganz am Anfang gewesen ist.
7. Der Indogermanist an der Universität Freiburg in der
Schweiz Wilhelm Oehl sammelt nach eigener Angabe seit 17 Jahren
„aus etwa 1400 lebenden und toten Sprachen aller fünf Weltteile”
Belege für die These: „Ihrem Ursprung nach sind alle Wörter aller
Sprachen entweder Schallwörter oder Lallwörter oder Bildwörter” 1)65.
„Mein Weg zu dieser Erkenntnis war der: ich ging, die Indogermanistik beiseite
lassend, von den Sprachen der Naturvölker aus, seit dem Sommer 1915, und fand
— ganz ungesucht und ungewollt — das Typensystem und die Bedeutungsstammbäume
der Lallwort- und Bildwortschöpfung. Nebenher forschte ich in der bisherigen
sprachwissenschaftlichen Literatur und fand hier vielfach Teilstücke des
Ganzen, das ich besaß; meine Kinder führten mir als unbewußte Versuchspersonen
die Mischtypen praktisch vor. Ich habe nichts erfunden, sondern nur gefunden.
Als ich im Juni 1915 nach gewissen Lautmalereien in den Südseesprachen suchte,
erging es mir wie einst im alten Testamente dem jungen Saul; er zog aus, um seines
Vaters Eselin zu suchen, — und fand ein Königreich” (S. 40).
Das Königreich ist aufgegliedert nicht in drei, wie man nach
dem ersten Zitat vermuten könnte, sondern in zwei sprachschöpferische
Situationen. Die erste liegt in der Kinderstube und liefert
die Lallwörter, welche während der 5000 Jahre, die wir historisch
überblicken, immer wieder neu geschaffen werden; die zweite produktive
Situation im Leben der Erwachsenen liefert die Schallwörter
210und Bildwörter. Auf das Phänomen der Lallwörter haben,
wozu Oehl die Belege wiedergibt, schon die antiken Grammatiker
Festus und Varro und dann immer wieder einzelne Linguisten
hingewiesen:
„La Condamine (1745), der „Mithridates” von Adelung-Vater, Buschmann,
Wackernagel, Diez, Lubbock, Curr, von Gabelentz, Tappolet, Körting,
Kretschmer, Gatschet, Curti, Giesswein, W. Schulze, Wundt, Trombetti,
Meyer-Lübke, Jespersen, Schrader-Nehring, Walde-Pokorny und viele andere,
die sich mehr oder weniger eingehend und verdienstlich mit dem Lallwort befaßt
haben, erkannten die Bedeutungsverzweigung dieser Wortschöpfung nur teilweise,
ihren feineren Typusbau so gut wie gar nicht.” (S. 3.)
Die Sammlung Oehl ist, wenn man einer flüchtigen Schätzung
trauen darf, in der Tat viel reicher, als z.B. die von Buschmann und
die von Koelle (Vokabularien afrikanischer Sprachen), aus welcher
Wundt in seinem Sprachwerk schöpft (I2, 339-f.). Als das entscheidend
Neue seiner eigenen Leistung aber betrachtet Oehl einen
„Bedeutungsstammbaum” und ein Typenschema der Lallwörter
(S. 33f. und 3Öff. der Rektoratsrede). Der Bedeutungsstammbaum
gibt an, auf was (Personen und Dinge) die Lallnamen ausstrahlen über
die kleine Welt der Kinderstube hinaus. Als Erstempfänger von
Lallnamen sind in der Wiegensituation beisammen: Vater, Mutter,
Kind, Mutterbrust, Muttermilch, Mund, Puppe; und es geht um
Ereignisse wie: saugen (säugen), essen, reden, wiegen, schaukeln
liebkosen, kitzeln. Dazwischen laufen zwei Gruppen von Formwörtern
(sie!), nämlich Interjektionen und Demonstrativa. Halten
wir uns an diese primäre Domäne.
Das Typenschema Oehls bietet eine Ordnung der Lautgebilde
selbst: A. einfache wie pa, ap, ma, am, ta, na, ka, la, sa; samt allem,
was man durch den bekannten Vorgang der Reduplikationen daraus
gewinnt; B. Misch typen wie pama, mapa samt allen anderen kombinatorischen
Möglichkeiten.
„Diese beiden Systeme, der Bedeutungsstammbaum und besonders das
Typensystem, am meisten die Mischtypen, erscheinen vielleicht auf den ersten Blick
erstaunlich und unglaubwürdig, ja phantastisch. Ist denn das möglich? Ist das nicht
bloße Buchstabenspielerei? Und wenn das alles wirklich so wäre — soll das der
Sprachforschung von Jahrhunderten entgangen sein? Die Antwort auf diese Zweifel
lautet: Es ist wirklich so” (38).
Das Empfinden des Autors, daß er damit auf Glatteis geraten
ist, bedarf vor Sachverständigen keiner näheren Begründung.
Denn variiert man kombinatorisch auch noch die Vokale, wie dies
faktisch im Lallspiel des Kindes geschieht, so umschließt die Liste
des Oehlschen Typenschemas nicht weniger als ungefähr alles,
211was in irgendeiner Menschensprache an Silben, Silbenpaaren und
Silbentripeln vorkommt. Und damit zerrinnt die Möglichkeit,
vom Lautbestand her die Klasse der Lallwörter als solche kenntlich
zu machen. Oehl selbst hält sich auch gar nicht daran, sondern
arbeitet einige Charakteristika sprachvergleichend heraus. Mir
scheint, daß dabei das Moment der Reduplikation noch stärker
unterstrichen werden mußte; denn kaum etwas anderes ist so auffallend
im Lallspiel des Kindes wie die Wiederkehr (zweimal und
öfter) der gleichen Silbe im exspiratorischen einheitlichen Komplex.
Wir haben in meinem Institut vor kurzem fruchtbare Lallsituationen
des Kinderlebens systematisch untersucht und das Hörbare auf
Schallplatten fixiert; wir werden in absehbarer Zeit imstande sein,
das Ergebnis ihrer exakten Analyse vorzulegen. An unseren Versuchspersonen
(deutschen Kindern) fanden wir z. B. eine vollkommen
eindeutige Akzentverlegung: sie beginnen einheitlich mit
dem Akzent auf der letzten Silbe und legen im Laufe von wenigen
Monaten einheitlich den Akzent vor; auf die erste bei Silbenpaaren
und recht häufig auch auf die erste bei Silbentripeln, welche zahlenmäßig
seltener sind als die üblichen Silbenpaare. Doch das nur im
Vorbeigehen; die Sache mit den Lallwörtern kann und muß vom
Kinde her auf eine exakte Beobachtungsbasis gestellt werden.
Eines ist in Übereinstimmung mit älteren Kinderbeobachtungen
und mit Oehl heute schon zu sagen, nämlich, daß Schallwörter bestimmt
nicht die ersten sind im werdenden Sprachschatz des Kindes.
Besonders reich ist die Sammlung Oehl an Schallwörtern.
Eine erste Übersichtstabelle, die veröffentlicht ist, unterscheidet
nicht weniger als dreißig Gegenstandsbereiche, wo sie regelmäßig
in allen Sprachen vorkommen; das Material der ersten neun Bereiche
wird vorgelegt und durchgesprochen in einer Artikelfolge im
„Anthropos” 1)66. Oehl beginnt mit den Wörtern für ‚husten’ und
ist im neunten Abschnitt erst bis zu denen für ‚keuchen, hauchen,
atmen, schnauben, blasen, pfeifen’ fortgeschritten; in den noch
versprochenen Klassen aber steigt die Liste bis zu den Wörtern für
‚Seele, Geist, Sinn, Verstand’ auf. Nun, daß die ‚Seele’ in der Gesellschaft
des Atmens und der außersprachlichen Atemgeräusche
angetroffen wird, ist nicht besonders überraschend; auch einiges
unter den „Verba dicendi”, wozu nach Oehl die Wörter für ‚schreien,
kreischen, schelten, rufen, singen, prahlen, loben, jammern, sprechen,
reden, plaudern, plappern’ (24. Klasse) gehören, war zu erwarten.
212Warum die natürlichen Schrittgeräusche des Menschen und der
Tiere wie ‚traben (trapp!), Galopp (aus dem Französischen), trippeln,
stapfen’ samt der sekundär lautmalend empfundenen Gruppe
‚Schritt und Tritt’ und ‚trampeln’ nicht (oder noch nicht) vorkommen,
ist unerfindlich. Ebenso vermißt man nach den atmosphärischen
Geräuschen in ‚wehen, Wind’, die Wassergeräusche in ‚plätschern,
plantschen, schwabbeln’. Ich meine, wenn schon durch Umhorchen
ein Inventar gewonnen wird, so müßte man dieses Ordnungsschema
ausschöpfen und auf Vollständigkeit sehen.
Einen guten Einblick in die Werkstatt Oehls gewährt z. B.
das Fazit in § 5 über „Räuspern, Schleim, Spucken, Speichel”,
das also lautet:
„Außer den drei Konsonanten s, p und t, nebst ihren Varianten und in wechselnder
Reihenfolge, tritt nämlich auch viertens die Guttural-Charakteristik als wortbauendes
Element in den Wörtern „Spucken, Speichel, Schleim, Räuspern” auf,
indem zu der zischenden Dental- und zu der blasenden Labial-Charakteristik (für
das sich vollendende Ausspucken) auch noch die Guttural-Charakteristik für das
räuspernde Heraufholen des Schleimes hinzutritt. Ein Wort mit diesen vier lautmalenden
Elementen würde also den ganzen Verlauf des Räusperns und Ausspuckens
nachbilden. Doch scheinen zweifellos viertypige Bildungen dieser Art nicht vorhanden
zu sein. Wohl aber finden sich solche dreitypige, d. h. Guttural + zwei von den
Lauten s, p, t und noch häufiger bloß zweitypige, d. h. Mischtypen aus Guttural
+ s oder p oder t bzw. umgekehrt” (421).
Wir erfahren also, daß im Grunde so gut wie alle Konsonanten
zum Aufbau von Wörtern der genannten Gruppe verwendet werden.
Begreiflich: der Gegenstand selbst, das zu malende Geräusch, ist
akustisch sehr komplex und beschäftigt seiner Entstehung
nach von der Kehle bis zu den Lippen alle Teile des Sprechapparates;
warum sollte nicht die eine Sprache dieses und die andere Sprache
jenes Moment oder jene Phase des Ganzen lautmalend wiedergeben?
Wenn von nachahmenden Schülern in Relation zum individuellen
Meister gesagt wurde; ‚wie er sich räuspert und wie er spuckt, das
habt ihr glücklich abgeguckt’, so wird man auch von den sonst so
strukturverschiedenen Menschensprachen kaum anderes erwarten,
als daß sie lautmalend Verschiedenes unterstreichen in all den dreißig
Klassen Oehls und darüber hinaus. Soweit ist die Sache in Ordnung.
Es entsteht nur unabweisbar die Methodenfrage, ob in einem
Fall, wo alle Konsonantengruppen Malpotenzen haben, vom Lautbild
her etwas anderes als die einförmige Diagnose ‚Schallwort’
gestellt werden kann. Der Schwächepunkt aller Oehlschen Diagnosen
ist immer wieder, was in seiner Auseinandersetzung mit
Steinthal aktuell wird; ich drucke die Stelle ab:213
„Völlig falsch ist, was in dieser Sache Steinthal behauptete: „Der Mangel
der Onomatopöie liegt darin, daß sie ein konstitutives Prinzip bietet, ohne regulativ
zu sein. Sie kann also günstigenfalls von der Etymologie erwiesen werden, aber kann
diese nicht leiten.” Und eine Fußnote dazu lautet: „Ferner muß ich bemerken, daß
alle Versuche, die Onomatopöie aus den uns fernliegenden Sprachen, wie denen der
Neger, Australier usw., zu erweisen, deswegen mißlich ist, weil wir diese Sprachen
nur von heute kennen. Wir dürfen uns nur auf die ältesten Kultursprachen beziehen,
weil nur diese gründlich historisch erforscht sind.” — Das ist Steinthals Antwort
auf die Frage, die er vorher S. 115 aufgeworfen hatte: „Eine wichtige Frage für
die vergleichend historische Grammatik ist: Kann das Prinzip der Onomatopöie
dazu gebraucht werden, lautliche Gleichheit von Wörtern verschiedener Sprachstämme
zu erklären?””
Oehl antwortet so: „Steinthals Fragestellung war gut, aber seine Antwort
war schlecht. Unsere Arbeit soll den schlagenden Beweis liefern, daß die Onomatopöie
usw. sowohl konstitutives Prinzip des glottogönischen Naturprozesses als auch
regulatives, heuristisches Prinzip der etymologischen Forschung ist. Zur Abwehr
der Steinthalschen Skepsis genüge vorläufig folgende Feststellung. Die ‚gründlich
historisch erforschten ältesten Kultursprachen’, auf welche allein sich Steinthal
beziehen will, enthalten eine große Menge verschiedenartiger Schall- und Lallwörter
jeder Zeitstufe. Wir können diese Wörter viele Jahrhunderte, ja Jahrtausende
lang in ihrer lautgesetzlichen Entwicklung genau beobachten: ein großer Teil davon
erliegt ziemlich früh dem lautgesetzlichen Verwitterungsprozesse und verliert so
durch Formwandel, vielfach auch durch Bedeutungswandel seinen ursprünglichen
onomatopöischen Charakter; andererseits aber behält ein großer Teil trotz aller
Lautgesetze (genauer: von ihnen wenig oder gar nicht berührt) den ursprünglichen
onomatopöischen Charakter oft erstaunlich deutlich und durch erstaunlich lange
Zeiträume. Dieser Satz vom Beharrungsvermögen sehr vieler Onomatopöien (und
der Wörter überhaupt!) läßt sich zwar nur auf indogermanischem, semitischem,
ägyptischem, ural-altaischem usw. Gebiete dokumentarisch nachweisen, aber er
muß notwendigerweise für alle Sprachen, auch für die erst gestern entdeckten,
Geltung haben. Wenn wir also in irgendeiner Sprache, sei es im vedischen Altindisch
oder im Hindustani oder in einem neuentdeckten Papuadialekt, ein augenscheinlich
und ohrenfällig lautmalendes Wort finden, so haben wir sofort das Recht,
es als höchstwahrscheinliche Onomatopöie zu behandeln, ohne Rücksicht darauf,
ob diese Onomatopöie erst ein Menschenalter oder schon viele Jahrhunderte in der
betreffenden Sprache lebt. Es ist nebensächlich, ob eine Lautmalerei dreißig oder
dreihundert oder dreitausend Jahre alt ist — wenn sie uns nur erkennbar geblieben
ist! — Soviel vorläufig. Von Einzelheiten und von den möglichen Fehlerquellen
(den „Scheintypen”) handeln wir später” (58ff., die Hervorhebung von mir).
Zugegeben, daß durch die jahrzehntelange Beschäftigung mit
einer so umsichtigen Sammlung das Ohr verfeinert wird; nur wächst
im gleichen Schritt mit der Feinheit des Heraushörens auch die
des Hineinhörens, und der wohlwollendste Kritiker wird bei Oehl
nicht frei von jenem Zweifel, den im Sinne Steinthals vermutlich
jeder Sachverständige verspürt. Wie wäre es mit dem Vorschlag,
die ganze Sammlung noch einmal unter neuen Gesichtspunkten
durchzuarbeiten, um diesem Zweifel zu begegnen? Oehl hat ja
214für eine erhebliche Anzahl seiner 1000 Sprachen soviel Material,
daß er Systemvergleiche machen könnte. Wobei z. B. nicht mehr
wie seither unter Beweis gestellt wird, daß die Guttural-Charakteristik
tausendmal das und das malt in jedem der gedeuteten Wörter.
Nein, man müßte nach meinem Dafürhalten jetzt anders vorgehen;
z. B. für gut abgegrenzte Gegenstandsbereiche, sagen wir für die
Namen der (außersprachlichen) Atemgeräusche des Menschen oder
für die menschlichen und tierischen Schrittgeräusche und Gangarten
die Systeme in jeder Einzelsprache für sich aufstellen. Denn
es wäre interessant zu erfahren, wie solche Gruppen systematisch
geordnet in der Sprache A so und in der Sprache B ein wenig anders
aussehen. Wo die entscheidenden Kriterien einer überschaubaren
Sprachgeschichte fehlen, muß sich ein Theoretiker nach einem zureichenden
Ersatz umsehen. Systemvergleiche und aus ihnen die
Erkenntnis von charakteristischen Maltechniken dort und hier sind
vorerst das einzige greifbare Forschungsziel, das ich mir als Ersatz
der fehlenden Sprachgeschichte vorstellen kann. Von unserer Muttersprache
her ergibt sich z. B. sofort die Frage, ob überall ebenso wie
bei uns gemischt vokalisch - konsonantisch gemalt wird. Die
Vokale unserer Geräuschnamen wie ‚brummen, summen, surren’
gegen ‚klirren, schwirren, bimmeln, schrill’ sind bestimmt nicht
irrelevant; wie ist es in anderen Sprachen und Sprachfamilien?
Gibt es solche, die vorwiegend konsonantisch, und andere, die vorwiegend
vokalisch malen, oder wie ist es sonst? Es genügt in unserem
Zusammenhang, das Ende eines einzigen Ariadnefadens aufgezeigt
zu haben; und wie ein weitgehend unentwirrtes Labyrinth liegt
trotz Oehl auch heute noch das Gesamtgebiet der Schallwörter
vor uns.
Weit eindeutiger sind, wie mir scheint, die Ergebnisse einer
kleinen Spezialarbeit Oehls und alles in seinem System versuch,
was methodisch auf ähnlicher Basis ruht; ich denke an die lehrreiche
Synopsis der Namen für die auffallende Tiergruppe der Schmetterlinge 1)67:
„Die Papilio-Wörter sind Bildwörter, d. h. sie suchen durch gewisse sprachliche
Mittel, durch passende Lautverbindungen eine bestimmte augenfällige, und
zwar nur augenfällige Erscheinung der Tierwelt zu bezeichnen. Man hat längst erkannt,
daß diese Wörter, zumal die bunte Reihe der germanischen Mundartenformen,
eine offenbare Reduplikation enthalten und daß diese Silbenverdoppelung das
regelmäßige Auf- und Niedergehen der Flügel des fliegenden Schmetterlings darstelle”
(76).215
Hier hat Renward Brandstetter in seiner Schrift „Die
Reduplikation in den indianischen, indonesischen und indogermanischen
Sprachen” (1917) vorgearbeitet und nicht weniger als 14 „onomatopoetisch-reduplizierende
Bildungen” aus ganz verschiedenen
Sprachstämmen nachgewiesen. Die Sammlung Oehl erweitert den
Gesichtskreis unvergleichlich und führt zu dem zitierten einheitlichen
Resultat. Außerdem wird überzeugend der Satz belegt:
„Die zahllosen reduplizierten papilio-Wörter waren ursprünglich sinnvoll,
bedeutungsvoll gewesen: die Doppelung gewisser leichter Silben sollte das leichte
Flattern der beiden Schmetterlingsflügel symbolisieren. Aber all diese Formen wie
pepe, pepele, lepepe usw. waren ohne etymologischen Zusammenhang mit der
übrigen Sprache, gleichsam Fremdlinge. Diese ursprüngliche Sonderstellung wurde
nun durch zwei Neuerungen — bald langsam, bald schnell — verwischt: durch das
Wirken der Lautgesetze und durch volksetymologische Umdeutung, vielfach auch
durch beides zusammen. Der zersetzenden, ‚verwitternden’ Wirkung der Lautgesetze
muß jedes Wort erliegen, wenn es lange Zeit in der Sprache lebt, und die
dabei möglichen Veränderungen der Wortgestalt sind ja bekanntlich zahllos” (89).
Man braucht nur hier einzusetzen, um die dem Malprinzip entgegenlaufenden
Strukturgesetze der Sprache in ihrem vollen Gewicht
zu erfassen. Denn das Wort von der ‚verwitternden’ Wirkung der
Lautgesetze ist. natürlich nur ein Bild, es ist der Sachverhalt vom
Ufer der Malhypothese gesehen. Was drüben liegt bei den Anti-Maltendenzen
und die Verwitterungen und Eindeutungen verursacht
oder steuert, ist nicht weniger als die Eigenart der menschlichen
Sprache. Wir haben das Strukturmodell, welches nicht bei
der Malerei zu finden ist, an anderen Darstellungsgeräten des Menschen
gefunden.
§ 14. Die sprachlichen Begriffszeichen.
Wer eine Logik so aufbaut, wie es bei den Engländern seit
Hobbes üblich wurde und am reifsten in dem Werk J. St. Mills
vor uns steht, beginnt mit den Namen, allgemeiner mit den Nennzeichen
der Sprache. Er denkt dabei an die gewachsene Sprache
und sieht sich veranlaßt, den durch besondere Bemühungen geklärten
und schließlich definitorisch fixierten Nennwert der
Sprachzeichen in der Wissenschaft abzuheben von dem vorwissenschaftlichen
Nennwert (Kurswert) der gleichen Wörter. Die Sprachtheorie
soll sich als Zuschauer dieser selektiven Arbeit der Logik
vorkommen und einiges notieren; ihr Horizont und ihr Interesse
wird am Vorwissenschaftlichen z. B. auch das allgemeine Ergebnis
der Etymologie umschließen. Das Etymon gar vieler
Wörter unserer Umgangssprache ist tot; was Wörter wie ‚Pferd’,
216‚Kuh’, ‚Schaf’, ‚Gans’ einst etymisch trafen, weiß heute unter den
neunzig Millionen, die des Deutschen mächtig sind 1)68, vermutlich
nicht einmal jeder Zehntausendste. Und wer es weiß, dem ist und
bleibt dies ein kaltes Wissen, von dem er nicht das mindeste verspürt
in irgendeinem praktischen Verwendungsfall der Wörter;
auch der verwegenste Dichter könnte es nicht mehr zum Klingen
bringen, wenn er sich etwa nach dem Vorbild gewisser Franzosen
in poésie pure ergehen und als Lyriker eine Etymonmusik machen
wollte 2)69. Anders verhält es sich mit Wörtern, deren Etymon noch
in irgendeinem Grade lebendig ist. Aber schieben wir das auf und
sehen zu, was der Kurswert eines deutschen Wortes wie ‚Hebel’
sprachtheoretisch zu lernen gestattet.
Was ein Hebel ist im Sinne der Umgangssprache, weiß mehr
oder minder genau auch ein Schulbub oder Holzknecht einigermaßen
anzugeben, wenn man ihm hilft, sich auszudrücken und sein lebendiges,
aber unformuliertes Wissen an Beispielen zur Geltung zu
bringen. Der Holzknecht wird Strohhalme und Weidenruten kaum
zu den Hebeln rechnen, sondern sich daran klammern, daß mit einem
richtiggehenden Hebel ordentliche (sozusagen übermenschliche)
Lasten wie Baumstämme vom Fleck bewegt und gehoben werden
können. Wozu denn sonst der eigene Name? Ob das Hebelding
aus Holz oder Eisen ist, erscheint ihm vielleicht schon irrelevant.
Dagegen räumt ein Physiker gründlich auf mit dem allzumenschlichen
Nutzungsgedanken und definiert; ‚ein Hebel ist in meiner
Betrachtungsweise jeder um eine feste Achse drehbare starre Körper’.
Damit kann er dann bequem und einfach seine Hebelgesetze
formulieren.
Was einst in der Vorzeit geschah, als die lebenswichtigen Tiere,
Pflanzen und Gebrauchsdinge von sprachschaffenden Wesen nach
hervorstechenden einfachen Kennzeichen ihre ersten Namen erhielten,
ist nicht in jeder Hinsicht unvergleichbar mit der Konvention der
Physiker, sondern bereits in einer Hinsicht das Vorbild dessen, was
diese und andere Wissenschaftler auf höherer Plattform wiederholen.
Vorausgesetzt, daß es so war, wie die Etymologen es sich
vorstellen, wenn sie im Etymon von Wörtern wie ‚Hund, Roß, Kuh’
zuerst nach je einer (sinnlich auffallenden) Sondereigenschaft der
alten Hausgenossen des Menschen fahnden. Auch derartige etymische
217Bedeutungsfixierungen waren einfach; nur daß die Sprachschöpfer
sinnennahe und die Wissenschaften manchmal sehr abstrakte Merkmale
bevorzugen. Nicht zu vergessen natürlich, daß die Wissenschaften
in weitem Umfang Wert darauf legen, protokollarisch und
explizite in ihren Definitionen festzuhalten, woran man gebunden
sein soll.
Auch das noch liegt in ihrer Linie, daß die definierten Begriffe
zu logisch kohärenten Systemen zusammengehen; manchmal kann
man dann in solchen Systemen wie auf Treppen oder Leitern in Abstraktions-
oder Determinationsschritten bequem hinauf- und
hinuntersteigen. Solch ein Wissensgebäude ist innerlich leicht beherrschbar
und menschlich wohl geordnet aufgeführt. Zu all dem
gibt es im sogenannten vorwissenschaftlichen Verband der lautsprachlichen
Nennzeichen bereits Anläufe, die man nicht geringschätzig
abtun sollte. Das mit den ‚Wortstämmen’ z. B. und den
Ableitungen daraus ist rein logisch gewertet schon eine gewaltige
Systemleistung der sprachlichen Ordnungszeichen; und wenn man
das Phänomen der ‚Wortklassen’ wie Nomina, Verba, Präpositionen
usw. im Überschlag hinzunimmt, dann fühlt man sich in den natürlichen
Sprachen, die wir kennen, von dem einen Grenzfall einer
kurz gesagt chaotischen Namengebung schon viel weiter entfernt
als von dem anderen Grenzfall, den sich irgendeine Wissenschaft
als Ideal ihrer Terminologie vorsetzen mag. Doch ist das ein Abschätzungurteil,
auf welches kein besonderer Akzent gelegt werden
soll. Wir beginnen noch einmal von vorne.
1. Es ist nicht uninteressant, den Vergleich des letzten mit
dem ersten, der wissenschaftlichen Begriffsbildung von heute mit
der freilich nur aus gewissen sprachhistorischen Indizien erschließbaren
und im wesentlichen prähistorischen Bedeutungsverleihung
der Nennwörter noch ein wenig weiter zu spinnen. Daß es im großen
und ganzen zuerst anschauliche Dinge, Vorgänge usw. gewesen sind,
die ihre Namen forderten, ist eine gut begründete und bewährte
Annahme der Etymologen. Weiter: Die Sprachschöpfer hielten
das Benannte artmäßig, gruppenmäßig auseinander, und zwar nach
solchen Erkennungs- und Merkzeichen (Diakritika), die einem auf
unmittelbare praktische Nutzung, Bewältigung, Schutz bedachten
Lebewesen von unserer Art in die Augen stechen. Das ist ein alter
Leitgedanke der Wortforschung, welcher durch neuere Vorstellungen
eingeschränkt und ergänzt, aber nicht restlos ersetzt werden kann.
Wohl wahr, daß man sehr früh in der Menschheitsgeschichte die
sogenannte magische Denkweise und Lebenseinstellung hypothetisch
218wird ansetzen müssen; und sie verändert das Bild. Das Nennen der
Dinge mit ihrem ‚wahren’ Namen wird in dieser Geisteshaltung zu
einem mächtigen (hilfreichen oder gefährlichen) Appellmittel des
Sprechers an die Dingwelt selbst. Die Geisteshaltung, von der wir
sprechen, ist nachgewiesen in allen Frühgedanken über die Sprache;
sie kommt, wie besonders Piaget gezeigt hat, auch überall bei
unseren eigenen Kindern auf. Aber man muß sich als Ausdeuter des
gut bezeugten Phänomens vor dem altbekannten Fehler eines proteron
hysteron, eines verkehrten Ansatzes, hüten. Der werdende
Mensch reflektiert, im großen gesehen, nicht vor, sondern nach dem
Schaffen, er reflektiert auch auf die Namen erst, wenn sie da sind.
Und ihre Geburt dürfte der Hauptsache nach so erfolgt sein, wie
es sich der gesunde common sense der erfolgreichen Wortforscher
vorstellte.
Die Berichte z. B. aus dem Munde der intimsten Kenner der Pygmäen von
heute stimmen in diesem Punkte vollkommen überein mit dem, was ein nüchtern
unbefangener Blick in unsere Kinderstuben lehrt. Aus meinem Arbeitskreis soll
in anderem Zusammenhang über das Ergebnis einer umfangreichen Aufnahme sprachlich
produktiver Situationen aus der entscheidenden Entwicklungsphase dreier
Kinder berichtet werden. Das sichtbare Geschehen in diesen Situationen wurde
von bestgeübten Beobachtern protokollarisch festgehalten und das hörbare Geschehen
vom Mikrophon auf Schallplatten eingetragen. Das einigermaßen mühsame, aber
ergebnisreiche Studium dieser wieder und wieder vorführbaren und beliebig vergleichbaren
Aufnahmen bringt viel Neues; angefangen von der Phonetik bis zu dem,
was uns hier interessiert. Die Sprachwerdung, d. h. die Ersterzeugung, das Konstantwerden
der Verwendung von Lautkomplexen als Zeigzeichen und Nennzeichen wird
in einigen Punkten tabellarisch greifbar. Erstaunlich z. B., wie konsequent die to-Deixis
Brugmanns bei allen drei Kindern wirklich von Dentallauten übernommen
wird. Dieselben (nahezu hundert) als wohlgelungen aus der Gesamtzahl ausgelesenen
Platten dokumentieren auch, was oben behauptet wird: Die Geburt der ersten Nennwörter
ist ganz und gar reflektionsfrei und völlig vor-magisch, könnte man sagen.
Die Vorstellungen eines Levy-Bruhl und seiner oft noch viel radikaleren
modernen Anhänger müssen, wie mir scheint, von Grund an revidiert werden. Das
Kind, welches wir kennen, erwirbt sich einen Erstschatz von Nennwörtern vor jedem
Anhauch einer reflektierenden magischen Haltung. Und wenn dieser Anhauch
kommt, so durchweht und färbt er keineswegs alle Lebenssituationen, sondern läßt
neben sich eine zweite Entwicklungslinie frei. Gewiß: in Fällen einer affektiven
Hochspannung und aus anderen Gründen verwandelt sich die Welt dem Kinde ungefähr
so, wie sich die Theoretiker der magischen Geisteshaltung das vorstellen;
allein daneben und dazwischen gibt es durchlaufend und ungebrochen etwas anderes,
nämlich die völlig magie-freie Experimentierhaltung des Kindes, kraft welcher der
Neuling des Lebens Schritt für Schritt und nach Maßgabe sieghafter Erfolge im
‚Umgang mit Material’ (wie wir das heute zu nennen pflegen) zum Lebenstechniker
ausreift. Das Kind wechselt unbekümmert hinüber und herüber aus der einen in die
andere Haltung und legt z. B. das Stückchen Holz, welches eben noch ein weinendes
und beruhigtes Pflegekind ‚war’, seelenruhig im nächsten Augenblick in den Ofen.
219Und nie und nimmer das Pflegekind, sondern nichts als das kommune Holzstück
verbrennt dann lustig vor seinen Augen. Man kann die Umstellungen als solche aus
der einen in die andere Haltung genau studieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß etwas wesentlich anderes bei zuverlässigen
Beobachtungen in Urwäldern herauskommen könnte: primum vivere deinde philosophari.
Um zu leben, muß man in genügendem Ausmaß erfolgreich sammeln,
jagen usw. lernen und sich dabei genau so wie das Kind von Übungsstufe zu Übungsstufe
tragen lassen. Geschieht es kooperativ unter Erfindung und Verwendung von
Nennwörtern, so muß die Angelegenheit der ‚Merkzeichen’ des Genannten ebenso
zunächst einmal in genügender Anpassung an das den Erfolg entscheidende Aussehen
und Verhalten der Dinge erledigt werden. Wer als Theoretiker gegen diese Weisheit
des common sense anlaufen wollte, müßte zuerst den Widerstand der besten Pygmäen-Kenner
der Gegenwart und der besten Kinderpsychologen überwinden und
überdies beweisen, daß er imstande ist, die Idee einer nichts als magischen Lebensordnung
konstruktiv zu Ende zu denken; derart natürlich, daß faktisch lebenstüchtige
Menschen dabei herausgerechnet werden. Denn lebenstüchtig in ihrem Lebensraume
sind die sogenannten Primitiven von heute; und auch unsere Vorfahren müssen es
gewesen sein, sonst hätten sie sich selbst und ihre Nachkommen nicht durchgebracht.
Unsere Formel, es sei einfach am Anfang gewesen bei der
ersten Namengebung und werde oft wieder einfach am Ende bei
den Wissenschaften, läßt Platz für ein Zwischenstadium, in welchem
das Etymon unlebendig, ‚abgeblaßt’ oder tot und eine wieder vereinfachende
Neugestaltung noch nicht da ist. Dieses Zwischenstadium
ist es, was die Denkpsychologen, zu denen ich vor zwei
Jahrzehnten selbst gehörte, zuerst erwischten, als sie auf ihre Weise
an konkreten Verwendungsfällen herausbringen wollten, was der
sprechende und hörende Gebraucher von Sprachzeichen wie ‚Pferd’
usw. meinend und vorstellend präsent hat. Daß das Meinen dabei
getrennt vom (anschaulichen) Vorstellen umschrieben und beschrieben
werden müsse, war eines ihrer allgemeinen Resultate, die geblieben
sind; ein anderes ist aufgehoben in dem Begriff der ‚Sphäre’, wie
ihn mehrere der damals arbeitenden Denkpsychologen gebraucht
und am zweckmäßigsten zuletzt wohl Ch. Bühler zu fassen vorgeschlagen
hat. Es ist in den methodisch einwandfreiesten und zuverlässigsten
Versuchssituationen geschulten Beobachtern immer wieder
aufgefallen, daß häufig überhaupt keine angebbaren (anschaulichen)
Sachvorstellungen da sind; wohl aber ein Bezug (eine Intention) des
Denkenden auf ein Stück oder Moment der in seinem latenten Wissen
vertretenen Welt. Ich selbst sprach in diesem Sinne von ‚Intentionen’,
Akten des meinenden Abzielens, und Ch. Bühler machte
deutlich, daß die Wasbestimmtheit (Poiotes) dessen, worauf der
denkende Sprecher im Einzelfall erlebnismäßig abzielt, sphärenartig
von anderem abgegrenzt ist. Das ‚Pferd’, um bei dem Beispiel zu
bleiben, gehört in meinem Wissensschatze grob gesagt z. B. in die
220Sphäre: ‚Tiere’ oder ‚Haustiere, Nutztiere’. Und solche Sphärenordnungen
machen sich im Erlebnis noch bemerkbar, wo alle konkret
ausgeführten Sachbilder fehlen. Sie fehlen dort und deshalb im Erlebnis
des sprechenden Denkers, wo und weil er sie nicht braucht.
Die Beobachtungen der Denkpsychologen, von denen eben die Rede war, sind
weder unrichtig noch nebensächlich, konnten aber das volle Ausmaß der sprachpsychologischen
Fragen nach den Prozessen im psychophysischen Systeme derer,
welche als Sprecher und Hörer mit Begriffszeichen sachgemäß umgehen, nicht beantworten.
Der Horizont jener Forscher war quoad Methode und theoretischer Umsicht
noch zu eng; er muß, bevor man die Sache wieder aufnimmt, vor allem durch
einen Blick auf das, was man bei Linguisten lernen kann, erweitert werden. Unser
Schlußwort hieß ‚Sphäre’; ich will es aufgreifen, um anzudeuten, wie ich mir das
Geben und Nehmen zwischen Sprachforschern und Psychologen ausgebildet vorstelle.
Im Arabischen und in anderen semitischen Sprachen gibt es ein merkwürdiges
Verfahren der Wortbildung und Wortableitung: die Bedeutungen der arabischen
Wörter, in denen das Konsonantengerüst k t b vorkommt, gehören alle zu der
menschlichen Angelegenheit des Schreibens. Die wechselnde Vokalisation dieses
Konsonantengerüstes bestimmt, an was spezieller gedacht werden muß: Arabisch
kätab = er schrieb, kätib = Schreiber, kitäb = Buch. Ein Arabist, der dies dort
weit verbreitete usuelle Verfahren vor sich hat, erfaßt sofort, daß ihm die deutschen
Denkpsychologen mit ihrer ‚Sphäre’ einen fruchtbaren Ansatz der Analyse geboten
haben. Denn gleichviel wie er selbst nun die Dinge beschreiben will, ob er zuerst von
jenem Konsonantengerüst oder zuerst von der Vokalisation spricht, so wird er sagen:
im Arabischen scheinen bei der Konstitution einer vollen Wortbedeutung wie kitäb
= Buch zwei Momente auf, von denen eines der Gegenstandssphäre, welche die
Denkpsychologen an deutschen Versuchspersonen entdeckt haben, entspricht. Ein
Indogermanist, welcher zugezogen wird, braucht nicht stumm zu bleiben; denn
Wortreihen aus dem modernen Deutsch wie ‚sprich, Sprache, Spruch’ werden gut
zu dem angeschlagenen Thema passen. Und zu guter Letzt ist das Bedürfnis da, ein
Konsilium der Kenner aller Menschensprachen darüber zu befragen, wie es mit den
vergleichbaren Lösungen derselben Aufgabe in anderen Sprachfamilien bestellt ist.
Wenn die Psychologie von dieser Tatsachenbasis ausgeht, gewinnen ihre Untersuchungen
eine weite Perspektive.
Soviel hier über die Beiträge der Denkpsychologie zur Frage nach den Erlebnissen
und der psychologischen Technik des Umgehens mit Begriffen. Das Buch
von Alexander Willwoll bietet mehr darüber 1)70.
2. Logisch gesehen läßt sich das Faktum der angeblich ungeklärten
Begriffe unserer Umgangssprache in verschiedener Weise
erläutern. Das Manifestwerden einer Sphärenordnung unseres
Wissens deutet allgemein darauf hin, daß es in vielen Fällen eines
aktuellen Wortgebrauches genügt, wenn statt des Inhaltes der
Umfang eines Begriffes, d.h. der Verwendungsbereich des Ordnungszeichens
irgendwie abgesteckt ist. Auch an folgendes wird man
erinnert: J. von Kries beschäftigt sich in seiner eigenartigen
„Logik” (1916) mehrfach mit einer Erscheinung, für die er den
221Terminus „synchytische Begriffsbildung” vorschlägt. Bekannt ist,
daß z. B. die Juristen auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, wenn
sie begrifflich exakt und einfach angeben sollen, was ein ‚Haus’,
ein ‚Fahrzeug’, ein ‚Unfall’ im Sinne dieses oder jenes Gesetzes ist.
Der Grund liegt, wie von Kries meint, darin, daß die Gruppen von
Gegenständen, denen diese Namen der Umgangssprache zugeordnet
sind, nach einer nicht genau fixierbaren Ähnlichkeit gebildet werden;
nach einer mehrfachen, d. h. nicht nur von einem einzigen Gesichtspunkt
aus bestimmten Ähnlichkeit. Das Detail der von
Kriesschen Auffassung kann wegbleiben; ich stimme ihm z. B.
nicht bei, wenn er auch die einfachen Farbbegriffe wie ‚rot’ und
‚blau’ zu den synchytischen Begriffen rechnet, sondern glaube, daß
die Heringsche Analyse sachrichtiger ist. Aber bei ‚Haus’ oder
‚Diebstahl’ mag er recht haben.
Das Gesamtgebiet der synchytischen Begriffe wird der Hauptsache
nach zusammenfallen mit dem Gebiet solcher Nennwörter
der Umgangssprache, für welche die folgenden zwei Angaben zutreffen.
Es sind Nennzeichen, die erstens in der Alltagssprache
einen Kurswert haben, der weder von einem noch lebendigen, verspürten
Etymon noch von der Wissenschaft her eindeutig festgelegt
ist. Und es handelt sich zweitens bei ihnen um Gegenstände, die
unserer differenzierten Kultur entsprechend vielgestaltig geworden
sind, aber einen alten Klassennamen weiter tragen. Was ist ein
Buch? Es gibt heute vielerlei, dem dieser Name beigelegt wird,
gedruckte Bücher und Notizbücher und eine ‚Buchung’ im Geschäftsleben,
die auf losen Blättern in Zettelkästen erfolgt. Ich denke mir,
es dürfte einfacher gewesen sein, den Begriffsinhalt des Namens
‚Buch’ anzugeben, als nach der Einführung einer leistungsfähigen
Gebrauchsschrift (Buchstabenschrift) jedes Schriftstück, z. B. auch
ein Brief, Buch hieß, oder noch einfacher, solange es nur Buchenrinden
als Schreibflächen gab. Denn damals war jedes beschriebene
Stück Buchenrinde und sonst nichts ein Buch.
Was ist ein Hund? Im modernen Deutsch ist das Etymon tot;
aber die Zoologie sorgt, wo es nottut, dafür, daß der Klassenname
definiert bleibt (auch der spaßige Grubenhund ändert daran nichts).
Früher, als das Etymon noch lebendig war, konnte einer unserer
Vorfahren sagen: Dies Haustier heißt Hund, weil es uns Beutetiere
fängt. Ich stelle mir vor, daß englisch Sprechende heute noch
ihren ‚hound’ im Hinblick auf die eingeschränkte Bedeutung ‚Jagdhund’
und ‚blood-hound’ ein solches ‚weil’ nachschicken können.
Sicher dann, wenn ihnen auf Besinnen die Verwandtschaft mit
222‚hunt’ (jagen) deutlich wird. Ich selbst finde keine derartigen Hilfen
für mein deutsches Wort Hund. Wenn ich herumprobiere und z. B.
das Adjektivum ‚hündisch’ abtaste, so bleibt das entweder neutral
im Bereiche der vielen mir sachlich bekannten Hundeeigenschaften
oder es nimmt die Tönung eines Schimpfwortes an, ungefähr
so wie die Griechen bestimmte Philosophen kynisch nannten,
vermutlich nach deren betonter (praktischer und theoretischer)
Schamlosigkeit. Nur vom Jagen ist gar nichts zu finden in ‚Hund’
und ‚hündisch’. Kurz das Etymon ist ausgelöscht für mich, weil
das in meiner Sprache isolierte Wort mir keine Vergleichshilfen
bietet. Die Isolierung im Wortschatz wird der Sprachhistoriker
als die häufigste Begleiterscheinung (sei es als Grund oder Folge)
einer Verblassung des Etymons bezeichnen.
3. Nun etwas anderes. Die Scholastiker philosophierten im Geleise
platonisch aristotelischen Denkens vielfach von der Sprache
aus und stellten z. B. an die Nomina die Frage, ob sie mehr und
anderes seien in der Welt als flatus vocis und was an Erkenntnisgehalt
sie dem Benutzer zu bieten haben. Wir schieben als Sprachtheoretiker
alles Metaphysische in den verschiedenen scholastischen
Antworten auf diese Frage beiseite und haben dann aus dem Universalienstreit
immer noch einiges in unserem Untersuchungsgang
Wichtige zu notieren. Der moderne Sprachtheoretiker wird aufmerksam
auf einen Punkt, wo er das scholastische Modell des
sprachlichen Begriffszeichens ergänzen und folgerichtig ausbauen
kann. Wir fangen an zu zeichnen und symbolisieren durch einen
Kreis das flatus vocis Genannte; es ist das sinnlich wahrnehmbare
Phänomen in Sprachzeichen wie ‚Pferd’. Das, worum das Nachdenken
und der Streit ging, das Repräsentatum eines solchen
Repräsentans, sei symbolisiert durch ein Viereck. Die Scholastiker
erfaßten wie jeder Logiker, daß in Reden wie ‚das Pferd ist kein
Wiederkäuer’ kein Konkretum, sondern ein Abstraktum und
Generale vom Wortklang ‚Pferd’ repräsentiert wird; wir deuten es,
weil es dieselben aber weniger Bestimmtheiten wie jedes Konkretum
‚Pferd’ aufweist, durch das kleine eingezeichnete Viereck an. Zugeordnet
ist dem Wortklang entweder überhaupt nur oder in hervorragendem
Sinne oder zum allermindesten auch das kleine Viereck,
die species Pferd als solche:
image223
Einzige Frage: wie wäre es, wenn diese Figur sachgerecht
folgendermaßen ausgeführt werden müßte?
image
So ist es; diese Korrektur hat sich in der empirischen Arbeit
der Sprachforscher als nötig und fruchtbar erwiesen. Es ist die
Phonologie, welche sie fordert. Denn nicht die ganze konkrete
Klangmaterie (flatus vocis), sondern nur ein Inbegriff relevanter
Momente an ihr ist maßgebend für die Nennfunktion des Sprachzeichens.
Es ist ein allgemeiner Satz der Sematologie, daß alle
Dinge oder Vorgänge in der Welt, die wir als Zeichen verwenden,
verwendet werden nach dem Prinzip der abstraktiven Relevanz.
Wenn man z. B. Signallaternen im Schiffsverkehr, Eisenbahndienst,
Straßenverkehr einführt, so gelten etwa die Abmachungen: rot →
Gefahr, Weg gesperrt; grün → keine Gefahr, Weg frei. Selbstverständlich
wird jedes Signalding, das ich dann einsetze, jede Laterne,
ein Konkretum mit unausschöpfbar vielen Bestimmtheiten wie
Gestalt und Größe sein. Aber relevant für den Verkehr und die
Verkehrspartner ist nur das Moment rot oder grün, welches in der
Konvention enthalten ist. Daß dem genau so ist mit den Klangphänomenen
als Namen, ist also nicht auffallend. Wenn ‚dasselbe’
Wort ‚Pferd’ von hundert deutschen Sprechern hervorgebracht
wird, klingt es hundertmal ein wenig anders; ich erkenne an der
differenten Sprechstimme meine Bekannten und oft auch am Wortklang
aus dem Munde eines bekannten oder fremden Sprechers,
wie es ihm zumute ist. Die Sprechklangdifferenzen sind pathognomisch
und physiognomisch signifikant, aber irrelevant für die
Nennfunktion des deutschen Wortes Pferd.
Daraus aber folgt das auch sprachtheoretisch nicht unwichtige
Ergebnis, daß jeder flatus-vocis-Nominalismus durch die Hilfsmittel
einer ordentlichen Sematologie allein und kurzerhand elegant
abgewiesen werden kann. Denn diese flatus-vocis-Antwort auf die
scholastische Frage erfolgt ja so, daß gewisse Denker kopfscheu
werden vor dem auf der rechten Seite unserer Figur verlangten
Eingehen auf Abstrakta und Generalia; sie retten sich, sie halten
sich an das vermeintlich echte Konkretum links. Bis die Phonologie
auftritt mit dem Beweis, daß jene Flüchtlinge vor dem Abstrakten
aus dem Regen in die Traufe geraten sind. Der radikale
Nominalismus ist ganz am Anfang des Universalienstreites aufgetreten
224und dann so gut wie einmütig von der gesamten Scholastik
verworfen worden; heute regt sich da und dort wieder ein
Gelüste nach ihm. Wir wiederholen das Axiom von der Zeichennatur
der Sprache und stellen noch einmal fest, daß jeder Versuch,
eine Sematologie (sagen wir kurz) rein physikalistisch aufzubauen,
ein Versuch mit untauglichen Mitteln ist und schon bei den einfachsten
Tatbeständen des sprachlichen Zeichenverkehrs, wie er sich
zwischen Menschen abspielt, scheitern oder wenigstens ins Stocken
geraten muß.
Eine historische Notiz: Wer das Hin und Her zwischen gewiegten Denkern
in der flatus vocis-These als Schauspiel verfolgen will, schlage H. Gomperz „Weltanschauungslehre”,
2. Bd. auf. Dort findet er auf S. 8i die Epikuräer gegen die
Stoiker und den „ehrwürdigen Upavarsha”, einen indischen Denker, diese auffallende
Lehre vertreten und bis in alle Absurditäten hinein verteidigen. Nur werden dort
noch naiv die ‚Buchstaben’ an Stelle des detaillierten Befundes der modernen Phonetik
und Phonologie aufgerufen. Auf S. n8f. kommt Gomperz noch einmal auf
die Sache zurück und schildert eine moderne Diskussion zwischen J. St. Mill und
Herbert Spencer in derselben Sache. Ich bin Gomperz für den Hinweis darauf
zu Danke verpflichtet; Gomperz selbst verwirft den flatus-vocis-Standpunkt. Neu
an unserer Art des Argumentierens ist nur der Rekurs auf das allgemein sematologische
Prinzip der abstraktiven Relevanz und der Verweis auf das Faktum des
Sprechverkehrs, welcher, wie ich glaube, ohne das Eingehen auf erlebnispsychologische
oder ontologische Fragen eine Entscheidung gestattet.
4. Um auf dem Niveau der modernen Logik die Angelegenheit
der Funktion sprachlicher Begriffszeichen so, wie es in der Sprachtheorie
geschehen muß, weiter zu führen, schlage ich vor, J. St. Mill
und Husserl gleichzeitig zu lesen und das, was sie z. B. über Eigennamen
und ‚Gemeinnamen’ resp. über Eigennamen und Artnamen
sagen, zu vergleichen. Auf diesem Wege erreicht man relativ einfach
das Ziel, welches ein Theoretiker der natürlichen, gewachsenen
Sprache nie aus dem Auge verlieren darf, nämlich den Sachverständigen
der einzelnen Menschensprachen etwas vorzulegen, woran
sie anknüpfen können und umgekehrt: nur das in sein Konzept
aufzunehmen, was aus dem Ergebnis der positiven Sprachwissenschaft
abgelesen ist. Ich beginne mit J. St. Mill.
Im Zentrum der Lehre Mills kommt ein Vergleich vor: es
sei mit den Eigennamen so wie mit dem bekannten Rötelstrich
des Räubers aus Tausendundeine Nacht. Der Räuber will aus
Hunderten von Häusern, die zum Verwechseln ähnlich sind, ein
einziges später wieder herausfinden und bringt zu diesem Zwecke
ein Merkzeichen an, den Rötelstrich. Eigennamen seien, meint
Mill, nicht mehr als Rötelstriche, also Diakritika. Schon dazu
könnte und müßte einer, der auszieht, um Mill zu kritisieren,
225sofort ein Glossarium eröffnen; denn Eigennamen werden in der
Regel nicht wie der Rötelstrich angeheftet und an der Stirne getragen,
damit man sie dort ablese und Johann von Jakob unterscheide.
Eigennamen werden zwar bei der Taufe oder anderen
Gelegenheiten ausgeteilt, aber man verläßt sich darauf, daß die
Objektsdiakrise schon sichergestellt ist und das Nennzeichen post
hoc im Sprechverkehr klaglos fungiert. Es war an einer früheren
Stelle dieses Buches Gelegenheit, über Namen, die man faktisch am
Benannten anheftet, zu berichten; dort wurde die Angelegenheit
des „symphysischen” Umfeldes von Nennzeichen sematologisch
allgemein behandelt. Hier werden wir den Millschen Vergleich nicht
in der Einstellung eines fehlersuchenden Kritikers, sondern loyal
auslegen und dem großen Logiker dahin folgen, wohin er uns führen
will. Wir erfassen mit ihm, daß die einmal ausgeteilten Eigennamen
nicht mehr fragen: bist du, den ich ‚Montblanc’ nenne, auch
wirklich ein weißer Berg? Denn Mill schreibt:
„Wenn wir den Eigennamen von etwas aussagen; wenn wir auf einen Menschen
deutend sagen, dies ist Braun oder Schmid, oder, auf eine Stadt deutend, dies ist
York, so teilen wir damit dem Hörer keine weitere Auskunft, keine Information
mit, als daß dies deren Name ist. Indem wir ihn in den Stand setzen, die einzelnen
Dinge zu identifizieren, können wir sie mit der Auskunft in Verbindung bringen, die
er schon früher von ihnen besaß; indem wir sagen, dies ist York, können wir ihm
sagen, daß es das Münster enthält, dies aber nur kraft dessen, was er früher von
York gehört hat, nicht durch das, was im Namen eingeschlossen liegt. Anders verhält
es sich, wenn man von Gegenständen vermittelst mitbezeichnender Namen spricht.
Wenn wir sagen, die Stadt ist aus Marmor gebaut, so geben wir dem Leser eine möglicherweise
ganz neue Auskunft, und dies einfach durch die Bedeutung des vielwörtigen
mitbezeichnenden Namens „aus Marmor gebaut”. Derartige Namen sind
nicht Zeichen der bloßen Gegenstände, erfunden, weil wir Gelegenheit haben, an die
einzelnen Gegenstände zu denken und von ihnen zu sprechen, sondern Zeichen,
welche ein Attribut begleiten, eine Art Livree, in welche das Attribut alle Gegenstände
kleidet, von denen erkannt ist, daß sie es besitzen. Sie sind nicht bloße Zeichen,
sondern mehr, d. h. bedeutsame Zeichen, und die Mitbezeichnung, die Connotation,
macht ihre Bedeutung aus” (41, die Hervorhebungen von mir).
Der Begriff Konnotation stammt aus scholastischen Gedankengängen
und ist dort auf die Erkenntnis zugeschnitten, die wir aus
Apollonius und von den Stoikern her bereits in unsere Analyse
aufgenommen haben. Die Nennwörter, so hieß es dort, enthalten eine
Wasbestimmung des Genannten; das ist der Sinn des scholastischen
‚notare’. Einige Scholastiker nun erklärten, durch Adjektive
wie albus sei nicht nur die Eigenschaft, das Farbmoment ‚weiß’
notiert, sondern es werde in einem Zug auch ein Träger dieser Eigenschaft
mit — notiert; kein bestimmtes Ding (versteht sich), wohl
aber irgend etwas, dem das Farbmoment zuzusprechen ist. Man könnte
226das modern etwa so ausdrücken, daß eine Leerstelle mitnotiert ist.
Hier griff Mill ein und versuchte, die Analyse fruchtbar zu machen
in der Weise, wie wir es von ihm selbst gehört haben. Rufen wir
die symbolische Strichzeichnung auf S. 224 zu Hilfe, um zu versinnlichen,
worum es geht. Die Figur image (eine kleine Vollform
und eine größere Leerform drum herum), mag jetzt
das scholastische ‚albus’ wiedergeben. Mill überlegt,
ob es Nennwörter gibt, die keine Konnotation bieten, und
findet gleich zwei Gruppen solcher Wörter, nämlich auf der einen
Seite Abtrakta wie die Röte und auf der anderen Seite die Eigennamen.
Bildlich wiedergegeben kann ich mir entweder die Leerform
ganz wegdenken und behalte nichts als die kleine Vollform
übrig image; oder ich kann die große Leerform ganz
ausfüllen, so daß das kleine Viereck in ihr verschwindet image
Hören wir Mill selbst darüber:
„Ein nichtmitbezeichnender Ausdruck ist ein solcher, der nur einen Gegenstand
oder ein Attribut bezeichnet. Ein mitbezeichnender Ausdruck ist ein solcher,
der einen Gegenstand bezeichnet und ein Attribut einschließt. Unter einem Gegenstand
wird hier etwas verstanden, was Attribute besitzt. So sind Johann, London
oder England Namen, welche nur einen Gegenstand bedeuten. Weiße, Länge,
Tugend bedeuten ein Attribut. Keiner dieser Namen ist daher mitbezeichnend.
Aber ‚weiß, lang, tugendhaft’ sind mitbezeichnend. Das Wort weiß bezeichnet alle
weißen Dinge, wie Schnee, Papier, Meeresschaum usw. und schließt ein, oder wie es
die Scholastiker nannten, mitbezeichnet (connotiert) das Attribut Weiße” (35).
Alles übrige kann wegbleiben. Mill beschreibt die Begriffe vom Umfang,
nicht wie wir hier, vom Inhalt her. Deshalb müßten die Symbolwerte des kleinen
und großen Vierecks vertauscht werden, um seine Lehre exakt wiederzugeben; das
ist für unseren Zweck natürlich völlig gleichgültig.
Wenn ich also in einer Rede den Eigennamen ‚Sokrates’ verwende,
dann notiere ich nach Mill durch dies Sprachzeichen das bekannte
image Individuum ohne Konnotation; wenn ich dagegen
sage ‚das Pferd ist kein Wiederkäuer’,
dann findet eine Konnotation statt image
Was sagt die historische Sprachwissenschaft und die Sprachtheorie
dazu 1)71? Es sei gestattet, vorerst alle sematologischen Bedenken
beiseite zu schieben. Wer, wie wir, dem flatus-vocis-Nominalismiis entgegenhält,
227daß die linke Seite des Strukturschemas nie anders als so
image aussehen kann, muß konsequent sein und aufs sorgfältigste
überlegen, ob etwa grundsätzlich dasselbe für
die rechte Seite gültig ist. Rickert als Logiker z. B.
schüttelt in der zweiten Auflage seiner ‚Grenzen der
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung’ bestimmte Rezensenten unwillig
ab. Sie imputierten ihm die Auffassung, der historische Begriff
‚Sokrates’ ergreife das Individuum restfrei. So ist und kann es nicht
sein nach Rickert, einfach deshalb nicht, weil das Individuum mit
all seinen Bestimmtheiten nie in einen Begriff und damit in das
Endergebnis der Wissenschaft eingeht. Daran braucht einer nicht zu
rütteln und könnte doch Mills Lehre von den Eigennamen verteidigen
; und zwar unter Verwertung einer von Husserl gemachten
Unterscheidung, auf die wir später (§ 19) eingehen werden.
Vorerst aber genügt der schlichte Hinweis auf die Einsicht,
daß das, was für alle Begriffe gilt, nicht für alle Namen gelten
muß, wenn gewisse Namen keine (vollwertigen) Begriffszeichen
sind. Überantworten wir diese Frage vorerst dem common sense
der Sprachforscher: Die Welt, in der wir leben, bietet Dinge, die
uns erstens aus irgendwelchen Gründen als Individuen genügend
interessieren, und bei denen wir uns zweitens zutrauen, sie individuell
jederzeit abzuheben von anderen und wiederzuerkennen.
Solchen Dingen geben wir Eigennamen; nicht nur jedem Menschen,
sondern auch Bergen und Flüssen, vielen Tieren, die um uns sind
und manchmal Bäumen und Steinen; nicht zu vergessen die Sterne,
welche Nacht für Nacht am Himmel erscheinen, und historische
Ereignisse, die nur einmal passierten. Ein bestimmter Diamant
heißt Kohinor (die Sachverständigen behaupten, daß sie ihn identifizieren
können) und eine Schlacht heißt die ‚Seeschlacht bei Salamis’,
(die Historiker lehren, sie habe nur einmal stattgefunden).
Was ein Individuum ist und was dafür gehalten werden darf, bereitet
dem Sprachforscher keine schlaflose Nacht. Jede Wissenschaft
wird das auf ihrem Gebiete genauer angeben.
5. Wir schlagen nach Mill Husserl auf. Husserl widmet das
zweite Hauptstück seiner „Logischen Untersuchungen” dem Thema
„die ideale Einheit der Spezies und die neueren Abstraktionstheorien”.
Die Front der Neuerer, gegen welche Husserl sich
wendet, reicht von Locke über Hume und J. St. Mill bis zu G.
E. Müller und Cornelius; auch Meinongs Auffassung in den berühmten
„Humestudien” erscheint dem Kritiker nicht scharf und
radikal genug abgehoben vom psychologischen Nominalismus.
228Husserls eigene Lehre ist eine Akttheorie, welche in mehr als einer
Hinsicht scholastische Gedanken erneuert. Gefragt wird, wie sich
z. B. in der Wahrnehmung, von der man auch nach Husserl ausgehen
kann und ausgehen muß, individuelle und generelle Gegenstände
„konstituieren”, das eine Mal ein Etwas, das ich mit dem
Namens Sokrates versehe, und das andere Mal ein Etwas, das ich
mit dem Namen „der Mensch” im Sinne von Homo sapiens der
Biologen versehe: ‚der Mensch hat dasselbe Gebiß wie andere
Hominiden’. Husserl differenziert:
„Wir auf unserem Standpunkt würden zunächst in der, bisher um der Einfachheit
willen meist bevorzugten, Sphäre der sinnlichen Abstraction unterscheiden:
zwischen den Acten, in denen ein attributives Moment anschaulich „gegeben” ist,
und den darauf gebauten Acten, die statt Acte bloßer Aufmerksamkeit auf dieses
Moment, vielmehr neuartige Acte sind, welche generalisierend die zugehörigen
Species meinen” (161).
„Das Objective des Meinens ist je nachdem (entweder) der universelle Sachverhalt
alle A sind B (oder) der generelle das A (in specie) ist B (oder) der unbestimmt
singuläre irgendein A ist B usw. Weder die individuelle Anschauung, die etwa zur
Fundierung der Evidenz die Denkvorstellungen begleitet, noch die Actcharaktere,
welche die Anschauung formen oder sich in der geformten intuitiv erfüllen, sondern
die im Vollzug der Acte auf solcher Grundlage „einsichtig” gewordenen gedanklichen
Objecte, die gedanklich so und so gefaßten Gegenstände und Sachverhalte
sind das, worauf wir aufmerksam sind. Und natürlich besagt die „Abstraction”,
in der wir statt bloß auf das individuell Anschauliche hinzublicken (es aufmerksam
wahrzunehmen u. dgl.), vielmehr ein Gedankliches, Bedeutungsmäßiges erfassen,
gar nichts Anderes, als daß wir in diesem einsichtigen Vollzug der gedanklichen,
bald so und bald anders geformten Acte leben” (163).
Es sind also nach Husserl verschiedene Akte des Meinens, in
welchen sich, manchmal an ein und demselben Material von Sinnesdaten „das
Objektive des Meinens” konstituiert, so daß es ein Individuum
A oder eine Spezies A oder noch einiges andere ist, was ein
Denkender denkend erfaßt und wovon ein Sprechender spricht.
Fragen der Ontologie über die so erfaßten und besprochenen Gegenstände
bleiben bei Husserl genau so wie in J. St. Mills Lehre von
den Namen ausgeschlossen; der Sprachtheoretiker hat gewiß am
wenigsten ein Interesse daran, solche Fragen einzubeziehen. Der
Unterschied der Husserlschen und Millschen Analyse wird an
seinem Quellpunkt deutlich, wenn man die Einleitungsworte der
Namenlehre Mills noch einmal nachliest. Dort heißt es:
„‚Ein Name’, sagt Hobbes ‚ist ein Wort, das willkürlich als ein Zeichen gewählt
worden ist, welches in unserem Geist einen Gedanken erwecken kann, der
einem früher gehabten Gedanken gleicht, und der, wenn er vor anderen ausgesprochen
wird, ihnen ein Zeichen sein kann, welchen Gedanken der Sprechende vorher in
seinem Geiste hatte.’ [Mill selbst fährt fort:] Diese einfache Definition eines Namens
als eines Wortes (oder einer Reihe von Wörtern), welches dem doppelten Zweck dient,
229uns selbst die Ähnlichkeit früherer Gedanken zurückzurufen, und ein Zeichen zu
sein, sie anderen kundzugeben, scheint untadelhaft. Die Namen tun in der That
viel mehr als dieses; aber was sie auch immer sonst noch tun mögen, so ist es ein aus
diesem hervorgehendes Resultat, wie man am geeigneten Orte sehen wird.
Ist es besser zu sagen, die Namen seien Namen der Dinge, oder sie seien Namen
unserer Ideen von den Dingen? das erstere ist der Ausdruck des gewöhnlichen Sprachgebrauches;
das letztere der Ausdruck einiger Metaphysiker, welche durch dessen
Annahme eine höchst wichtige Unterscheidung zu machen glaubten. Auch der eben
angeführte hervorragende Denker scheint dieser Meinung zu sein. ‚Da die in der
Sprache aneinander gereihten Wörter’, fährt er fort, ‚Zeichen unserer Vorstellungen
sind, so ist es offenbar, daß sie nicht Zeichen der Dinge selbst sind; denn daß der
Laut des Wortes Stein das Zeichen des Steines sein soll, kann nur in dem Sinne verstanden
werden, daß derjenige, welcher es hört, schließt, daß derjenige, welcher es
ausspricht, an einen Stein denkt.’ [Mill:] Wenn hiermit gemeint ist, daß nur
an die Vorstellung und nicht an das Ding selbst durch den Namen erinnert, oder daß
sie dem Hörer mitgeteilt wird, so kann dies natürlich nicht geleugnet werden. Nichtsdestoweniger
sind gute Gründe vorhanden, um bei dem gewöhnlichen Gebrauche zu
bleiben, und das Wort Sonne den Namen der Sonne und nicht den Namen unserer
Idee von der Sonne zu nennen; denn die Namen sollen nicht allein bezwecken, bei
dem Hörer dieselbe Vorstellung zu erwecken, die wir haben, sondern auch ihm mitzutheilen,
was wir glauben. Wenn ich nun aber einen Namen gebrauche, um einen
Glauben auszudrücken, so ist es ein Glaube in Beziehung auf das Ding selbst, und
nicht in Beziehung auf meine Idee von demselben” (26f.).
Wir verweisen noch einmal auf die historisch wichtige Tatsache, daß Aristoteles
in seinem Symbolbegriff beides zu vereinigen strebte (s. oben S. 185f.). Mit
der Überwindung der antiken Lehre von den Species sensibiles und intelligibiles
mußte dieser in der Tat zu einfache Versuch abgelehnt werden. Wir sehen Hobbes
und Mill je einen der beiden damit getrennten Wege in der Logik verfolgen.
Es sind zwei verschiedene Aufgaben gestellt und damit zwei
verschiedene Denkmodelle nötig, um sie zu lösen. Mill und Husserl
knüpfen beide an scholastische Gedankengänge an und schöpfen
ergiebig aus ihnen. Aber Husserl setzt sich vor, die Aktlehre der
Scholastiker (den intellectus in ihrem Sinne, d. h. nicht die Disposition,
sondern die intellektuellen Akte) noch einmal von Grund auf
und in seiner Weise durchzukonstruieren. Und Mill setzt sich vor,
die Bedingungen des inter subjektiven Sprechverkehrs, der sprachlichen
Mitteilung allgemein zu formulieren. Welche Zuordnungen zwischen
Lauten und Dingen müssen vollzogen sein, damit A dem B über die
Dinge etwas mitteilen kann? So hatte schon Platon die Frage
gefaßt und Mill verwirft die subjektivistische Umformulierung des
Problems im Konzepte von Hobbes. Ist da hüben und drüben allererst
etwas zu verwerfen, wenn man vor den zwei imponierend
konsequent durchgeführten Programmen steht? Manche glauben das
und verwerfen z. B. im Namen Husserls das Millsche Vorgehen,
weil angeblich die moderne Phänomenologie reinlicher, d. h. ärmer
230an unsicheren, bezweifelbaren Voraussetzungen sei; andere wieder
trauen umgekehrt der Evidenz aus Husserlscher Modellschau nicht.
Mill erneuert also die antike objektive Sprachanalyse und verwirft
den modernen Subjektivismus von Hobbes; Husserl dagegen holt
aus der Scholastik den Ansatz einer einklammernden Aktlehre
und baut ihn aus. Was sagt aus eigenem die erfolgreiche Wissenschaft
der Sprachforscher dazu?
6. Die Sprachforschung hat ein großes Interesse daran, daß
ihr im Sinne der Millschen Analyse erlaubt ist, axiomatisch
das Faktum des intersubjektiven Zeichen Verkehrs an die Spitze
zu stellen. Wenn das letzte Wort der Husserlschen Lehre
betont, daß ein Sprecher, der das Wort ‚Mensch’ verwendet, bald
die Spezies Mensch als solche (symbolisch: image), bald ein Individuum
als zugehörig zu dieser Spezies (symbolisch: image)
meint und daß es die Angelegenheit seiner Akte ist, ob
er das eine oder das andere meint, so kann ein entschiedener
Subjektivist dies Wort auf die Spitze treiben und erklären:
„Meinen kann ich schließlich alles mit allem” 1)72. Wogegen
gar nichts anderes als das eine zu sagen ist, daß solch eine Maxime,
zum Prinzip erhoben, das sicherste Mittel wäre, um jeden Sprechverkehr
unmöglich zu machen, ein Schlußeffekt, an dem auch der
Freieste der Freien nicht interessiert ist.
De facto werden selbst die kleineren Spielräume individueller
Freiheit wie bei ‚Mensch als Art’ oder ‚Mensch als Individuum’
im Sprechverkehr durch eigene sprachliche Mittel oder durch das
Umfeld des aktuellen Wortes ganz ausgeschaltet oder wenigstens
auf ein unschädliches Maß reduziert. Es ist wahr, daß Husserls
Aktlehre seit dem Universalienstreit zum erstenmal wieder energisch
das ungelöste Problem der Abstraktionstatsachen von der Erlebnisseite
her anging und die Abstraktionslehre Humes als eine Scheinlösung
entlarvte. Unrichtig aber wäre die Auffassung, daß die
Sprachtheorie an dem alten Denkmodell Husserls in den logischen
Untersuchungen ihr Genüge fände und den persönlichen Fortschritt
des großen Logikers, den die späteren Werke des Meisters andeuten,
beiseite schieben dürfte, als ginge er sie nichts an.
Denn wenn Diogenes im Faß zur Einsicht gelangt, daß seine
Selbstgespräche nicht den einzigen, ja nicht einmal den idealen und
231hinreichenden Ausgang der Analyse abgeben, sondern ein reduziertes
Kunstprodukt menschlicher Rede sind, so ist das ein Aha-Erlebnis,
an dem niemand vitaler interessiert sein kann als die
Sprachtheorie. Und mit der Rückversetzung des isolierten Sprechers
in die Gemeinschaft von Sprachgenossen verschwindet jeder Einwand
gegen den Ansatz Platons und Mills, d. h. gegen das objektivistische
Verfahren. Man kann ihn heute sogar in zwei Varianten ausgeführt
denken und tut gut daran, sich von vornherein beide zur geeigneten
Kooperation vorzumerken, nämlich eine Analyse von der Art der
Millschen und daneben eine Anwendung der in gewissem Ausmaß
unentbehrlichen, tierpsychologisch so fruchtbar gewordenen behavioristischen
Denkweise auf die Analyse der Menschensprache.
Denn wer immer die wahren Anfänge der Sprachentwicklung miteinbezieht,
wozu man z. B. in der Theorie der Zeigzeichen gezwungen
ist, der kommt, ob er davon weiß oder nicht, in die Bahnen Wegeners
und Brugmanns und d. h. zu einem behavioristischen Ansätze.
Wir haben dazu einen Beitrag geliefert im zweiten Kapitel
und brauchen post festum keine Apologie zu schreiben.
Wie nahe Husserl an eine objektivistische Sprachanalyse herangekommen
ist, erkennt man am klarsten aus seiner „Formalen und transzendentalen Logik”
(1929). Dort heißt es z. B. p. 30: „All dieses Objektive hat nicht nur das flüchtige
Dasein des im thematischen Feld als aktuelle Bildung Auftretenden und Vergehenden.
Es hat auch den Seinssinn bleibender Fortgeltung, ja sogar den objektiver Gültigkeit
in besonderem Sinn, über die aktuell erkennende Subjektivität und ihre Akte
hinausreichend. Es bleibt Identisches in der Wiederholung, wird in der Weise eines
bleibend Seienden wieder erkannt; es hat in der dokumentierten Form objektives
Dasein, ebenso wie die sonstigen Gegenständlichkeiten der Kulturwelt: es ist so in
einer objektiven Dauer für jedermann vorfindlich, in welchem Sinne nachverstehbar,
intersubjektiv identifizierbar, daseiend, auch wenn niemand es denkt.”
Das ist zunächst gesagt für die „Erzeugnisse” der Wissenschaft, für ihre
Sätze, die sich zu einer „universalen Theorie” zusammenfügen. Es gilt aber nicht
minder für den Gesamtgegenstand der Sprachwissenschaften. Man braucht (gewiß
auch im Sinne Husserls) nicht auf die vollendete Wissenschaft zu warten,
um den Gegenstand ‚lingua latina’ zu konstituieren und man muß sich nicht einmal
durch die ganze Phänomenologie hindurchgearbeitet haben, um diese Konstitution
als gerechtfertigt zu erkennen; sondern es gibt noch andere Wege zu diesem Ziele.
Einer der kürzesten ist die ordentliche, von der Monaden-Beschränkung freie Analyse
des Organon-Modells der Sprache. Es ist mir, seitdem ich es 1918 gegen
Husserl verteidigt habe, immer deutlicher geworden, daß das korrekte Zuendedenken
dieses Modells bestimmte Beschränkungen der Phänomenologie sprengen
und der Erkenntnistheorie einen neuen Ansatz von der Linguistik als Wissenschaft
her bieten muß. Eine immanent-kritische Studie des Fortschritts der Husserlschen
Phänomenologie im Hinblick auf sprachtheoretische Probleme bietet eine saubere
und subtile Dissertation, die abgeschlossen vor mir liegt; ich hoffe sie mit anderen
sprachtheoretischen Arbeiten zusammen in Kürze veröffentlichen zu können.232
Wünschenswert erscheint mir an dieser Stelle das Beispiel
einer Konfrontation des Millschen und Husserlschen Denkmodells
auf dem Boden der empirischen Wortforschung. Ich schreibe die drei
Kernworte ‚Konnotation der Artnamen, die ideale Spezies und das
Etymon’ zusammen; die Aufgabe ist zu diskutieren, ob die drei
Kapitel, aus welchen sie aufgelesen sind, in Ewigkeit getrennt
bleiben müssen oder nicht. Wie verhält sich die Konnotation zum
Etymon? Unser Zitat aus Mill spricht den Eigennamen die Konnotation
oder, was dasselbe ist, eine „attributive” Bestimmung des
Genannten ab. Darf man das in der Linguistik so verstehen, daß
den wohlbekannten Eigennamen der Städte, Berge, Flüsse, Personen,
welche Mill selbst image zur Erläuterung verwendet,
von Haus aus die Symbolik fehlt? Bestimmt nicht, denn
der Sprachhistoriker weiß, daß diese Namen genau so
gut ein Etymon haben wie die Artnamen. Bald ist es historisch
verblaßt oder gänzlich unspürbar geworden wie bei ‚London,
Rhein, Semmering, Wien’; bald ist es springlebendig wie bei (den
klaren Kompositis) ‚Montblanc, Kraxentrager, Heilbronn, Salzburg,
Buenos Aires’. Dasselbe gilt für die üblichen Personennamen.
Denn zwischen ‚Karl, Otto, Maria’ verglichen mit ‚Friedrich,
Gertraud’ auf der einen Seite, besteht derselbe Unterschied wie
zwischen ‚Pferd, Ochs, Esel’, verglichen mit ‚Zaunkönig, Bachstelz’
auf der anderen.
Vielleicht sind die als Eigennamen gebrauchten Komposita
widerstandsfähiger gegen eine Verblassung des Etymons; und wie
ist es sonst bestellt mit der besonderen Eignung der Komposita
als Eigennamen? Jedenfalls ist handgreiflich, daß zwischen der
Konnotation im Sinne Mills und einem mehr oder minder lebendigen
Etymon, wenn überhaupt eine Relation so sicher keine einfache
Korrelation besteht. Fast überflüssig hinzuzufügen, daß nicht nur
die Nennzeichen, sondern auch die deiktischen Wörter ein mehr
oder minder gut verspürbares Etymon haben. Denn sonst wären
die Forschungen Brugmanns und anderer, die wir im Kapitel vom
Zeigfeld der Sprache psychologisch zu interpretieren versuchten,
gegenstandslos; die Sinndifferenz (Funktionsdifferenz) von indogermanisch
*to- und *ko- gehört unbestreitbar zum Forschungsbereich
der Etymologen. Und die vielen Zeigwörter einer Sprache
müssen in ähnlicher Art wie die Nennwörter ihrer Funktion nach
gegeneinander abgehoben sein; von einem da zum dort, von einem
dieser zum jener in demselben Satz macht sich ja auch ein klar
erfaßbarer Bereichssprung und eine Änderung der Zeighilfen bemerkbar,
233den Sprachforscher auf eine Regel zu bringen allermindestens
versuchen können. Brugmann hat dies allgemein für die
indogermanischen Sprachen durch seine Lehre von den vier (Positions-)
Zeigarten versucht. Wir erheben also von neuem die Frage,
ob irgendeine indirekte Relation zwischen Konnotation und Etymon
besteht und welche es ist.
7. Kein Zweifel, daß ein dem Sprachgefühl lebendiges Etymon
den Anwendungsbereich eines Namens regulieren kann; ob muß,
ist eine andere Frage. Wenn diese Regulierung bei dem englischen
Worte ‚hound’ ähnlich wie beim deutschen ‚Hund’ einem Sphärenschema
anvertraut ist, so könnte daneben ungenützt genau so ein
unverblaßtes Etymon bestehen wie etwa im Wortschatz eines
modernen Physikers das Etymon von ‚Hebel’ nicht gefährdet ist
durch die wissenschaftlich fixierte Definition der Bedeutung. Wenn
ein moderner Physiker sich auf das Wort ‚Hebel’ besinnt, spürt er
genau so sicher wie der Holzknecht die Verbindung mit ‚heben’ auf,
obwohl er in seinen Hebelgesetzen davon Abstand nimmt. Das
folgende (oft zitierte) Beispiel von den verschiedenen Namen für
den Elefanten, der bald Einarmiger bald der Zweimaltrinkende
geheißen wurde, muß nach solchen Beobachtungen aus dem uns
selbst wohlvertrauten Bereich von Tatsachen mit der gehörigen
Vorsicht interpretiert werden.
Und zwar von der Einsicht aus, daß Anwendungsbereich und
Etymon durchaus nicht koinzidieren müssen; das Etymon kann
lebendig und trotzdem für den Anwendungsbereich nicht bestimmend
(d. h.: nicht ‚regieren’) sein. Es wäre sonst ja auch die
sprachgeschichtliche Tatsache kaum begreifbar, daß in der Zwischenphase
zwischen regierendem Etymon und einer neuen einfachen
Bedeutungsfixierung ein für den intersubjektiven Verkehr
erträglicher Zustand herrscht. Es gilt also (was gewiß auch anderen
schon auffiel), zu erfassen und anzuerkennen, daß ein unmittelbar
oder auf Besinnen lebendig werdendes Etymon nicht ohne weiteres
auch als regierend betrachtet werden darf. Wozu lang und breit
gar viel zu sagen wäre. Doch bleiben wir streng beim speziellen
Thema einer logischen Betrachtung der Dinge und begnügen uns
mit der keineswegs überraschenden Einsicht, daß ein Begriff entweder
nach Inhalt oder nach Umfang ‚begreifend’, d.h. fassend sein
kann. Die denkpsychologisch nachgewiesene ‚Sphäre’ beschreibt
in erster Linie eine Umfangsfassung, neben welcher das in erster
Linie inhaltlich fassende Etymon bestehen oder abblassen und
schließlich vollständig schwinden kann.234
Vielleicht ist es mehr als nur die Einschränkung des Umfanges
auf ein Individuum, was einen Namen zum Eigennamen macht;
doch ist es jedenfalls auch dies. Wenn im Familienkreise Artnamen
wie ‚der Vater’, bei Landleuten und Städtern der Name ‚die Stadt’
regelmäßig und unzweideutig situationsbestimmte Individuen treffen,
so gibt es auch Gegenbeispiele für die Verwendung von Eigennamen
als Klassenbezeichnungen. ‚Die Sonne’ ist gewöhnlich ein Individuum;
aber die Astronomen kennen viele ‚Sonnen’; es war nicht gerade
Sokrates (das Individuumexempel der Logiker), aber doch auch ein
Einmaliger, welcher bellum Gallicum führte, der Pompeius besiegte
und dann seinen Namen allen Kaisern seit 2000 Jahren ausborgen
mußte (während der besiegte Gegner Pompeius den seinigen als
Privatbesitz behielt). Das Herüber und Hinüber erfolgt also in
der gewachsenen Sprache sehr sorglos und unbekümmert; bei
situationsbestimmten Individuen herüber und, wenn Bruderindividuen
entdeckt werden, hinüber zum Klassennamen.
Trotzdem wird Mill recht behalten, wenn er als Logiker einen Unterschied
des Zuordnungsstatutes zwischen Eigennamen und Gemeinnamen sucht; denn ob
ich dem Kinde bei der Taufe einen echten und dauerhaften Eigennamen zuordnen
lasse, oder es später einen Backfisch nenne, weist faktisch auf einen solchen Unterschied
des Zuordnungsstatutes hin: der zweite Namen kommt dem Kinde nur als
Glied einer Klasse, der erste dagegen individuell zu. Darum verliert der einzelne
‚Backfisch’ in wenigen Jahren diesen Namen wieder, während ein Indianer, den
man ob seines (bewährten oder angewünschten) Kampfgeistes den ‚reißenden Wolf’
nennt, diesen ‚Eigennamen’ behält, auch wenn der Träger vor Alter zahm und
zahnlos geworden ist.
Wenn ich einem Kind bei der Taufe einen Namen wie Karl oder Maria feierlich
beilegen lasse, so ist das für die Nächstbeteiligten und später für andere, die
von den Nächstbeteiligten informiert werden, eine Konvention, die eingehalten
wird. Dieser Vorname allein genügt im kleinen Kreise als Individualzeichen.
Wenn das Kind in die Schule kommt, trifft es viele Namensbrüder oder Namensschwestern,
die auch Karl und Maria heißen. Der Zusatz des Familiennamens
genügt dann meist, um von neuem die Individualisierungsbedürfnisse zu befriedigen;
wenn nicht, dann häufen wir weiter wie in ‚Heinrich XXII., Reuß
jüngere Linie.’
Stehen diese und andere Eigennamen vom Zuordnungsstatut her betrachtet
auf einer Linie mit den ‚Klassennamen’? Ich sage mit J. St. Mill entschieden nein.
Denn die Zuordnung bei der Taufe ist nie und nimmer logisch äquivalent mit einer
Definition, sondern, von fern gesehen, äquivalent dem Anbringen eines Rötelstrichs
am Hause. Daß das Individualzeichen des Eigennamens dem Neugetauften nicht
auf die Stirne gebrannt wird, ist in unserer Frage gleichgültig. Die Nächstbeteiligten
merken ihn schon und vermögen seinen Träger (im Laufe der Jahre immer sicherer)
aus anderen als Individuum herauszuerkennen. Dies Individuum ist das Vorgegebene
und zur Taufe mitgebracht; es ist nicht einer ‚Definition’ bedürftig. Und die Taufe
ist auch keine Definition, sondern — (ein Sakrament möchte man am liebsten fortfahren)
es ist eine Beilegung analog dem Anheften; sie ist eine deiktische Namensverleihung.
235Die Eigennamen werden deiktisch ausgeteilt; es ist nicht ganz genau
das symphysische Umfeld, wohl aber etwas Analoges, was dabei relevant wird.
Wer in aller Welt sagt denn, daß Nennzeichen stets auf den Umfang befragt
werden müssen und faktisch befragt werden, wo immer wir sie im Sprechverkehr
verwenden? Das Leben, auch das Leben der sprachlichen Nennzeichen, ist reicher
als das einzige Denkschema, dem die Logistik alles einzwingen will. Es gibt offenbar
deiktische Namensverleihungen. Diesem Sachverhalt aber stehen gewisse
psychophysische Systeme, denen wir im Leben begegnen und die wir als unsere
Zeitgenossen voll anerkennen müssen, fassungslos gegenüber. Es gibt Denker,
denen die begriffliche Namensverleihung und Definitionen zum Eins und Alles
geworden sind. Doch so vielseitig wie andere reagieren diese psychophysischen
Systeme nicht mehr auf die schlichten Tatbestände der Linguistik. Die Sprachtheorie
aber hat ein Interesse daran, auch die reicheren Reaktionsweisen in ihren
Untersuchungsgegenstand mit einzubeziehen.
§ 15. Das indogermanische Kasussystem als Beispiel
eines Feldgerätes.
Um sofort anzudeuten, wo man stecken blieb und wie die
Konzeption des Symbolfeldes der Sprache fruchtbar werden kann
in der Kasuslehre, wiederholen wir die oft formulierte disjunktive
Frage: Sind die Kasuslokalistisch oder logisch-grammatisch zu deuten?
In dieser Entscheidungsfrage dürfte eine Wahrheit verspürt sein,
wenn es auch ein Leichtes ist zu beweisen, daß die Disjunktion,
so wie sie auf dem Papier steht, windschief ist. Denn die ‚Logik’
läßt es sich schlechterdings nicht gefallen, auf eine Ebene gebracht
zu werden mit dem ‚Raum’; und ‚grammatisch’ muß jeder Kasus
sein. Was ist also an Stelle des zweiten Disjunktionsgliedes zu setzen?
Daß an der alten Fassung ‚lokalistisch oder logisch-grammatisch’
irgend etwas nicht in Ordnung sei, verspürten viele Sprachforscher.
Delbrück z. B. umging den Begriff der ‚logischen’ Kasus und hielt
sich an die Dichotomie: lokalistisch und nicht-lokalistisch. Wundt
bemängelt daran mit Recht die Unbestimmtheit des zweiten Disjunktionsgliedes
und glaubt selbst mit ‚außen und innen’ durchzukommen;
es gäbe Kasus der äußeren und Kasus der inneren Determination,
lehrt Wundt. Worauf ein lästiger Fragesteller nach
der Manier von Kindern und Philosophen neugierig wird und Genaueres
erfahren will üben Innen und Außen. Ein Mann wie Wundt
gibt natürlich genauer an, was er meint; wir werden es beherzigen
und zuerst die wohldurchdachte und sehr umsichtige Kasuslehre
von Wundt skizzieren. Sie hat nach meiner Einschätzung die Probleme
soweit gefördert, daß heute keiner, der selbst weiterkommen
will, an der Leistung Wundts vorübergehen sollte. Daß Wundt im
Sprachhistorischen, wo er sich in Sachen der Kasus noch weitgehend
236auf die „Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache”
von Max Müller verläßt, überholt erscheint und daß er die Kasusfunktionen
zu allerletzt doch rascher als es angeht in die Logik
hineinwachsen läßt, ändert nichts an diesem Urteil. Jedenfalls gehört
eine sorgfältige Analyse und kritische Würdigung des Wundtschen
Innen und Außen als eine Etappe in den Gedankengang, der
hier den Sprachwissenschaften vorgeschlagen wird. Sollte in unsere
Zeichnung des Hintergrundes der Wundtschen Scheidung einiges
von dem Veralteten mit einfließen und unverbessert stehen bleiben,
so wird jeder Spezialkenner nachhelfen und entscheiden, ob die
ausgewählten Beispiele durch bessere, die dasselbe beweisen, zu ersetzen
sind oder prinzipiell getilgt werden müssen.
1. Die knappe Fassung, in welche Wundt das allgemeine
Ergebnis der indogermanischen Sprachvergleichung brachte, begegnete
keinem Widerspruch der zeitgenössischen Linguisten;
auch Delbrück fand daran nichts hier Erwähnenswertes auszusetzen.
Sie lautet ungefähr so: Zur lokalistischen Klasse gehören die
anschaulichen und zu der anderen Klasse die rein begrifflichen Sachverhalte,
die durch Kasus wiedergegeben werden. Was die Frage
nach der historischen Priorität der anschaulichen Kasus angeht, so
verhindert eine unbefangene Analyse der Verhältnisse in den indogermanischen
Sprachen den restlosen Sieg der lokalistischen
Entstehungstheorie. Der Kasuszahl nach steht das griechische
System der Gegenwart näher als das lateinische; aber die reicheren
Systeme, z. B. des klassischen Latein und das noch reichere im
Sanskrit, enthalten das gegenwärtige schon in sich nach Wundt.
Er schreibt:
„Dies führte zu einer zwischen den Gegensätzen der älteren Theorien vermittelnden
Auffassung. Von den acht Kasus des Sanskrit ließen drei, der Nominativ,
Akkusativ und Genitiv (der erste als der Subjektskasus, der zweite als die adverbiale
und der dritte als die attributive oder adnominale Bestimmung des Subjektes)
eine ausschließlich grammatisch-logische Deutung zu. Vier, der Dativ,
Lokalis, Ablativ und Instrumentalis (oder Sozialis) als Bestimmungen des wohin,
wo, woher und womit konnten lokalistisch aufgefaßt werden. Dem achten, dem
Vokativ, als dem Imperativ in nominaler Form, war von vornherein eine abgesonderte
Stellung anzuweisen” (62).
Einzelheiten sind für unser eigenes Vorhaben irrelevant. Sind
schon einmal zwei Klassen anerkannt, dann macht es für einen
Blick aus der Vogelperspektive nicht viel aus. ob z. B. der Dativ
als Kasus des ferneren Objektes mit zu der ersten Klasse gerechnet
wird oder in der zweiten verbleibt. Zumal der Historiker im Bereich
des Indogermanischen nach allgemeiner und wohlbegründeter Auffassung
237ein Zusammenwachsen ursprünglich getrennter Kasus, einen
Konkretismus findet und das entgegengesetzte Phänomen einer
differenzierenden Aufspaltung von einem in mehrere nicht ganz
abweisen kann. Denn wer bei der wuchernden Mannigfaltigkeit
der Kasusfälle in den kaukasischen Sprachen an Spaltungen denkt 1)73,
muß zum mindesten erwägen, ob nicht auch im Indogermanischen
der verarmenden Involution in geschichtlicher Zeit eine bereichernde
Evolution vorausgegangen sei.
Noch ist keine der beiden ‚Klassen’ scharf definiert oder begrifflich
angegeben, was sie unterscheidet; ‚anschaulich’ und ‚begrifflich’
sind Worte, die nicht einfach hingenommen werden dürfen.
Immerhin weiß der laienhafte deutsche Leser durch das Kunstmittel
der Fragen, die den Kasus der anschaulichen Klasse zugeordnet
werden, hier besser Bescheid und macht sich an irgendeinem lateinischen
Beispiel wie Roman proficisci klar, daß man jedenfalls übersetzt
nach Rom aufbrechen. Da wir Roman defendere mit Rom verteidigen,
d. h. parallel zur lateinischen Konstruktion wiedergeben,
so muß durch die beiden Beispiele nebeneinander der Unterschied
getroffen sein: der lateinische Akkusativ ist im ersten Fall nach
dem Schema der lokalistischen Theorie und im zweiten Fall (vielleicht
irgendwie) anders, nämlich so wie unser deutscher Akkusativ
zu deuten.
Ist man glücklich soweit, blickt aber zur Vorsicht noch einmal auf die kleingedruckten
Angaben über das Sanskrit zurück, dann fällt auf, daß dort der Dativ
auf ‚Wohin’? antwortet und der Akkusativ in der lokalistischen Klasse gar nicht
vertreten ist. Das erste ist kein Versehen, sondern es gibt tatsächlich einen
„Zieldativ” (Adressendativ). Das zweite muß wohl nach dem heutigen Wissen
dahin korrigiert werden, daß ein Richtungsakkusativ auch dem Sanskrit nicht
völlig fehlt.
Wir kehren nach dieser erläuternden Abschweifung zu Wundt
zurück und notieren an einem eingeschobenen Gedankengang etwas,
was aufschlußreich zu werden verspricht. Wundt wendet einigen
Scharfsinn und sein breites Wissen an ein wohlbekanntes Phänomen,
von dem er sagt: „Logisch betrachtet erscheint diese Tatsache absolut
irregulär; psychologisch aber wird sie vollkommen begreiflich” (65).
Man horcht auf, um nichts zu versäumen, woran das Merkmal der
‚logischen’ Kasusgruppe deutlich werden könnte. Was er ins Auge
faßt und dem psychologischen Verständnis empfiehlt, ist aber nur
238das Faktum, daß Nominativ und Akkusativ des Neutrums im Indogermanischen
gleichlautend sind. Immerhin ist, wenn Wundts
Betrachtungen richtig sind, vorzumerken für später, daß im Indogermanischen
irgendwie eine Bevorzugung stattfindet des Geschehens,
welches von „handelnden, lebenden Subjekten” nicht
nur ausgeht, sondern sie auch als Handlungspartner wieder trifft.
Stelle ich zwei Sätze einander gegenüber wie ‚Paul pflegt den Vater’
und ‚Paul trinkt (das) Wasser’, so liegt selbst für unser heutiges
Sprachgefühl noch ein gewisser Unterschied vor. Wir wollen ihn
gleich so fassen, wie es unser eigener Gedankenzug verlangt: Was
sich zwischen Paul und dem Vater abspielt, ist (nach unseren Denkgewohnheiten)
ein Tun zwischen zwei menschlichen Handlungspartnern;
wir können uns die Rollen vertauscht denken, so daß ein
andermal der Vater den Paul pflegt. Was sich zwischen Paul und
dem Wasser abspielt, ist (nach unseren Denkgewohnheiten) auch ein
Tun; doch will es uns nicht recht in den Kopf, daß ein andermal
auch das Wasser den Paul trinken könnte; es sei denn, man ließe sich
auf eine von unserem Weg ablenkende, übertragene Sprechweise ein.
Wundt weiß genau, daß uns sonst im Bereich des Indogermanischen
eine derartige Fiktion tatsächlich zugemutet wird,
zieht aber keine kasustheoretischen Konsequenzen daraus. Wir
lassen faktisch auch Materialien wie das Wasser und Steine „handeln”;
das Wasser ‚wälzt’ den Stein, der Stein ‚hemmt’ den Wasserlauf.
Dem dürfte, wie Wundt glaubt, „in den frühesten, den primitiven
Lebensbedürfnissen dienenden Sprachäußerungen” noch ein wenig
anders gewesen sein; es soll auch im Bereich des Indogermanischen
die in anderen Sprachfamilien konsequent durchgeführte ‚Wertunterscheidung’
zwischen leblosen und belebten Dingen gemacht
worden sein. Und wenn unser Neutrum ursprünglich konsequent
nur die leblosen Materialien als solche charakterisierte, dann verstehen
wir, sagt Wundt, daß im Gebietes dieser Neutra das Bedürfnis
einen Subjektskasus vom Objektskasus (den Nominativ vom Akkusativ)
zu unterscheiden, nicht so dringend war wie bei den als männlich
oder weiblich charakterisierten Lebewesen. Darum die bekannte
Erscheinung; es blieb beim Neutrum die eine Form für beides (Nom.
neutr. = Akk. neutr.) stehen. Soweit die Zwischenüberlegung.
Es wäre ein Abweg und ein Übergriff, wenn wir uns hier auf
die spezielle Frage der Neutra einließen; das müssen die Sachverständigen
unter sich ausmachen. Aber es lag mir daran, den Punkt
zu verdeutlichen, wo Wundt unserem eigenen Gedankengang am
nächsten kam. Sonst hat er das Handlungs-Klischee, dieses grundlegende
239und übergreifende Schema der indogermanischen Sprachen,
nicht weiter verfolgt; auch die Erläuterungsbeispiele sind erst
von mir in den Kontext hineingetragen, um ihn allgemein verständlich
zu machen. Wundt greift im Anschluß daran vergleichend
weiter aus und erörtert, daß und wie dieselbe Erscheinung einer
geringeren Mannigfaltigkeit von Kasusendungen auch im Dual
und Pluralis der verschiedensten Sprachen sichtbar wird. Über den
Klassenunterschied lokalistisch gegen „logisch” ist daraus immer
noch nichts Ersprießliches zu lernen.
Zwischendurch löst sich der Kasusbegriff wie von selbst in
nichts auf im Wundtschen Begriffsschatz; bei einer vergleichenden
Betrachtung nämlich, sagen wir des Sanskrit oder Lateinischen
auf der einen Seite mit dem Englischen auf der anderen. In
dem Augenblick, wo die reiche Entwicklung und Verwendung von
Präpositionen (oder der selteneren Postpositionen), die an Stelle
der Kasus auftraten, bedingungslos einbezogen wird in das Thema
‚Kasussysteme’, da ist es aus und vorbei mit einem faßbaren
Kasusbegriff; da ist die Erscheinung, über die man eben noch
sprach, wie eine Wolke vom blauen Himmel verschluckt. Kritisch
wird die Sachlage bereits dort, wo die Wortstellung im
Satz weitgehend, wenn auch noch nicht vollständig einspringt
wie in unseren modernen indogermanischen Sprachen und allen
voraus im Englischen. Hoffnungslos unsachlich aber kommt es
mir vor, den alten Begriff festzuhalten und anzuwenden, wo es
gilt, syntaktische Verhältnisse nach Art des Chinesischen zu beschreiben
(Reservatio mentalis: soweit ich sie verstanden habe). Am
Englischen, an dem Buch Georgs von der Gabelentz und an den
von Finck interpretierten Leseproben aus dem Chinesischen wurde mir
persönlich zuerst die Kasusfrage zum sprachtheoretischen Problem.
2. Wir fahren fort in der Wiedergabe der Wundtschen Lehre.
Wie fängt er das entwischte Phänomen wieder ein? Wundt würde
uns gar nicht zugeben, daß es entwischt war. Darum wird unbesorgt
ein allumfassendes Entwicklungsschema entworfen, in welchem die
semitischen und hamitischen Sprachen neben den indogermanischen
auf der dritten Stufe stehen. Die kasusreichsten, welche man
kennt (amerikanische, kaukasische, uralische, altaische, auch die
Türe-Sprachen) stehen nebeneinander auf der zweiten Stufe und
zahlreiche afrikanische (darunter die von Steinthal zuerst genauer
bestimmten Mande-Negersprachen, ferner das Hottentottisch-Buschmännische
und gewisse australische Sprachen) erhalten ihren Platz
auf der ersten Stufe.240
Hier auf der ersten Stufe gibt es (meist wenig systematisch)
ein Häufchen oder eine größere Fülle von Verbindungswörtern, die
unspezifisch nominale und verbale Begriffsverhältnisse wiedergeben
und dementsprechend auch syntaktisch vielfach unspezifische
Brücken schlagen. Das Gruppenmerkmal der ersten Entwicklungsstufe
ist jedenfalls dies: „Partikeln… in der Regel relativ selbständige
Wörter, die sich ebensogut mit dem Verbum wie mit dem
Nomen verbinden können, und die in manchen Fällen nach Laut
und Bedeutung mit selbständigen Substantiven zusammenfallen”
(74). Die zweite Stufe zeigt im wesentlichen einen Mangel an
grammatischen und eine Fülle von Ausdrucksmitteln für „äußere,
lokale, temporale und sonstige sinnlich anschauliche Verhältnisse”.
Auf der dritten Stufe sind die Verhältnisse im Indogermanischen
ein wenig verschieden von denen in den semitisch-hamitischen
Sprachen. Die semitischen Sprachen weisen „auf einen ursprünglichen
Zustand sparsamer Kasusbildung zurück, die sich zugleich
wesentlich auf sogenannte grammatische Kasus (Nominativ, Akkusativ,
Genitiv) beschränkt”, während die indogermanischen auf
der Entwicklungsphase einer fortschreitenden Reduktion eines ursprünglich
reichen Mischsystems vor uns stehen. Ihr System weist
eben die beiden Klassen ineinander auf wie im Sanskrit und läßt,
wenn man nur an die phonematische Ausprägung denkt, die sogenannten
lokalen früher als die sogenannten grammatischen verschwinden.
Vor allem die lokalen werden zunehmend ersetzt durch
Präpositionen. Es kommt Wundt plausibel vor, daß ein direkter
Entwicklungsschritt auch von I. nach III. erfolgen kann und daß
auch sonst breite Variationsmöglichkeiten bestehen. Selbst den
sonst bei ihm beliebten Entwicklungsbegriff verwendet er nur mit
allerhand Vorbehalten; er sagt ‚Typen’ häufiger und mit besserem
Gewissen als ‚Entwicklungsstufen’.
Jedenfalls sehen wir uns wieder beschenkt mit den zwei Klassen
und wissen immer noch nicht genau, wie sie zu definieren sind. Das
geschieht aber schließlich, und zwar durch eine bei Wundt verblüffend
elegante Wendung eines im besten Wortsinn konstruktiven
(produktiven) Denkens. Wenn ich sie mit eigenen Worten schildern
darf, so verweist uns Wundt auf das bestbekannte Stück Sprachgeschichte
oder noch exakter gesagt, auf zwei Zustände, wie Latein
und modernes Französisch oder Englisch, um vergleichend das
Diakritikon abzulesen. Wir stellen selbst abstrahierend und symbolisch
die beiden Klischees -us, -avit, -am für das Lateinische und
das charakteristische n—v—n (Nomen—Verbum—Nomen wie in
241gentlemen prefer blonds) als eine Möglichkeit im Englischen nebeneinander.
Wundt behauptet nun, daß mit Hilfe des ersten Klischees
beliebige, mit Hilfe des zweiten dagegen (d. h. durch die Wortstellung
im Satze ganz allein) nichts anderes als Kasus der sogenannten
logisch-grammatischen Gruppe differenziert werden
können; dies uns angeblich von der Sprachgeschichte vordemonstrierte
Faktum erhebt er zum Diakritikon und sucht es sachlich
zu begründen. Sein Argument lautet von den Kasusklassen her
gefaßt so:
„Dieses Kriterium besteht darin, daß bei der einen Art der Kasus der Nominalstamm
als solcher, ohne Hinzutritt irgendwelcher in der Form von Suffixen, Präpositionen
oder Postpositionen den Inhalt der Beziehung näher angebender Elemente
vollkommen zureichend die Kasusform ausdrücken kann, während bei der anderen
Art solche näher determinierende Elemente, die eine bestimmte, für das Begriffsverhältnis
wesentliche Vorstellung enthalten, niemals fehlen dürfen, falls nicht der
Ausdruck überhaupt ein unzulänglicher werden soll. Wir können dieses Verhältnis,
unabhängig von allen Erwägungen über Ursprung und Wert der verschiedenen
Kasusformen, zum Ausdruck bringen, wenn wir die Kasus der ersten Art als solche
der inneren Determination, die der zweiten als solche der äußeren Determination
der Begriffe bezeichnen. Der Nominativ, Akkusativ, Genitiv und der Dativ (als
Kasus des ‚entfernteren Objekts’) erweisen sich dann als Kasus der inneren Determination”
(83 f.).
Also kurz gesagt: alles, was durch Kontakt und Stellungsfaktor
allein manifest gemacht werden kann, gehört zu der (edlen)
logischen Klasse; was nicht, zu der andern. Das ist, wie mich
dünkt, die weitest fortgeschrittene Idee, das ist ein Denkmodell in
der Kasuslehre, um das ein weiteres Nachdenken lohnt. Warum ist
es gerade der Stellungsfaktor, der auslesend die erste Gruppe kennzeichnet
? Und was in der Bedeutung der Auserlesenen ist es, das
ihre Bevorzugung verständlich macht? Das sind die zwei Fragen,
die beantwortet werden müssen.
3. Kritik soll aufbauend sein. Wundt sagt Stellung und vernachlässigt
anzugeben, um welche Art von Stellungsgesetz allein
es sich handelt und handeln kann, wenn sie als Scheidungsinstanz
der Kasusklassen angerufen wird. Denn es gibt zum minesten zwei
Arten von Stellungsregeln, die streng unterschieden werden müssen.
Ich weiß nicht, ob passende Namen schon vorgeschlagen sind oder
nicht; ‚absolute’ und ‚relative’ Ordnung ist vielleicht das nächstgelegene
Begriffspaar, das einem Nachsinnenden dazu einfällt.
Doch ist es nicht eindeutig genug. Besser ist zu fragen: wo ist der
Null-Platz, der Koordinatenausgangspunkt? Das englische n—v—n
kann irgendwie mitten im Satze stehen; stets ist ein Platz vor
dem Verbum differenziert und in Opposition gesehen zu einem oder
242mehreren Plätzen nach dem Verbum. So müßte es nicht sein bei
jeder Stellungsregel, sondern es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten;
z. B. die, daß der erste Platz im Satze vor allen andern ausgezeichnet
ist oder der letzte. Es kann auch mitten in der Reihe
der Nullplatz (sozusagen) unbesetzt sein und die Platzrivalen in
Konkurrenz stehen um den direkten Vortritt des einen vor den
andern. So ist es im Falle des Kompositums, das wir später eingehend
durchsprechen werden.
Das Wundtsche Stellungskriterium ist jedenfalls dann zutreffend,
wenn der Nullplatz von einem Verbum besetzt ist wie in
unserem Klischee aus dem Englischen. Und von hier erhebt sich die
Frage, ob nicht die tiefere Weisheit in der Vermutung liegt, es
sei der Platz vorher und nachher gar nichts anderes als das bequemste,
sparsamste Mittel, um die grundlegenden Connotationen
des Verbums kenntlich zu machen. Grob gesagt, ist die folgende
Vermutung aufzustellen und zu prüfen: Es gebe keinen echten Objektkasus,
wo das Verbum fehlt; es gebe auch keinen dem indogermanischen
äquivalenten Nominativus, wo das Verbum fehlt. Ja,
die ganze Klasse der edlen, wie Wundt glaubt, unentbehrlichen
Fälle seien Verbaltrabanten; der Dativ auch, soweit er wirklich
neben dem Akkusativ oder ohne ihn ein Objektskasus ist, und der
Genitiv, soweit er genitivus objektivus ist und nicht die wesentlich
andere Funktion hat, ein attributives Verhältnis wiederzugeben.
Das ist der Kerngedanke unserer eigenen Kasustheorie. Diese
Idee, welche durchaus nicht neu und überraschend sein dürfte,
in einen inneren Zusammenhang zu bringen mit dem durch das
Auftreten eines Verbums charakterisierten Symbolfeldes der Sprache
ist die Aufgabe, die wir uns stellen.
Man muß ein Stück der Wundtschen Logik aus dem Wege
räumen, um seine anders lautende Kasusidee zu Fall zu bringen.
Wir schlagen also Wundts Logik auf, um die Grundlagen seiner
Lehre von der inneren und äußeren Determination vollständig begreifen
zu lernen. Im Kapitel von den Begriffs Verhältnissen behandeln
die Logiker sonst nur Identität, Überordnung, Unterordnung,
Koordination; das ist alles. Wundt aber holt, nachdem in seiner
Logik dies auch geschehen ist, ein zweites Mal aus und schreibt ein
Kapitel über die „Beziehungsformen der Begriffe”, oder, wie man
auch sagen könnte, über die Begriffskomplexionen. Ich zitiere den
entscheidenden Abschnitt:
„Den Verhältnissen, die unabhängige Begriffe zueinander darbieten können
stehen diejenigen Beziehungen gegenüber, in welche die Begriffe dann treten, wenn
243sie unter Hinzutritt einer Beziehungsform eine Verbindung zu einem komplexeren Begriffe
eingehen. Eine solche Verbindung erfolgt stets nach dem Gesetz der binären
Gliederung: das eine Glied derselben ist der Hauptbegriff, das andere ein Nebenbegriff,
der zusammen mit der Beziehungsform jenen näher begrenzt. Beide Begriffe
können wir darum als den determinierten und den determinierenden, die stattfindende
Beziehung als die Determination bezeichnen. Für unser Denken besitzen
die so gebildeten Determinationsprodukte denselben Wert wie die Begriffe von
ursprünglich einheitlichem Charakter; insbesondere können sie in die nämlichen
Relationen wie diese zu anderen Begriffen gebracht werden” (Logik3 I, 136f.).
Wer dies liest, denkt sofort an das Kompositum und an die
(freie) Wortgruppe; es sind denn auch diese sprachlichen Phänomene,
welche Wundt mitten in seiner allgemeinen Begriffslehre vor sich
sieht und als Logiker auszuschöpfen versucht. Er findet, daß die
Glieder der Begriffskomplexionen in der Regel verschiedenen
Kategorien (lies: Wortklassen) angehören:
„So sehen wir in Begriffsverbindungen wiel ‚guter Mensch’, ‚schlecht handeln’,
‚den König morden’ u. dgl. unmittelbar Begriffe verschiedener Kategorien vereinigt.
In solchen Beispielen dagegen wie ‚der Wille des Vaters’, ‚der Baum im Walde’, ‚das
Haus von Stein’ u. dgl. gehören die in Beziehung gesetzten Begriffe beide zu den
Gegenstandsbegriffen. Aber entweder wird durch die Kasusform die kategoriale
Funktion des zweiten Begriffs in solcher Weise verändert, daß die resultierende Bedeutung
derjenigen eines Eigenschaftsbegriffs gleichkommt, oder unser Denken ergänzt
zu dem determinierenden Gegenstands- einen Verbalbegriff, der dann zunächst
mit dem Hauptbegriff logisch verbunden ist, während sich ihm selbst wieder der
determinierende Begriff samt der durch die Präposition ausgedrückten Beziehung
anschließt” (ebenda).
Ich wiederhole: lingua docet logicam; es liegt in diesem ganzen
Abschnitt der Wundtschen Logik nichts anderes vor, als daß
Wundt aufschreibt, was ihn die Sprache, und zwar seine Muttersprache,
lehrt. Er hat die genannten Komposita und freien Wortgruppen
vor sich und schreibt in seine Begriffslehre, was er an ihnen
abzulesen vermeint. So ungefähr schrieb auch, Aristoteles seine
Kategorientafel dem Diktat der griechischen Sprache nach. Wenn
später in solchen Fällen Fehler im Diktat entdeckt werden, beschuldigen
Kritiker der Sprache die Lehrerin und nennen sie unlogisch.
Ich aber gehöre zu den Liebhabern der Sprache und beschuldige
die Schüler; sie haben nicht genau verstanden, was den
Sprachgebilden abzulesen ist.
Bei Wundt geht die Explikation in folgendem Geleise weiter:
Wenn ich die zwei Fügungen habe ‚Kirchturm’ und ‚Turm auf
Kirche (neben Kirche usw.)’, dann liegen im letzten Falle begriffliche
Komplexionen vor, die in vielen kasusreichen Sprachen
genau so präpositionslos wie unser ‚Kirchturm’ gebildet werden. Die
Sprachforscher kommen mit der Nomenklatur kaum nach; da gibt
244es einen ‚Adessivus’, ‚Inessivus’ und ich weiß nicht, was noch mehr.
Das alles sind Fälle äußerer Determination, die statt unserer präpositionalen
Gefüge natürlich auch durch eigene Suffixe, Präfixe
u. dgl. m. gebildet werden können. Der echte Genitiv ‚Turm der
Kirche’ dagegen ist von einer vornehmeren Art, was offenbar wird
in der endungsfreien Fügung ‚Kirchturm’. Warum? Hier beginnt
die Aufklärung des Logikers Wundt in Sachen der inneren Determination.
Deshalb sei dem so, weil durch innere Determination Komplexionen
zustande kommen, ohne daß man ein neues Datum zu
den schon gegebenen Gliedern (also gleichsam von außen) hinzufügen
muß. Das letztere gilt für die andere Gruppe; es gilt in allen
Fällen von äußerlich determinierten Begriffskomplexionen: „Allen
äußeren Beziehungsformen liegt entweder eine Raumanschauung
oder eine Zeitanschauung oder die Vorstellung einer Bedingung zugrunde”
(141). Beispiele: ‚Der Vogel auf (dem) Baum, die Imperatoren
nach Cäsar, ein Brief mit Geld, mit Begeisterung reden, wegen
Beleidigung klagen’.
Es verdient anerkannt zu werden, daß kein Kasustheoretiker
vor Wundt die Frage nach dem Klassenunterschied derart scharf
zugespitzt und auf ja oder nein vorbereitet hat. Daß eine Raumanschauung,
Zeitanschauung usw. hinzutritt bei der zweiten Klasse
ist unbestreitbar. Legen wir den Finger auf die ergänzende Behauptung,
daß die erste Klasse von Begriffskomplexionen eines hinzugefügten
Datums, eines äquivalenten Bandes nicht bedürfe. Das ist
(noch einmal gesagt) die Schlüsselstellung der Wundtschen Kasuslehre.
Man muß als Kritiker immer zuerst eine Phase durchmachen,
in der man sich als Anwalt und Verteidiger fühlt. Wie wäre es bei
‚Kirchturm’ mit dem Hinweis darauf, daß in der Tat ein Turm
schon hineingehört unter die Merkmale des Begriffes ‚Kirche’? Das
Kompositum holt nur heraus, was schon mitgegeben ist, verfährt
also nach dem Rezept, das Kant für die analytischen Urteile im
Unterschied von den synthetischen verfaßt hat; die analytischen
explizieren nur, die synthetischen dagegen fügen etwas Neues, dem
Ausgangsbegriff Fremdes hinzu. Ein ähnliches Denkmodell stand
faktisch Pate, als die Wundt sehe Scheidung aus der Taufe gehoben
wurde; nur ist es nicht ganz das gleiche wie bei Kant gewesen.
Denn es wäre zu einfach ad absurdum zu führen; zu ‚Hausvater’
oder ‚Vaterhaus’ paßt das über den Kirchturm Gesagte gewiß nicht;
denn im Begriff Vater ist gewiß kein Haus, und im Begriff Haus
kein Vater von vornherein schon enthalten.245
Nein Wundt nimmt an, es sei nicht in dem einzelnen Gliedbegriff,
wohl aber in beiden zusammengedacht schon alles enthalten,
was man braucht; der Begriff ‚Schlüssel’ z. B. enthält unter seinen
Merkmalen eine Leerstelle für den Verwendungsbereich des Dinges;
dorthin kann ich nacheinander ‚Haus’, ‚Koffer’ usw. einsetzen,
um die entsprechenden Komposita zu erhalten. Die gemeinte Leerstelle
ist unentbehrlich, denn zu irgendeinem der angedeuteten Verwendungsbereiche
muß jeder Schlüssel gehören. Wie ist es mit
‚Vaterhaus’? Nun ja, ein Haus hat irgendeinen Besitzer und ‚Väter’
können etwas besitzen; also sind in ihrem Begriffe schon die nötigen
Leerstellen angelegt.
Wir müssen nicht nur das letzte Beispiel, sondern den ganzen
Verteidigungsversuch auf die eigene Kappe nehmen. Wundt erwähnt
die scholastische Connotation nicht, die wir S. 2261. wiedergegeben
haben und hier anwenden. Dort hieß es, das Adjektivum
‚albus’ konnotiere ein Etwas, ein Ding, dem es als Eigenschaft inhäriert;
das ist der spezielle Fall einer Leerstelle, dem wir die
Wundtschen Gedanken annähern können, um sie zunächst einmal
zu verstehen. Scholastische Logiker und J. St. Mill hätten die
Lehre Wundts wohl kurzer Hand unter die allgemeine Konzeption
der connotatio eingeordnet. Wir haben es ihnen als Verteidiger
nachgemacht. Und so ist jedenfalls die Lage für den Anfang nicht
ganz aussichtslos; soweit die attributiven Fügungen in Frage stehen.
4. Wie ist es mit den prädikativen Fügungen und dem Akkusativ,
Dativ, Genitivus objectivus (oblivisci alicuius) und mit
dem Nominativ, der allen zusammen irgendwie als Gegenglied zugeordnet
sein mag? Wir machen die Scheidung von attributiven
und prädikativen Komplexionen wieder außerhalb des Wundtschen
Planes, sogar gegen seine eigene Lehre. Doch geschieht es im Hinblick
auf später vorzulegende Gründe und um soviel als möglich Brauchbares
herauszuheben aus der Wundtschen Idee von der inneren
Determination.
Da ist zunächst eine erste Fährte, die wieder aufgegeben
werden muß, weil sie zu Ende geht, bevor die wichtigsten Fälle
unter Dach gebracht sind. Man denkt vor allen anderen Akkusativanwendungen
an den Sonderfall eines offenkundig „inneren” Objektes.
Wir sagen im Deutschen ‚ein Spiel spielen, eine Tracht tragen,
einen Gang gehen’ und würden mit diesem Schema das ganze
Inventar deutscher Verba abwandernd nur von den aktivsten unter
den sogenannten aktiven oder transitiven Verben eine entschiedene
Abweisung erfahren, weil bei ihnen der Akkusativplatz regelmäßig
246durch andere ‚Objekte’ besetzt ist. ‚Einen Trunk trinken’ geht
noch ‚eine Sicht sehen’ klingt gezwungen und bei ‚hören’ wüßte ich
mir (sprachlich) analog kaum mehr zu helfen. Die Intransitiva gestatten
unser Probierspiel vielfach widerstandsfreier als die Transitiva. ‚Einen
(scharfen) Schlag schlagen’ sagt man Fechtern und
Tennisspielern nach, wobei man sich kaum zu überlegen braucht,
ob das Verb hier transitiv oder intransitiv verwendet sei. ‚Sitzen’
ist gewiß ein hochgradig selbstzufriedenes Intransitivum; und doch
könnten wir einem Reitlehrer den Ausdruck ‚einen guten Sitz sitzen’
zur Not noch gestatten 1)74.
Was in den Fällen eines inneren Objektes vorliegt, verdient den
Namen eines analytischen Verhältnisses, weil in der Tat aus dem
Verbalbegriff das in den Akkusativ gesetzte Nomen in ähnlicher
Weise unmittelbar herausgehoben werden kann wie nach Kant
das Merkmal ‚ausgedehnt’ aus dem Begriff ‚Körper’. Twardowski
hat sich vor Jahrzehnten im Rahmen seiner erlebnispsychologischen
Unterscheidung von Akt und (immanentem) Gegenstand für einen
Teil unserer Fälle interessiert und das Zeugnis der Sprache angerufen.
Allein es bedarf kaum des Beweises, daß dieser analytische
Akkusativ keineswegs zum Hauptfall erhoben werden darf. ‚Einen
Gang gehen’, ist eine analytische Komplexion, aber ‚einen Löwen
töten’ ist nicht in demselben Sinne analytisch und sprachtheoretisch
viel wichtiger.
Greifen wir das Beispiel Caius necat leonem auf, um an ihm
über die allgemeinsten Voraussetzungen, unter denen das Kasuspaar
Nominativ : Akkusativ auftritt, ins Klare zu kommen. Überall,
wo ein Ereignis wie das des Löwentodes mit Hilfe eines Zweiklassensystems
darstellender Sprachzeichen hinreichend eindeutig wiedergegeben
wird, findet der Sprachforscher eine Bedeutungskomplexion
und die Gelegenheit, die Frage Wundts zu beantworten. Nehmen wir
an, es werden wie in unserem lateinischen Text die zwei Lebewesen
Caius und der Löwe einzeln genannt, so ist schon durch das Nennen
der beiden in einem Atemzug bestimmt, daß beide beteiligt sind
an dem, was man darstellen will. Es muß aber mindestens noch ein
drittes und viertes aus der eindeutigen sprachlichen Komplexion
247ersichtlich sein, nämlich der Tod und welchen von beiden (Kampfpartnern)
er trifft. Es gibt nun Sprachen, welche dies dritte und
vierte genau so nachschicken, wie es unsere umständliche logische
Analyse vorsieht: den zwei Namen Caius und Löwe folgt im Texte
solcher Sprachen ein Ereigniswort und dem Ereigniswort eine Richtungsangabe,
eine Angabe, von welchem der beiden Partner der
Tod ausgeht und zu welchem er hingeht. Wundt selbst deutet
das Gerüst solcher Komplexionen im Deutschen so an: Caius
Löwe töten — er — ihn und behauptet nach Max Müller, es
gelte für die malaiischen Sprachen, die kaukasischen 1)75 und amerikanische
(94).
Man müßte aber viel Genaueres darüber erfahren, um mit der
Sache endgültig fertig zu werden. In der deutschen Wiedergabe
wird das eine Moment richtig getroffen sein, daß zwei Zeigwörter
(er — ihn) nachgeschickt und an ihnen die Richtungsangabe vollzogen
wird. Ob das nun selbst deklinierte Pronomina sind und sein
müssen, wie unser ‚er — ihn’, ist die erste der sprachtheoretischen
Fragen. Wenn ja, dann gehört die betreffende Sprache schon zu
den Nominativ-Akkusativ-Sprachen und leistet sich in puncto casus
hauptsächlich die Abweichung vom Lateinischen, daß sie ihre
phonematischen Kasuszeichen nur an nachgeschickten anaphorischen
Zeigwörtern (Pronomina) anbringt. Denkbar aber wäre auch
die Antwort nein. Wenn das nachgeschickte Zeigen durch undeklinierte
Partikeln wie ‚hier — dort’ erfolgte, was dann? Um in
unbeholfenem Kinderdeutsch etwas Derartiges nachzubilden, eine
fingierte Erzählung: Maus hier dort; das könnte den Sinn haben,
daß die Maus von hier nach dort gelaufen ist. Die Sprechsukzession
‚hier dort’ bildet in diesem Falle das Ereignis ab. Gleiches wäre
gewiß auch bei unserem anaphorischen Gebrauch der zwei nachgeschickten
Zeigwörter denkbar; und damit hätte man etwas anderes
als einen Nominativ-Akkusativ vor sich. Wundt selbst müßte eine
solche Konstruktion aus der ersten in die zweite Klasse, aus der
inneren in die äußere Determination verweisen. Und hier hätte man
je nach den Umständen immer noch die Wahl, ob die Konstruktion
in erster Linie an die Raumanschauung oder an die Zeitanschauung
appelliert. Ja der Gesamtdenkweise und den besonderen Todesvorstellungen
mancher Völker wäre es vielleicht noch adäquater,
248daß unser Caius als das Instrument betrachtet wird, durch welches
der Tod dem Löwen beikommt: Caio nex leoni. Dann stünde das
konditionale Moment des Wundtschen Schemas „äußere” Determinationen
im Vordergrund. Denn daran sei noch einmal erinnert,
daß Wundt den Gesamtbereich der äußeren Determinationen aufteilt
in Räumliches, Zeitliches, Bedingendes.
Was wir erreichen wollen durch die umständliche Analyse
des Löwentod-Exempels ist eine Lösung der Darstellungsaufgabe
mit sprachlichen Mitteln unter Umgehung der Subjekts-Objektsrelation.
Es kann nicht die Aufgabe des Sprachtheoretikers sein,
nachzuweisen, daß derartiges da oder dort (sagen wir im Baskischen)
wirklich vorkommt oder gar die Regel bildet. Genug, wenn an einem
einzigen Punkte die Lehre von der angeblich logischen Unentbehrlichkeit
der Kasus ‚innerer Determination’ erschüttert ist. Eine
Quelle voreiliger Interpretationen liegt darin, daß Wundt (vermutlich
nach dem Vorbild von Max Müller) in seine deutsche
Wiedergabe das Verbum töten eingesetzt hat. Wäre entschieden,
daß dies für alle Fälle, die er begreiflich machen will, richtig ist, dann
wäre damit auch entschieden, daß Caius Subjekt und der Löwe
Objekt werden muß. Sonst nicht; es könnte in einer Sprache eine
eigene Wortklasse für Ereignisse (Ereigniswörter, die keine Verba
sind) und doch keinen Subjekts- und Objektskasus geben. Hier
muß eine Revision der Wundtschen Kasustheorie einsetzen.
5. Am nächsten unserer eigenen Lösung der Kasusfrage kommt
Wundt dort, wo er sich vom Sprachgefühl darüber belehren läßt,
daß einige der analysierten Wortfügungen einen Verbalbegriff implizieren
(vgl. oben S. 244 gegen Ende des Zitates). Das ist eine
Einsicht, die nicht auf uns oder Wundt gewartet hat, um entdeckt
zu werden. Wir brauchen sie hier, um die Schlüsselposition des
Logikers Wundt anzugreifen. Wo immer ein Verbum die Komplexion
regiert, dort und nur dort sind Leerstellen, in welche primär
Caius und der Löwe eingesetzt werden können als Kasus der sogenannten
inneren Determination. Wir lassen dabei alle attributiven
Fügungen, die historisch aus den prädikativen hervorgegangen sein
dürften, beiseite und denken wieder an die indogermanische Lösung
der Darstellungsaufgabe im Löwentod-Exempel: Caius necat leonem.
Warum provoziert das Verbum die Fragen wer und wen? Weil es
der Ausdruck einer bestimmten Weltauffassung im ursprünglichsten
Wortsinn ist; einer Auffassung, die Sachverhalte unter dem Aspekt
des (tierischen und) menschlichen Verhaltens begreift und zur Darstellung
bringt.249
Unser Durchprobieren der deutschen Verba nach der Möglichkeit,
ihnen ein analytisches Objekt beizufügen, scheiterte keineswegs
an den sogenannten intransitiven; ein Beweis, daß auch sie eine
Objektsbeifügung innerlich (begrifflich) gestatten. Vielleicht verdient
unter allen anderen eine kleine Gruppe von Ereigniswörtern
in diesem Punkte eine besondere Beachtung; es sind diejenigen,
welche überhaupt nicht anders oder doch mit Vorliebe als „Impersonalia”
auftreten. Davon später noch ein Wort. Sonst trägt
ein indogermanisches Verbum regens regelmäßig entweder das
Senderzeichen der ersten oder das Empfängerzeichen der zweiten
oder das merkwürdige Zeichen der sogenannten dritten Person an
sich und markiert damit (zeigend), woher die ‚Handlung’ kommt
bzw. wohin sie abzielt: amo te, amas me, amor a te, amaris a me usw.
Diese Aktionskategorie ist aber keineswegs die einzige, welche
sprachliche Darstellungen ermöglicht; nicht einmal im Indogermanischen.
Wo sie angewendet wird, sind die Fragen wer? und wen?
sinnvoll; sonst nicht. Es ist also gar nicht so, wie Wundt glaubt,
daß zu den Gefügegliedern in Romam proficisci ein äußeres Datum,
nämlich Raumordnung hinzugedacht wird, in Romam defendere
dagegen nicht. Sondern logisch gleichgeordnet dem Raum ist im
zweiten Fall die Aktionskategorie. Bei Romam fugere und Romam
videre ist es prinzipiell nicht anders. Es kommt nicht darauf
an, daß man die Verhältnisse erlebnispsychologisch charakterisiert
und von Intentionen spricht. Tut man es, dann fragt wer?
nach dem intendierenden und wen? nach dem intendierten Glied
im Gefüge: ‚ich sehe, fühle, denke, will das und das’. Statt ‚ich’
kann natürlich auch ‚du’ und ‚er’ stehen. Nein, diese erlebnispsychologische
Interpretation ist keine conditio sina qua non; auch
das behavioristische Denkmodell vermag die Verhältnisse verständlich
zu machen.
Man hat am Tiere und am menschlichen Säugling grundständig
drei Bezugswendungen zu gegebenen Sinnendingen unterschieden;
erstens die positive Zuwendung, zweitens die negative Abwendung
oder Flucht und drittens die negative Zuwendung (Angriff, Abwehr).
In den Akkusativ kann im Deutschen und in anderen indogermanischen
Sprachen jedesmal der Bezugsgegenstand gesetzt werden:
etwas begehren, lieben, fressen; etwas fliehen, vermeiden; etwas
angreifen, abwehren, bezwingen 1)76. Ob das räumlich und damit nach
250Wundt äußerlich gemeint ist oder als aktionsbestimmendes Etwas,
wird nicht generell zu entscheiden sein. Das Wichtigste ist für den
Sprachtheoretiker, zu erkennen, daß die Aktion (die tierische und
menschliche) das Denkmodell ist, unter das man einen darzustellenden
Sachverhalt bringen muß, um das Kasuspaar, von dem wir
sprechen, zu begreifen. Habe ich ein Nennwort, welches dieses
Denkschema impliziert, z. B. ein Verbum, dann connotiert es zwei
Leerstellen. An ihnen ist der Nominativus und Akkusativus (oder
Dativus) angebracht. Die Nominativ- und Akkusativmarken sind
also nichts anderes als die Platzmarken eines bestimmten Symbolfeldes,
das wir damit beschrieben haben. Ob man damit logisch
hinreichend auch schon die Wortklasse des Verbums bestimmt hat,
mag vorerst dahingestellt bleiben. Jedenfalls fanden wir Wörter
mit solchen Leerstellen unter den Verba. Wir werden das Problem
der Wortklassen allgemein wenigstens streifen in § 19. Hier genügt
es, zu erkennen, daß die sogenannten Kasus der inneren Determination
in unseren Sprachen dem Denkmodell der Handlung zugeordnet
sind. Die Analyse der Impersonalia wird den Beweis erbringen,
daß wir Sätze auch dort, wo ein Geschehen geschildert wird, mit
einem anderem Denkmodell bauen können; und in den echten
Nominalsätzen liegen die Verhältnisse zum dritten Male anders.
§ 16. Ein kritischer Rückblick.
Der Zentralbegriff ‚Symbolfeld der Sprache’ ist beseelt und
getragen von einer Leitidee, deren erstes Aufdämmern in mir persönlich
mit Studien an Kants Kritik der reinen Vernunft zusammenhängt.
Dort ist expressis verbis an verschiedenen Systemstellen
ein Mittler eingeführt und dieser Mittler wird regelmäßig als Schema
charakterisiert und bezeichnet. Die vollendete und gleichsam offizielle
251Fassung des Kantschen Gedankens im „Schematismus der
Verstandesbegriffe” ist schwierig und dunkel; sie liegt auch so weit
von unserem Thema ab, daß ich sie hier beiseite schiebe. Viel blutvoller
und der empirischen Erprobung zugänglich tritt derselbe
Gedanke ordnender Schemata in jenen eindrucksvollen Fragmenten
auf, die in der Erstauflage der Vernunftkritik im Abschnitt von
der transzendentalen Deduktion der Kategorien stehen und später
gestrichen worden sind. Der sachliche Gehalt jener Überlegungen
über die Konstitution der einheitlichen Wahrnehmung aus dem
tausendmal wechselnden Stoff der Sinnesdaten wird nach meiner
Überzeugung umgeprägt und vom Vergänglichen geremigt in unserer
werdenden neuen Wahrnehmungslehre auferstehen. Die Erkenntnis
der Konstanzmomente im Wechsel der äußeren und inneren
Wahrnehmungsumstände ist in modernem Gewände eine Erfüllung
dessen, was dem Analytiker Kant im Prinzip schon damals einsichtig
war und wofür er die Idee vermittelnder, ordnender Schemata
brauchte 1)77.
Die sprachliche Fixierung und Fassung der wahrgenommenen
Sachverhalte ist vorbereitet und verwurzelt in den Prozessen, die
wir Wahrnehmungen zu nennen und unsachlich scharf von einer
„nachfolgenden” sprachlichen Fassung zu trennen pflegen. Ich habe
in der „Krise der Psychologie” zu beweisen begonnen, daß dieselben
semantischen Funktionen, die dem Analytiker der Sprache deutlich
werden, daß die Signal-, Anzeichen- und Symbolfunktion in
voller Entfaltung den Sinnesdaten des Menschen auch dort und
unter solchen Umständen zukommt, wo eine Intervention des Sprechapparates
nicht in Frage steht. Das im Sprechverkehr produzierte
Orientierungsgerät der menschlichen Sprache potenziert die Leistungen
der natürlichen Signale und Symptome, die wir wahrnehmend
den Dingen und Verkehrspartnern auch unformuliert abnehmen
und verdanken. Wie weit ein fingierter homo alalus ohne
die Sprache im Deuten und Verwerten der außersprachlichen Signale
und Symptome käme oder gekommen wäre, ist eine viel zu unbestimmte
Frage, als daß sie im Handumdrehen beantwortet
werden könnte.
Im Zuge einer Analyse des Sprechdenkens nun entdeckte ich
im Jahre 1907 das Erlebnis der syntaktischen Schemata. Das Wesentliche
daran ist schnell erzählt: ich hatte mich in Gelegenheitsbeobachtungen
252darüber selbst ertappt und das also Erfaßte in
monatelanger Beschäftigung vielleicht in meinem eigenen Sprechdenken
auch ein wenig gezüchtet. Denkversuche mit anderen, mit
zwei geübten Psychologen und einigen Studenten, waren dann so
angelegt, daß auch sie darauf kommen mußten. Sie hatten epigrammatisch
geschliffene Sentenzen, die ich jedem von ihnen einzeln
vorlas, rasch zu verstehen und, soweit es sich gab, kritisch zum
Inhalt eine Stellungnahme zu gewinnen. Nietzsches Aphorismenschatz
und Verwandtes waren die Fundstellen der Sätze, die ich
nach dem Gesichtspunkt ihrer Neuheit für die Versuchspersonen
und natürlich nach bestimmten Erwartungen über die Denkprozesse,
die sie veranlassen mochten, ausgesucht hatte. Das Drum und
Dran der Ergebnisse braucht nicht geschildert zu werden; jedenfalls
kamen meine Denker häufig in eine Lage, die jeder aus dem
Leben kennt, wo es oft so ist, daß man zu einem vorgelegten Text,
den man grammatisch vollkommen durchschaut, den schweren
Gedanken oder umgekehrt zu einem eigenen Gedanken geeignete
Worte und die prägnante Satzform sucht. Mitunter passierte es
im Ringen um die Lösung, daß Gehalt und sprachliches Darstellungsschema
getrennte Wege gingen, so daß sie auch im Rückblick der
Psychologen, die dies Erlebnis schilderten, noch verwunderlich getrennt
erfaßbar blieben. Und immer wieder wurde dann beschrieben,
daß dies oder jenes ganz oder teilweise leere syntaktische Schema
der eigentlichen Formulierung einer Antwort vorherging und das
faktische Sprechen irgendwie erkennbar steuerte. Häufiger wurden
diese Berichte noch in Erinnerungsversuchen, wo z. B. ein gegebenes
Sprichwort an ein sinnverwandtes in der Vorreihe erinnerte; es
erinnerte an ein verwandtes, aber bildlich und sprachlich anders
eingekleidetes Sprichwort, so daß die Versuchsperson sich fragen
mußte: Wie war es doch? Dann begann ein Suchen nach der anderen
sprachlichen Fassung des Gedankens. Kurz, ich zog den Schluß:
„Wenn wir einen schwierigen Gedanken ausdrücken wollen, dann wählen
wir erst die Satzform für ihn, wir werden uns innerlich erst des Operationsplanes
bewußt, und dieser Plan ist es dann, der erst die Worte meistert. Wenn wir ein
komplizierteres Satzgefüge durchschauen, so ist das ein Wissen um seine grammatische
Struktur, wir wissen um die Beziehungen, die zwischen den einzelnen
Teilen der ganzen Form bestehen. Das kommt auch, während wir selbst sprechen,
vor, z.B. wenn wir einen Zwischensatz mit ‚als’ beginnen und am Schlüsse des Nebensatzes
plötzlich abbrechen, dann kommt uns zum Bewußtsein, daß wir etwas erwartet
haben; das ist nicht nur eine sachliche Ergänzung, sondern auch eine grammatische,
wir erwarten einen Hauptsatz. In allen diesen Fällen kommt uns das gesondert
zum Bewußtsein, was nebenher und, ohne besonders beachtet zu werden,
stets oder fast stets zwischen Gedanken und Wörtern vermittelt, ein Wissen um die
253Satzform und das Verhältnis der Satzteile unter sich, etwas was als direkter Ausdruck
der grammatischen Regeln, die in uns lebendig sind, zu gelten hat” 1)78.
Dazu hat Pick Beobachtungen an Sprachkranken in Fülle
gesammelt und in seinem Buche „Die agrammatischen Sprachstörungen”
(I. Teil 1913) theoretisch ausgedeutet; das Beobachtete
ist also auch psychopathologisch bestätigt und ergänzt worden.
Auch Ch. Bühler brachte weitere Beobachtungsdaten in ihrer Arbeit
über die Prozesse der Satzbildung. O. Selz berichtet kurz und präzis
darüber in „Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums”
II (1922) S. 362 ff. Er selbst hat die Dinge sehr konsequent
weitergeführt und in seine umfassende Komplextheorie des Denkens
eingebaut. Befriedigt aber war ich damals nicht und bin es auch
heute nicht von dem Stand der Sache und vor allem von unserer
Methode. Die Beobachtungen sind gewiß korrekt; allein sie erfassen
doch nur fetzenhaft einen Tatbestand, der gründlicher erforscht
werden müßte. Wir waren Kinder unserer Zeit und legten Wert
auf eine Isolierung und isolierte Bestimmung der konstitutiven Faktoren
des Sprechdenkens, um den heillos kurzsichtigen Sensualismus
jener Tage zu widerlegen. Darum wurde das Erlebnis der ‚leeren’
Satzschemata so stark unterstrichen. Gewöhnlich ist es eben nicht
leer und doch vorhanden das syntaktische Schema; ob im Erlebnis
isolierbar oder nicht, ist sachlich gesehen eine untergeordnete Frage.
Wenn die damalige Beobachtungstechnik nicht ausreicht, muß man
eben neue Wege finden um weiterzukommen. Man darf den Befund
nicht für alle Zeit an die Bedingung einer hochgezüchteten Feinheit
des Beschreibens eigener Denkerlebnisse knüpfen, sondern muß
danach streben, ihn auch weniger subtilen Augen zugänglich zu
machen und noch mehr: es gilt ihn objektiv zu verifizieren.
Hier nun in diesem Kapitel ist niedergelegt, was ein Studium
des Sprachbaus zu bieten vermochte, um zu verifizieren, was ich
für eine Modelleinsicht halte, die mir seit 1907 im Kopf herumgeht.
Heute würde ich sie so formulieren: Daß das Sprechdenken und
mit ihm jedes andere im Dienste des Erkennens vollzogene Operieren
mit Gegenstandssymbolen genau so eines Symbolfeldes bedarf wie
der Maler seiner Malfläche, der Kartograph seines Liniennetzes von
Längen- und Breitengraden und der Notenschreiber, seiner noch
einmal anders hergerichteten Papierfläche oder allgemein gesagt wie
jedes Zweiklassensystem darstellender Zeichen. Daß die analytische
Aufgabe, welche damit der Sprachtheorie gestellt wird, mit dem
254hier Gebotenen noch nicht allgemein genug und logisch scharf genug
gelöst ist, blieb mit nicht verborgen.
Die menschliche Sprache als Darstellungsgerät, wie wir sie
heute kennen, hat einige Entwicklungsschritte hinter sich, die alle
dahin verstanden werden können, daß sie sich mehr und mehr befreite
aus dem Zeigen und weiter und weiter entfernte vom Malen.
Die Entbindung der einzelnen Sprachäußerung aus den Situationshilfen,
aus dem Zeigfeld der Sprache, ist ein Thema, das wir befriedigend,
wie ich glaube, im Abschnitt über den Satz zu Ende
führen können. Dagegen fehlt vorerst noch ein völlig klares außersprachliches
Modell, an dem die an der Sprache abgelesene Darstellungsweise
illustriert werden könnte. Daß ein Symbolgerät, wenn
es in dem Ausmaß wie die Sprache vom malenden Wiedergeben entfernt
und indirekt geworden ist, einen hohen Grad von Universalität
seiner Leistung erreichen kann, ist leicht einzusehen; aber warum
daneben die Fähigkeit zu relationstreuen Wiedergaben nicht grundsätzlich
verloren geht, verstehe ich offen gesagt nicht so, wie es
von einer vollendeten Sprachtheorie dem Verständnis aller erschlossen
werden müßte. Vielleicht überschätzen wir die Erlösung
vom Zeigfeld, vielleicht unterschätzen wir das Faktum der prinzipiellen
Offenheit und das Ergänzungsbedürfnis jeder sprachlichen
Darstellung eines Sachverhaltes vom Wissen her um diesen Sachverhalt.
Oder was dasselbe ist: vielleicht gibt es eine Ergänzung
alles sprachlich gefaßten Wissens aus einer Quelle, die sich nicht in
die Kanäle des sprachlichen Symbolsystemes ergießt und trotzdem
ein echtes Wissen erzeugt.255
IV. Aufbau der menschlichen Rede:
Elemente und Kompositionen.
Die kleine Schrift, welche Leibniz ad usum principis Eugenii
verfaßte, die Monadologie des großen Metaphysikers, beginnt
nach einer Definition mit dem Satze: Et il faut qu'il y ait des substances
simples, puisqu'il y a des composés; car le composé n'est
autre chose qu'un amas ou aggregatum des simples. Im wirklichen
oder nur scheinbaren Widerspruch zu diesem formalen Leitgedanken
von Leibniz steht im Konzept des Aristoteles an hervorragender
Stelle der Begriff einer Synthesis; er steht dort in der Lehre vom
Urteil. Bei Kant, Hegel und Cassirer kehrt er wieder; auch
Wundt bemüht sich um das Verständnis dessen, was er als ‚schöpferische
Synthese’ ansieht.
Im Gemüte unserer Zeitgenossen hat sich die alte Entscheidungsfrage
unter einigen neuen Namen niedergelassen und eingenistet; wer
sich als Psychologe zur ‚Gestaltidee’ oder irgendeiner ‚Ganzheitsauffassung’
bekennt, zieht gewöhnlich einen Strich, errichtet in
ihrem Namen Dämme gegen das ‚amas ou aggregatum’, weil kaum
einer noch zu den ‚Atomisten’ oder Elementariern gerechnet werden
möchte. Die sprachlichen Phänomene wurden von den Gestaltpsychologen
noch nicht befragt und abgelauscht, so oft man sie auch
nebenbei als Eideshelfer zitiert findet. Denn auf der einen Seite
führt jeder das Wort von den ‚Und-Verbindungen’ im Munde ‚um
auf ein Aggregat kat’ exochen hinzuweisen und auf der anderen
Seite hält er als letzte Reserve den Hinweis auf den sprachlichen
Satz parat, an dem es selbst dem Blinden aufgehen müsse, daß die
Analyse von Leibniz nicht allgemein anwendbar sei; der Satz sei
offenkundig mehr und etwas anderes als ein Aggregat von Wörtern.
Die ausdrückliche Gegenüberstellung ‚Gestalt gegen Und-Verbindungen’
ist in der Meinong-Schule gebräuchlich geworden; sie
steht z. B. so, wie sie heute verwendet wird, in einer Abhandlung
von R. Ameseder aus dem Jahre 1904 1)79. Daneben brauchte die
256Würde des Satzes vor einem Worthaufen nicht neu entdeckt zu
werden, weil sie, seit am Satze vom Typus S ist P (dem Satz aus
Onoma und Rhema im aristotelischen Konzepte) die Urteils-Synthesis
erläutert war, nie ernstlich in Zweifel gezogen worden ist.
Es ist nicht unsere Sorge, dort, wo es um „Substanzen” geht,
das Dogma der Monadologie zu retten oder den Liebhabern des
Synthesis-Gedankens recht zu geben; wir lassen uns nicht ablenken
auf Substanzen, sondern bleiben auf dem Boden der Sematologie
und sehen zu, ob man an zeichenhaften Gebilden beide Behauptungen
in einem Atemzug verstehen und vertreten kann, die vom Aggregatum
in einer Hinsicht und die vom Synthema in einer anderen.
So ist es; denn das Verhältnis der Wörter zur Satzeinheit verlangt
genau an der Stelle, wo die amas-Betrachtung ihren Dienst geleistet
hat und unsachlich wäre für das andere, was noch zu sagen ist,
einen Wechsel der Hinsicht, einen Betrachtungsumschlag, der geheimnisfrei
und ohne jeden Hauch von Mystik oder Paradoxie angegeben
werden kann. Wenn es zweierlei, nämlich Symbole und
ein Feld gibt im Satze, so kann eine zweimalige Zählung widerspruchsfrei
dort zum Ergebnis n und hier zum Ergebnis 1 gelangen. Und
das n darf und muß sich ebenso von Leibniz, dem produktiven
Mathematiker, sachgerecht als eine Summe wie die Feldeinheit als
etwas anderes denn eine Symbolsumme bestimmen lassen.
Soll etwas an Verwunderung erhalten bleiben, dann gibt es
am Sprachwerk des vollendeten und situationsentbundenen Satzes
Punkte genug, auf die sie hingelenkt werden kann. Nur ist es
gewiß nicht das Ehrenfels-Kriterium einer sogenannten Übersummativität,
an dem man Halt machen und staunend vor Andacht
verstummen soll. Denn wenn das Wort von der Übersummativität
gesprochen ist, erfährt man häufig nichts weiter; weder warum
die Summe zuerst aufs Papier gesetzt wird, wenn sie durch ein vorgesetztes
über wieder gestrichen werden muß, noch warum zum auslöschenden
Schwamm das normalerweise unverkennbare Quantitätsoder
Steigerungswort ‚über’ erkoren ist. Das Kriterium der Übersummativität
war sinnvoll erdacht in der Meinong-Schule, degenerierte
aber zu einem Abwehrzeichen wie unser deutsches ‚nein’ in
dem Augenblick, wo das Zweiheitsschema der Grazer Produktions
257theorie verlassen wurde. Es liegt nicht im Plane dieses Buches, das
Verlassene genau so, wie es war, zu restaurieren; wohl aber liegt
es auf unserem Wege, die Sprachphänomene selbst zum Reden zu
bringen im Sinne des Satzes, daß es weder Stoff ohne Form noch
Form ohne Stoff gibt. Mag man vorübergehend unsicher geworden
sein, wie das eine und wie das andere Moment gefaßt werden muß
im Reiche der von den Gestaltpsychologen bevorzugten Punkt- und
Strichfiguren auf weißem Papier, so darf den Sachverständigen im
Reiche des Sprachwerks nicht zugemutet werden, sich ungeprüft
miterschüttert zu fühlen. Denn sie wissen im großen und ganzen
ziemlich sicher anzugeben, was an einem Sprachphänomen als stoffliches
Moment und was als formales zu betrachten ist.
Nur eines noch in der Voranzeige: Ist man am Verhältnis
der Wörter zum Satze darauf gekommen, daß ein Wechsel der Signifikation
zu notieren ist, wenn man übergeht von den Zeichen,
welche Gegenstände nennen oder zeigen, zu dem Felde, das einen
Sachverhalt zeichnet, dann verlangt die Konsequenz, daß gefragt
wird, ob ein ähnlicher Wechsel noch einmal oder öfter gefunden
wird am Ganzen eines verwickelten Sprachwerkes. Genau derselbe
Wechsel wird nicht mehr gefunden; das Wortsatzverhältnis ist unwiederholt
und unwiederholbar. Aber es ist sinnvoll zu fragen und
förderlich, eine Antwort sorgsam vorzubereiten nach dem Fragen,
ob und wie sich andersartige Wechsel der Signifikation ergeben, wenn
man im Ubersatzgebiete vom einfachen Satz zum Satzgefüge und
dann gleichsam absteigend auf der anderen Seite vom Wort zu seinen
Phonemen übergeht. So öffnet sich ungezwungen im straffen Rahmen
einer zu vollendenden und sprachwissenschaftlich brauchbaren Sematologie
die Aufbaureihe: Phonem, Wort, Satz und Satzgefüge.
Das obere Ende der Aufbaureihe, das Satzgefüge, wiederholt
in merkwürdiger Weise das Zeigen der Wörter, mit dem wir im
Kapitel vom Zeigfeld die Analyse der Sprache begonnen haben.
Es gibt ein Zeigen im Modus der Anaphora; und wer das Zeigfeld
sucht, in dem es erfolgt, der findet das Band der werdenden Rede
selbst als Zeigfeld verwertet. Der Kontext ist das anaphorische
Zeigfeld, die werdende Rede selbst wird stellenweise und vorübergehend
vor- und zurückschauend, wird reflexiv. Das ist eine äußerst
merkwürdige und in außersprachlichen Darstellungsgeräten nur unvollkommen
nachahmbare Fügeart.
Kaum weniger spezifisch ist am unteren Ende der Reihe
sprachlicher Kompositionsmittel das Verhältnis des Wortes zu seinen
Phonemen. Die Phoneme sind Lautmale im Wortklang und können
258in jedem Wort abgezählt werden. Allein das Wortbild ist außerdem
gestalthaft, es hat ein Klanggesicht, das sich verändert wie ein
menschliches Gesicht im Wechsel des Ausdrucks und der Appellfunktion.
Im üblichen Begriffsschatz der Linguisten ist für auf fallende
Veränderungen dieser Art der Name ‚Emphase’ vorgesehen; und
Heinz Werner hat in seiner Sprachphysiognomik den Sonderfall
verfolgt, wo die Emphase darauf gerichtet ist, Eigenschaften des
genannten Gegenstandes lautcharakteristisch zu unterstreichen. Was
den Sprachtheoretiker allgemein beschäftigen muß, ist die merkwürdige
Konstanz des phonematischen Signalements der Wortbilder
im Wechsel ihres Klanggesichtes.
Wir durchmustern die Gebilde von unten nach oben und beginnen
mit einem noch nicht genannten ‚Element’ der Sprache,
nämlich mit der Silbe. Die Silbengliederung am Lautstrom der
Rede wird zwar weitgehend grammatisch verwertet, entstammt aber
keineswegs aus der Grammatik, sondern gehört zu den stoffbedingten
Gestaltungsmomenten. Es hat einen guten Sinn, die Betrachtung
mit diesen zu beginnen; denn wer sie nicht gehörig in Rechnung
stellte, dem blieben bekannte Erscheinungen im Aufbau der Rede
rätselhaft. Auch sind es psychologisch interessante Zusammenhänge,
die dem Sprachtheoretiker am Phänomen der Syllabierung besonders
deutlich entgegentreten. Es kommt mir vor, als sei durch die Entdeckung
von Stetson das alte Silbenproblem der Phonetiker so
weit gefördert, daß nunmehr das weitaus Wichtigste und sprachtheoretisch
Interessanteste, was noch aussteht, in Angriff genommen
werden kann; eine Untersuchung nämlich, wie sich Rezeption und
Produktion in Kooperation verhalten. Und kaum etwas anderes
wäre für das Gesamtgebiet der Sprachpsychologie (die zentralen
Sprachstörungen eingerechnet) aufschlußreicher als an einem einzigen
Punkte ein wirklicher Einblick in das überall nachgewiesene,
aber keineswegs aufgeklärte zentrale Wechselspiel zwischen Empfang
und Sendung. Wir versuchen auf moderner Basis einen Zugang
dazu, indem wir in der Silbenfrage die Akustiker und Motoriker
an den Verhandlungstisch bitten und zwingen, sich gegenseitig zu
verstehen und zu ergänzen.
§ 17. Die stoffbedingte Gestaltung des Lautstroms der Rede.
Die Artikulation im weiten Wortsinn ist keine Sondereigenschaft
der menschlichen Rede. Denn Tierlaute wie der Hahnenruf
oder der des Kuckucks und der sogenannte Gesang der Singvögel
sind gut artikulierte Lautfolgen; auch außersprachliche menschliche
259Äußerungen wie das Schluchzen oder Lachen sind artikuliert. Wohl
wahr, daß nichts von alldem die menschliche Rede erreicht an
Mannigfaltigkeit der produzierten Lautnuancen und an subtiler
Wendigkeit des Lautstroms; doch ist auch dazu anzumerken, daß
bei nachahmenden Schreivögeln (Staren und Papageien) rein technisch
durchaus Sprachähnliches zum Vorschein kommt. Wer beschreibend
fortfahren will, darf an dieser Stelle nicht laienhaft mit ‚Überlegung,
Sinn, Vernunft’ dazwischenfahren, sondern muß zunächst einmal geduldig
das Gesamtbild der Aufgliederung des Lautstroms der menschlichen
Rede frei vom Hinüberschielen auf den Sinn entwerfen. Wir
gehen zur Phonetik in die Lehre, um die sprachtheoretischen Fragen
nach dem Anteil der Erzeugungstechnik und der akustischen Eigenschaften
des Lautstoffs am Aufbau der Rede exakt zu stellen. Im
Mittelpunkt des Bildes steht das Phänomen der Silbe.
1. Ein moderner Phonetiker bleibt nicht stecken in der Beschreibung
von Vokalen und Konsonanten, sondern sieht und bestimmt
die Silbengliederung des Lautstroms, Sprechtakte und
noch höhere Formationen in eigener Regie, d. h. im ersten Anlauf
frei noch vom Gesichtspunkt der grammatischen Analyse. Merkwürdig,
wenn man so will, und doch durchaus gesichert ist das
Faktum dieser eigenen Gestaltungstendenzen. Denn Syllabierung,
Sprechtakte usw. treten auf und setzen sich durch, wenn
es nicht anders geht, auch gegen die Ansprüche der grammatischen
Gliederung der Rede. Nur sind die stoffbedingten Gestaltungstendenzen
plastisch genug, um sich in gewissen Grenzen
anzupassen. Wenn ich dem Lautstrom die Schablone einer vorgegebenen
starren Verszeile vorschreibe, so ist auch damit nicht
gesagt, daß ein guter Sprecher alle Zeilen gleichförmig taktierend
herausbringen wird, sondern etwas anderes ist, wie man weiß, zu
erwarten. Es ergeben sich ästhetisch reizvolle Spannungen und
es ergibt sich ein Spielraum individueller Lösungsmöglichkeiten aus
dem Gegenspiel der beiden Gestaltungsansprüche, die eben nicht
erst in der ‚gebundenen’ Rede, sondern auch schon in der sogenannten
ungebundenen zum Vorschein kommen. Das ist ein Gegenspiel,
welches nicht nur im Lautstrom der Rede, sondern bei allen vergleichbaren
‚Bauten’ in ähnlicher Weise angetroffen wird. Architekten,
Maler und Musiker könnten davon genau so gut wie wir zu
reden anfangen und jeder sein eigenes Sprüchlein darüber sagen;
er könnte zeigen, wie auf seinem Gebiet Spannungen zwischen
materialbedingten mit anderen Gestaltungstendenzen auftreten und
wie sie von Könnern gelöst werden.260
Mich dünkt, die Frage nach den phonetischen ‚Einheiten’
und alles, was damit zusammenhängt, sei bis heute von keinem
Sachverständigen weitsichtiger und einleuchtender behandelt worden
als von Sievers, der das Erbe von Sweet übernahm und vermehrte.
Sievers hatte als Beobachter ein feines Ohr für diese Dinge und
als Theoretiker das Zeug dazu, sie begrifflich befriedigender als
seine Vorgänger zu bewältigen. Sein Ergebnis bedarf nur einer Ergänzung,
keiner Änderung, um der Sprachtheorie als Basis zu
dienen. Sievers bevorzugt bei der Bestimmung der Laute (der
sonanten wie der konsonanten) die Erzeugungsanalyse und stellt
ihr eine rein akustische Silbentheorie an die Seite; das ist ein
Schönheitsfehler, vielleicht sogar etwas mehr. Doch verschieben
wir die Kritik. Ein Hauptverdienst von Sievers liegt, wie ich
die Dinge sehe, darin, daß er noch konsequenter als seine Vorgänger
den Gesichtskreis der Phonetik erweitert und die genannten
stoffbedingten Gestaltungstendenzen in ihr Programm aufgenommen
hat.
Wir fingen an aufzuzählen mit Sievers, es gebe: Syllabierung,
Sprechtakte usw. am Lautstrom der Rede. Das sind Gestaltungen,
Gliederungen, welche eine Eigentendenz verraten und sich nur im
Groben, aber keineswegs im Detail mit der grammatischen Gliederung
desselben Lautstromes decken. So kommt es z. B. ganz regelmäßig
vor, daß zu einer Silbe wird, was zwei Wörtern angehört
oder daß die Grenze zweier Sprechtakte einen Wortklang mitten
auseinanderschneidet. Der Sprachtheoretiker notiert also, daß es
durchgehend vom Kleinen zum Großen, und ginge es nicht weiter,
so mindestens von der Silbe bis zum verwickelten Satz einer Rede,
zwei Gestaltungsbedürfnisse nebeneinander gibt. Weil es sie gibt
und weil sie durchgehen vom Großen bis zum Kleinen oder umgekehrt,
so darf man sich die Arbeitsteilung zwischen Phonetik
und Grammatik nicht zu primitiv vorstellen; es wäre unsachgemäß,
etwa die wissenschaftliche Bestimmung gewisser elementarer Bausteine
der Rede ganz und gar ins Ressort des Phonetikers und die
Theorie der Großgebilde ebenso restfrei ins Ressort des Grammatikers
zu verweisen. Noch drastischer versinnbildlicht: Das werdende
Sprachwerk durchläuft im psychophysischen System eines Sprechers
nicht wie ein werdendes Backsteinhaus nacheinander zwei Prozesse,
nämlich zuerst das Backen der Elemente und dann die
Aufführung der Mauern aus ihnen. Ob primitiver oder subtiler
ausgedacht, so sollte durch die Phonetik seit Sweet prinzipiell
jede Backsteinlehre unmöglich geworden sein. Wieweit sie früher
261offen oder latent vertreten worden ist, mag der Historiker entscheiden 1)80.
2. Der Psychologe und Sprachtheoretiker hat Gründe genug,
sich für die Untersuchung des Silbenphänomens zu interessieren.
Denn es sind in allen Lagern immer wieder psychologische Kriterien
und Argumente, die angegeben und in die Wagschale gelegt werden,
und das Phänomen der Silbe muß in einer ordentlich aufgebauten
Kompositionslehre Platz haben. Trägt man aus Handbüchern der
Phonetik die Merkmale des Silbenbegriffes geordnet in eine Liste
ein, so bietet sich das Kennwort Wellentheorie für die Lehre von
Sievers und anderen Akustikern an. Wäre die Aufgabe gestellt,
eine optische Figur vom Typus der Sinuskurve nach dem unmittelbaren
Eindruck aufzugliedern in Teile, so gäbe es mehrere Lösungen,
die im Schema angedeutet seien:
image
Fig. 5.
Man kann entweder „die Gipfel” zählen und die Einheitsgrenzen
in die Wellentäler verlegen oder nach dem Beispiel der analytischen
Geometrie die Krümmungswendepunkte auf der Mittelachse
als Einheitsgrenzen auffassen. Beide Auffassungen lassen
Halbwellen erkennen und führen im Prinzip zu demselben Zählergebnis.
Und zu beiden gibt es Analoga in der Kriteriensammlung
der Silbentheoretiker. Wer die Silbe nach dem Vorgang von Sweet
als eine Sonoritätswelle charakterisiert, zählt Gipfel und sucht die
Grenzen in den Tälern; dies ist die Grundvorstellung bei allen Akustikern
und dürfte unentbehrlich, wenn auch nicht alles sein in der
Silbenlehre. Versteht sich, die gemeinten Sonoritätswellen erheben
sich nicht überall aus der Nullinie einer absoluten Lautunterbrechung,
sondern wie Berge und Hügel aus wechselnder Tieflage des Talbodens.
Wenn man nach den Anweisungen von Sievers und Jespersen
die durchschnittliche (relative) „Schallfülle” der Laute
auf einer (bei Jespersen) achtstufigen Skala festlegt, ergäbe sich
262für die zwei deutschen Wörter ‚Tante’ und ‚Attentat’ die folgenden
schematischen Klangfüllkurven mit den erwarteten zwei oder drei
Gipfeln:
image tante | atntat
Fig. 6.
Auf diese Analyse ist die einfache Definition von D. Jones zugeschnitten:
„Wenn zwei Laute einer Gruppe getrennt sind durch einen
oder mehrere Laute von geringerer Sonorität als jeder von beiden,
dann sagt man, jene Laute gehören zu verschiedenen Silben” (Outline
§ 99) 1)81. Wer sich einmal den Zauber dieser klaren Konzeption ergeben
hat, wird kaum wieder ganz davon frei werden, und es ist vermutlich
auch gar nicht nötig. Denn das Aufgliedern eines Klangstromes in
Wellen oder Pulse ist ein Strukturgesetz unseres Hörens; und warum
sollte es im sprachlichen Klanggebiet nicht die Dimension der Schallfülle
sein, an der eine Grundwelle sozusagen heraus- oder manchmal
auch hineingehört wird? Eine Serie äquidistanter und völlig gleichstarker
Schlaggeräusche wird von einem menschlichen Auffassungsapparat
so gut wie unvermeidlich rhythmisch (taktmäßig) gegliedert;
und ein Lautstrom vom Typus des sprachlichen wird nach
der Meinung der Forscher von Sweet bis Sievers in erster Linie
auf Sonoritätsweilen hin abgehört. Beides vermutlich kraft Anlage
und Übung zugleich, die in uns von früher Kindheit an gereift und
ausgebildet sind. Erhebliche Schwierigkeiten erwachsen gewiß nicht
aus dem Tatbestand der sogenannten Nebensilben; daß ein Wort
wie ‚Obst’ einen kleinen Sondergipfel an Sonorität in dem s-Laut
aufweist und trotzdem als einsilbig imponiert, ist nicht verwunderlicher
als daß ein Berg manchmal einen Nebengipfel hat und trotzdem
als ein Berg imponiert.
Ich verweise auf die Klangkurve auf S. 264. Sie stammt aus einer Arbeit
von Dr. Karl Brenner, der sich das Ziel steckt, mit den Mitteln einer objektiven
Analyse die Ausdrucksvarianten im Klanggesicht menschlicher Reden zu
bestimmen. Der Text ist in extenso in der Arbeit von H. Herzog „Stimme und Persönlichkeit”
in Zeitschr. f. Psych. 130 (1933), S. 306, abgedruckt. Unsere Sprecherin
hier gehört nicht zu den Sprechern dort; die Aufnahmen Brenners sind unabhängig
263von dem Radioexperiment der Herzogschen Arbeit. — In unserem Zusammenhang
soll nur das klare Klangbild einer Silbe beachtet werden.
Trotzdem müssen primär oder sekundär in der uns so geläufigen
Silbengliederung des Lautstroms noch andere materiale Gestaltungstendenzen
enthalten sein. Denn mit der sogenannten Sonorität
allein, mit ihr als einziger Variabein wäre die nachgewiesene Mannigfaltigkeit
der Silbencharaktere nicht herzustellen; auch mit der
achtstufigen Skala von Jespersen nicht. Was sonst noch an
Variabein aufzufinden ist, gehört vor allem in den Bereich der
Silbendauer und in den Bereich der Lautstärke. Silben lassen
sich dehnen und umgekehrt auf eine Minimaldauer verkürzen, weil
jede Silbe dehnbare, d. h. Dauerlaute (Klänge oder Geräusche) enthält;
es gibt daneben auch undehnbare Lautmomente, die eine
echte Dehnung nicht vertragen, sei es, weil eine knappe Sukzessionsordnung,
eine knappe Ablaufsgestalt, zu ihrem akustischen Charakter
gehört oder weil sie zerdehnt vom Sprechapparat nicht erzeugt
werden können; versucht man z. B. mitten in einem Wort die (vollständigen)
Verschlußlaute wie t oder p zu dehnen, so kommt ein
längeres Aushalten im wesentlichen nur der Lautpause in ihrem
Schöße zugute. Die Lautstärke kann mannigfach dosiert und als
charakteristisches Stärkerelief am Silbenband herausgearbeitet
werden. Was es da an Möglichkeiten gibt, ist von der Phonetik
seit Sweet sorgfältig untersucht worden.
Sievers betrachtet das Lautheitsrelief des Lautstroms neben
und in Kooperation mit dem Klangfüllrelief als ein entscheidendes
Moment der (gehörten) Silbengliederung. Es gibt, wenn er Recht hat,
grob gesagt auch ‚Drucksilben’, d. h. solche, die an erster Stelle als
einheitliche Intensitätswellen imponieren. Daß die Silbenlehre dadurch
erheblich komplizierter wird, darf gewiß nicht als Argument
gegen Sievers in die Debatte geworfen werden; denn der oberste
Anspruch an eine Theorie ist nicht, daß sie einfach, sondern daß sie
adäquat sein soll. Wenn die Intensitätswelle wirklich ein Silbenbildner
ist, wie Sievers behauptet, muß sie eben hingenommen
werden. Vielleicht wird sich die Angelegenheit der Doppelmerkmalslehre
von Sievers so klären, wie er es selbst schon vorbereitet hat;
daß nämlich faßbare Koppelungen zwischen Klangfüllwelle und
Intensitätswelle bestehen und daß faktisch ein Eindrucksprodukt
aus beiden zugleich gewonnen und als effektives Silbenscheidungskriterium
verwertet wird; so zum mindesten von den Partnern der
deutschen Sprachgemeinschaft. Denn das könnte in verschiedenen
Sprachen verschieden sein. Es gibt auf dem Gebiet der Musik264
image reines | durch | modifiziertes
Fig. 7. Silbe „Maul” in „Maulkorb”, einem laufenden Satztext entnommen. Gesprochen von einer weiblichen, sehr hellen Stimme in normalem
Leseton ohne besondere Akzentuierung; höchst erreichte Helligkeit v = 357,5 Hertz (zwischen f1 und fis1 der temperierten, zwölfstufigen Tonleiter).
Die Laufgeschwindigkeit des photographischen Papiers beträgt im Durchschmitt 1930 mm pro Sekunde; der Zeitmarkenabstand am Fuß
der Kurve 0,02 Sekunden. Die Originalaufnahme ist 1,8mal größer. Die Aufnahme erfolgte mit einem Oszillographen von Siemens & Halske
und einem elektrodynamischen Mikrophon der Western Electric Cie. im Studio der Ravag in Wien.
Man beachte neben den ausgemessenen Zeiten die Einschwingungsvorgänge der Laute.insert
Analoga dazu, wenn man das Ineinander von Melos, Längenrhythmik
und Stärkerhythmik zum Vergleich heranzieht und zuläßt.
Auch die Frage, wieweit Diphtonge die eindrucksmäßige
Silbeneinheit nicht stören, ist vielleicht für verschiedene Sprachen
verschieden zu beantworten. Das alles sind Feinheiten möglicher
Gliederungen, die erst von der sorgfältigen phonologischen Analyse
her ihr wahres Gesicht und Gewicht erhalten werden.
3. Auf einem anderen Blatt stehen alle Bemühungen um eine
„ motorische” oder „ erzeugungsgenetische” Silbencharakteristik.
Dem resignierenden Bekenntnis von Sievers zum Trotze sind immer
wieder Anläufe gemacht worden, die Silbengliederung des Lautstroms
als das Ergebnis und akustische Repräsentat einer einfachen
Wellenform oder Stoßform des lauterzeugenden motorischen Geschehens
nachzuweisen 1)82.
Ich übergehe de Saussures und Rousselots nicht uninteressante
Anläufe und rücke den Versuch des amerikanischen Psychologen
Stetson exemplarisch in den Vordergrund 2)83. Um seinen Versuch
zu verstehen, muß man vor allem den wichtigen Unterschied der
ballistischen Körperbewegungen gegenüber den geführten kennen.
Eine geführte Körperbewegung wie die meines Armes, wenn ich
langsam nach etwas greife, erfolgt unter Innervation der Beuger
und Strecker des Armes zugleich. Eine geschnellte Finger- oder
Armbewegung dagegen entbehrt der Abbremsung durch den Gegenzug
mitinnervierter Antagonisten und kann darum während ihres
Ablaufs auch nicht gesteuert, nicht präziser auf das Ziel hin gelenkt
werden. Jenes ist das Definitionsmerkmal und dieses eine
konsekutive Eigenschaft der ballistischen Bewegungen im Sinne von
265Stetson und seiner Mitarbeiter. Der Atemdruck der kurzen Silben
wird nach Stetson erzeugt durch ballistische Impulse, die der Blasebalg
erhält, es sind ‚ehest pulses’, während die Verhältnisse für die
langen Silben, was den Exspirationsdruck angeht, etwas komplizierter
liegen.
Man findet die beste zusammenfassende Beschreibung der beiden Bewegungsarten
in dem Aufsatz von Hartson; die Dinge sind praktisch sehr wichtig für alle
Arten von Höchstleistungen im Sport, beim Klavierspielen, Maschinenschreiben,
Schreiben usw. und auf diesen Gebieten früher untersucht worden als in der Physiologie
der Sprechbewegungen. Moderne Klavierlehrer legen, wo es auf Training zu
Höchstleistungen ankommt, großen Wert darauf, daß die bewegten Finger ‚geschleudert’,
ballistisch (wie ein geworfenes oder geschleudertes Ding) bewegt werden;
auch Sportlehrer legen Wert darauf beim Schlag des Golfspiels u. dgl. m. Warum?
Weil Bewegungen der ballistischen Art auf die Dauer am wenigsten ermüdend sind,
sehr schnell hintereinander ausgeführt werden können und präziser ausfallen (bei
genügender Übung) als die andere Art bei gleichem Tempo. So setzen sich, wie man
weiß, die unermüdlichen Bewegungen des schauenden Auges aus ballistischen Rucken
zusammen; auch die Aktion des unermüdlichen Herzens ist ballistisch; die Atem stoße
der Kurzsilben kommen also, wenn Stetson recht behält, in eine ausgezeichnete
Gesellschaft; diese Druckpulse (richtiger Druckpulsprodukte) legitimieren sich
dort neben den Herzpulsen und den Blickbewegungen der Augen als ballistische
Erzeugnisse.
Wird Stetson recht behalten? Es lohnt schon, seine Experimente,
welche in der Silbenfrage Erfahrungen einer dreißigjährigen
Laboratoriumsarbeit an anderen, leichter durchschaubaren Körperbewegungen
anwenden, genau zu studieren. Ich selbst war skeptisch
vor zwei Jahren, als ich zuerst die Dinge kennenlernte, skeptisch vor
allem ob der, wie mir schien, technisch zu primitiven Apparatur,
ob der Mehrdeutigkeit der Kurvenausschläge, und weil es mir unwahrscheinlich
vorkam, daß der Grobapparat des Blasebalgs solchen
Kurzwellenimpulsen folgen sollte. Nun aber hat mich Hartson,
der ein Semester an meinem Institut arbeitete, mündlich über einiges
genauer informiert, so daß die Bedenken im Hauptpunkt verschwunden
sind; vor allem sind die Muskelinnervationen heute direkt
am Saitengalvanometer sichtbar gemacht worden, was natürlich
ihre Existenz über jeden Zweifel erhebt.
Hartson schreibt in seinem Artikel von vornherein ganz allgemein: „ein
wohlintegrierter lebender Körper ist nie frei von muskulär
fixierten Stellungen [die zu der anderen Klasse von Innervationen
gehören], dem Fundament, auf welches die ballistischen
Impulse aufgesetzt erscheinen” (32); und sagt über die Sprechbewegungen:
„die ballistischen Exspirationspulse, welche beim
Sprechen die Silben konstituieren, werden ausgetrieben durch den
stetigen Exspirationsdruck” [sc. des aktiv ausgedehnten und dann
266passiv in sich zusammensinkenden Blasebalgs]. Es kann sich also
nach Hartson nur um ballistische Zusatz- (superimposed) Impulse
handeln. Nehmen wir an, daß solche „breath pulses” für die Kurzsilben
einwandfrei aufgezeigt werden, dann ist ein Teil der Silbenfragen
vom Erzeugungsaspekte her in der Tat beantwortet. Bestimmt
nicht alle; denn nun kommen die Langsilben, welche physiologisch
auf eine andere Weise ihre Dehnung und phonologische Ausgestaltung
erfahren; versteht sich im Englischen, das die Versuchspersonen
Stetsons sprechen und welches in dieser Hinsicht dem Deutschen
nahestehen dürfte. Ich glaube, Sievers und andere hätten diesen Befund
in ihre Grundauffassung von der Silbe leicht einbauen können.
Hartson gibt summarisch an: „Each syllable is a ballistic pulse in a stream
of air from the lungs, the volume of which is controlled by fixations in the rib cage
and abdomen.” Das muß höchst wahrscheinlich in zweifacher Hinsicht ergänzt
werden; denn erstens dürfte ein guter Teil der langen Silben, besonders der emphatisch
gedehnten, auszunehmen sein und zweitens wird Hartson durch seine
eigene Analyse der featuring movements im Ansatzrohr vor die Frage gestellt, ob
durch sie nicht auch effektive Silbenwellen erzeugt werden können. Denn er schreibt:
„Giving utterance to the many tones and syllables in the human repertory of song
and speech involves ballistic contractions of lips, tongue, lower jaw, and throat in
a variety of ways” (S. 39).
Die psychologische Hauptfrage nach all dem ist, ob und wie und
wieweit ein Hörer den ballistischen Charakter der kurzen und den
nichtballistischen der gedehnten Silben zu erfassen vermag oder
anders gewendet, wie sich die Erzeugungsmodalität im Akustischen
ausprägt. Auch bleiben nach meiner Auffassung immer noch Silbengliederungsmomente,
die nur aus Bewegungen des Ansatzrohres
in Kooperation mit dem Blasebalg erzeugt werden und die akustisch
gesehen mit den irgendwie erfaßten Druckpulsen gar nichts zu tun
haben; es bleibt mit anderen Worten die Grundauffassung eines
Akustikers wie Sievers in weitem Bereiche unerschüttert. Stetson
hat (summarisch bestimmt) das beigetragen, daß er zeigte, wie die
Druckstöße vor allem der kurzen Silben entstehen und wie in den
Wellentälern der Lautwellen die Silbengrenzen vielfach durch eigene
Momente abgesteckt werden; denn seine Druckanalysen treffen
natürlich in erster Linie das Phänomen der Grenzkonsonanten
und zeigen, wie es eigens gesetzt wird vom technischen Apparat
des Sprechens. Es ist also, um das Berg- und Talbild festzuhalten,
nicht so, daß unmarkierte Tiefpunkte in den Tälern die Silbengrenzen
sind, sondern dort stehen oft die markanten Phänomene
der Konsonanten als aktiv gesetzte Grenzen.
Sehr klärend erscheint mir im Werke von Stetson und seiner Mitarbeiter
die weite Übersicht der psychophysisch verwandten Innervationsverhältnisse in
267anderen Bewegungsbereichen. Hartson kennt in seiner Tabelle der untersuchten
Bewegungsarten des Menschen nicht nur „featuring vocal movements”, d. h. eben
die Einstellungseffekte des Ansatzrohres, sondern featuring movements überall, wo
dem Effekt des gröberen Bewegungsapparates die modifizierenden Obertöne (kurz
gesagt, das heißt Bewegungen in den kleinen Gelenken) aufgesetzt werden; so sind
z. B. Bewegungen der Finger den gröberen Exkursionen des Armes beim Schreiben
oder Klavierspielen aufgesetzt (superimposed) als featuring movements. Und diese
aufgesetzten Bewegungen müssen, wo es auf Präzision und Schnelligkeit zugleich ankommt,
ballistisch sein, dürfen also während ihres Verlaufes nicht durch Gegenimpulse
in die antagonistischen Muskeln teilweise gehemmt und damit geführt werden. Sie
sollen den Charakter frei ausschwingender Bewegungen haben und erst am Schluß
aktiv gestoppt (abgeschnitten) werden. Die Mehr-Apparate-Kooperation in unserem
Sprechorgan (Blasebalg, Stimmapparat und einstellbares Ansatzrohr) ist aus dieser
Perspektive betrachtet keine Ausnahme, sondern fügt sich der allgemeinen Struktur
aller subtileren Bewegungsproduktionen des Menschen ein.
4. Wie verhält es sich also im einzelnen mit den zwei Aspekten
der Silbenlehre, dem akustischen und dem motorischen? Die
moderne Radiotechnik ist auf vieles aufmerksam geworden, was
in der Sende- und Empfangsapparatur des natürlichen menschlichen
Sprechverkehrs verwirklicht ist und hat es mit eigenen Mitteln
nachgeahmt oder ersetzt. Unerreicht aber und vorerst technisch
nicht kopierbar ist die außerordentlich wichtige Kooperation der
Sender- und Empfangsapparatur in ein und demselben psychophysischen
System. Wir sind, wenn wir hörend aufnehmen, mehr
und anderes als rein akustische Rezeptoren; und wenn wir selbst
sprechen, sind wir mehr und anderes als taube Sender. Sondern
wir nehmen das Gehörte innerlich mitkonstruierend (oft förmlich
nachsprechend) auf und erzeugen die eigenen Sendungen unter der
wirksamen Kontrolle unseres mithörenden Ohres. Über Grenzfälle,
wo dies nicht mehr gilt und wo infolgedessen erhebliche und wohlbekannte
Verkehrsschwierigkeiten eintreten, will ich hier nicht berichten;
genug, wenn feststeht und anerkannt wird, daß die Aufnahme
und das Verständnis einer sinnvollen Rede beim vollsinnigen
hörenden Menschen den eigenen Sendeapparat in wechselndem Ausmaß
mit in Aktion versetzt und umgekehrt. Es wäre kurzsichtig,
eine Mitwirkung des Senders im Hörer nur dort zu vermuten, wo
faktische Artikulationsbewegungen nachweisbar sind; kurzsichtig,
wenn man die motorische Ausführung im Rahmen des allgemeineren
Resonanzphänomens, das ich im Auge habe, zu stark unterstreichen
wollte. Nein, es gibt auch dort noch ein zentrales Mitkonstruieren,
wo im eigenen Sprechapparat zum mindesten mit gröberen Methoden
kein muskuläres Mitsprechen nachzuweisen ist.
Wendet man diesen Grundsatz von der verschränkten Kooperation
auf die Frage der Silbengliederung eines gehörten Lautstroms
268an, so könnte ein entschlossener Vertreter der motorischen Silbentheorie
damit beginnen, daß er alles, was zu sagen ist, auszudrücken
versucht in ‚terms of motor-phonetics’. Stetson geht faktisch so
vor, und daher stammt seine scharfe Polemik gegen alle Akustiker.
Sie gewinnt die Färbung eines methodendogmatischen Kampfes;
ein überzeugter Behaviorist wie Stetson weist schon deshalb jede
Konzession in dieser Sache ab, weil er sich vor nichts mehr in acht
nimmt als vor dem gefürchteten Zurückgleiten in die vermeintlich
überholte Phase einer phänomenologischen Analyse des Tatbestandes.
Und dabei schießt die Polemik übers Ziel, schlägt die Kritik Stetsons
einige Purzelbäume, die ein anderer Psychologe dem verehrten
Fachgenossen nicht hingehen lassen darf.
Stetson will die akustische Silbenlehre widerlegen und. die motorische als
einzig sachgerecht erweisen. Was ihm vorschwebt, bleibt genau soweit denkbar
und sinnvoll, als der Resonanzfaktor im Hörer tatsächlich die Phänomene der Rezeption
bestimmt. Denn genau soweit darf man die These vertreten, daß die Silbenwelle
dem Empfänger präsentiert wird am eigenen Sendeapparat. Dort entsteht
echoartig dieselbe Welle von chest-pulses; wonach der Empfänger dem empfangenen
Vorgang nicht mehr anders gegenüber steht wie einer selbsterzeugten Silbenwelle:
er verspürt sie und kann die Silbe a von der Silbe b unterscheiden, ohne auf akustische
Diakritika angewiesen zu sein. Man nannte früher den Bereich, wo solche Unterscheidungen
statthaben, die Kinästhesis. Entschlossene Neuerer, wie J. B. Watson
und Stetson, vereinfachen ihr Konzept und argumentieren kurzer Hand etwa so:
Was ich, der Untersucher, weiß auf schwarz auf meinem Rußpapier habe, das hat
der aufnehmende Organismus auch; und darum kann er sich so, wie es die Erfahrung
lehrt, nach dem Empfang von a und b verschieden „verhalten”. Das ist die Substanz
der rein motor-phonetischen Silbenlehre Stetsons.
Objektive Daten, die man weiß auf schwarz vorzeigen kann, sind in der Tat
schlagende Argumente in der Wissenschaft. Es ist nur die Frage, ob die Aufnahmen
Stetsons ausreichen, um den vollen Tatbestand der Rezeption verständlich zu
machen. Wir werden unsere Gegenkritik nicht auf das Vorzeigen der ebenso sorgfältig
gewonnenen Kurve der Silbe Maul beschränken, sondern sind bereit, dem
Motoriker Stetson nachzurechnen, daß er einiges von dem, was die akustische
Kurve enthält, prinzipiell niemals an seinen Aktionsströmen wird ablesen können.
Wenn einiges hier prinzipiell nicht Auftretende aber in den akustischen Kurven
Sichtbare für den Sprechverkehr genau so relevant ist wie die chest-pulses, dann wird
sich jeder Verehrer der „objektiven” Analyse dazu bequemen müssen, einstweilen
das Vorgehen der Akustiker, weil es in wichtigen Punkten weiter in das Gebiet der
relevanten Momente im normalen Sprechverkehr vordringt, neben seiner eigenen
Motoranalysis zuzulassen. Mehr verlangen wir nicht. Das Ganze aber soll keine
leere Übung des Scharfsinnes sein, sondern bestimmte Einseitigkeiten in beiden
Lagern entlarven und einen Blick auf die zentralen psychologischen Probleme in der
Silbenfrage eröffnen.
Stetsons Hauptverdienst ist die Einführung der wichtigen Erkenntnis von
den ballistischen Bewegungen in die Silbenlehre; wir fordern ihn auf, dies sein eigenes
Ergebnis sorgfältig genug zu Ende zu denken. Angenommen, ich „schleudere”
269nicht Teile des Blasebalges resp. des Ansatzrohres beim raschen Silbensprechen,
sondern ich schleudere einen nicht angewachsenen freien Fremdkörper gegen ein
tongebende Saite, wie es faktisch der Fall ist bei den Klavierhämmern, dann wird
der Effekt meines Muskelimpulses von der Beschaffenheit der Saite (Material,
Länge, Spannung) mitabhängig; also niemals eindeutig und vollständig aus den
Aktionsströmen, die ich am tätigen Muskel abnehme, zu erkennen sein. Frage: Wie
verhält es sich in diesem Punkte mit den Lufterschütterungen, welche vom Stimmapparat
eines Sprechers erzeugt werden? Antwort: sie hängen genau so nicht nur
von den chest-pulses, sondern von den wechselnden Spannungen, der Höhlenbildung
usw. im Bereich des tönenden Instrumentes ab, können also niemals eindeutig und
vollständig am Saitengalvanometer, das nur Muskelströme anzeigt, abgelesen werden.
Dagegen belehren uns akustische Kurven wie die von Maul über vieles, was wichtig ist
im Sprechverkehr. Stetson müßte in seinen Kurven eine einzige Vokalanalyse
vorlegen, bevor er das Verfahren der Gegenpartei von Helmholtz bis Stumpf als
überholt betrachten dürfte; und wenn er es versuchen sollte, Vokalkurven in seinen
Aktionsströmen aufzuweisen, so gehört nur ein wenig Elementarphysik dazu,
um ihm ein glänzendes Fiasko vorauszusagen. Denn weder das schwingende Stimmband
noch irgendein anderer schwingender Teil des Stimmapparates wird ihm den
Gefallen tun, Aktionsströme vom Charakter der Vokalkurven zu liefern. Einfach
deshalb nicht, weil ihre Schwingungen genau so stromlos und autonom erfolgen wie
die einer angeblasenen toten Membran.
Nun wird uns versichert, die Vokale seien eine Luxuserscheinung im menschlichen
Sprechverkehr; denn gut geübte taube Menschen, die Gesprochenes am Mund
des Sprechers ablesen, kämen ohne sie zurecht. Ein merkwürdiges Beweisverfahren,
zu dem am Telephonverkehr der hörenden Menschen ein eleganter Parallelbeweis
von der ‚Luxuserscheinung’ der Konsonanten geliefert werden könnte (s. unten S.284),
worauf man vor dem Endergebnis stünde, daß es weder auf die Vokale noch auf die
Konsonanten ankommt. Nein, das alles ist, rein logisch beurteilt, eine Entgleisung.
Denn man kann aus dem Bestehen von Umwegen die Nichtexistenz oder Bedeutungslosigkeit
eines direkten Weges, man kann aus der Leistungsfähigkeit von Ersatzmitteln
wohl die Ersetzbarkeit, aber nicht die Überflüssigkeit des Ersetzten beweisen.
Beweisen aber kann man das faktische Hören hörender Menschen (wenn es sein
muß, auch mit behavioristischen Methoden); und daß Tische — Tasche — Tusche
kraft der gehörten Vokaldifferenz, die Stetson niemals sichtbar machen kann in
seinen Kurven, drei verschiedene deutsche Wörter sind, wird er keinem Deutschsprechenden
ausreden.
Es ist ein Schauspiel für Kenner, diesen Eiertanz der Nichts-als-behavioristischen
Bewegungsanalyse an allen Ecken und Enden der Psychologie immer
wieder aufgeführt zu sehen. In unserem Falle scheitert der Versuch, die Aktionsströme
der tätigen Muskulatur als das einzige Substrat des sprachlichen Sendeund
Empfangsvorganges im Bereiche der psychophysischen Systeme zu betrachten,
vorerst an dem schlichten physiologischen Faktum, daß der Gehörapparat different
anspricht auf Formen und Nuancen im Bereich der Luftwellen, die auf die viel
trägeren Aktionsströme der tätigen Muskeln gar nicht abgebildet werden können.
Der Umfang des Hörbaren überschreitet das, was wir mit eigenen Stimmitteln
nachmachen können, in vielen Dimensionen (Höhe, Tiefe, Intensität). Schon das
genügt, um die generelle Resonanzhypothese der radikalen Motoriker als überspannt
und unzulänglich zu erweisen. Völlig kraß aber kommt ihre Insuffizienz an den
Tatsachen der zentralen Sprachstörungen zum Vorschein, wo die Beobachtung des
270Unterschiedes von wesentlich sensorischen und wesentlich motorischen Störungen
zu den primitivsten gehört, die man machen kann 1)84.
Trotz alldem ist und bleibt das zentrale Mitkonstruieren und
das periphere Mitmachen, bleibt die Resonanz eine wichtige Tatsache.
Es gab Akustiker auf dem Gebiet der Silbenlehre, die nichts
wissen wollten z. B. von den Sieversschen ‚Drucksilben’ oder von
dem nach ihrer Meinung unklaren Begriff eines ‚Gewichtes’, das
eine Silbe haben und tragen kann im Sprechverkehr, gleichviel,
ob dieses Gewicht im konkreten Sprechfall in der Dimension der
Lautheit oder der Tonhöhe oder beider zusammen oder der aktiven
Kürze oder einer aktiv gehaltenen Länge faktisch realisiert wird.
Diese und andere Schwierigkeiten verschwinden in dem Augenblick,
wo die einseitig akustischen Analytiker sich belehren lassen. Denn
es ist faktisch so, daß in jeder Sprache gewisse Freiheitsgrade bestehen,
das Gewichtsrelief im Lautstrom der Rede bald mehr am
einen und bald wieder am anderen Momente zu realisieren. Daß
dies möglich ist und störungsfrei zugelassen wird, vermag nur der
Motoriker auf die einfachste Art und Weise zu erklären. Und der
konsequente Motoriker arbeitet, ob er es weiß oder nicht, stets mit
der Resonanzhypothese.
5. Ich wiederhole: die Silbengliederung des Lautstroms der Rede
gehört im groben zu den materialbedingten Gestaltungen und kommt
in verschiedener Weise zum Vorschein. Wie sie verwendet und verwertet
wird, vom sinnvoll Sprechenden, der die ihm vertrauten
Lautgebilde seiner Sprache aktuell erzeugt, ist wenigstens der Richtung
nach anzugeben. Die Wörter und Sätze, die er produziert,
halten sich in ihrem klanglichen Aufbau weitgehend an die natürliche,
gleichsam vorgegebene Gestaltung und prägen sie neu nicht
so radikal um, daß die natürliche Lautwelle der Silbenreihe je verschwinden
könnte. Die natürliche Lautwelle der Syllabierung
muß durchscheinen, weil das akustische Gesicht im Klangbild der
Wörter weitgehend charakterisiert ist durch ihre Ein-, Zwei-, Dreioder
Mehrsilbigkeit.
§ 18. Das Klanggesicht und das phonematische Signalement
der Wörter.
Es gibt verwickelter gebaute und einfache Sätze; es gibt
Komposita und Simplizia unter den Wörtern; der Begriff ‚einfach’
muß für jeden Bereich gesondert definiert werden, was keine Schwierigkeiten
bereitet, solange der Schlüsselsatz von der Zeichennatur
271der Sprache und das andere Axiom, daß sie ein Zweiklassensystem
von Zeichen (ein S-F-System) ist, respektiert bleiben. Der Grundsatz
von der Zeichennatur der Sprache ist berufen, die Elementenforschung
vor Stoffentgleisungen zu behüten. Es ist z. B. wahr,
daß die akustische Analyse einfache Töne als Grundton und Formanten
an jedem Vokalklang, ferner Momentan- und Dauergeräusche
an den Konsonanten zutage fördert; unwahr aber ist, daß demnach
diese Töne und Geräusche zu den sprachlichen Elementarphänomenen
gehören. Denn einfache Töne und Geräusche, gleichviel ob von
Stimmgabeln oder Stimmbändern erzeugt, haben im menschlichen
Sprechverkehr keinen Kurswert, sind Materialien wie das Papier
der Banknoten, aber keine Sprachzeichen.
Ob das gleiche gilt oder nicht gilt von den sogenannten „Lauten”
wie a und p, welche im Schriftbild eine optische Symbolisierung
erfahren, kann auf keinem anderen Wege entschieden werden als
über den Schlüsselsatz von der Zeichennatur der Sprache: Wenn
ihnen eine wohldefinierte Zeichenfunktion zukommt, so daß ihr
wahrer Name „Lautzeichen” heißen darf und heißen muß, dann
ja, sonst nein. Das logisch befriedigende Argument zu der bejahenden
Entscheidung hat erst die Phonologie erbracht, Jahrtausende
nachdem diese Phänomene als ‚Elemente’ praktisch bei
der Erfindung der Buchstabenschrift und theoretisch von den Sprachforschern
behandelt worden sind. Wir gehen in medias res und
greifen das sprachtheoretische Elementenproblem am Beispiel der
Phoneme auf.
1. Jeder handwerkstüchtige Phonologe einer gegebenen Sprache
stellt sachgerecht eine Liste der sprachlich relevanten Laute auf
und kann abzählen: im Deutschen gibt es die und die Phoneme,
sagen wir rund 40 an der Zahl. Darin liegt ebenso wenig ein Mysterium
beschlossen, wie wenn der Chemiker älteren Stils und heute
noch eine Liste der chemischen Elemente führt, worin uns alte Bekannte
wie Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Selen und unter den
neunzig oder mehr vielleicht auch einige Neulinge begegnen. Der
eine oder andere Neuling kann bei subtiler Analyse auch vom Phonologen
des Deutschen noch hinzuentdeckt werden. Wir unterscheiden
z. B. zwei Scharen von deutschen Wörtern oder Stammsilben an
der Differenz des kurzen (meist starken und) offenen e gegen das
lange (meist schwächere und) geschlossene e; oder (wie man in Anlehnung
an den Ausdruck der Instrumenten-Akustik auch sagen
kann) das ungedackte vom gedackten e; denn es gibt bekanntlich
auch offene und „gedackte” Orgelpfeifen, welche leicht unterscheidbare
272Klänge liefern, und Stumpf hat nachgewiesen, daß die übliche
Unterscheidung der Phonetiker klanglich identisch ist mit jener
anderen aus der Instrumenten-Akustik. So heben sich von einander
ab; Herr und hehr, Fell und fehl. Wie aber steht es mit dem Vokalphonem
der unbetonten Vor- und Endsilben wie in ge-(liebt) und
(liebt)-te? Wohl möglich, daß dasselbe optische Symbol noch ein
drittes Phonem symbolisiert. Das sind Feinheiten, die den Sprachtheoretiker
interessieren, aber selbstverständlich nicht im Handumdrehen
und nicht von ihm entschieden werden können 1)85.
Weitab von allen Detaüfragen hat Fürst Trubetzkoy für die
Vokalphoneme einen Systemgedanken vorgelegt, der (falls er sich
in der Empirie bewährt) an Tragweite und einleuchtender Einfachheit
dem Systemgedanken seines Landsmannes, des Chemikers
Mendelejeff, gewachsen sein dürfte. Genau solange, als man weiß
und nicht vergißt, was dort und hier geordnet wird: dort das Gesamtgebiet
der Vokalphoneme in allen Menschensprachen, hier die chemischen
Elemente. In der Chemie geht es um Substanzen mit Molekulargewichten
und chemischen Reaktionseigenschaften, in der
Sprachforschung allgemein um zeichenhafte Gebilde, und in der
Phonologie um Lautmale an Wörtern. Worin liegt letzten Endes
der Unterschied zwischen phonematischen und chemischen ‚Elementen’
beschlossen?
Man unterstreiche, wie immer sonst die Parallele aufgenommen
oder verworfen werden mag, jedenfalls das eine, daß Zeichen und
Substanzen zwei verschiedenen Gegenstandsgebieten der Wissenschaft
angehören. Die Zeichen setzen psychophysische Systeme nach
Art des menschlichen voraus. Man muß solche Systeme als Detektoren
eingesetzt denken, sonst werden Zeichen im Weltgeschehen
nicht manifest. Es ist uns gänzlich verborgen, ob im commercium
der Atome in der Retorte des Chemikers an irgend einer Stelle
Analoges geschieht wie im commercium psychophysischer Systeme.
In der Chemie entfällt für die wissenschaftliche Bestimmung
der Vorgänge der Zeichen-Faktor; in der Linguistik
dagegen ist er unentbehrlich und mit ihm das Prinzip der abstraktiven
Relevanz.273
Das Demonstrationsverfahren der Phonologen ist denkbar
trivial. Man verifiziert die These, daß im deutschen Sprechverkehr
die Vokale a — i — u als Phoneme fungieren, indem man beweist,
daß die Partner dieses Verkehrs auf Wörter wie Tasche — Tische —
Tusche different reagieren. Dazu braucht man an deutsch sprechenden
Menschen keine Experimente durchzuführen. Das Faktum eines
differenten Verhaltens ähnlicher Art muß im Zeichenverkehr der
Bienen ad oculos demonstriert d.h. an Körperbewegungen der Partner
sichtbar gemacht werden, während es die Linguisten mit ihrem
Nachweis ein wenig bequemer haben; denn jeder Deutschsprechende
bestätigt ihnen sofort, daß Tasche und Tusche zwei verschiedene
Wörter ‚sind’ Der Logiker aber darf und muß den Nachweis dort
und den Nachweis hier auf eine Linie stellen.
Das Aufzeigen des Chemikers verläuft anders; er entmischt
und isoliert mit seinen Mitteln z. B. das reine Gold, den reinen Wasserstoff
und bestimmt die Eigenschaften des (mit seinen Mitteln) nicht
weiter Entmischbaren. Genug, wenn man einsieht und zugibt, daß
eine ‚Analyse’ oder ‚Reduktion’ in beiden Fällen gefordert und zustande
gebracht wird. Die Reduktion des Chemikers ist (in dem
Bereiche, der uns hier interessiert) zu Ende geführt, wenn keine
weitere Entmischung mit den wohldefinierten Mitteln seiner Analyse
gelingt und das Isolierte sich in den entscheidenden Prüfungen und
Reaktionen als dasselbe erweist. Die Reduktion des Phonologen ist
dort zu Ende, wo die lautliche Annäherung von Wörtern, die in
einer Sprachgemeinschaft faktisch unterschieden werden, zu Ende
ist. Weiter darf ich die Angleichung nicht mehr treiben als bis auf
eine einzige Phonemdifferenz wie in Tasche — Tusche, sonst habe
ich keine lautlich unterscheidbaren zwei Wörter, sondern nur noch
ein Wort der deutschen Sprache vor mir. Daß sich dies lautlich
eine an verschiedenen Kontextstellen unter Umständen als mehr
denn eines ausweist (wie ‚liebe’ in ‚ich liebe’ und ‚die Liebe’), ist
ein Faktum, welches nicht in das Blickfeld des Phonologen gehört,
sondern andere linguistische Analysen fordert.
Das ist eigentlich alles, was wir vorerst in unserem Tatsachenbericht
brauchen. Der Chemiker denkt seine Befunde aus und findet
einen systematischen Halt für sie in der Idee von der atomistischen
Struktur der Materie. Mit Molekülen und Atomen rechnet man schon
lange, und Mendelejeff vermochte die Gesamtheit der bekannten
chemischen Elemente in einfacher Art zu ordnen durch seine geniale
Aufbauidee; die Hypothesenbildung ging in derselben Richtung um
mehrere Schritte weiter, als die damals letzten d. h. kleinsten oder
274einfachsten Komponenten als Produkte von noch einfacheren erkannt
wurden. Wie steht es mit den Phonemen? Wir haben in
der Psychologie eine Ära des atomistischen Denkens hinter uns
gebracht und könnten bei Gelegenheit einer sachgerechten Analyse
der Sprachlaute noch einmal besonders einleuchtend und einfach
den Beweis erbringen, daß das ältere atomistische Denkmodell in
der Psychologie sachwidrig ist und den Zeitgenossen von E. Mach
und Wundt an vielen Stellen das Konzept verdorben hat. Das
wäre aber heute eine befreiende Kritik post festum. Wichtiger ist
es, den neubeschrittenen Weg der phonologischen Analyse als ein
Verfahren zu erkennen, welches für weite Aufgabenkreise der Analyse
intersubjektiven Geschehens vorbildlich zu werden verspricht
und zu einem neuen Elementenbegriff führt. Hat einer dies Neue
voll begriffen, dann erkennt er nachträglich, daß es nicht in jeder
Hinsicht ganz neu ist, sondern mit vielem, was schon im Altertum
und seitdem immer wieder neben den Urstoffen ‚elementum’ genannt
wurde, verwandt ist 1)86.
2. Der Wortschatz einer Sprache wie des Deutschen enthält
viele tausend Lautbilder, die sich im Interesse eines eindeutigen
Sprechverkehrs genügend scharf voneinander abheben müssen.
Wenn der Psychologe zusieht, wie dies geschieht, so findet er im
Grunde dieselben Mittel, die ihm von andern Gebieten her vertraut
sind. Angenommen ich muß ebenso viele Menschen, wie es Lautbilder
in meiner Sprache gibt, auseinanderhalten und wiedererkennen,
so kann dies in gewissen Grenzen ohne sonderliche Zurüstungen
und wohlausgearbeitete Hilfsmittel geschehen; ich erkenne
Hunderte von näheren Bekannten am Gesicht oder Wuchs,
an eigenartigen Bewegungen oder an der Stimme. Und das heißt
begrifflich gefaßt: an Komplexcharakteren, um die ich mich nicht
besonders zu bemühen brauche, weil sie mir im Verkehr wie von
selbst aufgehen und behalten werden; sie entstehen jedenfalls vielfach
ohne eine nachweisbare Aufgliederung in Sondermomente.
Erst über den Kreis der leicht unterschiedenen engeren Bekannten
hinaus bedarf es der Intervention besonderer Kennzeichen,
die man dann und wann zu einem ‚Signalment’ zusammenstellt
und unter erschwerten Erkennungsumständen so verwertet, wie das
schon die Magd des Odysseus getan hat, als sie bei der Fußwaschung
ihren Herrn nach 20 Jahren am Signum einer Narbe identifizierte 2)87.
275Nun angenommen, ich hätte statt der Menschen einige Tausend
Hühnereier zu unterscheiden, so könnte ich etwa so vorgehen,
daß ich Erkennungszeichen auf ihnen künstlich anbringe. Der
Sparsamkeit und eines Vergleiches wegen, der mir für später vorschwebt,
wähle ich Farbtupfen und bestimme, daß drei Tupfen auf
jedem Ei angebracht werden. Wenn ich diese Tupfen jedesmal in
eine Reihe bringe und auch die Reihenfolge (etwa von der Spitze
weg) zur Charakterisierung mit verwerte, so kann ich ausrechnen,
wieviele verschiedene Einzeltupfen, notae, dazu notwendig sind.
Mit 16 Elementen kann man 4096 Dreierkombinationen bilden.
Die Anzahl der Lautmale (Phoneme) einer Sprache wie der deutschen
ist rund geschätzt vielleicht dreimal so groß wie die hier benützte
Anzahl der 16 Farbtupfen.
Die Wortbilder einer Sprache haben beides, ein (akustisches)
Gesicht vergleichbar dem (optischen) Angesicht, dem Wuchs oder
Gang der Menschen und ein Signalement wie meine gezeichneten
Hühnereier. Nur daß ihnen dieses Signalement nicht nachträglich
und von außen her aufgeprägt, sondern bei der Entstehung im menschlichen
Sprechapparat schon eingegeben wird. So ist es eben oder
kann es sein bei der Herstellung von dinglichen oder ereignishaften
Produkten, die keinen anderen Beruf und keine andere Existenzberechtigung
in der Welt haben, als den einzigen als Zeichen zu
fungieren. So ist es bei den Produkten des menschlichen Sprechapparates,
daß sie durch und durch auf ihre Zeichenfunktion hin
angelegt und hergestellt werden. Als flatus vocis sind die konkreten
Sprechprodukte minimale Energiequanten, die nur passend abgestimmte
Empfangsapparate zum Mitschwingen bringen und im
übrigen zu nichts anderem tauglich sind. Nicht einmal eine Kerzenflamme
wird man normalerweise durch sie in grobsichtbare Unruhe
versetzen oder ausblasen; sie vertragen auch vorzüglich eine
Hin -und Rückverwandlung in die elektrische Wellenform und dokumentieren
dabei noch einmal ihre Zeichennatur.
‚Gesicht’ und ‚Signalement’ sind bildhafte Namen für zwei,
nicht für eine und dieselbe Methode, ihre Diakrise zu garantieren,
denn das ‚Gesicht’ in unserem Sinn gehört zu den Gestaltern und
das Signalement der Natur der Sache nach entweder ganz oder
weitgehend zu den ‚Undverbindungen’. Wozu die zwei Unterscheidungstechniken
? Was wir beschreiben, mutet an wie eine
276jener mehrfachen Sicherungen, die man im Bereiche der organischen
Gebilde allenthalben und von da aus nachgeahmt auch
im Bereiche der irgendwie gefährdeten oder gefahrbringenden technischen
Geräte findet. Ob dieser Ersteindruck bestehen bleibt oder
späterhin korrigiert werden muß, ist eine vorerst offene Frage, die
wir nicht beantworten können. Jedenfalls aber gehört es nicht zu
dem Allerselbstverständlichsten, daß ein menschlicher Stimmapparat
als Sender einige Zehntausende kurzer Lautbilder so wohlgeprägt
erzeugen kann, daß jedes der Tausende von einem menschlichen
Hörapparat als Empfänger mühelos als das und das erfaßt
und von allen anderen unterschieden wird.
Das Gesicht, von dem wir sprechen, geht nahezu verloren
und wird fadenscheinig bei der optischen Symbolisierung der Wortbilder
in unserer Druckschrift, das Signalement dagegen bleibt mehr
oder minder gut erhalten. Als die Psychologen vor vierzig Jahren den
ersten Vorstoß machten zu einer modernen Analyse der Prozesse
des Lesens von Druckschriften, war dies der erste Punkt, über den
sie sich nicht sofort zu einigen vermochten, ob das gedruckte Wortbild
am Gesicht oder am Signalement erkannt wird. B. Erdmann
und Dodge waren Vertreter einer Gestaltstheorie, sie nannten das
Entscheidende die optische ‚Gesamtform’, während Wundt die
Gegenthese verfocht, daß das Wortbild am Signalement der ‚determinierenden
Buchstaben’ erfaßt wird. Die Diskussion verlief damals
im Sand und verdient heute nicht mehr so unzulänglich, wie sie
geführt wurde, erneuert zu werden. Wohl aber verdient das feinere
Fingerspitzengefühl Wundts im Rückblick volle Anerkennung.
Denn das ist in der Tat das tragende Prinzip jeder Buchstabenschrift,
daß versucht wird, die Signalement-Charakteristik des akustischen
Wortbildes unter Zurückstellung des Gesichtes optisch wiederzugeben.
Wir versuchen in der Schrift die Phoneme optisch zu
symbolisieren. Daß die abzählbaren optischen Phonemzeichen eines
gedruckten Wortes (enggeschart und als eine Gruppe oder Grüppchen
durch Spatien von den Nachbargruppen getrennt) eine gewisse
Gesamtform ergibt, ist selbstverständlich und unvermeidbar,
aber nicht das primäre Ziel des Verfahrens. Der geübte Leser verfährt
gewiß sehr summarisch und nützt die häufiger wiederkehrenden
Gesamtformen, die er global erfaßt; daran hat kaum je ein Sachverständiger
gezweifelt. Die entscheidende Frage ist, ob das Verfahren
der Buchstabenschrift seinen Namen zu Recht oder Unrecht
trägt, ob es primär auf eine systematische Wiedergabe
des Signalements am akustischen Wortbild oder auf etwas anderes
277abzielt. Und darin steht Wundt auf der siegenden Partei; es ist
die Phonologie, die ihm zu Hilfe kommt.
Man begegnet, wo das Thema ‚Buchstabenschrift und Phonologie’
verhandelt wird, dem Hinweis auf die Tatsache, daß die
optische Symbolisierung und das Aussprechen so disparat sein können
wie z. B. im modernen Englisch, wo bisweilen Oxford geschrieben
und Cambridge gesprochen wird (man denke an Wörter wie lawyer
oder laugh). Worauf zu erwidern ist, daß solche Diskrepanz erstens
in der Einschätzung oft stark übertrieben wird und zweitens kein
Argument gegen das Fundament der phonologischen Betrachtungsweise
liefert. Denn der tragende Grundgedanke ist (und er
bleibt richtig), daß eine Signalement-Symbolik schlechthin undurchführbar
gewesen wäre ohne einen natürlichen Halt des Verfahrens
im akustischen Wortbild selbst. Wie vollständig und wie
adäquat eine solche Signalement-Symbolik sein muß, um das Lesen
und Schreiben nicht übermäßig schwierig zu machen, ist eine durchaus
sekundäre Frage. Im übrigen verschwinden derart nur halbausgedachte
Einwände vor den wirklichen Erfolgen der Phonologie.
3. Es war ein ausgezeichneter Gedanke, die Sprachgebilde
vom Gesichtspunkt der Diakrise zu untersuchen. Bewährt er sich
am Lautbild der Wörter, dann wird man mit gleichem Erfolg die
Unterscheidungskriterien der Sätze erforschen. Hier ergibt sich
auf den ersten Blick, daß Gestaltmodulationen wie Satzmelodie
und Satzakzent diakritisch fungieren und eine Aussage zur Frage
oder zum Befehl verwandeln können. Folglich muß die Besinnung
rückwärts auf die gleichen Gestaltmomente am Klangbild des Wortes
gerichtet werden. Es wäre verhängnisvoll einseitig, wenn man am
Wortbild vor lauter Bäumen den Wald übersähe; in Sachen der
Diakrise sind Phoneme die Bäume und die Klanggestalt des Wortes
ist der Wald. Wir richten in der Elementarlehre unsere Aufmerksamkeit
zuerst auf die Bäume und ordnen die Zeichenfunktion der
Phoneme in eine große, wohlbekannte Klasse von Zeichen ein. Die
Phoneme gehören zu der Klasse der Marken, Male, Kriterien, Notae;
sie sind Lautmale am Klangbild des Wortes und bilden das Pendant
zu den Dingmalen, die man in der Logik von jeher gekannt und als
Merkmale, lateinisch ‚notae’, charakterisiert hat. Wir reproduzieren
das Schema der Nennwörter, der (sprachlichen) Begriffszeichen, und
unterstreichen noch einmal ihren spiegelbildlichen Bau:
image278
Der schraffierte kleine Kreis symbolisiert die Gesamtheit der
diakritisch relevanten Momente am Wortbild genau so wie das
schraffierte kleine Quadrat die Gesamtheit der begrifflich erfaßten
Momente am Genannten der Nennwörter symbolisiert. Daß zu den
relevanten Momenten am Wortbild elementare Lautzeichen, d. h.
Phoneme gehören, ist die konstitutive These der Phonologie; wir
lösen also in ihrem Sinne den vorher einheitlich schraffierten kleinen
Kreis symbolisch so auf: image und übersetzen das Bild
in den Satz, daß an jedem Wortklang eine angebbare
kleine Anzahl von Lautmalen diakritisch relevant
ist; es sind nicht exakt aber angenähert ebenso viele und angenähert
dieselben, welche in der Buchstabenschrift optische Symbole erhalten
haben.
Das ist eine Auffassung vom Bau der Wortbilder, um die
es lohnt zu diskutieren. Ich habe es schon einmal getan in dem Aufsatz „Phonetik
und Phonologie” und will jetzt die Gedanken so
anordnen, daß das dort am Ende Stehende zuerst gesagt wird. Präludierend
sei erinnert an die früher von uns kritisierte Hypothese:
Am Anfang waren die Wörter lautmalende Klangbilder. Gleichviel ob
das allgemein richtig ist oder nicht, so gibt es jedenfalls heute noch
malende Wörter, an denen man studieren kann, wie sich in ihnen
die Phoneme verhalten. Wilhelm Oehl stößt bei seinen Analysen
völlig sachgerecht auf den Tatbestand der „Lautcharakteristiken”;
er findet z. B. die Gutturalcharakteristik oder Dentalcharakteristik
oder Zischlaute einzeln oder kombiniert in bestimmten Wortklängen,
die er danach als Schallwörter anspricht. Hier ist es so, daß eine
nota oder mehrere notae des Klangbilds eine bestimmte nota oder
mehrere des Genannten malend wiedergeben. Soweit die von da
aus konzipierte Ursprungshypothese richtig ist, waren die Klangmale
des Wortes einst Wiedergaben von Dingmalen. Es interessiert
uns hier nicht mehr, ob und wieweit sie richtig ist, sondern daß sie
eine bequeme Ausgangsfiktion liefert; eine Fiktion, auf deren
Hintergrund die faktischen Verhältnisse ein klares Relief gewinnen
und durchsichtig werden.
Heute ist es so, daß keine der bekannten Menschensprachen
eine unbestimmte Menge von Lautcharakteristiken in ihren Wortklangbildern
zuläßt, sondern jede Sprache verwendet nur eine begrenzte,
angebbare Zahl, ein mehr oder minder wohlgeordnetes
System von Lautcharakteristiken; die üblichen Lehrbücher überschreiben
die Liste einfach mit „die Laute”. Daß niemand mehr
gibt als er hat, bedarf keiner Begründung; die Sprachen aber nützen
279weniger aus als sie haben, und das bedarf einer Begründung. Man
lese bei einem der besten Kenner der kaukasischen Sprachen, bei
Trubetzkoy, nach, wie dort phonetisch ungefähr die gleiche
Fülle von Vokalnuancen vorkommt wie im Deutschen. Nur daß
nicht die gleiche Anzahl von Vokalphonemen wie im Deutschen
am Wortschatz aufzufinden ist; die kaukasischen Sprachen sind
phonetisch nicht ärmer an Vokalnuancen als das Deutsche, wohl
aber phonologisch, d.h. unter dem Gesichtspunkt der diakritischen
Verwendung ihres Reichtums. Sie sind ungeheuer subtil im diakritischen
Einsatz der Konsonanten und äußerst sparsam mit Vokalcharakteristiken,
wo es auf die Diakrise der Wortbilder ankommt.
Paare wie Felge — Folge, Vater — Väter, Hummel — Himmel wären
in ihrem System ungetrennte Wörter. Genug; wir reproduzieren
den erlösenden Systemgedanken Trubetzkoys in Kürze so:
Man ordne die Vokalklänge in einem Dreieck an „so, wie es
bereits 1781 der junge Mediziner Hellwag angegeben hat” (Stumpf);
diese Ordnung ist neuerdings von Stumpf phänomenologisch
subtil als treffend nachgewiesen worden:
Die Dimension von links nach rechts (z. B.
u — ü — i, o — ö — e) heißt Helligkeit,
die Dimension von unten nach oben heißt
Sättigung; nicht dargestellt ist das lang
— kurz oder stark — schwach und ein
letztes Attribut, die „Intonation”, d. h.
ein Auf oder Ab der Tonhöhe des Vokal-
klanges während seines Verlaufes. Es gibt
image
Fig. 8.
nun Sprachen nach Trubetzkoy, die nur Sättigungsdifierenzen und
sonst nichts diakritisch verwerten. Sie haben das einfachste, eindimensionale
System von Vokalphonemen. Wo außer der Sättigung
nur noch die Helligkeit diakritisch verwendet wird, liegt ein zweidimensionales
System vor. Wir im Deutschen und in vielen anderen
indogermansichen Sprachen haben ein dreidimensionales System,
weil wir als dritte Dimension das lang — kurz (korrelativ mit geschlossen
— offen) verwenden. Andere dreidimensionale Systeme differenzieren
nach stark — schwach. Nach einer von Jakobson gefundenen
Regel benützen die meisten Sprachen phonologisch nur eines
von beiden; eine Regel, von der nur wenige Ausnahmen bekannt sind,
wo (wie im Deutschen und Englischen) beide Momente (Dauer und
Intensität) unabhängig voneinander relevant werden können 1)88.
280Und schließlich gibt es auf der letzten Komplexionsstufe noch
Sprachen, die außer allem Vorausgehenden auch noch melodische
Varianten zum Aufbau ihrer besonders reichen, vierdimensionalen
Systeme von Vokalphonemen ausnützen. Das ist in wenigen
Sätzen das Skelett der Trubetzkoyschen Theorie 1)89.
Der einfache und durchsichtige Systemgedanke Trubetzkoys
ist sprachtheoretisch von größter Tragweite. Wir lassen der Einfachheit
halber die schwierigere Aufgabe einer ähnlichen Ordnung der
Konsonanten aus dem Spiel und halten uns nur an die Vokale. Es
sei noch einmal an die Idee Mendelejeffs zum Vergleiche erinnert.
Dort galt es die Atomgewichte der chemischen Elemente
zu ordnen, und es stellte sich heraus, daß sie eine diskrete Reihe
bilden, die einem merkwürdigen Zahlengesetz folgt. Hier setzte das
Nachdenken der theoretischen Chemie ein und führte zu den bekannten
Erfolgen in Sachen des Aufbaus der chemischen Elemente
und schließlich der Materie überhaupt. An den Wortbildern der
Menschensprachen wird die Vokalisation ins Auge gefaßt; es stellt
sich auch bei ihr eine durchsichtige Ordnung heraus, wenn man den
Gesichtspunkt der Diakrise zur Geltung bringt, sonst nicht. Es
stellt sich heraus, daß zunehmend Stufe für Stufe die genannten
vier Dimensionen des Vokalreiches diakritisch relevant werden. Folglich
wird das theoretische Nachdenken an diesem Punkte einzusetzen
sein. Omne verum simplex. Greifen wir also selbst die Dinge an
diesem Punkte auf.
In Schallwörtern wie surren — knarren — klirren tragen die
Charakteristiken u — a — i zur Wiedergabe des Genannten bei.
Lassen wir die Maltheoretiker, welche mit ihren Forschungswünschen
an die ungeklärten Ursprungsfragen fixiert bleiben, vorerst ungestört
bei der Hypothese, so wie hier sei es am Anfang überall
gewesen. Mag sein, daß in Urzeiten ein freies oder freieres Malen
stattfand. Aber heute ist es überall so mit den Vokalen wie in der
Heraldik mit den Farben. Eine ordentliche Heraldik läßt nur bestimmte
Farben zu und eine ordentliche Sprache nur bestimmte
Vokalphoneme. Die kaukasisch sprechenden Menschen müssen sich
281mit drei Stufen der Sättigungsdimension begnügen, wo wir Deutschen
unter Mitverwertung der Helligkeit (u — ü — i, o — ö — e) acht und
unter Mitverwertung von kurz—-lang schematisch berechnet sechzehn
zur Verfügung haben (die Diphthonge bleiben dabei ungezählt).
Der Seitenblick auf die Heraldik ist uns nicht aus Versehen
passiert; denn dort ist es auch so, daß es ärmere und reichere Systeme
gibt, dort ist noch manches andere so wie in der Sprache.
Solange es gilt, mit Farben auf einer Malfläche nichts anderes als
eben die bunte Welt der Dinge einzufangen, wäre jede Beschränkung
der Nuancen nichts als Schikane und Selbstverstümmelung.
Solange es galt oder gilt, durch Vokale Dingcharakteristiken wiederzugeben,
wäre jede Beschränkung genau dasselbe. Wozu ein kleines
System diskreter, abzählbarer, privilegierter Einheiten dort und
hier? Das hat noch keiner aus der kleinen Gruppe der Nichts-als-Maltheoretiker
zu sagen gewußt. Das symbolfreudige Mittelalter
dagegen wußte genau, warum seine Heraldiker die Wappenfarben
beschränkten und auf ein System zu bringen trachteten. Weil kombinatorisch
aus Farben (und anderen Elementarsymbolen) eine Anzahl
wohlcharakterisierter und leicht zu erkennender Wappen aufgebaut
werden sollten. Die Vokale sind ebenso (in Kooperation
mit den Konsonanten) berufen, in bestimmter Kombination den
Wortbildern ein Signalement zu geben. Sie müssen zu diesem
Behufe wie alle Zeichendinge selbst jedes einzelne als das und das
erkennbar, d. h. diakritisch genügend scharf von den anderen getrennt
und abgehoben sein. Dazu das System und dazu die Beschränkung
auf eine kleine, übersehbare Anzahl.
Nur muß, wenn auf dem Wege des Signalementverfahrens der
Horizont eines mühelosen Wiedererkennens auf Tausende von Einheiten
erweitert werden soll, eine zweite Bedingung erfüllt sein,
die man nicht aus dem Auge verlieren darf; man kann sie als Psychologe
der aufstrebenden Phonologie unserer Tage nicht oft genug
ins Merkbuch schreiben. Es ist die einfache Tatsache, daß kein
Mensch imstande ist, Tausende von Gebilden, die wie die Eier in
unserem Exempel einzig durch Notae-Kombinationen charakterisiert
wären, praktisch so spielend, schnell und sicher auseinanderzuhalten,
wie das jeder normal geübte Partner einer Sprachgemeinschaft
mit den Klanggebilden der Wörter fertig bringt. Das ist
eine Behauptung, welche ich, zwar nicht experimentell bewiesen
habe, aber aus der Analyse des Wiedererkennens beim Lesen und
vielen anderen Daten ableite; ein Faktum, das wie andere erkannt
und respektiert sein will und auf die weitgehende Mitwirkung des
282akustischen Gesichts der Klangbilder bei ihrer Diakrise hinweist. Die
Phonologie von heute löst die Aufgabe einer systematisch aufgebauten
Diakrisenlehre nur im ersten Schritt und wird beim zweiten zur
Gestaltpsychologie in die Lehre gehen müssen. Dazu das Folgende.
4. Von der rezenten Sprache aus gesehen sind die Lautcharakteristiken
der nichtmalenden Wortbilder keine direkten Gegenstandszeichen,
sondern Lautmale, die nur die Funktion der internen Differenzierung
unserer Wortbilder erfüllen. Wenn man ein Wortbild
lautlich zerstückelt, so verraten die disjecta membra als solche so
gut wie nichts von den Eigenschaften des Genannten. Erst wenn
das Klangganze eines Wortses gegeben und genügend eindeutig
charakterisiert ist, kann jenes „Aufspringen” seiner Bedeutung
stattfinden, das indische Sprachtheoretiker schon erwähnen und
mit dem Sichöffnen einer Blume poetisch vergleichen; sie nennen
es den ‚Sphota’, das Aufplatzen 1)90. Es sind in der Tat mitunter auffallende,
aufleuchtende Erlebnisse, von denen jeder, der sich allmählich
lernend in einer Fremdsprache zurechtfinden muß, von denen
auch ein Psychologe, der Sprachvorgänge an sich selbst und an
Patienten mit zentralen Sprachstörungen beobachtet hat, anekdotenhaft
recht viel erzählen könnte. Das mühelose Verstehen einer
Rede aber geht ohne so herausgehobene Erlebnisse vor sich. Wir
merken in der Regel nichts von einem serienartigen inneren Aufplatzen;
das müßte ja bei Gelegenheit einer schnellen Rede förmlich
ein inneres Maschinengewehrfeuer sein. Und gerade das wäre ein
denkbar schlechtes Gleichnis für das wirkliche Geschehen. Wie
ist es also?
Nach meiner Erfahrung ist es bei der Auflösung verwickelter
psychophysischer Tatbestände zweckmäßig, zuerst besinnlich um
das Dorf herumzugehen, bevor man einen methodisch wohlüberlegten
Angriff wagt. Wie groß ist denn die Schar der Wortbilder,
die ein Durchschnittssprecher und -hörer im Alltagssprechverkehr
mühelos und auf Anhieb unterscheidet? Sind es Zweisilber, Dreisilber
usw., dann kommt ihm natülich das wichtige Moment der
Silbengliederung zu Hilfe, mit dem wir uns schon beschäftigt haben.
Wie steht es mit den Einsilbern, den selbständigen und denen, die
man vermutlich, weil es Sinnsilben sind, obwohl eingebettet in
größeren Wortklängen, doch hinreichend richtig aufnehmen muß?283
Erste Frage: wie viele phonematisch verschiedene autosemantische
oder synsemantische Sinnsilben gibt es überhaupt im
Deutschen? Antwort: es dürften in der Hochsprache eines erzählenden
Schriftstellers, es dürften in Goethes Wahlverwandtschaften
jedenfalls mehr als zweitausend, vielleicht gegen dreitausend
bis viertausend sein 1)91. Die nächste Frage lautet: in welchem Ausmaß
variieren im Sprechverkehr die Umfeldbedingungen dieser
einsilbigen Klanggebilde? Wichtig ist in vielen Fällen das sympraktische,
in anderen wieder das synsemantische Umfeld oder beide zusammen.
Daß es für das Auf fassen nicht gleichgültig ist, ab ein Wortklang
isoliert oder im Kontexte geboten wird, ist vor jeder genaueren
Untersuchung aus Alltagserfahrungen zu entnehmen. Wir hören
Gesprochenes aus größerer Entfernung oder durchs Telephon und
stellen fest, daß textlich isolierte Lautgebilde einer exakten Auffassung
große Schwierigkeiten bereiten, während die textlich systemgetragenen
noch spielend und exakt erfaßt werden. Die Kontexthilfen
schränken also die Spielräume des Möglichen so weit ein, daß
der (trotz Abschwächung respektive Verzerrung noch verbleibende)
Restbestand von Charakteren für die Diakrise genügt.
Theoretisch fruchtbar aber wird dieser Tatbestand deshalb, weil
wir einigermaßen exakt angeben können, welche Momente und Konstituenten
des Lautgepräges unter den genannten Umständen zuerst
und am meisten der Abschwächung, Verwaschung und Verzerrung
unterliegen. Es sind akustisch gesprochen die Geräusche, phonetisch
gesprochen die Explosionslaute, welche allem anderen voraus alteriert
werden. Bei wachsender Entfernung vom Sprecher wird rasch
die Grenze ihrer Tragweite überschritten, das Telephon schwächt
und verzerrt sie. Widerstandsfähiger sind in beiden Fällen die Vokalklänge
und mit ihnen, an sie gebunden, bestimmte wohlcharakterisierte
Komplexcharaktere (Gestaltqualitäten), z. B. die Melodie, d. h.
das Stimmhöhenrelief des Lautstroms, weiter das rhythmische Gepräge
(stark — schwach, kurz — lang), und schließlich die Helligkeitsund
Sättigungswellen der Vokalität. Tatsache ist, daß diese Komplexcharaktere
zusammen oft schon genügen, um die herabgesetzten
diakritischen Anforderungen zu erfüllen. Die Wortbilder werden
284dann vorwiegend an ihrem akustischen Gesicht und keineswegs
allein an ihrem Signalement erkannt 1)92.
Ähnlich werden die Ansprüche der Diakrise herabgesetzt, wo
das Klangbild eines Wortes empraktisch eingebaut ist. Man denke
an die übliche Grußformel (guten Morgen), wo zwei sich begegnen;
und über sie hinaus an alle jene Äußerungen, die man unter dem
Sammelnamen Ellipsen vielfach wie lästige Abfälle der menschlichen
Rede behandelt findet. Alle diese empraktisch eingebauten
Wörter und Satzfetzen degenerieren, was die Artikulation angeht,
mitunter so stark, daß faktisch nur noch ein verwaschenes Geräusch
oder Gemurmel bleibt, und werden trotzdem nicht mißverstanden.
Genau so ist es beim Wiedererkennen vertrauter Menschen, Tiere,
Gebrauchsgegenstände in den üblichen Lebenssituationen, daß irgendein
Komplexcharakter oder Einzelzug hinreicht, um sie zu identifizieren.
Man unterschätze die theoretische Tragweite dieser Dinge
nicht! Es gibt einige Beobachtungen an Kindern und Tieren, welche
beweisen, daß es ursprünglich beim Auffassen der menschlichen
Lautsignale nur auf dieses oder jenes Komplexmerkmal ankommt.
Dem dressierten Hunde sind wohlartikulierte Lautbefehle seines
Herrn Geräuschfolgen, die vielleicht und in erster Linie an dem,
was wir Betonung und Satzmelodie zu nennen pflegen, unterschieden
werden. Kann sein, daß da und dort auch ein einzelner Klang entscheidend
ist wie in den oft zitierten Beobachtungen von Preyer
und Lindner an Kindern 2)93. Von daher gesehen imponieren die
285empraktisch verschwommenen Klangbilder als Erscheinungen, an
denen viel zu erkennen ist. Wer der lex parsimoniae vertraut, darf
vermuten, daß die Schärfe der lautlichen Prägung nur in dem Maße
garantiert erscheint, als sie im normalen Sprechverkehr unerläßlich
ist. Und noch einmal wird an den empraktisch. eindeutigen Äußerungen
klar, daß ein Minimum diakritischer Ansprüche am bequemsten
vom Klanggesicht der Lautgebilde erfüllt wird.
5. Trotzdem bleibt die phonologische Analyse der Sprache
eine befreiende Tat. Das Phänomen des klingenden Wortes ist ein
Kontinuum und kontinuierlicher Nuancierung fähig in unabsehbar
vielen Dimensionen. Wir beginnen mit dem gröbsten durch Erwähnen
der Geschlechtsunterschiede menschlicher Stimmen: Männer-,
Frauen-, Kinderstimmen sind verschieden, und jedes Wort klingt
anders im Munde eines Mannes und eines Kindes. Das geht so weit,
daß die Sprechstimme einiger Dutzende von Menschen um mich
herum zu dem gehört, woran ich die Individuen identifiziere. Es
sind also physiognomische Züge im Klangbild eines Wortes, die wir
beachten und im Sprechverkehr ausnützen. Die Sprechstimme ist
weiter ein seismographisch fein ausschlagendes Ausdrucksorgan;
wir notieren oft an ihr, wir notieren manchmal am Klangbild des
einzelnen Wortes, wieviels geschlagen hat im Sender. Das Klangbild
ist also pathognomisch aufschlußreicher Modulationen fähig 1)94.
Doch all das darf jenen Inbegriff konstanter Momente, an denen
die Sprechpartner einer gegebenen Sprache die linguistisch erfaßbaren
Einheiten (wie sie im Wörterbuch verzeichnet stehen) wiedererkennen,
nicht stören; darf sie überhaupt nicht oder jedenfalls nicht soweit
entstellen, daß ihre Diakrise unmöglich würde. Der soziale Beruf
der Klangbilder im intersubjektiven Austausch fordert kategorisch
einen bestimmten Grad von Uniformität. Wie also bringt die deutsche
Sprache das Kunststück fertig, für die paar tausend Einsilber, die
in ihrem Wortschatz als auto- oder synsemantische Einheiten vorkommen,
ebensoviele differente Lautuniformen herzustellen, von
denen jede für sich wieder ungezählte Spielräume für all die zwar
linguistisch irrelevanten, aber für bestimmte Belange des konkreten
Sprechverkehrs doch sehr wichtigen und faktisch ausgenützten
physiognomischen und pathognomischen Eigenheiten offen läßt?
Die Phonologie erklärt, das sei eine Aufgabe, welche die Sprache
in sehr einfacher Weise mit Hilfe ihres Systemes einfacher Zeichen,
der Laut-notae oder Phoneme, löst.286
Und damit wird sie recht behalten. Ich habe vor kurzem
jene andere Sprache des Menschen und der Tiere studiert, die man
Pantomimik und Mimik zu nennen pflegt; man denke noch nicht
an die künstlichen Symbolsysteme der Taubstummen, Zisterziensermönche
und der lebhaft gestikulierenden Neapolitaner, sondern an
den Fonds der allverbreiteten mimischen Erscheinungen. Was ich
sagen und an ihnen erläutern will ist dies: Nach dem Ausweis älterer
und neuerer Studien (ich denke an Piderit, Leksch und an Wiener
Befunde) ist es so im mimischen Verkehr, daß aus dem Fluß des
kontinuierlichen Geschehens im Gesicht und an den gröberen Körperbewegungen
des Menschen bestimmte fruchtbare Momente hervortreten,
herausgeholt werden. Dies Verfahren ist Bildhauern und
Malern, die menschlichen Ausdruck in Stein und Farbe fixieren,
wohlvertraut; daß es auch den Partnern des trivialen alltäglichen
mimischen Verkehrs der Menschen wohlvertraut ist, wurde bewiesen
in meinem Ausdrucksbuch. Psychologisch gesehen genau
dasselbe geschieht am Klangbild des Wortes. Der aufnehmende
Hörer gewinnt diesem Lautkontinuum bestimmte fruchtbare Momente
ab für die unerläßliche Diakrise. Das ist es und gar nichts
anderes, was man Phoneme nennt. Zu solchem Herauserkennen
fruchtbarer Momente gehört hier und anderwärts ein geläufiges
Bezugssystem. Das System der Konsonanten, die in einer Sprache
vorkommen, ist ein Teil dieses Bezugssystems. In unser Konsonantensystem
ordnen wir z. B. das Moment b gegen p oder g gegen k
oder / gegen ch platzrichtig ein. Diese psychologische Tatsache
kommt im Befunde Trubetzkoys und seiner Mitarbeiter in der
wichtigen Bestimmung von Oppositionen im Reich der Phoneme
zum Vorschein. Unter erschwerten Auffassungsbedingungen, wie
sie in meinem Sammelreferat über das Sprachverständnis und in der
Arbeit von Ruederer beschrieben werden, wird dieselbe Tatsache
an den charakteristischen Verwechslungsfehlern deutlich. Manchmal,
wenn das Umfeld günstig ist, werden die fruchtbaren Momente auch
mehr hineingehört in den Klangstrom als daß sie herausgehört werden,
so ist es z. B. am Telephon.
Zugegeben, daß damit wieder einmal an einer Sonderklasse
menschlicher Wahrnehmungen Probleme aufgerollt werden; uralte
Probleme, die seit Platon und Aristoteles nicht mehr zur Ruhe
gekommen sind und im Universalienstreit der Scholastiker in eine
Höhe philosophischer Abstraktionen hinaufgesteigert wurden, die seither
kaum wieder erreicht worden ist. Ob zum Nutzen oder Schaden
der empirischen Wissenschaft, wäre mit zwei Worten nicht hinreichend
287differenziert zu sagen. Wenn Linguisten und Sprachtheoretiker
heute von neuem den Mut fühlen, von ihrem Gebiete
aus einzugreifen in das säkulare Ringen der größten Denker um
das Abstraktionsproblem, so können sie gute Gründe dafür vorbringen.
Denn wer umzulenken versteht das alte Interesse, umzulenken den
Blick der Abstraktionstheoretiker von den Dingen weg, die genannt
werden, auf das Nennende der Nennwörter, auf die Klanggebilde
selbst, der gewinnt neue Chancen. Einfach deshalb, weil diese
Gebilde nicht nur vorgefunden, sondern auch erzeugt werden
vom erkennenden Menschen. Und zwar gerade daraufhin erzeugt
werden von jedem Sprecher einer Sprache, daß sein Verkehrspartner
jedes richtig als dies und dies Lautgebilde wiederzuerkennen und
von anderen zu unterscheiden vermag. Darin liegt die große Chance
für diejenigen beschlossen, welche das Abstraktionsproblem als
Linguisten, am Wortklang, an dem Tatbestand der Phonologie von
neuem angehen wollen.
Historisch überwunden sein müßte für alle nach der Kritik
von Meinong und Husserl der sensualistische Lösungsversuch von
Locke über Berkeley und Hume bis herab auf J. St. Mill. „Allgemeine
Vorstellungen” sind die Phoneme einfach deshalb nicht,
weil es (Vorstellungen gleich Anschauliches gesetzt) dem psychophysischen
Apparate genau so unmöglich ist, „allgemeine” Bilder
zu produzieren wie dem Maler. Die Diskussion mit solchen Thesen
von neuem zu beginnen wäre ein Anachronismus, wenn nicht
Schlimmeres. Überhaupt sollte man den Akzent nicht einseitig
auf neue Spekulationen, sondern weit mehr auf die Ausnützung
moderner Untersuchungsmethoden legen. Die Psychologie hat die
Wichtigkeit der K on s tanzmomenteim ganzen Bereich der menschlichen
und tierischen Wahrnehmungen heute voll erfaßt und ist
im besten Zuge, dem Linguisten und Sprachtheoretiker (und allen
Philosophen) eine neue Tatsachenbasis zu bereiten. Selbst der in
vielen Punkten umsichtigste Ansatz Kants, dem Helmholtz eine
Reihe seiner schönsten Erfolge in der Wahrnehmungsanalyse verdankt,
ist nur zum Teil neu bestätigt worden und zum Teil überholt.
6. Stellt man sich ein Wort von einem guten Sprecher in den
verschiedensten Affektlagen gesprochen und mit Ausdruck geladen
vor, so ändert sich das Klanggesicht des Wortes, während das diakritische
Signalement erhalten bleibt. Es gibt also im Sprechverkehr
eine Konstanz des diakritischen Signalements im Wechsel des Klanggesichts
der Wörter. Das ist ein Satz, der keinen Sachverständigen
im Feld der modernen Wahrnehmungslehre befremdet. Denn ahnliehe
288Konstanzgesetze gibt es allenthalben; es gibt z. B. eine Größenkonstanz
der Sehdinge im Entfernungswechsel, eine Farbenkonstanz
der Sehdinge im Beleuchtungswechsel und etwas, was wir selbst
im Sprechverkehr entdeckt und experimentell verifiziert haben,
nämlich die Lautheitskonstanz der Hördinge im Entfernungswechsel
(s. oben S. 77ff.). Wir fragen, ob der neue Konstanzsatz den ganzen
Tatbestand, den wir bei der Unterscheidung eines Klanggesichts
vom Signalement der Wortbilder im Auge haben, erschöpfend fixiert,
und ob die Signalementkonstanz in jeder Hinsicht etwa der Farbenkonstanz
der Sehdinge im Beleuchtungswechsel gleich zu ordnen ist.
Auf beide Fragen ist mit nein zu antworten. Denn erstens
gibt es (zum mindesten im Deutschen) auch Gestaltmomente, die
konstant bleiben müssen, wenn die Diakrise der Wortbilder im
normalen Sprechverkehr nicht entscheidend erschwert werden soll;
ich denke z. B. an die Betonungsgestalt der Wortbilder, soweit
sie dem germanischen Betonungsgesetz folgt. Wenn wir das Worterkennen
noch einmal mit dem Erkennen von Menschen vergleichen,
so entspräche die weitgehend konstante Betonung der mehrsilbigen
Wörter im Deutschen etwa jenen physiognomisch konstanten Zügen
des menschlichen Gesichtes, die sich nicht bei jedem Zornanfall
oder Angstaffekt verändern und das Wiedererkennen eines Gesichtes
erheblich erschweren, wenn sie einmal faktisch variieren.
Man verschiebe in einem deutschen Text die Akzente von den
Stammsilben der Wörter hinweg auf die Endsilben — und der Lautstrom
klingt fremd, fast unanalysierbar auch dem geübten Hörer.
Es ist eine wichtige, aber ungelöste Frage, in welchem Ausmaß die
einzelnen Sprachen Gestaltmomente am Klangbild der Wörter in
ähnlicher Art konstant halten wie wir unseren Wortakzent.
Es dürfen zweitens die Phoneme, welche das konstante diakritische
Signalement eines Wortes im Wechsel seines Klanggesichts
konstituieren, psychologisch nicht auf eine Stufe gestellt werden
mit den Farbqualitäten, welche im Beleuchtungswechsel konstant
bleiben. Denn die Phoneme stehen bei genauerer psychologischer
Analyse schon in der Wahrnehmung, in welcher wir sie erfassen,
den begrifflichen Momenten näher als den sinnlichen Qualitäten.
Doch vermag ich dies einstweilen nur indirekt zu erschließen
und verzichte darum auf eine nähere Begründung meiner These.
Wir werden wohl im Rahmen von tierpsychologischen und kinderpsychologischen
Experimenten näher an die Dinge herankommen;
sprechende Papageien produzieren und hören vermutlich kein
Signalement in den Wortbildern.289
Literaturnotiz: Trubetzkoy schreibt an einem Lehrbuch der Phonologie,
das vermutlich alles Alte und vieles Neue bringen wird. Vorher sind die (S. 281
Anm.) genannten ‚Travaux’ und der Kongreßbericht der Phonologen in Amsterdam
(I933) nachzusehen. Ferner: E. Sapir, La realité psychologique des phonèmes,
in dem Sammelband „Psychologie du langage”, Journal de Psychologie (1933),
p. 247-265. — De Groot, De wetten der Phonologie en lum betekenis voor de
Studie van het Nederlands. De Nieuwe Taalgids 25. Sehr aufschlußreich sind
die exakten Studien von Gemelli und Pastori, Psych. Forsch. 18 (1933).
§ 19. Das einfache und das komplexe Wort.
Die Merkmale des Wortbegriffes.
Der Wortschatz einer Sprache ist ein offenes System; es können
stets Neulinge erscheinen und aufgenommen werden. Zum deutschen
Wort ‚Gas’ notiert das Wörterbuch von Kluge: „eine willkürliche
Wortschöpfung des Alchimisten van Helmont in Brüssel (gest.
1644), die in alle modernen Sprachen Europas drang”. Es wäre zwar
psychologisch interessant, die Erfindungsgeschichte dieses Wortes
im Geiste Helmonts zu kennen (Chaos-Hypothese), sprach theoretisch
dagegen ist sie von geringer Bedeutung. Die gewöhnlichen Neulinge,
welche Tag für Tag angeboten werden, sind entweder wurzelechte
Ableitungen oder Bildungen anderer Art; so sprossen z. B. neue
Wörter aus dem Bedürfnis des praktischen Lebens und werden als
Warenmarken verwendet. Wörter wie Mem oder Erdal sind Warenmarken,
die wir anderen Ortes einer eigenen sematologischen Betrachtung
unterziehen wollen; Wörter wie (die) Hapag sind sprechbare
Kurzfügungen, die schlüsselartig längere Gefüge vertreten;
in meinem Duden stehen sie noch nicht. Was sonst im Duden steht,
ist ein buntes Gemisch von einfachen und komplexen Wörtern,
Grundwörtern und Ableitungen durcheinander.
Das Inventar einer Sprache an einfachen Wörtern wäre das
reine Lexikon, ein Buch, das praktisch nur geringen Nutzen hätte
und darum unverwirklicht ist. Alles, was eine konstruierbare Sinnfügung
aufweist, wäre in ihm per definitionem nicht anzutreffen;
in welchem Ausmaß doch noch einige nur teilweise auseinander
ableitbare Wörter aufzunehmen wären, bliebe einer näheren Vereinbarung
überlassen. Mag sein, man wäre geneigt, wo ganze
Scharen regelmäßiger Ableitungen vorliegen wie bei singe — Sang;
klinge — Klang, das abgeleitete Wort als neue Einheit abzulehnen,
während der erste Zweifel entsteht, wo ein (für das Sprachgefühl)
bildungsgesetzlich mehr oder minder vollständig isoliertes Exempel
auftaucht; also vielleicht schon im Angesicht von erteilen — Urteil.
Mit allem Sinngefügten fielen, wie bei uns die Dinge liegen, weitaus
290die meisten deklinierten und konjugierten Ableitungen von vornherein
aus; doch müßten, wenn man korrekt unter ‚einfach’ nicht
die Zusatzbedingung ‚selbständig’ impliziert, neben den Stämmen
der Nennwörter und Zeigwörter irgendwo und irgendwie auch gewisse
Silben und andere phonematische Modulationen vollständig
vertreten sein. Jene nämlich, die einfache Wörter in echte Komposita
verwandeln. Wenn Marty autosemantische und synsemantische
Sprachzeichen zwar unterscheidet, aber einem einzigen Gattungsbegriff
unterordnet, so trifft er dieselbe Entscheidung.
Daß die jeder Einheit des reinen Lexikons beizufügenden
Funktionserläuterungen ein gut Stück Grammatik enthalten
müßten, erscheint zum mindesten für die Verhältnisse der indogermanischen
Sprachen unvermeidbar und wäre für das Chinesische
wohl quantitativ, aber nicht prinzipiell anders; die Analyse der
Sprache zwingt allenthalben zu Abstraktionen und führt kaum
irgendwo zu Inventaren mit äußerlich rein isolierten Einheiten.
Wo solch äußere Isolierung nicht gelingt, ist man beim Demonstrieren
auf eine distinctio rationis verwiesen, was die Idee des reinen
Lexikons keineswegs annulliert, wohl aber seine Realisierung praktisch
nicht verlockend erscheinen läßt; es sei denn, daß man nur
so weit geht, wie die üblichen Wurzelwörterbücher der indogermanischen
Sprachen.
Das reine Lexikon enthält alle einfachen Wörter und nur
diese. Wir wollen die Begriffe ‚einfaches’ und ‚komplexes’ Wort
besprechen und einige triviale, aber allgemeine Sätze über sie, Sätze,
die in einer ordentlichen Kompositionslehre gefaßt sein müssen, hinzufügen.
Auch der Wortbegriff selbst verlangt eine Analyse und
Definition. Dann kommt systematisch das Phänomen der Wortklassen.
1. Da ‚einfach’ und ‚zusammengesetzt’ korrelative Bestimmungen
sind, können sie nur in Abhebung voneinander begrifflich
erläutert werden. Ich gehe, um schnell zum Ziele zu kommen, von
zwei Anwendungen aus, die bei Brugmann und Husserl zu finden
sind. Brugmann übt mit guten Argumenten am landläufigen
Begriff ‚Kompositum’ Kritik und schiebt die bekannte Erscheinung
der Tmesis (Trennung) in den Vordergrund, und zwar so,
daß man auf entscheidende Gesichtspunkte dabei aufmerksam wird.
Tmesis heißt jene im Deutschen häufige Trennung, die ein einziges
Beispiel hier in allen Abarten vertreten mag: das Kompositum
‚antreten’ wird in dem Satze ‚er tritt eine Reise an’ getrennt.
Brugmann schlägt den eigenen Namen Distanzkompositum
291für diese und ähnliche Erscheinungen vor. Unter den Beispielen
marschiert unbesehen auch das französische ‚ne — pas’; gehört es
voll berechtigt dazu?
Husserl widmet in den logischen Untersuchungen scharfsinnige
Betrachtungen der Frage nach den ‚einfachen Bedeutungen’.
Und folgendes ist knapp gefaßt das uns hier interessierende Ergebnis:
„daß es wirklich einfache Bedeutungen gibt, lehrt das unzweifelhafte
Beispiel etwas. Das Vorstellungserlebnis, das sich im
Verständnis des Wortes vollzieht, ist sicherlich komponiert, die
Bedeutung ist aber ohne jeden Schatten von Zusammensetzung”
(288); halten wir das fest: „Im Sinne (dieser Redeweise) besteht
Zusammengesetztheit aus Teilen, die selbst wieder den Charakter
vor. Bedeutungen besitzen. Es ist eben eine letzte Tatsache,
daß eine Mehrheit von Bedeutungen sich zu einer Bedeutung verknüpfen
kann” (292). Husserl sieht diese Betrachtung und diesen
Begriff des Einfachen als den „normalen Sinn” von einfach an
und scheidet davon ab die Zusammengesetztheit, welche offenbar
wird, wenn ich z. B. den Eigennamen Sokrates vor mir habe und
die Bestimmungen aufzähle, die das Individuum Sokrates vom
Individuum Platon abheben. Der Eigenname impliziere eine solche
Vielheit von Bestimmungen und weise darum in seiner Bedeutung
eine andere Art von Zusammensetzung auf „zu jeder implizierenden
Bedeutung gibt es eine andere, ihren Inhalt gliedernde oder explizierende”;
man wird zu ‚Sokrates’ in der Tat explizierend viele
Bestimmungen beibringen müssen, bevor das genannte Individuum
genügend scharf von anderen Individuen getrennt ist. Für die Bedeutung
von etwas sei dies nicht nötig, sagt Husserl, auch gar
nicht möglich, weil sie „ohne Spur von impliziertem Inhalt” sei.
„Wir werden weiterhin den normalen Sinn dieser Rede zugrunde
legen, wonach also die zusammengesetzten Bedeutungen aus Bedeutungen
zusammengesetzt sind” (293).
Das ist ein happy end, dem wir restlos zustimmen; über das
Ausgeschiedene dagegen wird uns die Verwendung des bestimmten
Artikels in den Artikelsprachen andere und klarere Aufschlüsse
bringen, als sie Husserl hier zu bieten hat. Über die einfachen
Bedeutungen entschlüpft ihm (290) die bildliche Rede, daß sie sozusagen
in Einem Pulse das Genannte treffen, gleichviel, ob Implikationen
in diesem einen Pulse enthalten sind oder nicht. Das
wahre Kompositum wird also mehrere ‚Bedeutungs-Pulse’ aufweisen.
Wir notieren auch dieses Bild zustimmend und verzichten darauf,
es aus der erlebnispsychologischen Denkweise, die anklingen mag,
292in das sprachtheoretisch geforderte Denkmodell von den intersubjektiven
Verkehrszeichen zu übersetzen.
Nun ist alles beisammen, um anBrugmanns Distanzkompositum
‚ne — pas’ die Husserlsche Frage zu richten, ob es wirklich zwei
oder am Ende nur einen „Puls” enthält; einpulsige Ausdrücke sind
keine Kompositionen. Es ist wichtig, darüber einig zu werden, daß
der sprachhistorische Hinweis auf die Tatsache, die beiden Teile
von ‚ne — pas’ seien einst isoliert-bedeutungsvolle Wörter gewesen,
nicht genügt zu einer Beantwortung der Frage, wie es heute steht
um den Kompositionscharakter. Denn auch das deutsche ‚nichts’
und viel anderes war einst komponiert und hat den Kompositionscharakter
verloren. Eine Befragung des Sprachgefühls der lebenden
Franzosen wäre gewiß von Wichtigkeit und vielleicht die letztlich
entscheidende Instanz. Doch dürfte Brugmann seine Auffassung
viel einfacher, und zwar als Kenner der indogermanischen Sprachen
aus einem allgemeinen Bildungsgesetz gewonnen haben. Es ist
zum mindesten in dieser Sprachfamilie unzulässig, eine Tmesis ohne
Pulstrennung vorzunehmen. Der Dichter Morgenstern setzt uns
gelegentlich in seinen launigen Spielereien Verstöße dagegen vor,
die absurd-belustigend wirken sollen: ‚der Architekt jedoch entfloh
Nach Afri- od- Ameriko’.
Auch dem auffallenden modernen Kurzwortbedürfnis des
Geschäftslebens, aus welchem Bildungen wie ‚Hapag’ entspringen,
wären ähnliche Verstöße schon zuzutrauen. Daß das französische
‚ne — pas’ nicht dazugehört, sondern spürbar im Rahmen des alten
Gesetzes verbleibt, dürfte Brugmann, ohne darüber Rechenschaft
abzulegen, taktsicher getroffen haben.
Gälte es nachträglich seine Entscheidung zu stützen, dann geschähe dies
wohl am besten von der Tatsache aus, daß parallel zu ‚ne — pas’ die Bildungen
‚ne — point, ne — guère, ne — que’ gebräuchlich sind, woraus sich ergibt, daß die
werdende Rede zwischen dem schon hingesetzten ‚ne’ und dem vollendenden zweiten
Teil ein Ergänzungsbedürfnis ähnlich wie sonst bei den Distanzkompositionen
entstehen läßt. Wäre es gar nichts anderes, so müßte schon dieses Ergänzungsbedürfnis
imstande sein, dem ‚ne’ einen ersten Puls zu sichern, der durch den zweiten,
nachfolgenden erst in einer von mehreren Richtungen ergänzt wird. Bedeutungslose
Wortbestandteile können im wahren Sinne des Wortes nicht kompositionsartig
ergänzt werden. Auch die Tatsache eines möglichen Fehlens des zweiten Gliedes
(nach ne) weist in dieselbe Richtung.
Solange die indogermanische Regel in Kraft ist. Das andere wäre eine
Klangkomposition und keine Bedeutungskomposition. Es hieße, den einfachen
Bedeutungspuls (die Inder sagen Sphola) über Zwischengeschobenes hinweg aufhalten,
bis am Schluß erst das volle Klangbild eines einfachen Wortes konstituiert ist.
Soweit seien die begrifflichen Erläuterungen vom Einfachen
her geführt; das Weitere erfolgt zweckmäßig vom anderen Ufer, d.h.
vom komplexen Worte aus.293
2. Ich bilde zu ‚Haus’ das eine Mal ‚Hauses’ und das zweite
Mal ‚Haustor’, von denen das erste gewöhnlich als geformtes Wort
und das zweite als Kompositum charakterisiert wird. Zusammengesetzt
im schlichten Wortsinn sind beide; ob die unterschiedliche
Behandlung, die beide in den Büchern der Linguisten erfahren, begründet
sei, verlangt nach einer sprachtheoretischen Aufklärung.
Wer die Konzeption des Feldbegriffes in unserem dritten Kapitel
mitmacht, gerät am Beispiel ‚Hauses’ nicht in Verlegenheit: das
geformte Wort trägt hier ein Feldmoment an sich. Es ist ein historischer
Zufall, daß am deutschen Wort ‚Haus’ eine phonematische
Kasuscharakteristik fehlt, lat. ‚domus’ hat sie; die nicht mehr phonematisch
kenntlichen ‚Fälle’ werden im Kontexte moderner Sprachen
eben auf andere Weise differenziert, z. B. durch die Wortstellung
im Satze oder durch eigene Formwörter. So trivial das alles klingen
mag, die Verwirrung ist groß und unheilbar, wo es vergessen wurde.
D.h. überall dort, wo man Satz und Wort, Satzfügungen und Wortfügungen
nicht mehr trennte.
Das lag freilich zum guten Teil am Zustand der vorgefundenen
Sprachen selbst und an den Aufschlüssen über ihre Geschichte.
Man braucht sich nur das geformte Verbum anzusehen und einem
‚amat’ das ‚amabat, amabit’ an die Seite zu stellen, um den im
ersten Anlauf so gesichert anmutenden Abstand des geformten
Wortes vom Kompositum der Bezweiflung auszusetzen. Die Sprachgeschichte
weist unbestritten Übergänge kreuz und quer zwischen
Wortgruppe, Kompositum und geformtem Wort nach; Sprachveränderungen
im Laufe der erforschten Geschichte veranlaßten
mit die Besten im 19. Jahrhundert zur Auflassung der begrifflichen
Grenzen zwischen Satzfügung und Wortfügung. Es ist die
Frage, ob sie den inneren Widerstand dagegen zu früh aufgegeben
haben.
Hilft das Husserlsche Kriterium des Bedeutungspulses
weiter? Es ist auffallend, wie sich dasselbe Sprachgleichnis vom
Pulse den Silbenforschern und dem großen Bedeutungsanalytiker
Husserl angeboten hat. Sollte die menschliche Rede,
von außen und von innen betrachtet, gleichförmig eine Art von
pulsiger Gliederung erkennen lassen? Der Blasebalg des Sprechapparates
pufft Silben aus, wie steht es mit den Bedeutungspulsen?
Es wäre, wie immer man über die Verhältnisse am unbekannten
Entwicklungsquellpunkt der artikulierten Menschensprache denken
mag, jedenfalls unzulässig, heute eine einigermaßen strenge Korrelation
zwischen der Silbengliederung des Lautstromes und der
294Sinnaufgliederung in Bedeutungspulse anzunehmen; denn ein einsilbiges
Klangbild kann mehr als einen und ein mehrsilbiges Klangbild
kann einen einzigen Bedeutungspuls aufweisen. Beispiel: das
Husserlsche etwas, wenn er recht hat mit der Annahme von dessen
Einfachheit, was nach den Erörterungen an ne — pas linguistisch
bezweifelt werden könnte, weil es ja Parallelen wie irgendwas, sonstwas
und etliche usw. im Deutschen gibt. Sonst wählt man andere
Exempel wie unser gibt neben Wolle 1)95. Der Silbenpuls ist also
nicht (oder nicht mehr) restlos synchron mit dem Bedeutungspuls.
Die Ausgangsbeispiele ‚Haustor’ und ‚Hauses’ weisen die in
Rede stehende Deckung auf und müssen trotzdem sematologisch auf
getrennte Blätter geschrieben werden, weil das erste Wort zwei
Symbolwerte und das zweite einen einzigen Symbolwert und ein Feldzeichen
enthält. Wie ist es in dieser Hinsicht mit ‚amabat’ bestellt?
Wer rein das in ‚amabat’ Genannte (begrifflich Bestimmte) ins
Auge faßt, weiß gute Gründe dafür vorzulegen, daß das Moment
der Zeitstufe, sonst das Moment der Aktionsart oder beider zusammen,
wenn sie in ihm enthalten sind, den Symbolwerten
und nicht den Feldwerten zuzuzählen sind. Denn in dem Satze
‚Caius amabat patrem’ regiert einzig und allein die Wortklasse
(amare) und nicht das Moment der Zeitstufe oder Aktionsart das
Feld; der Subjekts- und der Objektskasus erfüllen (logisch gesprochen)
zwei Leerstellen des Verbums amare und bleiben untangiert
vom Moment der Zeitstufe und Aktionsart. Trotzdem bleibt noch
ein Unterschied zwischen ‚Haustor’ und ‚amabat’; und dieser Unterschied
liegt darin beschlossen, daß die beiden Momente in ‚Haustor’
gleichmäßig zwei lexikalische Einheiten, Stoffwörter sind (auf
derselben niedersten Formalisierungsstufe stehen), während das
zweite Moment in ‚amabat’, das Moment der Zeitstufe oder Aktionsart,
rein logisch betrachtet, ein Formmoment ist (einer höheren
Formalisierungsstufe angehört).
Die Aktionsarten und Zeitstufen der in diesen Dingen konsequent
durchkonstruierten lateinischen Sprache bilden ein System
und das &a-Moment unseres Wortes vollzieht eine Platzbestimmung
in diesem System; es ist also in Hinsicht auf dies bestehende System
295ein Formans. Der geduldige Analytiker der Sprache darf nicht,
weil er schon einmal die Scheidung von Stoff und Form bei Gelegenheit
der Symbol- und Feldwerte nötig hatte, bei einer zweiten Gelegenheit,
wo ihm dasselbe Begriffspaar von der Sache her wieder
nahegelegt wird, versagen. Feldwerte freilich im Sinne der Satzfunktion,
also Feldwerte im Symbolfeld des Satzes, haben derartige
Formantia keineswegs deshalb, weil sie Formantia sind.
Sondern sie sind und bleiben formalisierte Symbolwerte. Wir werden
diesen Ausdruck aufnehmen in unsere Terminologie, ihn rechtfertigen
und verteidigen in der Theorie des echten (Wort-)Kompositums;
verteidigen vor allem gegen die unitarischen Tendenzen
des 19. Jahrhunderts, die, gestützt auf wichtige und unbestreitbare
historische Befunde, den Unterschied von Wort und Satz nicht
mehr gesehen haben oder nicht mehr imstande waren, ihn sachgerecht
durchzuführen.
Es ist merkwürdig, daß die als Beispiele angeführten Formantien (ba im
lateinischen Imperfektum und bi im Futurum) nicht dem Schatz der Zeigpartikeln,
sondern dem Seins-Wort (griech. φν-, deutsch bin) entnommen sind; nach einer
Regel, die das Indogermanische weitgehend beherrscht. Denn das Nächstgelegene
wäre, daß man von der meist umgeformten Origo jetzt aus das Vergangene und
Künftige zeigend markiert. Analog dem örtlichen da und dort, welches von hier
aus die räumliche Position markiert, könnte man zeitliche Positionszeigzeichen vor
und zurück erwarten. Ich höre von einem Wissenden, daß man die indogermanischen
Augmente als ursprüngliche Zeigzeichen auffaßt. Im übrigen sind auch solche
Zeig-Nennwortfügungen Komposita, während man den Begriff des (Wort-) Kompositums
unzweckmäßig stark erweitern müßte, um die rein syntaktischen Anweisungen
wie unsere Kasuszeichen auch noch als Wörter und dementsprechend
das geformte Wort Hauses als Kompositum anzusehen.
Dagegen spricht die Einsicht in den Charakter der Sprache als eines Zweiklassensystems;
es wird, um noch eine zweite Parallele zu ziehen, auch keinem
Mathematiker in den Sinn kommen, die Operationszeichen +, -, x, √ usw. den
Zahlzeichen völlig gleichzustellen. Doch sei ohne weiteres zugegeben, daß damit
wieder das analytisch unbewältigte Phänomen der Symbolfelder in den Sprachen
berührt wird.
3. Was ist also ein Wort? Ich greife eine ansprechende Definition
des Wortbegriffes von Meillet auf; sie lautet: „Zu einem
Wort gehört die Verknüpfung (association) eines bestimmten Sinns
mit einem bestimmten Lautganzen und eine bestimmte grammatische
Verwendbarkeit” 1)96. Wenn man sich vorbehält, das unter „Assoziation”
und „Lautganzes” Verstandene genauer zu fassen, so erscheinen
mir die beiden Meillet-Kriterien ausgezeichnet gegriffen;
ob man sie durch eine getrennte Zählung der beiden Kettenglieder
der Assoziation (Lautganzes und Bedeutung) zu einer Dreiergruppe
296erweitert oder nicht, ist relativ gleichgültig. Wichtiger ist die Sorge,
das Wort definitorisch gegen den Satz abzugrenzen.
Immerhin ist ausdrücklich hervorzuheben, daß nicht alle
‚Lautganze’, sondern nur solche zu den Wörtern gehören, die eine
phonematische Prägung aufweisen; Schreie und erscheinungstreu
lautmalende Gebilde, die sich dem Zwang des begrenzten Phonemschatzes
einer Sprache entziehen, sind demnach ausgeschlossen.
Umgekehrt sind die „sinnlosen Silben” und Silbenpakete der Gedächtnispsychologen
zwar phonematisch geprägt, ermangeln aber
des Assoziationsfaktors im Sinne Meillets. Wir werden zweckmäßig
statt des Undefinierten Assoziationsbegriffes eine von den im
Organonmodell der Sprache charakterisierten Zeichenfunktionen
einsetzen müssen. Ich sage im Sinne des weitesten Umfanges, den
man dem Wortbegriff geben sollte, eine von ihnen. Denn auch
Lautgebilde, die wie Angehörige eines Einklassensystems anmuten,
z. B. die im Sprechverkehr allgemein kursfähigen Interjektionen, erheben
den Anspruch, im Wortschatz einer Sprache unterzukommen.
Es ist nur die Frage, ob sie die Bedingungen des zweiten Meillet-Kriteriums
erfüllen.
Ich schlage eine erweiterte Fassung des zweiten Meillet-Kriteriums
vor. Wenn es außer dem Symbolfeld der Sprache eine
zweite Ordnung gibt, in welcher die sinnvollen Zeichen ihre Feldwerte
erhalten, dann erscheint es mir konsequent, dieses zweite
Feld bei der Definition des Wortbegriffes mit ins Auge zu fassen.
Denn nicht nur die Interjektionen, sondern im Grunde genommen
alle „indeklinablen” Zeigzeichen erhalten nicht im Symbolfeld der
Sprache, sondern im Zeigfeld ihre Feldwerte; und diese Gebilde
wird man gewiß nicht aus dem Wortschatz verbannen können. Es
geht damit das zweite Meillet-Kriterium in die weitere Bestimmung
über, daß jedes Wort feldfähig ist.
Vielleicht genügt es schon, wenn man die phonematische
Prägung und die Feldfähigkeit zusammenstellt und zusammen zur
differentia specifica des Wortbegriffes erhebt. Denn das Stehen
in einem der beiden Felder impliziert den dazugehörigen Oberbegriff,
d. h. die Forderung, daß das Klangbild ein Lautzeichen und als
solches „sinnvoll” sein muß 1)97. Ergebnis: Wörter sind die phonematisch
297geprägten und feldfähigen Lautzeichen einer Sprache. Das
Genus proximum ‚Lautzeichen’ ist aus dem Axiom von der Zeichennatur
der Sprache herüberzunehmen, das alles Nichtzeichenhafte
aus dem Bereiche von la langue ausschließt.
Man soll den Wert formelhafter Definitionen nicht überschätzen;
immerhin sind sie der Einzelforschung da und dort erwünscht
und in der vollendeten Theorie eines Wissengebietes unentbehrlich.
Ich möchte, um die in Rede stehende Definition zu
empfehlen, sie noch einmal aufbauen und auf ihre Vorteile hinweisen.
Sie verbindet das Wort mit den Phonemen und mit den
Feldern, bringt also im Wortbegriff die drei Momente am Strukturmodell
der Sprache zusammen und unterstreicht überdies die Tatsache,
die im Oberbegriffe ‚la langue’ anklingt, daß ein rechtes
Wort im intersubjektiven Verkehr verwendbar sein muß. Ob ein
gegebenes Lautgebilde ein Wort sei oder nicht, kann selbstverständlich
nur im Hinblick auf irgendeine bestimmte Sprache wie lingua
latina gemeint sein und beantwortet werden. Nun, dann müssen
die Lautmale seines Klangbildes dem lateinischen Phonemschatz
angehören. Wenn es z. B. Schnalzlaute enthielte oder das Gebrüll
des Löwen erscheinungstreu wiedergäbe, wäre entschieden, daß es
gewiß nicht von Partnern der lateinischen Sprachgemeinschaft in
derselben Weise wie andere lateinische Wörter als sprachliches Verkehrszeichen
benützt worden ist. Römische Legionäre haben vielleicht
da und dort als Wachposten vor dem Feinde Löwengebrüll
oder Vogelrufe verabredungsgemäß als Signale an ihre Kameraden
verwendet; solche Signale haben ein sehr prägnantes Klanggesicht,
aber kein phonematisches Signalement. Und darum gehören sie,
so selten oder so häufig sie auch gebraucht wurden und wäre es
auch im ganzen römischen Heere üblich gewesen, mit allem Ähnlichen
nicht zum Bestände der lateinischen Sprache. Denn was
wirklich dazu gehörte, waren ausnahmslos Lautzeichen mit phonematischem
Signalement aus dem Lautschatz der lateinischen Sprache.
Daß man nach der Lautcharakteristik ein zweites Mal ausholen
und den Wortbegriff auch „von innen”, d.h. auf der Funktionsoder
Bedeutungsseite definieren muß, wird vom Axiom B vorgeschrieben.
Phonematisch korrekte, aber sinnlose Lautbilder gab
es vor dem Ebbinghausschen Silbenschatz der Assoziationsforscher
z. B. im Munde der Zauberer aller Zeiten: Abrakatabra.
Die Gläubigen natürlich verbaten und verbitten sich unsere Behauptung, daß
es sinnlose Silben sind. Um konziliant zu sein, sei eine Einigung auf der Basis vorgeschlagen,
daß die übernatürliche und magisch wirksame Sprache offenbar einen teilweise
298eigenen Wortschatz hat, dessen Gesetze wir nicht erforschen wollen; es geht
uns hur um die profane und um dasjenige in der magischen Sprache, was auch in der
profanen vorkommt. Die angenommene übernatürliche Wirksamkeit der sowohl profan
wie magisch verwendeten Sprachzeichen bietet dem Sprachtheoretiker so lange keine
Schwierigkeiten, als die angesprochenen Gewalten einfach zu Partnern des normalen
Sprechverkehrs, d. h. zu Empfängern (und Sendern) wie andere gemacht werden.
So ist es in den Fiktionsspielen des Kinderlebens und darüber hinaus in den gewöhnlichen
Ernstfällen sporadischer Wendungen eines Sprechers an ungesehene
oder stumme Hörer (wie es die Naturgewalten sind). Daß das eigene Sprechen auch
verstummen kann im Kontakt mit jenen Gewalten oder umgekehrt, daß der magisch
Angerufene in „Naturzeichen” und im Gewissen wortlos zu uns „spricht” nach der
in Rede stehenden Auffassung, ist kein Problem der Sprachtheorie, solange man
Sprache gleich Lautsprache setzt.
Die Abrakatabra-Gruppe auszuschließen aus dem Wortschatz
ist keine große Angelegenheit; viel wichtiger ist es, das Wort vom
Satze zu trennen. Wenn ich das Merkmal feldfähig vorschlage und
wenn darunter verstanden wird, was ich im Auge habe, ist dieser
Anspruch an die Definition des Wortbegriffes erfüllt. Denn selbst
feldfähig kann nur etwas sein, was dem Feld gedanklich opponiert
und von ihm abgehoben wird; Satzfeld und Wörter sind zweierlei.
Wörter stehen im Symbolfeld, füllen Plätze dort aus, sie nehmen
auch Feldzeichen an sich und in sich auf. Darüber mehr in der Theorie
des Kompositums. Außerdem aber haben Wörter noch etwas in
sich, nämlich das lexikalische Moment, das sie bildlich gesprochen
mitbringen. Es wäre durchaus möglich und vielleicht sogar der
nächste Weg zu einer Definition des Wortbegriffes, von diesem
lexikalischen Momente auszugehen. Wer dies versucht, kommt bei
den Nennwörtern auf eine Analyse, wie wir sie im § 14 geboten haben;
er muß dann aber bei den Zeigwörtern noch einmal neu anfangen
und für sie eine Analyse bieten ähnlich derjenigen, die Brugmann
vorgelegt hat. Vereinigt ist das alles in dem summarischen Merkmal
der Feldfähigkeit. Denn nur Lautgebilde mit Symbolwert (oder
Signalwert in dem Sinne, wie ihn die Zeigwörter haben) sind feldfähig.
Es bleibt dann nur noch die Frage offen, ob man positiv angeben
kann, was einem Wort die Feldfähigkeit verleiht; ist es vielleicht
die Zugehörigkeit des Wortes zu einer bestimmten Wortklasse
(Wortart)?
4. Wie müßte das Faktum der Wortklassen im reinen Lexikon
zur Geltung, müßte es überhaupt zur Darstellung gelangen? Ich
ergreife noch einmal die Gelegenheit, eine der entscheidenden sprachtheoretischen
Thesen dieses Buches zu unterstreichen; der sematologisch
erste Klassenschnitt trennt Zeigwörter und Nennwörter,
und zwar im wesentlichen so, wie es die großen griechischen Grammatiker
299in der Geburtsstunde der abendländischen Sprachwissenschaft
gesehen haben. Was wir an Neuem hinzulügen konnten, war
der Beweis, daß sich die Funktion der Zeigwörter im Zeigfeld und
die Funktion der Nennwörter im Symbolfeld der Sprache erfüllt.
Zweierlei gehört dazu und muß mitbeachtet werden, nämlich die
Betrachtung der Nennwörter im sympraktischen und symphysischen
Umfeld und die eigenartige Verwendung der Zeigwörter im Modus
der Anaphora. Das letztere ist sematologisch gesehen wohl die
merkwürdigste Kooperation oder Funktionsverschlingung der beiden
Wortarten. Eine Funktionsmischung liegt vor in der wichtigen
Erscheinung der Pronomina und ihrem von uns theoretisch als denkbar
erfaßten (und vielleicht an dem Beispiel aus dem Japanischen
auch als realisiert nachgewiesenen) Pendant der Prodemonstrativa.
Daß ein und dasselbe Zeichen zugleich demonstrieren und nennen
kann, überrascht keinen nur einigermaßen in seinem Handwerk bewanderten
Sematologen; es überrascht ihn eher das Umgekehrte,
daß nicht alle Sprachzeichen sowohl die eine wie die andere Funktion
haben sollten.
Nach dem Trennungsstrich zwischen Zeigwörtern und Nennwörtern
ist es zweckmäßig, den ordnenden Umblick auf bestimmte
Gebilde im Lexikon zu richten, die aus irgendwelchem Grunde eine
Sonderstellung außerhalb beider Kreise verraten. Die Interjektionen
und phonematisch geprägten Appellgebilde wie he! halloh! haben
wir schon einmal gestreift; sie sind weder wie die Nennwörter feldfähig
im Symbolfeld der Sprache noch ohne Vorbehalt den Zeigwörtern
beizuzählen; es gibt eigentlich nur ein Feld, in dem sie
naturgemäß wachsen und ohne Erläuterungskrücken verstanden
werden. Das ist das sympraktische Umfeld der Sprachzeichen. Es
dürfte auch nicht falsch sein, wenn man sie zum Einklassensystem
der tierischen und menschlichen Rufe rechnet und dadurch noch
gründlicher von den eigentlichen Wörtern trennt.
Weiter: schon in jedem ordentlichen Einklassensystem gibt
es auch Zeichen der Zustimmung und Nichtzustimmung oder Abwehr;
ihnen sind die vielfach satzvertretenden Lautgebilde wie ja
und nein verwandt. Bei unseren Kindern entsteht das ‚nein’ und
‚ja’, auch das später erst korrekt satzgefügte nicht greifbar bereits
in der Einklassenphase ihres Sprechens; diese Äußerungen werden
denn auch lange noch, wenn das Kind schon fügt, isoliert vorausgenommen
oder eindrucksvoll nachgeschickt. Ein moderner Logiker
wird ihnen noch andere Symbole, die ausgesprochene ‚Satzfunktionen’
im logischen Wortsinn haben, zugesellen, z. B. ‚gewiß’,
300‚vielleicht’ u. dgl. m., Symbole, die der Sprachhistoriker den Adverbien
oder einer anderen Klasse von Nennwörtern einzureihen
geneigt ist und ihrer Herkunft nach auch einreihen darf. Es liegt
für unseren Zweck nicht viel daran, dies Randgebiet der Wortklassen
restfrei zu ordnen.
Die Zeigwörter der indogermanischen Sprachen sind von Brugmann
einer ordnenden Idee, sind der Idee, daß es ein übersehbares
System von Zeigarten gibt, unterstellt worden. Wir haben die
Idee aufgenommen und dahin gewendet, daß Positions- und Rollenzeigwörter
relativ scharf zu sondern sind. Wichtig war außerdem
zu beweisen, daß es drei Modi des Zeigens gibt. In Sprachfamilien,
die dem Verbum und der verbalen Weltauffassung nicht das gleiche
Gewicht geben wie die indogermanische, könnten sehr wohl noch
andere Zeigarten vorkommen. Es wäre nicht schwer, im Handumdrehen
einige Möglichkeiten zu fingieren, doch bliebe dies ohne hinreichende
Tatsachengrundlage ein müßiges Spiel der sprach theoretischen
Phantasie. Man wird sich dies Mögliche von vornherein nicht
als Ersatz, sondern als Ergänzung der genannten Zeigarten vorstellen.
Denn das Zeigen im Raum und das Zeigen im Aktionsfeld des
intersubjektiven Verkehrsaktes sind doch wohl die nächst gelegenen
und wichtigsten Zeigarten.
Soll das reine Lexikon mehr sein als ein Verzeichnis von Klangbildern,
soll es wie jedes ordentliche Lexikon die Funktion jeder
Einheit angeben, dann müßte der Inbegriff dieser Erkenntnisse in
die Funktionsangaben im reinen Lexikon eingehen und sie beseelen.
Genau so und in demselben Sinn gehören auch die Klassen der Nennwörter
ins reine Lexikon; man müßte dort finden, ob ein Wort
Nomen oder Verbum, Präposition oder sonst etwas ist.
Das Phänomen der indogermanischen Wurzeln entsteht dadurch, daß vielfach
stofflich Verwandtes auch klanglich verwandt bezeichnet und die Wortklassen
nach bestimmten Bildungsregeln voneinander abgehoben werden. Daß dieselbe
Wurzel vielfach in einer ganzen Schar klassendifferenter Wörter angetroffen wird,
ist eine verständliche, aber keineswegs sematologisch geforderte Tatsache; es trifft
ja, wie man weiß, auch im Indogermanischen nicht für jede Wurzel zu, daß man
Nomina und Verba zugleich nachweisen kann, in denen sie zu finden ist. Noch weniger
ist dies der Fall, wenn man die Präpositionen und die Zahlwörter oder gar die Zeigpartikeln
mit einbezieht. Denkbar bliebe anderswo eine Ordnung der Verhältnisse,
welche das Phänomen von einer Wurzel, die sich in vielen Wörtern wiederfindet,
überhaupt nicht entstehen ließe; nachgewiesen sind Sprachen, in denen es wenigstens
nicht in demselben Ausmaß wie bei uns vorkommt.
Es wäre nun geboten, die Angelegenheit der Nennwortklassen,
die uns im dritten Kapitel sub specie des Darstellungsfeldes der
Sprache, d. h. syntaktisch beschäftigt hat, unter sematologischem
301Gesichtspunkt anzugehen. Gibt es Nennarien in ähnlichem Sinne,
wie Brugmann seine Idee von den Zeigarten verstanden wissen
will? Die Ordnung der Nennwörter ist für den Sematologen die
dornigste Rose im Garten der Sprachforscher. Der Theoretiker
findet heute in der Syntax von Wackernagel die nach meiner
Auffassung besten Aufschlüsse über den frühen Werdegang der
Lehre von den Wortklassen. Jellineks Geschichte der deutschen
Grammatik ergänzt die Angaben Wackernagels. Brøndal ist
zwar besser als Wackernagel bei den Philosophen bewandert und
rückt die Kategorientafel des Aristoteles in den Vordergrund;
doch versteht er nicht, wie mir scheint, die Motive der antiken
Philologen ebenso einsichtig zu präsentieren wie Wackernagel 1)98.
Vielleicht ist Brøndals Hinweis auf die Wichtigkeit der grammatica speculativa
des Duns Scotus richtig, was ich nicht kontrollieren kann. Daß die Logiker
von Port Royal als erste die Klasse der Präpositionen brauchbar definiert haben,
wird man ihnen gebührend anrechnen: „C'est l'exposant d'un rapport consideré
d'une manière abstraite et générale, et indépendamment de tout terme antécédent
et conséquent.” Das dürfte in der Tat die Präpositionen gut treffen und abheben
von anderen Wortklassen. Verwunderlich ist, daß man die Zahlwörter erst im 18. Jahrhundert
begrifflich gesondert haben soll nach Brøndal. Adelung bestimmt sie
angeblich als „unkonkresziert”, womit er gesagt haben soll, daß sie gleichsam nur
leere Hülsen des Wirklichen und nicht wie die Nomina wirkliche oder konkrete
Dinge nennen. Ist das nicht mehr hinein- als herausinterpretiert aus der nach
Jellinek ziemlich unklaren Adelungschen Sprachtheorie, so könnte eine Ahnung
vom höheren Formalisierungsgrad der Zahlen (gegenüber den Sinnendingen) darin
beschlossen liegen.
Zwischendurch eine Bemerkung zu Brøndals Definition des
Wortbegriffes. Er kritisiert Meillet und behauptet, das zweite
Merkmal des Wortes sei „die bestimmte Zugehörigkeit zu einer
Wortklasse” (17). Wobei vorausgesetzt und auch mit einigen Gründen
versehen wird, daß es einige differente Wortklassen in allen Menschensprachen
geben muß. Doch steht dieser These der Hinweis Porzigs
auf das Chinesische, das jedenfalls keine phonematisch. charakterisierten
Wortklassen kennt, entgegen. Ich denke mir, das Merkmal
feldfähig sei weiter und korrekter als das von Brøndal vorgeschlagene
Merkmal; unser Merkmal impliziert unter bestimmten Voraussetzungen
das Brøndal sehe. Doch kehren wir zur Frage nach den
Wortklassen zurück.
Sachlich brauchbar dürfte Brøndals Gedanke sein, daß man
die Wortklassen einer jeden gegebenen Sprache als ein System anzusehen
302habe „une totalité dont chaque membre prend son existance
et sa valeur du fait de ses rapports avec les autres membres”. Das
ist ein Wink, der im Zeitalter der Ganzheitsbetrachtungen auf Beachtung
rechnen kann und mit dem, wie mir scheint, sehr viel mehr
und Besseres zu machen ist, als was Brøndal selbst schon vorlegt.
Denn sein eigener Versuch verläßt den Bannkreis der philosophischen
Kategorienlehre nicht; und eigentlich hätte ein unbefangener Blick
auf die zweitausendjährige Geschichte der Logik und Erkenntnislehre
einem Mann wie ihm deutlich machen müssen, daß dort die
Lösung nicht zu finden ist. Auch bei Aristoteles nicht, der sich
in seiner Kategorientafel am engsten an die Sprache gehalten hat.
Mir scheint in der Tatsache, daß die Wortklassenfrage erst
dort brennend wird, wo man in den exotischen Sprachen auf verwunderlich
fremde Symbolfelder stößt, ein Wink zu liegen, wie sie
beantwortet werden müßte. Nämlich von den Feldwerten aus, die
Wörter im Satze erhalten; gleichviel ob diese Feldwerte den Wörtern
von vornherein eingegeben oder ihnen nur sozusagen angeheftet
werden. Wenn zu einem Verbum wie amarc die engsten Ergänzungsfragen
wer? und wen? auftauchen, so heißt das im Sinne der scholastischen
Analyse, daß amare zwei Konnotationen enthält, und es
heißt logistisch ausgedrückt, daß zwei Leerstellen zur Funktion
dieses Wortes im Symbolfeld gehören. Zwei Leerstellen, die nicht
durch Angehörige beliebiger, sondern nur bestimmter anderer Wortklassen
erfüllt werden können. Das Wort albus weist nur eine
Leerstelle auf und sie muß durch Symbole einer bestimmten Klasse
erfüllt werden. Das alles ist uns so wohlbekannt und vertraut, weil
wir den Satzbau und Wortgruppenbau unserer Sprache kennen;
und auf keinem anderen Wege als über die Kenntnis der Symbolfelder
wird die Frage nach den Wortklassen allgemein zu beantworten
sein. Das ist, wenn ich recht verstehe, auch die Auffassung, in
welche die Arbeit von Hermann über die Wortarten ausklingt 1)99.
Auch in dem Programm, das Porzig skizziert (Aufgaben der indogermanischen
Syntax), erscheinen die „Bedeutungskategorien” erst
nach der Analyse der „Satzstrukturen”.
§ 20. Die Funktionen des Artikels.
Die Rolle des Artikels in den Artikelsprachen ist vielgestaltig
und sprachtheoretisch interessant. Daß er, wie sein deutscher Name
sagt, als eine Geschlechtsmarke der Dingwörter auf die Bühne tritt,
303ist bei weitem nicht alles. Er markiert (eindeutiger im Griechischen
und Deutschen als in den romanischen Sprachen) auch den Numerus
und Casus und mischt sich sogar in die zentrale Funktion der Wörter,
die er begleitet, ein; er modifiziert ihren Symbolwert und ihre
Feldwerte. Sematologisch gesehen, ist das letztere recht merkwürdig
und die wichtigste Funktion des Artikels. Man sprach (um seine Beeinflussung
der Feldwerte vorauszunehmen) von einer „substantivierenden
Kraft” des Artikels (Wackernagel). Lassen wir den Kraftbegriff
beiseite und halten uns an die schlichte Beschreibung von Porzig:
Der Artikel „ist eigentlich das substantivbildende Formans geworden, durch
dessen Präfigierung (bzw. Suffigierung im Skandinavischen) ein Adjektiv ohne
weiteres zum Substantiv wird. Man könnte beinahe behaupten, daß artikellose
Substantiva dementsprechend nicht mehr eigentliche Substantiva seien. Man vergleiche
etwa Sätze wie er war König und er war der König, und man wird deutlich
den Adjektivcharakter des Wortes König im ersten Falle spüren. Aber wie ist es
mit Eisen ist ein Metall im Gegensatz zu das Eisen ist ein Metall? Vielleicht wird die
deskriptive Syntax hier eine neue Kategorie, die weder Substantiv noch Adjektiv
ist, feststellen müssen” 1)100.
Porzig stellt eine Forschungsaufgabe und sagt „vielleicht”.
Trifft seine Vermutung zu, dann läge eine bislang noch nicht gesehene
Folgeerscheinung des Artikelgebrauches vor. Auszunehmen
von der vermuteten Entsubstantivierung artikellos gebrauchter
Substantiva sind gewiß von vornherein die Eigennamen; denn die
artikelfreien Städtenamen z. B. oder die in der deutschen Schriftsprache
ebenso artikelfreien Personennamen könnten aus mehr als
einem Grunde, vor allem aber, weil sie der Connotation im Sinne
J. St. Mills entbehren, kaum zu wirklichen oder Quasi-Adjektiven
werden. Bleiben wir also mit Porzig bei den Gemeinnamen und
bestätigen ihm, daß die Stoff- und Warenwörter wie ‚Wasser’ und
‚Zigaretten’ in der Tat bestimmte Merkwürdigkeiten aufweisen, um
derenwillen sie auch von einer umsichtigen Logik gesondert ins
Auge gefaßt werden müßten. Altbekannt ist demgegenüber die (sozusagen
umgekehrte) Tatsache, daß der zu Adjektiven und anderen
Wörtern gesetzte Artikel substantiviert. Das Gut des Bauern ist
ein Ding und der Böse eine Person; ein wenig anders gebildet nur,
aber dem Erfolge nach damit vergleichbar sind die vom Verbum abgeleiteten
Nomina. Die Habe und die Gabe sind Dinge; ich las einmal
auf einem bayrischen Bahnhof die Aufschrift ‚Holzlege’ an dem
Holzschuppen, die Lege ist ein Raum 2)101. Sprachhistorisch verfolgbar
304erhalten die mit Artikel versehenen Wörter den Feldwert von Substantiven
im Kontexte.
Wir unterscheiden davon und reihen trotzdem unmittelbar
an — den Einfluß des Artikels auf den Symbolwert der Wörter. Ich
habe die zusammenfassenden Darstellungen über den Artikel in
den indogermanischen Artikelsprachen bei Wackernagel, Delbrück
und Behaghels studiert. Der wenigst philosophisch Orientierte
von den Dreien ist nach meinem Eindruck Behaghels. Und
doch trifft er vom ersten Satze an sowohl in dem, was er sagt, wie
in dem, was er nicht sagt, die einzige Fährte aus dem Gestrüpp des
scheinbar eigensinnigen Setzens und wieder Nichtsetzens des bestimmten
Artikels im Deutschen. Seine Regel lautet: „Bei individuell
nicht bestimmten Größen muß also im allgemeinen der Artikel
fehlen” (39); woraus zu folgern ist, daß nach Behaghels alles, was
einen Artikel führt, als ‚individuelle Größe’ markiert ist; nicht
weniger und nicht mehr. Daß diese Marke auch fehlen kann bei
‚individuellen Größen’, widerspricht dem Satze Behaghels nicht.
„Der bestimmte Artikel… dient der Unterscheidung einer Größe
von anderen gleichartigen. Der unbestimmte Artikel greift eine
Größe aus einer Mehrheit von gleichartigen heraus” (38).
Ein Philosoph, der dies liest, mag im ersten Anlauf Ärgernis
nehmen an der Bedeutung, die dem Worte individuell in diesem
Texte verliehen werden muß, damit er nicht im flagranten Widerspruch
steht mit den Tatsachen und der peinlich gewissenhaften Beschreibung
der Tatsachen, die Behaghels selbst bietet. Wie kann man
den bestimmten Artikel als ein besonderes Zeichen betrachten,
das nur den ‚individuell bestimmten Größen’ verliehen wird, wenn
‚das Pferd’ im Deutschen sowohl das vor den Augen des Sprechers
grasende Exemplar, das einen Eigennamen hat, wie die
Spezies der Zoologen treffen kann? Die Antwort auf diese Frage
lautet klipp und klar: Behaghels denkt genau so unphilosophisch
naiv wie die Sprache selbst, darum interpretiert er unbefangen und
nennt das im Koordinatensystem des hie et nunc, des Zeigfeldes,
Bestimmte, Unverwechselbare, und das begrifflich unverwechselbar
Bestimmte mit ein und demselben (nicht gerade glücklich gewählten)
Namen ‚individuell bestimmte Größe’ (Größe = Etwas).
Was uns selbst daran weiter interessiert und interessieren muß
als Sprachtheoretiker ist vorab die zweimal verschiedene Weise des
Bestimmtseins, die der ‚bestimmte’ Artikel nicht unterscheidet,
die er beide trifft, wobei er ihre Verschiedenheit souverain ignoriert.
Es ist erstens die Bestimmtheit, die ein Etwas durch raum-zeitliche
305Einordnung und zweitens die Bestimmtheit, die etwas in der begrifflichen
Ordnung der Dinge erfährt, erfahren kann. Das (mit dem
Finger aufgezeigte) Pferd vor meinen Augen ist kraft der Deixis
und die zoologische Spezies ‚das Pferd’ ist begrifflich, d. h. letzten
Endes kraft einer Definition unverwechselbar mit anderem bestimmt.
Derselbe Artikel steht beim einen und beim anderen. Das ist philosophisch
ausgelegt die Quintessenz der Lehre Behaghels. Sie trifft,
wie ich glaube, den Nagel auf den Kopf, d. h. sie formuliert für das
von Behaghels sorgsam und reich zusammengestellte sprachgeschichtliche
Material von Belegen eine Anwendungsregel, die
nicht nachträglich wieder durch „Ausnahmen” durchlöchert zu
werden braucht. Der Philosoph soll daran nicht herumdeuten, sondern
schlicht zur Kenntnis nehmen, daß Sprachen wie das Griechische
und Deutsche im scholastischen Sinn des Wortes realistisch denken.
Auch das Lateinische natürlich, nur gibt es im Lateinischen keinen
Artikel, an dem dies manifest werden könnte. Vielleicht ist es angebracht,
in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, daß das
griechische Wort ‚deixis’ und das lateinische Wort ‚demonstratio’
selbst beides auf eine Linie stellen, das Zeigen mit dem Finger im
Wahrnehmungsfeld und das begriffliche Greifbarmachen eines Sachverhaltes
im logischen Beweis; der logische Beweis heißt deixis
und demonstratio. Ein solcher Wortgebrauch ist nur verständlich
im Rahmen eines realistischen Denkens.
Gewiß, der Reichtum der von Behaghels unterschiedenen
Fälle bleibt bestehen und es ist viel Verwunderliches darunter.
Aber das Verwunderliche liegt nicht an dem, was der Artikel gemeinhin
leistet, wo immer er auftritt, sondern einerseits an den
wechselnden Umständen, unter denen der Sprecher die Bedingungen
der sinnlich deiktischen oder begrifflichen oder einer gemischten
Bestimmtheit im Kontexte als erfüllt ansieht, und andererseits an
den Bedingungen, unter denen er auf den Gebrauch des bestimmten
Artikels verzichtet, trotzdem etwas Bestimmtes genannt wird.
So restlos hat sich der Gebrauch des Artikels in keiner Artikelsprache
durchgesetzt, daß dies gar nicht mehr vorkäme. Wir wollen, um
nichts Aufklärendes zu versäumen, zu den Historikern in die Schule
gehen und die sprachtheoretische Diskussion über die syntaktische
und semantische Funktion des Artikels danach im erweiterten Umblick
von neuem aufzunehmen.
1. Nicht nur Menschen und Bücher, sondern auch die wissenschaftlichen
Begriffe haben oft ein merkwürdiges ‚Schicksal’.
Wackernagel resümiert in seinem aufschlußreichen Paragraphen
306über den Artikel, dem ich die historischen Daten entnehme: „Also
hat unser Ausdruck Artikel seine Bedeutung fast zufällig, lehrt
nichts über die Funktion des damit bezeichneten Redeteils. Aber
das ist viel besser, als wenn man zu einem zwar deutlichen, aber
sinnwidrigen Ausdruck wie Geschlechtswort greift, der über die wirkliche
Aufgabe des Artikels gar nichts lehrt und nur insofern wichtig
ist, als man mit Setzung des Artikels das Genus eines Substantivs
am bequemsten angeben kann” (II, 126). Historisch verständlich
wird der Ausdruck articulus (griechisch ἄρϑρον) als Gelenkwort,
wenn man ihn so weit faßt wie Theophrast und die Stoiker, d. h.
als Ausdruck für alle anaphorischen Zeigwörter.
Es gibt kaum ein treffenderes Bild für die Funktion der
anaphorischen Wörter als das von den ‚Gelenken’ der Rede. Man
denke etwa daran, wie und wozu wir in den indogermanischen
Sprachen Relativa in die Wortfolge einer Rede einsetzen. Das Ganze
besteht aus ‚Sätzen’ und die Relativa fungieren wie Zapfen eines
Gefüges, sie stehen an den beweglichen Stellen des wie mit Gelenken
ausgestatteten Satzgefüges. Daß und wie man dies technische Bild
teils feiner ausdeuten, teils durch Treffenderes ersetzen kann, werden
wir später sehen. Einstweilen aber muß anerkannt werden, daß die
Griechen keinen schlechten Griff machten, als sie die Struktur der
Rede bildhaft als ‚Gliederung’ und die anaphorischen Zeigwörter
als Gelenkmittel bezeichneten.
Geblieben ist und vertieft wurde durch die historische Sprachbetrachtung
die Erkenntnis, daß der Artikel überall, wo er ausgebildet
wurde, aus dem Bestände der Demonstrativa hervorgegangen
ist. Dies haben die Griechen ihrer eigenen Sprache abgelesen;
Wackernagel macht darauf aufmerksam, daß es auch in den
semitischen Sprachen so sein dürfte, wo z. B. das al im Arabischen
ein Wort ist, das auch hier und jetzt bedeutet. Ähnlich greifen die
späteren lateinischen Schriftsteller, wo sie bei der Übersetzung
griechischer Texte den ihrer eigenen Sprache fehlenden Artikel vermissen,
zu einem hic, ille oder ipse und deuten dem Historiker damit
schon das Material an, aus welchem die romanischen Sprachen ihren
Artikel bilden werden.
Die Begriffsverengung des Ausdrucks ‚Artikel’ trat ein, als die
griechischen Grammatiker jene andere, syntaktische Funktion der
Demonstrativa und Personalia entdeckten, die seither in dem
Klassennamen ‚Pronomina’ festgehalten und unentwegt an die
Spitze der grammatischen Analyse gestellt worden ist. Platzhalter
der Nennwörter zu sein ist die unbestreitbare syntaktische Funktion
307der Pronomina. Der ausgebildete Artikel in unserem Sinn des
Wortes aber ist, was immer er leisten mag, bestimmt kein Platzhalter,
sondern etwas ganz anderes, nämlich ein Satellit gewisser
Nennwörter. Darum mußte er heimatlos werden in der neuen
Terminologie und die modernen Linguisten hatten die Aufgabe,
seine Funktion oder Funktionen neu zu bestimmen. Soweit ich
sehen kann, haben sie diese Aufgabe historisch-deskriptiv vorzüglich
gelöst. Man weiß, daß der Artikel eine relativ junge Erscheinung
ist, deren Entwicklungsgang im Griechischen von Homer an, im
Germanischen von der gotischen Bibelübersetzung an Schritt für
Schritt verfolgt werden kann. Die Romanisten schöpfen das Rolandslied
und die Anglisten den Beowulf aus, wo sie Anfangsstadien des
Artikels philologisch exakt interpretieren 1)102. So wie das Lateinische
artikellos daneben steht, scheint es auch in anderen Sprachfamilien,
z. B. in der semitischen zu sein. „Hier haben das Assyrische im
Norden, das Äthiopische im Süden keinen Artikel; in den anderen
Sprachen haben wir einen solchen, aber in ganz verschiedenen Typen”
(227). Eine verwunderliche Tatsache. Die Lateiner haben ohne
Artikel eine Weltsprache ausgebildet, die Slawen vermissen ihn
nicht. Warum brauchten die Griechen, Germanen und Romanen
einen „bestimmten” und einen oder mehrere „unbestimmte” Artikel
in seinem Gefolge?
Die subtilen stilistischen Analysen Winklers und anderer Romanisten zielen
darauf ab, den Artikel als Kunstmittel in seiner Keimphase und später zu belauschen.
Zur Ergänzung ihrer Befunde und zur Illustrierung seines fortschreitenden Einzuges
in die Umgangssprache wären wohl einfache statistische Häufigkeitsübersichten wertvoll;
ich selbst habe z. B. nicht erfahren können, wievielmal häufiger Luther als
Ulfilas den Artikel setzt und dächte es mir instruktiv den Homer mit Herodot und
Xenophon oder die griechische Ilias mit der deutschen von Voss einmal rein
statistisch zu konfrontieren, um auch quantitativ den historischen Werdegang zu
verfolgen. Ist der Artikel im Deutschen noch auf der Höhe seiner Anwendungshäufigkeit
oder sind da und dort schon Rückzugstendenzen wie im Englischen
bemerkbar?
Systematisch kommt Wackernagel zu drei Verwendungsfällen
des Artikels im Griechischen, Deutschen (und in den romanischen
Sprachen, die er wenigstens nebenbei auch mit ins Auge faßt).
Die zwei ersten sind ausgesprochen deiktisch und unterscheiden
sich nur dadurch voneinander, daß im ersten Fall der Hinweis (ein
„schwacher” Hinweis) auf eben schon in der Rede Genanntes, im
308zweiten dagegen auf etwas zwar nicht schon Genanntes, aber „für
den Sprecher und Hörer Gegebenes” erfolgt. Man muß auf Homer
oder sonst in eine historische Keimphase des Artikels zurückgehen,
um Beispiele zu finden, die überzeugend rein dem einen und dem
anderen Fall zugeordnet werden können. Bei uns ist die anaphorische
und anamnestische Deixis des Artikels zwar nicht erloschen, aber
nur als Nebenfunktion erhalten; sie ist kaum irgendwo isoliert von
der dritten Verwendungsweise zu finden.
Wenn ich im Kreise meiner Studenten sage ‚die Universität ist morgen am
Feiertag geschlossen’, so ist gewiß das uns allen bekannte Gebäude, unsere Universität,
gemeint und der bestimmte Artikel vor dem Nennwort mag nebenbei auch
eine „schwache” Deixis im Sinne Wackernagels erfüllen. Praktisch kann jeder
Klassenname wie ‚Vater, Stadt, Staat, König, Kirche’ usw. in enger oder weiterer
Sprachgemeinschaft okkasionell wie ein Eigenname behandelt werden und dabei
hat es in der Regel den Anschein, als ob die Individualisierung wieder an einem
Zeigmoment hänge, das der Artikel enthält. ‚Ich geh in die Stadt’, der Hörer weiß
schon in welche und könnte die Richtung angeben, wo sie liegt; ‚der Himmel ist
strahlend blau’, es gibt nur einen, der in Frage kommt, es ist der hier jetzt über
uns zeigbare. Es ist regional verschieden, ob man ‚der Vater’ oder ‚Vater’ sagt, wo
im Familienkreis das eine Oberhaupt gemeint ist. Dagegen geht man wohl überall
im deutschen Sprachgebiet in ‚die Stadt’.
Man wird in Zukunft, um mit diesen subtilen Interpretationsfragen ohne
allzuviel Subjektivismus fertig zu werden, eine Kriterienlehre ausarbeiten müssen.
Vor allem ist, soweit als möglich, die echte und klare Anaphora von der Deixis am
Phantasma abzuheben; anamnestisch ist beides, aber damit ist nicht genug gesagt.
Um das anaphorische Moment deutlich zu verspüren, könnte man an Stellen denken,
wo zweimal dasselbe verschieden genannt wird (Appositionen). Wenn ich sage
‚Elisabeth, die Richterin Maria Stuarts’, so ist in diesem Artikel vielleicht ein rückverweisendes
Moment zu verspüren; man wird es entweder als sachverweisend oder
als syntaktisch-platzverweisend oder als beides zugleich bestimmen können. Das
Zeigmoment gehört mit anderen Worten gesagt (wenn überhaupt vorhanden)
hier zu jenen vieldeutigen Nebenerscheinungen, die wir später in Brugmannschen
Exempeln wieder finden werden (§ 26). Und ich brauche die Wortfolge nur umzudrehen ‚die
Richterin Maria Stuarts, Elisabeth’, so erfolgt der Rückbezug (musikalisch
markiert) auch ohne den Artikel (die Hochsprache vermeidet ihn tunlichst
vor Eigennamen). Ich wüßte nicht anzugeben, wie man reinere Parallelen zu den
homerischen Exempeln Wackernagels aus unserem modernen Deutsch gewinnen
könnte. Wo es sich dagegen um den ursprünglichsten Modus des Zeigens, um die demonstratio
ad oculos handelt, ist es viel einfacher, kontinuierliche Übergänge
zwischen dem starktonischen Zeigwort dir und dem schwachtonigen Artikel der aus
der Umgangssprache aufzugreifen.
O. Behaghels bekämpft die Meinung, „daß der bestimmte Artikel in älterer
Zeit vielfach stärkere deiktische Kraft habe, also dem deiktischen Pronomen näher
stehe” als „durchaus irrig”. „Der bestimmte Artikel stammt aus dem anaphorischen
Pronomen — nicht aus dem deiktischen, wie vielfach angenommen wird” (Deutsche
Syntax, 1. Bd., S. 33). — Und woher stammt das anaphorische Pronomen? Behaghels
mag seine guten Gründe haben, den deutschen Artikel in seiner historischen
309Keimphase mit dem Relativum in nähere Verbindung zu bringen wie mit dem ad
oculos demonstrierenden Zeigwort. Aber daß beide aus derselben Wurzel stammen
und heute in der Umgangssprache kontinuierlich ineinander übergehen, bestreitet
Behaghels natürlich nicht. Es gibt nur wenige autochthon anaphorische Pronomina
im Deutschen und Zeigen ist Zeigen in allen drei Modis, die wir unterschieden
haben. Im übrigen bleibe das historische Detail den Historikern überlassen.
Wir wenden nun die volle Aufmerksamkeit dem dritten Fall
in der Liste Wackernagels zu. Der sei, so wird bemerkt, nicht ohne
weiteres als deiktisch zu begreifen. Der Fall nämlich, wo der Artikel
„bei Abstrakta steht” und Gattungen gemeint sind. Der nachhomerische
Grieche sagt genau so wie wir ‚mie Philosophie’ oder ‚mas
Pferd’, wo irgendwie das Abstraktum ‚Philosophie’ und die zoologische
Spezies ‚Pferd’ direkt gemeint oder sonstwie gedanklich im
Spiele ist. An diesem Punkte können wir die eigenen sprachtheoretischen
Überlegungen wieder aufnehmen und die von Wackernagel
kurz vor Torschluß noch mit aufgezählte und sorgfältig historisch
belegte, aber doch mit verwunderten Augen betrachtete Erscheinung,
die „substantivierende Kraft” des Artikels, direkt mit
der dritten Funktion seiner Liste in Beziehung setzen. Das prägnante,
sachliche Zeigen, das Zeigen im anschaulichen Zeigfeld der
Sprache, ist erloschen im modernen Artikel. Wie verhalten sich die
angeblich neuen Funktionen (welche de facto gar nicht historisch
neu sein dürften) zueinander und zum Zeigen? Das ist unsere
Frage.
2. Wir fassen noch einmal festen Fuß in der Erkenntnis, daß
jedes mit einem Artikel versehene Sprachzeichen entweder selbst
schon ein Substantivum ist oder zum Range eines Substantivums
erhoben wird. Genau so wie wir das Ich, das Hier, das Jetzt oder
Einst kennen, bildet nach Wackernagel auch Homer schon gelegentlich
τὸ πρίν (das Einst) und bilden die nachhomerischen
Griechen τὰ του πολέμου (die Kriegsangelegenheiten) und οἱ νυν
(die Menschen von heute). Zu beachten bleibt freilich, daß in den
beiden letzten Exempeln der mit Plural- und Genusmarken ausgestattete
Artikel „Angelegenheiten” oder „Menschen” trifft, was
dementsprechend als regens von του πολέμου auftritt; man faßt
diese Beispiele korrekt als elliptische Gefüge auf. Doch soll uns das
ebensowenig ablenken wie die Tatsache, daß eine Substantivierung
im Lateinischen wie in modernen Sprachen auch ohne die Hilfe
eines Artikels möglich ist: „Neiden ist kleinlich”. In dem Umfang
aber, wie es z. B. Philosophen gelegentlich für ihre Zwecke ausnützen,
wäre dies echt philosophische Verfahren ohne Artikel kaum denkbar.
Platon und Aristoteles wären ohne den griechischen, die Hegelianer
310ohne den deutschen Artikel recht häufig in Ausdrucksnot geraten
und Martin Heideggers ‚Sein und Zeit’ in goldenes Latein
übersetzen wäre vermutlich ein schwieriges Unternehmen; wie sollte
man ‚das in der Welt Sein’ ‚das Sein zum Tode’ und ungezählte
noch viel verwickeitere Ausdrücke in Ciceronischem Latein wiedergeben?
Im Latein der Scholastiker ginge es schon leichter, das heißt
man müßte eben in unerhörtem Ausmaß entweder nach dem
schwachen Vorbild spätlateinischer Übersetzer der griechischen
Philosophen die Demonstrativa einspannen oder in ebenso unerhörtem
Ausmaß nach dem nicht ganz schwachen Vorbild der
Scholastiker neue Substantiva bilden (vgl. essentia, quidditas,
ubiquitas mit den vielen im Griechischen unaufgelösten Wortgruppen
wie τὸ τί ην ειναι — das (begriffliche) Wesen einer Sache) 1)103.
Was liegt hier vor?
Machen wir einen Umweg. Ich suchte einmal in der Psychologie
nach einem Terminus für ein jedem von uns wohlbekanntes,
spezifisches Erlebnis und habe es dann kurz angebunden Aha-Erlebnis
genannt; der Name ist heute eingebürgert in der Psychologie.
Wer sprachtheoretisch das Gewaltsame, aber nicht Unmögliche
eines solchen Ausdrucks überdenkt, findet, daß er aus ähnlicher
Sprachnot stammt, aus welcher in ungezählten Fällen die
Setzung des Artikels einen Ausweg bedeutet. In dem zitierten
Beispiel war nicht ein Artikel, sondern das Verfahren einer Wortkomposition
der Nothelfer. Allein Sprachnot und Abhilfe sind dort
und hier vergleichbar. Aha im Fluß der Rede ist nach der hergebrachten
Auffassung kein Nennwort, sondern eine Kundgabe-Partikel,
eine Interjektion; komponiert aber mit dem Nennwort ‚Erlebnis’
gewinnt seine Funktion einen etwas anderen Charakter. Es wird
grammatisch ausgedrückt zum Platzhalter eines Attributs und
psychologisch ausgedrückt mutet das Kompositum ‚Ahaerlebnis’
dem Hörer zu ‚du sollst an diejenige Bewußtseinslage denken, in
welcher du die Interjektion ‚aha’ zu produzieren pflegst’. In vergleichbarer
Art und Weise mutet der Artikel vor einem Satzstück
oder ganzen Satze dem Hörer in einigen (und zwar den interessantesten)
Fällen zu ‚du sollst auf die reine Nennfunktion des folgenden
sprachlichen Ausdrucks achten’. Der Artikel versieht den ganzen
311Ausdruck wie mit einer Klammer und verlangt für ihn (nun gleich
generell formuliert) in jedem Fall irgendeine von jenen Wendungen,
welche die Scholastiker im Auge hatten, wenn sie von den verschiedenen
Suppositionen der Wörter sprachen. Damit ist das Stichwort
gefunden und die Klasse von Phänomenen angegeben, von
der man ausgehen muß, um die ganze Angelegenheit logisch ins
Reine zu bringen.
Die von den Scholastikern ausgebaute, in der formalen Logik
starr tradierte und heute noch da und dort wie ein fossiles Requisit
völlig versteinert vorgetragene Lehre von den verschiedenen ‚Suppositionen’
der Wörter ist im Grunde etwas höchst Triviales. Angenommen,
in einem linguistischen Text kommen die drei Sätze
vor: ‚Vater ist zweisilbig’, ‚Vater ist ein Substantivum’, ‚Vater ist
ein Verwandtschaftsname’, so ‚supponiert’ jeder verständige Leser
‚zweisilbig sc. als Wortklang’, ‚Substantivum sc. unter den Redeteilen’, ‚Verwandtschaftsname
sc. unter den anderen sprachlichen
Symbolen’. Sonst steht das Wort Vater nicht sozusagen für sich
selbst wie in diesen Fällen, sondern es steht für den gemeinten Gegenstand:
‚Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr’.
Das nannte man die suppositio simplex und auch die anderen Fälle
hatten ihre eigenen Namen. Die Scholastiker glaubten die Suppositionen
noch säuberlich in eine Liste einfangen zu können und
konnten es auch bei dem Stande ihrer Linguistik. Heute dagegen
ist das, was einen Linguisten alles an einem Worte interessieren
kann, so mannigfaltig geworden, daß es keinen rechten Sinn mehr
hat, eine Liste der möglichen Suppositionen anzulegen. Geblieben
ist nur die suppositio simplex als die gewöhnliche und daneben die
ungeschiedene Gruppe der ungewöhnlichen Setzungsmodi eines
Wortes in Kontexten 1)104.
Der substantivierende Artikel hebt in jenen ungewöhnlichen
Bildungen aus dem Munde der Philosophen ein Wort oder ganze
Satzbestandteile aus dem Kontext und fordert, daß sie syntaktisch
als Substantiva und semantisch ihrem begrifflichen Wesen nach
genommen werden sollen. Wie wäre es mit einer Besinnung darauf,
ob etwa eine derart eigenartige Zumutung, nur unbeachtet von der
Theorie, in jedem Artikel beschlossen liegt und vor dem Artikel
z. B. im Lateinischen nur mit anderen Mitteln auch schon vorkommt
312und vor dem klassischen Latein in jeder Menschensprache möglich
ist? Beim Herausheben allein verbleibt es freilich nicht, sondern
es werden dem so behandelten Textstück neue Feldzeichen verliehen
und der Artikel selbst führt sie im Griechischen und Deutschen
der Einfachheit halber gleich mit sich.
3. Jedes einfache und, jedes komplexe Wort hat einen Symbolwert
und muß feldfähig sein, um als vollendetes Wort zu fungieren
(§ 19). Wenn die historische Tatsache, daß die Artikel aller
bekannten Artikelsprachen aus dem Bestand der Zeigwörter hervorgegangen
sind und in ihrer Keimphase dem anaphorischen Gebrauch
der Zeigwörter am nächsten standen, sinngemäß aufgehoben werden
soll in einer Theorie vom Artikel, dann gilt es zu erwägen, in welchem
Ausmaß auch heute noch die Fügung Artikel + Nennwort ein
Zeigmoment enthält. Der Name auf einem dinglichen Wegweiser
im Gelände ist durch seinen Standort, seine Komplexion mit dem
Richtungszeichen als ein Ortsname charakterisiert; der mit einem
Artikel versehene Name oder ein ganzes Kontextstück als Substantivum.
Worin liegt letzten Endes die Verwandtschaft der beiden
Komplexionen beschlossen? Das scheint mir eine korrekte und unvermeidliche
Problemstellung zu sein.
Die Substantiva haben in allen Sprachen, wo man die Wortklassen
phonematisch auszeichnet, irgendein Formans oder Formantia;
es wäre zu wenig von dem Artikel in den Artikelsprachen gesagt,
wenn man ihn nur als Substantiv-Formans kennzeichnen wollte.
Dazu allein hätte ihn weder das homerische Griechisch noch das
Deutsch der Gotenbibel vonnöten gehabt. Schreibt man ihm aber
das Moment eines kontextlichen Zeigens zu, als ob er dastünde und
sagte: behandle das Wort oder das Kontextstück, dem ich als
Satellit vorauseile oder angehängt bin so und so, dann wird manches
in seinem Auftreten und vielleicht alles in den Sprachen, wo er das
Feld beherrscht, begreiflich. Zum mindesten aber fügt er sich
gewissen allgemeineren Regeln ein, denen wir bei der Analyse des
Kompositums und in der Lehre von der Anaphora begegnen werden.
Die Substantivierung ist in unseren Sprachen nicht die einzige
Wortklassen Verwandlung, welche durch das Mittel eines kontextlichen
Zeigens verlangt werden kann. Im Deutschen gibt es parallel
dazu ein Zeigwort, welches zum mindesten andeutungsweise eine
Adjektivierung (oder Adverbialisierung) verlangt; es ist das Zeigwort
so. Man greife das Exempel Porzigs noch einmal auf und setze
ein ‚so’ vor ‚König’; ‚er ist so König, wie nur das Märchen den König
kennt’; das hieße gewiß die von Porzig vermutete Adjektivierung
313unterstreichen. Brugmann, der das Wesen der Anaphora nicht erfaßt,
verkennt auch, wie mir scheint, die spezifische Nuance in der
deiktischen Funktion des deutschen Wörtchens so 1)105. Es trifft nicht
zu; was in der Überschrift des Paragraphen angedeutet wird, daß
nämlich das moderne so seiner deiktischen Bedeutung „entkleidet”
ist; es sei denn, man engt unzweckmäßig den Begriff des Zeigens
auf die Positionszeigwörter ein. Wenn ich ad oculos demonstrierend
50 sage, wird der Hörer auf irgendein aus der Wahrnehmung abzulesendes
Wie verwiesen; ich mache ihm z. B. einen Handgriff vor
oder zeige, wie das Produkt meiner Tätigkeit ausfallen muß. Das
Griechische differenziert dabei noch häufig, ob es auf Quantität
oder Qualität ankommt. Und dieses Wie-Zeigmoment geht keineswegs
verloren im Modus der Anaphora; es ist zu wenig gesagt,
wenn man die so-Funktion als Unterstreichung (Emphase) charakterisiert.
Gewiß liegt Emphase und nicht viel mehr als Emphase in
dem Satze ich habe mich über sein Glück so gefreut. Allein
man vertauscht die Reihenfolge, wenn man wie Brugmann schreibt:
„Die Verbindung des so mit Adjektiva und Adverbia hat sich nun
bei uns von dieser Satzart aus, in der so den emphatischen Sinn
gewonnen hat, weiter verbreitet” (135).
Etwa deshalb, weil nur Adjektiva und Adverbia steigerungsfähig
sind? Nein, das ist keine gute Hypothese. Sondern deshalb,
weil Adjektiva und Adverbia genau das zu nennen berufen sind,
was durch so gezeigt werden soll. Das lehrreiche Beispiel Stöckleins
aus dem Fränkischen, welches Brugmann zitiert, erscheint
mir nicht korrekt interpretiert von ihm; es lautet: „Es wird as
(= als) wie gebraucht, um einen Vergleich abzukürzen, den man auszuführen
zu bequem ist, z. B. der hat mich geschlagen as wie, er hat
Sprüche gemacht als wie; as wie geht so in die Bedeutung einer Steigerung
über” (134). Natürlich ist dem so, und das mit dem „Übergang”
ist wörtlich zu nehmen, d. h. es steht am Ende, was Brugmann
an den Ausgang der Entwicklung rückt. Genau so steht am Ende
der emphatische und schließlich der wirklich sozusagen absolute
Gebrauch von so in Redewendungen wie ich ging im Walde so für
mich hin; ich habe das so (= umsonst) bekommen; das ist nicht so
gefährlich. Das letzte Beispiel ist wohl wesentlich „emphatisch”,
es ist ein Steigerungs-so. Im übrigen braucht man den Nachweis
Brugmanns, daß der so-Stamm im Gesamtbild der indogermanischen
Sprachgeschichte häufig dort zu finden ist, wo anderwärts aus dem
314to-Stamm gebildete Wörter auftreten, durchaus nicht vergessen
zu haben. Denn ein to-deiktisches Moment ist natürlich auch in
dem ad oculos demonstrierenden so enthalten. Nur verlangt es,
wenn der Blick des Signalempfängers die Position getroffen hat,
eine spezifische Beachtung; es verlangt kurz gesagt eine wie-Beachtung
dessen, was zu sehen ist, während sonst die to-deiktischen
Wörter wie da, dort die unbestimmtere Was-Beachtung oder aber
bei der, das eine spezifische Substantivbeachtung verlangen. Daß
beide Gruppen von Zeigwörtern stammverwandt oder stammidentisch
sind, erinnert an die Tatsache einer häufigen Stammverwandtschaft
des ich- und des hier-Wortes (S. 113ff.).
Sind wir damit auf dem rechten Wege, so hätte sich aus der
so-Deixis ein ähnliches Sprachgebilde wie unser Artikel entwickeln
können und dieser Artikel wäre (um mit Porzig zu sprechen)
kein Substantiv-Formans, sondern ein Adjektiv-(Adverbial-)Formans
geworden oder ist es da und dort sogar. Was wir damit sagen,
gehört in den Komplex der von Porzig aufgeworfenen und wirklich
interessanten Frage nach dem Werden „neuer Kategorien” in
unserer lebendigen Sprache.
§ 21. Die Undverbindungen.
Es war wie gesagt im Kreise Meinongs, wo man vom Gestalteten
die Ungestalt begrifflich abhob und exemplarisch das
Wörtchen und als einen Bildner von ungestalteten Komplexen aufgriff.
So ist die heute weit verbreitete Rede von den Undverbindungen
entstanden. Die Idee war, daß in der sprachlichen
Kompositionstechnik offensichtlich durch ‚und’ Beliebiges mit Beliebigem
gebündelt werden könne und daß solch ein Bündel nichts
anderes als ein amas ou aggregatum im Sinne von Leibniz sei.
Abgehoben davon präsentiert sich alles Gestaltete als ein ‚Mehr als
Summenhaftes’. Es sollte also an einer sprachlichen Komposition
das non-A zu A gefunden, d. h. etwas aufgezeigt sein, dem das sogenannte
erste Ehrenfels-Kriterium der Gestalten, der Charakter
einer „Übersummativität” nicht zukommt. Die Sprachtheorie hat
ein begreifliches Interesse daran, nachzusehen, ob das Beispiel gut
gewählt ist und faktisch repräsentiert, wofür es auserkoren wurde.
Das ist unser Start. Die Probleme der Gestaltstheorie werden dann
scheinbar in den Hintergrund rücken im Angesicht des sprachtheoretisch
ungemein aufschlußreichen (echten) Kompositums und
der Metapher. Erst am Schluß wird sich zeigen, wieviel wir einer
umsichtigen sprachlichen Kompositionslehre an allgemeinen Fragen
315und Aufschlüssen in Sachen der Gestaltphänomene entnehmen
können und umgekehrt.
1. Im ganzen war die Konzeption des generellen Begriffs der
Undverbindungen nicht schlecht. Man muß sich als wohlwollender
Kritiker nur entschließen, vor allem an das sachlich fügende und
der Sprache, das am klarsten in komplexen Zahlwörtern zum Vorschein
kommt, zu denken; die Komposition einundzwanzig entspricht
dem Gedankengang Ameseders. Im Deutschen bilden wir
nach den einfachen Wörtern für kleine Anzahlen bis zwölf die undfreien
Komposita dreizehn bis neunzehn und dann, sehr konsequent
mit einundzwanzig beginnend, die Undgefüge aus Einer- und Zehnerwörtern;
daß undfreie Additionskomposita (fakultativ neben den
undhaltigen) von hundert an wieder vorkommen (hunderteins,
tausendvierzig), geschieht aus Bequemlichkeit; der Sprachtheoretiker
aber hat Gelegenheit, sich an diesem Hinüber und Herüber, das
in sonst nahe verwandten Sprachen zu Verschiedenheiten führt,
zu überzeugen von der generellen Unbestimmtheit der uralten und
denkbar einfachen Fügeart des Kompositums. Unser dreizehn neben
dreihundert erteilt dieselbe Lehre, und historisch junge Kurzfügungen
der Mathematiker wie vier hoch drei (43) befolgen auf ihre Art noch
einmal kühn das vermutlich älteste Rezept: stelle unbekümmert
zusammen und überlasse die Spezifikation entweder dem Stoff oder
besonderen Konventionen. Denn der eindeutige Vollzug von ‚dreizehn’
neben ‚dreihundert’ und ‚hundertdrei’ ist etwas, was man als
Lernender der deutschen Sprache genau so hinnehmen muß wie
irgendeine lexikalische Konvention.
Das Wort ‚Rezept’ lief uns soeben unter; es kam aus alten Überlegungen,
die sich mir bei mehr als einem wunderlichen Phänomen
der Syntax aufdrängten. Das ‚vier hoch drei’ der sprechenden
Rechenkunst ist vergleichbar den Hieroplyphen der Ärzte auf jenen
Zetteln, die man Rezepte zu nennen pflegt. Die Arztrezepte sind
Anweisungen an den Apotheker, die mit einem R beginnen: Recipe,
d. h. entnimm aus deinem Vorrat! Dann folgen Zeile auf Zeile
die Namen und Quanten der Stoffe und dazu z. B. die Zeichen
M. f. p. Ni 100 (misce fiant pillulae numeri centum). Einiges in
der Syntax erinnert an die Rezepte; nur daß es eben keine Manipultionsvorschriften,
sondern Konstruktionsanweisungen an den
Hörer sind, die hier gegeben werden. Das ‚vier hoch drei’ der
sprechenden Rechner ist eine Schreibanweisung; das kolligierende
‚und’ ist ein Konstruktionsrezept. Einfach und verständlich
jedem Kind, das von sich aus im Alter von zwei, drei Jahren ins
316Reich der Zählkunst vorzudringen beginnt, ist das schlicht kolligierende ‚und’,
das vom Kind manchmal beim Aufzeigen und
dann beim Aufbau von Dinggruppen verwendet wird; ‚eins und
(noch) eins und (noch) eins’.
Beim Spracherwerb unserer Kinder gehen, soweit ich die Dinge aus eigener
Beobachtung und einigen Notizen in der Literatur beurteilen kann, manchmal die
praktisch wichtigen Wörtchen ‚noch’ und ‚auch’ voraus. Sie waren bei meinen
Kindern zuerst Kommandos an die Erwachsenen und erschienen empraktisch in
Situationen, wo das Kind ‚noch mehr’ des Guten, respektive ‚auch von anderem
etwas’ oder ‚selbst auch’ wie andere Empfänger etwas haben wollte. In einem
späteren Zeitpunkt setzten dann jene bekannten Selbstgespräche der spielenden
Kinder und in ihnen die zeigende und kolligierende Funktion des ‚noch, auch, und’
ein. Es wäre lohnend, neue Beobachtungen auf breiterer Basis und mit sprachtheoretisch
subtilerer Fragestellung darüber zu sammeln.
Die Undwörter der indogermanischen Sprachen, zu denen
man gleich der Einfachheit halber im Deutschen die Gruppe ‚auch,
noch, oder, aber’ und deren Äquivalente in den übrigen indogermanischen
Sprachen hinzunehmen kann, könnten, wenn man die Dinge
nur von der Funktion her betrachtet, einen ähnlichen Werdegang
gehabt haben. Die morphologische Verwandtschaft einiger von
ihnen mit Präpositionen widerspricht dieser allgemeinen Vermutung
nicht und, was wir im folgenden bringen, ist geeignet, sie in einem
Punkte zu stützen: Genau so wie es allenthalben ein sachliches
und syntaktisches Zeigen gibt, so muß man dem gerade besprochenen
und des sachlichen Kolligierens ein spezifisch syntaktisches gegenüberstellen; ‚er
behauptet krank zu sein und das ist wahr’. Der
Logiker findet in der Urteilslehre von B. Erdmann die ausführlichste
Grundlage und einige, wie mich dünkt, treffende psychologische
Hinweise zu einer klaren Einordnung und Differenzierung des syntaktischen
‚und’. D. h. Erdmann selbst schiebt die sprachlichen
Mittel seiner wohldefinierten und gut abgegrenzten ersten Klasse
„zusammengesetzter Urteile” beiseite mit der Bemerkung, diese
Fügemittel seien „in jeder entwickelten Sprache mannigfach”, was
kaum bestreitbar ist. Doch formulieren wir die Frage etwa so: Was
ist das adäquate Wort, wo immer eine möglichst rein additive
Komposition von Urteilssätzen (Erdmann nennt solche Kompositionen
„Urteilsverbindungen”) durch Bindewörter eigens symbolisiert
werden soll? Der suchende Umblick findet dann das syntaktische ‚und’
mit seinen Verwandten.
Im übrigen ist die logische Entwicklung der drei Formen kopulativer,
konjunktiver und divisiver Urteilsverbindungen bei Erdmann so elementar,
daß sie nach Angabe des Schlüssels von jedem selbst vollzogen werden kann. Wenn
ich das eine Mal habe ‚N.s Vater und Mutter sind tot’ und daneben ‚N.s Vater
317ist jung ausgewandert und gestorben’, so löst der Logiker beide Sätze in je zwei
Urteile auf. Dort: Vater — tot, Mutter — tot; hier: Vater — ausgewandert, Vater —
gestorben. Das erste Mal erhält er dasselbe P zu zwei verschiedenen Subjekten
und das zweite Mal zwei verschiedene Prädikate zu demselben (wiederkehrenden) S.
Jenes nennt Erdmann eine kopulative und dieses eine konjunktive Addition. Die
dritte Form ‚das Verbum steuern kann den Dativ und den Akkusativ regieren’
(nämlich bald das eine, bald das andere) heißt divisive Komposition. An dieser
ganzen Konstruktion ist sprachtheoretisch am beachtenswertesten das Spitzenfaktum
selbst, daß die angeführten Beispiele eine Auflösung im Sinne Erdmanns
erlauben und fordern. Man stelle ein Exempel der anderen Funktionsweise daneben,
um den Unterschied zu verdeutlichen: ‚senatus populusque romanus decrevit’. Hier
zeigt der Singularis korrekt an, daß das Kollektivum ein einziges Subjekt geworden
ist. Dieses ‚que’ ist demnach ein kolligierendes, also sachfügendes, nicht satzfügendes
‚und’. Wenn ein stilistisch ziselierender Sprecher den Plural ‚descreverunt’ wählt,
zerlegt er die Gesetzgebung als Ganzes wieder in Teilakte und gibt ein Urteilsgefüge
im Sinne von Erdmann wieder. Das sind natürlich Subtilitäten, die auch von Sprechmoden
so oder so gewendet werden können.
In dem „Abriß der Logistik” von R. Carnap (1929) werden (S. 91) fünf
Undfunktionen aufgezählt, von denen die ersten drei das von Erdmann Gesehene
wiederholen, während das divisive ‚und’ fehlt. Das vierte ‚und’ bei Carnap ist das
Kolligierende und sein fünftes Beispiel weist auf einen beachtenswerten Tatbestand
innerhalb des Kolligierens hin. Wenn ich durch ‚und’ Merkmale einer begrifflichen Bestimmung
häufe : ‚die verlorenen und nicht wiedergefundenen Gegenstände’, so findet
nach dem bekannten Gesetz mit der Inhaltsbereicherung in der Tat, wie Carnap
angibt, eine Umfangsverengerung statt, die Klasse der verlorenen und wiedergefundenen
Dinge ist kleiner als die Klasse der verlorenen. Daneben aber gehört zur Ergänzung
das andere: wenn ich die Eigenschaften eines bereits definierten begrifflichen
Gegenstandes oder eines gegebenen Individuums expliziere: ‚C. Julius Cäsar,
der Feldherr und Staatsmann’, so geht es nicht um eine Klassenverengerung, sondern
um eine aufzählende Entfaltung von Eigenschaften. Rein sprachtheoretisch gesehen
ist das Wörtchen ‚und’ unschuldig an dem einen und an dem anderen; denn
es häuft und bündelt hier und dort. Das Schauspiel, welches mit der Satzverkettung
begann und mit einer Dinghäufung fortgesetzt wurde, wiederholt sich zuletzt bei
den Begriffs- und Dingbestimmungen. Das ‚und’ bündelt auch innerhalb von Wortgruppen
die Attribute ‚der lebhafte und aggressive Blick des Herrn N’. Davon im
folgenden mehr.
Wir ziehen die Summe. Das sprachtheoretisch Wichtigste
an den Undverbindungen ist die Scheidung eines sachlich kolligierenden
vom syntaktisch fügenden ‚und’; auf deutsch etwa:
das sachbündelnde und das satzkettende ‚und’. Das letztere gehört
der Funktion nach zu den Konjunktionen; will man das erstere
in den historisch ehrwürdigen Wortklassen unterbringen, so ist es
(der Funktion nach) vielleicht am nächsten verwandt mit den Präpositionen.
Man denke z. B. an ‚Madonna und Kind’ neben ‚Madonna
mit Kind’. Viel wichtiger aber als diese Einordnung ist auf unserem
Wege die sematologische Einsicht, daß dem konjunktiven ‚und’
ein Schatten von Anaphora zugrunde liegt. Es ist alles andere als
318selbstverständlich, daß in einem System von darstellenden Zeichen
auch solche vorkommen, die zurück- und vorverweisen auf bereits
erledigte und noch bevorstehende Teile der aktuellen Darstellung
selbst. Das besorgen in der Sprache die Zeigwörter im Modus der
Anaphora, und nur ihnen verdankt die sprachliche Darstellung ihre
unvergleichliche Gelenkigkeit und zum Teil auch ihre Sparsamkeit.
Statt der Wiederholungen im Konzepte des explizierenden Logikers,
von denen wir Proben aus Erdmann brachten, finden wir den
lebendigen Text der natürlichen Sprache reichlich z. B. mit dem
Wörtchen ‚und’ und seinen Verwandten durchsetzt.
Hat man die doppelte Funktion klar am Undwort selbst erfaßt,
so ist es leicht, sie an allen seinen Verwandten wieder nachzuweisen.
Beide Funktionen sind heute noch in vollem Gebrauch
bei ‚noch’ und ‚oder’, während für ‚aber’ historische Tatsachen
mitherangezogen werden können, um das selten gewordene sachlich
gemeinte Simplex ‚aber’ in verdientem Umfang zu illustrieren. Denn
es wurde durch Bildungen wie ‚abermals’ ersetzt und klingt nur
noch einigermaßen vertraut in dem altertümlichen ‚aber und aber’
in unserem Ohre. Dagegen kommt die doppelte Funktion des ‚oder’
in dem von der Logik gesehenen Unterschied der sogenannten
divisiven und disjunktiven Urteilskomplexionen korrekt zum
Vorschein. Wenn ich die Fügung ‚es gibt weiße und schwarze
Schwäne’ ersetze durch den Satz ‚die Schwäne sind weiß oder
schwarz’, so liegt ein divisives ‚oder’ vor. Anders ‚er lügt oder sein
Gegner ist ein Schuft’; das ist ein disjunktives Gefüge.
2. Auf der Brücke von der Undverbindung zu den subtiler
symbolisierenden Arten und Nuancen des indogermanischen (Wort-)
Kompositums steht das schlicht kolligierende Zahlwort dreizehn und
seine Verwandten, die durchaus keine Zahlwörter sein müssen. Ich
hatte mich einst im Deutschen nach solchen Gebilden umgesehen
und kam in mein Kolleg mit ein paar armseligen Exempeln wie die
Schwarzweißkunst, die Hamburgamerikalinie, der westöstliche (Diwan).
Die Frage an meine Hörer, ob sie mir aus dem Deutschen und anderen
Sprachen eine reichere Beispielsammlung verschaffen könnten, belehrte
mich in fast beschämender Schnelligkeit darüber, daß das
von mir mehr Gefolgerte als Gefundene den Sachverständigen längst
aufgefallen und in reicher Mannigfaltigkeit aus indogermanischen
Sprachen geläufig war. Bis zurück zu den indischen Sprachforschern,
die den treffenden Namen Dvandva-(Paar) Kompositum dafür erfunden
haben 1)106.319
Beispiele: das lateinische ‚usus fructus’ bedeutet: Gebrauch und Nutzgenuß.
Im Griechischen kommen Bildungen vor wie άρτόκρεας (Brot und Fleisch),
νυχϑήμερον (Tag und Nacht). Besonders geläufig ist nach Angaben, die ich Herrn
Dr. Locker verdanke, das Verfahren dem Neugriechischen: μαχαιροπέρονα (Messer
und Gabel), γυναικόπαιδα (Frauen und Kinder), άνδρόγυνο (Mann und Frau,
Ehepaar), σαββατοκυριακό (Samstag und Sonntag, Weekend). Aus dem Deutschen
wäre etwa noch ‚bittersüß’ als charakteristisches Beispiel nachzutragen; das kulinarische
Gebiet ist auch in den romanischen Sprachen reich an Parallelen. Das
kulinarische Gebiet und das der menschlichen Kleidung, wo Zwittergebilde wie
‚Hemdhose’ (sachlich und sprachlich) geschaffen und von dem erfindungsreichsten
Odysseus unserer Tage, der Mode, „kreiert” werden.
Das Paar-Kompositum steht, um es noch einmal zu sagen,
den (kolligierenden) Undverbindungen im Sinne Ameseders nahe
und überläßt es den zwei genannten Gegenständen, sich sachlich
korrekt zusammenzuschließen. Es bedarf kaum mehr als eines Hinweises
darauf, daß Mann und Frau als Ehepaar gedanklich anders
gekuppelt werden, denn Messer und Gabel als Eßbesteck oder die
Geschmackseigenschaften einer Frucht zu bittersüß oder Samstag
und Sonntag zu einem Weekend. Der sprachliche Ausdruck aber
gibt von solcher Differenzierung nichts wieder; an ihm allein kann
man sie nicht ablesen. Wir haben hier wieder die Grundtatsache
vor uns, daß die natürliche Sprache überall nur andeutet, was
und wie es gemacht werden soll, und Spielräume für Kontextindizien
und Stoffhilfen offen läßt. Man darf dies auch bei der
Behandlung des (echten) Kompositums nie aus dem Auge verlieren.
§ 22. Sprachtheoretische Studien am Kompositum.
Wenn ich einmal nenne, so treffe ich damit und symbolisiere
etwas, was wir im Abschnitt über die sprachlichen Begriffszeichen
bestimmt haben. Wie ist es, wenn ich zweimal nenne und Sorge
dafür trage, daß das Zusammen, die Reihenfolge der zwei Nennungen
und andere Feldmomente Relevanz gewinnen, d. h. mit verwertet
werden als Symbolisierungsmittel? Das ist in seiner allgemeinen
Fassung das Thema im folgenden. Vergleichend ausgedrückt lautet
die Frage so: ist es das Analogon zum kolligierenden oder ein Analogon
zum konjunktiven ‚und’ oder etwas Drittes, was am Kompositum
zum Vorschein kommt und untersucht werden muß? Die Antwort
lautet, es sei am nächsten verwandt dem attributhäufenden ‚und’.
Denn jedes Kompositum sei im Sinne der objektivistischen Sprachanalyse
ein Wort mit gefügtem Symbolwert und verlange zu seinem
Sinnvollzuge im Sinne der Husserlschen Aktlehre faktisch (unter
gewissen Voraussetzungen und mit bestimmten Einschränkungen)
mehrere nennende Bedeutangspulse.320
Ist dies als These niedergeschrieben, dann findet sich der
Sprachtheoretiker gar rasch in eine, soweit ich sehen kann, nirgendwo
letztlich entschiedene Streitfrage der Linguisten verwickelt. Die
hergebrachte Lehre, aus welcher das Kompositum seinen Namen
erhielt, ist von bestimmten Neuerern, die eine scharfe begriffliche
Unterscheidung von Wort und Satz leugnen, verworfen worden. Man
suchte und fand im „sogenannten” Kompositum nicht ein komplexes
Wort, sondern ein Satzstück oder manchmal sogar einen richtigen
Mikrosatz, eingebaut in den größeren Satzzusammenhang; und
stützte diese neue Lehre bald mehr auf sprachgeschichtliche, bald
auf psychologische Argumente. Es ist spannend, das Hin und
Wider der Debatte darüber als Zuhörer zu verfolgen. Wer, wie
der Verfasser dieses Buches, Psychologe ist, den fesselt z. B. die Art,
wie Brugmann in einer seiner kurzen und lebendigen Abhandlungen
den Angriff gegen die hergebrachte Lehre führt 1)107:
„Ob ein Typus in vorhistorischer oder in historischer Zeit aufgekommen ist,
ist also gleichgültig. Nicht auf die Schicksale, welche die fertigen Komposita erfahren
haben, kommt es uns an, sondern auf den Kompositionsprozeß selbst, auf
die Komposition als Urschöpfungsakt” (361, das Stichwort von mir hervorgehoben).
Mehrere Gedanken sind kunstvoll gesetzt und symphonisch
abgestimmt in Brugmanns Lehre vom „sogenannten” Kompositum.
Man muß sie sorgfältig isolieren und das Ganze mit der ebenso im
wesentlichen psychologisch argumentierenden Abwehr des Angriffs
durch H. Paul vergleichen. In Pauls Prinzipien faßt ein kurzer
Absatz zusammen, was dieser unbestechliche Empiriker zur Verteidigung
der alten Lehre im Namen der Psychologie und im Namen
der grammatischen Analyse zu sagen weiß:
„Denn das Wesen des Satzes besteht ja darin, daß er den Akt der Zusammenfügung
mehrerer Glieder bezeichnet, während es im Wesen des Kompositums zu liegen
scheint, die Zusammenfügung als ein abgeschlossenes Resultat zu bezeichnen. Demungeachtet
liegen Satzkomposita in den verschiedensten Sprachen vor, so namentlich
in den indogermanischen und semitischen Verbalformen” (328).
Schieben wir das erste, psychologische Argument von Paul
einstweilen beiseite, obwohl ein Verteidigungswilliger auch von dieser
Seite her einiges zu sagen fände. Viel eleganter und zwingender
wird die Beweisführung, wenn man das zweite, das grammatische
Argument von Paul aufnimmt und nach einer sachgemäßen Vordiskussion
und Verallgemeinerung vollgewichtig zur Geltung bringt.
Die indogermanischen Verbalformen sind nicht das schlechthin beste
und reinste Beispiel einer wirklichen Fügung im Satzfeld; denn in
Bildungen wie amabat, amabit ist eine Symbolwert-Fügung mitenthalten
321(s. oben S. 2941!), weshalb die Partei der Unitarier hier noch
teilweise die Konsequenz ihrer neuen Auffassung ziehen und beides
(Kompositum und geformtes Wort) auf eine Linie stellen kann.
Einfacher ist es, sich an das geformte indogermanische Nomen zu
halten und die Frage so zu wenden: bist du bereit, auch zwei Fügungen
wie Hauses und Haustor auf eine Linie zu stellen? In beiden ist
mehr als ein Bedeutungsmoment zu verspüren, aber das zweite
Moment in Hauses ist etwas wesentlich anderes als das in Haustor.
In unserer Terminologie ist das Genitivformans ein Feldmoment
und darum ‚Hauses’ kein Kompositum, sondern ein Wort mit Feldzeichen.
Zum Kompositum dagegen gehören mehrere Symbolwerte,
die zu einem einzigen komplexen Symbolwert gefügt erscheinen.
Weitgehend mit Hilfe derselben Feldmomente, die einst
im Satzfeld verwendet wurden oder auch jetzt noch verwendet
werden. Das ist wahr und merkwürdig und hat den Neuerungsversuch
heraufbeschworen. Trotzdem ist und bleibt er sprachtheoretisch
undurchführbar, und die Verteidiger der alten Lehre
wie Paul, der feine Syntaktiker Willmanns und manche andere
von Format (auch Tobler und Delbrück gehören dazu) werden
nach meiner Meinung recht behalten: es gibt nicht nur „sogenannte”,
sondern echte Komposita.
Die psychologische Argumentation in der Satzfrage, wie sie
sich zwischen Wundt und Paul abspielte, erscheint mir schwammig
und veraltet. Eine Sprachtheorie, die etwas auf sich hält und einen
Nachweis ihrer Daseinsberechtigung auch an diesem Punkte zu
führen bereit ist, wird weder im Psychologischen allein noch im
Sprachhistorischen allein befangen bleiben, sondern das Wort von
Brugmann, es stehe der Urschöpfungsakt der Komposition auf der
Tagesordnung, in ihrer Weise aufnehmen und auslegen. Ist unsere
Definition des Wortbegriffes tragfähig, dann wird sie sich in Sachen
des Kompositums bewähren. Man muß Merkmal für Merkmal des
Wortbegriffs im Angesicht des symbolgefügten Wortes noch einmal
durchnehmen, um zu sehen, ob sie zutreffen. Dabei erhalten alle
Argumente der alten und der neueren Lehre zunächst einmal ihren
systematischen Platz; es wird im Namen der Sache eine strenge
Redeordnung eingeführt, was vielleicht wertvoller ist als die Entscheidung
selbst. Daß die Arbeit so umsichtiger Denker, wie sie
in der Partei der Neuerer vorhanden waren (Tobler, Bréal,
Dittrich, Brugmann 1)108, weder sachfremd noch ergebnislos gewesen
322sein dürfte, versteht sich fast von vornherein. Man blickte auf die
Phänomene, erfüllt von dem Goethewort ‚es ist der Geist, der sich
den Körper baut’: „Der wirkliche Anfang des Vorganges, den wir
Kompositionsbildung nennen, ist vielmehr immer eine Modifikation
der Bedeutung des syntaktischen Wortverbandes”
(Brugmann). Paul gibt in seiner Antwort darauf zu, es sei zwar
gewöhnlich, aber doch „nicht immer so, wie Dittrich angenommen
hat” (330); Paul legt in der Entstehungsfrage den Hauptakzent
auf die „Isolierung” der Gesamtbedeutung vereinigter Wörter. Nun,
wir müssen diese Frage, ob der Erstschritt zum Entstehen eines
Kompositums stets innen oder manchmal auch außen gemacht
werde, beiseite schieben und könnten dabei mit einem anderen
Goethewort aufwarten, das ungefähr so lautet: Aber was ist innen
und was ist außen? Dies zweite Wort ist in Sachen der Lavaterschen
Physiognomik gesprochen und wäre exakt auf unsere Frage transponierbar 1)109.
Lassen wir das Zitieren; die Frage nach dem Anstoß zur Bildung
eines Kompositums ist aus den historischen Belegen meist nicht
zu beantworten, so lebensnahe auch einige fiktive und historisch
belegte Fälle von Brugmann gegriffen und interpretiert erscheinen
mögen. Die Anstoßfrage wäre auch, wenn beantwortet,
nicht schlechthin entscheidend. Viel wichtiger ist, daß die Kriterienserie
aus unserer Wortlehre es prinzipiell gestattet, zu entscheiden,
ob das fertige Produkt einer historischen Entwicklung wirklich unter
die Schar der Wörter gegangen ist und dort Aufnahme gefunden
hat oder nicht. Ob und wieweit; denn das kann in Etappen,
die man mit Hilfe der Kriterien zu bestimmen vermag, geschehen. So
wird das Endurteil lauten. Doch vorerst sei ein Blick auf den
Befund der Sprachhistoriker gestattet, damit erkennbar wird, wovon
wir sprechen und wie reichhaltig das Kompositum der indogermanischen
Sprachen vor uns steht.
1. Die Historiker erblicken in Bildungen wie ‚Akropolis’ die
Zeugen und Überreste eines Kompositionsverfahrens, das vermutlich
323älter ist als die indogermanischen Flexionen; und zwar deshalb, weil
das determinierende Nennwort (Akro-) in seiner nackten Stammform
verwendet ist. In Wörtern wie ‚Neapolis’ zeigt das Adjektivum
(Nea-) schon die weibliche Form, in Akropolis dagegen noch nicht
einmal diese. Der Sprachtheoretiker notiert diesen Befund und erhebt
die Frage, ob man in noch umfassenderem Umblick auf alle
bekannten Menschensprachen eine ähnliche Ursprünglichkeit des
äußerlich schlichten Zusammenstellens als einfachstes Fügungsmittel
wiederfindet; nach den Tatsachen, die W. Schmidt verwertet,
ist dies faktisch so. Nur sollte man, wie mich dünkt, daneben die
ebenso greifbare Ursprünglichkeit der musikalischen Modulationen
als Kompositionsmittel nicht übersehen. Denn das Kind moduliert
schon musikalisch und nützt diese Modulationen aus zu einer Zeit,
wo seine lautlichen Äußerungen sonst noch ganz wie ein Einklassensystem
imponieren und Synthemata schlechthin nicht in Frage
kommen; wir haben auf unseren Schallplatten an fixierten ersten
Kinderworten den hinreichenden objektiven Beweis dafür. Diese
musikalischen Mittel dürften demnach in der Geschichte der darstellenden
Sprache nicht jünger, sondern eher älter sein als die freilich
denkbar einfachen Nebeneinanderstellungen. Darauf müssen
wir noch zu sprechen kommen.
Neben dem flexionsfrei gefügten steht im Indogermanischen
das flexionshaltige Kompositum (die historisch jüngere Form) wie
‚Jahreszeit’ und neben der Gesamtklasse nominaler die ebenso reichhaltige
Klasse der verbalen Komposita. H. Paul faßt einen Hauptzug
der Geschichte dieses Klassenunterschiedes so:
„Ursprünglich besteht ein scharfer Unterschied zwischen verbaler und nominaler
Komposition. In der verbalen werden nur Präpositionen als erste Kompositionsglieder
verwendet, in der nominalen Nominalstämme und Adverbien, anfangs nur
die mit den Präpositionen identischen, später auch andere. In der verbalen ruht
der Ton auf dem zweiten, in der nominalen auf dem ersten Bestandteile. Bei der
Zusammensetzung mit Partikeln ist demnach der Akzent das unterscheidende Merkmal.
[Man erkennt also hier die Intervention eines musikalischen Momentes und
erhebt die Frage, warum die Akzentuierung verschieden ist.] Sehr häufig ist
nun der Fall, daß ein Verbum und ein dazugehöriges Nomen actionis mit derselben
Partikel komponiert werden. In einer Anzahl solcher Fälle ist das alte
Verhältnis bis jetzt gewahrt trotz des Bedeutungsparallelismus zwischen den
beiden Kompositis, vgl. durchbrachen — Dürchbruch, widersprächen — Widerspruch
usw. In anderen Fällen hat die verschiedene Akzentuierung eine verschiedene
Lautgestalt der Partikel erzeugt, wodurch sich verbales und nominales
Kompositum noch schärfer voneinander abheben. Hier ist im Nhd. das alte Verhältnis
nur in einigen wenigen Fällen erhalten, wo die Bedeutungsentwicklung
nicht parallel gewesen ist, wie erlaúben — Úrlaub, erteilen — Úrteil” (S. 247f.).324
Es ist das Klanggesicht des symbolgefügten Wortes, was hier behandelt
wird. Die Komposita unterstehen, so wird uns gezeigt, besonderen
Akzentprägungen, Woran man praktisch ihre Arten unterscheidet
und woraus eine Reihe konsekutiver Klangveränderungen historisch
begreifbar wird. Allein da kommt auch schon der erste Einwurf:
Was wird aus diesem Klanggesicht des Kompositums in Fällen der
Trennung (Tmesis)? Das zu Fügende wird oft durch zwischengeschobene
Wörter getrennt. Beispiel: ‚er brach unter diesen Umständen
kurz entschlossen die Reise ab’. Brugmann schreibt eine
Apologie zu dem Begriff der Distanzkomposition, trägt Argumente
zusammen, um „die richtige Stellung zu finden” zu der von den
Grammatikern als Tmesis (Trennung) beschriebenen Erscheinung:
„In der Tat handelt es sich hier ebenfalls um Kompositionelles, und wir wollen,
um eine kurze Bezeichnung zu haben, die an den nun einmal gegebenen Namen
Kompositum sich anschließt, in Fällen wie ‚wenn er mir abkauft’ vom Kompositum
mit Kontaktstellung der Glieder oder kurz von Kontaktkomposition, in solchen dagegen
wie ‚er kauft mir ab’ von Komposition mit Distanzstellung der Glieder oder
kurz von Distanzkomposition sprechen” (382).
Durch fünf Gruppen von Beispielen wird der Satz gestützt,
„daß die Distanzstellung ebensogut eine allgemein-indogermanische
Erscheinung ist wie die Kontaktstellung”. Wonach ein Fremdling
verwundert fragen mag, ob denn je daran gedacht worden ist, die
Distanzkomposition um der Trennung willen auf ein eigenes Blatt
zu schreiben. Ganz so primitiv ist dies natürlich nie geschehen; doch
war man in der Tat geneigt, im Begriff des Kompositums das Merkmal
des ohne die sekundäre Tmesis überall vorhandenen engen Kontaktes
mit einem daraus entspringenden eigenen Klanggesicht stark zu unterstreichen
(so z. B. Sweet). Dies bleibt auch richtig und wichtig
für alle Fälle, wo Tmesis unmöglich ist, weil das Zusammen und
die einsinnige Reihenfolge als Kompositionsmittel ausgewertet erscheinen:
Akropolis, Haustor, Tageszeit. Eine Fügung wie ‚Zeit des
Tages’ ist in unserer Frage nicht mehr ganz dasselbe wie ‚Tageszeit’.
Jedenfalls wollen wir selbst im folgenden die untrennbaren
Kontaktkomposita in der üblichen Weise voranstellen; die andere
Gruppe müßte sprachtheoretisch gesondert behandelt werden,
weil sie auf beträchtlich verschiedene Probleme hinführt.
Das Zusammen und die einsinnige Reihenfolge im Nacheinander
fügt die Wörter einer Rede in allen bekannten Menschensprachen.
Wir sind beiden Momenten im Zuge des analytischen Verfahrens
begegnet und haben sie neben anderem als Konstituenten des Satzfeldes
erkannt; im Zuge der Aufbaubetrachtung müssen sie sachgerecht
wieder behandelt werden. Daß dies nicht erst am Satze,
325sondern schon am symbolgefügten Worte, dem Kompositum, nötig
wird, ist das stärkste Argument der Neuerer. Gibt es überhaupt einen
drastischeren Beweis für ihre These als die unbestreitbare Tatsache,
daß Satz und Kompositum dieselben Fügemittel enthalten?
Man trifft nicht weit am Richtigen vorbei mit der These, daß
tabellarisch aufgenommen im Schöße des indogermanischen Kompositums
schon alle syntaktischen Momente zu finden sind, die im
Satze wieder zum Vorschein kommen. H. Paul braucht darum
in seiner Inventaraufnahme der indogermanischen Komposita nicht
weniger als 19 Schachteln, um alles fein säuberlich auseinander
zu halten. Dabei behauptet er, daß die ersten 15 Typen aus selbständigen
Wörtern durch „Synthesis”, d.h. durch eine engere Bündelung
entstehen, und erkennt eine spezifische Genesis aus dem Satze
nur den vier letzten zu, die durch folgende Beispiele repräsentiert sind:
„aus abhängigen Sätzen entspringen Komposita wie quilibet, quamvis;
eingeschaltete Sätze werden Komposita wie weißgott, scilicet, je ne sais quoi;
mit Hilfe von Metaphern können Sätze zu Kompositis verwandelt werden wie
Fürchtegott, Geratewohl, Vergißmeinnicht, Gottseibeiuns, vademecum; ganz selten auch
„ein wirklicher Satz, der seine Selbständigkeit bewahrt”. Um diese Seltenheit zu
begründen wird dann die zusammenfassende Abhebung des Satzes vom Kompositum,
die wir auf S. 321 zitiert haben, nachgeschickt.”
Die Unitarier fahren zunächst einmal mit dem Schwamm über
diese Zweiteilung der „Typen” und verkünden sieghaft, es gäbe gar
keine Wortkreszenz außerhalb des Satzes. In seinem Schoß müsse
letzten Endes alles geworden sein. Und warum in aller Welt ein
Trennungsstrich, wenn doch im Kompositum und im Satze
dieselben manifesten Mittel und derselbe Bedeutungsgehalt der
Fügungen gefunden wird? Ein ‚Schuhmacher’ ‚macht Schuhe’;
die erste Bildung enthält genau so wie die zweite das Nennwort
‚Schuh’ im Akkusativ. Es wäre ein Leichtes, an den ersten 15 Typen
Pauls die gesamten übrigen Satzfügungsmittel herauszupräparieren.
Das ist die unerschütterte Ausgangsbasis der Neuerer.
Die Frage, woher und wozu dann zwei Erscheinungsweisen für
ein und dasselbe? wird elegant durch den Hinweis auf das besonders
hohe Alter des Kompositums beantwortet. Das in höherem Grade
analytische Verfahren unseres Satzes ist jünger; vielleicht war es
(so geht die Überlegung weiter) einmal so, daß die Komposita fast
allein das Feld beherrschten. Nach dem Aufkommen des analytischen
Verfahrens ging dann das Komponieren in die neuen Verhältnisse
ein und erhielt einen Altensitz im neuen Haus, weil dies bequemere
Mittel in vielen Fällen, wo Stoffhilfen und Redegeläufigkeit einspringen,
vollkommen hinreichend ist. Daß ein so kurzes und bequemes
326Bildungsmittel bei der Neuordnung der Verhältnisse erhalten
blieb, ist leicht verständlich. Genauer besehen ist das Alte
aber nicht in allen Formen und in allen indogermanischen Sprachen
gleich lebendig geblieben, sondern es traten schon in sehr alter Zeit
und noch schärfer in den modernen Sprachen bestimmte Reduktionen
ein. So ist z. B. die rein nominale Fügung wie in ‚Hausschlüssel’
nicht überall ein so springlebendiges Bildungsmittel wie im Deutschen,
sondern im Englischen und in den romanischen Sprachen viel
seltener. Die Übersicht bei Delbrück (Vgl. Gramm. 1900), welche
auch W. Schmidt in seiner vergleichenden Studie zitiert, ergibt,
daß die nominale Komposition „im Altindischen nicht häufig, im
Griechischen und gerade auch im Lateinischen, dann auch im Slavischen
wenig zahlreich” ist. Dagegen kommt sie neben dem modernen
Deutsch im Gotischen und im Litauischen häufig vor.
2. Es empfiehlt sich, unserer Skizze aus der indogermanischen
Sprachvergleichung das Ergebnis ausgedehnter Studien des universellen
Sprachvergleichers W. Schmidt anzureihen. Sie sind so
orientiert, daß am manifesten Sprachphänomen das Zusammen und
die einsinnige Reihenfolge und von der Funktion her der Genitiv
von vornherein zum Hauptthema gemacht und ins Zentrum der
vergleichenden Syntax gestellt werden. Schmidt legt ein imponierendes
Tatsachenmaterial dazu vor und ordnet die zwei Vorkommnisse
der Vor- und Nachstellung des determinierenden Gliedes ins
Licht der Kulturkreistheorie 1)110.
Wenn ich im Deutschen Kuhhorn in Hornkuh verkehre, so
wird mir an dem einen Exempel schon deutlich, daß und wie die
Reihenfolge der Kompositionsglieder beim Aufbau mitverwertet wird
im rein nominalen Kompositum. Beliebige andere Beispiele wie
‚Rassenpferd’ und ‚Herzenskind’ erlauben ähnliche Verdrehungen
und erhärten das strenge Gesetz: das erste Glied eines nominalen
Kompositums ist im Deutschen das „determinierende” und das
zweite Glied ist das „determinierte”. Dies deutsche Gesetz gilt
nicht für alle Sprachen; wohl aber dürfte allgemein gelten, daß die
Reihung überhaupt relevant wird und daß prinzipiell dieselbe semantische
Differenzierung der Glieder überall, nur in einer zweiten
Gruppe von Sprachen an die umgekehrte Reihenfolge geknüpft ist.
Ein Seitenblick auf die verbalen Komposita der indogermanischen Sprachen
gibt den summarischen Aufschluß, daß die Tmesis eine Reihenumkehr ohne Bedeutungsverschiebung
gestattet; das Distanzkompositum ‚wahrnehmen’ bedeutet
327in umgekehrter Folge ‚ich nehme wahr’ dasselbe. Manchmal wird solche Umkehr
mit anderen Reihenänderungen zusammen als Inversion syntaktisch relevant,
nie aber (soweit ich sehen kann) für die Fügung der Symbolwerte. Die strengen
Kontaktkomposita der verbalen Gruppe schließen jede Umkehr von vornherein
aus; die verbalen Komposita stehen auch aus anderen Gründen auf einem eigenen
Blatt. Wir bleiben vorerst ganz bei der nominalen Gruppe.
Schmidt nun behandelt die Tatsachen als Kulturkreisforscher.
Was mag die Vor- oder Nachstellung des bestimmenden Kompositionsgliedes
mit Kultur und Kulturkreisen zu tun haben? Schmidt
deckt Korrelationen der schlichten Reihung zu anderen Feldmomenten,
vor allem zu Präfix- oder Suffix-Verwendung und zum
Auftreten von Präpositionen und Postpositionen auf, so daß er
schließlich das eine Moment der Reihung wie eine Art Leitmuschel
des gesamten strukturvergleichenden Verfahrens benützen kann.
Es entsteht kraft dieser Korrelationen ein weitverzweigtes, sprachtheoretisch
faszinierendes Theoriengebäude, und zu guter Letzt wird
eine erlebnispsychologische Basis gesucht. Schmidt glaubt, es müsse
wohl völkerpsychologisch eine Motivation oder Motivationen für die
Entscheidung der Sprachen, ob Vor oder Nach, zu finden sein. Und
diese Motivation, um welche mannigfache Überlegungen kreisen,
ist, wenn ich recht sehe, der Schlußstein in dem weitgespannten
Kuppelbau der Schmidtschen Theorie; sie ist das Bindeglied
zwischen Sprachstrukturen und Kulturkreisen.
Um das Ganze kurz nachzuzeichnen, geht der Sprachtheoretiker
am besten von Schmidts Gedanken über diese Motivation aus, macht
also das Letzte zum Ersten. Als vergleichend gut begründet sieht
Schmidt die Annahme an, daß die Voranstellung des determinierenden
Gliedes wie in ‚Hausvater’ oder ‚Akropolis’ überall das Ursprüngliche
ist. Ich zitiere diesen Obersatz der Theorie samt seiner
Begründung wörtlich:
„Die ursprüngliche Stellung des Genitivs ist in allen Sprachen die Voranstellung.
Diese geht mit psychologischer Notwendigkeit daraus hervor, daß der Genitiv in
der Begriffsbildung die differentia specifica darstellt, die als etwas bis dahin Unbekanntes,
und deshalb jetzt Neues, aus einem schon bekannten alten Begriff, einem
genus, eine neue species hervorgehen läßt, eben als Neues die Aufmerksamkeit als
Erstes auf sich zwingt und deshalb auch eher, früher ausgesprochen wird als das
‚regierende’ Nominativsubstantiv, welches das genus und als solches etwas schon
Bekanntes darstellt” (488).
Man entnehme dem Zitat, daß Schmidt die Diskussion unter der
Überschrift ‚Genitiv’ führt; gemeint ist natürlich nur der Stellungsgenitiv.
Denn sobald der phonematisch charakterisierte Genitiv
in einer Sprache auftritt, wird er auch in höherem oder geringeren
Grade zunächst einmal stellungsfrei; wir fügen im Deutschen wie
328in den meisten indogermanischen Sprachen ebenso geläufig ‚des
Vaters Haus’ wie ‚das Haus des Vaters’. Nur in den romanischen
Sprachen (und in einem Punkt im Englischen) bestehen besondere
Verhältnisse, welche von Schmidt eigenartig in einer Zusatzhypothese
behandelt werden.
Schmidt bestimmt die Funktion dieses Stellungskasus, den er
Genitiv nennt, kurz und bündig; er sei berufen, das begriffliche
Verhältnis von differentia specifica zum Gattungsbegriff wiederzugeben.
Und ebenso schnell ist ein psychologisches „Gesetz” gefunden:
Voran die differentia specifica! weil sie das Neue bietet.
Wie wäre es, wenn ein advocatus diaboli dem weitsichtigen Sprachvergleicher
Schmidt jeden dieser Schritte seines Hypothesenbaues
zunächst einmal bestritte?
Das wäre nicht schwer; denn, um mit dem ersten zu beginnen,
so weiß die moderne Denkpsychologie, daß das Verhältnis des Ganzen
zu einem seiner Teile in menschlichen Gedankenzügen genau so
wichtig ist und genau so häufig vorkommt wie die begriffliche
Über- und Unterordnung; und parallel dazu kennt die Linguistik
einen eigenen genitivus partitivus. Es entsteht also die Frage, ob
die Schmidtsche Interpretation auch dort zutreffend ist, wo das
Kompositum eine Aufgliederung nach dem Schema ‚Ganzes-Teil’
vornimmt. Man interpretiere ein Beispiel wie ‚Baumstumpf’ und
fasse es das eine Mal als begriffliches und das zweite Mal als anschaulich
zerlegendes Kompositum auf. Der Stumpf ist begrifflich
die Gattung und anschaulich nicht etwa das Ganze, sondern der
Teil. Darf man unbesehen das begriffliche Einordnungsverfahren
und das anschauliche Komponieren psychologisch völlig gleichstellen?
Sehen wir weiter zu.
Was dürfte das Auffallende, das Neue in einer Sprechsituation
sein, wo ‚Baumstumpf’ gebraucht wird, das Phänomen Stumpf oder
das Phänomen Baum? Dem Kritiker genügt die achselzuckende
Antwort ‚non liquet’. Sonst würde er umfassender zugreifen und
ein durchaus triviales Ergebnis, welches in jeder Abhandlung über
‚Apperzeption’ oder ‚Aufmerksamkeit’ vorkommt, als Kronzeugen
aufrufen. Was uns zuerst in die Augen springt, ist je nach Umständen
bald das Alte, Vertraute, und bald das Unbekannte, Neue:
in einer fremden Stadt der einzige Landsmann, in einem vertrauten
Dorf der einzige Fremde.
Endfrage: Ist es wirklich so, daß das irgendwie Aufgefallene
im sprachlichen Ausdruck ein Abonnement für die erste Reihenstelle
hätte? Gewiß nicht, sondern das „dicke Ende” spielt nicht nur
329im Leben und im Sprichwort, es spielt auch in der sprachlichen
Reihung eine Rolle; ausgezeichnet kann der erste aber auch der
letzte Platz einer Wortserie sein, was wieder durch Parallelen
aus allen vergleichbaren Bereichen illustrierbar ist. In Versmaßen
(um nur das eine anzuführen) steht z. B. neben dem Trochäus der
Jambus und (etwas seltener vielleicht) neben dem Daktylus dessen
Spiegelbild. Und überhaupt: wer kennt nicht das Gewicht des
letzten Wortes?
Nein, so summarisch ist die Motivationsfrage im Rahmen des
Schmidtschen Problems gewiß nicht zu lösen. Ich mache den
Vorschlag, die Dinge nicht sofort aus dieser oder jener relativ einfachen
erlebnispsychologischen Gesetzmäßigkeit begreifen und erklären
zu wollen. Das kann nicht gehen, weil die äußeren und inneren
Umstände der Sprechsituationen viel zu mannigfaltig und zu variabel
sind, um unter eine einzige Regel gebracht zu werden. Fast noch
wichtiger aber ist die Einsicht, daß das Aussprechen eines Zweiwortgefüges
von vornherein nicht als direkte Spiegelung eines vorausgegangenen
Eindrucksaufbaus angenommen werden darf. Denn
derart spiegelhaft oder echoartig zum Eindruck verhält sich das
psychophysische System der ausdrückenden und darstellenden
Sprache nicht. Steht die interessante Ausgangsthese Schmidts
von der Priorität der Voran-Stellung in der Sprachvergleichung
fest, was ich nicht zu beurteilen vermag, dann wird gewiß die
Sprach-Theorie und-Psychologie darüber nachzudenken haben. Aber
sie wird dabei einige Umwege nicht scheuen dürfen. Nehmen wir
an, die Sache sei wenigstens für die indogermanischen Sprachen zustimmend
entschieden. Dann darf die Einsicht der indogermanischen
Sprachvergleichung in das hohe Alter von Bildungen wie
‚Akropolis’ herangezogen und mit ihrem vollen Gewicht in die Diskussion
eingesetzt werden. Waren diese Fügungen anfangs eher
Sätze als irgend etwas anderes?
Diese Frage ist sehr wichtig; denn wir finden in unserem
eigenen Sprachgefühl, daß das strenge deutsche Fügungsgesetz nur
für die echt attributive und nicht für prädikative Fügungen gültig
ist. Schmidt betont mit Recht, daß wir uns im Rahmen unserer
Muttersprache mit ihrer lebendigen Nominalkomposition unter keinen
Umständen umstellen und in ein Wort wie ‚Vaterhaus’ etwa auch die
verdrehte Bedeutung ‚Hausvater’ einfühlen können. Bleiben wir
bei der Berufung auf unser Sprachgefühl und erkunden zweierlei,
was direkt daneben mit derselben Sicherheit entschieden werden
kann. Es gab erstens von jeher reine Nominalsätze in der indoeuropäischen
330Sprachfamilie und auch wir bilden sie da und dort; ich
stelle zwei wohlbekannte Beispiele nebeneinander: ‚Ehestand Wehestand’
und ‚Lumpenhunde die Reiter’. In beiden fungiert ein Glied
des Gefüges als S und das andere als P im Sinne der Logik; die Frage
ist, ob diese Funktionsdifferenz an die Reihung als solche gebunden
erscheint oder nicht. Antwort: nein, denn ‚Lumpenhunde’ ist P
und steht an erster Stelle, ‚Wehestand’ ist P und nimmt den zweiten
Platz ein. Wems gefällt, kann umdrehen in ‚Wehestand der Ehestand’
und bemerkt dabei das Akzentgewicht des P und daß im
modernen Deutsch ein Bedürfnis besteht, einen Artikel in den umgedrehten
Text einzufügen. Jedenfalls gelingt uns hier mit Leichtigkeit
etwas, was am Kompositum ‚Vaterhaus’ unmöglich ist. Wenn
angegeben werden sollte, wo in solchen Fügungen das P häufiger
steht, so fiele die Bevorzugung vermutlich, auf den zweiten Platz.
Dazu eine zweite Beobachtung im Geltungsbereich des modernen
Sprachgefühls: Wo immer ein nominales Kompositum der historisch
jüngeren Form das phonematische Genitivzeichen mitenthält, ist
der Bann der strengen Stellungsregel gebrochen; denn die zwei
neuen Fügungen ‚Vaters Haus’ und ‚das Haus Vaters’ sind beide
möglich und grob gesprochen bedeutungsidentisch.
Aus beidem zusammen folgt, daß eine umsichtige Beantwortung
der Schmidtschen Reihungsfrage in keiner Sprache unbeachtet
lassen sollte, ob neben dem reinen Stellungsgenitiv schon phonematische
Genitivcharakteristiken vorkommen oder nicht und wie
es mit der Ausnützung des Stellungsfaktors zur Differenzierung
von S und P bestellt ist. Schmidts großer Ordnungsversuch opponiert
korrekt und einleuchtend das Moment der Reihung mit den
phonematischen Charakteristiken und unterstreicht z. B. gegen
Wundt die historische Priorität des Reihungsmomentes. Es fiel
Schmidt auf, daß die Vor- oder Nachstellung des affixlosen Genitivs
regelmäßig mit anderen Entscheidungen im Aufbau der Sprache
parallel gehen:
„Hier nun war es möglich, scheinbar sich sogar auf einen einzigen Gegenstand
zu beschränken, nämlich die Stellung des affixlosen Genitivs in bezug auf den
Nominativ, den er näher bestimmt. Scheinbar, denn in Wirklichkeit schließen
an diesen Gegenstand in psychologischer Notwendigkeit eine ganze Reihe von grundlegenden
Elementen der Satzbildung sich an und werden durch ihn in weitgehendem
Maße bestimmt und beeinflußt” (S. 381).
Und zwar ist es eine außerordentlich einfache und wichtige
Korrelation, die als Ergebnis der universal vergleichenden Betrachtung
deutlich wird; Schmidt formuliert sie schon 1903 in
folgender Weise:331
„Steht der affixlose Genitiv vor dem Substantiv, welches er näher bestimmt,
so ist die Sprache eine Suffixsprache eventuell mit Postpositionen, steht der Genitiv
nach, so ist sie eine Präfixsprache eventuell mit Präpositionen” (382). Wir fügen
von uns aus hinzu: Mnemotechnisch ist diese Regel äußerst einfach so zu behalten,
daß jeweils am unbesetzten (vom Genitiv nicht besetzten) Wortende jene anderen
Zusätze angebaut werden.
Ausnahmen deutet Schmidt als Übergangserscheinungen und
legt Wert darauf, daß man nicht wie Wundt diese Korrelation
im wesentlichen zwar anerkenne, aber die Priorität der Genitivstellung
übersehe oder bestreite. Sondern es bleibe dabei, daß die
Genitivstellung als „das historisch Bestimmende” anzusehen ist.
D. h. allgemein sprachtheoretisch ausgedrückt, daß man das
Reihungsmoment als das primäre Fügungsmittel der Sprachen ansieht,
wogegen weder theoretisch noch empirisch vom Kenner der
kindlichen Sprachentwicklung etwas einzuwenden ist. Denn auch
im Spracherwerb des Kindes ist es so, daß die Reihung vor anderem
rezipiert und syntaktisch ausgewertet wird; die Reihung nach den
(allerdings noch älteren) musikalischen Differenzierungsmitteln. In
diesem Punkte wird Schmidt wohl recht behalten. Es ist überhaupt
kein Umsturz, sondern nur ein Ausbau seiner Theorie, ein korrektes
Zuendedenken, was von der Sprachtheorie her geleistet werden
kann. Und dazu gehört an dieser Stelle entweder die naive Frage,
wofür denn letzten Endes die nach Schmidt jüngeren phonematischen
Charakteristiken ausgewertet sind, oder gleich die vermutend
weiter ausgreifende Frage, ob am Quellpunkt des größeren Reichtums
äußerer Mittel auch eine wichtige Funktionsbereicherung zu
suchen ist. Wir setzen sie hypothetisch an und behaupten, sie bestehe
in einer Differenzierung der Fügungen in prädikative und
attributive Synthemata und schreiben zuerst eine Apologie dieser
alten grammatischen Unterscheidung.
3. Ungefähr 2000 Jahre lang wurde in den Sprachwissenschaften
die prädikative Satzfunktion durchaus korrekt unterschieden
von der attributiven Fügung im Schöße des Kompositums und der
Wortgruppen. Wofür ich mich einsetze, ist die These, daß in der
Tat nie etwas anderes als eine attributive Komplexion im Kompositum
vorliegen kann; auch in der „Wortgruppe” nicht, wenn man
den Begriff sachgemäß zu definieren versteht. Die genetische Ableitung
des Kompositums aus der Satzfügung widerspricht dem,
was ich im Auge habe, nicht. Auch die greifbare Tatsache, daß man
als Sprachkünstler das zu Prädizierende einem Kompositum oder
einem Adjektivum, Adverbium usw. eingeben und auftragen kann,
widerspricht ihm nicht. Denn man kann Nägel auch mit der Beißzange
332einklopfen und mit dem Hammer ausziehen; und doch bleibt
es ein guter und wichtiger Satz, daß der Hammer zum Klopfen
und die Zange zum Ausziehen konstruiert ist. Das Kompositum
und die Wortgruppe sind zu attributiver Fügung in la langue, soviel
auch la parole sie mit dem Gewichte prädizierender Fügungen
ausstatten mag. Und das Kompositum ist überall erst dort aus dem
Satze geboren, wo es zur Eigenfunktion als komplexes Wort zugelassen
und berufen wird. Wenn ich recht verstehe, ist dies der
eigentliche Widerstand H. Pauls gegen die „Analytiker” Wundt
und Brugmann, daß er dem Worte im Kompositum geben will,
was des Wortes ist, und dem Satze die Prädikation vorbehält.
Und genau so wie Paul denkt in diesem Punkte auch Tobler.
Die Analysen Schmidts sind vielfach auf Sprachzustände gemünzt,
in denen das Kompositum historisch schon geboren ist. Es
erhebt sich die fragende Vermutung, ob etwa alle Menschensprachen,
die heute bekannt sind, das (Wort-) Kompositum bereits gebildet
haben. Das genitivische Moment, generell gefaßt, so wie Schmidt
es tut, ist überall zu finden; allein es ist (generell gefaßt) noch gar
kein rechter Genitiv, sondern etwas mit unseren grammatischen
Kategorien kaum zu Beschreibendes, noch weitgehend Undifferenziertes.
Denn es gilt auch hier wie sonst die Regel, daß ein
sprachliches Bildungsmittel erst in Opposition zu etwas anderem,
von dem es sich abhebt, einen prägnanten Charakter erhält; die
prädikative Fügung wird prägnant in Abhebung von der attributiven.
Wenn in dieser oder jener Sprache eine solche Prägnanz noch nicht
vorhanden ist, wenn unbestimmt bleiben muß, ob dies und das in
exotischen Sprachen ein Kompositum oder Satz ist, dann braucht
der Analytiker einen neuen Begriff, den er sich eigens bilden mag.
Aber jedes Phänomen, das wirklich Genitiv heißen soll, wird sich
ausweisen und Antwort auf die Frage geben müssen, ob es zu dem
gehört, was Schmidt selbst gelegentlich in der hergebrachten Weise
als genitivus objectivus charakterisiert und aus dem eigentlich von
ihm Behandelten abscheidet, oder aber zu dem nominalen Genitiv.
Das lateinische oblivisci alicuius und die große Schar ähnlicher
Konstruktionen im Griechischen, Sanskrit usw. dürfen durchaus
nicht in eine Reihe mit den attributiven Genitiwerwendungen und
damit auf gleich und gleich mit dem nominalen Kompositum
gebracht werden. Das wäre eine sachlich ungerechtfertigte Gleichstellung.
Gleichstellen darf man nur den nominalen, d. h. nomenregierten
Genitiv mit dem von Schmidt hauptsächlich untersuchten
„affixlosen” Stellungsgefüge der fortgeschrittenen Sprachen. Es ist
333in diesen Sprachen nur innerhalb der attributiven Fügemittel so,
daß sie sich fast unbemerkt hinüber und herüber vertreten und
ausgetauscht werden können.
Zu den wohlbekannten Fehlern der nichts-als-historischen
Phase unserer Geisteswissenschaften gehört es, daß man da und dort
vor lauter Kontinuität die Punkte übersah, wo eine Strukturveränderung
liegt. Wenn man in einer Sprache, die den fortgeschrittenen
Zustand erreicht hat, übergeht von der rein satzbildenden Reihung
zur attributiven, so passiert man eine Stelle, wo ein Funktionswechsel
liegt: es wird, was ein Satzmoment war, zum Wortmoment
gemacht. Verankert ist der Sinn dieser These im Axiom D, dem Satz
vom Zweiklassensystem ‚Sprache’. Es ist bemerkenswert, daß
Schmidt, von dem wir uns (voll Bewunderung für die Kühnheit
seines Theorienbaues) führen ließen, an einer anderen entscheidenden
Stelle den von uns geforderten gedanklichen Schritt exakt vollzieht.
Dort nämlich, wo er den Begriff der Suffixe und Präfixe
definiert:
„Als Prä- und Suffixe im eigentlichen formalen Sinne des Wortes können
nur diejenigen Formen bezeichnet werden, die selbst keinerlei inhaltliche Bedeutung
mehr haben, sondern nur dazu dienen, formale, grammatische Beziehungen der
Wörter zum Ausdruck zu bringen” (S. 387).
Das ist, wie mich dünkt, scharf und korrekt. Wir verlangen
dieselbe begriffliche Klarheit in Sachen des Wortes und haben darum
das geformte Wort von vornherein trotz seiner faßbaren Komplexität
vom Kompositum abgehoben. Ein Kompositum liegt überall dort
vor, wo eine Fügung zweier Symbolwerte zu einem komplexen
Symbolwert stattfindet; unser Kriterium ist genau dasselbe, was
Schmidt mit ‚inhaltlicher Bedeutung’ treffen will.
4. Warum ist die Voran-Stellung des determinierenden Gliedes
im nominalen Kompositum die Regel und der sozusagen natürliche
Fall? Es ist ärgerlich für einen Pyschologen, diese anscheinend so
einfache Frage Schmidts nicht beantworten zu können. Wir wollen
wenigstens nicht versäumen darauf hinzuweisen, daß in der Syntax
der sogenannten Gebärdensprache, die Wundt an Taubstummen,
bei den Zisterziensermönchen und sonstwo aufgegriffen und untersucht
hat, die Nachstellung ebenso häufig ist; und das verstehen
wir. Denn die Symbole der Gebärdensprache bleiben eng in der
Anschauung verhaftet und ihre grundlegenden Kompositionen
werden unter Anschauungshilfen vollzogen. Es ist durchaus natürlich,
daß man bei der Fügung ‚blinder Mann’ voraus das Dingsymbol
‚Mann’ und dann erst das Attributsymbol ‚blind’ realisiert. Die
334Lautsprache müßte anders beschaffen sein als wir sie kennen, um
unter das gleiche Gesetz zu fallen; sie müßte ein Malfeld haben und
es kompositorisch verwenden. Die Gründe gewisser Nachstellungs-Bevorzugungen
in der Gebärdensprache fallen also weg in dem Maße,
wie die Lautsprache dem Malverfahren entwächst. Allein damit ist
nicht gesagt, daß nun die Voran-Stellung das schlechthin natürliche
sei; ich weiß nach dem früher darüber Vorgebrachten keine direkten
Argumente für sie aufzufinden. Vielleicht wird man, um an die
Sache heranzukommen, viel tiefer in die denkpsychologischen Vorgänge
des sprachlichen Komponierens eindringen oder noch einmal
zu den Historikern in die Lehre gehen müssen.
An den Verhältnissen im Deutschen fällt auf, daß ursprünglich der Akzent
die verbalen von den nominalen Kompositionen geschieden hat: „In der verbalen
ruht der Ton auf dem zweiten, in der nominalen auf dem ersten Bestandteil”
(Paul). Ist das richtig, dann ist später jedenfalls das verbale Fügen freier geworden
und überträgt heute dem Akzent Nuancen wie die zwischen durchschauen und
durchschauen, unterstehen und unterstehen, überlegen und Überligen, wozu es am
nominalen Kompositum kein Analogon gibt. Wir haben die Eigenart der verbalen
Komposita nicht besprochen und wollen auch hier mit Schmidt uns auf das nominale
beschränken. Aber ein Streifblick auf die einfache Tatsache, daß der Akzent allein
die jedenfalls semantische (und oft auch syntaktische) Differenz, welche zwischen
Bildungen wie dem ‚durchbrechen’ und ‚durchbrochen’ besteht, manifest zu tragen
vermag, zwingt zur Frage, ob die Betonung im deutschen Nominalkompositum
nicht ebenso wichtig ist wie der Stellungsfaktor, das Voran.
Schmidt beruft sich mit Recht auf unser unerschütterliches Sprachgefühl
in Sachen des Kompositums. Nun dann spiele man innerlich einmal mit Akzentverlegungen
an verkehrbaren nominalen Fügungen wie ‚Vaterhaus — Hausvater’
oder ‚Kuhhorn — Hornkuh’, wobei man den Artikel vor dem Ganzen wegläßt. Der
Effekt belehrt uns zum mindesten darüber, daß der Kompositionsnerv getroffen
ist und das „Sprachgefühl” anspricht auf Akzentverlegung. Ja, unter besonderen
Umständen ist der Starkton sogar wichtiger als die Voranstellung; wir gebrauchen
z. B. Fügungen wie ‚das Billroth-Haus’ und ‚das Haus Billroth’ nebeneinander mit
einem feinen, aber ohne jenen grundlegenden Bedeutungsunterschied, wie er zwischen
‚Hausvater’ und ‚Vaterhaus’ besteht. Man wird also den Tatbestand zum mindesten
für das Deutsche durch das Merkmal ‚Voranstellung’ allein nicht hinreichend charakterisiert
haben, sondern irgendwie in Zusammenhang bringen müssen mit dem germanischen
Betonungsgesetz. Und wer das durchführt, steht alsbald vor sehr beachtenswerten
Tatsachen.
Wir konfrontieren noch einmal das geformte Wort Hauses mit dem Kompositum
Haustor und achten auf die Betonung. Dort ist das Symbolglied (die Stammsilbe)
mit dem Akzent versehen und das Feldglied bleibt unbetont. In ‚Haustor’
liegen zwei Symbolglieder vor; welches erhält den Akzent? Das zweite Glied erweist
sich in vielen Punkten als das Standbein sozusagen des Gefüges, während
das erste als Spielbein fungiert. Denn ein Haustor ist kein Haus, sondern nur ein
Tor, ein Kuhhorn ist keine Kuh, sondern nur ein Hörn und ein Tagedieb ist kein
Tag, sondern ein Dieb und danach wird das Gefügte syntaktisch behandelt; der
Genitiv z. B. lautet des Kuhhornes. Den Akzent aber erhält nicht das Standbein des
335Gefüges, sondern das Spielbein. Soweit ist die Sachlage völlig klar und eindeutig
beschrieben für das nominale Kompositum.
Wir stellen noch einmal fest: Grammatisch regierend ist das unbetonte
Standbein des Gefüges; denn es verleiht, wo Abkömmlinge aus verschiedenen Wortklassen
gefügt werden, dem Ganzen einen Wortklassencharakter und es bestimmt
das grammatische Geschlecht des Kompositums und mit ihm die geschlechtsdifferenten
Feldzeichen. Was leistet daneben das akzenttragende Spielbein? Es ist
bildlich gesprochen ganz und gar mit der Nuancierung des Symbolwertes befaßt
und geht darin (mehr oder minder vollständig) auf. An diesem Punkte kann der
Logiker eingreifen, wenn der Begriff der attributiven Relation neu definiert und von
der prädikativen abgehoben weiden soll. Man denke zum Vergleiche noch einmal
an die verschiedenen Funktionen des und. Das und als Konjunktion fügt Sätze;
das und in komplexen Zahlwörtern bündelt so wie das Dvandva-Kompositum zwei
Gegenstände und macht (deren Selbständigkeit als Gegenstände mehr oder minder
wahrend) ein Kollektivum aus ihnen; das Merkmale häufende und dagegen greift
nicht über den einzig symbolisierten Gegenstand hinaus, sondern fügt seine definierenden
oder explizierenden Bestimmtheiten: ‚die verlorenen und nicht wiedergefundenen
Handschriften; der elegante und leichtsinnige Alkibiadis’. Genau so
wenig greift das determinierende Glied eines nominalen Kompositums über die
Nennfunktion des Standbeines hinaus und in das Satzfeld ein, sondern ist ganz und
gar mit der sozusagen internen (häuslicheren) Angelegenheit einer definierenden oder
explizierenden Bestimmung des begrifflichen oder anschaulichen Gehaltes seiner
Bedeutung befaßt. Taceat mulier in ecclesia; in Angelegenheilen des Satzaufbaues
schweigt jedes echt attributive Sprachmittel.
Wählt man diese Einsicht als Grundstein, dann lautet die Frage, welche an
das verbale Kompositum gerichtet werden muß, nicht so, ob es die gewonnene Einsicht
bestätigt, sondern anders. Es ist nunmehr die Frage, ob die verbalen Fügungen
auf dasselbe Blatt wie die nominalen zu schreiben sind. Die Antwort lautet: nein,
denn weder die verbale Kontaktfügung noch die Distanzfügung schweigt in Angelegenheiten
des Satzbaues. Die strengen Kontaktkomposita mit der (nach Paul)
ursprünglich typischen Betonung des Verbalgliedes, Wörter wie überstehen, überlegen,
übersétzen, unterstehen, die sehr häufig eine bildlich übertragene Bedeutung
annehmen, emanzipieren sich dabei oft vom Aktionscharakter ihrer Simplicia;
wir sagen z. B. eine Krankheit überstehen. Und die Distanzkomposita verhalten sich
nicht weniger frei. Denn gleichviel, ob ich eine Bildung wie durchbrechen mit dem
Simplex brechen oder mit dem strengen Kontaktkompositum durchbrechen vergleiche,
so ergibt sich, daß der akzenttragende Bestandteil durch sich keineswegs
damit begnügt, den begrifflichen Gehalt des Verbuns zu nuancieren. Der Satz um
‚durchbrechen’ herum geht oft lokalistisch weiter; man bricht durch nicht ‚etwas’,
sondern ‚durch etwas’. Doch steht freilich daneben ‚er bricht eine Wand durch,
einen Zweig ab, ein Hufeisen entzwei’, Bildungen, die ohne scharfe Grenzen hinführen
zu ‚in Scherben brechen, in die Flucht schlagen’, von denen man kaum mehr
behaupten wird, daß es Komposita sind. Einige von den engeren Kompositionen
dieser Art folgen der Formel für attributive Relationen. Ja, die Infinitive ‚zielfahren,
wettfahren’ sind schon soweit in die nominale Gruppe hineingeraten, daß sie überhaupt
keiner Tmesis mehr fähig sind, und nur als Infinitive oder Partizipien, also der
grammatischen Funktion nach dem Nomen nahegerückt vorkommen.
Ist dies ein erstes und vielfach noch rohes, aber immerhin haltbares Ergebnis
der Durchmusterung des ungemein vielseitigen verbalen Kompositums im Indögermanischen,
336dann steht also fest: die verbale Fügung muß jedenfalls insofern
scharf von dem viel einfacheren nominalen Kompositum unterschieden werden, als
sie sich nicht beschränkt auf die Nuancierung des Bedeutungsgehaltes, den das
Standbein des Gefüges mitbringt, sondern in das Satzfeld mitbestimmend übergreift.
Es war kein Zufall, daß Brugmann zuerst eine Apologie des Begriffes Distanzkompositum
schrieb und zu schreiben sich gedrängt fühlte. Denn dem Distanzkompositum
wird die Lehre der Neuerer am meisten gerecht. Sie durften auch das
verbale Kontaktkompositum, auf keinen Fall aber das nominale einbeziehen. Hier
sagte Tobler schon 1868 (Über die Wortzusammensetzung) der Richtung nach das
entscheidende Wort, nämlich daß es (prägnante) Komposita nur in flektierenden
Sprachen gibt, da sie immer erst auf Grundlage der Flexion, d. h. nachdem diese den
gesamten Sprachstoff einigermaßen durchdrungen und geformt hat, aufkommen
können (5). Man ersetze ‚Flexion’ durch die allgemeinere Angabe ‚phonematische
Modulation’ und denke nur an das rein attributive nominale Kompositum — und
Tobler ist bis heute zum mindesten nicht widerlegt. Die W. Schmidtsche These
von der Priorität des Stellungsfaktors ist damit leicht zu vereinigen; denn was der
Stellungsfaktor vor den phonematischen Modulationen geleistet hat, bleibt ja, wie
wir gesehen haben, faktisch unbestimmt bei Schmidt und darf in seiner Vogelschau
auf die Verhältnisse unbestimmt bleiben. Auch widerspricht der Satz von Tobler
der Annahme nicht, daß Fügungen wie Akropolis älter sind als die Flexionen. Denn
dies ältere muß noch kein prägnantes, d. h. rein attributives Kompositum gewesen
sein.
Soviel hier vom Unterschied der nominalen und verbalen Komposition. Eine
letzte Umfangserweiterung müßte eine systematische Komposita-Lehre durch die
Einbeziehung der aus Zeig- und Nennzeichen gefügten Wörter erfahren. Wir
streiften einiges, was dazu gehört, auf S. 143 ff.; das Hauptgebiet solcher Fügungen
aber wäre im Bereiche des flektierten Verbums zu suchen, dessen Personalendungen
Rollenzeigzeichen sind.
5. Zur Förderung des Schmidtschen Problems trägt das Gesagte
die eine, nicht unwichtige Erkenntnis bei, daß der Stellungsfaktor
ebenso interferiert oder wenigstens interferieren kann mit dem
musikalischen Fügungsfaktor des Akzentes wie mit dem Faktor der
phonematischen Modulationen. Halten wir diese Dreiteilung der
Fügungsmittel, die sich uns (S. 175 f.) rein phänomenologisch ergeben
hat, fest. Die Interferenz des Stellungsfaktors mit den
phonematischen Modulationen ist in der aufschlußreichen Schmidtschen
Korrelationsregel (s. oben S. 332) festgelegt. Das Verhältnis
des Stellungsfaktors zu den musikalischen Modulationen müßte
auf dem weiten Felde des Universalvergleiches erst einmal ordentlich
durchgeprüft werden. Wie wichtig das ist, erkennt man z. B.
an den Erörterungen Schmidts über die bekannte Bevorzugung
des Nachstellens in den romanischen Sprachen:
„Es sind die romanischen Sprachen mit ihrem Fallenlassen der alten,
organisch gewachsenen Genitivvoranstellung und ihrer immer stärker sich durchsetzenden
„analytischen” Genitivnachsetzung” (491).337
Schmidt nimmt diese Erscheinung so ernst, daß ihm ein
Grundpfeiler seiner Kulturkreisdeutung des Vor- oder Nach-Phänomens
erschüttert schiene, wenn sich herausstellen sollte, daß die
romanische Nachstellung aus innersprachlichen Ursachen entstanden
sei. Denn sonst kennt Schmidt im Gesamtbilde seines Universalvergleiches
nur äußerlich, d. h. durch Sprachmischung verursachte
Umschläge. Der Stellungswert sei im Sprachgefühl so fest verankert,
„daß es psychologisch unmöglich wäre, hier plötzliche Änderungen eintreten
zu lassen. Eine Verbindung wie z. B. ‚Haus-Vater’ können wir unter keinen Umständen
in ihr Gegenteil, in ‚Vater-Haus’ umwandeln, ohne sofort auch die
Bedeutung radikal zu ändern. Die Verbindung des Genitivs mit dem Sprachgefühl
ist so eng, daß man zunächst überhaupt keinen Weg sieht, wie sie gelöst und gewandelt
werden könnte. Auf rein innerem Wege vollzieht sie sich auch in der Tat,
wie wir gesehen haben, niemals” (495).
Wie kommt also das Italienische zu Bildungen wie capo stazione
(Stationsvorstand);. das Französische zu timbre poste (Briefmarke) und
die romanischen Sprachen allgemein zu der bevorzugten normalen
Nachstellung der Adjektivums in der (attributiven) Wortgruppe?
Da von Schmidt nicht mit Unrecht auf die feste Verankerung im
Sprachgefühl hingewiesen und auch sonst die Psychologie aufgerufen
wird, so sei mir erlaubt, ein Wort darüber vorzubringen. Dies
Sprachgefühl wird grundsätzlich geändert, wo immer phonematische
Mittel einspringen; wo sollte bei Cicero oder Horaz ein Widerstand
gegen den Stellenwechsel in Sachen des „Genitivs” angebracht sein?
Das Lateinische gehört (ganz im Sinne der allgemeinen Schmidtschen
Regel) in Sachen der Kasus überhaupt zu den Suffixsprachen und
zeigt den Zustand einer Erlösung des Reihenmomentes aus der syntaktischen
Funktion so rein und vollständig wie kaum eine andere
Sprache. Denn auch die Stellung in der Wortgruppe ist weitgehend
frei, weil die Kongruenz der Suffixe die Zuordnung des Adjektivums
zum Nomen eindeutig genug markiert. Die attributive Voranstellung
des determinierenden Gliedes kann sich im Lateinischen nur in dem
relativ seltenen nominalen Kompositum äußern, und darin ist das
Sprachgefühl des Lateiners genau so fest wie das unsere. Wenn
sich im Werdegang der romanischen Sprachen vermutlich in dem
Maße, wie die Suffix-Diakritika schwinden, gleichzeitig mit dem
Bedürfnis zu einer neuen syntaktischen Stellungsverwertung
auch das Bedürfnis einer neuen attributiven Stellungsverwertung
für die Wortgruppe geltend macht, dann kann weder die Schmidtsche
noch irgendeine andere Sprachtheorie konstruierend voraussagen,
was eintreten wird. Bildet sich aus Gründen, die nur von einer
subtilen historischen Untersuchung des Prozesses aufzudecken sind,
338ein neues „Sprachgefühl” für die Nachstellung in der Wortgruppe
aus, so erscheint es psychologisch plausibel, daß auch das quantitativ
untergeordnete nominale Kompositum mit hineingezogen
werden kann 1)111. Das ist, wie mir scheint, alles, was psychologisch
über die Nachstellung als solche zu sagen ist.
Darüber darf aber die Betonungsfrage nicht vergessen
werden; und sie belehrt uns sofort, das der Starkton dem determinierenden
Kompositionsglied erhalten bleibt in Bildungen wie
timbre poste. Wenn man Montblanc neben Weißhorn hält, so
vermindert sich (ganz im Sinne der Endabsicht in der Schmidtschen
Beweisführung) der Unterschied zwischen dem deutschen und französischen
Sprachgefühl in Sachen des nominalen Kompositums. Es
bliebe nur zu fragen, wie es sich in diesem Punkte mit den anderen
Fällen der Schmidtschen Klassen voranstellender und nachstellender
Sprachen verhält. Gibt es Sprachen, die den Akzent auf das Standbein
des Gefüges legen? Wenn ja, dann wäre dies der radikalere
Gegensatz; wenn nein, dann wäre die Spielbeinbetonung ein durchgehendes
Gesetz der nominalen Gefüge in allen Sprachen und nur
die Stellung wechselnd.
6. Kehrt die Sprachtheorie nach ausgedehnten Lernstunden
bei den intimen Kennern der Menschensprachen zu ihrem eigenen
Leisten zurück, dann vermag sie die triviale These, das Kompositum
sei wirklich ein Kompositum, d. h. ein symbolgefügtes Wort (und
zwar am reinsten das nominale), auch gegen Männer wie Brugmann,
geordnet mit einigen Argumenten, auszustatten. Brugmann ist
unzufrieden mit dem alten Namen und sähe ihn am liebsten ersetzt
durch ‚Worteinigung oder Einigungswort’.
„Indessen wir haben ja seit alten Zeiten so viel Unzulängliches und Irreführendes
in unserer grammatischen Terminologie… und werden es vermutlich
durch die Jahrhunderte weiterzuschleppen haben, daß man auch die ‚Zusammensetzungen’
nicht so bald abschütteln wird” (400).
Mir scheint, symbolgefügtes Wort expliziere den Tatbestand,
wenn es nötig ist; sonst war der alte Name durchaus sachgerecht.
Jedenfalls ist vor allem das nominale Kompositum auch als ‚Einigungswort’
ein Wort; wir können alle Merkmale des Wortbegriffes
an ihm verifizieren. Es hat erstens ein eigenes Klanggesicht,
dessen Betonungsregeln bis heute nur teilweise wissenschaftlich
339bestimmt sind, und manchmal treten auch phonematische Modifikationen
am symbolgefügten Wort auf wie in erlauben — Urlaub und erteilen
— Urteil der Paulschen Liste. Das Kompositum erweist sich
zweitens als feldfähig und gehört einer bestimmten Wortklasse an.
Das symbolgefügte Wort verhält sich im Satzfeld im ganzen genau
so wie ein Simplex; alle syntaktischen Relikte in seinem Schöße sind
wie verschluckt und bleiben unberührt, wo dies Gebilde seine „grammatische
Verwendbarkeit” im konkreten Fall beweist und selbst
mit Feldzeichen versehen wird. Die Sprache selbst befolgt die Parole
Brugmanns und bringt am Kompositum neue Feldzeichen an,
gleichgültig, „ob ein Typus in vorhistorischer oder in historischer
Zeit aufgekommen ist” und wie wenig oder wieviel der ehemaligen
Feldzeichen es noch in sich enthalten mag. Ob ‚Akropolis’ oder
‚Mannsbild’, der Genitiv des Kompositums wird gebildet, als ob
es ein Simplex wäre: άκροπόλεως, des Mannsbildes. Hier bewährt
sich das zweite Meillet-Kriterium des Wortbegriffes.
Daß die phonetischen und phonematischen Charakteristika
der unitas multiplex, von der wir sprechen, am Kontaktkompositum
ein wenig anders als am Distanzkompositum ausfallen,
ist richtig und verständlich. Die Korrektur, welche Brugmann
als Verfechter der Innenansicht an den Bestimmungen der
Außenansichtler Paul und Willmanns anbrachte, lautet in knappster
Fassung etwa so: Ihr habt recht mit eurem Hinweis darauf, daß
das Kontaktkompositum einer Akzentgestaltung untersteht, deren
das Distanzkompositum nicht fähig ist; ihr habt recht mit eurem
Hinweis auf die Folgen, die daraus entspringen: es heißt lateinisch in
schlicht-syntaktischer Fügung „sub vos placo” nicht „sub vos plico”,
wie „supplico vos” (394); auch verfällt das Kontaktkompositum
in der Sprachgeschichte viel häufiger dem Schicksal der Isolierung,
was seltener dem Distanzkompositum widerfährt aber doch auch
bei ihm vorkommt. Vgl. das deutsche wahrnehmen oder durchbleuen
(Simplex mhd. bliuwen ‚schlagen’, das als Simplex ausgestorben
ist). Allein euere Charakteristik ist unvollständig. Es sind zwar
nicht dieselben, aber es müssen irgendwelche, z. B. musikalische
Gestaltbindungen, sein, welche die Glieder des Distanzkompositums
in jedem Verwendungsfall äußerlich wahrnehmbar einen.
Was die demnach stets auch am Klanglichen aufscheinende
Wort-Einung, sematologisch auszeichnet, ist die Tatsache, daß die
syntaktischen Momente in seinem Schöße nicht aufgehoben und
gänzlich verwischt sind. Füge ich ein aktives Verbum mit einem
Nomen zum Kompositum, so kann es sein, daß das Nomen in den
340Objektkasus gerät wie im Beispiel Schuhmacher oder in den Subjektkasus
wie in Meistersinger. ‚Gesundbeter’ und ‚Hellseher’ illustrieren
andere Verbalergänzungen, ‚Weihgabe’ und ‚Leihgabe’ verdeutlichen,
wie selbst durch die Nomenform des zweiten Bestandteiles
hindurch noch die Verbalwurzel in verschiedener Weise regierend
bleiben kann usw. Das sind äußerst interessante und aufschlußreiche
Verhältnisse, die wir nur streifen und als Sprachtheoretiker
keineswegs auf eigene Faust systematisch behandeln können. Zu
guter Letzt aber müßte wohl jeder systematischen Behandlung ein
Satz des Inhaltes nachgeschickt werden, daß vieles in den Kompositionen
nur angedeutet wird und vom Stoff her einer Bedeutungspräzision
bedürftig ist wie in unserer immer wieder brauchbaren
Serie ‚Backofen, Backstein, Backobst’ usw. Wer je in die Lage
kam, deutsch konzipierte wissenschaftliche Gedanken englisch
wiederzugeben, vermag ein Lied zu singen über die Verlegenheit,
in die man oft gerät, wenn deutsch nur angedeutete Beziehungen
englisch ausgedeutet werden müssen; es sind nach meiner Erfahrung
in der Regel die bequemen deutschen Komposita, welche drüben
als Blankoschecks nicht angenommen werden, sondern eingelöst
werden müssen.
Daß nahezu die gesamten Satzfügungsmittel im Schöße der
deutschen Komposita wiederkehren, sei also noch einmal als Faktum
anerkannt. Allein dicht daneben steht das andere Faktum, daß
jeweils und streng gesetzlich ein Feldbruch aufzuzeigen ist zwischen
der wortimmanenten Fügung eines Kompositums und dem Satzfeld,
in das dieses Kompositum eingeht. Wenn einer ‚men Schuhmacher
oder den Gesundbeter oder den Tagdieb durchbleut’, so
hat der Akkusativ in Schuh usw. nicht das mindeste mit den Kasus
im Satzfeld zu tun; denn dort könnte ebensogut eine Genitivkomponente
stehen. Es war wohl letzten Endes diese Einsicht in
den Feldbruch, welche die Zusammenstellung der Komposita mit
den Nebensätzen in dem feingeschliffenen Buch von Hermann
Jacobi „Compositum und Nebensatz” (1897) begründet hat. Kompositum
und Nebensatz haben viel miteinander zu tun. Aber dies
unterscheidet sie, daß der ausgewachsene Nebensatz nicht wie das
klare Kompositum feldfähig ist und z. B. nicht mit Kasusformantien
im ganzen versehen werden kann wie ‚Akropolis’ und ‚Mannsbild’. Daß
es Übergangserscheinungen im Reiche der Komposita gibt, will ich
nicht bestreiten; die Beispiele der vier letzten Gruppen in der Liste
H. Pauls, jene „Satzkomposita” also, sind nicht feldfähig, sondern
bleiben, wo immer sie eingesetzt werden mögen, im Satzfeld liegen
341wie erratische Blöcke oder wie Vokative und Interjektionen. Ebenso
gibt es in den meisten Sprachen merkwürdige Feldfusionen zwischen
regierenden und abhängigen Sätzen. Allein, es hieße sich viele
sprachtheoretische Einsichten versperren, wenn man den normalen
Feldbruch dort und hier leugnen wollte, deshalb, weil manchmal
merkwürdige Zwischenerscheinungen auftreten. Denn es sind ungemein
leistungsfähige Gelenke der menschlichen Rede, die im Feldbruch
zwischen den abhängigen Sätzen selbst ausgebildet werden;
und es ist etwas wesentlich anderes, was aus dem Feldbruch zwischen
Kompositum und Satz entsteht. Mehr davon im letzten Paragraphen
dieses Buches.
§ 23. Die sprachliche Metapher.
Im Schwarzwald steht ein Baum, den nennt man Hölzlekönig;
nicht weit davon ein anderer, die Hölzlekönigin. Der König
und die Königin sind weit und breit die schönsten Stämme und
wahrhaftige Baumriesen. Wir wollen die Sprechweise untersuchen,
die solche Komposita bildet und darüber hinaus die sprachliche
Metapher allgemein ins Auge fassen. Wer die sprachliche Erscheinung,
die man Metapher zu nennen pflegt, einmal anfängt zu beachten,
dem erscheint die menschliche Rede bald ebenso aufgebaut aus
Metaphern wie der Schwarzwald aus Bäumen. Komposita wie
‚Fingerhut, Handschuh, Tischbein’ sind Metaphern; wenn ich von
einem Ehepaar sage ‚er ist ein Elefant und sie ein Reh’, so bietet
sich dasselbe Begriffswort Metapher wieder an; und so hinab bis
zu den sinnlichen Metaphern ‚helle, scharfe Töne (oder dunkle,
weiche), Tonfarbe, Farbenton, süße Freude, bitteres Leid, kalter
Mord, düstere Pläne’ und bis hinauf zu kühneren und ausgesuchten
Bildern bei Rhetoren, Dichtern und Philosophen. Die weitausgesponnenen
Beispielsammlungen der antiken Rhetorik, welche vorwiegend
für didaktische Zwecke angelegt wurden, sind sprachtheoretisch
steril, soweit meine Kenntnis reicht; moderne Forscher
sind vielfach in erlebnispsychologischen Fragen, die gewiß auch
dazu gehören, stecken geblieben 1)112. Mir schwebt als sematologisches
342Kernstück einer wohlaufgebauten Lehre von der Metapher etwas vor,
was im unmittelbaren Anschluß an die Undverbindungen und an
das Kompositum ausgeführt werden muß. Denn metaphorisch
in irgendeinem Grade ist jede sprachliche Komposition und das
Metaphorische ist keine Sondererscheinung.
1. Als metaphorisch empfunden wurden von den psychologischen
Experten Stählin 1)113 so einfache sprachliche Kompositionen
wie ‚der greise Wald’; die Versuchspersonen gaben an,
daß sie durch das Beiwort an bestimmte Eigenschaften, z. B. die
Rinde alter Bäume oder an wirr herabhängende Flechten, erinnert
und in einer eigentümlichen Weise der Überlagerung und des Ineinander
von zwei Bedeutungssphären (Mensch — Baum) dabei inne
werden. Wenn man parallel dazu ‚ein verwitterter Greis’ bildet, so
werden es ähnliche Eigenschaften des Aussehens alter Menschen
sein, die im Erlebnis unterstrichen sind. Nur diesmal natürlich
gedacht (und vielleicht auch innerlich gesehen) an einem Menschen;
und zwar so, als ob sie diesmal herübergenommen wären aus der
Sphäre ‚Gemäuer, Felsen’. Die subtilen Erlebnisanalysen in Stählins
Arbeit erbringen also den Beweis, daß der von den Griechen erfundene
und zunächst auf die umständlich durchgeführten poetischen und
rhetorischen Vergleiche gemünzte Terminus Metapher auch für die
Erlebnisanalyse zu Recht besteht und treffend ist. Im Erlebnis ist
oft (selbst bei den einfachen Beispielen, die wir absichtlich gewählt
haben) eine Sphären-Zweiheit und so etwas wie das Hinüber von
einer in die andere nachweisbar und verschwindet erst bei großer
redensartlicher Geläufigkeit der Kompositionen.
Wir treiben hier weder Stilistik noch Erlebnispsychologie,
sondern überlegen als Sprachtheoretiker, welche Bewandtnis es mit
der Allverbreitung metaphorischer Wendungen und Techniken in
der darstellenden Sprache hat. Ist diese Sphärenmischung nicht
ein sehr merkwürdiges Cocktailverfahren und wozu das Ganze?
Der Sprachhistoriker wird z. B. durch die Tatsachen des Bedeutungswandels
zum Nachdenken über das Phänomen der Metapher geführt
und konstatiert, daß viel ursprünglich Metaphorisches im Lauf
der Sprachgeschichte allmählich nicht mehr als solches empfunden
worden ist. Jean Paul, der romantische Dichter, faßt diese Tatsache
343in das bekannte (metaphorische) Wort von den ungezählten
vergilbten Metaphern der Sprache. Hermann Paul aber, der
prosaische Linguist, macht sich aufschlußreicher den folgenden Vers
zu dem sprachhistorischen Phänomen der Metapher:
„Die Metapher ist eines der wichtigsten Mittel zur Schöpfung von Benenungen
für Vorstellungskomplexe, für die noch keine adäquaten Bezeichnungen existieren.
Ihre Anwendung beschränkt sich aber nicht auf die Fälle, in denen eine solche
äußere Nötigung vorliegt. Auch da, wo eine schon bestehende Benennung zur Verfügung
steht, treibt oft ein innerer Drang zur Bevorzugung eines metaphorischen
Ausdrucks. Die Metapher ist eben etwas, was mit Notwendigkeit aus der menschlichen
Natur fließt und sich geltend macht nicht bloß in der Dichtersprache, sondern
vor allem auch in der volkstümlichen Umgangssprache, die immer zu Anschaulichkeit
und drastischer Charakterisierung neigt. Auch hiervon wird vieles usuell, wenn
auch nicht so leicht wie in den Fällen, wo der Mangel an einer anderen Bezeichnung
mitwirkt.
Es ist selbstverständlich, daß zur Erzeugung der Metapher, soweit sie natürlich
und volkstümlich ist, in der Regel diejenigen Vorstellungskreise herangezogen
werden, die in der Seele am mächtigsten sind. Das dem Verständnis und Interesse
Fernerliegende wird dabei durch etwas Näherliegendes anschaulicher und vertrauter
gemacht. In der Wahl des metaphorischen Ausdruckes prägt sich daher die
individuelle Verschiedenheit des Interesses aus, und an der Gesamtheit der in einer
Sprache usuell gewordenen Metaphern erkennt man, welche Interessen in dem Volke
besonders mächtig gewesen sind.
Eine erschöpfende Übersicht über alle möglichen Arten der Metapher zu
geben, ist eine kaum zu lösende Aufgabe. Ich begnüge mich damit, einige besonders
gewöhnliche kurz zu besprechen” (94f.).
Noch einmal kurz: Eine Hilfe aus Ausdrucksnot, wenn der
Wortschatz versagt, und ein Mittel zu drastischer Charakterisierung
ist die Metapher nach Paul. Und da die Regel gilt, daß Unbekanntes
nur durch Bekanntes, Interesseferneres durch Interessenäheres bestimmt
werden kann, so liefert sie dem Historiker die genannten
Indizien. Das sind drei beachtenswerte Stichworte, zu denen wohl
jeder Historiker aus seinem Spezialgebiet die passenden Belege in
Fülle beizubringen vermag; Paul selbst bringt sie aus dem Deutschen
(95ff.). Matt und unbestimmt dagegen kommt mir der Zusatz vor,
daß die Metapher „mit Notwendigkeit aus der menschlichen Natur
fließt”. Es wäre gewiß befriedigender, wenn man solches Ausfließen
strenger und einleuchtender in Korrelation bringen könnte mit Ausdrucksnot
und Ausdrucksdrastik zugleich und im Hintergrund den
Anschluß fände an die Grundtatsachen des lautsprachlichen Symbolisierens
überhaupt. Die weiter führende Frage lautet: Was
ist im Vergleich mit der Undverbindung und dem gewöhnlichen
Kompositum die spezifische Leistung des sphärenmischenden Komponierens?344
Es gibt außerhalb der Sprache in den verschiedensten Darstellungstechniken
fernere und nähere Parallelen zu dem sprachlichen
Mischverfahren der Metapher. So hat Galton z. B. mehrere
Menschen nacheinander auf dieselbe Stelle einer photographischen
Platte aufgenommen, um der Technik des Photographierens dem
Erfolg nach etwas abzulisten, was man sonst nur als Produkt psychophysischer
„Verarbeitung” und aus der darstellenden Kunst kannte,
nämlich das Typenbild. Näher heran noch an das zu Erläuternde
reicht die bekannte Leistung des Doppelauges, daß sich dasselbe
Ding auf zwei Netzhäuten abbildet und unter normalen Bedingungen
doch nur einfach gesehen wird; einfach und plastischer als mit jedem
Auge allein, wenn die geringfügigen Bilddifferenzen (ihre Querdisparation)
für den Effekt des exakteren und schärferen Tiefensehens
verwertet wird 1)114. Viel wichtiger aber ist für den angestrebten
Vergleich der Hinweis darauf, daß bei der binokularen Vereinigung
alles wirklich Disparate, was sich nicht vereinigen ließe,
ausfällt. Das Galton-Bild zeigt verwischte Konturen, das binokulare
Bild nicht und ebensowenig das metaphorisch Charakterisierte.
Ich unterstreiche das zuletzt Gesagte und will zur Abwechslung
zwei von Kindern produzierte Metaphern als Zeugen anrufen: ‚Die
Suppe hat den Schnupfen’ und ‚der Schmetterling strickt Strümpfe’.
Dort war ein Blase auf der Suppenoberfläche im Teller entstanden
und hier kreuzte ein sitzender Schmetterling seine langen Fühler
wechselnd rechts über-, links übereinander, genau wie es die Großmutter
macht mit langen Stricknadeln. An solchen Fällen wird
uns deutlich, daß das sphärenmischende Komponieren die psychophysisch
einfachste Abstraktionstechnik ist, zu der im Originalfall
psychophysisch denkbar wenig gehört. Überall dort nämlich, wo
ein eindrucksvolles, wahrgenommenes Phänomen Ausdrucksnot aus
Wortmangel erzeugt oder eine drastische Charakteristik fordert.
Nicht mehr (aber freilich auch nicht weniger) leistet der Sprachschöpfer
in diesem Falle, als daß er das Eigentümliche sieht und
345daß ihm das Grundgesetz der sogenannten Ähnlichkeitsassoziation
zu Hilfe kommt. So entstehen im Kinderleben die ungezählten
merkwürdigen Benennungen, welche niemand aufschreibt; es sei
denn, daß zufällig einmal etwas Besonderes für die Ohren bewundernder
Eltern dabei herauskommt.
2. Wir sind nicht mehr weit vom Ziele. In meiner „Ausdruckstheorie”
werden ausführlich die Tatsachen der sinnlichen Metapher
behandelt, die kein Rätsel aufgeben, wenn man sich an das von
Piderit und Wundt im Bereich der menschlichen Mimik Gefundene
und Gedeutete hält. Das ‚bittere’ Leid und das ‚süße’ Glück und
der ‚sauere’ Verzicht sind keine freien Erfindungen der Dichter,
sondern sichtbare Ausdrucksphänomene auf menschlichen Gesichtern.
Darüber muß der Interessierte die im Ausdrucksbuch vorgelegten
Dokumente anhören. Das Zusammenbringen der sprachlichen
Fassung ist hier nicht produktiv, sondern gibt nur wieder, was in
jedem Sehen und Verstehen des gewachsenen menschlichen Ausdrucks
schon zusammen gesehen wird.
Nicht faktisch zusammengesehen oder eines neben dem andern
vergleichend wahrgenommen war in unserem Beispiel aus Kindermund
das Stricknadelspiel der Großmutter und das Fühlerspiel des
Schmetterlings. Es wäre vermutlich eine vergebene Liebesmühe, die
strickende Großmutter und den sitzenden Schmetterling im Experiment
mit Kindern räumlich zusammen zu bieten, um eine derartige
Metapher zu provozieren. Ausgeklügelte Einfälle lassen sich
nur schwer provozieren und jene kindliche Metapher war ein ‚freier’
Einfall. Zusammengeraten sind in ihm zwei Situationsbilder kraft
eines Erinnerungsvorgangs, worin das spielerische Moment stark
unterstrichen werden muß. Den Anstoß bildete eine kontemplative
Betrachtung des Wahrgenommenen und in ihr das Erhaschen eines
fruchtbaren Momentes. Sonst lernen die Kinder an solch fruchtbaren
Momenten die Ereignisse ihrer kleinen Welt physiognomisch
zu charakterisieren: daß auch die Katzel ‚greift’ und der Stuhl
‚steht’ und ‚hinfallen’ kann auf den Boden wie ein Kind und so
in infinitum 1)115. Unsere eigene Umgangssprache ist im prosaischen
Gebrauch noch voll bis an den Rand mit derartigen physiognomischen
Charakteristiken; das ist ein gut Teil ihrer „vergilbten”, d. h.
unauffälligen Metaphern.346
Man variiere nun den Fall der Stricknadelmetapher so, daß
eine märchenerzählende Großmutter das von einem einzelnen Kinde
Gefundene in die sprachliche Schilderung eines Schmetterlings aufnehmen
und für andere Kinder wiederverwenden wollte. Sie hätte bestimmt
kein Glück, wenn es wie sonst im Märchen bei Worten allein
bliebe, wenn die Erzählerin nicht etwa zu einer Demonstration die
Stricknadeln ergriffe. Wie steht es mit den weit ausgesponnenen Metaphern
in den homerischen Erzählungen? Homeros ist nach alter Vereinbarung
blind und wäre ein schlechter Demonstrator, wenn ähnliches
irgendwann einmal bei seinen ungezählten und oft sehr verwickelten
Metaphern nötig wäre. Seine Hörer sind auch keine Kinder, wohl aber
erwachsene Menschen, denen es bei all ihrem praktischen Wissen von
der Welt noch eine Quelle primärer Funktionslust gewesen sein muß,
im Phantasma hin und her an heterogenen, umständlich und behaglich
charakterisierten Situationen die Sphärenmischung der Metapher zu
vollziehen. Kindermärchen sind äußerst sparsam an sprachlichen
Vergleichen, Homeros schwelgt darin; er bietet, was Kinder prinzipiell
nicht leisten können, auch wenn man mit dem erzählend vergleichenden
Umblick ganz in der Kinderstube bliebe 1)116. Die mir
sonst unbekannte Mentalität der homerischen Hörer stelle ich mir
so vor, daß Funktionslust an Sphärendeckungen mit Abstraktionserfolgen
darin vorkommt; wesentlich anders vermutlich wie uns
dürfte ihnen gerade dieses Abstraktions verfahren noch eine frische
Quelle der Funktionslust gewesen sein. Gewiß erquicken auch wir
uns an den homerischen Bildern; doch gehört, wenn ich mich nicht
täusche, eine künstliche Reduktion der Ansprüche bei uns dazu
ungefähr so, wie wir uns sogar auf die weit fernere Mentalität des
Kindermärchens reduzieren und dadurch den Einlaß in das sonst
verlorene Paradies des früh kindlichen Phantasierens verschaffen
können 2)117.
3. Eine exakte Verifizierung des hier skizzierten und ursprünglich
an Kinderbeobachtungen konzipierten Modellgedankens über
347die Metapher erfordert mehr als ich bis heute ausführen konnte.
Die einfachste technische Analogie zu dem besagten Modell wäre
etwa die folgende: Wenn ich in einen Projektionsapparat an Stelle
eines Diapositivs eine lichtundurchlässige Pappscheibe mit ausgestanzten
Löchern gebe, werden auf der Leinwand Lichtflecke
von der Form meiner Löcher sichtbar. Schiebe ich dazu eine zweite
Scheibe mit anderer Lochung hinein, dann entsteht auf der Leinwand
ein Differenzphänomen, d. h. Lichtflecke nur soweit, als Loch
oder Lochteil der einen Scheibe auf ein Loch in der anderen trifft.
Sind meine Öffnungen lange Spalten und irgendwie, z. B. parallel
auf jeder Scheibe aber in beiden in verschiedener Richtung angeordnet,
wie in folgender Skizze, dann erhalte ich als Differenzbild
ein wieder leicht übersichtliches Muster:
image
Fig. 9.
Dies technische Modell am Skioptikon ist uns nicht rein zufällig
in die Feder geraten, sondern soll miterläutern, daß der konstruierende
Aufbau von Bedeutungsgefügen einen projektivischen
Charakter, eine projektivische Komponente enthält. Ich hoffe mehr
als diese Andeutungen auf exakter Grundlage in anderem Zusammenhang
bieten zu können; das Projektivische (Zentrifugale) in scheinbar
reinen Rezeptionsvorgängen muß zuerst in der schlichten Wahrnehmung
und an bestimmten merkwürdigen psychopathologischen
Ausfallserscheinungen gesehen und studiert sein, bevor man hoffen
darf, es in der höheren Region des Sprechdenkens systematisch zu begreifen.
Die Frage ist, ob ein Doppelgüter oder Doppelfilter im technischen
Bereich Leistungen ermöglicht, die als Analoga zu den ungemein
feinen Abstraktionswirkungen der metaphorischen Sphärendeckung
betrachtet werden dürfen. Wenn ich im Munde der Schwarzwaldbewohner
den Namen Hölzlekönig finde für einen Baum, den
ich noch nicht gesehen habe; wenn ich den Ausdruck sofort verstehe
und mit H. Paul als eine „drastische” Charakteristik empfinde,
so erwächst mir als Psychologe die Aufgabe, die Entstehung
meines Phantasiebildes im Anschluß an jenen Ausdruck psychologisch
(psychophysisch) in einfacher Weise begreiflich zu machen.
Die Begriffssphäre Wald und die Begriffssphäre König werden
vereinigt; dasselbe Gesamtobjekt soll beiden zugleich genügen. Ich
348denke also Königliches einem Baum an. Daß ich gerade so und nicht
umgekehrt verfahre, das lehrt mich das metaphorische Kompositum
allein noch nicht, ein ‚Hölzlekönig’ könnte auch ein Mensch
sein, dem ich ein Waldreich zudenke und mit dem Wald eine königliche
Rolle unter anderen Besitzenden. Dann läge ein wesentlich
anderer Fall vor. Wenn ich aber das Wort lese oder höre im Kontext
des ersten Satzes, mit welchem dieser Paragraph beginnt, ist jedes
Schwanken ausgeschlossen. Die Zusammenstellung „ein königlicher
Baum” täte ungefähr dieselben Dienste, wirkt nur weniger
„drastisch” in jener Textstelle und wäre obendrein noch mehrdeutig.
Ginge ich analytisch vor und setzte unmetaphorisch Adjektiva zu
dem Namen ‚Baum’ (der größte, der schönste, überragend, beherrschend),
so müßte ich sie häufen, um einigermaßen denselben
Bedeutungs- und Vorstellungseffekt zu erreichen wie durch die
Sphärenmischung.
Die selektive Wirkung der Sphärendeckung braucht kaum
eigens herausgearbeitet zu werden; man halte irgendein neugeschliffenes
anderes Beispiel oder die abgegriffene Metapher
‚Salonlöwe’ daneben: ‚Freund N. ist ein Salonlöwe geworden’. Es
gibt am Wüstenbewohner ‚Löwe’ gar viele sprichwörtlich fixierte
Eigenschaften, darunter auch Blutgier und Kampfgeist. Die Sphäre
‚Salon’ aber deckt sie ab, genau wie die Baumsphäre alle nicht
passenden Königseigenschaften abdeckt; ich werde auf dem Spaziergang
im Schwarzwald zum Hölzlekönig nicht Krone und Purpurmantel
und beim Rendez-vous mit Freund Salonlöwe nicht Blutdurst
und männlichen Kampfgeist erwarten. Wie solches Abdecken
zustande kommt im psychophysischen System, ist eine der
zentralen Fragen an die Sprachpsychologie.
Denn die prägnante Metapher ist trotz ihrer Häufigkeit eine
Sondererscheinung, das Gesetz der Abdeckung aber allgemein. Wir
könnten am Kompositum das Faktum der (echten Ehrenfelsschen )
Ubersummativität attributiver Bedeutungsgefüge illustrieren, indem
wir den Finger auf das Plus legten, das in Gefügen wie ‚Backofen’ und
‚Backstein’ vom Sachwissen her hinein getragen wird. Allein das damit
Gesagte bliebe eine halbe Wahrheit, wenn nicht das Faktum der
Untersummativität hinzu erläutert würde. Abdecken, Ausfall, Selektion,
Differenzeffekt sind Ausdrücke für ein und dasselbe schlichte
Phänomen, welches man dem in der Gestalttheorie seit Ehrenfels
allein hervorgehobenen Kriterium der Übersummativität an die Seite
stellen muß, um die attributiven Komplexionen in der Sprache vollständig
zu beschreiben.349
Die reine Logik kommt und forciert von den Begriffszeichen
das eine, die Bedeutungskonstanz: dasselbe Wort — dieselbe Bedeutung
überall, wo es verwendet wird. Daß der intersubjektive
Verkehr mit Zeichen der gewachsenen Sprache diese Forderung nur
äußerst unvollkommen erfüllt, haben die Kritiker der Sprache seit
dem klassischen Altertum häufig und ausführlich genug demonstriert.
Der Verfasser dieses Buches gehört zu den Liebhabern der gewachsenen
Sprache und zieht es vor, sie erst zu belauschen und
wissenschaftlich nachzuzeichnen, was vorliegt, bevor er ins Hörn
der Kritiker bläst. Und findet, daß der spanische Stiefel seine Vorteile
z. B. für den Reiter haben mag; stolze Reiter auf starren, wohldefinierten
Wortbedeutungen sind die klaren Sprecher der Wissenschaft.
Andere Vorteile aber bietet dem intersubjektiven Verkehr
eine gewisse Plastizität der Bedeutungssphären unserer Nennwörter.
Daß man mit Freiheitsgraden im Maschinenbau arbeiten kann und
arbeiten muß, weiß die moderne Technik; die Organismen wissen
es schon viel länger. Und die Freiheitsgrade der Bedeutungssphären
unserer Nennwörter sind wie die oft reichlich komplizierten modernen
Maschinen und wie die Organe der Organismen durch bestimmte
Sicherungseinrichtungen korrigierbar gemacht. Übersummativität
und Untersummativität der attributiven Komplexionen erhöhen in
erstaunlichem Ausmaß die Produktivität der Sprache und machen
lakonisches Nennen möglich. Wozu freilich gehört, daß im Systeme
selbst auch eine Korrektur der Unbestimmtheiten und Mehrdeutigkeit
dieser Komplexionen zubereitet ist.
Noch etwas gehört dazu und muß als Vordersatz zur Lehre
vom Abdecken störender Momente beim sphärenmischenden Verfahren
eigens ausgesprochen werden. Es ist die Tatsache, daß wir
das Wort aus dem Munde unserer Mitmenschen im Großen und
Ganzen als verstehenswillige Hörer entgegennehmen. Wir machen
beim normalen Sprechverkehr die durchaus begründete Voraussetzung,
daß der Sprecher sinnvolle sprachliche Kompositionen
bildet, und variieren bei schwer vereinbaren Redestücken probierend
aus, wie sie am Ende doch noch ein Gefüge zulassen. Manchmal
ist es wie beim Rätselraten. Das richtige Rätsel verlangt ungewöhnliche
Leistungen variierenden Probierens; leichtere Rätsel und nicht
eigens als Spürsinnsprüfer erdacht sind manche Metaphern. Wir
müßten tiefer als heute das Gesetz der Sphären in unserem Sprechdenken
erfaßt haben, um mehr als aphoristische Beobachtungen
darüber bringen zu können. — Doch nun zu einem ganz anderen
Deutungs- und Erklärungsversuch der sprachlichen Metapher.350
4. Aufsehen erregte 1919 unter den Sachverständigen das Buch
von Heinz Werner über die sprachliche Metapher 1)118. Mit Recht
wie mich dünkt; denn es enthält eine große Sammlung metaphorischer
Namen und sprachlicher Wendungen aus dem Vorrat der weniger
bekannten Menschensprachen und den energischen Anlauf zu einer
theoretischen Bewältigung der vielgestaltigen Phänomene. Werners
Grundgedanken sind im 8. Kapitel „zusammenfassende Entwicklungspsychologie
der Metapher” schon den Überschriften abzulesen: 1. Die
Hauptentwicklung der M. aus dem Geiste des tabu; 2. Die Entwicklung
der echten Metapher durch Motivwandlung; 3. Die Entwicklung der
Metapher durch Rückläufigkeit des Metaphorisierungsprozesses;
4. Die degenerative Entwicklung der echten Metapher aus der
Pseudometapher. — Was ist echte und was ist eine Pseudometapher?
Es entsteht in der Regel ein klärender Fortschritt, wenn ein
Neuerer, der das Zeug dazu hat, einer tradierten Lehre so widerspricht,
wie die Antithesis der Thesis. Nach Werner entsprang
die echte Metapher einmalig aus dem Geiste des tabu und dient
nicht dem Hervorheben, sondern einem Verhüllungsbedürfnis:
„Zu (den) pseudometaphorischen Bildungen gehört die Metapher aus Ausdrucksnot
und aus Abstraktionsnot wie die der anthromorphistischen Anschauung.
Wollen wir über den objektiven Schein hinaus einzig den subjektiven Tatbestand
gelten lassen, so werden wir diese Einstellungen als Urwurzeln des Gleichnisses
abweisen müssen, wenngleich wir zugeben, daß sie als Vorübung und Vorbildung
des gleichnismäßigen Denkens ihren Wert haben, der allerdings erst durch die bedeutende
Motivwandlung im tabuistischen Zeitalter nutzbar wird” (190).
Es wird also das alte Denkmodell der Sachverständigen nicht
gerade a limine abgewiesen, aber doch in den Winkel gestellt; die
„Vorübungen” des unbefangenen gleichnishaften Denkens, aus denen
wir das Kind und die homerischen Bilder zu verstehen glaubten,
genügen nicht. Sondern die Menschheit mußte in frühen Phasen
dem Zwang des tabuistischen Verhüllungsbedürfnisses unterworfen
sein, damit aus ihm die echte Metapher entsprang und allgemeine
Verbreitung in den Sprachen der Nachtabu-Völker fand. Beweis:
Die Gleichnisarmut der Vortabu-Sprachen, welche folgendermaßen
erklärt wird:
„Der Nomade kann seine Affekte ungehemmt ausleben, ohne Störung vollzieht
sich ihm der Ausgleich zwischen der Erregung und ihrer Ausfuhr. Daher
finden wir selbst hochstehende Nomadenvölker (wie einen großen Teil der Indianer
Nordamerikas, die Massai in Afrika), welche eine außerordentliche Armut an
tabuistischen Bildungen zeigen. Der Nomade ist gewiß ebenso furchtsam wie der
Seßhafte, seine Furcht findet aber ihre sofortige Ausleitung, zumindest durch
351Flucht; der Seßhafte muß die Unbill ohnmächtig auskosten. Der Nomade ist das
Kind des Augenblicks. Der Austausch objektiver und subjektiver Kräfte vollzieht
sich ihm ausschließlich in der Gegenwart. Der Seßhafte hingegen ist Zukunftsund
Vergangenheitsmensch” (191).
Es erwacht im Seßhaften die Sorge und die Erinnerungsbedrängnis, „jeder
Baum und Stein kann Merkzeichen einer glücklichen Vergangenheit sein, die
Wehmut- oder einer unglücklichen, die Bitterkeit hervorruft” (ebenda; warum
so pessimistisch?). Ein Ausweichen ist die Verhüllungstechnik des Worttabu.
Man zeichne das Zitierte ein in das Bild einer restlos erlebten
magischen Weltansicht und beachte, daß das Ganze vom ersten
Satze an nicht als eine Angelegenheit der Darstellung, sondern des
Ausdrucks, d. h. der freien oder gehemmten Entladung von Affekten
behandelt wird. Dann hat man die tragenden Gedanken der Wernerschen
Theorie beisammen. Werner schildert an der Hand seiner
Dokumente die Erscheinungsformen der Metapher und findet, das
erste sei überall die „dingliche Metapher”.
„Während bei den Australiern die rein sprachliche Metapher noch arg
im Primitivsten steckt, etwa rein generalisierende Metaphorik die ganze Ersatzbildung
ausmacht, ist die Metapher, die durch die symbolische Hineinsicht in die
Dinge zustande kommt, schon relativ entwickelt. Wir finden hier hochgebildete
Dingmetaphorik bei gering entwickelter Vorstellungs- und Wortgleichnismäßigkeit.
Die psychologische Wurzel der Dingmetaphorik ist nicht wie auf der Höhe poetischer
Bildung: Anpassung der Vorstellungswelt an einen künstlerischen Willen, sondern
Hineinsicht in vorhandene Naturgestalten. Auf dem Wege der Erhebung eines geläufigen
Vorgangs zum Gleichnis entwickelt sich die zweite Stufe, in der ein vorstellungsmäßiger
Ausdruck für einen tabuierten nicht bereits in der Umwelt vorgefunden,
sondern in der Vorstellungswelt erst gesucht werden muß” (194).
„Die dritte Stufe, zu der allerdings von der vorhergehenden mancherlei
Übergänge hinüberführen, stellt der seßhafte Kulturzustand dar, dessen Träger es
nicht vermögen, die Furcht rein motorisch durch Verlassen des Sterbeortes zum
Erlöschen zu bringen. So entwickelt man allerlei Schutzmaßregeln; das tabu des
Todes, dessen einfache Form in der Vermeidung des Toten beruht, wird zu einem
verwickelten System des Schutzes umgebogen.”
„Wir erkennen also die Entfaltung des tabu als eine Folge der Entwicklung
von Nomadismus zur seßhaften Kultur. Der ursprüngliche, unstete Wandertrieb
wird auf etwas höherer Stufe benutzt, um die Furcht rein motorisch-atavistisch,
abzureagieren. Immer mehr aber reduziert sich diese Ausdrucksform auf ein Minimum
der motorischen Äußerung: Und eben jene Scheu, die ursprünglich der Beweggrund
einer außerordentlichen Entfaltung motorischer Kräfte im Wandertrieb war, wird nun
geradezu zu einem Negativum: zur Hemmung jeder zugreifenden Bewegung” (195f.).
„Die Metapher ist in der Urform ein intellektueller Sebstschutz des Individuums.
Dieser Selbstschutz äußert sich vorerst darin, daß die Metapher Erzeugnis
zweier Tendenzen ist: der Tendenz, eine Vorstellung oder einen Gedanken, dessen
Ausdruck im Sinne der Sünde oder Gefahr tabu ist, zu unterdrücken und andererseits
doch durch die sprachliche Auswahl die Mitteilung zu ermöglichen.
Dieses Widerspiel von tabu und Offenbarung entwickelt sich so, daß das tabu
als hemmende Tendenz, ursprünglich maximal, immer mehr reduziert wird” (196f.).352
Die zuletzt genannte Reduktion bedeutet eine rückläufige
Bewegung, eine Dekadenz sozusagen der ursprünglich so lebenswichtigen
und lebenskräftigen echten Metapher. Abgeschwächt
steckt immer noch deutlich etwas vom Tabu in dem Gebrauch der
Metapher zum Spott, zur Warnung, zur Drohung. Zum Nichts
wird dieses Etwas erst im spätesten und höchsten Typus, in der
ironischen und schmeichlerischen Metapher. Soweit unser
Referat.
Um die kritische Würdigung vom Ende her einzuleiten, so
scheinen mir die genannten „Typen” des Metaphorischen nicht
schlecht gegriffen; Witz und Tabu sind auch von Freud im
ganzen wohl sachgerecht zusammengebracht worden. Allein wie
steht es z. B. mit der Einordnung der homerischen Bilder in den
Dekadenzast der Wernerschen Entwicklungskurve? Das Tabu-Moment
in ihnen ist sicher gleich Null oder von Null nicht sehr verschieden;
und auf der anderen Seite haben sie mit Spott oder Witz,
mit Ironie oder einem Schmeicheln auch nichts zu tun. Nein, dem
homerischen Bilde steht die ganze Denkweise der Wernerschen
Theorie nicht viel anders gegenüber wie das bekannte Tier dem
neuen Scheunentor. Wozu auch die im Kinde und bei Homer so
frisch-lebendige Erscheinung einem Denkschema unterwerfen, wo sie
nur im Dekadenzast Platz findet? Da dürfte, so sagt sich ein erfahrener
Analytiker von gegebenen Theorien, in der Erstkonzeption
des Metaphorischen etwas Verfehltes stecken. Und so ist es auch.
Werner sieht sich von Anfang an berechtigt oder gezwungen zu
der Entscheidung im Sinne eines Entweder-Oder. Entweder ist
die Metapher (im Singularis) ein Abstraktionsmittel oder ein Verhüllungsmittel;
er glaubt, die zweite Alternative als richtig erwiesen
zu haben für die Metapher (im Singularis). Wie wäre es, wenn man
den ganzen Nachweis aus dem imponierend breit angelegten empirischen
Material nicht im mindesten in Zweifel ziehen müßte, um
doch mit guten Gründen dem Kinde und Homeros zu geben, was
ihnen gebührt? Es gebührt ihnen und der ganzen überblickbaren
indogermanischen Sprachgeschichte die tabu-freie Metapher, gleichviel,
ob die verhüllende Metapher nebenherlaufen und welches Gewicht
sie einst gehabt haben mag.
Denn die Wernersche Verhüllungsidee wird in den klarsten
Fällen, die wir kennen, nicht mit den Mitteln der in unserem Sinne
echten Metapher, sondern viel einfacher erreicht. Anspielungen
aller Art gibt es in Hülle und Fülle im menschlichen Sprechverkehr.
Sie sind erfolgreich zwischen A und B, wenn B an der Stelle, wo A
353seiner Zunge Halt gebietet und einen Haken schlägt, die innere
Situation miterlebt und das Spiel durchschaut. Das Hakenschlagen
aber wird faktisch viel mannigfaltiger realisiert, als es die Wernersche
Analyse wahrhaben will. Wenn ich das Wort ‚Teufel’ nicht
aussprechen darf und durch ein ‚Gottseibeiuns’ ersetze, wenn ich
‚Hose’ vermeidend die ‚Unaussprechlichen’ sage, so liegt beileibe
kein Bildersatz vor, sondern etwas, das man technisch am einfachsten
mit den Paraphasien gewisser Sprachgestörter auf eine Linie bringt.
Nicht spezifische Metaphern im Sinne der bekannten Auf teilung des
Aristoteles, sondern Metonymien wären das reine und völlig ausreichende
Ersatzmittel eines hochgradig tabu-gehemmten, um nicht
zu sagen tabu-verseuchten Sprechverkehrs.
Es gibt allerhand Para-Erscheinungen im Sprechdenken, es
gibt neben dem sehr charakteristischen Vorbeitreffen, das den
Namen Paraphasie führt, auch eine Paraphantasie. Binet hat sie
als erster dokumentarisch erfaßt und beschrieben; sie ist eine ganz
triviale Alltagserscheinung. Wer im Nachdenken über dies und das,
wer sich zur Lösung einfacher Denkaufgaben bekannte Sinnendinge
in Vorstellungsbildern innerlich präsent macht, der denkt z. B.
an ‚Milch’ und bildet sachlich korrekt ein Urteil, einen Satz, in
dem der Begriff „Milch” enthalten ist. Gelingt es ihm nachher, einwandfrei
anzugeben und näher zu beschreiben, von welcher Art
das Phantasma war, auf das sich sein rasches und flüchtiges Denken
stützte, so fehlt nicht selten gerade das, worauf alles ankommt.
Kein Zweifel: er dachte wirklich an Milch und operierte sprechdenkend
mit der bekannten weißen Flüssigkeit; aber sein Phantasma enthielt
bildlich ausgedrückt nur einen dinglichen Rahmen, nicht das
weiße Ding selbst, er sah z. B. innerlich nur das Gefäß, den Milchtopf.
Eines der Binetschen Kinder operiert sprechdenkend mit
dem Elefanten, sieht aber innerlich nicht den Dickhäuter selbst,
sondern nur das treppenartige Holzgerüst im zoologischen Garten,
auf dem die Kinder das zahme Tier besteigen dürfen. Auch das
sind wohlbekannte und keineswegs rätselhafte Para-Erscheinungen;
und alle Para-Erscheinungen sind von der Metapher sehr weit entfernt
und verschieden. Auch sie sind wichtig und aufschlußreich,
doch fehlt ihnen das Merkmal der Sphärenzweiheit und die entscheidende
Eigenschaft alles Metaphorischen, kraft des Differenzphänomens
eine Abstraktionsaufgabe in einfacher Art zu lösen.
Ich muß es den sachverständigen Linguisten überlassen, die
Belege Werners nachzuprüfen; mir scheint in der Tat viel Paraphasisches
oder Metonymisches darin enthalten, von Werner vielleicht
354auch übermäßig unterstrichen zu sein. Aber sei dem, wie
immer, so wird gerade das zum Problem, warum die echte Metapher
in allen Paraphasien des Tabu-Menschen immer noch eine so große
Rolle spielt. Mein Vers dazu lautet: Nicht einmal die Welle des
Tabu vermochte die Metapher umzubringen. Die Metapher mag ganz
so, wie es Werner schildert, bei den Primitivsten, die wir kennen,
noch auffallend selten sein und einen Schritt höher in den Sprachen
auffallend häufig, sogar in wuchernder Fülle auftreten. Das Tabu
mag zeitlich nicht allzuweit abstehen von diesem Aufblühen des
Metaphorischen und in einem inneren Zusammenhang stehen mit
ihm. Nur dürfte dieser innere Zusammenhang verwickelter und
anders sein als Werner meint. Er denkt sich auch, wie mir scheint,
die Wurzeln des Tabu in den Lebensverhältnissen der sogenannten
Primitiven zu einfach aus; denn nach Frobenius gibt es z. B.
seßhafte Pflanzer, die ganz und gar nicht von tabuistischer Totenscheu
besessen sind, sondern die Schädel der Verstorbenen wie andere
teuere Erinnerungszeichen geradezu pfleglich um sich scharen. Auf
keinen Fall aber dürfen die Para-Erscheinungen in der Sprache als
direkter Mutterboden der Metapher angesehen werden.
5. Aus der Vogelschau linguistischer Inventaraufnahmen darf
abschließend Folgendes gesagt werden: Der Wortschatz einer
Sprache, sowie er sich im Lexikon aufgezettelt präsentiert, sieht auf
den ersten Blick wie ein buntes Konglomerat, wie eine Moräne aus.
Man kann mit Moränenbrocken Zyklopenmauern, man könnte mit den
lexikalischen Sinneinheiten der Sprache nur Zyklopentexte bauen.
Allein die wirklichen Texte sehen anders aus. Und die zwei stoffverändernden
Prinzipien, die uns am Kompositum und an der Metapher
deutlich geworden sind, lassen sich im Hinblick auf das Leibnizsche
Axiom sehr einfach darstellen. Das erste erzählt von der Übersummativität
und das zweite von der Untersummativität der Bedeutungsgefüge;
es wird hinzugefügt und abgestrichen in ein und
demselben Gefüge. ‚Hausvater’ und ‚Hausschlüssel’ sind zwei
Komposita; die Spezifikation der jeweils gedachten Beziehung
ist hinzugedacht, also übersummativ. ‚Wachszündholz’ ist auch
ein Kompositum; es lehrt uns dasselbe wie der ‚Salonlöwe’, das
homerische Gleichnis und die auffallende Behauptung „Grün ist
des Lebens goldner Baum”. Die Regel lautet, daß alles Unverträgliche
wie die Zusatzbestimmung ‚aus Holz’ am ‚Wachszündholz’
und die Gold-Farbe am grünen Baum in solchen Kompositionen
ausfällt. Der Extrakt aus allem ist unser Modellgedanke
vom Doppelfilter.355
Daß wir das Phänomen des Ausfallens an den Doppelbildern
des menschlichen Zweiauges, d. h. an einem Beispiel aus dem Bereich
der (sinnlichen) Wahrnehmung erläutern konnten, ist kein
Zufall; denn schon die Wahrnehmung untersteht dem Zusatz-Ausfalls-Gesetz,
weil schon die Wahrnehmung ein Sinngefüge ist und
uns vordemonstriert, was die sprachliche Fügung auf höherer Stufe
wiederholt. Den Nullfall sozusagen in beiden Richtungen verifizieren
nahezu rein das Dvandvakompositum und die Und-Verbindungen
der Sprache. Man denke dabei zuerst an die komplexen
Zahlwörter und damit an die sachbündelnden Undwörter. Daß
sich von diesem Nullfall abhebend die echten Komposita und die
übrigen Kompositionen der Sprache sowohl übersummativ in einer
wie untersummativ in anderer Hinsicht verhalten, ist erlebnispsychologisch
keineswegs auffallend; das Metaphorische mit seiner betonten
Selektivität entspringt problemfrei überall dort, wo die von
H. Paul schon treffend aufgezählten Bedingungen gegeben sind.
§ 24. Das satzproblem.
Es ist schwer, keine Elegie zu schreiben im Anblick all des
Scharfsinns, der schon an die Aufgabe einer Definition des Satzbegriffes
gewendet worden ist; John Ries hängt seinem sorgfältigen
Bericht über die Geschichte der Satzlehre eine Liste von Definitionen
an, die 139 Nummern enthält 1)119. Wenn auch trotz der Auslese noch
manche offenkundig leere Nuß und viele Wiederkehrer darin vorkommen,
so bleibt es doch erstaunlich genug, daß man ein dutzendmal
ausholen und immer wieder einen andern Zug oder ein ganz
neues Gesicht dem Satz der Menschensprache abgewinnen konnte.
Das ist nach Erfahrungen auf anderen Gebieten nur möglich bei
sehr beziehungsreichen und hochgradig synchytisch angelegten
Zentralbegriffen eines Sachbereiches, wie sie in der Umgangssprache
gebildet werden und bis tief in die Wissenschaften hinein Undefiniert
bleiben.
Der Satzbegriff verdient als Musterbeispiel solcher Begriffe
das höchste Interesse eines Logikers der Geisteswissenschaften. Es
ist eine mehrfache Synchyse in ihm, die nicht aufgehoben werden
darf, solange er ein philologischer Begriff ist und bleiben soll. Erst
wenn die eigenartige Formalisierung der Grammatik einsetzt, fallen
die aspekt verschiedenen Merkmale des philologischen Satzbegriffes
auseinander und müssen nun auch reinlich und restfrei ein jedes
356auf seinem Grund und Boden verfolgt und behandelt werden. Die
merkwürdigen Verhältnisse sind völlig überschaubar, wenn man
sie an unserem Vierfelderschema erläutert und abliest. So wie der
berufene Interpret von Texten den „Satz” vorfindet und in seiner
Weise beschreibt, gehört dies Etwas in den Quadranten W; es ist
das elementare Sprach werk, was der Philologe im Auge hat, wenn
er von den Sätzen eines Textes spricht. Jeder dieser Sätze ist ein
bestimmungsreiches Etwas, an dem man grammatische und psychologische
Erkenntnisse verifizieren und anwenden kann.
Am besten gehen wir, um dies zu erläutern, von Ries aus,
der in seiner Satzlehre das bestimmungsreiche Ganze des Philologen
zum Begriff erhebt. Das ist durchaus korrekt und logisch einwandfrei;
es liegt eine anerkennenswerte Leistung darin beschlossen.
Fraglich wird das Unternehmen von Ries erst in dem Augenblick,
wo nun dieser synchytische Begriff der Grammatik präsentiert
und dem Grammatiker zugemutet wird, mit ihm zu arbeiten. Im
19. Jahrhundert sind ähnliche Offerten von Psychologen an die
Grammatiker gemacht worden und haben da und dort ein wenig
Verwirrung gestiftet; im großen und ganzen aber sind sie mit vollem
Rechte abgelehnt worden. Auch mit dem synchytischen Satzbegriff
von Ries kann man keine grammatische Satzlehre aufbauen.
Warum nicht?
Weil die Grammatik eine Wissenschaft ist, die es mit Formen
und nichts anderem zu tun hat, im Gebiete des Satzes mit Satzformen
und nicht mit konkreten Sätzen in der ganzen Fülle ihrer
stofflichen und psychologischen Eigenschaften und Bezüge. Der
Grammatiker wird solche konkrete Sätze stets als Beispiele
brauchen, aber immer auch richtig als „Beispiele”, d. h. als Realisierungsfälle,
an denen abstraktiv die Formen abzulesen sind, behandeln.
Die grammatische Formalisierung streift alles ab, was
am konkreten Satze als wichtige aber ungrammatische Eigenschaften
vom Philologen mitgesehen und mitbehandelt, d. h. in seiner Interpretation
beachtet wird. Ist es nötig, diesen einfachen Sachverhalt
an außersprachlichen Verhältnissen eigens zu illustrieren? Die
Geometrie und Stereometrie sind Formalwissenschaften. Angenommen,
es käme der Kristallograph zum Stereometer und biete
ihm seine exakten Apparate und Methoden zur Bestimmung kristalliner
Körperformen an, was wäre die Antwort? Es wäre im
Prinzip dieselbe Antwort, welche wir Ries erteilen müssen. Sie
lautet in unserem Falle: Du hast in Deinem synchytischen Satzbegriff
ein erstes Merkmal, das den Grammatiker brennend interessiert;
357aber Du hast andere Merkmale, welche die Grammatik
nicht tangieren. Es sei denn, der Grammatiker wird durch sie aufmerksam
auf formale Momente, die er selbst noch nicht genügend
beachtet und untersucht hat. Sehen wir zu.
1. Das Ries sehe Satzbuch gipfelt in einem eigenen, logisch
hochwertigen Definitionsvorschlag, der mit großem Geschick drei
Merkmale vereinigt und so lautet:
„Ein Satz ist eine grammatisch geformte kleinste Redeeinheit,
die ihren Inhalt im Hinblick auf sein Verhältnis zur Wirklichkeit
zum Ausdruck bringt” (99).
‚Grammatisch geformt’ und ‚kleinste Redeeinheit’ und die
Bestimmung, welche der Relativsatz fixiert, sind drei aspektverschiedene
Merkmale. Denn es ist ohne weiteres klar, daß im ersten
die Gebildelehre und im dritten eine Aktbetrachtung ihr Scherflein
beiträgt; fraglich bleibt vor näherer Diskussion vielleicht nur, wer die
mittlere Bestimmung ausspricht und zu vertreten hat. Da für unseren
Zweck wenig daran gelegen ist, so sei vorerst kein besonderer Wert auf
den Nachweis gelegt, daß der Begriff‚Rede’ (= sinnvolle Rede) und
feiner die „Redeeinheit”, an welche Ries denkt, ihre logische Heimat
im Rahmen einer Lehre von der Sprechhandlung hat; genug, daß
die Aspektverschiedenheit des ersten und dritten Merkmals, so wie
sie jeder selbstdenkende Leser verspürt, auch aus den nachgeschickten
Erläuterungen des Autors (S. 100) unzweideutig hervorgeht. Die
Frage aber, ob daraus ein kritischer Einwand konstruiert werden
kann, würde ich zunächst einmal glatt verneinen. Nein, es ist schon
so und liegt in der Natur der Dinge begründet, daß ein philologisch
brauchbarer Satzbegriff mit Merkmalen aus mehreren Aspekten ausgestattet
sein muß. Wer diese Art Synchyse verwirft, ist gezwungen,
den Satzbegriff der Philologen aus der Liste definierbarer Begriffe
zu streichen; nur wer sie zuläßt, vermag der logischen Klärung der
im Fingerspitzengefühl der Sprachforscher lebendigen Satzidee einen
Dienst zu leisten.
Dem berufenen Philologen erwachsen zum mindesten im Bereich
der indogermanischen Sprachen kaum irgendwo ernstliche Erkennungs-
und Interpretationsschwierigkeiten in Sachen vorgefundener
„Sätze”. Gewiß, man laborierte im Altertum ein wenig an der
Ellipsenfrage oder widersprach sich da und dort bei der Ordnung
der Satzarten. Allein das ist alles nichts im Vergleich zu der Konfusion,
die hätte entstehen müssen, wenn man nicht von jeher für
dies Undefinierte Etwas ein zuverlässiges Fingerspitzengefühl besessen
und mit dessen Hilfe im Einzelfall die richtige Auffassung
358hinreichend zuverlässig getroffen hätte. Man hatte es faktisch und
vermochte im Anwendungsfall auch stets zu rechtfertigen, warum
man dies und das noch für ein selbständiges und sinneinheitliches
(d. h. nicht direkt ergänzungsbedürftiges) Redestück ansah und
anderes wieder nicht. Das ungefähr war und ist der weiteste Satzbegriff
der Praktiker. Ich habe 1919 die kurze Formel vorgeschlagen:
Sätze sind die (kleinsten selbständigen) Sinneinheiten der Rede 1)120.
Die theoretisch Unbekümmerten nehmen die Konsequenz auf
sich, auch ein signifikantes und wohlplaziertes hm der Alltagssprache
noch einen Satz zu nennen und versichern unwidersprochen, solch
ein hm sei oft reicher an Ausdrucksgehalt, präziser und weniger
der Fortsetzung bedürftig als manche wortreiche Rede. Am rechten
Flügel freilich spitzen andere ihre Bedenken gegen diesen gummiartig
ausgeweiteten Satzbegriff auf die straffe, aus der Logik bezogene
Forderung zu, ein rechter Satz müsse zweigliedrig sein und
die zwei aristotelischen Momente des Urteils, nämlich S und P
klipp und klar manifest enthalten. Wer hat Recht, d. h. wo ist der
zweckmäßig weder zu weite noch zu enge Satzbegriff der Philologen?
Der scharfsinnige Analytiker John Ries verwirft zwar die strenge
Forderung einer Zweigliedrigkeit, hält aber daran fest, daß eine
Äußerung „grammatisch geformt” sein müsse, um Satz zu heißen.
Ries zeichnet alle Kompromißlösungen zwischen den in dieser und
in anderer Hinsicht oft polar entgegengesetzten Meinungen der
Theoretiker in der Satzfrage sorgfältig nach und baut in seiner
eigenen Lehre um den Palast des wahrhaft echten und höchst vollendeten
Satzes ein ganzes Dorf von Metökenhäuschen auf, in denen
ei die angeblich halbechten und unvollendeten Satzerscheinungen
unterbringt. Ihre Hauptformen seien aufgezählt.
So heißt es z. B.: Interjektionen und Vokative sind „Gebilde,
die den Sätzen in keiner Weise zugerechnet werden können”; ja
und nein (allgemeiner: Bejahungs- und Verneinungspartikeln) sind
keine Sätze, aber Satzvertreter. Weiter: Satzreste sind Bildungen,
359denen einiges leicht aus dem Kontext Ergänzbare aber nicht zu
viel davon fehlt; Kurzsätze dagegen sind unergänzbare Fügungen,
sind ein Nebentypus der „Vollsätze”. Von Satzresten und Kurzsätzen
zusammen sagt Ries:
„Die Kurzsätze stehen zwar etwas weiter als die Teilsätze und Satzstücke
von den Vollsätzen ab, aber beide kommen ihnen doch — nicht nur ihrem Bedeutungsgehalt
nach, sondern auch in ihrer formalen Anlage, da ihnen ein Satzschema gewöhnlichen
Baus zugrunde liegt — so nahe, daß sie im wesentlichen als richtige
Sätze zu gelten haben, nur von unvollständiger oder unvollkommener Form” (185).
Der Kurzsatz allein wird so beschrieben:
„Was wirklich zu sprachlicher Einkleidung gelangt, ist die eine im Vordergrund
stehende Vorstellung allein oder mit einer oder der anderen Begleitvorstellung:
ihr auf die knappste Form gebrachter Ausdruck, meist nur ein Wort oder eine enge
Gruppe, ist der Kurzsatz” (184). Beispiele: Aleine Hochachtung! Mit Ihrer Erlaubnis!
oder Briefaufschriften wie Herrn N. N.
Keine Sätze aber Satzworte sind nach Ries die allein stehenden
Nominative, welche z. B. als Auf-, An- und Überschriften vorkommen.
Die Nominalsätze indogermanischer Sprachen sind nur ein Nebentypus
des Satzes. Imperative dagegen sind in jeder Hinsicht vollwertige
Sätze, denn „der (an sich begründete) Zweifel an der Zweigliedrigkeit
der Imperative berührt ihren Satzcharakter nicht, da
sie ohnehin nicht zu den unumgänglichen Erfordernissen des Satzes
gehört”.
Der Leser erkenne aus diesem Exzerpte, daß unsere (verkürzt
erzählte) Parabel von dem Riesschen Metökendorf nicht aus der
Luft gegriffen ist. Nach all den meist feinsinnigen Glossen über den
(Parole-) Charakter der geflügelten und nichtgeflügelten Worte, die
als Beispiele aufgeführt werden, entsteht nun aber die sprachtheoretische
Frage, ob man auf diese Weise zum Ziel kommt
oder in Gefahr gerät, aus der Satzlehre etwas zu machen, was sie
nicht oder wenigstens nicht einzig und allein sein sollte, nämlich
ein Kapitel aus der linguistique de la parole. Daß zu heiligen Texten
Glossarien und zur intimen Charakteristik der Volks- und Gausprachen
Idiomatiken gehören, wird kein Vernünftiger in Frage
stellen; ja es ist sogar ein hochinteressantes Problem, wie Worte
im Leben der Menschen stehen, wie Dichter und Biographen satzbaulich
signifikante Reden einem Helden nachsagen oder ihn selbst
sprechen lassen als wärs ein Stück von ihm. Dazu oder dahinter
gehört ein achtenswerter Ast der Linguistik, eine ordentlich aufgebaute
Theorie von la parole. Die ausgeführte Satzlehre von Ries
bietet breite Ausführungen dazu und legt ein Florilegium von Ausspruchstypen
vor samt Interpretationen, die das Herz eines Philologen
360erfreuen mögen. Im Einleitungskapitel des Buches aber war
dieses Ziel nicht vorgesehen, sondern es hieß dort:
Unser Versuch „wird besonders darauf bedacht sein, sich vor den im I. Abschnitt
besprochenen Fehlern und Mängeln früherer Definitionen zu hüten; er wird
vor allem wirklich eine Begriffsbestimmung des Satzes erstreben, als des grammatischen
Kunstausdrucks für ein bestimmtes sprachliches Gebilde, und acht haben,
daß sich diesem nichts anderes unterschiebe. Wenn er so wenigstens die Klippen
vermeidet, an denen viele seiner Vorgänger gescheitert sind, dürfte er vielleicht
auch dann nicht vergeblich unternommen, vielmehr als Vorarbeit für andere noch
von Nutzen sein, wenn es ihm selber nicht gelingt, das Ziel völlig zu erreichen” (2).
Das letzte ist wahr geworden; das Ries sehe Buch ist wie kaum
ein anderes geeignet, neue sprachtheoretische Untersuchungen
auszulösen. Im Grunde gilt es, zuerst das rechte und genaue Wort
zu finden für das in dieser Definition bereits erfaßte Etwas, dann
den Schein restlos zu vernichten, als seien die angeblichen Halb- und
Viertelsätze samt und sonders das oder nur das, was ihre Namen bei
Ries andeuten. Wozu z. B. die empraktisch vollendeten Äußerungen
von neuem als „Satzreste” charakterisieren und die symphysisch
eindeutigen Namen als „Satzworte”? Der Terminus Satzwort ist,
logisch streng beurteilt, ein hölzernes Eisen. Doch will ich nicht vorgreifen.
Das dritte aber wird sein, daß man das Riessche Angebot
an die Grammatik zwar höflich entgegennimmt, weil jeder von
jedem andern lernen und sich anregen lassen soll. Im übrigen aber
verhält es sich mit dem Geschenk eines jeden aspekt-synchytischen
Satzbegriffes an die Grammatik ungefähr wie mit den meisten
Hochzeitsgeschenken: sie sind schön und man kann sie nicht
brauchen. Das ist ein hartes Wort, muß aber zunächst einmal ausgesprochen
sein, bevor es eingegrenzt und gemildert werden darf.
2. Was ist also das Etwas der Riesschen Satzformel? Wo
immer ein Produkt aus Menschenhand unter Gesichtspunkten betrachtet
wird, die dem ersten und dritten Merkmal der Riesschen
Satzdefinition entsprechen, da liegt eine Organonbetrachtung vor.
Man blickt auf die Form des Produktes und erkennt aus der Verwendung,
warum sein Schöpfer ihm diese und keine andere Form
verliehen hat. Ein zum Schaben bestimmter Stein wird anders geformt
als ein Stein zum Klopfen oder Hacken. Die sachverständigen
Prähistoriker behaupten, daß sie die Schabsteine der Steinzeitmenschen
erkennen und im großen und ganzen von den Steinbeilen
gut zu unterscheiden vermögen; es gibt eine wohlausgebaute Gerätelehre
in ihrer Wissenschaft. Auch die Ries sehe Satzdefinition entspringt
aus einer Werkbetrachtung. Denn das erste Merkmal der
Riesschen Bestimmung, die „grammatische Form” wird einem
361Satz verliehen nach dem Gesichtspunkt des dritten Merkmals;
das Kommando eines Imperativs z. B. manifestiert ein anderes
Verhältnis des Sprechers zur Wirklichkeit wie die „Behauptung”
der sogenannten Aussage. In einer guten Definition des Satzbegriffes
der Philologen darf auch der Erzeuger des Produktes selbst vorkommen;
und zwar nicht wie Pilatus im Credo, sondern als der
Jedermann einer Sprachgemeinschaft, welcher Stellung nimmt und
etwas setzt im Satze.
Der konkrete Satz in einem Texte ist ein Aktualwerk. Das
ist ein Begriff, den sich die Lebenspsychologen um Ch. Bühler
auf ihrem Gebiete ausgedacht haben 1)121. Es ist ein sehr brauchbarer
Begriff; denn sc ist es vielfach im Bereiche menschlicher Poesis,
daß etwas hervorgebracht wird, was im Augenblick der Erzeugung
in die physische Welt eintritt, um einen Augenblick darauf aus ihr
verschwunden zu sein. Der Schauspieler auf der Bühne hat ebenso
lang und hart gearbeitet an seiner Rolle wie ein anderer Künstler
an seinen Werken aus Stein; dann aber steht er auf den Brettern
und erzeugt ein Aktualwerk. Und der Sprecher eines Satzes erzeugt
das gleiche. Daß es Mittel und Wege gibt, das einmal geformte
Sprachwerk auf Stein und Papier zu bewahren, ändert seinen
Charakter als Aktualwerk; immerhin muß das Fixierte, um irgendwann
wieder zu erstehen, von einem Nachschöpfer reproduziert werden.
Auf den Satz als Aktualwerk, auf den konkreten Satz der
Philologen, ist die Ries sehe Begriffsformel zugeschnitten; das von
Ries definierte Etwas ist ein Typus, dem man die Aufschrift geben
kann: das elementare sprachliche Aktualwerk. Diese Behauptung
läßt sich Punkt für Punkt beweisen. Wir prüfen daraufhin zuerst
die entscheidenden Merkmale eins und drei. Wer die „grammatische
Formung”, das erste Merkmal, wegließe, auf was würde er damit verzichten?
Antwort: es ginge ihm ähnlich wie einem Prähistoriker,
der auch unbearbeitete oder nur uncharakteristisch bearbeitete Fundstücke
in seine Sammlung prähistorischer Steinbeile einreihte. Gewiß
kann auch einmal ein unbearbeiteter Stein wie ein Steinbeil
verwendet werden, und grammatisch ungeformte Wörter oder Lautgesten
stehen oft und immer im menschlichen Verkehr an Stellen,
wo sonst geformte Sätze stehen. Nur kann man sie entbunden aus
ihrer Kreszenz nicht mehr als Sätze erkennen. Das erste Ries sehe
Merkmal charakterisiert also den Satz als ein Etwas, das in die
II. Spalte unseres Vierfelderschemas gehört, weil es subjektsentbunden
362immer noch als Satz erkennbar ist. Die genannte Entbindung
ist das Thema unseres nächsten Paragraphen.
Das dritte Merkmal (im Relativsatz der Riesschen Satzformel)
bedarf, um exakt verstanden zu werden, der authentischen Interpretation
des Autors. Er schreibt:
„Die Bestimmung, daß der Satzinhalt im Hinblick auf sein Verhältnis zur
Wirklichkeit zum Ausdruck gebracht wird, kennzeichnet die dem Satz eigne besondere
Ausdrucksgestaltung, in der sich ein auf die Frage der Tatsächlichkeit des Vorstellungsgehalts
gerichteter seelischer Vorgang auswirkt, weil er aller Satzbildung
zugrunde liegt. Diesen Vorgang selber in die Definition als weiteres Merkmal aufzunehmen,
ist kein Anlaß, da er in jener Bestimmung als ihre notwendige Voraussetzung
mit enthalten ist” (101).
„Inhalt des Satzes ist der (lexikalische, stoffliche) Bedeutungsgehalt der in
ihm enthaltenen Worte und Wortgruppen zusammen mit deren logisch-syntaktischen
Beziehungsbedeutungen, also die im Satze sprachlich verkörperten Bewußtseinsinhalte
aller Art, Einzelvorstellungen wie deren Verbindungen, Tatbestände, Sachverhalte,
als Gedachtes wie als Gewolltes” (100).
Franz Brentano würde sagen, es sei durch dieses Merkmal
der Setzungscharakter von Urteilssätzen mitgetroffen. Daß Ries
an Stelle einer Thesis die allgemeinere Bedingung „Verhältnis zur
Wirklichkeit” wählt, hat gute Gründe. Denn es gibt nach alter
Einsicht auch Fragen und Heische-Sätze und sprachlich gefaßte
Emotive (um mit Marty zu sprechen), die andere Stellungnahmen
des Sprechers offenbaren. Es liegt nicht in meiner Absicht, hier zu
wiederholen oder fortzuführen, was ich darüber in dem Satzartikel
1919 vorgetragen habe. Herr Dr. Sonneck wird als Linguist dazu
das Wort ergreifen und die Diskussion weiterführen. Ein Verehrer
Husserls findet an demselben Punkte Gelegenheit, die Aktcharaktere,
von welchen hier die Rede ist, genauer und allgemeiner
zu entwickeln.
Festzuhalten bleibt, daß sich die Ries sehe Satzformel im
ganzen zu der Weisheit des guten Linguisten bekennt: quod non
est in actis, non est in mundo. Wobei unter „Akten” das zu verstehen
ist, was man als linguistischer Beobachter dem kontextlich
isolierten Satze abhören kann. Detektiv soll dieser Beobachter über
den Rahmen der untersuchten „Redeeinheit” hinaus nicht sein; er
darf am Vollsatze der Riesschen Formel auch Situationsindizien
nicht verwerten, wo sie vorhanden sind, und nicht vermissen, wo
sie fehlen. Daß solche Zurückhaltung im Prinzip wenigstens möglich
und wissenschaftlich fruchtbar ist, gehört zu den stillschweigenden
Voraussetzungen nicht nur der Riesschen, sondern jeder Satzlehre,
die auf das blickt, was im Satze faktisch sprachlich gefaßt
363und geäußert wird. Wir sind also wieder im Quadranten W des
Vierfelderschemas.
Das zweite Merkmal der Riesschen Satzformel ist das merkwürdigste.
Es heißt in den Erläuterungen dazu:
„Rede ist Sprache in ihrer lebendigen Erscheinung, in ihrer wirklichen Verwendung
jeder Art, als Verständigungsmittel im sozialen Verkehr wie als bloße
Kundgabe von Vorgängen in unserem Innern, leise oder laut, im Selbst- oder im
Zwiegespräch, mündlich oder schriftlich, vergangen sowohl als gegenwärtig” (99f.).
Lebendiges ist gewiß nur anzutreffen am lebendigen Wesen,
das man entweder vor sich hat oder zu den Produkten seines Lebens,
z. B. zu einem Brief, der von ihm stammt, hinzudenkt. Und wenn
sich die Lebensäußerung dieses Wesens sprachlich ergießt, was ist
dann die „Redeeinheit”, welche Ries in seine Satzformel setzt?
Ob er unsere Auffassung darüber anerkennen wird, vermag ich aus
dem Buche, das er geschrieben hat, nicht eindeutig vorauszusagen.
Aber es gibt in diesen Dingen eine sachliche Konsequenz, die mächtiger
und wichtiger ist als ausdrückliches Jasagen.
Die gesuchte Einheit ist auch von de Saussure schon gesucht
aber nicht gefunden worden; de Saussure hat nur das Wort ‚parole’
(oder manchmal auch ‚le langage’) bereit für den Bereich, innerhalb
dessen sie nach seiner Ansicht bestimmt werden müßte. Die Ries sehe
„Redeeinheit” kann nach meiner Meinung nirgendwo als im Bereich
der aristotelischen Praxis bestimmt werden. Wer das Sprechen
als menschliche Handlung auffaßt, findet, daß es wie in jeder menschlichen
Tätigkeit, die den Charakter eines wohlgeordneten Handelns
trägt, so auch im Sprechen sachgemäße Einheiten gibt. Dürfen wir
also sagen: was beim Hämmern ein Schlag, das ist beim Sprechen
ein Satz? Sofern das Kinheitskriterium nicht zu einseitig nur am
Äußerlichen gewonnen wird, vielleicht ja; der Phonetiker allein kann
dieses Kriterium gewiß nicht liefern. Wundt dagegen beschrieb
den Satz als eine bestimmte und wohlcharakterisierte innere Handlung,
die sich weitgehend auch äußerlich erkennen läßt; und Ries
wandelt, wenn ich ihn recht verstehe, in seinem zweiten Satzmerkmal
mit vielen anderen modernen Sprachtheoretikern ein Stück weit
dieselbe Bahn. Daß man das stets betonte Moment der Einheitlichkeit
eines Satzes auch anders zu erfassen versuchen kann, ist richtig
und wird in der Arbeit von Sonneck systematisch erörtert. Aber
bleiben wir bei Ries. Wer wie er vorgeht und die Einheitsprägung
aus der „lebendigen Rede” abliest, nimmt in seine Definition des
Satzbegriffes einen Zug auf, der, wenn überhaupt, dann nur an
der Sprechhandlung direkt beobachtet werden kann. Ähnlich wie
eine Geste des Schauspielers dem sachverständigen Blick des Bebachters
364als eine sinnvolle und sinnvollendete Einheit des Ausdrucksgeschehens
imponiert, so dürfte sich Ries die Erfassung des
Momentes „Redeeinheit” vorstellen. Der Sprecher verleiht einem
Satz in der Regel eine erkennbare musikalische Gestalt nach Melodie
und Akzent; darin wird ein „Plus” von Stellungnahme offenbar
— so ungefähr muß wohl das zweite Ries sehe Merkmal mit dem
dritten verbunden werden 1)122.
3. Wir haben bis hierher das Buch eines Forschers interpretiert,
der es verdient und fordern durfte, daß Nachkommende
sein Ergebnis mit dem größten Maßstab messen und die höchste
Energie eines Weiterdenkens zuerst an die Erschöpfung des Erreichten
setzen. Ist unsere Auslegung richtig, dann hat Ries die alte
und stets lebendige Satzidee der Philologen in geduldiger Versenkung
nachgezeichnet und zu einem ordentlich definierten Begriff erhoben.
Es sei nicht versäumt, einen Weg zu nennen, auf dem die Begründung oder
Widerlegung der vorgelegten Schilderung befördert werden kann. Ich selbst habe
die mehr als hundert Satzdefinitionen aus Ries einzeln auf Zetteln vor mir liegen
und kann sie beliebig gruppenweise nach ihrem Hauptcharakter auf die Quadranten
des Vierfelderschemas verteilen. Die Rechnung geht so auf, wie es zu erwarten
stand, daß nämlich wenige ganz einseitig nur in einen, die meisten dagegen
in mehrere und einige der umsichtigsten ähnlich wie die Definition von Ries in
drei oder vier Quadranten zugleich gehören. Es gibt keinen von wirklichem Gehalt,
den man überhaupt nicht unterbrächte.
Die aristotelischen Gedanken über den Satz (den Urteilssatz und andere
Sätze, die keine Urteile formulieren), gehören ebenso wie vermutlich das meiste,
was die von Ries nicht aufgenommenen Logiker darüber vorbringen (auch Aristoteles
steht nicht in der Liste) in den Gebildequadranten; doch weiß ich das
nicht aus eigener Erprobung. Brentanos Satzlehre und Husserls Bemerkungen
über den Satz sind Aktauffassungen; Brentano ist dabei anders wie Husserl
Psychologe und will Psychologe bleiben; Brentanos Grundauffassung von der
Eingliedrigkeit des wahrhaft elementaren Urteilssatzes wird uns nicht direkt aber
indirekt im folgenden Paragraphen beschäftigen. Doch auf die Logiker kam es
uns bis hierher weniger an als auf die Philologen.
Ein Logiker der Sprachwissenschaften soll dies Ergebnis nicht
verwerfen, sondern verständlich machen. Im Werdegang der Geisteswissenschaften
und in den eigenartigen Begriffssystemen, die sie
hervorgebracht haben, ist das Walten einer sachlichen Vernunft
erkennbar, und die oft hochgradig synchytischen Begriffe der Geisteswissenschaften
sind unvermeidlich. Jedenfalls trifft dies zu auf
die philologische Satzidee. Die Verständigung mit Hilfe von Lauten
ist menschheitsgeschichtlich nach aller Wahrscheinlichkeit viel älter
als der geformte Satz; genau so wie die Verwendung von Steinen
365als Werkzeug älter sein dürfte als die prägnant bearbeiteten Steinbeile.
Sieht man nur auf die Funktion im Sprechverkehr, dann imponieren
formal durchaus ungleichartige Lautgebilde als äquivalent;
die erste Aufgabe einer allgemeinen Lehre von den Verkehrseinheiten,
die wir faktisch finden, kann nur die sein, systematisch die Umfelder
anzugeben, in welchen sie auftreten. Wer die Tatsachen der sympraktischen
und symphysischen Verwendung von Lautzeichen
richtig erkennt, ist als Theoretiker imstande, das Metökendorf um
den Satzpalast herum gründlich zu entvölkern. Die Evakuierten
leben kraft eigenen Rechtes und bedürfen des Gemessenwerdens
am „Vollsatz”, d. h. an den synsemantisch eingebauten und synsemantisch
„vollendeten” Reden nicht. Es sei denn, sie selbst gehören
ihrem Umfeld nach zu den Mischlingen, was vorkommt.
Die Formenwelt der Grammatik ist der Hauptsache nach
aus dem synsemantischen Einbau von Sprachzeichen entsprungen
und muß von daher entwickelt werden. Wohl wahr, daß es auch
Einklassensysteme gibt und daß man ohne Synsemantik situationsentbundene
Symbolisierungen sich vorstellen kann. Bergfeuer und andere
optische Signale, vielfach auch charakteristische Rufe haben vor dem
Telegraphieren wichtige Ereignisse schnell und weithin verkündet;
das waren Signale ohne Syntax. Warum die bekannten Menschensprachen
etwas anderes geworden sind als reiche Einklassensysteme
von solchen Symbolen, wurde in der Axiomatik erörtert. Jedenfalls
sind sie etwas anderes, nämlich Symbolfeld-Systeme, und damit
muß auch die Satzlehre rechnen. Die Angabe der Riesschen Definition,
ein Vollsatz sei „grammatisch geformt”, ist viel zu unbestimmt
und vage. Wir ersetzen sie durch die präzise andere Angabe, daß
der Vollsatz ein geschlossenes und wohlbesetztes Symbolfeld aufweist.
Dies ist das Fundament, auf welches die rein grammatische Satzlehre
gebaut werden muß. Wären die Feldgeräte alle so weitgehend
erforscht wie z. B. das indogermanische Kasussystem, dann könnte
man als Sprachtheoretiker daran denken, eine allgemeine grammatische
Satzlehre in Angriff zu nehmen. Der Versuch im folgenden
Paragraphen hält sich an ein einziges Satzmerkmal.
§ 25. Der Satz ohne Zeigfeld.
Es gibt im Anwendungsbereich der menschlichen Sprachzeichen
einen Befreiungsschritt, der vielleicht einmal im Werdegang
der Menschensprache zu den entscheidendsten gehörte. Wir vermögen
ihn zwar nicht historisch zu rekonstuieren, wozu so gut wie
jeder Anhalt in der Linguistik von heute fehlt, können ihn aber
366systematisch bestimmen als die Befreiung, soweit sie geht und
möglich geworden ist, von den Situationshilfen; es ist der Übergang
vom wesentlich empraktischen Sprechen zu weitgehend synsemantisch
selbständigen (selbstversorgten) Sprachprodukten. Sehen wir zu,
was darüber der rezenten Sprache, die wir sprechen, abzulesen ist.
Ein Fahrgast der Straßenbahn sagt empraktisch gerade aus;
sein Nachbar im Wagen erzählt: Der Papst ist gestorben. Diese
zweite Äußerung führt alles mit sich, was sie braucht, um auch
außerhalb des Straßenbahnwagens eindeutig und genau so wie im
Wagen verstanden zu werden. Das erste ist eine empraktisch vollendete
und das zweite eine synsemantisch abgeschlossene Rede.
Unser zweites Beispiel ist mit Absicht aus dem Bereich dessen
gewählt, was man in der Zeitung liest und wovon man spricht im
Trambahn wagen. Der Sprecher verkündet ein Tagesereignis und
seine Rede impliziert einen nicht formulierten Bezug auf das ‚Jetzt’
der Zeitung, auf das Heute oder Gestern. Immerhin kann man behaupten,
daß der gleiche Satz am gleichen Tage auf der ganzen
Welt gesprochen und in allen örtlich verschiedenen Situationen
gleich verstanden wurde. Der Satzsinn ist also entbunden aus den
örtlichen Umständen der Sprechsituation, aber nicht aus den
zeitlichen; er ist entlassen aus dem Hier, aber nicht aus dem
Jetzt. Es gibt Sätze, deren Sinn auch zeitlich den Umständen der
Sprechsituation enthoben ist, z. B. der Satz ‚zwei mal zwei ist vier’
und andere wissenschaftliche Sätze.
Es sei zum Thema erhoben, worin diese schrittweise Befreiung
besteht und wie weit sie führt. Ein Kenner anderer menschlicher
Erlösungen mag voraussagen, daß gleichen Schrittes mit der Befreiung
aus den Umständen der Sprechsituation eine neue Verankerung
stattfindet, und er wird recht behalten; es ist das Symbolfeld
der Sprache, worin die neue Fixierung erfolgt. Doch ist das eine
sehr abstrakte Weisheit. Was sprachlich geschieht im Augenblick
des Bindungswechsels, wird faßlicher an einem übergreifenden Vergleich
aus dem Gebiet nichtsprachlichen Darstellens; es gibt einen
Befreiungsschritt von ähnlicher Tragweite am Werk des Malers,
der von einem großen Könner erläutert worden ist. Wir erzählen
diesen Befreiungsschritt im Werk des Malers Leonardo da Vinci
nach und bauen die Parallele mit der Sprache aus, nicht befangen
in einer Gleichseherei, sondern aus dem Bedürfnis, vorübergehend
außerhalb der Sprache etwas zu haben, woran das stets verspürte,
aber nie definierte Moment der Selbständigkeit oder Selbstgenügsamkeit
des Satzsinnes gemessen werden kann.367
Der vollendete Satz, von dem die Rede sein wird, ist der reine
Darstellungssatz vom Typus S → P (S ist P). Er tritt im Indogermanischen
dominierend mit einem Verbum finitum als P und
einem Nomen oder einem dem Nomen äquivalenten Satzgliede als
S auf; er erscheint daneben auch verballos als Nominalsatz und mag
in anderen Sprachfamilien mit bisher unbekannten Symbolfeldern
noch in anderen Abarten vorkommen. Mir wenigstens ist kein Weg
bekannt, auf dem dies ausgeschlossen werden könnte. Die Formel
S → P der aristotelischen Logik soll nur die Zweigliedrigkeit des
Gebildes und einen bestimmten Grad von Asymmetrie in seinem
Bau andeuten. Wir streifen zunächst mit einem Blick die uns geläufigen
Nominalsätze der indogermanischen Sprachen, um auch
sie in die Analyse mit einbeziehen zu dürfen. Notwendig wäre dies
nicht; doch erweitert es in erwünschtem Maße den Bereich, aus
welchem die Erläuterungsbeispiele gewählt werden.
1. Der Kontrolle unseres eigenen Sprachgefühles unterstehen
jene meist sprichwörtlichen verballosen Sätze, die von vielen Sachverständigen
betrachtet werden als Überbleibsel eines früher im
Bereich der indogermanischen Sprachen vermutlich häufiger als
heute verwendeten Nominalsatzes. Es sind Sätze wie ‚Ehestand
Wehestand; die Gelehrten die Verkehrten’. Oder ein wenig reichere
Sätze wie ‚Jung gewohnt alt getan; neuer Arzt neuer Friedhof;
mitgefangen mitgehangen; lange Haare kurzer Sinn’ 1)123. Die Frage
lautet, ob auch in diesen Sätzen etwas von der Differenzierung
in S und P zu erkennen sei oder nicht. Äußerlich fehlen alle anderen
Merkmale außer der Reihenfolge der Glieder (samt einer charakteristischen
Betonungsgestalt des Ganzen). An der Reihung wird zu
entscheiden sein, ob es belanglos ist, mit welchem der beiden Glieder
wir beginnen.
Die logische Analyse sollte diese Sätze in erster Annäherung
als einfache Korrelationsaussagen bezeichnen; denn sie fixieren etwas
368Ähnliches wie etwa die mathematische Formel, welche eine Größe x
als Funktion einer Größe y bestimmt: x = f (y). Durch die Satzform
allein ist nicht mehr als eine Korrelation schlechthin bestimmt;
denn das jeweils Spezifische an dem Verhältnis ist sprachlich nicht
gefaßt, sondern muß von der Sache her gefunden werden. Selbstverständlich
wird jeweils ein anderer spezifischer Zusammenhang in
all unseren Beispielen von deutschen Hörern gedacht; aber diese
Spezifikation ist sprachlich nicht ausgedrückt, sondern wird vom
Stoff her hineingetragen. Wäre ein Name vonnöten für das wirklich
Dargestellte, so würde ich den Namen Korrelationssätze vorschlagen.
Man probiere nun an den Korrelationssätzen die Umstellung
aus: ‚neuer Friedhof neuer Arzt’. Das ist nicht mehr derselbe, sondern
ein veränderter Satz, woraus hervorgeht, daß die Reihenfolge irgendwie
relevant ist. Man darf an diesen Sätzen ebensowenig eine einfache
logische Konversion vornehmen wie an Verbalsätzen von der Form
S → P. Genau so wenig wie etwa aus ‚die Müller sind Diebe’ hervorgeht,
daß alle Diebe auch Müller sind, behauptet das Sprichwort,
daß jeder ‚kurze Sinn’ mit ‚langen Haaren’ ausgestattet ist, wohl
aber behauptet er eine gewisse regelmäßige Konsekution umgekehrt:
lange Haare kurzer Sinn. Und wenn einmal ein scheinbar schlicht
umkehrbarer Satz gefunden wird wie mit ‚klein Geld kleine Arbeit’,
so wäre man geneigt, den zweiten Grundsatz nicht mehr dem Arbeiter,
sondern dem Arbeitgeber in den Mund zu legen. Mit einem Wort:
Eine Differenzierung der Satzglieder ist auch hier zu finden, und
ich wüßte keinen Fall anzugeben, wo sie fehlte.
Was die Relevanz der Reihung angeht, so ist demnach an.
diesen deutschen verballosen Sätzen ein ähnliches Ergebnis abzulesen,
wie es uns in dem Befunde von W. Schmidt entgegentrat.
Dort wurde klar, daß in allen Menschensprachen die Reihenfolge
der Komplexionsglieder relevant werden kann in attributiven Gefügen;
sie ist ausnahmslos relevant, wo andere Fügezeichen fehlen.
Ähnlich wie das deutsche Kompositum ‚Briefmarke’ und das französische ‚timbre
poste’, so stehen sich nach Schmidt im ganzen Bereich
der bekannten Menschensprachen die zwei Fälle der Voranstellung
und Nachstellung gegenüber. Im Satze S → P liegt
eine prädikative Fügung vor. Es gilt die gut begründete Regel,
daß dieselben Fügemittel sowohl prädikativ wie attributiv in der
Sprache verwendet werden; und so darf man allgemein behaupten,
es sei dort, wo alle übrigen äußeren Kennzeichen fehlen, immer noch
an der Relevanz der Reihung (und parallel dazu meist auch an der
Betonung) zu erkennen, daß eine Differenzierung der zwei Glieder
369jedes prädikativen und attributiven sprachlichen Gefüges besteht.
Es ist nichts anderes und nicht mehr als dieses Faktum, das wir
in dem symbolischen Schema S → P andeuten und wiedergeben
wollen. Denn der spezifische Charakter dieser Differenz ist verschieden
und muß verschieden sein in Verbalsätzen, Nominalsätzen
und wie immer sonst noch die Typen heißen mögen. Dieser spezifische
Charakter ist eine Angelegenheit des Symbolfeldes.
Es ist eine weltanschauliche Eigenheit, wenn die Indogermanen
das Darzustellende außerordentlich häufig wie einen
menschlichen Akt behandeln, ein Verbum actionis wählen und die
Rollen verteilen: ‚die Sonne wärmt den Stein; der Wind heult;
das Wasser fließt (den Berg hinab), es wälzt den Stein’. Andere
Sprachen folgen diesem Schema nicht, wie wir an dem Löwentod-Exempel
gesehen haben. Die allgemeinste Analyse der Darstellungssysteme
vom Typus Sprache, d. h. die Logik in moderner Form,
streift in ihren abstraktesten Satzmodellen nicht nur das Aktklischee
mit allem Anthropomorphismus, sondern vielfach auch die einfache
Aufgliederung des Satzes in S und P ab. So symbolisiert z. B. das
logistische Schema a R b (z. B. a = b, a ∼ b) zwei Relationsfundamente,
die des S- und P-Charakters entbehren; wofür dann freilich
ein drittes Zeichen (R) in der Formel steht. Wir vermeiden die Frage,
ob und wie die neue Analyse zu allgemeineren und mannigfaltigeren
Satzmodellen in der Logik führt, und halten uns an die in den natürlichen
Sprachen greifbare Aufgliederung.
2. Am Synthema S → P soll verdeutlicht werden, daß die
Sinnerfüllung weitgehend unabhängig und befreit wird sowohl von
den Umständen der Sprechsituation wie von einem vorausgehenden
und nachfolgenden Kontexte. Diese Selbständigkeit des Satzsinnes
hat, wie alles in der Welt, ihre Grade und Grenzen, die abzustecken
sind, indem man den Übergang aus der empraktischen
in die synsemantische Verwendung der Sprachzeichen ordentlich
untersucht. Aber vorher sei das außersprachliche Vergleichsbeispiel
erörtert.
Leonardo da Vinci setzt in seinem Malerbuch auseinander,
daß das Gemälde alles mit sich führt, was es braucht, daß es einen
hohen Grad von Selbständigkeit (Selbstgenügsamkeit) besitzt. Die
Selbstgenügsamkeit des Malerbildes ist nach Leonardo in einer
Hinsicht, die uns besonders interessiert, größer als die des plastischen
Kunstwerks. Nehmt eine Statue zum Vergleich; seht zu, wie sie
im Räume steht und was sie vom Aufstellungsraum und dessen
Beleuchtung verlangt. Variiert, bitte, den Platz im Räume, indem
370ihr die Statue hoch oder tief, aus einer Ecke oder Nische frei auf
den Marktplatz oder mitten im Saale aufstellt; variiert, bitte, die
Beleuchtung des Standorts, indem ihr das Licht anstatt von schräg
oben, wie es der Künstler vorsah, von unten her kommen laßt (wie
wenn ein beleuchteter Marmorboden es reflektiert), so daß die
Augenhöhlen, Nasenlöcher und was sonst noch zuvor im Schatten
war, auf einmal voll beleuchtet und das zuvor Beleuchtete nunmehr
beschattet wird. Und ihr habt ein verändertes Werk vor euch.
Genug des Experimentierens: es ist schon so wie Leonardo sagt,
daß zur Plastik ein Umfeld gehört aus dem Raum des Standorts und
eine bestimmte Beleuchtung. Die Plastik lebt davon, sie muß einoder
angebaut oder von vornherein für einen freien Stand mitten
auf einem Platze geschaffen sein. Und nur das bestimmt einfallende
Licht hebt ihre Linien und Flächen in adäquater Weise, setzt Glanz,
Reflexe und realen Schatten an die richtigen Stellen des Werkes.
All das ist wesentlich anders beim Gemälde. Denn der Meister
des Pinsels setzt in seinem Gebilde selbstherrlich Licht, Schatten
und alle anderen Effekte genau dorthin, wo er sie braucht. Ob dann
das Standortslicht von rechts oder links her einfällt, stört ihn nicht;
sein Werk verlangt viel weniger vom Standortsraume als die Plastik.
Und dies aus dem einen Grunde, weil es selbst alles mit sich führt,
was es braucht. Der Maler ist physisch eingeschränkt in seinen
Darstellungsmitteln, hat nur die zweidimensionale Leinwand zur
Verfügung und kann auf ihr weder reale Tiefen noch wirkliche
Lichteffekte wie Glanz und Leuchten, aufsitzende Reflexe oder
reale Schatten anbringen. Doch gerade aus dieser Beschränkung
entspringt die wahre Freiheit des Malers im imaginären Raum und
dessen Ausmessung, in der imaginären Lichtordnung und den Effekten
aus ihr. Das Faktum also, daß der Maler auf Mittel sinnen muß,
in seinem Werke einen Bildraum und in ihm eine eigene Beleuchtung
auftreten zu lassen, befreit ihn zugleich von Hilfen des symphysischen
Umfeldes, deren der Plastiker nicht entraten kann.
Soviel nur brauchen wir; doch ist es erforderlich, die Warumfrage
noch einmal zu erheben und eine allgemeine, auf unser Gebiet
übertragbare darstellungstheoretische Antwort zu finden. Warum
also ist das Gemälde nach Leonardo, der etwas verstand von den
Dingen, um einen Schritt oder um einige Schritte freier vom symphysischen
Umfeld als die Statue? Warum führt es in einem höheren
Grade alles mit sich, was es braucht, als die Statue?
Es wäre ermüdend, gegen Absolutisten rechts und Absolutisten links die
mitgemeinte Gradabstufung immer wieder eigens hinzufügen. Daß man nicht jedes
371Bild in jeden Winkel hängen darf, ohne seine Wirkung zu beeinträchtigen, wußte
Leonardo vermutlich ebenso genau, wie heute eine ordentliche Hausfrau oder der
jüngste Museumsassistent. Daß nicht alle Sinnwerte eines Satzes von der Form S
ist P situationsunabhängig und daß die faktisch situationsunabhängigen es nicht
alle in demselben Ausmaße sind; daß oft der Kontext vor und nach dem Satz S ist P
zu differenzieren und zu nuancieren hat, nicht nur, was ein Satz ausdrückt (kundgibt)
an aktuellen Erlebnissen des Sprechers; sondern auch, was er darstellt, dies und noch
mehr bleibt unbestritten. Doch sollte umgekehrt ebenso unbestritten bleiben, was
wir über den Satz vom Tod des Papstes und vom Satze, daß zwei mal zwei vier ist,
wirklich behauptet haben.
Eine allgemeiner gefaßte Antwort auf die gestellte Frage lautet
so: Genau in dem Ausmaß, wie Glanz und Schatten und alle übrigen
Bild werte des Gemäldes unabhängig werden von der Beleuchtungsrichtung
im Aufstellungsraum, werden sie abhängig und bestimmt
als Feldwerte in einer neuen Ordnung. Sie werden bestimmt von
der Lichtführung (so lautet r der technische Ausdruck) im Gemälde
selbst. Der Schöpfer des Bildes hat eine Lichtführung gewählt,
hat sich und sein Werk dem Gesetz unterstellt, daß im Bildraum
das Licht z. B. von rechts oben kommen soll; dann gehen alle Schlagschatten
der gemalten Dinge nach links hin und nur solche Flecken
auf der Malfläche imponieren als Schlagschatten, die systemgerecht
sitzen; alle Bildwerte sind systemgetragen. Prinzipiell derselbe Feldwechsel
kommt im Gebiet der sprachlichen Äußerungen vor. Denn
genau in dem Ausmaß, wie sprachliche Äußerungen frei werden
ihrem Darstellungsgehalte nach von den Momenten der konkreten
Sprechsituation, unterstehen die Sprachzeichen einer neuen Ordnung,
sie erhalten ihre Feldwerte im Symbolfeld, sie geraten unter den
mitbestimmenden Einfluß des synsemantischen Umfeldes.
Wenn ich mit dem Worte ‚Zwei’ zu sprechen anfange, so muß
nicht immer ein arithmetischer Satz herauskommen, welcher ganz
zeigfrei ist. Sondern es könnte z. B. auch so weitergehen: ‚Zwei
Augen, ach zwei Augen, die kommen mir nicht aus dem Sinn’.
Dann wäre der zuhörende Mathematiker um einen Satz aus seiner
Wissenschaft betrogen und überhaupt keine weitgehende Erlösung
des Satzsinnes aus der konkreten Situation erreicht. Logistiker
pflegen solche Sätze (mit Recht) aus der Wissenschaft in die „Lyrik”
zu verweisen; doch darf man den Äußerungen dieser Art nicht
schlechtweg jeden objektiven Darstellungswert abstreiten deshalb,
weil das Zeigzeichen ich (in mir) darin vorkommt. Es gibt Grade
auch in diesem Punkte; denn unser Sprecher setzt faktisch die
Sendermarke ‚ich’ in die Wortreihe ein, meint aber mehr als das
Augenblicksich damit; er meint einen den Sprechaugenblick überstehenden,
372auch in der Vergangenheit und Zukunft liebeskranken
Rollenträger. Das ist eine genau so gebräuchliche Erweiterung der
Ich-Sphäre, wie wenn ein Sprecher in Berlin hier sagt und ganz
Berlin einschließt. Schon dadurch wird der Sinn einer sprachlichen
Äußerung dem Bereich der demonstratio ad oculos entrückt, wenn
auch immer noch eine Zeighilfe zu seiner Sinnerfüllung unentbehrlich
bleibt.
Wenn man die schrittweise Erlösung des Satzsinnes aus den
Umständen der Sprechsituation und die schrittweise ansteigende
Dominanz des Symbolfeldes systematisch studiert, kommt zum
Vorschein, daß solche Sätze vom Typus S → P, welche Aussagen
über die Wirklichkeit sind, bis tief in alle Wissenschaften hinein
auf einer Selbständigkeits-Treppe stehen, aber ihrem Darstellungsgehalte
nach niemals der Ordnungsdaten aus dem Zeigfeld restlos
entraten können, wenn anders sie im strengen Wortsinn Aussagen
über die Wirklichkeit, Existenzaussagen, bleiben sollen und nicht
unversehens ins Rollenfach der rein begrifflichen Sätze übergehen.
Nur muß man dabei ebenso an die implizierten wie an die explizierten
Bezüge denken. Der Mustersatz vom Tod des Papstes enthält
explizite kein jetzt, aber implizite einen Bezug auf das (Zeitungs-)
Jetzt des Sprechers. Daß es mit allen Existenzaussagen der Geschichte
und der Physik im Grunde genommen genau so ist, wäre
vermutlich streng zu beweisen. Das ist erkenntnistheoretisch interessant
und verifiziert von der Sprache her die These Kants,
daß Begriffe ohne Anschauung leer sind und nichts anderes als
„leere” Erkenntnis ergeben. Daß solch „leere” Erkenntnis, daß
Modelleinsichten wertlos oder entbehrlich wären im Aufbau der
Erfahrungswissenschaften, hat weder Kant behauptet noch liegt
es in unserer Absicht.
Doch schieben wir restlos alle erkenntnistheoretischen Überlegungen
beiseite und bleiben bei der sprachtheoretischen Aufgabe,
von Äußerungen ausgehend, die eng im Hier — Jetzt — Ich — System
der subjektiven Orientierung verankert sind, die sprachlichen Mittel
einer Lösung anzugeben. Das einfachste unter ihnen ist die Erweiterung
der um die punktförmige Origo dieses Koordinatensystems
gelegten Sphäre, die zeigend mitgetroffen werden kann. Der Held
in Autobiographien und in Ich-Romanen sagt Bände lang ich, und
wir verstehen ihn genau so gut, wie wenn er jedesmal statt ich einen
Personennamen gesetzt und die ganze Erzählung in der dritten
Person Singularis geschrieben hätte. Wir verstehen ihn, weil alle
geschilderten Ereignisse in dem derart erweiterten Ichbereich stattfinden.
373Dasselbe gilt für den erweiterten Bereich des Hier und Jetzt,
die ebensogut durch Eigennamen wie ‚Wien’ und ‚Nachkriegszeit’
ersetzt werden können. Es gibt ein Zeitungsjetzt, eine historische
Jetztzeit, ein geologisches Jetzt usw. und genau so die erweiterten
Hierbereiche.
Die Ansprüche der erzählenden Sprache des täglichen Verkehrs
und des Historikers, die Ansprüche an eine Befreiung des
Satzsinnes aus der strengsten Gebundenheit an das Zeigfeld sind
damit schon weitgehend befriedigt. Warum befriedigt? Weil das
Erzählte und wenn das Erzählte den damit abgesteckten Rahmen
nicht überschreitet. Sonst spielen in allen epischen und historischen
Erzählungen die gut geregelten Versetzungen eine wichtige Rolle. Das
Märchen beginnt stilgemäß mit der Versetzungsanweisung: es war
einmal; der Historiker nennt die Zeit ein wenig präziser und macht
Ortsangaben dazu. Versetzungen sind ein zweites Entbindungsmittel
sprachlicher Äußerungen.
Wenn ein Bereich durch Eigennamen wie ‚Paris, Revolution,
Napoleon I.’ zuvor genannt oder als unausgesprochene Voraussetzung
mitgegeben ist, erfolgen in der Rede die Versetzungen in den Bereich
hinein und aus ihm in andere Bereiche fast ebenso unbemerkt wie
die Versetzungen bei Kamera-Sprüngen im Film, über die später berichtet
werden soll. Exposition: Der General Napoleon aus Italien
zurück in Paris. Wir sind bei ihm und verstehen das weiterhin Erzählte
von seinem ‚hier, jetzt, ich’ aus. Oder ein Fall aus dem Leben:
eine Frau aus dem Volke berichtet von ‚ihm’ und was er ihr vorwirft;
und das ich-Wort im Flusse ihrer lebendigen Schilderung
der jüngsten Eheszene springt hin und her, muß jetzt aus ihrem
und gleich darauf wieder aus seinem Munde ertönend gedeutet
werden. Man pflegt dies in der Epik als ein Wechselspiel von erzählender
und direkter Rede zu bezeichnen: „Ich trag das Geld aus
dem Haus” [sc. behauptet er von mir] und „ich muß mich abrackern”
[sc. behauptet er von sich]. Ohne die subtile Verkehrstechnik des
Standpunktswechsels wäre die Rede dieser Frau für jeden Hörer
unentwirrbar; kraft dieser Technik aber fließt sie wohlverstanden
in den mitfühlenden Empfänger. Sehen wir zu, ob und wie aus den
Versetzungstatsachen Befreiungsfolgen entspringen.
3. Die Erwähnung einer Exposition ist uns nicht unbedacht
unterlaufen. Sie war in den analysierten Beispielen vor dem Satz
gegeben; wie wäre es damit, daß sie in den Satz einbezogen wird?
Ein Eigenname wie ‚Heidelberg’ oder ‚Bodensee’ nennt unbewegliche
Dinge, zu denen ein gewöhnlicher Mohammed faktisch hingehen
374muß, um eine Bedeutungserfüllung der Namen zu erleben.
Ist dies geschehen und der Eigenname taucht dem Hörer, welcher
dort war, jetzt irgendwo in der Welt als Satzsubjekt auf, dann
ist eine Deixis am Phantasma im Gang und die Erlösung des Satzsinnes
aus den Verständnishilfen der konkreten Sprechsituation
bereits mehr oder minder weit vorbereitet; wer im Phantasma zur
Sache versetzt ist, kann vergessen, von wo aus er hinversetzt wurde.
Ich bringe dies erstens, um einer Reihe von Sprachtheoretikern
gerecht zu werden, die das S direkt als das Expositionsglied des
Satzes bestimmt haben; Ph. Wegener war der konsequenteste von
ihnen. Ich bringe es aber zweitens auch, um einen sehr wichtigen
andersartigen Entsubjektivierungsschrüt menschlicher Sprachäußerungen
an systematischer Stelle in unsere Darstellung einzuführen.
Wenn ich ohne Präludien höre ‚es regnet’, so nehme ich dies
Wort als eine Wetterdiagnose in der Sprechsituation; es regnet
im Augenblick dort, wo sich der Sprecher befindet, der Sachverhalt
ist to-deiktisch aufzeigbar im hier — jetzt-Bereich des Sprechers.
Durch die beigefügte Exposition ‚am Bodensee’ erfolgt ein Enthebungsschritt:
‚es regnet am Bodensee’; dies erweiterte Wort kann
irgendwo gesprochen sein, sein Sinn ist weitgehend abgelöst von der
engsten to-Deixis im Rahmen der Sprechsituation.
Mag sein, daß dieser Satzbau in Sprachen mit einem reichen
und dominierenden System lokalistischer Kasus häufiger ist als im
Indogermanischen. Die Expositionsformel ist adäquat, wo immer
im Satze eine Versetzungs-Erlösung der geschilderten Art erreicht
wird; sie ist aber nicht genügend und inadäquat, wo andere
Symbolfelder im Satze aufgebaut und andere Befreiungsschritte
durch sie ermöglicht werden. Bevorzugt ist im Indogermanischen
das Denkschema der Aktion und der wichtigste Enthebungsschritt
ist und bleibt im Rahmen dieses Denkschemas die merkwürdige
Rollenübertragung an die sogenannte dritte Person: Caius handelt
nicht nur, wenn er den Löwen tötet, er handelt auch, wenn er sieht
und hört. Ja er handelt in einem weitesten Wortsinn vielleicht sogar
dann noch, wenn er sitzt oder lebt. Doch lassen wir diese letzte Frage
offen. Es könnte sein, daß das Symbolfeld ein wenig modifiziert
ist, wenn Caius sitzt oder ‚lebt’: er lebte in Rom. Caius wird Gehandelt,
wenn ihn die Sonne wärmt, wenn ihn ein Freund liebt, ein Feind
haßt, wenn ihn die Wähler zum Konsul machen.
Aber gleichviel: erscheint Caius als S in einem lateinischen
Satze, so ist der Sinn dieses Satzes ebenso enthoben vom hie et nunc
des Sprechers, aus dessen Munde er kommt, wie unsere Regendiagnose
375durch die Exposition ‚am Bodensee’. Doch ist die Lösung
in einer anderen Weise erfolgt; ich brauche als Hörer den Caius
nicht an seinem geographischen Orte aufzusuchen wie mein Heidelberg
(um mir zeigen zu lassen, wo es regnet), sondern Caius mag zu
mir kommen im Phantasma wie der Berg zu Mohammed oder bleiben,
wo er ist; darauf kommt es in neunzig von hundert Fällen gar nicht
an. Fungiert Caius doch in unserem Beispiel sogar als irgendeiner,
der keinen bestimmten Platz auf Erden hat und an kein Jahrhundert
gebunden ist. Sondern darauf kommt es an, daß er zum
Rollenträger erkoren ist einer Handlung, die von ihm ausgeht oder
an ihm vorgenommen wird; Caius wird zur persona tertia der indogermanischen
Sprachen. Gleichviel, ob der Satz weitergeht nach
dem Typus ‚necat’ oder ‚necatur’ oder ‚est’, die Sprache hat den
Caius zur persona tertia erkoren, das heißt auf Deutsch zum Rollenträger
in einem aus der Sprechsituation herausgehobenen Geschehen.
Es ist, wenn die Rede mit der Nennung ‚Caius’ beginnt, ein Symbolfeld
jener Art eröffnet, die wir in dem Abschnitt über das indogermanische
Kasussystem geschildert haben.
4. Worte wie es regnet, es donnert gehören linguistisch betrachtet
zu den Impersonalien. Formal erscheint die dritte Person auch in
den Impersonalien, was im Widerspruch steht mit dem Namen,
den sie von den Grammatikern empfangen haben. Doch glaube
ich, daß die Bezeichnung ‚Impersonalien’ in einem tieferen Sinne
zu Recht besteht, trotzdem ihr z. B. die mythologische Phantasie
der Lateiner und die Gestalt des Juppiter tonans in die Quere
kommt. Die Wetter-Vokabeln der indogermanischen Sprachen sind
nur maskierte, keine vollwertigen indogermanischen Verba; sie sind
Ereigniswörter, die ein anderes Symbolfeld um sich verlangen und
eröffnen wie unsere Verba. Denn nicht die Frage wer? sondern
die Fragen wo? und wann? zielen bei einem ‚es regnet’ auf die Ergänzung
ab, die es aus empraktischem Gebrauch entbindet und zu
einem selbständigen Satze erhebt, der alles mit sich führt, was zu
seiner Sinnerfüllung gehört. Wo in einer Sprache an Stelle unserer
Verba dominierend solche Ereigniswörter vorkommen, trifft die
Expositionsformel des Satzes den Nagel auf den Kopf; denn das
wahre S dieser Sätze nennt in der Tat die Situation, in welcher das
Ereignis stattfindet; das wahre S eines situationsenthobenen Regensatzes
liegt in der Bestimmung am Bodensee. Fehlt diese Bestimmung,
dann ist und bleibt die Rede es regnet eine situationsverhaftete Rede.
Die indogermanischen Logiker von Herbart an waren auf der
rechten Spur, wenn sie das sprachlich fehlende S der Impersonalien
376suchten, aber auf der falschen Spur, wenn sie das Gesuchte mit dem
S der Verbalsätze auf eine Stufe stellten. Der Sachverhalt einer
Wetterdiagnose der in Rede stehenden Art wird durch das Ereigniswort ‚es
regnet’ global (ungegliedert) genannt und nicht erst aufgebaut;
durch eine Beifügung wie ‚am Bodensee’ wird die Position
angegeben, von der aus das also Genannte to-deiktisch angetroffen
werden kann. Im Deutschen lassen sich beliebige Verba in ähnlicher
Weise verwenden; ‚es spukt’ ‚es wird getanzt’ (Milieuimpersonalien);
die nächste Ergänzungsfrage verlangt auch hier die Angabe einer
Situation. Wenn ich nennend sage, wo und wann es spukt oder getanzt
wird, ist eine Versetzung angeregt und der Punkt bestimmt,
an dem im Phantasma das Phänomen gezeigt werden kann 1)124.
Parallel den Wettersätzen nennen die Impersonalien des subjektiven
Befindens global ein Erlebnis und fügen die persona, welche
es trifft, in einem der Casus obliqui bei: ‚taedet me, pudet me, piget
me (alicuius rei); mich ekelt, mir graut’. Ob mir oder mich (oder
meiner) ist eine sekundäre Frage. Man überlege zuvor, warum der
Lateiner statt necor, necaris nicht parallel zu den Impersonalien
bildet necatur mihi, necatur tibi, eine Konstruktion, die durchaus
möglich, ja sogar unvermeidbar wäre, wenn wie im Falle der Impersonalien
das erst global genannte Ereignis der Tötung zugedacht
werden müßte einem Lebewesen, das ich-zeigend sprechen oder duzeigend
getroffen werden kann. So ist es aber im Symbolfeld des
echten Verbalsatzes nicht, sondern es wird der Sachverhalt schildernd
aufgelöst und dazu die Rollen verteilt.
Wir sind damit ungesucht wieder auf die Angelegenheit verschiedener
Symbolfelder in verschiedenen Sprachen gestoßen; sie
steht unerledigt am Ende des dritten Kapitels, sie ist auch hier nicht
aus dem Handgelenk und deduktiv zu erledigen. Doch bedeutet es,
so will mir scheinen, einen Fortschritt, wenn wir an unserer eigenen
Muttersprache eine erste Dichotomie vollziehen können. Das allgemeine
Schema S → P mag stehen bleiben, weil es in unseren
Überlegungen nur angibt, daß zwei funktionsverschiedene Glieder
in dem Synthema enthalten sind. Diese Funktionsdifferenz ist eine
377andere in dem uns bestvertrauten analytischen Verbalsatz und in
dem aus der Sprechsituation entbundenen impersonalen Satz. Es
war kein Zufall, daß die indogermanischen Logiker befremdet auf
die Impersonalien blickten und sich im 19. Jahrhundert durch Jahrzehnte
intensiv mit ihnen befaßten. Den geschlossensten Überblick
des Hin und Her ihrer Lösungsvorschläge bietet der Bericht
in B. Erdmanns Logik. Die Hauptfrage war damals, ob die Impersonalien
Prädikatsätze mit fehlendem Subjekte oder Subjektsätze
mit fehlendem Prädikat seien; es gab Verfechter der ersten und
Verfechter der zweiten Auffassung. Das sprachliche es im Deutschen
und il im Französischen, welches im Lateinischen nicht zum Vorschein
kommt, galt beiden Parteien mit Recht nicht als eine sprachlich
fungierende persona tertia, sondern als eine „unpersönliche”
Marke an der Leerstelle des Satzfeldes. Erdmann selbst bekennt
sich zur Auffassung der Prädikatstheoretiker und ergänzt im Sinne
des lateinischen Mythos vom Juppiter tonans ein mitgedachtes aber
nicht genanntes Irgendetwas als Ursache des genannten Donneroder
Regenphänomens: ‚Irgendetwas’ (anstelle des Juppiter) erzeugt
das von uns wahrgenommene und sprachlich genannte
Phänomen.
Säuberlich aufgespalten findet die Kritik zweierlei auszusetzen
an der Diskussion der Logiker von Herbart bis Erdmann: daß
sie erstens allzu stark in dem ihnen einzig geläufigen indogermanischen
Hauptfall eines Satzschemas befangen blieben und daß sie
zweitens infolgedessen Disparates verglichen haben. Die wirklich
vergleichbaren Sätze sind nicht ‚es regnet’ und ‚Caius schläft’, sondern
‚es regnet am Bodensee’ und ‚Caius schläft’; denn nur diese beiden
Äußerungen sind ungefähr gleich weitgehend aus den Umständen
der Sprechsituation entbunden (sympraktisch frei). Im Hinblick
auf den Erlösungsschritt, der erfolgt, wenn ich von einem ‚es regnet’
zu dem Satze ‚es regnet am Bodensee’ übergehe, darf man sagen,
es sei die Expositionsangabe, welche die Befreiung bringt.
Stellt man das isolierte ‚es regnet’ mit einem künstlich isolierten
Prädikatswort wie ‚necat’ zusammen, so wird die verschiedene Ergänzungsbedürftigkeit
der beiden deutlich; jenes verlangt in erster
Linie eine Antwort auf die Frage wo? (und wann?) Wird sie sprachlich
gegeben, dann ist das meteorologische Ereignis eingefügt in
eine Situation, in welcher es deiktisch zu erreichen ist. Ein isoliertes
geformtes Wort wie ‚necat’ dagegen verlangt in erster Linie eine
Antwort auf die Fragen wer? und wen? und damit eine sprachliche
Sackverhaltsergänzung.378
Von hier aus noch einmal rückwärts gesehen erscheint uns
das Wort ‚es regnet’ als eine unaufgelöste (globale) Sachverhaltsangabe;
es ist keine Rede davon, daß das Ereignis des Regnens
sprachlich in demselben Sinne unvollständig gezeichnet wäre wie die
Handlung des Tötens durch das isolierte Wort ‚necat’ Man begreift
auch sehr gut, warum Brentano seine Lehre von der Eingliedrigkeit
des elementaren Urteils gerade an den Impersonalien
zu beglaubigen versuchte. Allein es ist vom Standpunkt der Darstellungsanalyse
aus festzustellen, daß das Wort ‚es regnet’ in jedem
Verwendungsfall ergänzungsbedürftig ist, weil es entweder empraktisch
eingebaut verstanden sein will oder eine Expositionsangabe
fordert, um (seiner Bedeutung nach), aus der Sprechsituation
erlöst, verselbständigt zu werden. Daß durch die sachgemäßen Ergänzungen
zu ‚pluit’ und zu ‚necat’ zwei in den Menschensprachen
weit verbreitete Satzbau-Verfahren angedeutet sind, sei unter Hinweis
auf die Analyse des Löwentod-Exempels auf S. 247 ff. noch
einmal festgestellt; das eine von ihnen führt korrekterweise und
einseitig ausgebaut zu den Casus der sogenannten äußeren Determination
oder zu präpositionalen Ausdrücken ‚am Bodensee’ usw.;
das andere führt zu den Casus der sogenannten inneren Dertermination.
Ob man das eine Symbol S → P für beide Äußerungsformen
festhalten will, ist eine rein terminologische Zweckmäßigkeitsfrage.
Man könnte sich z. B. einen S-Kasus vorstellen, der den Namen
durchaus verdient und doch ganz und gar ein Expositionskasus,
also nicht unser Nominativus wäre. Und man könnte sich eine
Klasse oder Klassen von ausgesprochenen Prädikatswörtern vorstellen,
die sich syntaktisch wesentlich anders als unsere Verba
verhielten und doch ähnlich wie die Verba Ereignisse symbolisierten
und von den Dingwörtern abgehoben werden müßten.
5. Jedenfalls aber verstehen wir allgemein, daß das Bedürfnis,
den Darstellungsgehalt einer Rede frei zu machen vom aktuellen
Zeigfeld, in der erzählenden Rede aufkommt. Man kann sich im
großen Entwicklungsgang der Menschensprache Einklassensysteme
deiktischer Rufe als das erste vorstellen. Dann aber kam einmal das
Bedürfnis, Abwesendes einzubeziehen und das hieß, die Äußerungen
von der Situationsgebundenheit befreien. Die Mittel dazu sind für zwei
Hauptfälle in der Sprache, die wir selbst sprechen, angegeben und
psychologisch beschrieben. Die Enthebung einer sprachlichen Äußerung
aus dem Zeigfeld der demonstratio ad oculos beginnt in unserer
eigenen Sprache entweder raum-zeitlich, indem eine nennende Versetzung
379an Stelle der primär ungeformten, weil mitenthaltenen hier-jetzt-Deixis
eingeführt wird (Impersonalia). Oder sie beginnt an
der primär ebenso ungeformten, weil mitgegebenen ich-Deixis (Verbalsatz).
Kein Wegweiser sagt ausdrücklich hier, obwohl er von hier
aus zeigt; die situationsverhafteten Sprechäußerungen des Menschen
(wie das geradeaus des Trambahngastes) entbehren aus dem gleichen
Recht mit dem überflüssigen hier auch das überflüssige jetzt und
ich, obwohl sie von da aus verstanden werden müssen. Setze ich,
wie das in indogermanischen Verbalsätzen regelmäßig geschieht,
ein ich-Zeichen, du-Zeichen, er-Zeichen in die Äußerung (amo, amas,
amat), wozu geschieht das also, was wird damit erreicht?
Das höchst merkwürdige er (sie, es) der indogermanischen
Sprachen steht psychologisch keineswegs auf gleicher Stufe mit
ich und du, den Sender- und Empfängerzeichen; doch erkennt man
an der persona tertia am klarsten, wozu auch ich und du im darstellenden
Verbalsatz auserkoren sind. Alle drei sind, um es noch
einmal zu sagen, völlig überflüssig in Äußerungen wie ‚es regnet’;
wozu also werden sie in darstellende Verbalsätze eingesetzt? Ich
bilde drei Mustersätze: amo te; amas me; amat Caius Camillam;
und stelle fest, daß im ersten und zweiten Satz der aufgegliederte
Sachverhalt des Liebens in sehr einfacher Weise der aufgegliederten
aktuellen Sprechhandlung zugeordnet wird. Man projiziert sozusagen
den Sachverhalt des Liebens auf die aktuelle Sprechhandlung.
Es gibt zwei Partner des Liebens, es gibt zwei Partner der
aktuellen Rede; die letzteren, der Sender und Empfänger der Botschaft,
sind zeigend zu erreichen. Man zeigt sie faktisch und
macht dabei kenntlich, daß sie und wie sie identisch sind mit den
Partnern des Liebens. Mehr Worte darüber sind kaum vonnöten;
von Nutzen wären weitere Erläuterungen nur dann, wenn sie aus
andern Sprachfamilien Satzmodelle mit wesentlich verschiedenem
Projektionsverfahren daneben beschrieben und bestimmten. Rein
lokalistisch darstellende Sprachen könnten die Projektion des Ereignisses
auf die Positionen der Sprechsituation vornehmen: die
Liebe strahlt vom Senderort hier zum Empfängerort da (wo du
bist), lateinisch etwa: amatur (es wird geliebt, man liebt) hinc istuc
im ersten oder istinc huc im zweiten Fall. Oder die Konstruktion
könnte wieder instrumental-dativisch erfolgen wie in dem
konstruktiv ersonnenen ‚Caio nex leoni’: amatur me (Instrumentalis)
tibi (Dativus commodi). Das alles ist ohne weiteres im
Rahmen der Sachverhaltsprojektion auf die aktuelle Sprechhandlung
möglich.380
Auf einem neuen Blatt aber steht der dritte indogermanische
Mustersatz amat Cains Camillam. Denn hier wird über die zwei
natürlichen Rollenträger der aktuellen Sprechhandlung hinaus ein
dritter Rollenträger hinzukonstruiert und to-deiktisch (im Irgendwo)
getroffen: amat. Wozu? Um diesen hinzugedachten Rollenträger
weiterhin gleichzustellen den ich-deiktisch, und du-deiktisch
getroffenen Rollenträgern der Sprechhandlung. Denn auf ihn kann
nun das Liebesereignis genau so wie auf den Sender und Empfänger
der Botschaft mitprojiziert werden: er liebt mich, er liebt dich; ich
liebe ihn, du liebst ihn. Daß dieser dritte Rollenträger in indogermanischen
Sätzen nicht nur genannt wird (als Caius), sondern auch
zeigend angedeutet ist in dem t des amat, muß wohl aus den gleichen
Sprachbedürfnissen verstanden werden, aus welchen das Anbringen
von ich- und du-Formantien am finiten Verbum (oder aufgelöst
das Setzen der isolierten ich- und du-Wörter) entsprungen ist. Und
wenn ich mich nicht täusche, liegt der Quellpunkt eines generellen
Setzens der Rollenzeigzeichen dort, wo die Sprache über das Präsente
hinausgreift und Nichtpräsentes erzählend wiedergibt. Denn gleichviel,
ob dieses Abwesende dramatisch oder episch erreicht und
präsentiert wird, man braucht in beiden Fällen Markierungen entweder
lokalistischer oder personaler Art, um es sprachlich darzustellen.
Solange nämlich, als man an dem Verfahren einer Projektion
des Abwesenden auf die Koordinaten der Sprechsituation
festhält. Unsere Sprachen halten daran fest und benützen fast
durchgehend ein System von Personalzeichen, das sie konform ihrem
bevorzugten Symbolfeld, dem Handlungsklischee, durch die dritte
Person erweitert haben.
Streng genommen ist also kein indogermanischer Satz mit
finitem Verbum völlig zeigfrei, sondern hat in Form des Personalsuffixes
am Verbum stets ein Zeigzeichen. Doch kann man schon an
dem amo te den ersten Befreiungsschritt aus der engsten Gebundenheit
des Satzsinnes an das ad oculos Demonstrierbare feststellen.
Denn die Sphären des Ich und Du sind gewöhnlich erweitert, wenn
er gesprochen wird: Der Liebende und Geliebte überleben in der
Regel samt ihrer Liebe die gegebene Sprechsituation und das kann
mitgetroffen sein in Sätzen wie ‚amo te’ oder ‚amas me’. Das erzählende
Präsens begreift eine unbestimmte Jetzt-Sphäre ein, in
welcher der jetzt Sprechende und der jetzt Angesprochene mit
andauern.
Viel weiter aber geht die Befreiung im dritten Mustersatz. Der
unbestimmte er in amat ist nur insoferne noch auf die aktuelle
381Sprechsituation bezogen, als er zum Nicht-Ich und zum Nicht-Du
des Sprechers gehört; er ist weder Sender noch Empfänger der
Mitteilung, sondern eben ein tertius, der to-deiktisch erreichbar gedacht
wird. So in der Regel wenigstens; und spricht oder schreibt
einmal der Caius selbst an Camilla jene Liebeserklärung, dann hat
er sprachlich schon eine Objektivierung vollzogen und läßt in der
Formel das Sender- und Empfängerzeichen verschwinden, genau wie
Jedermann außerhalb der Affäre. Das wird durch den Einsatz der
Nennwörter Caius und Camilla, an denen die Feldzeichen angebracht
werden, möglich. Es bleibt also nicht beim unbestimmten
Zeigezeichen er (t in amat), sondern dies Gezeigte wird außerdem
genannt. Das in den Objektkasus gesetzte Etwas (Camillam) wird
in unseren Sprachen überhaupt nicht zeigend (wie in anderen
Sprachen mit verschwenderischer Anwendung der Personalia),
sondern nur nennend getroffen. Von der ganzen (ursprünglicheren)
Projektion des zu schildernden Sachverhaltes auf das Koordinatensystem
der aktuellen Sprechhandlung ist dann nur das to-deiktische
Zeichen der persona tertia übrig geblieben. Erhalten blieb aber
außerdem die Kategorie Handlung für das Darzustellende selbst.
Damit dürfte im Felde der Tatsachensätze die weitest mögliche
Sinnerlösung aus den Umständen der Sprechsituation erreicht sein.
Gewiß, der Logiker wird noch an allerhand anderes denken, z. B.
daran, daß die Eigennamen unseres Musterfalles durch wissenschaftlich
definierte Klassennamen ersetzt werden sollten, oder daran,
daß an Stelle des temporären Sachverhaltes einer menschlichen Liebe
naturgesetzliche Sachverhalte von allgemeiner (übertemporärer)
Geltung sprachlich gefaßt werden in Sätzen von der Form S → P.
Wir werden zustimmen und nicht widersprechen; auch die vorwissenschaftlichen
Weisheitssätze wie ‚steter Tropfen höhlt den
Stein’ beanspruchen einen allgemeineren Geltungsbereich wie der
Mustersatz von der Liebe des sterblichen Menschen Caius. Allein
nicht darauf kommt es in unserem Zusammenhang an, sondern auf
die Frage, ob unsere Sprache noch objektiver sprechen kann, den
dargestellten Sachverhalt noch gründlicher den Umständen der
Sprechsituation entrückt zu präsentieren vermag. Und darauf
lautet die Antwort nein. Das Zeigzeichen der dritten Person ist
ein kaum je störendes Schwänzchen, das noch abfallen könnte und
faktisch abfällt, z. B. in den verballosen Korrelationssätzen. Sonst
aber ist durch das Nennen anstelle alles Zeigens faktisch die Befreiungsgrenze
im Rahmen der natürlichen Sprache erreicht. Eine
noch weiter gehende „Entsubjektivierung” der Sätze kann von
382diesem Punkte an nur durch explizite Definitionen der verwendeten
Nennwörter, durch Auflösung der üblichen Implikationen und durch
eine eindeutigere Syntax, als sie die natürliche Sprache zu bieten
vermag, erwartet werden 1)125. Wohlverstanden: solange es sich um
Wirklichkeitssätze und nicht um etwas anderes handelt.
6. Das letzte Wort über den Satz ohne Zeigfeld führt in die
Logik. Die Aussage ‚zwei mal zwei ist vier’, Gleichungen der
Mathematiker wie ‚a + b = b + a’, die Mustersätze der logischen
Axiomatik wie ‚A ist A’ — sehen rein sprachlich betrachtet nicht viel
anders aus wie die Wirklichkeitssätze und müssen trotzdem auch
vom Sprachtheoretiker auf ein eigenes Blatt geschrieben werden.
Wer dies tut, braucht nicht vergessen zu haben, daß jeder Sprecher
in seinen Kindertagen die Bedeutung aller Nennwörter direkt oder
indirekt gezeigten Dingen und Sachverhalten entnommen und
übend behalten hat. Versteht man den Begriff Deixis so weit wie
die Griechen, dann ist diese Behauptung exakt zu beweisen. Wer
nun als Adept einer Wissenschaft und zu guter Letzt in der Logistik
neue Symbole vorgesetzt erhält, dem ergeht es beim Erlernen wieder
so, daß die to-Deixis einspringen muß: ‚Schau dahin! dies Zeichen
vor deinen Augen auf der Tafel, auf der Buchseite, wird von uns
als Symbol für das und das verwendet’. So oder ähnlich geht es
bei der Bedeutungsverleihung aller Symbole zu und ohne diese
Zeighilfen ist faktisch kein Symbolsystem in den intersubjektiven
Verkehr zu bringen. Aber der Nabelstrang, welcher beim Lernen die
Symbolik der wissenschaftlichen Sprache aus der natürlichen speist
und wachsen läßt, scheint späterhin irgendwie durchschnitten zu
werden, wenn man so will.
Ich sagte, es scheint so; in Wahrheit gilt es erst zu prüfen
und dann zu entscheiden, ob man sprachtheoretisch eine Irrelevanz
der to-deiktischen Lernbehelfe im Sinngefüge des hochformalisierten
logischen Darstellungssatzes vom Typus S → P nachweisen kann.
Faßt man die Sätze der Logik schärfer ins Auge, so kann dabei
nichts anderes zum Vorschein kommen, als was weniger „streng”
die Logik seit Aristoteles in ihren klarsten Augenblicken mitlaufend
unter anderem auch schon sagte und was die Logik auf ihrer
höchsten Abstraktionsstufe heute einzig zu sagen weiß: die Darstellung
383mit Zeichensystemen vom Typus der Sprache wird reflexiv
in der Logik. Die Logik besinnt sich auf die Struktur des Darstellungsgerätes
vom Typus Sprache und stellt Sätze hin, an denen
die Konstruktionsbedingungen aller einfachen und komplexen Gebilde
des Systems und aller Operationen, wodurch sie auseinander
hervorgehen, einsichtig werden. Zum Beispiel den Satz, daß A
einmal und noch einmal gesetzt identisch sei und bleiben müsse in
jedem Beweisgang.
Das ist alles; und mehr darf man nicht verlangen weder von
der Logik überhaupt noch von irgendeinem sozusagen absolut zeigfreien
Satz vom Typus S → P, der dazugehört. Denn viele oder
sogar alle Sätze der Logik und (wie viele glauben) damit auch die
Sätze der Mathematik könnten mit dazu gehören; jedenfalls ist
dies von ernst zu nehmenden Logikern behauptet worden. Es ist
also die Reflexion auf die Systembedingungen, es ist eine Selbstbeschränkung
erster Ordnung, welche die weitest gehende Irrelevanz
der to-deiktischen Lernbehelfe garantiert. Ich wiederhole: im Bereich
der reinen Logik. Die Sätze, von denen wir sprechen, kommen nur
in der reinen Logik vor und erweisen sich aufgelöst und zurückverfolgt
auf ihre letzte Begründung als analytisch evidente Sätze
oder schlechtweg als Tautologien.
Im Grunde genommen weiß und lehrt man dies seit Jahrhunderten
da und dort in der formalen Logik. Neuerdings sind
Alois Riehl, Benno Erdmann und J. von Kries in demselben
Jahre 1892 zurückgekommen auf eine Einsicht, die man bei Locke,
Hume und J. St. Mill vorbereitet findet, und haben ‚Real- und
Idealurteile’ oder ‚Real- und Reflexionsurteile’ oder ‚Objektsurteile
und Begriffsurteile’ unterschieden, um die Sonderstellung der logischen
Sätze zu kennzeichnen 1)126. Die Logik fällt danach nur Ideal =
Reflexions = Begriffs-Urteile. Den einfachsten Zugang zum Verständnis
dieser These öffnet, wie mir scheint, die alte Suppositionslehre
der Scholastiker: Wenn Du ‚Vater’ findest in einem Kontexte,
so merke Dir, daß manchmal das Wort dort steht nicht um ein
Symbol zu sein für den bekannten Erzeuger von Kindern, sondern
damit Du eine suppositio formalis usw. an dem wahrgenommenen
Zeichending vornehmen kannst. In der Linguistik z. B. nimmst
Du es als Substantivum. Ähnlich, wenn Du bei Logikern den Satz
findest ‚A ist A’; merke Dir, daß das nicht ein kindliches Spiel
384sein soll, sondern daß Du zur höchsten Formalisierung des Satzsinnes
vordringen und eine der Grundlagen des Darstellungssystems vom
Typus Sprache (nämlich den Identitätssatz), daran erfassen mußt.
In unserem Zusammenhang ist nur das eine wichtig, nämlich
einzusehen, daß die im Verständnis aller Sätze immer fortwirkende
Lemdeixis unterschieden werden muß von der Objektdeixis, die
implizite in allen Wirklichkeitsaussagen enthalten bleibt und nicht
eliminierbar ist. Ohne Objektdeixis gibt es keine Existenzaussage;
sie bleibt in allen Wirklichkeitssätzen auch dort, wo sie sprachlich
nicht zum Vorschein kommt, implizite enthalten. Bei den rein
begrifflichen Sätzen dagegen fällt die Objektdeixis mit der Lemdeixis
zusammen, weil die logischen Sätze über den Begriffsinhalt als
solchen gefällt werden und nicht darüber hinausgehen. Das ist
nach meiner Auffassung alles, was man in der Sprachtheorie braucht,
um der Eigenart logischer Sätze gerecht zu werden.
§ 26. Die Anaphora.
Die Mehrsatz-Kompositionen der Sprache heißen bei uns
Modernen Satz-Verbindungen oder Satz-Gefüge. Das sind übertragene
Namen, Metaphern. Es gibt aber noch anderes in der Welt als Bündel
und Bauten aus Stein und Holz, womit Sachverständige diese
Einheiten verglichen haben, um bald dies, bald jenes Moment an
ihnen hervorzuheben. Wer Verknüpfung sagt, denkt, falls er für
etymische Valeurs empfänglich ist, an Schlingen und Knoten; die
Tatsachen gestatten ihm dies. Schon die Griechen nannten Wörter
einer bestimmten Klasse σύνδεσμοι (σύνδεσμα) und die Lateiner
spannten durch ihre conjunctiones zwei Sätze an ein ‚Joch’; es waren
dieselben Wörter in der Mehrsatz-Einheit, welche den Griechen das
Bild der Fessel und den Lateinern das des Joches nahelegten. Die
Schöpfer des Wortes Text dachten an Gewebe; doch weiß ich nicht
genau, was sie vom Gewebe auf das Sprachliche spezifisch übertragen
wollten.
Endlich noch ein letztes Bild, das ich vor den anderen einer
Neubelebung empfehle, nämlich die Metapher von den Gelenken der
Rede, die in dem griechischen Namen ἄρϑρα = Gelenkwörter enthalten
ist. Gelenkwörter hießen ursprünglich alle sprachlichen
Zeigzeichen im Modus der Anaphora. Wir interpretieren das Gleichnis
für unseren Zweck und in unserer Terminologie folgendermaßen:
ähnlich wie der tierische und menschliche Körper durch seine Gelenke,
so erfährt das Band der Rede da und dort eine bestimmte
Absetzung, es findet jeweils ein Bruch des Symbolfeldes statt, und
385trotzdem bleibt das Abgesetzte funktional vereinigt, weil die anaphorischen
Zeigwörter eine Redintegration der abgesetzten Teile
symbolisieren und mehr oder minder genau angeben, wie sie vollzogen
werden soll. Das ist, wie mir scheint, eine Fassung der
Dinge, die zwar nicht für alles, aber doch für vieles im weiten und
bunten Plane der Phänomene, die uns zuletzt in diesem Buche
interessieren, so adäquat und erschöpfend ist, wie nur irgendein Bild
es sein kann.
Die ganze Formenwelt der Mehrsatz-Einheiten selbst wird erst
im folgenden Paragraphen wenn auch nicht erschöpfend behandelt,
so wenigstens zum Thema erhoben; vorher sei noch einmal der Weg
eines übergreifenden Vergleiches empfohlen, um das Wesen und
die Leistungsfähigkeit des anaphorischen Zeigens zu begreifen. Daß
die Anaphora von einigen großen Linguisten klar erfaßt und von
anderen gründlich verkannt worden ist, wird am Beispiel von H.
Paul und Brugmann deutlich. Ich zitiere ein Wort aus den Paulschen
Prinzipien und erläutere etwas ausführlicher die Gründe eines
typischen Mißverstehens an der Auffassung von Brugmann. Paul
schreibt:
„Es war für die Entwicklung der Syntax ein höchst bedeutsamer Schritt; daß
dem Demonstrativum, dem ursprünglich nur die Beziehung auf etwas in der Anschauung
Vorliegendes zukam, die Beziehung auf etwas eben Ausgesprochenes
gegeben wurde. Dadurch wurde es auch möglich, dem psychologischen Verhältnis,
daß ein Satz selbständig hingestellt wird und zugleich als Bestimmung für einen folgenden
dient, einen grammatischen Ausdruck zu geben. Das Demonstrativum kann sich
auf einen ganzen Satz oder ein Satzglied beziehen” (148, die Hervorhebung von mir).
Das ist eine sehr treffende Bemerkung, welche in der Sprachtheorie
aufgegriffen und ausgedacht zu werden verdient. Doch muß
man sich zuvor die Gründe derer ansehen, welche die Eigenart der
Anaphora bestritten haben. Wir konfrontieren also die alte Auffassung
der Anaphora, welche Paul vertritt, und eine moderne,
um über das Phänomen als solches ins klare zu kommen; das ist
das Thema im ersten Abschnitt. Unser Ergebnis lautet, der Kontext
selbst werde zum Zeigfeld erhoben in der Anaphora. Daran schließen
dann wie auf losen Blättern einige Betrachtungen an, welche die
Leistungsfähigkeit der Anaphora allgemein beleuchten.
1. Die moderne Verkennung der Anaphora, die ich im Auge
habe, ist am konsequentesten bei K. Brugmann zu finden; in
seiner klassischen Akademieabhandlung über die Demonstrativpromina
der indogermanischen Sprachen steht folgendes:
„Der Unterschied zwischen Deixis und Anaphora, wie er seit Apollonius
Dyskolus in bezug auf den Gebrauch der Demonstrativpronomina gemacht zu
werden pflegt (vgl. Windisch Curtius' Stud. 2, 251 ff.), wird öfters als die wichtigste
386Verschiedenheit in der Verwendung dieser Wortklasse betrachtet und dementsprechend
zu ihrer Definition verwendet; so sagt z. B. Wundt, die Funktion des
Demonstrativums sei die des Hinweises auf Gegenstände und Personen, die entweder,
weil sie sich in unmittelbarer Nähe befinden, oder weil sie kurz zuvor erwähnt
wurden, der besonderen, sonst für sie geltenden Namenbezeichnung nicht bedürfen.
Diese Einteilung trifft aber nicht das Wesen unserer Pronominaklasse.”
„Ursprünglich scheinen die Demonstrativa nur auf Elemente der unmittelbaren
Sinneswahrnehmung bezogen worden zu sein. Der Sprechende behandelte
dann aber seine gesamte Vorstellungswelt nach Analogie der gegenwärtigen Anschauung,
und das Wesen dieser Klasse von Pronomina, wie sie in geschichtlichen Zeiten
allenthalben gebraucht werden, bestimmt man wohl am besten so: sie sind die
sprachliche Hinweisung auf etwas, dem der Sprechende seine Aufmerksamkeit
zugewendet hat, und fordern den Angesprochenen auf, den Gegenstand ebenfalls
ins Auge zu fassen. Will man alsdann eine Einteilung der sämtlichen einschlägigen
Fälle in der Richtung vornehmen, in der die Unterscheidung nach Deixis und Anaphora
liegt, so wäre die einzige mit dem Wesen der Sache in Übereinstimmung
befindliche Scheidung darnach zu machen, ob es etwas ohne weiteres Bekanntes,
nicht erst durch die augenblickliche Situation bekannt Werdendes ist, worauf
hingewiesen wird, oder etwas, dem diese Eigenschaft nicht zukommt” (13 ff.). Also
Bekanntes und Nichtbekanntes.
Brugmann widmet der Frage einen ganzen Paragraphen;
ich habe den ersten und letzten Abschnitt, die bestreitende Behauptung
und den positiven Vorschlag des großen Sprachforschers
abgedruckt. Dazwischen steht die psychologische Begründung für
beides. Es wird an Beispielen verdeutlicht, daß der Hinweis auf
wahrhehmungsmäßig Präsentes „ohne feste Grenze” übergeht in
den Hinweis auf soeben Wahrgenommenes, was noch frisch im
Gedächtnis steht; und zu dem Letzteren wird schlankweg die
Anaphora gerechnet.
„So ist es, wenn ich ohne eine das Pronomen begleitende hinweisende Gebärde
zu jemanden sage dies war herr N., nachdem ein Herr an uns vorübergegangen ist,
oder wenn ich nach dem Donner sage das war kräftig! oder nach Anhörung eines
Liedes dieses lied ist mir neu”. „Wenn ich bei den Worten dies war herr N. nur etwa
den Kopf nach der Seite wende, an der die Person vorübergegangen ist, so gibt diese
Gebärde dem Pronomen den Charakter einer sinnlichen Deixis.” Und wie steht es
nun mit der Anaphora? Die Funktion des Demonstrativums ist, wenn ich z. B.
nach dem Anhören einer Behauptung sage dies ist mir neu genau dieselbe wie in
jenem Satz dies lied ist mir neu. Und es tritt auch dadurch kein Unterschied ein,
daß das Pronomen, statt auf die gehörten Worte eines anderen, auf ein vom Redenden
selbst gesprochenes Wort geht.
Auch kehren in beiden Fällen die verschiedenen Grade in der Schärfe der
Deixis wieder „bis herab zum gewöhnlichen Artikel”. „Und in dieser Beziehung
ist auch keine Verschiedenheit, ob das deiktische Pronomen auf vorausgegangene
Worte geht oder auf nachfolgende: Vgl. z. B. merk dir die (diese) lehre: du mußt usw.
und merk dir die Uhre: du mußt usw., ich setze den fäll, daß usw.”
Das alles klingt beim ersten Hören sieghaft überzeugend; die
Brugmannschen Beispiele sind vorzüglich aus dem Leben gegriffen
387und beweisen, daß der Schnitt zwischen einem Hinweis mit und
ohne Kopfwendung in der Tat bedeutungslos ist. Denn was soll
daran gelegen sein, ob ich die Kopfwendung nach dem soeben
vorübergegangenen Herrn hin ausführe oder nicht ausführe? Ob dies
Lied, von dem ich weiter sprechen will, faktisch gesungen worden oder
nur als Gesprächsgegenstand mir und meinem Redepartner soeben
noch präsent gewesen ist? Wir stimmen Brugmann bei: ob wahrgenommen
oder nur gedacht, ist schlechthin irrelevant. Hinzuzufügen
ist aber eine freilich entscheidende Einschränkung: solange
es sich um nichts anderes als um das primär sachliche Zeigen handelt.
Solange besteht in der Tat keine Veranlassung, einen Schnitt zu
ziehen. Denn die Deixis am Phantasma beruht auf genau denselben
psychologischen Voraussetzungen wie die demonstratio ad oculos und
operiert mit den gleichen sinnlichen Zeighilfen. Anders aber werden
die Dinge in dem Augenblick, wo an Stelle des sachlichen Zeigens
ein syntaktisches Zeigen vorliegt. Denn die psychologische Grundlage
des syntaktischen Zeigens ist verschieden von der des sachlichen
und die Horizonte des dort und hier Zeigbaren (Treffbaren) schneiden
sich zwar, sind aber keineswegs identisch. Brugmanns Beispiele
stammen aus dem Bereich des sachlichen Zeigens; auch in der
Bemerkung dies ist mir neu kann der gemeinte Neuheitscharakter
im Sinne Brugmanns völlig parallel zu dem Neuheitseindruck,
den das gehörte Lied hervorrief, am Dinge haften, das mir durch
die Rede des anderen in der Vorstellung präsent geworden ist. Der
Hinweis durch das Wörtchen ‚dies’ ist in solchem Falle ein sachlicher
Hinweis und Brugmann bleibt im Rechte.
Wie aber, wenn ich den Text ein wenig verändere und sage:
dies ist wahr (falsch, plausibel, gelogen usw.)? Ein wahres oder
falsches Ding gibt es auf Erden und im Himmel und in der Hölle
nicht; denn wahr oder falsch kann nur ein Urteil, ein Satz oder
allgemeiner eine Darstellung als solche sein 1)127. Worauf ich verweise
im Satze ‚dies ist wahr’ ist nicht ein Ding, sondern es ist eine eben
ausgesprochene Behauptung, ein Stück der Rede selbst, in die ich
gerade eingeschaltet bin. Gleichviel (wie Brugmann mit Recht
betont), ob diese Behauptung in meinem oder deinem oder (wie
wir ergänzend hinzufügen) im Munde eines Dritten, dem wir zuhören,
entstanden ist. Die Theorie der Dinge verlangt nichts anderes,
als daß erkannt und ein wenig philosophisches Erstaunen für das
Faktum aufgebracht wird, daß die aktuelle Rede, die meistens auf
388etwas, was sie nicht selbst ist, geht, sich manchmal zurückwendet
und reflexiv wird. Die Anaphora ist reflexives Zeigen und muß als
solches genau so gut und genau so scharf von dem gewöhnlichen
sachlichen Zeigen unterschieden werden, wie man z. B. den Selbstmord
vom gewöhnlichen Morde abhebt. Daß es Fälle gibt, die von
außen her so oder so interpretiert werden können, hat Brugmann
bewiesen, mehr nicht.
Ein anderes Beispiel, durch das man systematisch auf Differenzen
innerhalb der Anaphora aufmerksam wird. Wir erproben
die Brugmannsche Formel an dem ehrwürdig-trivialen Modell des
korrekten Syllogismus der Logiker: Alle Menschen sind sterblich.
Caius ist ein Mensch. Also ist Caius sterblich. Auch ein solches
‚also’ oder ‚demnach’ oder ‚folglich’ fungiert trivial bestimmt anaphorisch
zeigend. Um alles zu sagen, so fordert es den Hörer auf,
die beiden Vordersätze zusammenzudenken (owogav nach Aristoteles)
und die Konsequenz zu ziehen. Und darin ist (was immer
sonst noch) jedenfalls ein Zurück- und Vorverweisen in der Reihe
der aufeinanderfolgenden Sätze enthalten. Doch darf die genauere
Interpretation in diesem Falle nicht übereilt verfahren. Fest steht,
daß der Rückverweis auf etwas geht, woraus die Konsequenz
zu ziehen ist und daß ich mich an die vorausgehenden Sätze wenden
muß, um dieses Etwas zu finden. Ein Logiker weiß ferner, daß
das Ziehen derjenigen Konsequenz, die ihn interessiert, nicht
im mindesten beeinträchtigt wird durch eine passende Änderung
der Termini in den Vordersätzen. Ob das Menschen sind und Caius
oder ob an ihrer Stelle von X und Y gehandelt wird; ob es sich ums
Sterben oder ein beliebiges anderes Prädikat a handelt, ist in Hinsicht
des Ziehens der logischen Konsequnz völlig irrelevant. Im
Gebrauch der Logik fordert also das anaphorische Zeigen gleichzeitig
zu einer Formalisierung der dargestellten Sachverhalte auf.
Ich stelle, um weitere Differenzen, die in einer systematisch ausgebauten
Lehre vom anaphorischen Zeigen nicht übersehen werden
dürfen, wenigstens anzudeuten, einander gegenüber ‚mies ist unrichtig’
und ‚dies ist eine Lüge’, was noch einmal unterschieden
werden muß. Denn das zweite kann als eine Beleidigung empfunden
und gerichtlich bestraft werden, während das erstere vor der Instanz
einer logischen Rechtsprechung ausgetragen werden muß. Auf
eine Erörterung dieser Dinge soll aber hier nicht eingegangen werden;
genug, wenn zugegeben wird, daß es in all dem jedenfalls ein internes,
irgendwie zurück- und vorweisendes Zeigen gibt. Mit der viel
zu armen Dichotomie in Bekanntes und Unbekanntes ist diese
389greifbare Mannigfaltigkeit der Zeigfälle theoretisch nicht zu bewältigen.
Nein, die Anaphora muß von einer ganz anderen Seite her
studiert werden, nämlich so: Hat man am Satz ohne Zeigfeld erkannt,
daß und wie die sprachliche Darstellung in bestimmten Grenzen
und schrittweise den Anschauungsstützen der Sprechsituation enthoben
und frei wird von Zeichen, die wie Wegweiser fungieren, so
bietet das Satzgefüge ein neues Schaustück. Die alten Zeigzeichen
verschwinden nicht, sondern übernehmen (vom Außendienst entlastet)
eine innendienstliche Funktion des Zeigens. Mit einem Wort:
sie stehen immer noch da im Kontexte, aber ihre Arme oder Pfeile
weisen nicht mehr direkt auf Dinge, die man mit den Augen im Blickfeld
suchen soll und findet, sondern sie deuten auf Kontextstellen
und Kontextstücke hin, wo man findet, was am Platze der Zeigzeichen
selbst nicht geboten werden kann. Was die anaphorischen
Pfeile direkt treffen, sind nicht die Dinge, von denen die Rede ist,
sondern es sind entweder die sprachlichen Fassungen dieser Dinge,
also Sätze oder Satzteile, wie es Paul schon völlig korrekt angibt.
Oder es sind doch die Dinge, aber so wie sie gefaßt sind; die Dinge
und Sachverhalte also, wie sie von den Gesprächspartnern bereits
als das und das charakterisiert worden sind. Man wird diesen
Unterschied parallel zu unserer Formel vom satzfügenden und
sachbündelnden und in Zukunft scharf ins Auge fassen und
Kriterien finden, an denen rein grammatisch in vielen Fällen
wenigstens das eine vom anderen unterschieden werden kann. Jedenfalls
aber sprächen alle anaphorischen Pfeile, wenn sie sprechen
könnten, ungefähr so: schau vor oder zurück das Band der aktuellen
Rede entlang! Dort steht etwas, das eigentlich hierhergehört, wo
ich stehe, damit es mit dem Folgenden verbunden werden kann.
Oder umgekehrt: dorthin gehört, was mir folgt, man hat es nur der
Entlastung wegen versetzt.
Wer es sein Leben lang mit nichts anderem als mit der Sprache
zu tun hat, verliert manchmal die Fähigkeit, sich zu verwundern
über das, was die Sprache zu leisten vermag; es ist ihm zu selbstverständlich
geworden. Dann ist es an der Zeit, daß er sich vergleichend
nach Außersprachlichem umsieht. Es sollen hier die
höheren Kompositionsmittel anderer Darstellungsgeräte eines Blickes
gewürdigt werden. Mehr als ein orientierender Blick aus der Vogelschau
kann und darf es in dieser ersten Skizze nicht sein. Man findet
Ansätze zu internen, sozusagen bautechnischen Zeigzeichen manchen
Ortes außerhalb der Sprache; doch sind es überall nur Ansätze. Das
390sachgerechte Zusammenfügen wird meistens durch andere Hilfsmittel
garantiert. Trotzdem ist es lohnend und lehrreich, die verschiedenen
Fügetechniken zu studieren; denn wer sie kennt,
findet vieles in der Sprache wieder und vielfach genügen auch der
Sprache die nicht-anaphorischen Fügemittel vollkommen. Als
schlechthin unentbehrlich kann demnach das anaphorische Zeigen
keineswegs angesprochen werden; doch ist es sehr wirkungsvoll
und in mehr als einer Hinsicht außerordentlich charakteristisch
für die Sprache. Wir erinnern uns klar noch einmal der Kontextfaktoren,
die im analytischen Untersuchungsgang systematisch
besprochen worden sind (S. 174ff.); wo und wie ist jenem System
der neue Faktor anzureihen?
2. Die Anaphora gehört am engsten zusammen mit dem Kontextfaktor
des „Nebeneinanderstellens” aus der Liste von H. Paul.
Daß und wie sich die in einem Satze vereinigten lexikalischen Sinneinheiten
rein stofflich zusammenfinden und aneinander anpassen,
wurde über das von Paul nur Angedeutete hinaus an den Text-Rekonstruktionen
der Versuchspersonen Ch. Bühlers, es wurde
noch einmal anders an der Metapher mit ihrem Abdeckungs- und
Abstraktionseffekte deutlich. Die Anaphora ist ein eigenes Mittel
der Sprache, um solches Zusammengehen in gewissem Ausmaß dem
Zufall zu entziehen und weiter, als es die syntaktische Ordnung im
Symbolfeld des einzelnen Satzes schon vollbringt, Bestimmtes an
Bestimmtes anzuschließen. Sie macht es möglich, ohne Gefährdung
der Gesamtübersicht Einschiebungen aller Art zu vollziehen und in
kleinen oder großen Bögen über alles Zwischenliegende hinweg schon
Dagewesenes wieder hervorzuholen oder erst Kommendes schon im
voraus zur Verbindung mit dem gerade Genannten in Aussicht zu
nehmen. Im ganzen ein außerordentlich vielgestaltiges Füge- und
Beziehungsmittel, das die Beschränkungen des psychophysischen
Gesetzes, daß die Wörter im Redeabfluß nur kettenförmig eines
nach dem anderen hervorgebracht werden können, weitgehend
ausgleicht.
Um nichts zu übersehen, was dazu gehört, vergleichen wir zuerst
wie aus der Vogelschau den Wortabfluß menschlicher Reden mit
dem Bildabfluß im (stummen) Film. Lessing kam da und dort bei
seinem Vergleich der Sprache mit dem Bilde des Malers auf Homer;
die Sprachtheorie sollte, was er begonnen, auf breiter Basis einmal
zu Ende führen und dabei die Möglichkeiten des bewegten Bildes
nicht vergessen. Ob man je daran gedacht hat, die Odyssee faktisch
im Film wiederzugeben? Geschähe es, so wüßte die Sprachtheorie
391eine Reihe von Gesichtspunkten namhaft zu machen, unter
denen Vergleiche hinüber und herüber der Strukturanalyse beider
Darstellungsgeräte förderlich wären. Es sei mir gestattet, zur Vorbereitung
auf die Schilderung des dem stummen Filme versagten
Mittels der Anaphora zuerst eine Ähnlichkeit von epischer Erzählung
und Filmtechnik zu unterstreichen.
Der Film ist dem Epos verwandter als der dramatischen Rede
im Hinblick auf die Deixis am Phantasma. Denn im Drama kommt,
wo Abwesendes hineingezogen und zeigend behandelt werden soll,
der Berg zu Mohammed, während die Stärke der epischen Erzählung
in der beweglichen Versetzbarkeit Mohammeds zum Berge
liegt. Der Film ist episch in diesem Punkte aus leicht ersichtlichen
Gründen. Um mit dem Greifbarsten zu beginnen: Im erzählenden
optischen Filmband treten an vielen Stellen Szenenschnitte auf,
die der technisch naive Zuschauer kaum bemerkt. Bei der Aufnahme
des Films wurde sprunghaft ein Standpunktswechsel vollzogen, man
ist von einer Fern- zur Nahaufnahme gesprungen oder ein Stück weit
um den Gegenstand herumgegangen mit der (während des Ganges
geschlossenen) Kamera. Das sind die einfachsten Versetzungen,
welche bei der Wiedergabe ebenso wenig stören wie ein Rundgang in
Etappen, den wir selbst als Betrachter um eine Statue, ein Haus, eine
Stadt herum vollziehen, ein Rundgang mit Betrachtungspausen.
Streng genommen treten unvermeidbare Betrachtungspausen mit Blickpunktssprüngen
überall ein, wo wir bei scheinbar kontinuierlichem Sehen ein ruhendes Bild
mit unserem Blick abwandern oder ein bewegtes mit dem Blick verfolgen. Es ist
eine große Täuschung, wenn einer glaubt, er habe je z. B. eine Kreisfigur oder die
Konturen einer menschlichen Gestalt mit bewegtem Blick ähnlich wie man dies
mit der bewegten tastenden Hand tun kann, kontinuierlich wahrnehmend abgefahren;
das ist aus physiologischen Gründen unausführbar. Auch der Lesende springt mit
seinem Blick das optische Zeilenband entlang und sieht während der Bewegung
keine Druckfiguren. Der Kameramann nützt also nur das überall Unvermeidliche
manchmal in technisch raffinierter Weise aus.
Die ersten exakten Aufschlüsse über die Blicktechnik des wandernden menschlichen
Auges brachte das Buch von B. Erdmann und R. Dodge über das Lesen:
„Psychologische Untersuchungen über das Lesen auf experimenteller Grundlage”
1898. — Das Thema der Augenbewegungen wurde von da an mit zäher Beharrlichkeit
von Dodge weiter verfolgt und mit den Fortschritten der Experimentiertechnik
immer weiter ausgebaut. Die Augen werden, wie wir heute kurz sagen
können, auf ihrem Wege von einem zum nächsten Fixationspunkt physiologisch
nie „geführt”, sondern „geschleudert”. Sie bewegen sich ballistisch und darum
letzten Endes ist ein kontinuierliches Abfahren von Dingkonturen mit dem Blicke
unmöglich; die tastende Hand dagegen bewegt sich „geführt”, d. h. so, daß die
Bewegung in einem antagonistischen Muskelspiel abgebremst wird und in jedem
Augenblick Zusatzsteuerungen zugänglich bleibt.392
Wir haben an einigen gerade laufenden Filmen die Kamerasprünge
abgezählt und die unerwartet große Anzahl von durchschnittlich
500 gefunden. Etwa 80-90% davon gehören zu den bereits
genannten Perspektivensprüngen. Durchaus geläufig ist z. B., daß
man die Hauptperson auf einem Weg begleitet und etappenweise
einige Durchgangsorte sieht: Lady N. übernimmt es im Gesellschaftszimmer,
die Kinder zur Neujahrsfeier zu holen; man sieht
sie weggehen ‖ die Treppe steigen ‖ das Kinderzimmer öffnen ‖ die
Kinder wecken usw. Dazwischen liegt jeweils ein Kamerasprung.
Und genau so im Prinzip verfolgt Homer den Gang der Penelope zur
Schatzkammer, um den Bogen des Odysseus für den Wettkampf der
Freier zu holen (Od. XXI):
„Und so stieg sie empor die ragende Treppe des Hauses,
Nahm mit kräftiger Hand den zierlich gebogenen Schlüssel,
Prächtig geschmiedet aus Erz mit elfenbeinernem Griffe,
Ging zur Kammer darauf im Geleite der dienenden Frauen,
Ganz am Ende des Hauses, da lagen die Schätze des Königs,
Golden und ehern Gerät und vielgehämmertes Eisen.
Dort auch ruhte der Bogen, der doppeltgekrümmte; daneben
Lag der Köcher, er war voll schmerzensreicher Geschosse
…
Als zu jenem Gemache die herrliche Fürstin gekommen
Und die eichene Schwelle betrat, die klugen Verstandes
Einst der Künstler geglättet und grade gemacht nach der Richtschnur
Und mit Pfosten versehn zum Halt für die glänzenden Flügel,
Machte sogleich sie los die Riemen vom Ring an der Türe,
Steckte den Schlüssel hinein und schob die Riegel beiseite,
Nach der Seite sie stoßend, und dumpf erdröhnten die Flügel.
Wie des weidenden Stieres Gebrüll auf der Wiese, so dröhnte
Dumpf die prächtige Tür, beim Druck des Schlüssels sich öffnend.
Und sie betrat das hohe Gerüst; dort standen die Truhen,
Welche die duft'gen Gewänder bewahrten; sie reckte von dort aus
Sich in die Höh' und nahm den Bogen herab von dem Nagel
Mit dem Behälter, der ihn umschlossen mit schimmerndem Glänze.
Und sie setzte sich nieder und legt' ihn über die Knie,
Laut aufschluchzend, und nahm heraus den Bogen des Königs.
Aber nachdem sie das Herz durch Tränen des Kummers erleichtert,
Stieg sie herab und ging nach dem Saal zu den üppigen Freiern,
Und sie hielt in der Hand den Bogen, den doppeltgekrümmten,
Und den Köcher; er war voll schmerzensreicher Geschosse.
Aber es trugen den Korb ihr nach die dienenden Frauen,
Voll von Eisen und Erz, dem Kampfgerät des Gebieters.
Und sobald zu den Freiern sie kam, die herrliche Fürstin,
Trat sie neben den Pfosten des festgefügten Gemaches,
Und sie hielt vor den Wangen den duftigen Schleier zusammen,
Sprach zu den Freiern darauf und redete, also beginnend:”393
Man ist dabei, man wird versetzt zur hochragenden Treppe des
Hauses an den Eingang der Schatzkammer usw.; und fängt mit
dem Dichter an einigen Etappen diskontinuierlich bestimmte sorgfältig
ausgemalte Teilszenen, fruchtbare Momente des ganzen Geschehens
auf. In diesen Versetzungen Mohammeds zum Berg liegt
zunächst eine Gleichartigkeit beschlossen, um derentwillen wir vom
Film sagen müssen, er sei dem Epos verwandt. Wir fügen aber sofort
hinzu, daß es vor allem zwei Momente sind, die jede sprachliche
Darstellung unvergleichbar reicher macht als je ein stummer Film
werden kann. Das eine sind die kurzen, geschlossenen Einheiten der
einzelnen Sätze und was sie an Gehalt zu bieten vermögen; das andere
ist das Fügemittel der Anaphora. Doch bleiben wir noch einen
Augenblick bei der Technik des bewegten Bildes und führen den
Vergleich von seinen Mitteln aus weiter.
Sorgfältig gewählt sind im Filme die Größensprünge. Kamerafachleute
sagen in Übereinstimmung mit Bela Balazs, es gäbe im
Prinzip drei Größenstufen bei Personenaufnahmen, nämlich das
Großbild, Normalbild und Kleinbild. Das Großbild bietet oft nur
den Kopf und an ihm ein Ausdrucksgeschehen, das Normalbild den
ganzen handelnden Menschen im genügend weit mit aufgenommenem
Aktionsfeld, das Kleinbild eine Landschaft oder Menschenmasse,
worin der Held bis an die Grenze des Verschwindens untergeht oder
sich an einem Ferngeschehen abmüht. Kontinuierliche Übergänge
und sprunghafte Wechsel im derart natürlich nur roh abgesteckten
Größenbereich sind beliebte Darstellungstechniken des Films.
Wie man sprachlich darstellend verfährt, um das eine Mal die
großen Züge einer Sache und dann wieder Einzelheiten herauszuholen,
läßt sich aus vielen Gründen nicht allgemein und nicht
mit zwei Worten angeben; man könnte aber, um typische Techniken
zu studieren, wieder zuerst zu den Epikern und Märchendichtern in
die Schule gehen. Wird, wie das schon in der durchsichtigen Erzählungstechnik
des kindlichen Märchens nicht selten geschieht,
zuerst ein Rahmen abgesteckt, dann bedarf es für die folgenden
Einzeleintragungen keiner umständlichen sprachlichen Fügemittel
mehr. Homer verlegt, wie ich einer Arbeit von F. Trojan entnehme,
die Rahmenschilderung oder Exposition mit Vorliebe auf den Olymp
in den Rat der Götter und kann danach, weil man schon weiß, wie
es im Ganzen ausgehen muß, sich vielfach behaglich an Einzelschilderungen
verlieren. Cäsar fährt nach einer allgemeinen Notstandsschilderung
seines Heeres im Feindeslande mit ‚veni, vidi,
vici’ fort; Goethe skizziert im Sänger in vier Zeilen die Situation
394und läßt vier sprachlich unverbundene Sätze folgen: ‚Der König
sprachs, der Page lief; der Knabe kam, der König rief.’ In all
diesen Fällen genügt die Szenenfolge, es bedarf keiner anderen
Fügemittel.
Raffiniertere Kamerasprünge halten z. B. den Helden oder
die Helden fest und wechseln unvermittelt das Milieu um sie; ein
Rendez-vous auf der Straße, das Paar im Tanzsaal, zu Hause;
oder ein Herr im Frack springt in Boston ins Meer und steigt nach
einigem Wassergewoge bei Sorrent im Badekostüm ans Ufer. Wir
notieren für unseren Zweck die Wiederkehr des Handelnden und
denken im Vorbeigehen daran, wie mannigfaltig und frei die sprachliche
Darstellung das stoffliche Fügemittel der Wiederholung von
sinntragenden Nennwörtern (oder auch einmal von Zeigpartikeln)
verwendet: Abraham zeugete Isaak. Isaak zeugete Jakob. Jakob…
Eine Kettenstruktur ohne Bindewörter. Die sachlich selbstverständlichen
Zeitpausen des Zeugens (genau so wie die weiblichen
Partner) bleiben unerwähnt, was die Sprachtheorie nur in dem Ausmaß
interessiert, das wir an früherer Stelle (S. 172) abgesteckt
haben. Von Wiederholungen, die durch Anaphora ersetzt werden
können, wird noch zu sprechen sein.
3. Nun etwas anderes. Gekünstelt, aber manchmal praktiziert
auf der Leinwand sind eingeschobene Erinnerungs- und Phantasiegeschehnisse,
die den Akteur in Gedanken beschäftigen; auch
dabei findet ein irgendwie vorangezeigter und markierter Szenenwechsel
statt. Doch kann man technisch auch so vorgehen,
daß die Bilder des Abwesenden in Gegenwartssituationen hineingesetzt
werden. Ich sah in dem Pariser Don-Quichotte-Film z. B.
die Phantasmata des Helden als Strichfiguren durch das büchergefüllte
Studierzimmer und über die Folianten hinwegziehen. Damit
erzwingt sich der Film in gewissen Grenzen das dem Drama von
Natur aus eingegebene Zitieren des Berges zu Mohammed. Der Film
macht zu diesem Zweck eine Basisszene zur Bühne und zitiert auf
sie das Abwesende, das er gespensterhaft durchsichtig werden läßt,
um es vom Erscheinungsraum (der Bühne) abzuheben; es sind Luftgebilde
wie das wilde Heer und andere Gespenster und vielfach in
einem bühnendisparaten Maßstab aufgenommen und eingesetzt.
Sie sind mit einem Wort das Bild im Bilde, soweit es der Film zu
bewältigen vermag. Und weil der Film in diesem Punkte nicht weit
mitkommt, behaupten wir, es fehle ihm etwas für jede dramatische
Rede sehr Wichtiges und Charakteristisches, nämlich das Zitieren
des Abwesenden in das Gegenwärtige hinein. Es fehlt ihm diejenige
395Präsentierungstechnik, welche Engel sehr eindrucksvoll am dramatischen
Geschehen beschrieben hat 1)128.
Weiter: Der sprachlichen Darstellung (z. B. im Epos) sind
Einschiebungen durchaus geläufig; die Sprache besitzt die adäquaten
Mittel, sie richtig zu demarkieren. Filmtechnisch dagegen sind und
bleiben sie ein Sonderunternehmen. Sonst erinnert die Filmtechnik
in mehr als einer Hinsicht an die Sprünge und Diskontinuitäten
der Träume. Im Traum des nicht ganz oberflächlichen Schlafes
erfolgt regelmäßig bei jedem Impuls zu einer Rückschau auf Erinnertes
oder Vorschau auf Erhofftes, Befürchtetes die vollständige
Entrückung aus der Gegenwart, also ein vollständiger Szenenwechsel
statt. Allgemeiner ausgedrückt: ein Absprung aus der Basis-Situation,
zu welcher der Träumende meist nicht wieder zurückkehrt 2)129.
Hier liegt wieder ein bedeutsamer Unterschied zwischen der Fügetechnik
des sprachlichen Epos und derjenigen des Filmes vor.
Der Film mit seinen gleichfalls vollständigen Versetzungen
ist in diesem Punkte ungefähr auf gleich und gleich mit der Traumregie
des Vorstellungslebens, die sich der Wachregie gegenüber als
reduziert erweist. Und die Wachregie des komplexen Denkens und
Vorstellens kommt kunstgerecht zum Vorschein in den verwickelten
Bauten der Haupt- und Nebensätze, im Wechsel von erzählender,
direkter und indirekter Rede usw. Doch bleiben wir hier bei den
gröberen Einschiebungen. Homer kann z. B. in die zitierte Schilderung
des Penelopeganges eine scharf demarkierte Geschichte des Odysseus-Bogens
einschieben. Die sprachliche Darstellung gestattet ihm durch
ihre spezifischen Fügemittel, die in diesem Punkte höheren Leistungen
der Wachregie unseres Vorstellungslebens zu mobilisieren. Als Versetzungszeichen
396genügt am Beginn der Episode das Wörtchen
einst, welches der Film nicht sprechen und der Traum des tieferen
Schlafes als Generalindex der Einschiebung nicht ordentlich festhalten
kann. Dem Erzähler Homeros (vielleicht auch der Penelope)
fällt schon beim Gedanken an den Bogen die Geschichte des
Waffenstücks ein:
„In Messene waren sie einst zusammen gekommen
In des beherzten Orsilöchos Haus. Dort holte die Buße,
die das gesamte Volk ihm schuldig geblieben, Odysseus.”
Diese Geschichte aus der Vorvergangenheit wird dann behaglich
erzählt. Und am Ende führt zur Basis-Situation zurück die
bereits zitierte Wortfolge: „Als zu jenem Gemach die herrliche
Fürstin gekommen” usw.
Das Thema „Film und Epos” ist sprachtheoretisch ungemein
aufschlußreich. Wir betonen für unseren Zweck noch
einmal: beide versetzen den Seher oder Hörer ausgiebig; und
dann fahren wir fort: die Sprache aber ist dem Film bei weitem
überlegen kraft ihrer Zeigzeichen allgemein, kraft der Deixis am
Phantasma und des anaphorischen Gebrauchs dieser Zeigzeichen
im besonderen.
4. Um eine klare Vorstellung von dem Vorkommen, der Verteilung
und dem Gewicht der Anaphora als Fügemittel in normalen
Prosatexten zu erhalten, habe ich statistische Aufnahmen gemacht
und Schaubilder der über die Texte hin verstreuten anaphorischen
Wörter gezeichnet, die anderen Ortes veröffentlicht werden sollen.
Es gibt von großen Meistern des Deutschen auffallend anaphoraarme
Texte (bei Goethe und Nietzsche z. B.) und vielfach sehr
reiche in Gedichten und Prosawerken von Schiller. Doch schwankt
dieser Reichtum auch bei demselben Autor und in demselben Werk
oft außerordentlich stark. Mit anaphorischen Verweisungen überladen
sind vielfach Texte der üblichen Kanzleisprache. Man kann
an ihnen erläutern, wohin es führen müßte, wenn für die Sprache
mutatis mutandis nicht derselbe Grundsatz gültig wäre, den mehr
als ein nachdenklicher Maler für seine persönliche Darstellungstechnik
ausdrücklich formuliert hat: Malen heißt Weglassen. Auch
gut sprechen heißt sparsam sein und dem Hörer viel übrig lassen;
vor allem aber eine weitgehende Freiheit im eigenen mitkonstruierenden
Denken. Die anaphorischen Zeigzeichen legen streng besehen
dies konstruktive Mitdenken des Hörers ans Gängelband und, wenn
irgendwo, so gilt für ihren Einsatz die griechische Weisheit des
Maßhaltens.397
§ 27. Die Formenwelt der Satzgefüge.
(Eine Skizze.)
Es ist ähnlich wie beim Kompositum: der vergleichende
Sprachforscher kennt auch, an den Sätzen eine fixierte Formenwelt
von Gefügen, über deren Geschichte man vieles weiß. Zu wünschen
blieb dort und hier, daß der Quellpunkt des Mannigfaltigen gefunden
und ordentlich gefaßt würde. Das war es, was Brugmann
meinte, wo er in Sachen des Kompositums das Wort niederschrieb:
„Nicht auf die Schicksale, welche die fertigen Komposita erfahren
haben, kommt es uns an, sondern auf den Kompositionsprozeß
selbst, auf die Komposition als Urschöffungsakt”. Man könnte
die gleiche Devise über eine Serie von Arbeiten schreiben, die sich
von Adelung bis Nehring um das Wesen des Satzgefüges bemühten;
es war vor allem die Hypotaxe, auf deren ‚Urschöpfungsakt’
das Nachdenken abzielte. P. Kretschmer formuliert eine Erstannahme
darüber so: „Es ist eine für die Geschichte der Satzgefüge
grundlegende, übrigens bis auf Adelung zurückgehende Erkenntnis,
daß es ursprünglich nur einfache Sätze gegeben hat und das
hypotaktische Satzverhältnis aus dem parataktischen hervorgegangen
ist” 1)130. Was diese Auffassung stützt, sind sowohl historische
als psychologische Erwägungen. Man kann die psychologischen
verteidigen gegen scheinbare und wirkliche Einwände, die von
Männern wie Meillet und Brugmann, weit schärfer und grundsätzlicher
aber noch von H. Paul erhoben worden sind. Davon
wird ausführlich die Rede sein.
Historisch gesehen fällt für unsere Sprachfamilie die Tatsache
ins Gewicht, daß im Urindogermanischen keine Relativa und
Konjunktionen nachgewiesen sind, woraus Eduard Hermann (besonders
vom Griechischen her) die Folgerung zog, daß es im Urindogermanischen
keine Hypotaxe gegeben habe. Doch traten
Forscher auf, welche die Bündigkeit dieser Folgerung bestritten
und darauf hinwiesen, daß im Bereich der lebenden Sprachen überall
dort, wo ein ähnliches Fehlen hypotaktischer Formantien vorkommt,
musikalische Differenzierungsmittel der Sätze einspringen.
So ließ es sich vor allem Jacobi angelegen sein, vergleichende
Befunde aus anderen Sprachfamilien vorzulegen und außerdem die
vermutlich ältesten nebensatzartigen Fügungen der Indogermanen
aus Relikten am erstarrten Kompositum zu rekonstruieren. Meillet
unterstrich den Faktor der musikalischen Mittel und hielt es für
398denbkar, daß es älteste indogermanische Konjunktionen gab, die
frühzeitig ausgestorben sind. Es ist also, wie man sieht, kein Mangel
an Meinungsverschiedenheiten über die Urgeschichte der Satzgefüge.
Wir treffen als Phänomenologen den Nerv der Dinge und die
sprachtheoretischen Probleme, wie mich dünkt, am schnellsten
durch die klare Opposition eines Sprachzustandes, worin die Parataxe
das Bild beherrscht, mit einem anderen Sprachzustand, worin
die Hypotaxe auf der Höhe ihrer Entwicklung steht. Als ich daran
arbeitete, fand ich eine Wiener Dissertation, welche die gesuchte
Opposition geradezu paradigmatisch behandelt. Es ist die von
Prof. Czermak geleitete, sprachtheoretisch lehrreiche Untersuchung
von W. Diemke 1)131; ich entnehme ihr einen Text aus dem Altägyptischen,
der mit einem Satzgefüge aus Thukydides aufschlußreich
verglichen wird. Für unsern Zweck genügt es, die deutsche Wiedergabe
beider Reden, wie sie der Autor selbst bringt, zu vergleichen.
Die ägyptische ist das Paradigma einer lapidaren Sprache, die
griechische ein Beispiel jener reichgegliederten (polyarthrischen)
Perioden, die uns aus der Kunstwerkstätte der griechischen und
lateinischen Klassiker bekannt sind und im Vergleich mit modernen
Texten wie die weiland hochgetakelten Fregatten der alten Seefahrer
anmuten. Thukydides baut (um ein anderes Bild zu gebrauchen)
in der folgenden Probe mitunter bis ins fünfte oder
sechste Stockwerk. Diemke schildert am Ägyptischen das Aufkommen
des zweiten Stockwerks, nämlich der dort nicht ganz
fehlenden aber stets nur spärlich verwendeten Relativsätze und
bereitet uns damit auf die Untersuchung der wesentlich anderen
Verhältnisse in den indogermanischen Sprachen vor.
Was aus den Arbeiten der Indogermanisten zu weitergreifenden
sprachtheoretischen Gedanken am meisten anregt, ist die prägnante
Darstellung der Tatsachen bei Kretschmer und die Lehre von
H. Paul. Ich stelle sie einander gegenüber in der Absicht, die
mehrfachen Wurzeln des Formenreichtums unserer Satzgefüge zu
erfassen. Das wird, wie ich hoffe, eine Beitrag werden zu dem weit
größeren Systeme, welches nur universal vergleichend gewonnen
werden könnte und eine Aufgabe für die Kommenden bleibt.
1. Der ägyptische Vergleichstext Diemkes aus der „Sinuhegeschichte”
(Sinuhe B 5) lautet so:399
Ich machte das Gehen nach Süden | nicht beabsichtigte ich zu gehen nach der
Residenz | ich meinte: Kämpfe entstehen | nicht glaubte ich: ich lebe nach ihnen |
ich überschritt das Maatigewässer unweit der Sykomore | ich kam auf die Insel
Snefru | ich verweilte dort in einem Feldstück | früh brach ich auf | es wurde Tag
ich traf einen Mann — stehend in der Nähe | er begrüßte mich achtungsvoll | er
fürchtete sich | es kam die Zeit des Abendessens | ich näherte mich der „Stierstadt” |
ich fuhr hinüber auf einem Schiff — nicht war ein Steuer an ihm — im Wehen des
Westwindes | ich zog vorbei an… | ich gab meinen Füßen den Weg nach
Norden |…
Die Satzperiode aus Thukydides (Hist. belli Pelopon. VII/69, 2)
sieht grammatisch aufgegliedert folgendermaßen aus:
Nikias
durch die Lage der Dinge vollkommen verwirrt
und sehend
wie groß und nahe die Gefahr bereits war
— denn man war fast schon im Begriffe auszulaufen —
und glaubend
— wie es bei Kämpfen von so entscheidender Wichtigkeit meist zu geschehen
pflegt —
es fehle überall noch etwas
auch geredet sei noch nicht genug
berief wiederum die einzelnen Schiffsführer
sie anredend mit ihres Vaters und ihrem eigenen Namen und nach ihrem Stamm
und auffordernd jeden einzelnen
keiner solle das in die Schanze schlagen
was er an Ruhm erworben habe
keiner solle die alten Tugenden verdunkeln lassen
durch welche ihre Vorfahren geglänzt haben
und erinnernd an das Vaterland
das die herrlichste Freiheit genieße
an die allen Bürgern uneingeschränkte Freiheit in ihm ihre Lebensweise
zu gestalten
und anderes sagend
was Menschen hervorzubringen pflegen
die sich in einer derartigen Lage befinden
die sich nicht davor hüten
daß es einem veraltet erscheinen könne
und was Menschen bei allen solchen Fälle Ähnliches sich zurufen
das sich bezieht auf Frauen Kinder und vaterländische Götter
aber es für nützlich haltend in der gegenwärtigen Lage.
Man versteht ohne Kommentar von unserer Seite, warum
der Verfasser in der ägyptischen Rede die „ägyptische Kulturseele”
und in der griechischen das vielgelenkige, durchgegliederte Wesen
des Griechentums gespiegelt sieht. Der Ertrag seiner Untersuchung
an Einzelerkenntnissen liegt beschlossen in dem Nachweis, daß in
den Inschriften aus dem Zeichen des nebenordnenden Demonstrativums
400image das des unterordnenden Relativums image hervorgeht.
Das heißt genauer gesagt: dies letztere ist überall auch in den
ältesten Texten schon zu finden; doch ist es selten und tritt später
sehr viel häufiger an den Stellen auf, wo ursprünglich nur das erstere
vorkommt. Wo wir nach Diemke in jeder indogermanischen Sprache
etwa die folgende Satzfolge erwarten: ‚als es Tag geworden war,
traf ich einen Mann, der mich achtungsvoll begrüßte, weil er sich
fürchtete’, stehen die Sätze im ägyptischen Mustertext unverbunden
nebeneinander. Diese Dominanz der Parataxe wird merkbar aber
nicht wesentlich geringer beim Übergang aus den mehr feierlichen
in die trivialen Prosatexte und in späterer Zeit unter dem Einfluß
der Griechen und Römer, wo eine größere Leichtigkeit und Gelenkigkeit
festzustellen ist. Wenn das Wort von der ‚lapidaren
Sprache’, das man besonders für die älteren Steintexte auch bei
den Griechen und Römern gebraucht, definiert werden müßte, so
wäre nach meinem Ermessen kein extremeres Musterbeispiel für
das Lapidare zu finden als diese Texte in der hochentwickelten
Sprache der Ägypter.
In dem von Diemke analysierten Material gibt es sprachtheoretisch außerordentlich
interessante Tatsachen. Machen wir uns die Dinge auf dem Wege einer
Nachkonstruktion und mit Hilfe der selbsterarbeiteten Begriffe klar. Wenn ich
deutsch zu erzählen anfange es kam ein Mann — und fortfahre mit einem todeiktischen
Zeigwort, so müßte das noch lange kein echtes Relativpronomen sein. Sondern
es wäre vermutlich im Urindogermanischen eine (undeklinierbare) Zeigpartikel
gewesen. Frage: wie steht es mit der semantischen und syntaktischen Funktion
dieser Zeigpartikel? Im erzählenden Text kommt keine demonstratio ad oculos
in Frage, wohl aber muß man sich überlegen, ob etwa, bevor die klare anaphorische
Verwendung ausgebildet war, eine Deixis am Phantasma zum mindesten im Vordergrund
stand. Wenn ich erzähle N. N. lebte vor hundert Jahren in Rom. Dort gab es
damals…, so ist eine Deixis am Phantasma im Gange. Jetzt noch einmal: es kam
ein Mann [und weiter] to. Es kann so sein, daß der Erzähler in der Phantasieszene
wie mit dem Finger auf das, was vor ihm steht, hinweist. Die sprachtheoretische Frage
nach der Geburt des Relativums lautet also klipp und klar: wie unterscheidet sich das
Relativum, daswir in unserer Sprache kennen, von einer solchen Deixis am Phantasma?
Brugmann sah überhaupt keinen Unterschied; ihm hätte der von Diemke
ausführlich geschilderte Befund am Ägyptischen vorgelegt werden müssen. Daran
wird zu mindesten deutlich, daß das altägyptische to nicht eigentlich rückweisend,
sondern so ausgesprochen vorweisend (kataphorisch) war, daß man für
das später entstandene Bedürfnis eines Rückverweises ein eigenes Zusatzzeichen
erfunden hat. Das ist sprachtheoretisch wohl der interessanteste Befund der Arbeit,
auf die wir uns stützen. Denn die Deixis am Phantasma hätte ein Zusatzzeichen
nicht nötig gehabt; wenn das Gemeinte mir, dem Sprecher, und meinem Hörer
innerlich vor Augen steht, genügt ein schlichtes to, um es zu treffen. Anders dagegen,
wenn ich mich in der Rede zurückwende und ein gerade ausgesprochenes Wort
zeigend noch einmal treffen und durch den Nennwert dieses Wortes denselben Gegenstand
401erreichen will. Eine solche Zurückwendung ist der erste Schritt in der Konstitution
eines Relativums; er führt zur Relativpartikel.
Der zweite Schritt hängt Feldzeichen an diese Partikel an und macht sie
dadurch zum (deklinierten) Pronomen. Das ist ein Fortschritt für den man vielleicht
aus dem Indogermanischen (konstruktiv erschlossene) Belege geben könnte. Der
Korrektheit wegen sei eigens hinzugefügt, daß die Aufzählung eines ersten und
zweiten Schrittes in unserer Analyse nicht zeitlich gemeint ist, sondern eine rein
logische Aufgliederung bedeutet. Die beiden Schritte sind unabhängig voneinander
und konnten auch gleichzeitig oder jeder ohne den anderen gemacht werden. —
Daß sich die sachliche Korrektheit der Interpretationen Diemkes meiner Beurteilung
völlig entzieht, ist selbstverständlich. Ich kann nur sagen: wenn ich Diemke recht
verstehe und wenn er sicher den ersten Schritt gefunden und näher bestimmt hat,
so verwundert sich ein Sprachtheoretiker nicht darüber, sondern denkt sich, das
sei etwas, was man nach der rein phänomenologischen Analyse irgendwo gesondert
nachweisbar erwarten durfte. Vielleicht, nachdem einmal der Blick für diese Dinge
geschärft ist, läßt er sich noch deutlicher anderwärts auch feststellen. — Im Rahmen
des Ägyptischen wäre es erwünscht zu erfahren, wieweit das ausgebildete Relativum
nachträglich eine temporale, konditionale usw. Färbung erhalten oder sich mit
eigenen Zeichen für diese Momente verbunden hat. Denn dies wäre parallel zur
indogermanischen Sprachgeschichte zu erwarten.
2. Das Relativum ist das anaphorische Zeigzeichen kat' exochen.
Wenn und wo es entstanden ist, sind Horizonte frei für den bekannten
Formenreichtum an Konjunktionen und Nebensatzfügungen. Ist
also die Geburt des Relativums in einer Sprache der gesuchte Quellpunkt
ihrer Formenwelt von Nebensatzgefügen schlechthin? Antwort:
nein; sondern es gibt noch andere Entstehungsweisen. Die
Gefahr einer zu raschen und prinzipienmonistischen Theorie der
Dinge wird vermieden, wenn an klaren Fällen Gefüge nachgewiesen
sind, die eine andere Struktur haben. Rein formal und vom einfachen
Satz her gesehen könnte es dabei erweiternd oder zusammenfassend
zugehen; im ersten Fall wird (grob gesprochen) aus einem
Satz zwei und im andern Fall aus zweien einer. Es gab unter den
Sprachforschern einen sehr konsequenten Erweiterungstheoretiker,
es war H. Paul; und es gibt einen ebenso konsequenten Synthetiker,
es ist P. Kretschmer.
Daß diese Gegenüberstellung keineswegs aus der Luft gegriffen
ist, wird äußerlich schon an der Art erkennbar, wie Paul
nach einer Schilderung des erweiterten Ein-Satzes den Leser seines
Buches durch die Mitteilung überrascht: „Wir haben im Vorhergehenden
schon die Grenzen des sogenannten einfachen Satzes
überschritten und in das Gebiet des zusammengesetzten hinübergegriffen.
Es zeigt sich eben bei wirklich historischer und psychologischer
Betrachtung, daß diese Scheidung gar nicht aufrecht erhalten
werden kann” (§ 100). Liegt darin schon eine Polemik angedeutet,
402so nimmt sie eine präzise Form an in der Frage, wie es
wohl am Anfang gewesen sein mag. Paul bestreitet nicht nur den
Leitsatz, welchem die Sachverständigen nach Kretschmers Bericht „bis
auf Adelung zurück” vertrauten, sondern spitzt seinen
Widerspruch auf die überraschende Gegenbehauptung zu, es habe
nie eine wahrhafte Parataxe gegeben: „Wenn wir nun gesehen haben,
daß bei der Hypotaxe eine gewisse Selbständigkeit des einen Gliedes
bestehen kann, so zeigt sich auf der anderen Seite, daß eine Parataxe
mit voller Selbständigkeit der untereinander verbundenen Sätze
gar nicht vorkommt, daß es gar nicht möglich ist Sätze untereinander
zu verknüpfen, ohne eine gewisse Art von Hypotaxe” (147f, die
Hervorhebung von mir). Das heißt also: Am Anfang war die Hypotaxe
und sie ist niemals überwunden worden.
Was hätte Paul wohl zu dem ägyptischen Text gesagt? Vermutlich
dies: Ihr seht hier noch deutlicher als irgendwo anders,
daß ich recht habe. Denn Ihr wollt mir doch nicht etwa einreden,
daß der Erzähler jener Begegnung am frühen Morgen rein zufällig
die Sätze gerade so einander folgen ließ, wie Ihr sie braucht, um
durch das Beiwerk von drei Fügezeichen eine regelrechte indogermanische
Haupt-Nebensatzperiode daraus zu machen! Nein, sondern
der Ägypter hat die Sätze genau so wie Ihr aneinander gereiht,
damit einer die andern näher bestimme und eine logisch aufgebaute
Rede daraus werde. Und das ist es, was Paul eine Unterordnung
nennt. Worauf man nicht widersprechen sondern nur noch fragen
darf, ob seine Begriffsbildung sachgemäß und zweckentsprechend
sei oder nicht. Ist jeder Satz, der von einem Nachbarsatz irgendwie
‚determiniert’ wird, ein Nebensatz? Ein Mann wie Paul hat natürlich
„historische und psychologische” Gründe, wenn er von der
herrschenden Meinung abkommt und eigene Wege einschlägt.
Allein phänomenologisch gesprochen ist dies der schwache
Punkt in seiner Lehre, daß er der Gegenpartei eine Auffassung von
der ‚Selbständigkeit’ (jedes Satzes in parataktischen Reihen) andichtet,
die faktisch nie vertreten worden ist. Wenn man als Verteidiger
der Angegriffenen die von uns erörterte Selbstgenügsamkeit
des Satzes ohne Zeigfeld einführt, ist alles gesagt, was Paul erwidert
werden muß. Ein Satz kann so selbstgenügsam wie die Sätze
der Logiker und doch sachlich gefordert sein an einer bestimmten
Stelle der exakten Beweisführung; oder er ist sachlich näher bestimmt
und selbst bestimmend in den Nachbarschaftsverhältnissen
eines logisch aufgebauten Kontextes. Das alles muß, soweit es geht,
zunächst einmal außer Rechnung gestellt werden am Eingang zur
403Lehre von den Satzgefügen und ihren fixierten Formen. Daß sich
die derart beiseite geschobene Betrachtung an späterer Systemstelle
doch wieder meldet, sei vorausgesagt, und wieweit sie unabweisbar
wird, sei später erörtert. Doch vorerst gilt es, die wohldurchdachte
Lehre Pauls in ihren Grundzügen darzustellen.
Paul geht, was für seine Theorie entscheidend ist, vom Darstellungssatz
ohne Zeigfeld (S → P) aus und verfolgt die Erscheinungen,
welche eintreten, wenn entweder ein zweites S zum gemeinsamen
P oder ein zweites P zum gemeinsamen S hinzukommt.
Wir selbst haben dies Erweiterungsschema im Anschluß an die
Erdmann sehe Logik herangezogen, um die Funktionen des Wortes
und zu erläutern (S. 317f.). Es ist nichts nachzutragen als die
Notiz, daß auch Paul als Grammatiker den Unterschied eines sachbündelnden
vom satzfügenden und verspürt und ihm gerecht wird
durch die fast erstaunte Bemerkung, daß aus der Relation S → P
„die übrigen syntaktischen Verhältnisse entspringen mit einer einzigen
Ausnahme, nämlich der kopulativen Verbindung mehrerer
Elemente zu einem Satzgliede” (S. 138). Dieser Rest von Anerkennung
der Eigenart attributiver Undverbindungen ist bei Licht besehen
die Legitimation für Pauls Widerstand gegen die Neuerer
in der Theorie des (Wort-)Kompositums. Pauls Lehre vom erweiterten
Satze wäre viel klarer noch einmal aufzubauen von einem,
der mit uns die merkwürdige Tatsache, daß nach mehreren Subjekten
im Satze das P bald mit dem Singular- und bald mit dem
Pluralzeichen versehen wird, auf den genannten Unterschied bezöge:
‚senatus populusque Romanus decrevit (decreverunt)’. Doch
in dieser Sache sind die Akten für uns geschlossen; es ist weiterhin
nur noch vom satzfügenden und die Rede.
Wenn das satzfügende und nach einem einzigen Subjekt
zwischen zwei Prädikaten auftritt, sagt der Logiker mit Recht, es
seien zwei Urteile da, und Paul sagt, es liege eigentlich ein Satzgefüge
vor: er fiel um und starb. Daß darin ein sachliches Verhältnis
der beiden Ereignisse mitgetroffen und zur Darstellung gebracht
ist, wird niemand bestreiten. Und ist dies sachliche Verhältnis
manchmal ein schlichtes Nacheinander, so wird es in anderen Fällen
beliebig reicher und nuancierter sein: er liebte und verzieh; er heuchelt
und erreicht sein Ziel. Ja, wozu noch lange und breit über weitere
Möglichkeiten sprechen oder die Voraussetzung aufrecht erhalten,
daß nur ein Subjekt in solchen Gefügen vorkommen darf? Die
Eigenart der Paulschen Lehre ist hinreichend genau umschrieben,
wenn man zum ersten Stichwort ‚Erweiterung’ das zweite von der
404‚Undkonjunktion’ durchgesprochen hat. Wir fassen also die Paulsche
Lehre in die knappe Formel: Am Anfang war das satzerweiternde
und satzzerlegende Und.
Zusätze sind in einem Überblick, wie er hier geboten werden
soll, kaum vonnöten. Die Paul sehe Idee ist zwar einseitig aber
keineswegs zu widerlegen. Und aus dem, worin sie treffend ist, gewinnt
ein Kenner der Geschichte und Meister der Auslegung wie er
allgemeine Einsichten, an denen sein Kapitel über die „syntaktischen
Grundverhältnisse” so reich ist, wie kaum eine andere kurze Schilderung
der Satzgefüge. Daß das und nicht überall als Wort erscheinen
muß sondern ungesagt bleiben oder durch ein anderes aus der Schar
der Und-Wörter ersetzt sein kann, wußte Paul natürlich genau so
gut wie wir. Die relativ reinste Parataxe in seinem Sinne findet er
verwirklicht in „Parallelsätzen” wie er lacht, sie weint und erkennt
die Anaphora als einen „höchst bedeutsamen Schritt” in der Entwicklung
der Syntax an. Die Anaphora bedeutet ihm ein Ersparungsmittel: „Wir
können uns eine umständlichere Ausdrucksweise
denken, in welcher der Satz immer zweimal, einmal als selbständig,
einmal als abhängig gesetzt würde. Statt einer solchen Wiederholung,
die wenigstens nur ausnahmsweise wirklich vorkommt, bedient sich
die Sprache der Substitution durch ein Pronomen oder Adverbium
demonstrativum” (S. 148).
Gewiß ist das korrekt gesagt und kann nicht widerlegt sondern
nur vertieft werden. Dadurch nämlich, daß das reflexive Demonstrieren
als ein höchst verwunderliches und keineswegs selbstverständliches
Phänomen erkannt und die Geburt des echten Relativums
als ein Wendepunkt in der Geschichte der Satzgefüge herausgearbeitet
wird. Paul notiert das Thema ohne selbst es auszuführen.
Ebenso notiert er im letzten Absatz seines Kapitels denjenigen
Quellpunkt hypotaktischer Gefüge, welchen Kretschmer an den
Anfang stellt; doch wird nur berichtet, es komme vor, daß Aufforderungen
und Fragen „in logische Abhängigkeit treten” (zu einem
Darstellungssatz) und sich dabei in „Bezeichnungen der Bedingung
oder des Zugeständnisses” verwandeln: Quidvis opta et veniet (150).
Man beachte noch einmal das et an der Problemstelle und erwarte
einen Wechsel des Erklärungsversuches dort, wo (wie bei Kretschmer)
dies ‚und’ nicht mehr mit einem Akzent versehen ist.
3. Die Formel derer von Adelung bis Kretschmer lautet:
Am Anfang war die parataktische Satzkette, bis Ineinanderschiebungen
auftraten. Es ist von entscheidender Bedeutung, daß diese
zweite Rekonstruktion nicht wie die Paul sehe vom Satz ohne Zeigfeld
405ausgeht sondern von einem (phänomenologisch betrachtet)
primitiveren Sprachzustand. Dort ist es die darstellende Rede
S → P, die man sich erweitert denkt, und hier sind es darstellende
und kundgebende oder appellierende Sprachäußerungen, die sich
enger zusammenschließen. Lesen wir die äußerst prägnante Aufzählung
der Hauptfälle bei Kretschmer:
„Äußerlich betrachtet sind drei Fälle zu unterscheiden, i. Der zweite von zwei
aufeinanderfolgenden Sätzen wurde dem ersten untergeordnet. Zum Beispiel
Timeo. Ne moriatur ‚Ich habe Furcht. Möge er nicht sterben!’ wird zu Timeo ne
moriatur, wo das lateinische ne gegenüber deutschem ‚ich fürchte, daß er stirbt’
sich eben aus dieser Entstehung erklärt. 2. Der erste Satz wird dem zweiten untergeordnet:
Εἴ (= εἴϑε) μοί τι πίϑοιο. ‚O, möchtest
du mir doch gehorchen! Das wäre weit besser’, wird zu einem Satz verschmolzen,
indem der erste Satz als Bedingung für den zweiten aufgefaßt wird: ‚Wenn du mir
folgst, wäre das weit besser’ (II. H 27). Vgl. die Satzfügung von: Sint Maecenates,
non deerunt, Flacce, Marones (Martial. VIII 56,5) und in Schillers: Sei im Besitze
und du wohnst im Recht = Wenn du im Besitz bist, so wohnst du im Recht. 3. Ein
eingeschobener Satz wird dem ihn umgebenden Satz untergeordnet. II. B 308 ff.
δράκων… σμερδαλέος, τόν ρ αύτός Όλύμπος ήκε φόωσδε, … ὄρουσεν ist ursprünglich
folgendermaßen gedacht ‚ein schrecklicher Drache — den schickte
der Olympier selbst ans Tageslicht — stürzte sich…’. Indem der eingeschachtelte
Satz dem ihn einschließenden untergeordnet wird, wird das Demonstrativum τόν zu
dem, was wir Relativum nennen.
Anders erklärt H. Lattmann, KZ. 49 (1919), 100 den Satztypus Timeo ne
moriatur, indem er ne als intensive (vgl. gr. νή, ναι) und indefinite (lat. -nĕ in Fragen)
Partikel auffaßt und in dem Konjunktiv einen Potentialis sucht. Also ursprünglicher
Sinn: Ich fürchte, er möchte vielleicht sterben” (62f.).
Die Meinungsverschiedenheit der Sachverständigen über das
lateinische ne tangiert die sprachtheoretische Würdigung der synthetischen
Lehre nicht. Denn auch der Satz mit dem Potentialis
enthält eine Kundgabe, die sich im Satzgefüge auswirkt. Wir müßten
sehr weit ausholen, um den Blickpunkt zu finden, von dem aus die
ganze Mannigfaltigkeit der von Kretschmer aufgedeckten Verhältnisse
übersichtlich wird; wir müßten vor allem die ‚Satzarten’
systematisch behandeln, was über die hier gebotene Analyse der
darstellenden Sprache weit hinausginge. Doch ist einiges, was zum
Thema des Zeigfeldes gehört, im Anschluß an Kretschmers ersten
und zweiten Hauptfall ohne solch weites Ausgreifen zu sagen. Seinen
dritten Hauptfall schreiben wir auf ein neues Blatt, weil die Entstehung
des Relativums auf ein anderes Blatt gehört und schon
durchgesprochen ist.
Ich erhebe die gewiß einfache und naheliegende Frage: gab
es in der angenommenen Ausgangsphase neben ‚Timeo. Ne moriatur’
auch Satzfolgen wie ‚Times. Ne moriatur’ oder ‚Medicus timet. Ne
406(pater meus) moriatur’? Vielleicht, vielleicht auch nicht; es käme
darauf an zu wissen, ob der sprachlich gefaßte Wunsch (der Kranke
möge nicht sterben) in diesen hinzugedachten Fällen ebenso aus
der Seele des Sprechers aufsteigt wie in ‚Timeo. Ne moriatur’.
Oder aber aus der Seele des angesprochenen Du bzw. des Arztes.
Im fertigen Sprachzustand des klassischen Latein, wo aus den zwei
Sätzen ein hypotaktisches Gefüge geworden ist, besteht kein Auslegungszweifel;
da wird eine ‚Befürchtung’ der Subjektsperson des
ersten Satzes zugedacht, gleichviel, ob dies Subjekt ich-zeigend,
du-zeigend oder nennend gesetzt ist. Wie aber war es in der rein
parataktischen Rede? Man könnte sich eine Zwischenphase vorstellen,
in welcher die Wunschfunktion (besser: Abwehrfunktion)
des ne noch sehr lebendig war und ein Sprung vorlag aus der erzählenden
Rede des ersten Satzes in eine direkte Rede, die der
zweite Satz bot: „Medicus timet: ne moriatur”. Daß solche Überlegungen
an Kretschmers eigenem Beispiel überflüssig sind, darf
uns nicht abhalten, sie anzustellen, nachdem wir aus dem Ägyptischen
gelernt haben, wie wenig selbstverständlich die Übergänge
zum echten Satzgefüge hin faktisch sind. Dort freilich bei der
Geburt des Relativums waren andere Fortschritte wie hier vonnöten;
aber Übergänge werden auch hier unvermeidlich gewesen sein.
Und einer von ihnen dürfte die Mischung sein, die ich im Auge habe,
eine Mischung, welche mit dem bekannten Spezialfall eines Einbaus
von direkten Reden in die Erzählung angedeutet aber noch keineswegs
hinreichend bestimmt und ausgeschöpft ist.
Es ist kein Zufall, daß die sprachhistorisch so klar und überzeugend
sprechenden Beispiele Kretschmers den (uralten) Imperativ
und den Optativ (oder Prohibitiv) enthalten. Denn Kretschmer
legt in seiner ganzen Satzlehre den Akzent auf die Ausdrucksund
Appellfunktion. Man könnte die genannten Wortformen, wenn
sie nicht da wären, samt den Sätzen, denen sie ihren Charakter verleihen,
am Organon-Modell der Sprache konstruieren. Ebenso wie
die seltenen satzartigen Anfügungen an Interjektionen; ich denke
an lat. heu me miserum oder vae victis. In unserem Zusammenhang
ist folgendes wichtig: Überall dort, wo das in dem viel jüngeren
Satze ohne Zeigfeld nur noch durch musikalische Modulationen
wiedergegebene Ausdrucks- und Appellmoment eine eigene phonematische
Form hat (die wie beim Imperativ komm! veni! auch im
Fehlen eines Suffixes bestehen kann), da liegt generell die Möglichkeit
zu den von Kretschmer gesehenen und beschriebenen Satzgefügen
vor.407
Warum? Die Antwort ist psychologisch und lautet: Weil
unsere Affekte und Willensregungen auf Dinge und Sachverhalte
gerichtet und an ihnen orientiert, von ihnen her motiviert zu sein
pflegen. Das volle Verständnis von sprachlichen Affekt- und Willensäußerungen
macht es oft erforderlich, daß etwas von dieser Intention
auf Objektives nicht nur mitverraten sondern eigens gesagt wird.
Ist also etwas von diesem Objektiven in einem der Ausdrucks-Appelläußerung
nachfolgenden oder vorausgehenden Satze sprachlich dargestellt,
dann wachsen die beiden Äußerungen wie von selbst zu einem
hypotaktischen Gefüge zusammen, weil sie ans ein und demselben
Erlebnis gespeist werden. Denn es ist greifbar dasselbe Erlebnis,
aus welchem der Sprecher zweimal ausholt zu dem ‚Timeo. Ne
moriatur’ oder zu dem so aufschlußreichen anderen Mustersatz,
aus welchem wir verstehen lernen, warum die Griechen ihr Wort
für wenn nicht wie wir als ein Derivat des Relativums gewonnen
haben. Kretschmer hat einen typischen Sprechfall gesehen und
als eigenen Quellpunkt hypotaktischer Gefüge erkannt.
Ist man soweit, dann gehört es zu den Funktionen des Psychologen,
die sachverständigen Sprachhistoriker darauf hinzuweisen,
daß nicht nur affektstarke Erlebnisse, sondern auch affektschwache
oder affektneutrale Gedanken einen Sprecher, der sie wiedergeben
will, zum Zweimalausholen veranlassen oder geradezu zwingen
können. Ersetze ich das lateinische timeo durch ein verbum sentiendi
oder declarandi, dann fällt jedem ehemaligen Lateinschüler ein,
daß er die merkwürdige Konstruktion eines accusativus cum infinitivo
danach zu erwarten hat: ceterum censeo Carthaginem esse
delendam. Psychologisch beschrieben verhält sich der Gedankengehalt,
den der accusativus cum infinitivo wiedergibt, zum Bekenntnis
des Gedankenaktes, den das Wort censeo ausspricht,
durchaus ähnlich, wie der Furchtgehalt des ne moriatur zum Bekenntnis
des Furchterlebnisses in timeo. Darum machen wir in unseren
modernen Sprachen auch keinen durchgehenden Unterschied zwischen
beiden Fällen, sondern setzen ein Derivat des Relativums wie das
deutsche daß dort und hier; oder wir fahren mit einer direkten Rede
fort dort und hier: ‚ich fürchte: er stirbt’; ‚ich erkläre: Carthago
muß vernichtet werden’. Daß der accusativus cum infinitivo linguistisch
nicht einfach den (gewöhnlichen) Nebensätzen gleichzuordnen
ist, steht fest. Die Frage, wie er sich allgemein sprachtheoretisch
gefaßt von ihnen unterscheidet, wird eigens zu erörtern sein.
4. Es fördert den Überblick und die klare Unterscheidung des
Kretschmerschen vom Paulschen Typus, wenn man gute Bezeichnungen
408einführt. In Kretschmers Typus ist es die Intentions-Einheit
des zweimal Wort gewordenen Erlebnisses, in Pauls
Typus dagegen ist es eine Sachverhalts-Relation, was die Fügung
konstituiert. Die Erzählung er fiel um und starb schildert zwei
Ereignisse, die Schlag auf Schlag denselben Menschen trafen, und
überläßt es dem Hörer, die Sachverhalts-Relation spezifisch auszudenken.
Soll man das schon eine Hypotaxe nennen? Tatsache
ist, daß wenig dazugehört, um die durch und nur angedeutete Relation
sprachlich nuancierter zu fassen und komplexer zu gestalten:
‚er fiel um aber sprang wieder auf; die Tauern sind sehr schön aber
schwer zu erklettern’. Ein solches aber setzt im Hörer ein Weiterdenken
voraus und korrigiert oder bremst; es spricht zum Hörer
ungefähr so: „vielleicht hast du erwartet, daß der Gestürzte liegen
blieb? Nein, sondern…; vielleicht reizt Dich die Schönheit der
Tauern, allein bedenke auch das Folgende”. Es sind im Wesentlichen
solche Subkonstruktionen, welche die Interpretation Pauls stützen;
und man muß sie in unseren Beispielen machen und zulassen, weil
andernfalls die Fügung unverständlich würde. Denn objektiv liegt
zwischen den Eigenschaften ‚schön’ und ‚schwer zu erklettern’ kein
Verhältnis des Gegensatzes, der Opposition oder was sonst man mit
‚aber’ meinen könnte, vor. Wir sind damit ungesucht noch einmal
auf den Faktor des Mitkonstruierens gestoßen, und er allein vermag
die Lehre Pauls in gewissen Grenzen zu stützen.
Kretschmers Fügetypus dagegen ist ursprünglicher, ist
sprachhistorisch vermutlich älter; er müßte im Prinzip schon mit
den Signalen eines Einklassensystems zu erzielen sein. Und wenn
ich mich nicht täusche, gehören faktisch die seltenen Koppelungen
unserer fixierten Interjektionen mit einfachen Nennungen und Darstellungssätzen
hierher: Oweh! Der Feind! Pfui der Teufel! (Pfui die
Schande!); Aha, es donnert! Reicher wäre wohl die Ausbeute aus
der Kinderstube; und zwar in jener beachtenswerten Phase, in
welcher die sogenannten Einwortsätze von Mehrwort-Äußerungen
abgelöst werden. Das sind anfänglich in der Regel noch keine S → P-Sätze,
sondern Äffekt- und Nennmischungen oder Appell- und Nennmischungen
aus einem und demselben Sprechanlaß heraus. Ist schon
ein geformtes Abwehrzeichen da, so klingt dies voluntative nein
aus dem Munde deutscher Kinder meist nicht viel anders wie das
lateinische ne (nämlich näh) und wird vorausgestellt oder nachgeschickt
der nennenden Äußerung. Versteht sich, daß die grammatisch
wohlgeformten Gefüge aus Homer und die anderen Erläuterungssätze
Kretschmers keine Kindersprache sind. Aber
409ich wollte das vermutlich besonders hohe Alter des von ihm beschriebenen
Fügungstypus durch die Parallele illustrieren.
Der ausgeformte Darstellungssatz S → P, mit welchem Paul
beginnt, ist jünger. Beherrscht ihn das Kind genügend, dann erscheinen
Gegenüberstellungen wie papa brav, olol bös, Bildungen also,
die Paul neben seinem Beispiel er lacht, sie weint in die Liste der
relativ reinsten parataktischen Gefüge hätte aufnehmen können.
Ob gleichzeitig oder erst später auch Satzerweiterungen, die Pauls
Formel folgen, als typische Erscheinung auftreten, vermag ich nach
einer Durchsicht der zuverlässig beobachteten Kinderäußerungen
nicht zu entscheiden. Sie sind bekannt, ich selbst erinnere mich an
sie ganz deutlich, weil sie mir auffielen; doch sind sie nie in der
Paulschen Perspektive belauscht worden. Wo sie in der Form
auftreten, wie sie mir auffielen, wird besonders deutlich, daß in
der Tat das eine P zu mehreren S (vielleicht auch umgekehrt) ein
beliebtes und vom kindlichen Spracheleven oft spielerisch ausgenutztes
und eingeübtes Modell ist:
„Wenn das Kind Zweiwortsätze spricht, an deren Urteilssinn kein Zweifel
mehr besteht, z. B. Vater brav, kann man gelegentlich beobachten, daß der kleine
Sprecher mit einer einzigen derartigen Leistung nicht zufrieden ist, sondern, um bei
dem gewählten Beispiel zu bleiben, nun alle anderen Anwesenden der Reihe nach mit
demselben Prädikat ausstattet (mama brav, tante brav usf.). Hier kommt der Anreiz
zu dem zweiten und den folgenden Urteilen offensichtlich nicht von außen, sondern
das Kind wiederholt eben seine Urteilstätigkeit an anderen Subjektsgegenständen.
Es wendet sich sozusagen mit einem Blankoschema im Kreise herum, um auch die
anderen Personen der Reihe nach einzusetzen; oder, was dasselbe heißt, es hält die
Verfahrungsweise fest und überträgt sie auf andere Fälle. Ich weiß nicht, ob es in
dieser frühen Zeit auch schon vorkommt, daß in ähnlicher Art das Prädikat variiert,
während das Subjekt konstant bleibt oder sogar, daß S und P gleichzeitig wechseln,
so daß wir es also bildlich gesprochen mit einem völlig unausgefüllten Urteilsschema
zu tun hätten. Sicher aber kommt etwas anderes vor, was hierher gehört, nämlich
manche von den bei vielen Kindern so sehr beliebten Antithesen. Gewiß nicht alle.
Es gibt Fälle, in denen man aus der ganzen Situation und der Art des Aussprechens
(in einem Zuge) die Überzeugung gewinnt, daß das Ganze als ein einheitlich kompliziertes
Urteilsgefüge betrachtet werden muß, daß, mit anderen Worten, das Verhältnis
des Gegensatzes von vornherein das Zentrum des Satzgedankens bildete.
Daneben aber habe ich andere Fälle beobachtet, die eine andere, eben die uns hier
interessierende Deutung forderten. Das ist z. B. dann ganz unverkennbar, wenn das
Urteil mit dem entgegengesetzten Prädikat erst an späterer Stelle einer Satzreihe
mit sonst konstantem Prädikat auftritt” 1)132.
Ich bin heute der Ansicht, man könnte nach genügender sprachtheoretischer
Vorbereitung manche Frage der Linguisten, die sich mit den Formen der Satzgefüge
befaßt haben, in der Kinderstube beantworten und sollte sich diese leicht
zugängliche Beobachtungsquelle nicht entgehen lassen.410
Noch einmal später tritt in der Kindersprache das vollendete
Relativum und mit ihm die Schar der anderen anaphorischen Fügemittel
auf. Doch darüber ist vorerst zu wenig bekannt, was unsere
sprachtheoretische Skizze über die Satzgefüge fördern könnte.
5. Ein Wort über den Begriff der Hypotaxe, dessen Definition
ebenso schwierig ist wie die des Satzbegriffes. Was ist ein Nebensatz?
Die Diskussion der älteren Sachverständigen von Adelung bis
Heyse (Lehrbuch der deutschen Sprache 1849) arbeitet immer konsequenter
die Idee aus, daß sich das Verhältnis des Satzes zu seinen
Wörtern auf höherer Stufe im Verhältnis des Satzgefüges zu seinen
Sätzen wiederhole: „Die Nebensätze sind bestimmende oder ergänzende
Teile des Hauptsatzes, sie verhalten sich zum Hauptsatz
und seinen Teilen ähnlich, wie die erweiternden Bestimmungen
des einfachen Satzes zu diesem und seinen Teilen; sie unterscheiden
sich von diesen Bestimmungen nur dadurch, daß sie die Form von
Sätzen haben” (Heyse). Wenn sich ein Sprachtheoretiker heute
danach umsieht, welche Erscheinungen dieser Auffassung am adäquatesten
entsprechen, so fallen ihm unter anderem der im Anschluß
an den Kretschmerschen Typus erwähnte accusativus cum
infinitivo und die lateinischen Partizipialkonstruktionen ein. Denn
beide stehen faktisch im Symbolfeld des einen Rahmensatzes und
tragen seine Feldzeichen; die gehäuften Partizipien in der Musterperiode
aus Thukydides z. B. erscheinen im Nominativ, der sie wie
das Subjekt (Nikias) selbst in den Rahmensatz einbaut. Dasselbe
gilt für den Akkusativ in ‚ceterum censeo Carthaginem esse delendam’.
Es findet also, um das Bild von den „Gelenken” einer Rede
wieder aufzunehmen, an dieser Stelle kein Feldbruch und keine Gelenkbildung
statt, sondern das eine Symbolfeld des Rahmen- oder
Dachsatzes nimmt diese Zusätze regelrecht in sich auf. Die Verhältnisse
liegen in diesem Punkte ähnlich wie beim Kompositum
(und der losen Wortgruppe). Nur im Innern in ihren sozusagen
häuslichen Verhältnissen sieht es vielleicht ein wenig anders aus wie
im Innern des Kompositums; es ist viel mehr Raum in ihnen, die
Entfaltungsmöglichkeiten des vom Verbum ausgehenden Innengefüges
sind größer.
Doch lassen wir diese Frage vorläufig noch offen und denken
im Vorbeigehen an die sogenannten absoluten d. h. nicht so unmittelbar
einbezogenen Partizipialkonstruktionen, z. B. den ablativus
absolutus im Lateinischen. Die Bequemlichkeit eines Systems,
das neben den Kasus der innern Determination einen so weitherzigen
Kasus der äußeren Determination (das Wort im Sinne Wundts
411verstanden) besitzt, wie es der sogenannte lateinische Ablativus ist,
wird weidlich ausgenützt wie ein bequemes Nest, ein fixiertes Gehäuse,
in dem man Sachverhalte beliebig breit und mit denselben
syntaktischen Mitteln wie sonst in Sätzen sprachlich aufbauen und
wiedergeben kann. Unabhängig (innerhalb des nestbildenden
Rahmens) von den Verhältnissen im Symbolfeld des regierenden
Satzes. Soll man den Ablativus überhaupt zum Bestand des Symbolfeldes
lateinischer Sätze rechnen? Ich muß diese Frage den Sachverständigen
überantworten; man hat als Laie den Eindruck, daß
es zum guten Teil das gemischte Kasussystem des Lateinischen ist,
was zu den erstaunlich weitgespannten „erweiterten” Sätzen führt,
die wir aus den Klassikern kennen. Denn wenn die nächsten Leerstellen
um das Verbum durch Antworten auf die Fragen quis?
quid? besetzt sind, kommen der Reihe nach Bestimmungen des
ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando? und werden mit eingebaut.
Ein solcher lateinischer Satz ist dann wie ein feldmäßig
gepackter Tornister mit allem versorgt; mit sehr viel mehr jedenfalls,
als die Kasus der inneren Determination allein zu bilden
vermöchten.
Hier wäre die Stelle, wo eine systematische Lehre vom Nebensatze
die weit verbreitete Auffassung zu würdigen hätte, daß der
Nebensatz ein Satzglied sei oder ein Satzglied vertrete. Diese
Auffassung ist soweit berechtigt, als kein (vollständiger) Bruch
des Symbolfeldes und keine Gelenkbildung vorliegt, wie sie am
elegantesten durch das Relativum mit seinen Derivaten, den Konjunktionen,
geschaffen worden ist. Sie ist berechtigt, soweit Einbauten
wie die bezogenen oder unbezogenen Partizipialkonstruktionen
oder Bildungen vom Typus des accusativus cum infinitivo
vorliegen. Wo dagegen die Anaphora in ihrer vollen Leistungsfähigkeit
einspringt, braucht man den Notverband des festen Einfügens
nicht mehr, sondern kann völlig neu anfangen und trotzdem
unterordnen, wo und wohin man will. Das ist die Sonderleistung
der anaphorisch und selbst fügbar gewordenen Zeigzeichen. Nein,
wir müssen uns korrigieren: die Satzteil-Theorie findet auch an dem
Kretschmerschen und Paulschen Typus schon ihre Grenzen.
Denn jedes konjunktive und kann einen Feldbruch setzen und mit
neuem Subjekt beginnen, und die direkten Reden oder angefügten
Appell- oder Ausdruckssätze haben stets ihr eigenes Symbolfeld 1)133.412
H. Paul wird in seiner deutschen Grammatik dem Tatbestand,
auf welchen die Satzglied-Theorie in erster Linie achtet, durch die
Anerkennung einer ersten Hauptgruppe von Nebensätzen, die er
„Kasussätze” nennt, gerecht. Es folgen aber dann zwei andere
Hauptgruppen, die sprunghaft neue Unterscheidungsgesichtspunkte
einführen. Und darin liegt das logisch Unbefriedigende der meisten
Klassifikationsversuche beschlossen. Aber wer weiß? Vielleicht
sind nicht die Ordner, sondern ist das zu Ordnende verantwortlich
für die vielerlei Gesichtspunkte.
Unter den Neueren unterstreichen manche das meist unbestrittene
Anlehnungsbedürfnis der Nebensätze und folgen Marty
in dem Vorschlag, sie den Synsemantika einzureihen: „Nicht nur
Namen, auch ganze Sätze können zu bloß mitbedeutenden Zeichen
degradiert werden, sie werden zu Nebensätzen, sind nicht mehr selbständig,
sondern nur unselbständig bedeutend und auch da geschieht
es, daß die ursprüngliche Bedeutung noch als innere Sprachform
wirksam ist”. Am konsequentesten, soweit ich sehen kann, hat
diese Idee W. Brandenstein in einer klaren und aufschlußreichen
Arbeit zu Ende gedacht: „Mit ‚Nebensatz’ wird ein Doppeltes gemeint.
Erstens Sätze von einem gewissen äußeren Aussehen,
zweitens Sätze mit gewissen noch nicht festgestellten Bedeutungsmerkmalen.
Diese beiden Begriffe, die sich hinter dem einen Terminus
‚Nebensatz’ verbergen, decken sich sehr oft, aber durchaus nicht
immer” 1)134. Der eigene Definitionsvorschlag Brandensteins lautet
schließlich so: „Es scheint also nur der Ausweg zu bleiben, daß
wir die Nebensätze der Bedeutung nach als diejenigen Sätze definieren,
die synsemantisch sind, die für sich gestellt keine oder nur
eine andere Bedeutung hätten” (135). Ob dies vollkommen der
Martyschen Definition vom ‚synsemantisch’ entspricht, bleibe dahingestellt.
Jedenfalls soll das Anlehnungsbedürfnis damit in den
Vordergrund gerückt sein.
Allein die Sache hat einen Haken und ist keinesfalls eine hinreichende
Bestimmung. Nehring 2)135 hat dies scharf erfaßt und herausgearbeitet.
Wir können, was er Neues bringt, unserer Analyse des
413Paulschen Typus anschließen. Dort wurde deutlich, es sei eine
Sachverhalts-Relation, was die Fügung er liebte und verzieh konstituiert.
Nehring gelangt zur Erkenntnis, daß es bei der Hypotaxe
wesentlich auf die Darstellung solcher Sachverhaltsrelationen
ankommt. Der Nebensatz verrate zwar einen synsemantischen
Charakter, also ein Anlehnungsbedürfnis; allein es „komme noch
eine logische Größe dazu”. Entkleidet man das von Nehring
Gemeinte einer merkwürdigen Sprechweise, so bleibt die Einsicht,
daß das hypotaktische Gefüge als Ganzes der Wiedergabe einer
Sachverhaltsrelation dient.
Das gilt zwar nicht für den Kretschmerschen Typus; sonst
aber ist es weithin entscheidend. Die Dinge müßten an dieser Stelle
von einem befähigten Logiker aufgegriffen werden, der uns zeigt,
wie und wieweit die Vielgestalt der bedingten Urteile durch die
Formenwelt der Satzgefüge wiedergegeben wird. Zwischen (unbedingten)
kategorischen und den in der verschiedensten Weise
bedingten und eingeschränkten Urteilen besteht logisch ein großer
Unterschied. Die hypotaktischen Gefüge sind neben vielem andern
dazu berufen, bedingte Urteile wiederzugeben: wenn es blitzt, so
donnert es. Hier steht die Abhängigkeitsrelation der Ereignisse im
Mittelpunkt; ich könnte deutsch den Korrelationssatz ‚lange Haare
kurzer Sinn’ daneben halten. Manche deuten ja die angeblichen
Nominalsätze als Bedingungsgefüge. Ist jemand in seinen Überlegungen
bis hierher vorgedrungen, dann kann ihn die Charakteristik
des Nebensatzes als eines synsemantischen (oder wie es früher
hieß synkategorematischen) Sprachgebildes jedenfalls nicht mehr
vollständig und für alle Typen befriedigen.
Nebensatz und Nebensatz ist vielerlei. Brandensteins zu
einfache Universalformel wird also dem Paulschen Typus mit den
Sachverhaltsrelationen nicht gerecht. Sie schiebt aber auch den
Kretschmerschen Typus mit einer bestimmten zu leicht genommenen
Beweisführung beiseite. Brandenstein erkennt zwar die
Fruchtbarkeit des Organonmodells der Sprache an, glaubt es aber
in seiner Frage vernachlässigen zu dürfen. Wir fanden, gerade das
sei wesentlich in Fügungen des Kretschmerschen Typus, daß aus
demselben Sprechanlaß zwei Äußerungen fließen, die sich ergänzen,
weil sich die eine von ihnen mit dem Akt und seinem Stattfinden
und die andere mit dem intentionalen Gehalt befaßt: ‚Censeo
Carthaginem esse delendam; timeo ne moriatur’. Brandenstein
aber versperrt sich selbst den Weg zu dieser Auffassung, weil er
glaubt den Beweis in der Hand zu haben, „daß man jede Klasse
414von Sprachzeichen durch rein psychologische Merkmale allein ausreichend
festlegen kann, d. h. daß die Angabe genügt, was diese
Gattung von Sprachzeichen auszudrücken vermag” 1)136 (119). Für
ihn sind also alle Sätze unisono Ausdrucksäußerungen; derart
unisono, daß kein Platz ist für die so charakteristischen Gefüge,
wie sie Kretschmer beschrieben hat. Also zusammengefaßt: Der
Enderfolg einer so vereinfachten Sprachtheorie ist eine Ratlosigkeit
im Angesicht sowohl des Paulschen als des Kretschmerschen
Typus von Satzgefügen.
Hypotaxe und Hypotaxe ist also mindestens dreierlei. Wer
nach allem, was wir aus der mehr als hundertjährigen Diskussion
der Sachverständigen aufgelesen und durchgesprochen haben, noch
einmal die ägyptische Sinuhegeschichte liest, wird auch dort schon
Wendungen finden, die auf den Kretschmerschen Typus hinführen.
Zum Beispiel: ich meinte: Kämpfe entstehen; nicht glaubte
ich: ich lebe nach ihnen. Das ist, wenn die deutschen Wiedergaben
adäquat sind, jene Mischung aus erzählender und direkter
Rede, die sehr ursprünglich sein dürfte, die vielleicht der erste Ansatz
zu Gefügen nach dem Kretschmerschen Typus war. Ein Undwort
und mit ihm Satzerweiterungen nach dem Modell von Paul
sind in der deutschen Wiedergabe des ägyptischen Textes nicht
zu finden. Und last not least, so spielt das Relativum kaum eine
Rolle in der lapidaren Sprache der Ägypter. Der entschiedene
Entwicklungswendepunkt zu den reichgegliederten Satzperioden der
indogermanischen Sprachen muß eingetreten sein, als man lernte,
den werdenden Kontext selbst zum Zeigfeld zu machen, um vielgestaltig
freie Gelenke am Band der Rede anzubringen. Der entscheidende
Wendepunkt war die Ausbildung des Zeigens im Modus
der Anaphora.
6. Auf dieser Plattform sollten die intimen Kenner der sprachhistorischen
Befunde die Angelegenheit der Satzgefüge noch einmal
aufnehmen. Schreibt man, wie wir es nötig fanden und am Kompositum
415begründet haben, die Angelegenheit der rein attributiven
Gefüge auf ein eigenes Blatt, dann gilt im Bereich des Indogermanischen
eine Regel, die an das Wort der Schachspieler erinnert: regina
regit colorem. Regina ist das Verbum und, was es bestimmt, ist die
Angelegenheit des Symbolfeldes und der Symbolfeldgrenzen. Das
Verbum vermag auch dann noch ein Symbolfeld um sich zu eröffnen
und zu regieren, wenn es als Infinitiv oder Partizipium, als
Verbalnomen oder als verbales Glied eines Kompositums auftritt.
Rückwärts die Reihe noch einmal: Das Verbalnomen und alle abgeleiteten
Wörter, in denen ein Verbalbestandteil als solcher noch
lebendig ist, formieren z. B. Komposita, in denen ein Objektskasus
deutlich verspürt wird. Die zwei Wörter wasserhaltig und wasserreich
differenziert mein eigenes Sprachgefühl in demselben Sinne, wie
Schuhmacher und Schuhsohle, während das Sprachgefühl mich
schwanken läßt, ob der gleiche Unterschied auch zwischen Haarband
und Haarfarbe noch zu verspüren sei. Über das Partizipium und
den Infinitiv als satzfeldregierende Wörter müßten sich die Lateiner
aussprechen; die Frage lautet nicht, ob sie regieren können, sondern
wieweit sich das von ihnen eröffnete Symbolfeld der Herrschaft
des übergeordneten Satzes zu entziehen vermag.
Um das Bild von den Gelenken der Rede ein letztes Mal aufzunehmen,
so liegt beim accusativus cum infinitivo deshalb kein
Gelenk, sondern eine Verwachsung (Symphyse) vor, weit ein gemeinsames
Glied vorhanden ist, das vom finitiven Verbum der
Periode in den Objektskasus verwiesen wird, während es im Symbolfeld
des Infinitivs die Subjektsleerstelle ausfüllt. Der Übergang aus
einem zum anderen Symbolfeld erfolgt also in Gefügen wie ceterum
censeo Carthaginem esse delendam gleichsam im Innern dieses gemeinsamen
Gliedes. Ähnlich also wie in allen anderen Fällen der
vielgestaltigen Erscheinung, welche man das άπό κοινού genannt
hat, aber nicht ganz so innerlich wie in den von Kretschmer ins
Auge gefaßten Hypotaxen. Wenn ich dagegen mit Hilfe anaphorischer
Zeichen füge: ich liebe den am meisten, welcher…, so liegt ein klares
Redegelenk vor, denn es gibt kein Glied mehr, das beiden Symbolfeldern
zugleich angehört und jedes der beiden deklinierten Zeigzeichen
ist völlig frei; jedes kann eine beliebige Leerstelle seines
eigenen Feldes erfüllen: ich gebe dem, dessen… usw. Das ist der
Durchbruch zu jener Freiheit, in deren Bereiche nicht nur Satzglied
hier auf Satzglied dort bezogen, sondern auch ein ganzer Satzgehalt
wieder aufgenommen und im anderen als Satzglied behandelt
werden kann und umgekehrt: Er wehrt sich mit Händen und Füßen,
416was taktisch völlig verkehrt ist; die Ihr suchet, nahm den Schleier.
Das letztere ist ein Beispiel aus Brandenstein, bei dem nach seiner
eignen Einsicht das Merkmal des synsemantischen Charakters der
Nebensätze nicht anwendbar oder nichtssagend wäre. Oder endlich:
es werden zwar zwei Sachverhalte gezeichnet, aber gar nicht absolut
behauptet, sondern die Prädikation gilt der Sachverhaltsrelation:
‚Wenn U1 dann U2’. Das ist auf dem Formniveau der wahrhaft
gelenkigen Rede mit ihrem erstaunlichen Reichtum an Nuancen
ein Hauptfall; er heißt in der Sprache der hergebrachten Logik das
hypothetische Urteil, weil es gar nicht zwei, sondern nur eines ist.
Damit sind noch einmal die von uns erfaßten Typen aufgezählt.
Es kommt mir vor, als müßten sich der Kretschmersche und Paulsche
Typus durch alle Wandlungen der Sprache hindurch verfolgen
lassen. Der Kretschmersche besonders dann, wenn man das
Gefüge von erzählender und direkter Rede, welches wir an einem
der Kretschmerschen Beispiele entwickelten, mit dazu rechnet.
Wenn ich deutsch erzähle, er sagte mir, ich sei farbenblind, so steht
so gut, wie gleich gebräuchlich und ohne wesentliche Sinnverschiebung
daneben: er sagte mir, du bist f. oder sogar: er sagte mir,
ich bin f. Bei günstigen Situationshilfen und der richtigen Betonung
wird die zweimal verschiedene Gefahr eines Mißverständnisses bei du
bist und ich bin vermieden. Daß diese äquivalenten Redewendungen
nebeneinander gebraucht werden können, liegt an dem uns geläufigen
Projektionsverfahren, das wir beschrieben haben; das Nichtpräsente
wird regelmäßig im Indogermanischen auf die Momente der
aktuellen Sprachsituation projiziert. Im übrigen aber ist der
Kretschmersche Fall (das zweimal zu Worte kommen desselben
Erlebnisses) ein psychologisch derart natürlicher Fall, daß man den
Kretschmer-Typus (bevor das Gegenteil erwiesen ist) auf irgendeiner
Entwicklungsstufe in allen Sprachen erwarten darf.
Ebenso unvermeidlich ist es, daß erzählende Menschen das
Bedürfnis haben, Korrelationen zwischen zwei sprachlich gefaßten
Sachverhalten wiederzugeben. Wenn dies Bedürfnis zum erstenmal
drängend wird bei unsern Kindern, dann erfolgt in günstigen Augenblicken
z. B. die Rezeption der sprachlichen Komperationsausdrücke
(klein — kleiner — der aller kleinste) und im unmittelbaren Anschluß
daran gewöhnlich auch die erste Rezeption der Deklinations- und Konjugationsformen,
die vorher trotz Häufung von Wörtern zu oft recht
komplizierten Erzählungen Monate lang gänzlich unrezipiert bleiben.
Älter sind in der Sprache des Kindes die schon einmal erwähnten
musikalisch pointierten Antithesen als Ausdrucksmittel für
417Sachverhaltsrelationen. Vielleicht weicht die Reihenfolge der Ausdrucksmittel
im Werdegang der Menschensprachen nicht allzuweit
von dieser Entwicklungsfolge ab. Jedenfalls aber darf man die Idee
des Paulschen Typus von Satzfügungen so verallgemeinern, daß die
pointierten Nominalsätze, die sich in unseren Sprichwörtern erhalten
haben und die wir rein phänomenologisch als Korrelationssätze
charakterisierten, mit dazugehören.
Auf einer Sprachstufe, wo die Anaphora ein geläufiges Gelenkbildungsmittel
ist, trifft das Sprichwort Sachverhaltsrelationen in
ungezählten Varianten so: wer lügt, der stiehlt; wo Tauben sind, da
fliegen Tauben zu. Aber vor der Geburt des Relativums wußte
man sich auch schon zu helfen, wenn anders diejenigen Recht
haben, die den sprichwörtlichen Nominalsätzen ein besonders hohes
Alter zuschreiben: lange Haare, kurzer Sinn. Noch direkter kommt
man zum Ziele durch eine eigene Nennung des Sachverhaltes. Das
kann durch Präpositionen geschehen, die durch Verschmelzung
mit anaphorischen Zeigwörtern als Konjunktionen fungieren (nachdem,
trotzdem usw.). Es kann auf weit primitiverer Sprachstufe,
aber auch im einfachen Satz durch nennende Wiedergabe der Sachverhaltsrelation
erreicht werden. Irgendwo las ich einmal aus einer
exotischen Sprache übertragen den Ausspruch, der Donner sei der
(jüngere?) Zwilling des Blitzes. Das wäre, wenn es typisch und ein
Hilfsmittel aus Sprachnot sein sollte, ein noch einfacherer Weg,
um vieles von dem wiederzugeben, wozu bei uns allgemein die
Relativa und spezieller die Wennsätze berufen sind.418
11) A. de Saussure, Cours de linguistique générale. Ich zitiere nach der
im allgemeinen wohlgelungenen deutschen Übersetzung. Berlin 1931.
21) Ein logisch Drittes, die Linguistik sei gar keine eigene und einheitliche
Wissenschaft oder Wissenschaftsgruppe, denken wir erst gar nicht durch.
31) E. Husserl, Logische Untersuchungen, II. Bd. (1901), S. 287.
41) D. Hilbert, Axiomatisches Denken, Mathematische Annalen 78 (1918).
„Wenn wir eine bestimmte Theorie näher betrachten, so erkennen wir allemal,
daß der Konstruktion des Fachwerkes von Begriffen einige wenige ausgezeichnete
Sätze des Wissensgebietes zugrunde liegen und diese dann allein ausreichen, um aus
ihnen nach logischen Prinzipien das ganze Fachwerk aufzubauen” (406). — Eine
der historisch interessantesten Auseinandersetzungen über die Probleme, auf welche
das „axiomatische Denken” im Sinne Hilberts hinführt, sind die polemischen
Bemerkungen gegen W. Whewell in der Induktionslehre J. St. Mills. Die „Philosophy
of Discovery” von Whewell (das Vorwort ist von 1856, die vor mir liegende
Ausgabe von 1860) ist von Kant inspiriert, die Auseinandersetzung vollzieht sich
also im Grunde zwischen Mill und Kant. Wir können sagen: das was keiner von
beiden bestreitet, das was Mill immer wieder als den richtigen Kern der Whewellschen
Auffassung anerkennt, dies exakt ist der Forschungsbereich der Axiomatik
einer Erfahrungswissenschaft. Man beachte bei Mill vor allem Bemerkungen wie
die folgende: „Die Schwierigkeit besteht für den Letzteren (es ist der Richter,
welcher ein Tatbestandsurteil fällen muß) nicht darin, daß er eine Induktion zu
machen, sondern darin, daß er sie zu wählen hat.” Um Erstwahlen sozusagen von
fruchtbaren Ausgangsideen handelt es sich in der Axiomatik der Einzelwissenschaften.
Aus welcher Erkenntnisquelle sie gespeist werden, ist eine Frage, die den Rahmen
der Axiomatik der Einzelwissenschaften überschreitet.
51) Ich selbst fühle mich mitverantwortlich nicht für seine Konzeption (die
ganz und gar dem verehrten Verfasser gehört), wohl aber für die Herausgabe des
lehrreichen Buches; man mußte Gardiner zureden, das langsam Gereifte in geschlossener
Form zu veröffentlichen und daran habe ich es, als mir eine Gelegenheit
geboten war, nicht fehlen lassen. Es ist dann in dem Buche selbst noch viel hinzugekommen,
was ich aus dem mündlichen Bericht nicht kannte. Wir werden an
mehreren Stellen auf Gardiners Buch zurückkommen und viel aus ihm zu lernen
haben.
61) Dies Regenbeispiel ist erörtert in Alan Gardiners ansprechendem Buch
„The theory of speech and language” 1932. Ich bestätige dem verehrten Autor gern,
daß ich es 1931 in London am Dreifundamentenschema auf der Tafel durchgesprochen
habe, ohne zu wissen, daß er es 10 Jahre vorher schon aufgezeichnet hatte. Vielleicht
ist das Londoner Klima für die Gleichförmigkeit der Exempelwahl verantwortlich.
Das Dreifundamentenschema selbst ist von keinem von uns beiden, sondern von
Platon zuerst soweit konzipiert worden, daß es ein Logiker aus Platons Ansatz
herauslesen konnte. Als ich es 1918 in dem Aufsatz „Kritische Musterung der neueren
Theorien des Satzes” (Indog. Jahrbuch 6) ausführte, dachte auch ich nicht an
Platon, sondern wie Gardiner an die Sache und sah das Modell vor mir. Die
Titel meiner zwei Vorträge im University College in London waren 1. Structure of
language, 2. Psychology of Speech. Im Anschluß an sie hatte ich mit Gardiner
jene von ihm erwähnten eingehenden Diskussionen, die uns beiden offenbarten,
daß er vom Ägyptischen und ich vom Deutschen her „die” Sprache der Menschen
übereinstimmend beurteilten.
71) Der deutsche Name Kuckuck mag mehr oder minder weitgehend dem
bekannten Ruf, den wir im Walde hören, „ähnlich” sein, so ist doch diese Ähnlichkeit
selbst nicht mehr als das Motiv der Laut-Ding-Zuordnung, die den Namen erst
zum Namen macht; zum Namen nicht des Rufes, sondern des Vogels (den notabene
die wenigsten der Kontrahenten lebendig im Walde und gleichzeitig mit dem Rufe
wahrgenommen haben dürften). Es fehlt viel, es fehlt logisch alles für die Gleichung
Ähnlichkeit = Zuordnung. Nur das steht fest, daß sich jeder Sprachgenosse anders
und einfacher an der Schöpfung neuer Namen beteiligen könnte und faktisch kann,
wo immer vereinbart ist, daß Ähnlichkeit überhaupt, daß irgendeine Ähnlichkeit
das Zuordnungsmotiv sein soll. Zuordnung und Motiv der Zuordnung müssen aber,
wie immer die Dinge liegen, logisch unterschieden werden.
81) Dies ist eines der Ergebnisse einer (noch unveröffentlichten) Studie von
Dr. Bruno Sonneck, „Sprachliche Untersuchungen zur Zeichentheorie”, die sich
auf J. Gonda, ΔΕΙΚΝΥΜ, Semantische Studie over den indogermaanschen
Wortel deik-, 1929, sowie auf die einschlägigen Artikel in den etymologischen Wörterbüchern
von Walde-Pokorny, Walde, Kluge und Paul stützt, jedoch in ihren
Ergebnissen von den allgemeinen Aufstellungen Gondas nicht unwesentlich abweicht.
Es schien mir wichtig, den Zeichenbegriff in Verbindung mit Etymonfragen
zu bringen; Sonneck dürfte diese Aufgabe, soweit es heute möglich ist, in dem umgrenzten
Gebiet gelöst haben.
91) The Century Psychology Series. The Century Co., New York.
101) Vgl. dazu K. Bühler, Die geistige Entwicklung des Kindes, 1. Aufl.,
1918, S. 116f.; 5. Aufl. 1929, S. 224ff. und die Erörterungen über das, was die Signale
der Ameisen und Bienen vom symbolischen Zeichen unterscheidet, in der Krise,
S. 51ff. Zur Fingergeste später mehr.
111) Wilhelm von Ockham schreibt mit Vorliebe „supponere dafür. Supponere
pro aliquo gebraucht Ockham, wie dies nach Thurots Nachweis mindestens schon
seit dem Jahre 1200 üblich war, in intransitivem Sinne gleichbedeutend mit „stare
pro aliquo.”” M. Baumgartner in Überwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie,
II, 10, S. 602.
122) Wir schreiben nicht „an sich” sondern „für sich”, d. h. abgesehen von der
Vertretung.
133) K. Bühler, Phonetik und Phonologie. Travaux du Cercle Linguistique
de Prague, 4, 1931, S. 22-53.
141) Das äußerlich unhörbare sogenannte „innere” Sprechen durchbricht die
Regel nicht. Denn auch hier sind dem Einsamen selbst, für den es da ist,
„Laute” oder ein Ersatz für Laute in irgendeiner Form (akustisch, motorisch,
optisch) anschaulich gegeben, also vernehmbar; sonst liegt kein echtes Sprechereignis
vor.
151) H. Gomperz, Semasiologie, S. 278. Vgl. auch, den Aulsatz „Über einige
philosophische Voraussetzungen der naturalistischen Kunst” in Beilage zur Allgemeinen
Zeitung, Nr. 160 und 161 vom 14. und 15. Juli 1905.
161) Travaux du Cercle Linguistique de Prague I. (1929), S. 39-67.
171) Vgl. meine Ausdruckstheorie S. 40.
181) Vgl. den Fundbericht in meiner Geistigen Entwicklung des Kindes,
5. Aufl., S. 309f.
191) K. Bühler, Ausdruckstheorie, S. 23ff.
201) Mein erstes Wort als junger Psychologe war 1907 ein von den Fachgenossen
damals gar nicht freundlich aufgenommener Widerspruch gegen diesen säkularen
theoretischen Mißgriff. Heute gilt er in psychologischen Fachkreisen als entlarvt
und überwunden; es besteht aber einige Veranlassung, nun umgekehrt gegen die
Tendenzen eines anderen, in mehr als einer Hinsicht antithetischen Prinzipienmonismus
die alte Assoziationsidee in ihrem beschränkten Geltungsbereich zu
verteidigen. Dazu E. Frenkel, Atomismus und Mechanismus in der Assoziationspsychologie,
Zeitschr. f. Psych. 123 (1931).
211) Über kompliziertere Systeme gibt z. B. der „Codice Commerciale de'
Segnali” Editione Austro-Ungarica. Firenze 1869, der vor mir liegt, Aufschluß.
Man kann, was uns hier nicht interessiert, natürlich auch buchstabieren mit Flaggen.
221) Die reine Hilfsfunktion der Phoneme steht ja auf einem anderen Blatt
und bleibt bei dieser Narnengebung unberücksichtigt. Globale Signale dort und gegliederte
Symbolik hier, das ist der entscheidende Systemunterschied. Er bleibt
derselbe, ob man die wahrnehmbaren Zeichen mit oder ohne die Hilfe diakritischer
elementarer Kennzeichen aufbaut. Es gibt isoliert aufzeigbare „Flaggenmale”
dort, wie es isoliert aufzeigbare Lautmale (Phoneme) in der Sprache gibt — allein,
das interessiert uns hier nicht weiter.
231) Schon de Saussure nennt diese Auffassung eine „ziemlich verbreitete
Theorie” und verteidigt die nach seiner Auffassung linguistisch unentbehrliche
ältere Auffassung. — Lehrreich ist nachzulesen, wie sich die Sache in Wundts
Theorie verschiebt und zu einem psychologischen, aktualgenetischen Problem wird:
Die Sprache, I2, S. 602f.
241) Der linguistisch nicht versierte Leser überlege, um das Gesagte rasch an
einer einzigen Beispielgruppe zu verifizieren, wie verschieden das Sinngefüge der
folgenden Komposita im Deutschen ausgeführt werden muß: Back-Ofen, Back-Stein,
Back-Huhn, Back-Pulver. Die Sprache stellt in allen Fällen ganz gleichartig zusammen;
der Vollzieher des Sinngefüges muß aus seiner Sachkenntnis schöpfen,
um sich dabei nicht zu vergreifen.
252) Im Konzept der großen Sprachforscher der Vergangenheit tritt die Erkenntnis
des hier gemeinten Zweiheitsmomentes manchmal in merkwürdiger Verhüllung
auf oder muß aus ableitenden Gedankengängen erschlossen werden. Im
Konzepte Schleichers z. B. spielt die Gegenüberstellung von Bedeutungs- und
Beziehungsausdruck in der Sprache eine große Rolle. In seiner ersten Phase spekuliert
Schleicher damit im Hegelschen Geiste über den Unterschied und die
vermeintliche Dreistufenfolge: monosyllabisch-isolierende: agglutinierende: flektierende
Sprachen. Das alles ist, wie man weiß, längst überholt. Geblieben aber ist
und sprachtheoretisch exakt gefaßt werden muß der für alle Sprachen gültige Satz
von den unentbehrlichen zwei Klassen von Sprachgebilden. Zu dem über Wort
und Satz hier Gesagten siehe auch Cassirer, Die Sprache1, S. 281f. Das Zweiheitsmoment
wird dort ganz anders eingeführt; im Endergebnis aber treffen wir
vollkommen zusammen. In der Anm. auf S. 281 zitiert Cassirer einige Belege zu
dem Gesagten aus dem Befunde der vergleichenden Sprachforschung.
261) Die Idee von der fast durchgehenden binomischen Struktur der Sprache
ist nicht ganz neu, hat aber z. B. im Kreise der Forscher um Trubetzkoy zu neuen
bemerkenswerten Erfolgen der Analyse geführt.
272) In etwas anderer Form ist eine logische Deduktion des Dogmas vom
Lexikon und der Syntax von Käthe Wolf auf dem Hamburger Psychologenkongreß
vorgelegt worden. Dazu 12. Kongr.-Ber., S. 449-453. In unseren Überlegungen
hier wird das Eingehen auf die „Darstellungsfelder” der Sprache, die dort
herangezogen sind, vermieden.
281) K. Brugmann, Die Demonstrativpronomina der indogermanischen
Sprachen. Abh. der sächs. Ges. d. Wiss. 22 (1904).
291) K. Bühler, Ausdruckstheorie 1933, S. 44 und 74ff.
301) Ph. Wegener, Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens,
1885, bes. S. 19ff. Neuerdings hat A. H. Gardiner den Bau der Sprache von hier
aus beleuchtet: The theory of speech and language 1932.
311) Die Tatsachen dazu sind ausführlich in meiner „Ausdruckstheorie” besprochen;
man sehe darin besonders die Ausführungen von Wundt (136f.) und
Klages (180f.) nach und orientiere sich allgemeiner nach dem Stichwort Deixis
im Sachregister.
322) Vgl. dazu z. B. Brugmann-Delbrück, Grundriß der vgl. Gram. der
indogerm. Sprachen, 2. Bd., 2. Teil, 2. Aufl. (1911), S. 307ff.
331) Die Differenzierung zwischen einem speziell die Position des Empfängers
treffenden da-Wort und anderen, die ihn nicht treffen, sondern etwas, was auch dem
Empfänger ein da ist, ist im Italienischen und (wie ich höre) auch sonst in romanischen
Sprachen lebendig. Im Lateinischen scheint das iste-Wort präzis auf den gegenwärtigen
Partner bezogen vor allem in der Gerichtssprache ein wohldefinierter
Terminus gewesen zu sein; nicht ganz streng, aber doch überwiegend scheint auch
ούτος den Empfänger zu treffen: τίς δ΄ούτος; = wer bist du da?
341) Seitdem dies niedergeschrieben wurde, ist es uns gelungen, mit Hilfe des
Phonogrammarchivs in Wien eine Apparatur aufzubauen, mit der es möglich wurde,
(in einem nahezu widerhallfreien Raum) die Vermutung experimentell zu prüfen.
Sie hat sich in hohem Grade als richtig herausgestellt; Herr Mohrmann wird in
seiner Dissertation darüber berichten. Wir hören danach die Intensität der Sprachlaute
ungefähr so, wie wir die Größe der Sehdinge sehen, nämlich nahezu korrekt
in ihrer Senderstärke (nicht nach Empfangsstärke an unserem Ohr); ein Faktum,
das wichtig werden dürfte für die Phonologie und viele von uns meist naiv als selbstverständlich
hingenommene Tatsachen des alltäglichen Sprechverkehrs. — Es muß
nun (und zwar diesmal in einem wiederhallreichen und klar überhörbaren Raum)
ebenso sorgfältig das Phänomen des Hörens der Senderrichtung (abgehoben von der
Herkunftsqualität) studiert werden. Dann werden wir besser als heute darauf
vorbereitet sein, die akustischen Leitfäden der istic-Deixis zu beschreiben. Diese
Leithilfen sind gewiß nicht sehr exakt, aber praktisch unter wohlüberhörten Raumverhältnissen
brauchbare und allgemein ausgewertete Indizien.
351) Dazu K. Bühler, Ausdruckstheorie, S. 105ff.
362) ‚Das Messer ist nicht da’ heißt im ganzen deutschen Sprachgebiet, es
sei nicht aufzufinden oder sonstwie im Augenblick unerreichbar, und die Einheimischen
heißen in einigen Gegenden Österreichs (von den Sommergästen abgehoben) ‚dasige’
statt ‚hiesige’.
371) Im Bulgarischen, das manchmal mit angeführt wird, soll die Erscheinung
überhaupt nicht vorhanden sein.
381) Mit der neueren Arbeit von Theodor Baader, Die identifizierende Funktion
der Ich-Deixis im Indoeuropäischen. Indog. Bibl. 3. Abt., 10. Bd. (1929),
bin ich als Laie in diesen Dingen nicht recht fertig geworden. Baader untersucht
die Nennwörter, welche einen k-Stamm enthalten und findet neun Klassen solcher
Wörter. Einige von diesen Klassen erwecken in der Tat den Eindruck, als seien
sie innerlich zusammengehalten durch Momente, die dem Ich-Bereich und Eigentumsbereich
näher stehen als anderes in der Welt der Nennwörter. Der Sprachtheoretiker
aber vermißt in dieser Arbeit irgendein Wort darüber, wie sich ihr Verfasser
im Bereich des Indogermanischen den allgemeinen Zusammenhang von Zeigwörtern
und Nennwörtern vorstellt. Es ist nicht selbstverständlich, daß ein k-Stamm
dort und ein k-Stamm hier sphärenverwandt verwendet sein müssen. Und dies
dürfte doch wohl die tragende Voraussetzung der ungemein materialgesättigten
Untersuchung von Baader sein. Es gibt Sprachstämme, die offenkundiges Zeigen
weitgehend unter Mitverwertung von Nennwörtern vollziehen; Baader scheint
umgekehrt anzunehmen, daß im Indogermanischen der k-Stamm, dessen deiktische
Verwendung außer Zweifel steht, auch zum Aufbau einheitlicher Nennwortklassen
(und nur für diese?) verwendet wurde.
391) Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Kömern, 2. Aufl.,
2. Teil (1891), S. 313 und 316.
401) Das „Vorgreifen” auf noch nicht Gesagtes ist psychologisch durchaus
verständlich, seitdem wir wissen, wie regelmäßig dem erst noch zu erfüllenden ein
mehr oder minder „leeres” Satzschema in unserem Denken vorauseilt. Auf Plätze
in diesem Schema erfolgt der Vorverweis. Brugmann nennt den Vorverweis
einmal ‚präparatorische’ Verwendung der Demonstrativa im Unterschied von der
rückverweisenden Anaphora. Der neue Terminus ‚präparatorisch’ ist nicht sehr
scharf; wo unterschieden werden muß, sagen wir Rückverweis und Vorverweis
(oder Rückblick und Vorblick). Sonst müßte man ein zweites Wort aus dem
Griechischen suchen und dies wäre Kataphora. Die griechischen Sprachgelehrten
sagten wie wir ‚oben’ und ‚unten im Texte’ (ἄνω und κάτω); sie hatten ein gutes
Recht dazu im Hinblick auf ihre Textrollen. Wir werden uns diese Entstehung
vormerken für die exakt theoretische Behandlung der Anaphora und Kataphora;
im Zeitalter Brugmanns war die Einsicht in den wahren Charakter der beiden
verloren gegangen, sie muß wiederhergestellt werden. — Ob das am optischen
Text gewonnene sprachliche Bild und die Namen zwanglos auch auf die akustische
Erscheinungsform der Rede übersetzbar seien, ist eine sekundäre Frage, die
immerhin gestellt werden kann. Falls es in die Vergangenheit zurück „hinauf” geht,
so müßte der Vorblick in die Zukunft „hinab” gerichtet sein. Es sei denn, die Griechen
hätten sich den Gegenwartsaugenblick wie einen Tiefpunkt vorgestellt, von dem
aus es nach beiden Seiten .hinauf geht. Nun dann wäre das eine Wort Anaphora
für beides auch vom sinnlichen Bild her gerechtfertigt. Wie blicken eigentlich die
Völker des Erdkreises in die Vergangenheit und wie in die Zukunft?
411) Das ist ein Terminus, der Mißverständnissen weniger ausgesetzt ist als
der Terminus ‚Anamnestisches Zeigen’, der mir zuerst vorschwebte. Denn anamnestisch
ist im Grunde auch die Anaphora, und das eigentlich produktive Moment
am konstruierten Phantasma ist nicht anamnestisch, sondern überschreitet die
Leistung der reinen Reproduktion.
421) Belege dazu aus Theaterbeobachtungen in meinem Buche „Ausdruckstheorie”,
besonders S. 44ff.
431) Dies Faktum, wie es Hering und andere experimentell festgestellt haben,
ist nicht ganz so allgemeingültig, als die Älteren annahmen. Denn es wurde neuerdings
bewiesen, daß viele Menschen gewohnheitsmäßig die Sehrichtungen eines
Auges bevorzugen. Es gibt Rechtsäuger und Linksäuger, ähnlich wie es Rechtshänder
und Linkshänder gibt. Ein Rechtsäuger sieht die binokularen Sehrichtungen
gewöhnlich von seinem rechten Auge aus. Das schränkt die Bedeutung der Heringschen
Konstruktion ein wenig ein, hebt sie aber nicht prinzipiell auf. Um die Aufklärung
der Rechtsäugigkeit und Linksäugigkeit hat sich besonders W. R. Miles
verdient gemacht; seine Ergebnisse sind in größerem Zusammenhang bequem nachzulesen
in: The Journal of General Psych. 3 (1930), p. 412ff.
441) So ist die Frage bereits gestellt und beantwortet in der von mir bearbeiteten
4. Aufl. der „Grundzüge der Psychologie” von Ebbinghaus, I. Bd., 1919, S. 585ff.
Dort sind auch die Originalarbeiten, auf die sich die Antwort stützt, zitiert. Nur
ist, wie gesagt, alles noch geschildert ohne eine Anwendung auf die Tatsachen des
sprachlichen Zeigens, weshalb auch der Ausblick auf die Anaphora fehlt.
451) Vgl. Blase, Geschichte des Plusquamperfektums im Latein. Gießen
1894. Man betrachtet heute die Ausbildung der „Zeitstufen” unseres lateinischen
Beispiels als eine relativ junge Erscheinung in der Geschichte des indogermanischen
Verbums; einige subtile Bemerkungen dazu gibt Porzig in „Aufgaben der indogermanischen
Syntax”. Festschrift für Streitberg (1924), S. 147.
461) Griechisch richtig wäre wohl die Bildung άντιδεικτικαί; ich würde prodeiktisch
der bequemen Sprechbarkeit wegen vorziehen, fürchte aber den Einspruch
der Gräzisten, weil das Präfix ‚pro’ seine lateinische und nicht seine griechische Bedeutung
darin haben müßte.
471) Die weit verbreiteten ‚Höflichkeitspronomina’ neben einem primären
System von Personalia interessieren uns hier begreiflicherweise nicht.
481) Persönlich habe ich mit redlichem Bemühen, als sie um 1910 erschienen
waren, die faßlichen und äußerst instruktiven Übersichten von Fr. N. Finck, vor allem
sein didaktisches Meisterstück „Die Haupttypen des Sprachbaues” und später noch
vieles andere studiert; Bücher wie Sapirs Language und einige Franzosen, voran
Meillet und zuletzt das von ihm inspirierte Sammelwerk „Les langues du monde”
(1924); auch das methodisch neuorientierte Buch des ideenreichen Ethnologen
W. Schmidt, „Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde” (1926), das an einer
bestimmten Stelle hier ausführlich zu Wort kommen soll. Ein System der Sprachstrukturen
ist vielleicht in Anfängen da und dort zu ahnen; doch es auszuführen,
dazu reichen nach der Auffassung aller Sachverständigen die auf bewährtem Wege
induktiv gewonnenen Ergebnisse nicht aus.
491) Ausdruckstheorie, S. 128-151.
501) Die Griechen und Lateiner setzen den Namen des Eigentümers im Genitiv
und schreiben ‚Romam’ auf Wegweiser so wie wir manchmal ‚nach Wien’; solche
Einzelheiten interessieren uns noch nicht. Vermutlich wird auch der ungeformte
Ortsname auf Wegweisern allgemein verstanden. Wenn nicht, dann könnten wir
andere Musterbeispiele vorschlagen.
512) Das Fremdwort Symphyse (Verwachsung) ist in der Medizin gebräuchlich;
der nachdenkende Leser soll auch bei ‚symphysisches Umfeld’ an ‚Zusammenwachsen’
denken. Wenn ein flüchtiger Leser aber nur an ‚physischen Zusammenhang’
denkt, so schadet das kaum, weil es sachlich nicht daneben trifft und das Wort
Physis ja aus derselben Wurzel stammt.
521) Siehe: Julius Klanfer, Sematologie der Wappenzeichen, Wiener Diss.
1934. Dort wird das Tatsachenmaterial vorgelegt, auf welches sich unsere Ausführungen
stützen.
531) Diese Behauptung stützt sich auf Tatsachen, die im Kapitel Gemäldeoptik
meiner „Erscheinungsweisen der Farben” ausführlich besprochen sind. Sollten die
Dinge einmal experimentell weiter verfolgt werden, dann wäre eine Bezugnahme
auf die sprachliche Syntax hinüber und herüber gewiß sehr lehrreich. Es dürfte
neben der generellen Analogie auch durchgreifende Verschiedenheiten geben; denn
beides ist zwar Darstellung, aber die Sprache ist nicht Gemälde. Vgl. vorerst die
aufschlußreichen Untersuchungen von L. Kardos, Ding und Schatten. Ergbd. 23
zur Z. f. Ps. 1934.
541) Streitberg-Festschrift 1924, S. 234ff. Die Herrmannsche Definition
wird dort zitiert.
551) Ch. Bühler, Über Gedankenentstehung. Z. f. Ps. 80 (1918) und Über die
Prozesse der Satzbildung, ebenda 81 (1919).
561) J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung
von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. 2 Bde., Basel 1920 und 1924. — Herr
Kollege A. Wilhelm, den ich um Aufschluß bat über Zeigwörter auf den ältesten
griechischen Inschriften, hat mir das Buch von Wackernagel in die Hand gedrückt
und als das nach seiner Meinung beste empfohlen. Ich bin ihm dauernd zu Dank
dafür verpflichtet.
571) Dem war, wie man weiß, noch teilweise anders in der Notenschrift der
mittelalterlichen Musik. Aber was immer sie gewesen und wie die historische Entwicklung
sich vollzogen haben mag, für das Verständnis der modernen Notenschrift
als System ist das irrelevant.
581) W. Müri, Symbolon. Wort- und sachgeschichtliche Studie. Beilage zum
Jahresbericht über das Städtische Gymnasium in Bern, 1931. (Siehe auch das
Ref. im 49. Band der Indogerm. Forsch.)
591) Das Material der Musik sind Töne, nicht Notenköpfe auf dem Papier, die
quoad materiam von Tönen ganz verschieden sind. Ebenso denkt man bei ‚Fieber’
an Körpertemperatur und nicht an Bleistiftstriche auf einem Stück Papier. Beim
farbigen Gemälde und selbst noch bei der farblosen Photographie ist dem insofern
anders, als Gegenstandsfarbe durch Malfarbe oder wenigstens ‚Weißwert’ durch Weißwert
wiedergegeben wird.
601) Vgl. dazu K. Bühler, Die Erscheinungsweisen der Farben (1922), S. 95ff.
wo der Interessierte auch weiterführende Literatur zitiert findet.
611) P. Hankamer, Die Sprache, ihr Begriff und ihre Deutung im 16. und
17. Jahrhundert, Bonn 1927.
622) Ernst Hoffmann, Die Sprache der archaischen Logik, Heidelberg, Abh.
z. Philos. und ihrer Geschichte, 3, 1925.
631) Wir subsummieren dabei der Einfachheit halber das Eigenartige der
Vokale unter die Rubrik Klangfarbe, wie es nach der neuerdings von Stumpf wiederbelebten
Helmholtzschen Auffassung berechtigt ist. Scripture bestreitet die
Grundlagen dieser Auffassung; sollte er gestützt von Thirring und seinen Schülern
recht behalten, so müßten in unserem Vergleich die drei verschiedenen Instrumente
durch drei gesondert anblasbare Kesonatoren (Ansatzrohre) ersetzt werden, was
für unsere Zwecke natürlich vollkommen gleichgültig ist.
641) Zitat nach W. Wundt. Die Sprache I., S. 319 aus L. Geiger, Ursprung
und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft L. 1868, S. 168.
651) W. Oehl, Das Lallwort, Rektoratsrede Freiburg (Schweiz) 1932; in Aussicht
steht von ihm ein Buch „Fangen — Finger — fünf”.
661) W. Oehl, Elementare Wortschöpfung, Anthropos, Bd. 12/13, S. 575 und
1047, Bd. 14/15, S. 405.
671) W. Oehl, Elementare Wortschöpfung: papilio — fifaltra — farfalla.
Bibl. dell'Roman. 3 (75-115).
681) So die Angaben im geographisch-statistischen Universalatlas von Hickmann.
692) Vgl. dazu den sprachtheoretisch umsichtigen und ungewöhnlich aufschlußreichen
Artikel von E. Winkler, Sprachtheorie und Valery-Dichtung. Z. f. franz.
Sprache und Lit. 56 (1932).
701) A. Willwoll, Begriffsbildung. Psychol. Monographien, 1926.
711) Eine brauchbare kurze Übersicht der Bemühungen um die Definition
des Begriffes ‚Eigennamen’ (ὄνομα κύριον) seit Aristoteles gibt: Viggo Brøndal,
Les parties du discours, Copenhagen 1928, S. 9-13. B. zitiert aus der neuesten Zeit
Sprachforscher wie Jespersen und Funke, die Akttheorie Husserls aber erwähnt
er an dieser Stelle nicht. Zuletzt nimmt er die Millsche Bestimmung als die brauchbarste
hin.
721) Dies Wort steht sinngleich in meiner ersten Arbeit über das Denken (1907)
und in den sprachtheoretischen Untersuchungen von E. Winkler (1932); wir
haben beide aus Husserl die nächstgelegene Konsequenz gezogen.
731) Siehe z. B. Trubetzkoy, Langues caucasiques septentrionales. In: Les
langues du monde (1924) p. 336, wo das kasusarme System im Adyghischen mit dem
Reichtum anderer Sprachen derselben Familie verglichen wird.
741) Die aus Verben derart gebildete Nomina haben die Linguistik seit Max
Müller und Useners berühmter Abhandlung über die Götternamen viel beschäftigt.
P. Kretschmer klärte die Tatsache, daß viele von ihnen (die Tracht, die Lage, die
Sicht usw.) als Feminina auftreten. Vgl. auch den schönen Aufsatz von W. Porzig,
Die Leistung der Abstrakta in der Sprache. Blätter f. deutsche Philos. 4 (1930) und
vorher in der Festschrift f. Streitberg (1924), S. 146ff.
751) Man wird von vornherein nur an die von Trubetzkoy ausdrücklich als
‚casus patiens’ und ‚casus agens’ von der lokalistischen Gruppe abgehobene Klasse
in den kaukasischen Sprachen denken dürfen, wenn die Wundtsche Formel dort
überhaupt anwendbar ist, was ich nicht zu entscheiden vermag. S. Trubetzkoy,
a. a. O. und 328.
761) Es scheint mir eine sinnvolle Frage des Sprachtheoretikers zu sein, ob
diese drei grundständigen Bezugswendungen irgendwo in einem reicheren Kasussystem
differenziert sind. Ich könnte mir neben einem spezifischen „Anklagekasus”,
einem Akkusativ der negativen Hinwendung, einen spezifischen Kasus der
positiven Hinwendung (Zärtlichkeit, Liebe, Fürsorge) vorstellen und einen spezifischen
Kasus der negativen Abwendung (Fliehen, Verabscheuen, Vermeiden).
Das Geben, von welchem der Dativus seinen Namen empfing, ist eine psychologisch
verwickeitere Verhaltungsweise. Doch kann natürlich auch sie zum Grundmodell
erhoben werden. Dann stehen im Nominativ und Dativ ursprünglich die zwei
Personen, die auch in unserem Organonmodell vorkommen, nämlich der Sender
und Empfänger. Diesmal aber nicht der Sender und Empfänger der sprachlichen
Botschaft, sondern eines Gutes oder eines (sachlichen) Geschehens. Wenn wir
auf einen Brief „Herrn N. N.” schreiben, verwenden wir diesen durchaus originär
denkbaren Dativus, der keinen Akkusativ neben sich haben müßte, während
unsere Sprache sonst den Dativ nur zusätzlich und ganz, wie man sich ausdrückt,
als Kasus des ferneren Objektes verwendet. Ich könnte mir den Adressendativ
als den einzigen neben dem Nominativ als Normalfall vorstellen.
771) Die fortgeschrittensten modernen Bücher über das, was ich im Auge habe,
sind: E. Brunswik, Wahrnehmung und Gegenstandswelt. Wien (Deuticke) 1934
und L. Kardos, Ding und Schatten. Leipzig (J. A. Barth) 1934.
781) K. Bühler, Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge.
Arch. Psychol. 12 (1908), S. 84ff.
791) R. Ameseder, Beiträge zur Grundlegung der Gegenstandstheorie. In:
„Abhandlungen z. Gegenstandstheorie und Psychologie”, hg. von A. Meinong 1904.
Dort im Abschnitt ‚Verbindungsgegenstände und ihre Relate’ (S. 116) wird am
Undkomplex (a und b) verdeutlicht, daß und die Bezeichnung des Relates und daß
ein Undkomplex kein Gestaltkomplex ist. — Ich selbst hatte die Sache als eine Angelegenheit
der Meinong-Schule in Erinnerung; Herr Kollege Mally war so freundlich,
mir auf eine Anfrage den genauen Standort anzugeben, wofür ich ihm danke. Ob
das Sprachexempel später von Wertheimer genau so oder irgendwie anders ausgewertet
wurde wie von Ameseder, steht vorerst noch nicht zur Diskussion; ein
Sprachtheoretiker muß zunächst das sprachliche Phänomen als solches ins Auge fassen.
801) Daß sie überhaupt aufkommen konnte, liegt begründet in dem für die
Geschichte der Sprachwissenschaft wichtigen Faktum, daß die griechischen Grammatiker
am Buchstaben philosophiert haben und theoretisch nicht ganz fertig geworden
sind mit der Aufgabe, die gesprochene von der geschriebenen Rede, den
Lautstrom dort und die Buchstabenzeile hier sachgemäß und scharf genug zu unterscheiden.
Denn für die Zeile, für den Aufbau der optischen Zeichen ist die Backsteinlehre
weitgehend berechtigt; sinnfälliger noch für eine aus dem Setzkasten herauskonstruierte
Druckzeile wie für unsere moderne (fließende) Handschrift.
811) Die analysierten Beispiele sind einem sehr sorgfältigen Sammelreferat
von H. Krause „Der Stand der Silbenfrage” (1930) entnommen.
821) Der oft zitierte Satz von Sievers lautet: „Eine einheitliche genetische
Definition des Begriffs ‚Silbe’ läßt sich nicht geben” (55). Wo er dann selbst den
Namen „Drucksilben” vorschlägt, darf man stutzen, aber ihm nicht ohne weiteres
einen Widerspruch ankreiden. Es ist nicht so, daß Sievers damit selbst das angeblich
Unlösliche unversehens gelöst hätte oder daß ihm eine Entgleisung aus seiner
akustischen Silbenlehre in die motorische Betrachtungsweise unterlaufen wäre.
Denn Sievers hat nur an einem einfachen motorischen Äquivalent des von ihm
akustisch gefaßten Phänomens der Silbengliederung gezweifelt und das „Druckphänomen”
akustisch oder auch akustisch verstanden. Ob das mit den Drucksilben
in seinem Sinne physikalisch ausdenkbar ist oder nicht, ist eine andere Frage.
832) R. A. Stetson, Motor Phonetics. Archives de Phonétique Exp. 3 (1928). —
Hudgins and Stetson, Functions of the breathing movements in the mechanism
of speech. Ibid. 5 (1930). — Außerdem wurde mir ein ungedrucktes (in Maschinenschrift
vervielfältigtes) Manual of motor phonetics for the deaf (1933) mit
den in unserem Text genannten Bildern von Aktionsströmen geschenkt. L. D.
Hartson, Analysis of skilled movements. Personal Journal 11 (1932).
841) Vgl. zu dieser Kritik der einseitigen Erzeugungsanalyse: P. Menzerath
und A. de Lacerda, Koartikulation, Steuerung und Lauterzeugung 1933. bes. S. 59.
851) Das Akustische bei Stumpf, Sprachlaute 258ff. Kritische Ergänzungen
aus der phonologischen Betrachtungsweise dazu in meinem Aufsatz „Phonetik und
Phonologie” 33ff. Ob noch einmal neue und wieviele phonematische Differenzen
in Wortreihen wie mehre, Meere, Märe zum Vorschein kommen, überlassen wir der
Entscheidung der Sachverständigen. Die für unsere standardisierte Rechtschreibung
Verantwortlichen tuen entweder so, als ob sie es wüßten, oder sie schlagen absichtlich
aus bestimmten Zweckmäßigkeitsgründen für die optische Wiedergabe Differenzierungen
vor, welche dem Akustischen nicht adäquat entsprechen.
861) Über den Elementenbegriff im Altertum vgl. H. Diels, Elementum 1899.
872) Das polizeiliche Verfahren der Fingerabdrücke beweist, wenn nicht mehr,
so jedenfalls das eine, daß mit Geduld und Umsicht schon an jedem passend ausgesuchten
Texturstück der Hautoberfläche eine praktisch hinreichende Individualcharakteristik
gewonnen werden kann, was uns hier nicht weiter interessiert.
881) So ist das Referat der Trubetzkoyschen Vokaltheorie bereits zu lesen
in „Phonetik und Phonologie”. Heute müßte die Schilderung der dreidimensionalen
Systeme ein wenig differenzierter ausfallen; denn Trubetzkoy selbst unterscheidet
heute, wie ich aus einem Vortrag weiß, mindestens drei Ausnutzungsweisen des
Gewichtsmomentes, unter denen wiederum die deutsch-englische wegen des
freien Akzentes als die schwerst durchschaubare erscheint.
891) Genaueres in „Phonetik und Phonologie”. Travaux du Cercle Linguistique
de Prague 4 (1931), S. 22-52. Die programmatische Arbeit von Trubetzkoy
ebendort 1 (1929) unter dem Titel „Zur allgemeinen Theorie der phonologischen
Vokalsysteme”.
901) Bei H. Gomperz, Semasiologie S. 81 darüber einen quellenmäßigen Beleg.
Den experimentellen Beweis dafür, daß Komplexe als solche ohne die Vermittlung
ihrer Elemente assoziationsfähig sind, erbrachte die Arbeit von G. Frings „Über
den Einfluß der Komplexbildung auf die effektuelle und generative Hemmung”.
Arch. Psych. 30 (1913).
911) Die Zahl ist geschätzt nach silbenstatistischen Untersuchungen, über die
andern Ortes mehr berichtet wird. Faktisch ausgezählt kommen auf den ersten
zwanzig Seiten der Wahlverwandtschaften rund tausend differente Sinnsilben vor.
Es ist aus dem Verlauf der Kurve des Zuwachses von Neulingen auch nach der
dreißigsten Seite nicht genau, aber doch einigermaßen abzusehen, wie viele noch
ausstehen.
921) Über ältere Untersuchungen, die das beweisen, ist berichtet in dem Sammelreferat
K. Bühler, Über das Sprachverständnis vom Standpunkt der Normalpsychologie
aus I. Die akustische Sprachwahrnehmung, Ber. III. Kongr. f. Psych.
1908, S. 94ff. — Neuere Versuche von Hans Ruederer, Die Wahrnehmung des
gesprochenen Wortes. Münch. Diss. 1916. — Die fortgeschrittene Technik akustischer
Apparate erlaubt heute einfachere Experimente; man müßte zugreifen und
die Angelegenheit des faktischen Erkennens und Wiedererkennens sprachlicher
Klanggebilde auf die Basis systematischer Beobachtungen stellen.
932) K. Bühler, Die geistige Entwicklung des Kindes, 6. Aufl. 1930, S. 226
referiert: So konnte Preyer z. B. das Sätzchen wie groß ist das Kind? reduzieren
auf das einzige Wort groß, ja sogar auf einen einzigen Vokal, ein langgedehntes oo,
es erfolgte danach immer noch die angelernte Reaktion. Lindners Kind war dressiert
auf den Satz ‚hol die Butter!’ Eines Tages sagte der Vater: Das ist eine Napoleonsbutterbirne
und sofort lief der Kleine nach der Butterdose (im Alter von 1:4).
Das Kind Tappolets wendete den Kopf auf die Frage; ‚wo ist das Fenster?’, es
reagierte aber auch genau mit denselben suchenden Bewegungen, wenn man ihm
im gleichen Tonfall vorsprach ‚où est la fenêtre?’ (o;6-o;8). — Wir haben eine
experimentelle Untersuchung an Hunden im Gang, deren vorläufige Resultate
vielleicht stärker bestimmte Einzellaute (z. B. helle gegen dunkle Vokale) als die
Komplexcharaktere als wirksam hervortreten lassen.
941) Über die Begriffe physiognomisch und pathognomisch orientiert die „Ausdruckstheorie”
S. 15-35.
951) Es kommt uns nicht darauf an, ob das Beispiel Husserls durch den
besprochenen linguistischen Befund wirklich als unzutreffend erwiesen werden
kann oder nicht; ein wenig Nachdenken würde uns zurückführen auf den Unterschied
der Husserlschen Aktanalyse gegen die linguistische Gebildebetrachtung, die wir
in § 4 und § 14 erläutert haben. Das aber sollte vorläufig so lange aus dem Spiele
bleiben, bis eine Definition des .Bedeutungspulses verlangt wird.
961) A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale (1921), p. 30.
971) Vorausgesetzt wird bei der hier mitverwerteten Implikation die Erkenntnis,
daß weder das ‚aliquid’ ohne ein ‚pro aliquo’ (aus der scholastischen Formel) noch
umgekehrt ein Zeichen im strengen Wortsinn ist. Wer dagegen gewohnt ist, unter
Zeichen nur das erste manifeste Glied der Komplexion zu verstehen, muß aus den
zwei Meillet-Kriterien drei machen. Darüber folgt noch ein Wort.
981) Brøndal, Les parties du discours. Partes orationis. (Untertitel: Etudes
sur les catégories du langage.) Es ist der französische Auszug aus dem dänischen
Werk: Ordklasserne.
991) Eduard Hermann, Die Wortarten. Nachrichten v. d. Ges. d. Wiss.
Göttingen. Phil.-hist. Kl. 1928, S. 1-44.
1001) W. Porzig, Aufgaben der indogermanischen Syntax. Festschr. f. Streitberg
(1924), S. 148.
1012) Über die abgeleiteten Konkreta und Abstrakta gibt Aufschlüsse, welche
die berühmte Idee Useners über den Ursprung der Götternamen in überzeugender
Weise zum Teil korrigieren: P. Kretschmer in Glotta Xlll, S. 101-116.
1021) Vgl. z. B. E. Winkler, Grundlegung der Stilistik, S. 42 und dazu weiter
Neuphilol. Monatsschr. 3, S. 158, vorher Z. f. franz. Spr. u. Lit. 54, S. 451ff. —
Regula, Zur Artikellehre im Französischen, Z. f. neuere Spr. 2 (1931). — E. Glässer,
Über den Stilwert des Artikels im Romanischen, Z. f. franz. Spr. u. Lit. 57, S. 31ff.
1031) Wackernagel zitiert Syntax II, 142 Beispiele aus Platon, wo in Definitionen
echte Substantiva in Reih und Glied mit artikelverschenen Adverbia
aufmarschieren, z. B. τήν δέ όρϑότηια καί τήν ώαελίαν καί τό εύ καί τό κλώς τήν
άλήϑειαν είναι τήν άποτελούσαν (Leg. II 667C). Hier ist jede andere sprachliche Interpretation
ausgeschlossen.
1041) Um die Phänomene von neuem zu ordnen, müßte man heute wohl von
den Umfeldern ausgehen, die wir unterscheiden. Das Sprachzeichen tritt gewöhnlich
im synsemantischen Umfeld auf; das ist der Grundfall. Daß es auch sympraktisch
und symphysisch eingebaut fungieren kann, haben wir gezeigt und die verschiedenen
Suppositionen machen Gebrauch davon.
1051) Demonstrativpronomina, S. I34ff.: „5. Verselbständigtes und der Demonstrativbedeutung
entkleidetes so”.
1061) Brugmann, Delbrück II, 1, S. 58ff.
1071) K. Brugmann, Über das Wesen der sogenannten Wortzusammensetzung.
Eine sprachpsychologische Studie. Sachs. Ak. Ber. Phil.-hist. Cl. 1900, S. 359ff.
1081) Die Liste stammt aus Brugmanns Abhandlung; dort in der Anmerkung
auf S. 362 stehen genauere Literaturnotizen. Ein sorgfältiges kritisches Sammelreferat
von L. Perutz, das vor mir liegt, behandelt aus der Zeit von Grimm bis
Petersen (Der Ursprung der Exozentrika. Indog. Forsch. 34 1914. und E. Fabian,
Das exozentrische Kompositum im Deutschen, 1931) 22 Arbeiten über die Komposita.
In dieser Übersicht wird sehr deutlich, daß die Neuerer keineswegs in allen
Punkten übereinstimmen. Der von Brugmann mitzitierte Tobler z. B. scheidet
ganz in unserem Sinne Satz und Kompositum sehr scharf; ob er in der Ursprungsfrage
ganz auf Brugmanns Seite steht, bleibe unerörtert.
1091) Siehe K. Bühler, Ausdruckstheorie, S. 23.
1101) W. Schmidt, Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde. 1927 (bes.
im 2. Teil).
1111) Ausführlicher über die historische Entwicklung der Attributstellung im
Französischen in Ettmayers Anal. Syntax II; man sehe vor allem die Ausgangsregel
auf S. 634 und z. B. die statistische Angabe über Chrestien de Troyes auf S. 642ff.
— Die Farbenattribute, zu denen unser Beispiel im folgenden Abschnitt gehört,
standen von Anfang an mit Vorliebe nach (Ettmayer, S. 644).
1121) Die aristotelische Definition und Erläuterung (Poetik cap. 31) ist treffend
und einwandfrei: „Metapher ist die Einführung eines fremdartigen Wortes, welches
entweder übertragen ist von der Gattung auf die Art, von der Art auf die Gattung,
von der Art auf die Art und nach Analogie.” „Analogie nenne ich es, wenn sich ein
zweites zu einem Ersten verhält, wie ein Viertes zu einem Dritten. Dann kann man
nämlich statt des Zweiten das Vierte setzen und statt des Vierten das Zweite, fügt
auch wohl zuweilen dasjenige hinzu, zu welchem dies in Beziehung steht, an dessen
Stelle der übertragene Ausdruck steht.” Metapher in striktem Wortsinn ist nach
Aristoteles nur die Analogie. Es fehlt dieser objektiven Analyse, wie man sieht,
ein Impuls zur Gegenbeleuchtung vom Erlebnis her, während die modernen Untersuchungen
vielfach eines festen Haltes in der objektiven Sprachanalyse entbehren.
1131) W. Stählin, Zur Psychologie und Statistik der Methaphern. Arch.
Psychol. 31 (1914). Zum Folgenden: O. Sterzinger, Die Gründe des Gefallens
und Mißfallens am poetischem Bilde. Ebenda, 29 (1913).
1141) Daß nach dem Muster dieser einen längst bekannten Auswertung eines
technischen Nebeneffektes, der Parallaxe, im psychophysischcn System noch andere
wichtige Auswertungen stattfinden dürften, nimmt neuerdings N. Ach an und hat
seine Idee durch Beispiele belegt: „Das Kompensations- oder Produktionsgesetz
der Identifikation. Ein psychologisches Grundgesetz.” Kongr. Ber. Psych. 12
(1931). Diese Idee dürfte richtig konzipiert und vielleicht auch für das Gebiet der
Metapher fruchtbar sein. Vorher aber ist der Ausfall als solcher zu beachten. Vgl.
dazu die Tatsache daß es ‚Rechtsäuger’ und ‚Linksäuger’ unter den Menschen gibt,
was oben S. 130 Anm. erwähnt wurde.
1151) Der „physiognomische” Blick in die Welt ist primär (autochthon) im
Leben des Kindes; man braucht als Theoretiker keinen eigenen Faktor unter dem
Namen Anthropomorphismus anzusetzen. Über Sonderleistungen des physiognomischen
Erkennens vgl. „Ausdruckstheorie” S. 203.
1161) Die Gründe dieser Behauptung sind in meinem Buche „Die geistige Entwicklung
des Kindes” zusammengestellt und erörtert (6. Aufl. 1930, S. 358ff.).
Es ist ein Indizienschluß; man sollte die nicht unwichtige Sache einmal in direktein
Verfahren mit zureichenden Methoden angehen.
1172) Wir sprachsatten, bildflüchtigen Schilderer von heute sagen z. B. einer
Granate nach, daß sie eine Geländedeckung wegrasiert habe und verlassen uns
darauf, daß der Hörer im Nu das Verschwinden versteht. Der Erzähler Homer
hätte behaglich zu einem zeilenfüllenden Gemälde ausgeholt, um Ähnliches zu sagen
und seine Hörer müssen nicht nur Geduld, sondern auch Funktionslust bei der
Sphärenmischung gehabt haben.
1181) H. Werner, Die Ursprünge der Metapher. Arbeiten zur Entwicklungspsychologie.
Hsg. von F. Krueger, 3. Heft, 1919.
1191) John Ries, Was ist ein Satz? Beiträge zur Grundlegung der Syntax,
Heft III (1931).
1201) K. Bühler, Kritische Musterung der neueren Theorien des Satzes. Indog.
Jahrb. 6. — Am Organon-Modell der Sprache wird in diesem Aufsatz erläutert und
abgelesen, was ‚Sinn’ und Sinneinheiten sind. P. Kretschmer hatte schon 1910
eine ähnliche Kritik wie ich an den rein psychologischen Satzdefinitionen von
Wundt und H. Paul geübt; daß ich diese Kritik nicht kannte, sei dem verehrten
Kollegen hiermit bestätigt. Kretschmers eigener Definitionsvorschlag unterstreicht
den Handlungscharakter des Satzes: „Der Satz ist eine sprachliche Äußerung,
durch die ein Affekt oder Willensvorgang ausgelöst [= gelöst] wird.” Vgl.
P. Kretschmer im Art. „Sprache”, Gercke-Norden, Einl. in die Altertumswiss.,
1. Bd., 3. Aufl. (1927), S. 60 des Separatums.
1211) Vgl. Ch.. Bühler, Der menschliche Lebenslauf (1933). § 26.
1221. Die exaktesten neuen Beobachtungen darüber in der inhaltreichen Arbeit
von Gemelli und Pastori. Ps. Forsch. 18.
1231) Eine größere Beispielsammlung bei H. Paul. Er sagt von den reicheren
der zweiten Gruppe: „Zwar pflegt man solche Sätze als verkürzte hypothetische
Perioden aufzufassen und demgemäß ein Komma zwischen die beiden Bestandteile
zu setzen, aber daß man sie durch eine hypothetische Periode umschreiben kann
(wo viel Geschrei ist, da ist wenig Wolle usw.) geht uns hier gar nichts an, ihre
grammatische Form ist keine andere als die von Sätzen wie ‚Ehestand Wehestand,
die Gelehrten die Verkehrten, Bittkauf teurer Kauf’ usw.” (125). Auch in unserem
Zusammenhang ist jene andere Auffassung, für welche neuerdings Amann wieder
eingetreten ist (Die menschliche Rede) deshalb nicht störend, weil wir das Abzuleitende
ebensogut auf die unbestrittenen Bildungen wie ‚Ehestand Wehestand’
allein stützen könnten.
1241) Vgl. dazu die Bemerkung von K. Ettmayer, Analytische Syntax der
französischen Sprache, 1934, II Bd., S. 806: „Das allen subjektslosen Sätzen
Gemeinsame ist nicht das Fehlen eines Agens, sondern das Fehlen einer begrifflich
geformten und gestalteten Intuition, eines Dispositionsträgers, der in Erscheinung
zu treten vermag.” — Wenn ich den Terminus „Intuition” recht verstehe, so fällt
er irgendwie mit dem von uns als Situationsmoment beschriebenen Faktor zusammen.
E. bringt interessante Varianten aus dem Altfranzösischen.
1251) Die Abstreifung des anthropomorphistischem Denkens, das in der dominierenden
Verwendung des Aktionsklischees beschlossen liegt, wurde in der alten
aristotelischen Logik durch eine Transformierung aller Sätze mit finitem Verbum
in ist-Sätze angestrebt. Die moderne Logik stellt und erfüllt in diesem Punkte
strengere Anforderungen. Doch das interessiert uns hier nicht weiter.
1261) O. Külpe, Vorlesungen über Logik (1923) griff den gemeinten Unterschied
auf und verfolgte ihn noch etwas schwerfällig durch die drei Bereiche von Begriff,
Urteil und Schluß hindurch. Literaturangaben dort S. 243.
1271) Der Hinweis auf einen ‚falschen Bart’ im Unterschied vom ‚echten’ oder
auf ‚falsches Geld’, den ‚falschen Demetrius’ usw. ist leicht aufzulösen.
1281) K. Bühler, Ausdruckstheorie, S. 44ff. Vgl. auch E. Winkler, Das
dichterische Kunstwerk (Kultur und Sprache III) 1924. — Die Erkenntnis, daß und
wie die dramatische Rede „präsentiert”, wie ich es nennen möchte, ist vielleicht
zum erstenmal ganz scharf von Lessing und dann noch einmal sehr prägnant von
Goethe formuliert worden. Ich entnehme dies einer ausgezeichneten Wienei
Dissertation, die von Arnold angeregt wurde (M. Winkel, Die Exposition des
Dramas 1934). Engel münzte diese Erkenntnis für seine Lehre von der körperlichen
Beredsamkeit des Schauspielers aus. Wir streifen den wichtigen Zug der dramatischen
Präsentation hier nur im Vorbeigehen. Vielleicht wäre historisch und sachlich
mehr darüber zu finden bei E. Hirt, das Formgesetz der epischen, lyrischen und
dramatischen Dichtung (1923), ein Buch, das ich noch nicht- kenne. Das Faktum
als solches ist uns selbst im Fortgang ausdruckstheoretischer Untersuchungen (Filmstudien)
sehr wichtig geworden.
1292) Daß im Traume auch genau das Umgekehrte, nämlich ein Nichtloskommen
von einer Situation oder ein Immerwiederzurückkehren in sie, stattfinden kann,
interessiert uns hier nicht weiter.
1301) P. Kretschmer, Sprache (1927), S. 62.
1311) W. Diemke, Die Entstehung hypotaktischer Sätze. Dargestellt an der
Entwicklung des Relativsatzes in der Sprache der alten Ägypter. Wien. Diss. 1934.
1321) K. Bühler, Die geistige Entwicklung des Kindes, 5. Aufl., S. 402f.
1331) Daß sekundär (selbst bei Relativsätzen) jene merkwürdige Fusion eintreten
kann, die man das Phänomen des άπό κοινού genannt hat, sei angemerkt;
Paul hat diese Fusion ausführlich an seinen erweiterten Sätzen aus dem Mittelhochdeutschen
belegt (138, 140), wo sie häufig war: ich hab ein sünt ist wider euch
(H. Sachs). Doch schon der Eindruck des Ungewöhnlichen beweist, wie scharf sonst
die Symbolfelder getrennt sind.
1341) W. Brandenstein, Kritische Musterung der neueren Theorien des Nebensatzes,
Indog. Forsch. 44 (S. 125).
1352) Nehring, Studien zur Theorie des Nebensatzes. I. Zeitschr. f. vergl.
Sprachforschung 58.
1361) Der Beweis selbst ist nur flüchtig skizziert, so daß es sich nicht lohnt, näher
darauf einzugehen. Der scharfsinnige Marty hat schon genau gesehen, daß die Annahme
einer Entsprechung nicht zutrifft für Kundgabe und Appell. „Denn bei
Äußerungen der Unlust und des Schmerzes ist es offenkundig nur möglich, Mitleid
und Willen zur Hilfe zu erwecken”, also ganz andere psychische Phänomene als die
kundgegebenen. Gewiß ist dem so, und darüber darf man nicht mit einer Handbewegung
hinweggehen. Ebensowenig wie über die Tatsache der entsprechenden
Diskrepanz zwischen Ausdruck und Darstellung. Ich verweise diesen und anderen
Versuchen gegenüber auf das, was oben § 2 gesagt ist über das Organon-Modell
der Sprache.