 Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
Corpus de textes linguistiques fondamentaux
• IMPRIMER
• RETOUR ÉCRAN
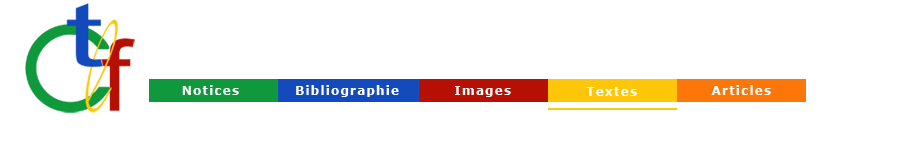
I. Abschnitt.
Einleitung.
§ 1. Stellung, Aufgabe und Methode der Phonetik.
Unter Phonetik oder Lautphysiologie verstehen wir die
Lehre von den Sprachlauten im weitesten Sinne des Wortes,
d. h. von der Erzeugung, dem Wesen, der Verwendung derselben
zur Bildung von Silben, Worten und Sätzen, endlich
von ihrem Wandel und Verfall. Somit bildet dieselbe ein
Grenzgebiet zwischen der Physik, insofern sie sich mit der
rein akustischen Analyse der einzelnen Lautmassen beschäftigt,
der Physiologie, insofern sie die Functionen der zur
Erzeugung und Wahrnehmung der Sprachlaute thätigen Organe
erforscht, endlich der Sprachwissenschaft, insofern
sie über die Natur eines der wichtigsten Objecte derselben
die nöthigen Aufschlüsse ertheilt und damit zugleich ein Mittel
zum Verständniss der durch die historisch-vergleichende Lautlehre
ermittelten Gesetze für den Wandel der Sprachlaute an
die Hand gibt.
Nur für die beiden genannten naturwissenschaftlichen
Disciplinen kann die Erforschung des Werdens und der Natur
der Einzellaute Selbstzweck sein ; für den Sprachforscher
ist die Phonetik nur eine Hilfswissenschaft. Für ihn hat
nicht der einzelne Laut einen Werth, sondern die Lautsysteme
der einzelnen Spracheinheiten, deren Verhältniss zu
einander und ihre allmähliche Verschiebung. Mit andern
Worten, es ist die Aufgabe der Naturwissenschaft, ausgehend
von dem bestehenden, direkt zu beobachtenden Sprachmaterial,
die allgemeinsten Gesetze zu ermitteln und zu formuliren,
welche die unumgängliche Grundlage für den Weiterausbau
unseres Wissenszweiges bilden. Mit diesen grundlegenden
Ermittelungen hat sich der Sprachforscher natürlich
1zunächst bekannt zu machen ; seine eigentliche und höhere
Aufgabe aber ist es, auf Grund derselben die Entwickelung
des jetzt Bestehenden aus dem früher Vorhandenen historisch
zu verfolgen. Diese historische Anwendung der Phonetik
fällt selbstverständlich allein der Sprachwissenschaft zu, denn
nur diese ist zur richtigen Fragestellung gerüstet und im
Stande authentisches Beweismaterial aus vergangenen Sprachperioden
zu liefern.
Von der Erreichung des hiermit der Phonetik gesteckten
Zieles sind wir zur Zeit freilich noch weit genug entfernt.
Die Schuld daran trägt aber grossentheils nur die einseitige
Weise, in der sie bisher oft betrieben worden ist. Die
Sprachforschung hat zu wenig von der Naturwissenschaft und
diese zu wenig von der Sprachforschung gelernt oder lernen
wollen ; und wo wirklich ein gegenseitiger Wissensaustausch
stattgefunden hat, ist er wegen Mangels an Controlfähigkeit
auf Seiten des empfangenden Theiles so vielfach von Missverständnissen
begleitet gewesen, dass die auf diesem Grunde
aufgebauten Theorien wenig oder gar keinen Bestand haben
konnten.
Soll für diese Uebelstände Abhülfe geschafft werden, so
gilt es vor Allem sich von einer Masse von Vorurtheilen zu
befreien, zu denen theils die Schule, theils die praktische
Uebung des Lebens uns hingetrieben hat, und von denen gerade
gelehrte Kreise am allerwenigsten frei sind. In erster
Linie steht unter diesen Vorurtheilen die Meinung, dass allein
in den Schrift- oder Cultursprachen das sprachlich Normale
und Natürliche geboten werde. Die nothwendige Voraussetzung
dieser Lehren, die Einheitlichkeit der Sprachen, besteht
ja überall nur auf dem Papier ; und so müssen, wenn ein
Jeder fortfahren will (wie es bisher fast stets geschehen ist)
den Lautzeichen der Schrift eine willkürliche Aussprache unterzulegen
und diese zur einzigen Grundlage seiner Beurtheilung
fremder Lautsysteme zu machen, eine schliesslich
unzählbare Masse von Standpunkten in den unlöslichsten Conflikt
mit einander gerathen. Und bestünde nun auch wirklich
in einer Cultursprache irgendwo eine grössere Einheit (und
diese könnte erfahrungsgemäss doch nicht anders als durch
künstliche Züchtung auf Grund eines aus einer frühem
Sprachperiode überlieferten Schriftsystems entwickelt sein),
wie könnten aus ihr gewonnene Anschauungen zur Aufklärung
der so oft von der Einheitlichkeit zur Vielfachheit hindrängenden
2Sprachentwickelung dienen ? Dazu kommt noch,
dass die Lautsysteme der einzelnen modernen Cultursprachen
einander zu fern stehn, als dass man aus ihrer Vergleichung
allein mit der erforderlichen Sicherheit allgemeinere phonetische
Sätze ableiten könnte.
Das Hauptgewicht bei aller phonetischen Ausbildung
ist gegenüber solchen einseitigen Auffassungen auf möglichst
reiche persönliche Erfahrung zu legen. Ein gewisses
Quantum von mündlicher Ueberlieferung, sei es aus dem
Munde des Volkes oder eines bereits zuverlässig geschulten
Lehrers, ist durchaus unerlässlich, wenn nicht die ganze
Masse des etwa eingeprägten theoretischen Wissens todt und
unfruchtbar bleiben soll ; denn eine blosse Beschreibung wird
nie im Stande sein, diejenigen Feinheiten eines Lautsystems
oder der Betonung (im weitesten Sinne des Wortes) klar darzulegen,
die den eigentümlichen Charakter einer Sprache
und auch wohl die specielle Richtung ihrer Weiterentwicklung
bestimmen, während das einigermassen vorgebildete Ohr
diese Dinge mit Leichtigkeit aufzufassen vermag.
Den Ausgangspunkt für alle weiteren Studien muss dabei
jedem Beobachter die ihm von Jugend auf geläufige Mundart
bilden. Ist ihm eine eigentliche Volksmundart nicht zugänglich,
so halte er sich wenigstens an die unbefangene, leichte
Umgangssprache der Gebildeten seiner Heimath, nie an den
verkünstelten Jargon der Schule, der Kanzel, des Theaters
oder des Salons. Zu dieser Selbstbeobachtung soll zunächst
die gegenwärtige Schrift eine Anleitung geben. Ist man mit
Berücksichtigung der in ihr vorgezeichneten Gesichtspunkte
zu völliger Klarheit über alle lautlichen Erscheinungen der
eigenen Mundart gekommen, so gehe man zum Studium erst
näher liegender, dann allmählich auch zu dem der ferner stehenden
Mundarten und Sprachen über, und wenn es irgend
angeht, suche man sich eine oder mehrere Mundarten vollkommen
anzueignen.
Ueber die Art, wie man bei diesem fortschreitenden Studium
die Lautsysteme verwandter Mundarten zu betrachten
hat, sind unten namentlich in den Schlussbetrachtungen des
§ 11 einige nähere Andeutungen gegeben. Es sei aber auch
hier schon nachdrücklichst darauf hingewiesen, dass die
Aufgaben der Phonetik nicht durch blosse statistische Betrachtung
von Einzellauten und deren Veränderungen gelöst
werden können. Denn im Allgemeinen ist es nicht der
3einzelne Laut, welcher nach gewissen, überall gültigen Gesetzen
der Veränderung unterliegt, sondern es findet gewöhnlich
eine correspondirende Entwickelung correspondirender
Lautreihen in correspondirender
Stellung statt (vgl. z. B. die gleichmässige Verschiebung
der Tenues-, Medien- und Aspiratenreihe in der germanischen
Lautverschiebung, oder die Umsetzungen ganzer Vocalsysteme
durch Steigerung oder Minderung der specifischen Articulationen
der Vocale u. dgl.) ; ja in der Regel werden sich auch
noch besondere Gesichtspunkte auffinden lassen, welche die
Veränderung einer solchen Lautreihe aus dem Gesammthabitus
des Systems und der speciellen Stellung jener Reihe in
ihm erklären helfen.
Vor allen Dingen suche man sich also einen genauen Einblick
in den Bau jedes zu behandelnden Lautsystemes zu
verschaffen ; man wird gut thun, dabei stets im Auge zu behalten,
dass dieser nicht so sehr durch die Anzahl der zufällig
in ihm zusammengewürfelten Laute an und für sich, als
durch das Verhältniss dieser einzelnen Glieder unter einander
bedingt wird, und dass nicht der allgemeine akustische Eindruck
eines Lautes das Wesentliche bei der Sache ist, sondern
die Art, wie er gebildet wird ; denn das was wir Lautwandel
nennen, ist ja erst eine secundäre Folge der Veränderungen
eines oder mehrerer derjenigen Articulations factoren,
durch deren Zusammenwirken ein Laut erzeugt wird.
Die Erwerbung einer derartigen phonetischen Vorbildung
ist, wie hier von vorn herein betont werden soll,
keine leichte Sache. Sie erfordert eine unermüdliche, ausdauernde
Schulung der Sprachorgane und, namentlich mit
Beziehung auf den zuletzt angeführten Satz, des Gehörs.
Denn einerseits pflegt das Ohr für ihm fremdartige Laute oder
deren Unterschied von den ihm geläufigen stets bis zu einem
gewissen Grade taub zu sein, oder wo wirklich ein Unterschied
wahrgenommen wird, pflegen wir oft Mitteldinge zwischen
den fremden und den eigenen Lauten zu hören, die nur
dadurch entstehen, dass die Vorstellung der eigenen Laute
mit den entsprechenden gehörten fremden zusammenschmilzt.
Andererseits laufen wir bei der nun einmal erworbenen Unempfindlichkeit
des Gehörs für kleinere Verschiedenheiten im
Klange der Laute oft Gefahr, fremden Lauten, die man nur
mit dem Gehör erfassen kann, solche Articulationen zuzuschreiben,
mit denen man bei dem Versuche der Nachbildung
4dem akustischen Effekt derselben einigermassen nahe kommt,
obwohl oft genug diese eigenen Articulationen den fremden
nicht entsprechen. Ein jeder solcher Fehler in der Auffassung
und Zergliederung eines Lautes in seine Articulationsfactoren
muss natürlich das System in Verwirrung bringen und den
Nutzen der Phonetik illusorisch machen. Man wird also
erst dann sagen dürfen, dass ein vorläufiger Abschluss in der
phonetischen Vorbildung nach dieser Richtung hin erreicht
ist, wenn es dem Beobachter gelingt, jeden fremden Laut, womöglich
auch nach dem Gehöre allein, richtig zu erfassen und
nach seiner Stellung im eigenen wie nach seinem Verhältniss
zu entsprechenden Lauten anderer Systeme zu charakterisiren.
Die landläufige Grammatik nimmt gewöhnlich von den
Buchstaben oder Lauten ihren Ausgang und steigt von da
zu der Betrachtung der Silben, Wörter und Sätze auf. Es
ist aber von selbst einleuchtend, dass eine streng systematisch
vorgehende Phonetik bei der Untersuchung des Satzes beginnen
müsste, denn der Satz allein ist ein in der gesprochenen
Sprache selbst gegebenes, direkt zu beobachtendes Object ;
das Wort, die Silbe, der Einzellaut aber nehmen gar oft im
Satze verschiedene Gestalt an, und der Einzellaut pflegt in
der absoluten Form, wie ihn uns die Grammatik vorzuführen
gewohnt ist, häufig gar nicht einmal isolirt in der Sprache zu
existiren. So sollte also zunächst der Satz untersucht werden,
mit allen denjenigen Veränderungen, die er beim mündlichen
Ausdruck erfahren kann (z. B. denjenigen, welche derselbe
Satz erleidet, wenn er als einfache Aussage, als Ausrufs-, als
Fragesatz etc. verwandt wird, u. a. m.). Erst nachdem man
gelernt hat, diesen veränderlichen Eigenschaften des Satzes
Rechnung zu tragen, sollte man zur Zerlegung des Satzes
selbst fortschreiten, d. h. zur Untersuchung der einzelnen
Sprachtakte (§ 33) und der Silben als Glieder dieser
Sprachtakte ; daran erst hätte sich dann die Analyse der Silben
als solcher und die ihrer Einzellaute anzuschliessen.
Was sich dann am Ende als Definition des Einzellautes ergibt,
ist schliesslich doch nur eine zum guten Theil von willkürlich
gewählten Gesichtspunkten abhängige Abstraction von den
vielfach veränderlichen Gestalten, unter denen derselbe sogenannte
Einzellaut im Satze auftreten kann. Aus praktischen
Gründen pflegt man aber auch beim Studium der Phonetik
von den einfachsten Elementen zu den complicirteren Gebilden
fortzuschreiten, und diese allgemein angenommene
5Methode ist auch in dem vorliegenden Werke festgehalten
worden. Will man sie aber befolgen, so muss man, wie schon
aus dem Gesagten sich ergibt, sich stets die wichtige Thatsache
vergegenwärtigen, dass wir mit den wenigen Dingen,
die wir von dem künstlich isolirten Einzellaut aussagen
können, noch keineswegs das Wesen desselben in der lebendigen
Sprache erschöpft haben. Jedenfalls ist die Aufstellung
eines blossen Lautsystemes, so wichtig sie an sich ist, doch
immer nur eine der elementarsten Thätigkeiten des Phonetikers,
in dessen Bereich die gesammten Erscheinungsformen
der gesprochenen Sprache fallen. Man beruhige sich also
nicht bei dem Studium der Laute an sich, sondern prüfe,
immer zunächst wieder an der Hand der Muttersprache, eben
so genau die Silben-, Takt- und Satzbildung. Alle so erworbenen
Kenntnisse erprobe man dann weiter zunächst an der
Behandlung lebender Sprachen und Mundarten, und erst
wenn man sich hier völlig gerüstet findet, gehe man zur Anwendung
der phonetischen Kriterien zur Erläuterung älterer
Sprachzustände und ihrer allmählichen Veränderung bis zu
ihren modernen Repräsentanten über.
§ 2. Allgemeine akustische Sätze.
1. Unter dem Namen Schall fassen wir sämmtliche vermittelst
der Gehörorgane und nur vermittelst dieser wahrgenommenen
äusseren Eindrücke zusammen. Schall entsteht
dadurch, dass ein elastischer Körper in rasche hin- und her- gehende
Bewegung (Schwingungen) versetzt wird. Diese
Bewegung theilt sich zunächst den den Körper umgebenden
elastischen Medien (in weitaus den meisten Fällen der Luft)
mit und wird von diesen wieder auf gewisse Theile des Gehörorganes
übertragen, welche nun ihrerseits durch Reizung der
Gehörnerven in uns die Empfindung des Schalles hervorrufen.
Die Fortpflanzung der Schallbewegung geschieht in der Form
von Wellen (Schallwellen).
2. Der erste und Hauptunterschied verschiedenen Schalles,
den unser Ohr auffindet, ist der Unterschied zwischen Geräuschen
und musikalischen Klängen. Die Empfindung
eines Klanges wird durch schnelle periodische Bewegungen
der tönenden Körper hervorgebracht, die eines Geräusches
durch nicht periodische Bewegungen. Unter einer
6periodischen Bewegung verstehn wir dabei eine solche, welche
nach genau gleichen Zeitabschnitten immer in genau derselben
Weise wiederkehrt.
3. Geräusche lassen sich nicht weiter akustisch classificiren ;
dagegen unterscheidet man musikalische Klänge nach
ihrer Stärke, ihrer Tonhöhe und ihrer Klangfarbe.
Die Stärke wächst und nimmt ab mit der Weite, Amplitude
der Schwingungen des tönenden Körpers, die Tonhöhe
mit der Schnelligkeit, mit der die einzelnen Schwingungen
auf einander folgen, oder, was dasselbe ist, mit der Anzahl der
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (einer Secunde) gemachten
Schwingungen, der Schwingungszahl. Die Klangfarbe,
das Timbre endlich hängt ab von der Zusammensetzung
des Klanges.
4. Die durch einfache Pendelschwingungen hervorgerufene
Klangempfindung nennt man einen (einfachen) Ton.
Solche einfache Töne geben von den gebräuchlichen musikalischen
Instrumenten fast nur die Stimmgabeln. Alle übrigen
erzeugen nur Klänge im engern Sinne, d. h. Zusammensetzungen
aus einfachen Tönen.
5. Jeder Klang besteht aus einer Reihe von Tönen (Theiltönen,
Partialtönen), deren Schwingungszahlen sich wie
1, 2, 3, 4 etc. verhalten. Den tiefsten Theilton nennt man den
Grundton ; nach ihm wird die Tonhöhe bemessen ; die übrigen
Theiltöne heissen auch die (harmonischen) Obertöne.
Dem ungeübten Ohre verschmelzen die Theiltöne eines
Klanges leicht zu einer durchaus einheitlichen Empfindung ;
doch kann man die Coexistenz derselben in dem Klange durch
Hülfsapparate (Resonatoren) leicht nachweisen.
6. Die Farbe eines Klanges hängt nach 3. und 5. ab
von der verschiedenen Anzahl und Stärke seiner Theiltöne.
Sie kann also durch Verstärkung, Schwächung oder gänzliche
Eliminirung eines oder mehrerer Theiltöne willkürlich verändert
werden. Hierzu bietet sich ein Hauptmittel in der
Resonanz.
7. Jeder überhaupt zur Klangerzeugung fähige Körper hat
einen Eigenton (z. B. also eine Saite eines Streichinstrumentes
oder eines Clavieres, aber auch jeder begrenzte Luftraum).
Wird nun ein Körper von den Schallwellen eines Klanges
getroffen, in welchen ein dem Eigenton des Körpers gleicher
oder doch nahezu gleicher Theilton enthalten ist, so wird der
7Körper zum Mittönen erregt. Dadurch wird der betreffende
Theilton verstärkt, und infolge davon auch die Farbe des gesammten
Klanges modificirt.
Je elastischer der zum Mittönen bestimmte Körper ist, um
so besser ist er für seinen Zweck geeignet. Insonderheit sind
daher begrenzte Lufträume, Resonanzräume, dazu anwendbar.
Diese haben aber zugleich noch die Eigenschaft,
den Durchgang von Tönen, die nicht mit dem Eigen tone des
Hohlraumes zusammenfallen, mehr oder weniger verhindern,
d. h. diese Töne, falls sie durch den Hohlraum durchgeleitet
werden sollen, dämpfen zu können.
Es versteht sich von selbst, dass auch die unharmonischen
Töne, aus denen ein Geräusch zusammengesetzt ist, der Verstärkung
durch Resonanz und der Dämpfung fähig sind.
Derartige Resonanzräume von veränderlicher Gestalt und
veränderlichem Rauminhalt werden bei den meisten Blasinstrumenten
verwandt. Man pflegt sie in dieser Anwendung
mit dem Namen Ansatzrohr zu-bezeichnen, weil sie meistens
mit der Schallquelle direkt verbunden sind. Eine ebensolche
Verbindung einer Klangquelle mit einem Ansatzrohr,
das der mannigfaltigsten Umgestaltung (d. h. der vielfältigsten
Modulation eines hindurchgeleiteten Klanges) fähig ist
und innerhalb dessen zugleich wieder Geräusche verschiedenster
Art erzeugt werden können, bietet das menschliche
Sprachorgan dar, dessen Einrichtung und wesentlichste Functionen
die folgenden §§ besprechen werden.
§ 3. Das menschliche Sprachorgan.
Das menschliche Sprachorgan besteht aus drei wesentlich
verschiedenen Theilen mit wesentlich verschiedener Function :
dem Respirationsapparat, dem Kehlkopf und dem dem letzteren
vorgelagerten Ansatzrohr.
Die Aufgabe des Respirationsapparates ist die Herstellung
des zur Erzeugung von Sprachlauten nothwendigen,
aber noch nicht selbst schallbildenden Luftstromes ; Kehlkopf
und Ansatzrohr dienen durch ihre Articulationen
entweder gleichzeitig oder unabhängig von einander zur Bearbeitung
dieses Luftstromes ; und zwar erregt der Kehlkopf
denselben in der Regel zum Tönen, nur in einzelnen Ausnahmefällen
(nämlich bei der Bildung des h und des Spiritus
8lenis, vgl. § 17, sodann aber regelmässig beim Flüstern) zur
Hervorbringung von blossen Geräuschen ; das Ansatzrohr
aber wird entweder zur Modification der im Kehlkopf erzeugten
Klänge resp. Geräusche, oder aber zur Hervorbringung
selbständiger, von der Thätigkeit des Kehlkopfs unabhängiger
Geräusche verwandt. Es ist von grosser Wichtigkeit, von.
vorn herein sich dieses Functionsunterschiedes deutlich bewusst
zu werden, da er die unentbehrliche Grundlage für das
Verständniss der Bildung und also auch der Eintheilung der
Sprachlaute ist.
Anm. 1. Zur Veranschaulichung des Gesagten achte man auf die verschiedene
Thätigkeit der einzelnen Organe, während man die Sprachlaute,
die man von Jugend auf zwanglos zu bilden gelernt hat, in systematischer
Anordnung nach einander ausspricht. Man kann hierbei dem ungeübten
Ohre durch das Gefühl zu Hülfe kommen, indem man einen Finger auf
den Kehlkopf legt (Kempelen 232). Jedesmal wenn die Stimmbänder
tönen, geräth der Kehlkopf in deutlich fühlbare zitternde Schwingungen.
Diese wird man z. B. bei allen Vocalen und den Nasalen leicht wahrnehmen
(bei diesen Lauten dient das Ansatzrohr nur zur Modification). Dagegen
ist es alsbald einleuchtend, dass z. B. bei k, t, p ; ch, s, f innerhalb
des Ansatzrohres selbst ein Geräusch gebildet wird ; der Kehlkopf bleibt
während der Bildung dieser Laute ganz ruhig. Er geräth aber sofort wieder
in das charakteristische Zittern, wenn man die sog. tönenden Mediae
g, d, b oder sog. weiches s (franz. engl. z) oder franz. engl. v ausspricht.
Für die Selbstbeobachtung ist vielleicht das beste Verfahren, sich beide
Ohren fest zu verstopfen ; auch der leiseste Klang des Kehlkopfes gibt
sich dann als ein ganz charakteristisches lautes Schmettern im Ohre zu erkennen,
während die Geräusche der Mundhöhle keine wesentliche Aenderung
erfahren. Für die Beobachtung anderer empfiehlt sich die Anwendung
eines Kautschukschlauches, dessen eines Ende in den Gehörgang
eingepasst wird, während man das andere, zur Auffangung der Schallwellen
mit einem kleinen Glastrichter versehen, vor den Mund (resp. bei
Nasalen vor die Nasenöffnung) führt. Man kann dann sehr leicht und
deutlich unterscheiden, ob ein beliebiger Laut bloss aus Klängen oder
aus Geräuschen oder aus beiden zugleich besteht. Zur Controle der Kehlkopfthätigkeit
kann man auch den Trichter, wie beim Auscultiren, luftdicht
auf den Kehlkopf aufsetzen (vgl. Brücke, Wiener Sitz.-Ber.,
math.-naturw. Cl. XXVIII, 69 f.).
Anm. 2. Auch das Ansatzrohr kann zur Erzeugung von Klängen benutzt
werden ; dies geschieht z. B.beim Pfeifen. Diese Klänge kommen
aber in der Sprache nicht zur Verwendung ; für diese ist also die Beschränkung
der Thätigkeit des Ansatzrohres auf die Bildung von eigenen
Geräuschen und die Modification der Kehlkopfklänge resp. -geräusche
streng festzuhalten.
Was den Bau der einzelnen Theile des Sprachorgans betrifft,
so ist ein näheres Eingehn auf die Construction des
Respirationsapparates für die Zwecke der Sprachwissenschaft
nicht erforderlich (über seine Function wird § 4, 2 das
9Wesentlichste beibringen) ; unerlässlich ist dagegen das Studium
des Kehlkopfs und des Ansatzrohres. Da aber eine detaillirte
Beschreibung dieser Theile ohne zahlreiche Abbildungen
doch eher verwirrend als aufklärend wirken würde,
so sollen hier nur die hauptsächlichsten Punkte angegeben
werden, die für das Verständniss der Lautbildung in Betracht
kommen. Wir beginnen mit dem Kehlkopf.
1. Der Kehlkopf (larynx) besteht der Hauptsache nach
aus folgenden beweglichen Theilen. Auf der Luftröhre (trachea),
welche den Zutritt der Luft zu den Lungen vermittelt,
ruht als ihr oberstes abschliessendes Glied und als Träger des
ganzen Kehlkopfs der Ringknorpel (cartilago cricoidea).
Er hat ungefähr die Gestalt eines Siegelringes, dessen breite,
plattenförmige Fläche nach hinten gekehrt ist. Ueber ihm
ruht der Schildknorpel (cartilago thyreoidea, der Adamsapfel
nach unserer vulgären Bezeichnung). Dieser besteht
aus zwei etwa viereckigen Platten, die nach vorne unter einem
Winkel an einander gelehnt sind und so eine auch von aussen
leicht fühlbare Kante bilden. Nach hinten zu klaffen diese
beiden Flügel soweit auseinander, dass sie die Platte des Ringknorpels
zwischen sich aufnehmen können. Die hinteren
Kanten der Flügel laufen nach oben zu je in einen hornförmigen
Fortsatz aus. Vermittelst dieser Hörner hängt der
Schildknorpel zusammen mit dem Zungenbein (os hyoideum),
einem Knochen von der Gestalt eines Hufeisens, dessen
Oeffnung wie die des Schildknorpels nach hinten zu liegt.
Das Zungenbein gehört bereits nicht mehr zum Kehlkopf,
doch bildet es für diesen wie der Ringknorpel eine Hauptstütze.
Anm. 3. Ueber die Lage der drei besprochenen festen Theile kann
man sich leicht durch Betasten des Kehlkopfes unterrichten. Geht man
auf der vorderen Kante des Schildknorpels (des Adamsapfels also) mit der
Fingerspitze aufwärts, so gelangt man über eine nachgibige Stelle hinweg
auf den nach vorn zu liegenden Bogen des Zungenbeins, dessen beide
Arme sich dann ziemlich weit nach rechts und links verfolgen lassen.
Geht man umgekehrt auf dem Grat des Schildknorpels abwärts, so stösst
man auf den vordem schmalen Rand des Ringknorpels, der sich durch
seine grössere Widerstandsfähigkeit gegen den Druck leicht von den sich
unten an ihn anschliessenden Knorpelringen der Luftröhre unterscheiden
lässt.
Der durch Ring- und Schildknorpel umschlossene Hohlraum
ist durch Muskeln und Schleimhäute derartig ausgekleidet,
dass man das Ganze als eine Röhre betrachten kann, aus
10deren Hinterwand ein Stück herausgeschnitten ist. Auf der
Basis dieses Ausschnittes, d. h. also auf dem obern Rande der
Platte des Ringknorpels, sind zwei kleine Knorpel von dreieckiger
Grundfläche verschiebbar und drehbar befestigt, die
Giessbeckenknorpel (auch Giesskannenknorpel,
Stellknorpel, cartilagines arytaenoideae) Von den drei
Ecken ihrer Grundfläche springt je eine in den Hohlraum der
Röhre vor ; sie wird bezeichnet als der Stimmfortsatz (processus
vocalis) ; die beiden andern sind für uns gleichgültiger.
Von diesen Fortsätzen aus ziehen sich von hinten nach vorn
quer durch die Röhre hindurch zwei mit Schleimhaut überkleidete
Muskelbündel, die Stimmbänder (chordae vocales).
Nach vorn zu sind dieselben unmittelbar neben einander in
der Höhlung des Schildknorpels angeheftet, nach rechts und
links laufen sie in die Seitenwände der Röhre aus. Diese wird
also durch die von beiden Seiten aus vorspringenden Stimmbänder
bis auf einen Spalt von wechselnder Breite verengt,
die Stimmritze (glottis, auch glottis vera im Unterschied
von der nachher zu nennenden glottis spuria). Die Glottis
zerfällt wieder in zwei Abschnitte, die Bänderglottis oder
die eigentliche Stimmritze, d. h. das Stück zwischen der vordem
Insertion im Schildknorpel und den processus vocales,
und die Knorpelglottis oder Athemritze, d. h. den Raum
zwischen den einander zugekehrten Innenflächen der Giessbeckenknorpel.
Durch Drehung und Verschiebung dieser
letztern kann die Gestalt der Stimmritze dergestalt variirt
werden, dass entweder beide Theile geöffnet oder beide geschlossen
oder nur die Bänderglottis geschlossen ist. Ausserdem
können die Stimmbänder durch besondere Muskeln verlängert
oder verkürzt und in verschiedenen Graden gespannt
werden.
Die Stimmritze bildet also die erste Einengung, die sich
dem aus den Lungen ausgetriebenen Luftstrom entgegenstellt.
Unmittelbar über derselben erweitert sich der Kehlkopf wieder
zu zwei häutigen Taschen (ventriculi Morgagni), deren obere
Begrenzung abermals durch zwei in den innern Raum vorspringende
Bänder von mehr wulstiger Gestalt gegeben wird,
die Taschenbänder (falschen Stimmbänder). Sie
unterscheiden sich von den Stimmbändern besonders dadurch,
dass sie keinen eigenen Muskel enthalten und dass sie weiter
von einander abliegen, also auch nicht zur Schallerzeugung
verwandt werden. Den spaltförmigen Zwischenraum zwischen
11ihnen findet man bisweilen mit dem Namen der falschen
Stimmritze (glottis spuria) bezeichnet. Auch er ist wie die
Stimmritze, nur nicht in demselben Grade, der Verengerung
und Erweiterung, ja selbst des partiellen Verschlusses fähig.
Endlich gehört zum Kehlkopf noch der Kehldeckel
(epiglottis), ein platter Knorpel von birnförmiger Gestalt, der
mit seiner schmalen Spitze unmittelbar über der vorderen Insertion
der Stimmbänder am Schildknorpel angeheftet ist und
dessen oberer, breiter Theil wie eine Klappe über die obere
Oeffnung des Kehlkopfes hinausragt. Durch einen besondern
Muskelapparat kann diese Klappe mehr oder weniger geneigt
oder auch vollständig auf die Oeffnung des Kehlkopfes niedergedrückt
werden.
Anm. 4. Die oberen Theile des Kehlkopfes, von den Stimmbändern an
gerechnet, kann man auch am lebenden Individuum vermittelst des Kehlkopfspiegels
untersuchen, d. h. eines kleinen runden oder eckigen
Spiegelchens, das an einem Stiele unter einem Winkel von etwa 45° in den
über dem Kehlkopf liegenden Theil des Mundraumes eingeführt wird. Zur
Selbstbeobachtung genügt ausser einem solchen Spiegelchen noch ein kleiner
Handspiegel, der das Bild des Kehlkopfs nach dem Auge des Beobachters
reflectirt, und eine hellbrennende Lampe, deren Cylinder rings mit
einem Schirm umgeben ist, der nur durch eine dem Munde zugewandte
Oeffnung die Strahlen der Lampe durchdringen lässt. Ausführlichere Angaben
über die Handhabung des Instrumentes s. u. A. bei Czermak. Der
Kehlkopfspiegel, 2. Aufl., Leipzig 1863 (z. Th. wiederholt aus den Wiener
Sitz.-Ber., math.-naturw. Cl. XXIX (1858), 557—584).
2. Unter dem Namen Ansatzrohr fassen wir alle die
dem Sprachorgan zugehörigen und oberhalb der Stimmritze
liegenden Hohlräume zusammen. Von diesen gehört der
kleinste, der Kehlraum, noch dem Kehlkopfe selbst an ;
es ist das nach oben durch den Kehldeckel, nach unten durch
die Stimmbänder begränzte Stück desselben. lieber ihm befindet
sich der Rachenraum, welcher seinerseits nach vorn
und oben in die beiden wichtigsten Theile des Ansatzrohrs,
den Mundraum oder die Mundhöhle und die Nasenräume
oder die Nasenhöhlen übergeht. Seine Abgrenzung
gegen den ersteren ergibt sich ungefähr durch die Stellung
des weichen Gaumens (s. unten S. 14) bei der Aussprache
des gutturalen n (s. § 13 und 8, 2, 3), die gegen die
Nasenhöhlen durch die Stellung des Gaumens bei der Aussprache
der nicht nasalirten Vocale.
Kehlraum und Rachenraum (die man auch wohl unter dem
Namen Kehlraum oder Schlundkopf zusammenfasst)
werden bei der Bildung aller Sprachlaute von dem schallerzeugenden
12Luftstrome passirt. Ihre Gestaltveränderungen
sind nicht allzu erheblicher Art, und können hier um so eher
übergangen werden, als sie bei weitem nicht in dem Grade
wie die übrigen Theile des Ansatzrohres die Sprachlautbildung
beeinflussen. Mund- und Nasenraum können dagegen einerseits
beim Sprechen entweder einzeln oder gemeinschaftlich
je nach Willkür in Anspruch genommen werden, andererseits
verlangt die bedeutende Einwirkung, welche Combination
oder Nichtcombination dieser Theile sowie die Gestaltveränderungen
des Mundraumes auf die Sprachlautbildung ausüben,
hier ein etwas detaillirteres Eingehen.
Die Mundhöhle ist der complicirteste Theil des ganzen
Ansatzrohres ; sie ist aber zugleich auch am leichtesten zu studiren,
da alle ihre Theile mit blossem Auge, bei Selbstbeobachtung
mit Hülfe eines gewöhnlichen Spiegels, leicht zu
überschauen sind.
Im Allgemeinen ist zunächst daran zu erinnern, dass der
Mundraum zwischen dem unbeweglichen Oberkiefer und dem
beweglichen Unterkiefer eingeschlossen liegt. Hebung oder
Senkung des letzteren verursacht je nach ihrem Grade wesentliche
Veränderungen des Rauminhaltes wie der Form der
Mundhöhle. Die Mannigfaltigkeit derselben wird sodann noch
vermehrt durch die Bewegungen der an Ober- und Unterkiefer
angehefteten selbständig beweglichen Weichtheile, nämlich
des weichen Gaumens, der Zunge und der Lippen. Aus
Rücksichten auf die Anschaulichkeit beginnen wir die Einzelbeschreibung
mit den letztgenannten.
Ueber Form und Bewegungen der Lippen lehrt die einfache
Anschauung alles Nöthige. Insbesondere aber ist bei der
Beobachtung der Lippenthätigkeit das Augenmerk auf die
verschiedenen Stärkegrade ihrer Betheiligung bei
der Sprachlautbildung zu richten. Im Einzelnen präge man
sich genau die Gestaltungen der Mundöffnung bei der Bildung
der verschiedenen Laute ein. Hierbei sind neben der bloss
durch die Bewegungen des Unterkiefers bedingten mehr oder
weniger weiten Oeffnung, wie sie etwa beim a erscheint,
namentlich noch zu merken die spaltförmige Ausdehnung
(durch Zurückziehen der Mundwinkel, Heyse 31), wie beim
hellen i, und die Rundung, d. h. eine entweder durch Aufeinanderpressen
der seitlichen Theile der Lippen oder durch
Einziehung der Mundwinkel oder durch beides zugleich bedingte,
mehr oder weniger ringförmige oder ovale Verengung
13der Mundöflhung, wie bei u, o, endlich die (immer mit geringer
Rundung verbundene) Vorstülpung, die man ebenfalls
bei der Bildung des u oder gewisser Arten von sch beobachten
kann.
Anm. 5. Bei der Beobachtung der Bildung der einzelnen Sprachlaute
pflegt sich unwillkürlich die Aufmerksamkeit auf die Thätigkeit der
Zunge und des Kehlkopfs zu concentriren, und man geräth dabei leicht in
Gefahr, die der Lippen ganz zu übersehen. Vor diesem Fehler ist aber
um so eindringlicher zu warnen, als die Lippenthätigkeit insbesondere bei
der Vocalbildung eine sehr bedeutende Rolle spielt. So beruht, um nur
eins gleich hier anzuführen, der eigentümliche Klangcharakter des englischen
Vocalismus wesentlich auf der geringen Theilnahme der Lippen an
der Sprachlautbildung (wie es denn in England eine ausgesprochene Anstandsregel
ist, die Lippen beim Sprechen möglichst wenig zu bewegen).
Für manche deutsche Mundarten ist die starke Vorstülpung der Lippen
bei der Rundung charakteristisch, so dass ein Deutscher leicht zu der
Meinung geführt werden kann, als seien Rundung und Vorstülpung im
wesentlichen eine einheitliche Handlung. Aber das Schwedische zeigt
z. B. sehr starke Verengungsgrade bei dichter Anpressung der Lippen an
die Zähne, es erscheint also dort die Contraction durchaus unabhängig von
der Vorstülpung, auch dem Englischen geht die Vorstülpung fast ganz ab,
ohne dass dieser Sprache deshalb die Rundung fehlte.
Hinter den Lippen bilden die Zähne eine abermalige
Verengung des Ansatzrohres, welche unter Umständen für die
der Lippen vicarirend eintreten kann.
Verfolgt man nun von der Innenseite der Oberzähne beginnend
mit der Fingerspitze die obere Wandung der
Mundhöhle, so gelangt man zuerst an eine kleine nach innen
zu convexe Wölbung, die Alveolen der Oberzähne. An
diese schliesst sich der nach innen concav gewölbte harte
Gaumen, der etwa soweit rückwärts reicht wie die beiden
Zahnreihen. Ist man mit dem Finger bis zu dieser Grenze
fortgeschritten, so fühlt man, wie an die Stelle des harten
Gaumendaches plötzlich eine weiche, dem Drucke nachgebende
Muskelplatte tritt. Dies ist der weiche Gaumen
oder das Gaumensegel (velum palati). Man kann dasselbe
in seiner ganzen Ausdehnung am bequemsten übersehen, wenn
man ein recht breites ä ausspricht und wo möglich die Zungenspitze
aus dem Munde hervorstreckt ; hierbei sieht man, wie
das Gaumensegel nach hinten zu durch einen bogenförmigen
Muskel, den hintern Gaumenbogen (Schlundgaumenbogen,
arcus pharyngopalatinus) begrenzt wird, dessen
untere Enden nach dem Pharynx zu verlaufen. Durch die von
diesem Bogen freigelassene Oeffnung hindurch erblickt man
die hintere Rachen wand. Ungefähr in seiner Mitte ist das
14Gaumensegel von einem zweiten, nur stärker gewölbten Bogenmuskel
durchzogen, dem vordem Gaumenbogen
(Zungengaumenbogen, arcus glossopalatinus), dessen
beide senkrechten Pfeiler seitwärts in die Zunge verlaufen.
Zwischen den beiden Gaumenbögen liegen seitlich die Mandeln
(tonsillae), und von der höchsten Wölbung des vordem
Gaumenbogens herab zieht sich nach dem hintern Gaumenbogen
hin und über diesen noch etwas hinausragend das
Zäpfchen (uvula).
Die Bewegungen des Gaumensegels sind einfach ; es kann
entweder nach vorn gezogen werden, bis zum Zungenrücken
hin (dies geschieht z. B. bei der Aussprache des gutturalen n),
oder nach rückwärts an die hintere Rachenwand gepresst
werden (z. B. bei der Aussprache der Vocale), wobei es zugleich
mehr oder weniger gehoben wird. Im ersteren Falle
sperrt es, wie schon oben bemerkt, den Rachenraum vom
Mundraum, im letztern vom Nasenraume ab. Beim ruhigen
Athmen und bei der Aussprache von nasalirten Lauten hängt
es freischwebend zwischen Zungenrücken und Rachenwand,
so dass Mund- und Nasenraum ein Continuum, oder doch
mindestens zwei communicirende Hohlräume darstellen.
Auf der untern Seite des Mundraumes begegnen wir
von den Lippen nach innen fortschreitend zunächst wieder
einer Zahnreihe, sodann der Zunge, welche nach vorn zu in
eine freiliegende, weniger massige Spitze ausläuft. An ihren
rückwärtsliegenden, absteigenden Theil schliesst sich der
Kehldeckel (s. S. 12) an, den man leicht fühlen kann, wenn
man eine Fingerspitze auf dem Rücken der Zunge abwärts
führt.
Die Bewegungen der Zunge werden, da sie fast sämmtlich
zur Articulation von Sprachlauten dienen, erst später im Einzelnen
besprochen werden.
Anm. 6. Um zum Verständniss der complicirten Bewegungen der
Zunge zu gelangen, ist es sehr Tathsam sich einige Kenntniss von ihrer
Muskulatur zu verschaffen. Hierbei kommen zunächst die beiden Wurzeln
der Zunge in Betracht. Die vordere Zungenwurzel (musculus genioglossus)
setzt an der innern Seite des Unterkiefers an und zieht die Zunge durch
ihre Contraction nach vorn ; die hintere Zungenwurzel (musculus hyoglossus)
ist am Zungenbein (s. S. 10) angeheftet und zieht die Zunge nach hinten
und unten. Ausserdem besitzt die Zunge noch einen obern Längsmuskel,
der die Zungenspitze nach oben gegen den harten Gaumen hebt,
und einen untern Muskel, der sie gegen die untern Schneidezähne senkt ;
ferner quere und senkrechte Muskelfasern, welche die Zunge ganz oder
stellenweise verschmälern, verlängern, hügelförmig aufheben oder umgekehrt
15verbreitern, verkürzen und aushöhlen können. Endlich besteht noch
ein vielfach zusammengesetztes Muskelsystem, welches die Zunge in ihrem
vorderen, mittleren oder hinteren Theile hebt oder senkt.
Ueber dem Mundraum liegt seiner ganzen Länge nach der
rings von festen Wänden umschlossene, also unveränderliche
Nasenraum. Vom Mundraume scheiden ihn der harte und
der weiche Gaumen (das Gaumensegel), welcher letztere je
nach seiner Stellung die Communication zwischen beiden verhindert
oder gestattet. Charakteristisch ist für den Nasenraum,
dass er in zwei Mündungen, die Nasenlöcher, endigt
und dass diese nicht wie die Mundöffnung verschlossen werden
können.
Das gesammte Ansatzrohr besteht hiernach im Wesentlichen
aus drei Theilen, deren Communicationen unter einander
durch zwei klappenartige Verschlüsse regulirt werden
können : dem Kehlraum nebst dem zugehörigen Kehldeckel,
und Mund- und Nasenraum, denen als gemeinschaftliche
Klappe der weiche Gaumen dient ; den Verkehr mit der äussern
Luft reguliren die Lippen.
Anm. 7. Von allen in diesem § besprochenen Theilen des Sprachorgans
verlangen die sichtbaren das genaueste Studium ; eine vollständige
und sichere Kenntniss der Theile des Mundraums und ihrer Bewegungen
ist ganz unerlässlich. Man beginne also mit dem Studium des Mundraumes,
sodann versuche man mittelst des Kehlkopfspiegels einen Einblick in den
Kehlkopf zu gewinnen, und endlich orientire man sich über den innern
Bau des ganzen Organs womöglich durch das Studium anatomischer Präparate,
sei es vom menschlichen, sei es vom thierischen Körper. — Von
ausführlicheren Beschreibungen, wie sie sich fast in jedem anatomischen
oder physiologischen Handbuch finden, nenne ich hier nur als für die
Zwecke des Sprachstudiums besonders empfehlenswerth (auch wegen der
Abbildungen) die von Merkel, Laletik S. 5—36, auf welche auch die hier
gegebene Darstellung vielfach zurückgeht ; die neuere Literatur s. bei
Grützner 38 ff.
§ 4. Die Functionen der Sprachorgane im Allgemeinen.
(Indifferenzlage. Respiration. Die Stimmregister. Schallbildende
und schallmodificirende Articulationen.)
1. Die Indifferenzlage der Sprachorgane.
1. Die Indifferenzlage der Sprachorgane. Während
des ruhigen Ein- und Ausathmens ist die Respiration
einer willkürlichen Einwirkung von Seiten des einzelnen Individuums
in der Regel nicht unterworfen. Das Ansatzrohr
und der Kehlkopf befinden sich vielmehr dabei in einer Stellung,
welche ein möglichst ungehemmtes, geräuschloses
Durchströmen der Luft ermöglicht. Wir nennen diese Lage
16die Ruhelage oder Indifferenzlage. Solange die genannten
Sprachorgane in ihr verharren, ist es unmöglich einen
Sprachlaut hervorzubringen ; damit dies geschehe, muss wenigstens
ein Theil derselben aus der Ruhelage herausbewegt
und dem Respirationsstrom als Hemmniss entgegengestellt
werden, oder mit andern Worten, es muss eine Articulation
stattfinden. Es folgt hieraus von selbst, dass alle Untersuchungen
über Sprachlautbildung in gewisser Hinsicht von
der Untersuchung der Ruhelage der Organe ausgehen müssen,
und dass es demnach die erste Aufgabe des Beobachters sein
muss, sich der Lagerung der einzelnen Theile, namentlich
des Ansatzrohres, klar bewusst zu werden und sein Muskel- und
Tastgefühl bezüglich dieser Theile dergestalt zu üben,
dass er jede Bewegung alsbald bemerkt und nach ihrer Richtung,
Stärke u. s. w. abschätzen lernt.
Die wesentlichsten Momente für die Stellung der Organe
im Indifferenzzustande sind folgende : Die Stimmritze ist in
ihren beiden Theilen weit geöffnet, das Gaumensegel hängt
schlaff herab, sodass der Respirationsstrom sowohl durch den
Mund wie durch die Nase geführt wird ; die Zunge liegt
schlaff in der Mundhöhle, welche sie zum grossen Theile ausfüllt ;
die beiden Kiefer sind massig von einander entfernt,
die Lippen endlich sind ein wenig spaltförmig geöffnet. Wie
man sieht, ist dies die Lage der Organe, wie sie Jedermann
beim ruhigen Schlaf und Kindern überhaupt beim Athmen
eigen ist ; ausserdem pflegen die Lippen geschlossen zu werden,
ohne dass deshalb eine wesentliche Umlagerung der übrigen
Partien stattfindet.
Anm. 1. Genauere Angaben lassen sich, namentlich was die Stellung
der Zunge betrifft, nicht geben, weil hier zu viel individuelle Abweichungen
in Frage kommen. Diese zu bestimmen ist die Sache des einzelnen
Beobachters.
2. Die Respirationsverhältnisse.
2. Die Respirationsverhältnisse. In dem oben
Gesagten ist bereits enthalten, dass die gewöhnliche Athmung
von dem Begriffe der Articulation auszuschliessen ist, da sie,
zwar an sich ebenfalls geregelt, doch auch ihren ungestörten
Fortgang hat, wenn Kehlkopf und Ansatzrohr sich im Indifferenzzustande
befinden. Durch blosse Steigerung des
Druckes beim gewöhnlichen Athmen bringt man zwar gewisse
Geräusche (verschiedene Arten des Schnaufens, Keuchens,
Schnarchens, je nachdem Mund und Nase, oder bloss die letztere
geöffnet ist) hervor, aber niemals Laute, die in der Sprache
17selbst zur Anwendung kämen (auch nicht das h, s. § 17, 1).
Beim Sprechen aber erfährt die Respiration eine andere Behandlung
als beim blossen Athmen. Beim Athmen wird die
Luft unter wesentlich gleichen Druckverhältnissen und in
gleichen Zeiträumen langsam und gleichmässig eingezogen
und ausgestossen. Beim Sprechen wird dagegen durch einen
raschen Hub des Brustkastens ein grösseres Quantum von Luft
schnell in die Lungen eingeführt, die Ausathmung geschieht
langsamer, stossweise (theils durch spontane Aufhebung des
Exspirationsdruckes, theils wegen der jeweiligen Hemmungen
durch die Articulationen des Kehlkopfs und des Ansatzrohrs)
und unter sehr verschiedenem Drucke, oder was dasselbe ist.
mit verschiedener Energie. Insofern also die Intensität der
Sprachlaute und die Silbenbildung zum Theil auch die Quantität
der Laute von der Respiration abhängt, ist auch diese
als ein wesentlicher Factor der Lautbildung zu betrachten :
doch soll der Ausdruck ‘Articulation’ auch im Folgenden
immer nur für die Hemmungen des Exspirationsstromes gebraucht
werden, wie dies seither stets üblich gewesen ist (doch
plaidirt neuerdings Techmer für Ausdehnung des Begriffes
der Articulation auch auf die Respiration).
Anm. 2. An und für sich ist die Zahl der Möglichkeiten verschiedener
Druckstärke bei der Exspiration unbeschränkt : für die Sprache kommt es
aber nicht so wesentlich auf das absolute Mass derselben, als auf das Verhältniss
der innerhalb einer Sprache oder Sprachgruppe zur Unterscheidung
gewisser Sprachlaute factisch verwandten Druckgrade an. Hierdurch
wird die Beobachtung sehr vereinfacht, da die Anzahl der verschiedenen
Grade selten über zwei oder drei hinausgeht. Es kommt z. B. bei der
Unterscheidung von b und p, dund t, gund k bezüglich ihrer Respirationsverhältnisse
zunächst nur darauf an, dass hier überhaupt zwei Grade
von Druckstärke einander gegenüberstehen. Die faetischen Masse des
Druckes bei der Aussprache dieser Laute können vielfach wechseln und
wechseln thatsächlich, je nachdem man dieselben z. B. in lauterer oder
leiserer Rede oder im Flüstern verwendet, aber überall bleibt der Gegensatz
zwischen den zwei Graden. Hat man also zunächst die Anzahl der
überhaupt unterschiedenen Grade festgestellt, so folgt als zweite Aufgabe
den Abstand derselben von einander festzustellen (in Süd- und Mitteldeutschland
liegen z. B. b und p u. s. w. einander vielfach näher als in
Norddeutschland, u. dgl.). Für die Beobachtung muss hierbei noch die
Entscheidung, welche das Ohr nach den Stärkegraden der Schallempfindung
gibt, hauptsächlich massgebend sein, da wir noch nicht im Besitze
von Instrumenten sind, welche bei allen Lauten genauere Druckmessungen
ermöglichten. Am leichtesten sind noch Druckmessungen bei den Verschlusslauten
(besonders den Labialen) und bei Reibelauten mit starker
Engenbildung vorzunehmen. Der einfachste Apparat dazu ist eine U-förmig
gebogene, zu etwa einem Drittel mit Wasser gefüllte Glasröhre, an deren
18einem Ende ein dünner Kautschukschlauch befestigt ist ; das andere Ende
dieses Schlauches wird in den Mund bis hinter den Verschluss oder
die schallbildende Enge eingeführt. Im Allgemeinen wird aber schon ein
einigermassen geübtes Ohr ausreichend sein, namentlich wenn man, wie
schon oben § 3 Anm. 1 empfohlen wurde, einen Kautschukschlauch zur
Concentrirung der Schallwellen verwendet. Nebenher versäume man nicht
auf das verschiedene Muskelgefühl zu achten, das sich bei der Aussprache
von Lauten verschiedener Druckstärke in den Articulationsorganen (z. B.
bei b und p in den Lippen) kundgibt.
Es ist bereits im Vorhergehenden stillschweigend vorausgesetzt,
dass die Sprachlautbildung nur während des Processes
der Exspiration vor sich gehe. In der That ist diese Art
der Lautbildung durchaus die gewöhnlichere und nach dem
Baue und der relativen Lage der Sprachorgane die natürlichere ;
denn nur so kommt der Respirationsstrom der fortschreitenden
Bewegung der Schallwellen zu Hülfe.
Anm. 3. Versucht man die einzelnen Sprachlauteinspirirend statt exspirirend
zu sprechen, so wird die klare und scharf abgegrenzte Färbung
derselben verwischt, die Stimme wird rauher und dumpfer. Zu einer regelmässigen
Verwendung ist denn auch die inspiratorische Lautbildung in den
indogermanischen Sprachen nicht gekommen. Im Deutschen werden allenfalls
in nachlässiger Rede Partikeln wie ja, juchmit Inspiration gesprochen,
seltener auch so (gewöhnlich dann ho ausgesprochen), beide aber
auch nur dann, wenn sie für sich allein in die Rede eines andern eingeworfen
werden, überhaupt hängt sehr vieles dabei lediglich von persönlicher
Angewöhnung ab. Sonst kommt es wohl vor, dass dies oder jenes
Wort während eines Gähnanfalls durch Inspiration hervorgebracht wird.
Zuerst beobachtet wurde die inspiratorische Sprechweise von Kempelen
S. 103 f. bei ‘geschwätzigen Weibern und eifrigen Betern in katholischen
Kirchen’. Aus der Schweiz berichtet Winteler S. 5 den gelegentlichen
Gebrauch derselben zur Unkenntlichmachung der Stimme. Die Schnalzlaute
der Hottentotten aber, die bisweilen zu den inspiratorischen Lauten
gerechnet werden (wie auch noch in der ersten Auflage dieses Werkes geschehen),
sind wie bereits Chladni S. 216 richtig erkannte, vielmehr Sauglaute,
die bei geschlossenem Kehlkopf erzeugt werden. Sie erscheinen
ausserdem ja stets in Begleitung von Lauten exspiratorischer Bildung,
während die gegebenen Beispiele aus dem Bereiche der indogermanischen
Sprachen stets inspiratorische Bildung ganzer Silben oder Worte aufweisen.
3. Die Thätigkeit des Kehlkopfes.
3. Die Thätigkeit des Kehlkopfes. Der ersteTheil
des Sprachorgans, welcher sich dem Exspirationsstrom articulirend
entgegenstellen kann, ist der Kehlkopf. Die Articulation
besteht hier in der stufenweisen Verengerung der
Stimmritze bis zu völligem Verschluss. Je nachdem mit diesen
verschiedenen Verengungsgraden der Stimmritze verschiedene
Grade der Exspirationsstärke combinirt werden, entstehen
im Kehlkopfe Geräusche oder Klänge verschiedenster
Art. Man bezeichnet die ersteren als Kehlkopfgeräusche,
19die letzteren mit einem zusammenfassenden Namen als
Stimme (Chladni 187 f.) oder Stimmton, engl. voice.
Unter Stimmton verstehn wir also einen durch rhythmische
Schwingungen der Stimmbänder hervorgebrachten musikalischen
Klang, einerlei welcher Höhe, Intensität u. s. w., und
ganz abgesehn von seiner Verwendung zur Erzeugung verschiedener
Sprachlaute.
Von den Kenlkopfgeräuschen finden beim gewöhnlichen
lauten Sprechen (und dies ist durchaus als die natürliche
Sprechweise zu betrachten) nur zwei, das h und der Spiritus
lenis (s. § 7, l und § 17) Anwendung ; dagegen wird der
Stimmton verwandt zur Erzeugung der Vocale, Nasale.
Liquidae und mancher anderer ‘tönender’ Consonanten, d. h.
gerade derjenigen Laute, auf welchen vorzugsweise die
Hörbarkeit und die musikalische Verwendbarkeit der Sprache
beruht. Wegen dieser seiner Wichtigkeit für die Sprachbildung
ist er bei Betrachtung der Leistungen des Kehlkopfs
billig voranzustellen.
Hierbei ist allerdings gleich darauf aufmerksam zu machen,
dass eine direkte Untersuchung der Eigenschaften des Stimmtons
am lebenden Sprachorgan nicht möglich, wenigstens bis
jetzt nicht erreicht ist. Denn er gelangt vermöge des eigenthümlichen
Baues des Sprachorgans niemals unverändert,
sondern bereits umgestaltet durch die Resonanzwirkungen
des Ansatzrohres, zum Ohre des Hörenden, sei es z. B. als
Vocal, oder als Liquida oder als Nasal u. s. w. Nun bleiben
aber für jeden dieser Einzellaute die Resonanzverhältnisse des
Ansatzrohres sich wesentlich gleich, da sie von der Thätigkeit
des Kehlkopfes unabhängig sind ; daraus folgt aber wieder,
dass die verschiedenen Bildungsarten des Stimmtons sich in
ähnlicher Weise auch bei jedem Einzellaute finden müssen,
bei dessen Erzeugung der Stimmton betheiligt ist, mit andern
Worten, dass sich die Eigenschaften des Stimmtons ohne erheblichen
Schaden auch an einem Einzellaute (z. B. jedem
beliebigen Vocal) demonstriren lassen.
Bei den Vocalen nun (die wir einmal aus praktischen
Gründen als Vertreter aller Stimmtonlaute betrachten wollen)
hat man im Allgemeinen zu unterscheiden die Intensität, die
Tonhöhe und die musikalische Reinheit. Dabei sind die
Unterschiede der einzelnen Vocale und Vocalnüancen als erst
später zu behandeln natürlich ausser Acht gelassen.
Die Intensität hängt wie bei jedem Klange von der
20Energie ab, mit welcher der tönende Körper zu Schwingungen
erregt, d. h. hier von der Energie, mit welcher der Exspirationsstrom
durch die Stimmritze getrieben wird : je stärker
der Exspirationsdruck, um so lauter der erzeugte Stimmton
resp. Vocal. — Es versteht sich übrigens leicht, dass
gegenüber dem Wechsel des Exspirationsdruckes der Kehlkopf
sich nicht indifferent verhält ; vielmehr wächst (nach
einem für alle Articulationen geltenden Gesetze) mit der
Energie der Exspiration auch die der Kehlkopfarticulation ;
die articulirenden Kehlkopfmuskeln müssen eben gegenüber
einem gesteigerten Luftdrucke stärker angespannt werden,
um die Stimmbänder in ihrer Articulationsstellung verharren
und nicht gewaltsam auseinandertreiben zu lassen. Daher ermüdet
auch bei lauterem Sprechen der Kehlkopf in demselben
Masse wie die Brust schneller als bei leiserem.
Bezüglich der Tonhöhe sind zunächst zwei verschiedene
Stimmregister, das der Bruststimme und das der Kopf- oder
Falsetstimme, zu unterscheiden. Physiologisch ist
dieser Unterschied begründet durch die verschiedene Stellung
und Action der Stimmbänder.
Bei der Bruststimme werden die Stimmbänder fest
schliessend mit ihren Innenrändern aneinander gelegt ; der
Stimmbandmuskel zieht sich zusammen und gestaltet so den
ganzen Stimmbandkörper zu einer festen, elastischen Masse.
Durch den aus den Lungen kommenden Luftstrom wird der
in dieser Weise gebildete Verschluss des Kehlkopfes derart
unterbrochen, dass die Stimmbänder für einen Moment zur
Seite gedrängt werden, um im nächsten vermöge ihrer Elasticität
wieder zusammenzuschlagen. So entsteht eine Reihe
discontinuirlicher Luftstösse, welche durch ihre rasche rhythmische
Aufeinanderfolge im Ohre die Empfindung des Klanges
hervorrufen.
Bei der Kopfstimme wird der Stimmbandmuskel nicht
contrahirt ; die Stimmritze ist in ihrem vorderen Theile nicht
ganz geschlossen, sondern nur bis auf einen schmalen elliptischen
Spalt verengt ; die Stimmbänder schwingen (nach den
neueren Untersuchungen von Carl Müller und Oertel, vgl.
Grützner 97) zwar wie bei der Bruststimme in ihrer ganzen
Breite, aber nicht als ganze Massen, sondern so, dass sich
sagittale Knotenlinien darin bilden. Ferner findet Berührung
der Innenränder beim jedesmaligen Rückgang zur Articulationslage
nicht statt, sondern der erwähnte Spalt wird nur in
21rhythmischer Folge erweitert und verengt. Die hierdurch entstehenden
Luftpulsationen verhalten sich übrigens bezüglich
ihrer Einwirkung auf das Ohr ebenso wie die der Bruststimme.
Anm. 4. Genaueres über diese beiden sowie die zum Theil noch daneben
angenommenen anderen Register s. bei Grützner S. 87 ff.
Innerhalb beider Register liegt bekanntlich eine lange
Reihe von Klängen verschiedener Tonhöhe. Diese hängt
nach § 2 von der Schnelligkeit der Stimmbänderschwingungen
ab, und diese wird wieder bestimmt durch das Verhältniss des
jeweiligen Exspirationsdruckes zu der Länge und der Spannung
der Stimmbänder.
Die musikalische Reinheit des Stimmtones endlich beruht
hauptsächlich auf dem feineren anatomischen Bau der
Stimmbänder, ihrer mehr oder weniger vollkommenen und in
allen Theilen gleichmässigen Elasticität u. s. w.
Beim Flüstern (engl. whisper) ist die Stimmritze wie
bei der Kopfstimme nicht völlig verschlossen ; zugleich ist
aber der Exspirationsdruck soweit herabgesetzt, dass der Exspirationsstrom
nicht mehr die Kraft hat die Stimmbandränder
zum Tönen zu bringen, sondern nur durch seine Reibung an
ihnen Geräusche, die bereits oben genannten Kehlkopfgeräusche,
zu erzeugen. Diese verhalten sich, soweit es ihr
akustischer Charakter zulässt, analog dem Stimmton. Allerdings
kommen dabei die Unterschiede bezüglich der Tonhöhe
und der Reinheit fast ganz in Wegfall, sodass man wesentlich
nur verschiedene Grade der Intensität und der Rauhigkeit unterscheiden
kann. Dieselben sind ihrerseits bedingt durch die
Stärke des Exspirationsdruckes- auf der einen, und die Energie
und die Art der Engenbildung auf der andern Seite. Hinsichtlich
dieser letztern sind drei Hauptformen zu unterscheiden.
Die erste Form kann man die des sanften Flüsterns
nennen. Hier ist bei ganz geringem Exspirationsdruck die
ganze Stimmritze spaltförmig verengt. Verstärkt man den
Exspirationsdruck, um damit zum mittleren Flüstern überzugehn,
so wird gleichzeitig die Bänderglottis geschlossen,
sodass nur die Knorpelglottis offen bleibt. Dies mag die gewöhnlichste
Bildungsweise sein ; nur ausnahmsweise begegnet
man der dritten Form, der des heiseren Flüsterns (wheeze
der Engländer). Bei dieser sind auch die Taschenbänder in
ihrem vordem Theile geschlossen ; der Kehldeckel wird gleichseitig
stark gesenkt, sodass nur eine kleine Oeffnung für die
Luft bestehn bleibt. Diese Form verlangt übrigens sehr starken
22Exspirationsdruck und ermüdet den Kehlkopf wegen der
energischen Contraction aller seiner Theile sehr schnell.
Anm. 5. Im ausdrücklichen Gegensatz zu Helmholtz (Tonempfindungen
S. 170), welcher nur die mittlere Form anzuerkennen scheint,
verweise ich auf die wichtigen Ausführungen von Czermak, Wiener Sitz.-Ber.,
math.-naturw. Cl. XXIX (1858), 570 ff. (daraus wiederholt in seiner
Schrift über den Kehlkopfspiegel S. 69 ff., beidemal mit vorzüglichen Abbildungen
der verschiedenen Articulationsformen des Kehlkopfes) und besonders
LII, (1865), 623 ff., mit denen meine eigenen laryngoskopischen
Beobachtungen vollkommen übereinstimmen.'
Man kann auch, wie zuerst wohl Czermak, Wiener Sitz.-Ber.,
math.-naturw. Cl. LII (1865), 630 beobachtete, eine
Verbindung des Stimmtones mit dem Flüstergeräusch herstellen,
indem man zur Erzeugung des letzteren die Knorpelglottis
geöffnet hält. Dieser ‘tönende Eeibelaut des Kehlkopfes’
stellt nach Grützner eine ‘matte, hauchende Stimme’
dar, die, wie ich glaube, in verschiedenen Variationen beim
Stöhnen von uns nicht selten gebraucht wird. Nach den
Untersuchungen von Brücke und Czermak muss dieser Laut
auch im arab. h enthalten sein, worüber mir kein eigenes Urtheil
zusteht.
Anm. 6. Sweet S. 7 glaubt ihn auch im gewöhnlichen dän. r zu erkennen,
das nach ihm zugleich Zurückziehung der Zunge und Lippenrundung
enthält (das wäre also labialisirte gutturale Spirans mit dem
Hauchton statt des reinen Stimmtones). Hierüber kann ich nicht entscheiden,
glaube aber behaupten zu dürfen, dass das Reibungsgeräusch
der norddeutschen r, welche Sweet ebenfalls hierherzieht, nicht im Kehlkopf,
sondern lediglich zwischen Zungenrücken und weichem Gaumen
erzeugt wird (s. § 12, 1, c).
4. Die Thätigkeit des Ansatzrohres.
4. Die Thätigkeit des Ansatzrohres. Im Vorhergehenden
wurde gezeigt, dass die Aufgabe der Kehlkopfarticulationen
darin besteht, für die Bildung ganzer Reihen
von Sprachlauten (Vocalen, Liquidae, ‘tönenden’ Mediae und
Spiranten, also durchaus functions verschiedenen Lauten) ein
gemeinschaftliches Substrat, den Stimmton resp. die Kehlkopfgeräusche
zu liefern ; bei andern Lautreihen bleibt hinwieder
der Kehlkopf ganz passiv (vgl. § 3, Anm. 1). In beiden
Beziehungen verhält sich das Ansatzrohr abweichend :
es ist niemals ganz passiv (d. h. ohne merkbaren Einfluss auf
den Charakter des einzelnen Sprachlautes) und seine Articulationen
ergeben stets nur Einzellaute. Einer jeden Articulationsform
des Ansatzrohres entspricht stets
nur ein einziger resultirender Sprachlaut, innerhalb
dessen allenfalls graduelle Unterschiede, je nach der
23Stärke des Exspirationsdruckes, oder qualitative, je nach der
Betheiligung oder Nichtbetheiligung des Kehlkopfes an der
Articulation, zu statuiren sind.
Anm. 7. Hat man z. B. dem Ansatzrohr die zur Bildung eines a nothwendige
Articulationsform gegeben, so wird man unveränderlich immer
nur wieder ein a hervorbringen, solange man die gegebene Stellung festhält,
mag man nun lauter oder leiser oder flüsternd, höher oder tiefer
sprechen. Aehnliches kann man bei der Bildung eines f, s, ch, oder auch
eines b—p, d—t, g— k u. s. f. beobachten, doch kommen bei Bildung
dieser graduellen Unterschiede zugleich kleine Aenderungen der Articulationsform
in Betracht, wie stärkeres Zusammenpressen der Lippen bei
p als bei b, etc. (vgl. § 9, Anm. 2).
Die Möglichkeit verschiedene, ihrem Gebiete nach scharf
abgegrenzte Sprachlaute hervorzubringen, beruht also in erster
Linie auf der Möglichkeit, dem Ansatzrohr verschiedene Articulationsformen
zu geben. Diese werden demnach später bei
der Besprechung der einzelnen Sprachlaute selbst die Aufmerksamkeit
wesentlich in Anspruch nehmen : hier handelt
es sich zunächst nur um die Feststellung und Klarlegung
eines Fundamentalunterschiedes in der Form und der Wirkung
der Articulationen überhaupt.
Wenn man die Bildung z. B. eines p, t, k oder eines,f, s,
ch beobachtet, so findet man leicht, dass dabei der Kehlkopf
keinen Antheil als Schallerzeuger hat (§ 3, Anm. 1) ; dass
vielmehr ein tonloser Luftstrom irgendwo im Ansatzrohr, z. B.
bei p und fan den Lippen (resp. Zähnen) eine Hemmung erfährt,
welche zur Erzeugung eines Geräusches an dieser Stelle
Veranlassung gibt. Wird die Hemmung aufgehoben, so erlischt
das Geräusch alsbald, auch wenn die Exspiration noch
weiter fortdauert ; wird sie an einer andern Stelle des Ansatzrohres
hergestellt, so erscheint ein von dem ersten Geräusch
durchaus verschiedenes. In jedem Falle lässt sich aber innerhalb
des Ansatzrohres eine Stelle bestimmt fixiren, an welcher
das Geräusch seine Entstehung findet.
Ganz anders bei der Bildung z. B. eines Vocals, sagen
wir a. Wir wissen, dass hier der Kehlkopf als Substrat des
Lautes den Stimmton liefert ; derselbe liegt aber auch dem i,
u u. s. f. zu Grunde, man gelangt von a zu i oder zu jedem
beliebigen andern Vocal durch blosse Gestaltveränderungen
des Ansatzrohres, während der Kehlkopf vollkommen in der
alten Articulationsstellung beharrt. Der Unterschied zwischen
a, i, uberuht also ebenso gut auf der Articulation des Ansatzrohres,
wie der von f, s, ch ; aber nirgends kann man innerhalb
24des Ansatzrohres einen Punkt fixiren, an welchem der
dem a im Gegensatz zu i und u eigentümliche Klang (als
etwas vom Stimmton Unabhängiges) gebildet würde. Vielmehr
wirkt hier das Ansatzrohr als Ganzes (und zwar nach dem
Princip der Resonanz, s. § 2, 7) umgestaltend auf den im
Kehlkopf erzeugten Stimmton ein.
In dem ersteren Falle bewirkt also die Articulation des
Ansatzrohres die Erzeugung eines selbständigen Lautes (f, s,
ch), im zweiten Falle nur die Modificirung eines bereits anderwärts
erzeugten Lautes (des Stimmtones). Wir nennen danach
eine Articulation der ersteren Art eine schallerzeugende
oder schallbildende, eine der zweiten Art eine schallmodificirende.
Man sieht leicht, dass der Kehlkopf, sobald er überhaupt
an der Articulation theilnimmt und nicht bloss rein passiv die
Luft durch die weitgeöffnete Stimmritze durchströmen lässt,
immer nur schallbildend wirkt, und dass sich diesem Schall
gegenüber das Ansatzrohr stets modificirend verhalten muss.
Die Fähigkeit der Schallbildung ist aber nicht auf den Kehlkopf
beschränkt, sondern auch dem Ansatzrohr eigen, wie wir
oben bei f, s, chgesehen haben. Die Produkte dieser Schallbildung
im Ansatzrohr verhalten sich denen des Kehlkopfs
analog : auch sie gelangen nicht unverändert zum Ohre des
Hörers, sondern auch sie werden stets durch einen Theil des
Ansatzrohres resonatorisch modificirt. Bei dem am Gaumen
gebildeten ch wirkt z. B. der grössere Theil der Mundhöhle als
Resonanzraum mit. Es sind also ohne Ausnahme bei jedem
Sprachlaut beide Arten von Articulation vorhanden. Dass wir
die Wirkung der schallmodificirenden Articulationen bei den
Consonanten nicht in dem Grade wahrzunehmen pflegen wie
bei den Vocalen, hat seinen Grund theils darin, dass wir
überhaupt nicht gewohnt sind darauf zu achten, theils darin,
dass sie in der That nicht so sehr in's Ohr fallen wie bei den
Vocalen. Von ihrem thatsächlichen Vorhandensein kann man
sich aber leicht jederzeit überzeugen ; man spreche z. B. anhaltend
ein s oder chund verändere während dessen die Gestalt
der Mundöffnung beliebig ; jede Veränderung der Lippenstellung
wird dann eine andere Färbung des s oder ch zur
Folge haben ; dasselbe Experiment kann man beim m bezüglich
der Unterkiefer- und Zungenstellung machen, u. s. w. mit
den nöthigen Modificationen bei allen Consonanten. Ueberall
bleiben hierbei die schallerzeugenden Articulationen ungeändert
25bestehn. nur ein an diese Articulationsstellen angrenzender
Resonanzraum wird verschieden umgestaltet. Ob den
Einwirkungen desselben ein musikalischer Klang, wie bei
den Vocalen und einigen Consonanten, oder ein Geräusch,
wie bei den übrigen Consonanten, unterliegt, ist nur insofern
nicht ganz gleichgültig, als die akustisch einfacheren Klänge
(also auch der Stimmton) viel empfindlicher gegen derartige
Einflüsse sind als die complicirteren Geräusche.
Anm. 8. Aus diesem und dem gleich nachher zu nennenden Grunde
erscheint uns nämlich der Unterschied zwischen iund u z. B. um so viel
bedeutender als der ganz analoge zwischen einem s mit spaltförmiger oder
gerundeter Mundöffnung (s. § 23), dass wir nicht nur iund u als gesonderte
Laute betrachten, sondern zwischen ihnen noch eine ganze Vocalscala
einschieben, während wir die Verschiedenheit jener s gar nicht oder
doch nur selten wahrnehmen.
Ausserdem ist noch zu beachten, dass ein Laut um so
mannigfacher modificirt werden kann, je grösser und veränderungsfähiger
das zur Resonanz dienende Stück des Ansatzrohres
ist, d. h. je weiter rückwärts im Sprachorgan seine
schallbildende Articulation stattfindet. In erster Linie stehen
also hier die Vocale (deren Unterschiede überhaupt bloss auf
schallmodificirender Articulation beruhen), dann folgen die
Gutturale, Dentale und schliesslich die Labiale (bei denen
der Resonanzraum hinter der lautbildenden Articulationsstelle
liegt und also am wenigsten zu akustischer Geltung gelangt).
Zum Zustandekommen eines Sprachlautes sind demnach
jederzeit drei Factoren erforderlich :
1. ein Exspirationsstrom, dessen wechselnde Stärke
(und Dauer) durch die Thätigkeit der Athmungsmuskulatur
regulirt wird ;
2. eine schallerzeugende Hemmung dieses Stromes,
die nach dem Orte (theils im Kehlkopf, theils im Ansatzrohr,
theils in beiden gleichzeitig), dem Grade (Verschluss oder Engenbildung,
letztere wieder mehrfach abgestuft), der Dauer
und der Energie verschieden sein kann ; die Energie der Hemmung
richtet sich nach derjenigen der Exspiration (vgl. S. 21
und 23 f.), braucht also nicht weiter besonders betrachtet zu
werden ;
3. ein Resonanzraum, welcher dem durch das Zusammenwirken
von 1. und 2. erzeugten Schall seine specifische
Färbung gibt.
Alle Veränderungen von Sprachlauten, welche die Sprachgeschichte
aufweist, entstehen hiernach entweder durch Veränderungen
26der Energie der Exspiration, oder solche des
Grades, des Ortes und der Dauer der Hemmung, oder solche
des Resonanzraumes, oder Combinationen derselben. Ohne
genaue Rücksicht auf diese drei Factoren der Sprachbildung
ist also auch eine systematische Betrachtung des Lautwandels
nicht möglich.
Anm. 9. Früher hat man die Lautwandlungen wesentlich nur vom Gesichtspunkte
der Veränderungen in der Druckstärke und der schallbildenden
Articulation aus betrachtet (z. B. Uebergang von Tenues zu Medien
und umgekehrt, oder Wandel von Verschlusslauten zu Spiranten u. dgl.) ;
das weite und vielleicht bedeutsamste Gebiet, das des von den Einwirkungen
der modificirenden Articulationen abhängigen Lautwandels,
hat noch keine zusammenfassende Behandlung gefunden ; man hat sich
vielmehr mit einer Reihe zusammenhangsloser, wenigstens nicht in den gehörigen
Zusammenhang gesetzter Einzelbeobachtungen begnügt. Das
Verdienst, auf eine strenge Scheidung der beiden verschiedenen Articulationsfactoren
nachdrücklich und mit voller Klarheit aufmerksam gemacht
zu haben, gebührt nach den ersten Anregungen von Heyse S. 15 und
Merkel Anthrop.771 namentlich Winteler (Ker. Mundart 5 ff.), auf dessen
Angaben die hier gegebene Darstellung wesentlich zurückgeht ; nur habe
ich schallbildend und schallmodificirend an die Stelle der Winteler'schen
lautbildend und -modificirend treten lassen, weil diese
zu Missverständnissen Anlass geben können ; denn ein Laut, d. h. ein
Sprachlaut, entsteht ja eben erst durch das Zusammenwirken von Schall-bildung
und -modification.
§ 5. Die Eintheilung und das System der Sprachlaute.
(Principielle Fragen).
1. Seit den ältesten Zeiten zerlegt die Grammatik die
Masse der Sprachlaute in zwei grosse Hälften. Vocale und
Consonanten. Diese Eintheilung hat einen nicht geringen
praktischen Werth, insofern sie einen wesentlichen Functions
unterschied der Laute bei ihrer Verbindung zu Silben
und Wörtern im Ganzen richtig bezeichnet. Sie ist ausserdem
mit unserer gesammten einschlägigen Terminologie, überhaupt
mit allen Forschungen über Lautlehre so innig verwachsen,
dass es wohl für unmöglich gelten muss, sie vollständig durch
eine andere zu ersetzen, obschon sie, namentlich mit Rücksicht
auf ihre Verwendung auf dem Gehiete wissenschaftlicher
Lautlehre, an manchen Gebrechen laborirt. Von diesen sollen
hier nur die zwei am meisten in die Augen fallenden erwähnt
werden.
Der erste Fehler ist der, dass die obige Eintheilung sich
nicht auf das Wesen der Laute gründet, sondern auf ihre
27Functions verschiedenheiten. Diese treten allerdings auch
für den oberflächlichen Beobachter leicht und deutlich hervor ;
zur Erkenntniss des Wesens der Sprachlaute führt erst ein
längeres, mühsameres Studium. Es war also nicht ungerechte
fertigt, dass man jene zum ersten Ausgangspunkt für die
Classification des Materiales machte. Die Folgezeit hat aber
gelehrt, dass die Bequemlichkeit des so geschaffenen Systems
für den Fortschritt in der Erforschung jenes mühsameren
Theiles der Lautwissenschaft ein wesentliches Hemmniss gewesen
ist : denn die Verworrenheit und Unsicherheit der Ansichten
auf lautlichem Gebiet, der man auch jetzt noch so
vielfach begeguet, ist zu einem grossen Theile die Folge davon,
dass man nicht vermocht hat, sich von dem alten ererbten
Ein theilungsschema zu emancipiren und neue, selbständige
Beobachtungen an die Stelle der aus diesem Schema abgeleiteten
Theorien treten zu lassen. Eine wissenschaftliche Lautlehre
kann aber nur auf dem Grunde richtiger Erkenntniss
des Wesens der Laute aufgebaut werden ; die Functionen derselben
können zwar für die Untersuchung der Laute selbst
Fingerzeige geben, und es wäre unbedingt falsch, sie ausser
Rücksicht zu lassen ; aber sowohl die Einwirkungen der einzelnen
Laute auf einander wie ihre selbständigen Veränderungen
empfangen direkt von ihnen aus nur in den seltensten
Fällen Licht. Daraus dass m, n, r. l z. B. ihrer Function nach
gewöhnlich Consonanten im herkömmlichen Sinne des Wortes
sind, dürfen wir allerdings schliessen, dass in ihrer Articulation
etwas vorhanden sein müsse, was sie den übrigen ‘Consonanten’
ähnlich macht, und doch lehrt die Untersuchung
ihrer Articulation wie ihre akustische Analyse, dass ein principieller
Unterschied zwischen ihnen und den ‘Vocalen’ a,
i, u u. s. w. nicht existirt. Der hierin liegende Widerspruch
wird naturgemäss einen aufmerksamen Forscher zu eingehenderer
Untersuchung der Frage anreizen, wie es denn zugeht,
dass ein Laut wie m oder l seinem Wesen nach Vocal,
seiner Function nach Consonant sei, und warum dieselbe
Differenz nicht etwa auch bei dem ‘Vocal’ astattfinde u. s. w. ;
mit der richtigen Beantwortung dieser Fragen ist ihm dann
der Weg zu einer Menge weiterer Erkenntnisse gebahnt. Wer
aber bloss von der functionellen Seite ausgehend m oder l
u. s. w. einfach zu den Consonanten, wohl gar zu den ‘tönenden
Reibelauten’ rechnet, der wird niemals richtig verstehn
können, warum denn gerade diese und immer nur diese so
28ganz andere Wirkungen auf ihre Lautumgebungen (z. B. benachbarte
Vocale) ausüben als andere ‘tönende Reibelaute’,
wie franz. engl. v, z, neugriech. γ u. dgl.
An dem gegebenen Beispiel lässt sich zugleich auch der
zweite Hauptfehler des alten Systems erläutern : die Unmöglichkeit,
eine bestimmte Scheidung zwischen Vocalen und
Consonanten durchzuführen. Dafür legen schon die alten
Vermittelungskategorien der Halbvocale, Liquidae und wie
sie alle heissen mögen, ein halb unfreiwilliges Zeugniss ab.
Sonst braucht man nur einen kleinen Theil der Laute irgendwelches
Lautsystems durchzuprüfen, um zu sehen, dass Laute,
die das hergebrachte System ihrer Function nach den Consonanten
zuschreibt (wie eben m, n, r, l), manchmal eben so
häufig, manchmal freilich auch seltener, vocalische als consonantische
Functionen haben und umgekehrt, kurz dass
diese Functionen grossentheils etwas zufälliges, von der zufälligen
Stellung innerhalb der Silbe oder dem Worte oder
von der nächsten Lautumgebung abhängiges sind. Niemand
kann z. B. daran zweifeln, dass Worte wie ritten, handelin
ihrer landläufigen Aussprache eben so gut zweisilbig sind wie
ritte, hände, dass also die Silben -ten, -del und -te, -de gleichwerthig
sind. Untersuchen wir dieselben auf ihre Zusammensetzung
hin, so finden wir, dass die beiden letztern aus den
‘Consonanten’ t, dund dem ‘Vocal’ e bestehn ; während der
Bildung des t, dsperrt die Zungenspitze den Mundraum luftdicht
ab, zur Bildung des e senkt sie sich, der Luft freien
Austritt aus dem Munde gestattend ; nur unter dieser Bedingung
kann überhaupt ein e hervorgebracht werden. In -ten,
-del schreiben wir zwar dasselbe Vocalzeichen e wie in -te,
-de, aber der factischen Aussprache ist es fremd. Spreche ich
ritten aus, so bleibt die Mundhöhle von dem Momente an
durch die Zungenspitze abgesperrt, wo das erste t articulirt
wird, es kann also auf das t in Wirklichkeit eine nicht folgen,
vielmehr schliesst sich das n direkt an das t an. Analog bei
-dl ; die Zungenspitze bleibt in ihrer absperrenden Stellung
bis zu Ende der Silbe ; statt sich wie bei -de zur Bildung des
e zu senken, wird sie weiter hinten so zusammengezogen, dass
zwei kleine Seitenöffnungen entstehen, aus welchen das l heraustönt.
Man spricht also rit-tn,han-dl, d. h. n und l sind
dem e in rit-te, hän-de gleichwerthig, haben vocalische Function.
Kehrt man die Lautfolge um, so werden n, l zu Consonanten,
wie in hand, bald ; aber auch ohne dies kann derselbe
29Functionswechsel eintreten, z. B. durch Anschiebung eines
‘Vocals’, wie in berittne, behandle, sobald diese Wörter dreisilbig
ausgesprochen werden. Der Vocal allein ist aber wiederum
nicht massgebend, denn man kann eben so gut auch
be-rit-tn-(n)e, behan-dl-(l)e viersilbig aussprechen (ohne zwischen
t-n, d-l ein e einzuschieben), d. h. dem n, l auch vor
einem ‘Vocale’ vocalische Function ertheilen. Genauer betrachtet,
betrifft dies aber wieder nur die erste Hälfte des n,
l, denn ihre zweite Hälfte wird doch als Anlaut der letzten
Silbe -ne, -le und zwar als Consonant empfunden. Auch
untereinander können n und l beliebig ihre Functionen vertauschen ;
in handeln, gesprochen han-dln, ist l ‘Vocal’, n
Consonant, in schallend, gesprochen schal-lnd, umgekehrt.
Ja, die Spaltung desselben Lautes in einen vocalischen und
einen consonantischen Theil, die wir eben in be-rit-tn-(n)e
u. s. w. kennen lernten, kann sogar soweit ausgedehnt werden,
dass derselbe Laut zwei ganze Silben für sich allein ausfüllt
und dabei abwechselnd als Vocal, Consonant, Vocal und
wieder Consonant fungirt ; das geschieht z. B. in Worten wie
berittenen, welche man sehr häufig als be-rit-tn-nnn aussprechen
hört (man spreche rasch und unbefangen einen Satz wie :
die berittenen Offiziere, und man wird unwillkürlich selbst zu
dieser Aussprache greifen ; mit bezeichne ich hier das n in
‘vocalischer’ Function). Ein und derselbe Laut wird also
fortwährend zwischen den beiden Kategorien hin- und hergeworfen,
und vielfach hängt es ganz vom Belieben des Sprechenden
ab, ihm die eine oder die andere Function zuzutheilen.
Worin der Unterschied dieser Functionen besteht, soll
gleich hier mit einigen Worten zur weiteren Klarlegung des
Gesagten angedeutet werden ; wir werften dann weiter unten
in dem Abschnitt über die Silbenbildung eingehender darauf
zurückkommen (§ 26 ff.).
In einer jeden Silbe unterscheidet das Ohr leicht einen vor
allen andern Theilen der Silbe hervortretenden Laut, den wir
den Silbengipfel oder auch den Träger des Silbenaccentes
nennen können ; es hat z. B. in Silben wie an, al,
ab, ap, at, ak offenbar der erste, in solchen wie na, la, ba, pa
u. s. w. der zweite Laut diese Geltung, denn an, na sind nicht
weniger einsilbig als einfaches a. Ebenso bei den oben gegebenen
Beispielen ; in rit-tn, han-dl trägt das n und l den Accent
30der zweiten Silbe, in be-ritt-ne, be-hand-le ist derselbe
auf das -e fortgerückt, n und l sind also nur noch gewissermassen
zurücktretende Beigaben zu dem Träger der Silbe,
also Mitlauter, Consonanten. im eigentlichsten Sinne des
Wortes.
In dieser Bedeutung, welche von der herkömmlichen, wie
man sieht, etwas abweicht, hat das Wort ‘Consonant’ zuerst
Thausing (Natürl. Lautsystem 97) angewendet und ihm
sehr passlich statt des alten nun nicht mehr zutreffenden Gegensatzes
‘Vocal’ den Ausdruck ‘Sonant’ als Bezeichnung
des Silbenaccentträgers entgegengestellt. Wir können
daher das Resultat der obigen Betrachtungen kurz dahin zusammenfassen,
dass Laute wie n, l, über deren Charakter damit
noch nichts ausgesagt wird, je nach Belieben als Sonanten
oder Consonanten gebraucht werden können.
Hiermit ist freilich in abstracto der Uebelstand verknüpft,
dass das Wort Consonant nun in doppelter Bedeutung erscheint,
dass es das eine Mal einen Unterschied der Function,
das andere Mal einen des Lautcharakters bezeichnet. Für die
Praxis aber wiegt dieser Uebelstand nicht schwer ; denn alle
Laute, welche die ältere Grammatik als Consonanten in ihrem
Sinne auffasst, werden auch von unserer Seite nach der überwiegenden
Häufigkeit ihrer Function in den meisten Fällen
als consonantisch bezeichnet werden müssen, und umgekehrt
fallen die ‘Vocale’ bei der Silbenbildung fast regelmässig in unsere
Kategorie der Sonanten. Denn nicht alle Laute besitzen
dieselbe Leichtigkeit des Functionswechsels wie die oben besprochenen.
Die Fähigkeit Sonant zu werden, haben wenigstens
in den älteren indogermanischen Sprachen wol nur die
mit Stimmton begabten Laute, und von diesen kommen factisch
wieder nur die (ursprünglich) auf blosser Resonanzveränderung
des Stimmtones ohne Beimischung eigener Geräusche
des Ansatzrohres gebildeten in Betracht, also die
Vocale, Nasale und Liquidae der hergebrachten Bezeichnungsweise
(vgl. Thausing 99). In den modernen Sprachen erstreckt
sich aber die Fähigkeit zu sonantischer Function zum Theil
auch auf die Laute, welche auf Geräuschbildung beruhen (s.
weiter unten), namentlich wenn dieselben Dauerlaute sind.
Anm. 1. Im Deutschen erscheinen z. B., wie schon Thausing hervorhob,
s und sch als Sonanten in den Interjectionen bst ! und sch ! Andere
Fälle entstehen durch Verstümmelungen von Silben mit ursprünglich vocalischem
Sonanten ; wie wenn man z. B. in Thüringen ein Wort wie gesagt
31oft zweisilbig, oder doch nahezu zweisilbig ausspricht, ohne ein e
hören zu lassen (image ksächt). Höchst interessant in dieser Beziehung ist die
englische Verkehrssprache, soweit sie nicht durch zu weit eingreifende
Schuleinflüsse modificirt ist. Man vergleiche z. B. die sehr instructiven
Notirungen von Sweet bei Ellis IV, 1206 und Phon. 115 f., wonach etwa
die Worte the written and printed representation of the sounds of language
sich darstellen als image ðritnnprinte1dreprznteisnvðsəun(d)zvlängue1dz.
Anm. 2. Die Ausdrücke ‘sonantisch’ und ‘consonantisch’ sind, wie
man leicht sieht, gleichbedeutend mit silbenbildend und nichtsilbenbildend,
wofürandere syllabisch und unsyllabisch oder silbisch
und unsilbisch vorgeschlagen haben und gebrauchen. Da indessen
der Ausdruck ‘sonantisch’ in der oben im Anschluss an Thausing
festgestellten Geltung von einer Reihe von Sprachforschern bereits angenommen
worden ist, so soll er auch fernerhin in dem vorliegenden Werke
angewandt werden.
Hiermit wäre für den functionellen Theil der Lautforschung,
welcher die Verwendung der Sprachlaute zur
Silben- und Satzbildung zu behandeln hat (s. unten Abschnitt
III, Cap. 2) ein erster Grund gelegt. Die Eintheilung nach
dem Princip der Sonanz und Consonanz ist aber natürlich nicht
geeignet, zur Grundlage für die Betrachtung des Wesens der
Laute zu dienen, welche sich vielmehr auf die Bildung der
Laute und den daraus resultierenden akustischen Werth derselben
zu richten hat.
2. Hier erhebt sich nun sofort die wichtige Vorfrage : was
denn ein Einzellaut sei ? Die streng theoretische Antwort
hätte natürlich zu lauten, dass darunter ein Schall zu
verstehen sei, der durch eine bestimmte Zusammenwirkung
bestimmter Articulationsfactoren und nur durch diese erzeugt
werde. Aber in der Praxis hat Niemand daran gedacht, diesen
Satz in voller Strenge durchzuführen. Man fragt gewöhnlich
nur nach der Articulationsfonn des Ansatzrohres, in zweiter
Linie nach Betheiligung oder Nichtbetheiligung des Kehlkopfes
an der Articulation im Allgemeinen ; man ignorirt also
grundsätzlich alle die Verschiedenheiten, welche von der
Respiration und der qualitativen Art der Hemmung im Kehlkopf
abhängen ; d. h. man fasst beispielsweise alle diejenigen
Schälle unter der Kategorie des ‘Lautes’ a zusammen, welche
bei einer gewissen Mundstellung und bei tönender Stimme
hervorgebracht werden können, ohne Rücksicht auf Dauer,
Stärke, Tonhöhe u. s. w. der einzelnen Laute aus denen die
Kategorie a abstrahirt ist 1)1. Ja soweit ist man in der einseitigen
32Betonung der Articulationsstellungen gegangen,
dass Brücke seine Zeichen ausdrücklich als Stellungszeichen,
nicht als Lautzeichen aufgefasst wissen wollte, d. h.
als Zeichen welche bloss das Verharren der articulirenden
Organe in einer bestimmten Stellung oder den Durchgang
derselben durch eine solche andeuten sollen. Was damit Erhebliches
gewonnen sein soll, ist nicht recht abzusehen. es
scheint im Gegentheil, dass alle weiteren Erörterungen über
die Eigenschaften der Laute sich weit schlechter an diese
Stellungszeichen anknüpfen lassen. Zu völliger Consequenz
lässt sich übrigens auch dies System nicht durchbilden, denn
es dürfte ja danach das Zeichen p z. B. nur die Stellung des
Mundes mit geschlossenen Lippen und offenem Kehlkopf
darstellen : eine Stellung, bei der niemals ein Laut hervorgebracht
werden kann. Vielmehr kommt die eigentliche Lautbildung,
die wir durch das Zeichen p versinnlichen, in einem
Worte wie apa dem Verschluss und der Wiederöffnung der Lippen
zu, d. h. zwei Akten, welche der eigentlichen Articulationsstellung
zeitlich vorausgehen und folgen. Diese Lautbildung
selbst kann aber wieder verschieden sein nach der Art
der gleichzeitigen Exspirationsbewegung, welche z. B. darüber
entscheidet ob der zwischen den beiden a gehörte Laut als
‘tonlose Media’ oder als ‘Tenuis’ oder als ‘Aspirata’ gefasst
wird. Alles dies gehört nothwendig mit zur Charakteristik
des Lautes, denn es ist klar dass die drei eben benannten
Arten ‘tonloser Verschlusslaute’ nicht etwa in dem Sinne als
gleichartig anzusehen sind wie etwa starke und schwache,
oder hohe und tiefe a u. dgl., denn der faktische Gebrauch in
den Sprachen lehrt, dass sie als gesonderte Lautclassen empfunden
werden ; sie nehmen ja auch an den verschiedenen
Stärkeabstufungen theil die wir etwa beim a in apa wahrnehmen
können, unbeschadet ihrer relativen Stärke und sonstigen
Eigenschaften.
Wir müssen es also von vornherein ablehnen, die blosse
Articulationsform allein zur Grundlage einer Eintheilung der
Sprachlaute zu machen, weil eben diese Form nicht überall
zur Völligen Charakteristik der Laute genügt, welche die
33empirische Sprache unterscheidet, und zwar in gegensätzlicher
Verwendung unterscheidet. Diese gegensätzliche
Verwendung ist es eben, welche die Grenze zu ziehen hat
zwischen dem was wir als Laut zu bezeichnen haben und
den unter diesen zu subsumirenden Varietäten. Ein Beispiel
möge dies erläutern. Die Zahl der möglichen Vocale und
Vocalnüancen ist, wie die Erfahrung in Uebereinstimmung
mit der aus der Betrachtung der Articulationsverhältnisse sich
ergebenden Theorie lehrt, eine unbeschränkte zu nennen.
Das Ohr vermag zwar allen diesen, auch den feinsten individuellen
Schattirungen zu folgen, aber aus dieser unendlichen
Zahl möglicher Laute wählt die Praxis nur eine beschränkte
Anzahl von Typen oder Kategorien aus, die sie unter einander
in einen Gegensatz stellt. Die vielen Spielarten von a,
die ein aufmerksamer Beobachter constatiren und unterscheiden
kann, werden nur deshalb als eine Einheit betrachtet,
weil sie sammt und sonders in einen bestimmten Gegensatz
zu den ebenso mannigfachen Spielarten der Gesammttypen o
oder ä oder anderer Laute gesetzt werden.
Aber auch damit sind die Schwierigkeiten noch nicht erledigt,
die sich der Aufstellung eines Systemes hemmend in
den Weg stellen. Wenn bei der Erzeugung eines nach den
obigen Normen praktisch fixirten Lautes mehrere Articulationsfactoren
nothwendig verbunden sein müssen, welcher von
ihnen ist der oberste und wesentlichste, und muss also für
die Systematik den Ausschlag geben ? Da ergiebt sich denn,
dass man denselben Laut häufig von ganz verschiedenen Gesichtspunkten
aus betrachten kann. Versuchen wir z. B. die
Lautgruppe amba zu analysiren. Ueber den Vocal a kann kein
wesentlicher Zweifel sein ; er ist einfacher Stimmton, modificirt
durch die Resonanz der Mundhöhle, die man doch hier
nicht wird als das primäre auffassen wollen. Isoliren wir das
folgende m, so ist auch dieses ein reiner Stimmtonlaut, dem
a als solcher nahe verwandt, aber charakteristisch von ihm
geschieden durch den Schluss der Lippen und eine andere
Stellung des Gaumensegels (§ 7). Es folgt das b, das wir ebenfalls
isoliren können. Mund und Nase sind beide abgesperrt,
und in den Hohlraum des Mundes ertönt die Stimme (§ 17, 4)
ebenfalls ohne begleitendes Geräusch ; also auch das tönende
b kann in seiner Isolirtheit und während der mittleren Zeit
seines Bestehens als ein einfacher Stimmtonlaut charakterisirt
werden (und ist so von Kräuter charakterisirt worden) : Mit
34dem m ist dieser der Articulationsstellung nach verwandt
durch den gemeinschaftlichen Verschluss der Lippen ; ja man
kann das m ebensogut als ein nasalirtes tönendes b bezeichnen
wie man von einem nasalirten Vocale spricht, denn m unterscheidet
sich von b eben wie der nasalirte Vocal vom reinen
Vocal nur dadurch, dass bei dem erstem das Gaumensegel frei
im Munde schwebt, der Luft Eingang in Mund- und Nasenraum
verstattend, bei letzterem aber dem Rachenrand fest anliegt.
Müsste man danach die Nasale als selbständige Klasse
nicht ganz aus dem System der Sprachlaute eliminiren und
sie vielmehr als Unterabtheilung der Mediae fassen, wie man
die Nasalvocale als Varietät der reinen Vocale darzustellen
pflegt ? Wir haben aber weiter oben beim b die Akte des Verschlusses
und der Öffnung ignorirt, die im Zusammenhange
der Rede doch jedesmal das Ertönen der Stimme begleiten
und die dergestalt charakteristische Schälle erzeugen, dass
sie, namentlich bei schwach tönender Stimme, als das Wesentlichere
angesehen werden können, und dadurch tritt das b,
das wir eben als nahen Verwandten der ‘Stimmtonlaute’ a
und m kennen gelernt hatten, in nächste Beziehung zu dem
tonlosen p, das doch als vollkommenster Gegensatz zum
Vocallaute aufgefasst werden muss. Wollen wir nun b und p
vergleichen, was ist denn da das Wichtigere : die Verschlussbildung
und Öffnung. oder das Tönen und Nichttönen der
Stimme ? Und wenn wir uns etwa aus diesem oder jenem
Grunde entschliessen, b und p in erster Linie als Verschlusslaute
zu charakterisiren, gehört dann das m, bei
dessen Bildung die Lippen geschlossen, ein Canal aber, der
Nasencanal, geöffnet ist, zu diesen Verschlusslauten, welche
beide Luftwege (durch Mund und Nase) absperren, oder zu
den Vocalen, welche auch einen Luftweg offen lassen, nämlich
den durch den Mund, während der Nasencanal abgesperrt
wird ? Unterscheiden sich ferner b als ‘tönender’ und p als
‘tonloser’ Verschlusslaut lediglich durch die Betheiligung
oder Nichtbetheiligung der Stimme an der Hervorbringung
dieser Laute ? Eine einfache Messung des Expirationsdruckes
mit dem oben S. 18 f. erwähnten Instrument zeigt sofort, dass
b nicht nur tönend ist, sondern auch einen geringeren Exspirationsdruck
besitzt. Wenn nun in einer ganzen Reihe von
Sprachen an die Stelle des ‘tönenden’ b ein Laut getreten ist,
welcher zwar nicht selbst tönend, aber vom p doch durch
schwächeren Exspirationsdruck deutlich geschieden ist (§ 14),
35soll man denselben nun als ein ‘tonloses b’ oder als ein
‘schwächeres p’ bezeichnen ; oder mit anderen Worten, wenn
die alten Ausdrücke Media und Tenuis beibehalten werden
sollen, welche ursprünglich den tönenden und schwachen
resp. den tonlosen und starken Laut bezeichnen sollten, welcher
von ihnen muss denn die Erweiterung seines Begriffes
erfahren ? Es ist doch sehr natürlich, dass derjenige, welcher
sein b tönend spricht, in diesem Mittönen der Stimme das
eigentliche Charakteristicum des Lautes findet, daher auch
geneigt sein wird jenen schwachen tonlosen Laut dem p näher
zustellen ; während umgekehrt derjenige, welcher ein ‘tonloses
b’ zu bilden und nur durch den Exspirationsdruck vom p
zu unterscheiden gewöhnt ist, ein feineres Ohr für alle Unterschiede
der Expirationsstärke haben und also in der Abstufung
der Intensität das Wesentliche erblicken wird ; ihm rangirt
dann das Mittönen der Stimme bei Andern, wenn er es
überhaupt beachtet, erst in zweiter Linie. Der strenge Systematiker
wird vielleicht sagen, dass solch subjective Bedenken
oder Auffassungen nicht in Betracht kommen dürfen, wo es
die Aufstellung eines abstracten Systems gilt. Aber es bedarf
doch auch wieder nur eines geringen Nachdenkens, um zu
erkennen, dass dies subjective Empfinden gewisser charakteristischer
Eigenheiten gewisser Laute im Vorzug vor anderen
Eigenheiten derselben Laute für die geschichtliche Entwickelung
derselben, mithin auch für die geschichtliche Entwickelung
einer ganzen Sprache von bedeutendem Einfluss sein
kann. Für denjenigen, welcher die Lautphysiologie zu sprachgeschichtlichen
Untersuchungen benutzen will, ergibt sich
geradezu die Nothwendigkeit auch auf diese subjectiven Momente
in der Auffassung der Laute durch die Sprechenden
Rücksicht zu nehmen, selbst auf die Gefahr hin, sein abstractes
System dadurch zu stören.
Ist es denn also überhaupt möglich, ein allen Anforderungen
genügendes allgemeines System aufzustellen, in
dem, wie es die Vollständigkeit erfordert, alle möglichen
Laute der menschlichen Sprachorgane ihren Platz finden ?
Auf diese Frage ist mit möglichster Entschiedenheit Nein zu
antworten ; denn Niemand kann von vorn herein alle möglichen
Combinationen der einzelnen Articulationsformen überschauen.
Eine jede neu untersuchte Sprache kann wieder
neue Combinationen bringen, die sich nicht in das System
fügen das wir aus den Lauten der uns näher bekannten Sprachen
36ahstrahirt haben 1)2. Sehen wir aber auch selbst von dieser
Ausdehnung der Frage auf alle möglichen Laute ab, so
bleibt doch noch immer aus den vorher angeführten Gründen
die Aufstellung eines allgemeinen Systems unthunlich, weil
eben die Bedingungen für die Hervorbringung der Laute so
mannigfaltig sind, dass ein System nur durch willkürliche
Bevorzugung gewisser Factoren vor andern geschaffen werden
kann, und ein so gewonnenes System kann natürlich keinen
Anspruch auf absolute Gültigkeit haben.
Ich meine also, im ausdrücklichsten Gegensatz zu den
neueren auf Herstellung einer allgemeinen Lautsystematik
gerichteten Bestrebungen, an der Auffassung festhalten zu
müssen, dass eine gedeihliche Weiterentwickelung der Lautsystematik
nur auf dem Wege der genauen Erforschung und
Charakterisirung der Einzelsysteme der Einzelmundarten
(letzteres Wort im allerstrengsten Sinne genommen)
zu erwarten ist ; denn nur auf diese Weise kommt das
nun einmal als Factor im Sprachleben mitwirkende subjective
Moment der Lautauffassung seitens der Sprechenden zu seinem
Rechte.
Sollen nun, wie die vergleichende Sprachforschung es fordert,
Systeme verwandter Mundarten und Sprachen, die aus
einem gemeinschaftlichen Grundsystem abgeleitet sind, mit
einander verglichen und in historischen Zusammenhang gebracht
werden, so ist freilich eine gewisse Verallgemeinerung
der für jene Einzelsysteme gegebenen Definitionen nicht zu
umgehen ; aber auch diese Verallgemeinerung wird sich je
nach den bestimmten Bedürfnissen des einzelnen Falles zu
richten haben. In dem vorliegenden Buche, dessen ausdrücklicher
Zweck der einer Einleitung in das Studium der
Lautgeschichte der indogermanischen Sprachen ist, sind z. B.
von vorne herein alle Laute principiell von der Betrachtung
ausgeschlossen worden, welche sich bisher nicht als Glieder
37indogermanischer Lautsysteme haben nachweisen lassen, z B.
die Schnalzlaute der Hottentotten oder die Kehlkopflaute der
semitischen Sprachen, soweit sie nicht etwa einmal eine beiläufige
Erwähnung finden. Dieser Zweck des Buches muss
denn auch den Ausschlag geben bei der Aufstellung der allgemeineren
Definitionen gewisser Lautgruppen, d. h. diejenigen
Formen eines ‘Lautes’ (d. h. wie oben ausgeführt,
aller derjenigen Schallvarietäten, welche herkömmlicher Weise
als lautliche Einheit gefasst werden) müssen von uns als Normalformen
betrachtet werden, welche mit einigem Grund als
die Normalformen der gemeinschaftlichen Stammmutter der
modernen indogermanischen Sprachen oder jedenfalls als die
historischen Vorgänger der modernen Laute zu erschliessen
sind.
Anm. 3. Es ist z. B. unten in § 12 ausgeführt, dass es zwei Arten
von l-Lauten giebt, deren eine bloss auf Resonanz des Stimmtones beruht,
während die andere ein eigenes Mundgeräusch hat. Ebenso zeigt § 24
dass es neben den spirantischen, d. h. auf Mundgeräuschbildung beruhenden
Lauten wie ð, Ʒ auch Formen ohne dieses Geräusch giebt, die also
auch nur aus resonatorisch verändertem Stimmton bestehen. Streng systematisch
müssten beide Lautclassen vollkommen parallelisirt werden ;
sie werden aber absichtlich getrennt, weil man Grund hat anzunehmen,
dass l mit Geräuschbildung innerhalb der indog. Sprachen das secundäre
sind, während sich für ð, Ʒ das umgekehrte wahrscheinlich machen lässt.
Ebenso spreche ich in § 22 von einer lateralen oder nasalen Degeneration
gewisser Laute, weil diese ‘Degenerationsformen’ eben nur unter gewissen
Bedingungen für andere Formen sonst erscheinender Laute auftreten, aber
niemals für sich isolirt erscheinen. Doch ist hin und wieder anmerkungsweise
auf die verschiedenen Möglichkeiten der Auffassung hingewiesen.
3. Wollen wir nun nach Erledigung dieser Fragen an die
systematische Betrachtung der indogermanischen Sprachlaute
näher herantreten, so ist zunächst an die oben S. 26 gegebenen
Factoren der Lautbildung anzuknüpfen : Exspiration,
Hemmung, Resonanz ; die erstere kann wieder nach
Stärke und Dauer, die Hemmung nach Grad und Ort verschieden
sein. Jeder dieser Factoren kann theoretisch zum
Ausgangspunkte einer Eintheilung gemacht werden, ebenso
aber auch ferner der akustische Gesammtwerth der
Sprachlaute, der aus dem Zusammenwirken aller Factoren
resultirt. Welcher von allen diesen Ausgangspunkten praktisch
zum obersten Eintheilungsgrunde zu machen sei, darüber
lässt sich streiten ; doch scheint es für unseren Zweck
am vortheilhaftesten, mit der Erwägung der akustischen Eigenschaften
38zu beginnen und die Erörterung der übrigen Eintheilungsgründe
nachfolgen zu lassen. Doch halte man dabei
stets im Auge, dass auch diese anderen Eintheilungsgründe,
obschon aus praktischen Rücksichten hier an zweite Stelle gesetzt,
an sich von nicht geringerer Bedeutsamkeit sind als der
akustische Werth eines Lautes.39
II. Abschnitt.
Die Gruppen der Sprachlaute und die Einzellaute.
I. Die Gruppen.
§ 6. Die Sprachlaute nach ihrem akustischen Werthe.
(Sonore und Geräuschlaute).
Wie bereits oben S. 8 f. und 19 ff. ausgeführt wurde, erzeugt
das menschliche Sprachorgan zum Zwecke der Sprachbildung
Schälle von wesentlich zwiefacher Art. nämlich musikalische
Klänge und Geräusche. Die ersteren haben ihren Ursprung
ausschliesslich im Kehlkopf, ihre gemeinsame Grundlage ist
der Stimmton, die letzteren werden mit geringen Ausnahmen
(s. § 17) im Ansatzrohr gebildet. Den vollkommensten akustischen
Gegensatz bilden daher Laute, welche entweder aus
bloss resonatorisch verändertem (s. S. 24 f.). Stimmton oder aus
bloss resonatorisch veränderten Geräuschen bestehen. Hiernach
ergeben sich zunächst zwei Hauptclassen der Sprachlaute :
I. Sonore (Reine Stimmtonlaute, Stimmlaute),
II. Geräuschlaute.
Diese Geräuschlaute an sich sind im Gegensatz zu den bei
tönender Stimme hervorgebrachten Sonoren als tonlos zu
bezeichnen.
Es ist aber auch möglich, Stimmton und Ansatzrohrgeräusch
bei der Bildung eines Sprachlautes zu vereinigen : dies
geschieht z. B. beim franz. engl. v oder z, wie man nach den
oben S. 9 gegebenen Andeutungen leicht ermitteln kann.
Solche Mischlaute bilden in akustischer Hinsicht einen Übergang
zwischen Sonoren und Geräuschlauten, und man wird
sie daher, je nachdem das eine oder das andere Element
in ihnen vorwiegt und subjektiv als das wesentlichere empfunden
wird, der einen oder der anderen von diesen beiden
40Klassen näher beiordnen können. Mit den Sonoren bilden sie
wegen des Mittönens der Stimme die Gruppe der tönenden
(stimmhaften) Laute ; mit den reinen Geräuschlauten
werden sie durch die beiden gemeinschaftliche Geräuschbildung
zusammengehalten, sie sind aber dann im Unterschied
von den bloss auf Geräuschbildung beruhenden tonlosen
(stimmlosen) Geräuschlauten als tönende oder halbsonore
Geräuschlaute zu bezeichnen.
Anm. 1. Man achte genau auf den Unterschied der Begriffe tönend
und sonor ; ein j eder Sonorlaut ist zwar eo ipso auch tönend, aber nicht
umgekehrt ein jeder tönende Laut auch ein Sonorlaut. Ebenso hüte man
sich vor Verwechselungen zwischen sonor und sonantisch. Sonor bezeichnet
einen gewissen akustischen Werth gewisser Laute, sonantisch
aber bezieht sich auf die Verwendung beliebiger Laute in der Silbenbildung.
Eine absolut feste Grenze zwischen den Sonorlauten und
den tönenden Geräuschlauten kann nicht gezogen werden, da,
wie später ausgeführt werden wird, durch Veränderungen in
dem Verhaltniss von Exspiration und Articulation einem Sonorlaut
Geräusche beigemischt, oder einem Geräuschlaut sein
specifisches Geräusch entzogen werden kann. Wir haben aber
Grund anzunehmen, dass in den älteren indogermanischen
Sprachen nur drei Gruppen von Lauten normaler Weise als
Sonorlaute gebildet wurden, nämlich die sogenannten Vocale,
die Liquidae (d. h. die l- und r-Laute) und die Nasale.
Diese fassen wir daher auch hier allein als die eigentlichen
Sonorlaute auf ; alle übrigen Laute werden zu den Geräuschlauten
gerechnet. Hieraus ergibt sich weiter, dass, wenn etwa
ein l- oder r-Laut, oder ein Nasal mit einem Geräusche gebildet
wird, wir diese Form als eine abgeleitete betrachten,
wie umgekehrt auch die rein sonor gebildeten Nebenformen
von Lauten, welche nach diesem Gesichtspunkte der Gruppe
der Geräuschlaute zufallen sollten.
Anm. 2. Die Eintheilung der Sprachlaute in Sonore und Geräuschlaute
ist für das Indogermanische von wesentlicher Bedeutung. Im Sanskrit
wirken z. B. die Sonorlaute in anderer Weise auf den Sandhi ein, als
die Geräuschlaute (Whitney, Ind. Gramm. § 117, vgl. unten § 42). Vor
allem aber ist zu bemerken, dass die Sonorlaute in der indogermanischen
Grundsprache als Sonanten fungiren konnten, alle Geräuschlaute aber
stets nur als Consonanten auftraten (vgl. namentlich K. Brugman, Nasalis
sonans in der indog. Grundsprache, in Curtius' Studien IX, 287 ff. und
die neueren Untersuchungen über indogermanischen Vocalismus).
Anm. 3. Die vorstehenden Bestimmungen sind sämmtlich nach
Massgabe der beim lauten Sprechen eintretenden Erscheinungen gemacht
worden. Sie treffen aber auch auf die Flüsterstimme ohne weiteres zu, sobald
41man statt des Stimmtons überall das Flüstergeräusch einsetzt. Die
Terminologie braucht deswegen für diese nicht besonders abgeändert zu
werden.
§ 7. Die articulationsarten.
Die Articulationen des Kehlkopfs.
Ueber diese ist bereits oben S. 19 f. das Notwendigste
beigebracht. Die Stimmritze steht entweder offen und lässt
die exspirirte Luft ungehemmt durchstreichen (dies ist der Fall
bei allen tonlosen Lauten, ausser den wenigen mit Kehlkopfverschluss
gebildeten, vgl. § 17, 4) ; der Kehlkopf selbst
nimmt also an der eigentlichen Articulation keinen Antheil.
Oder die Stimmritze ist so weit verengt, dass die ausgeathmete
Luft an den Rändern der Stimmritze ein reibendes Geräusch
erzeugt (dies ist zum Theil der Fall beim h, s. § 17,
1, 3, und mit stärkerer Engenbildung namentlich bei allen
geflüsterten Lauten). Drittens kann die Stimmritze so
weit verengt sein, dass die Stimmbänder durch die austretende
Luft in tönende Schwingungen versetzt werden (dies
geschieht bei allen tönenden Lauten). Viertens endlich
kann die Stimmritze vollkommen verschlossen werden (dies
tritt z. B. ein bei der Bildung des Spiritus lenis. § 17, 1, 2,
und gewisser Tenues, § 17, 4).
Die Articulationen des Ansatzrohres.
a. Die Gestalt des Nasenraumes kann nicht willkürlich
verändert werden. Nimmt er also überhaupt an der Lautbildung
Theil, so dient er entweder als blosser Resonanzraum
(z. B. bei den sog. Nasalen m, n, nu. s. w., oder den nasalirten
Vocalen etc.), oder die hindurchstreichende Luft bringt an
den Engen des Canales ein reibendes Geräusch hervor (wie
z. B. beim Schnaufen durch die Nase).
b. Die Articulationsformen des Mundraumes sind denen
des Kehlkopfes ähnlich ; nur fehlt beim Mundraum eine Stellung,
welche einen musikalischen Ton erzeugte. Dafür ist
aber die Zahl der möglichen Articulationsformen desselben
dadurch erhöht, dass er zwei veränderliche Ausgänge hat,
nämlich durch die eigentliche Mundöffnung und durch die
Nase. Sehen wir von der letzteren zunächst ab, so ergeben
sich folgende drei principiell verschiedene Stellungen des
Mundes.
1. Der Mundcanal ist durchgehends so weit geöffnet,
42dass die ausgeathmete Luft ohne Erzeugung eines
Mundgeräusches hindurchströmt ; der Mundraum dient dann
bloss als Resonanzraum. Dies ist der Fall bei allen Sonoren.
2. Der Mundcanal ist so weit verengt, dass der Exspirationsstrom
an den Rändern der Enge ein reibendes Geräusch
erzeugt ; dies geschieht z. B. bei Lauten wie f, s, ch,
oder franz. engl. v, z u. ä.
3. Der Mundcanal ist an einer Stelle vollkommen geschlossen,
z. B. an den Lippen bei b, p, hinter oder an
den Zähnen bei d, t, am Gaumen bei g, k, aber auch z. B.
bei den sog. Nasalen m, n, n, s. unten.
Mit diesen Stellungen combiniren sich nun die verschiedenen
Stellungen, welche das Gaumensegel als Regulator
des zweiten Mundausganges einnimmt. Dieser letzteren
scheint es nur zwei zu geben, da bisher eine Stellung desselben
nicht beobachtet worden ist, welche zur Erzeugung
eines Reibungsgeräusches durch einen durch die Nase geführten
Luftstrom diente. Es kommen also nur folgende Stellungen
in Betracht :
4. Der Nasenraum ist durch Anpressen des Gaumensegels
an die hintere Rachenwand abgesperrt, also von der
Articulation ausgeschlossen. So werden die meisten Sprachlaute
gebildet ; man kann dieselben demnach als reine Mundlaute
bezeichnen.
5. Der Eingang zum Nasenraum ist durch Senkung
des Gaumensegels geöffnet. Bei dieser Stellung entstehen
Laute, die man als Mundnasenlaute charakterisiren
kann, weil bei ihrer Erzeugung sowohl Mund- wie
Nasenraum betheiligt sind. Bezüglich der Verschiedenen Betheiligungsweisen
des Nasenraumes s. oben unter a.
Nennen wir alle diejenigen Geräusche, welche durch Reibung
eines Luftstroms an den Rändern einer Enge entstehen,
Reibelaute oder Spiranten (auch Fricativae wird dafür
gebraucht), alle diejenigen Sprachlaute aber, welche mittelst
eines völligen Verschlusses des Sprachorganes gebildet
werden, einstweilen Verschlusslaute, so ergeben sich aus
den oben angegebenen Factoren folgende verschiedene Lautgruppen :
1. Aus 1 und 4 die rein sonor gebildeten Arten der
Vocale und Liquidae (§ 10 ff.).
2. Aus 1 und 5 die nasalirten Vocale und Liquidae
(§ 10 ff.)-43
3. Aus 2 und 4 die Mundspiranten oder Spiranten
im engeren Sinne ; z. B. tonloses/, s, choder tönendes v, z,
Ʒ (§ 15).
4. Aus 2 und 5 würden sich nasalirte Spiranten ergehen :
man kann zwar solche bilden, z. B. ein nasalirtes
tönendes z, aber in der empirischen Sprache scheinen sie
nicht vorzukommen, da durch die doppelte Oeffnung des
Mundraumes der Luft ein zu geräumiger Ausweg geschaffen
ist, als dass Reibungsgeräusche mit Leichtigkeit entstünden.
5. Aus 3 und 4 die Mundverschlusslaute oder Verschlusslaute
im engeren Sinne ; hierher gehören die sog.
Tenues k, t, p und Mediae g, d, b nebst ihren Aspiraten (§ 14).
6. Aus 3 und 5 die sogenannten Nasale, m, n, n u. s. w.
(§ 13), die, wie bereits oben angeführt, als nasalirte Mundverschlusslaute
aufgefasst werden können.
Die Praxis hat diese 6 Klassen von Lauten, aus denen
ohnehin die vierte in Wegfall kommt, noch weiter reducirt,
indem sie die zweite nur als eine Unterabtheilung der ersten
betrachtet, während sie 5 und 6 als getrennte Klassen bestehen
lässt. Ein Gesammtname für die in unserer ersten Klasse
vereinigten Laute ist bisher nicht üblich gewesen, man kann
dafür etwa Mundsonore gebrauchen ; Klasse 2 wäre demnach
als die der nasalirten Mundsonoren zu bezeichnen :
Klasse 3 und 5 pflegen schlechthin als Spiranten und Verschlusslaute
aufgeführt zu werden ; für Klasse 6 ist von
Alters her der Name Nasale üblich gewesen ; seit Brücke ist
dafür auch der nichtssagende Name Resonanten aufgenommen,
der besser vermieden wird.
An Kehlkopflauten kommen hierzu noch der Stimmton,
das h als Kehlkopfspirans und der Spiritus lenis als Kehlkopfverschlusslaut ;
diese aber erscheinen stets nur als Begleiter
oder Bestandtheile von Lauten, die ihre specifische Form
erst im Ansatzrohr erhalten und kommen deshalb erst bei der
Combinationslehre in Betracht.
Anm. 1. Man unterscheide in der Praxis scharf zwischen einem Nasal
als einem Laute unserer sechsten, und einem nasalirten Laute als einem
unserer zweiten (und vierten) Klasse. Namentlich aber muss vor einer
Vermischung der dritten und fünften Klasse, insbesondere vor einer Verwechselung
der Ausdrücke Spirans (zu Kl. 3) und Aspirata (zu. Kl. 5)
nachdrücklichst gewarnt werden. Die grosse Verwirrung, an welcher lange
Zeit z. B. die Lehre von der Entwickelung der Medialaspiraten in den
indogermanischen Einzelsprachen litt, ist wesentlich eine Folge unklarer
Vorstellungen auf diesem Gebiete gewesen. Obwohl die hier in Betracht
44kommenden Verhältnisse so ausserordentlich einfach sind, hat man doch
die in sich selbst widerspruchsvollsten Definitionen mit Ruhe hingenommen ;
wie wenn z. B. Corssen das lat. f als eine ‘labiodentale Spirans mit
festem Kern’ bezeichnete. Von einem solchen Kern, unter dem wohl ein
Verschluss verstanden werden soll, kann natürlich bei einer Spirans
keine Rede sein. Geht der Spirans ein Verschluss voraus, so bekommen
wir einen Doppellaut, eine Affricata, d. h. Verschlusslaut + Spirans
(s. unten § 21, 1), folgt der Oeffnung des Verschlusses ein einfacher Hauch
(statt der Spirans), so entsteht das was wir Aspirata nennen (s. unten
§ 17, 4). Zu den Verschlusslauten gehören eben nur die sog. Tenues
und Mediae nebst deren Aspiraten nach der landläufigen Terminologie ;
zu den Spiranten dagegen alle übrigen Geräuschlaute, insbesondere
auch die nur in Folge missverständlicher Namensübertragung so vielfach
fälschlich als Aspiraten bezeichneten lat. deutschen f und ch, engl. th,
oder φ, χ, ϑ der neugriechischen Aussprache.
Noch eines muss gleich hier noch über die sog. Verschlusslaute
bemerkt werden. Die blosse Verschluss Stellung
an sich wirkt natürlich niemals schallbildend ; bei tonloser
Exspiration bedeutet Verschluss beider Ausflussöffnungen
des Mundraumes einfach völliges Aufhören jeder Schallbildung,
ebenso jeder Verschluss der Glottis. Bei tönender
Stimme kann allerdings die Verschlussstellung des Mundes
schallmodificirend wirken (s. unten § 17, 4), das eigentlich
Charakteristische bei den Verschlusslauten aber ist der Akt des
Verschlusses und die Lösung desselben, also diejenigen
beiden Momente, welche der Verschlussstellung vorausgehn
und ihr folgen. Da aber diese drei Momente (Verschliessung,
Verschlussstellung, Oeffnung) nothwendiger Weise mit einander
verbunden sind, so betrachten wir das phonetische Resultat
derselben praktisch doch als nur einen Sprachlaut.
Das Nähere hierüber s. unten § 17,4 und 20, 2.
Anm. 2. Das indische System stellt die Nasale wegen ihrer Mundcanalverschlüsse
zu den Verschlusslauten, und einige Neuere möchten sich
demanschliessen. Es ist in der That nicht unwichtig, auf diese Verschlüsse
bei den Nasalen hinzuweisen, sie spielen bei der Combination der Laute
eine wesentliche Rolle. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass doch
der Nasencanal bei ihrer Hervorbringung geöffnet ist, und dass sie dadurch
den Vocalen und Liquiden, überhaupt allen Lauten nahe stehen,
die nicht mit völligem Verschluss aller Luftwege gebildet werden. Sonst
müsste man ja auch unter Umständen jene anderen Laute wegen der Absperrung
des Nasencanales als Verschlusslaute bezeichnen. Auch das l,
welches wie die Dentale t, d, neine Absperrung des Mundcanals in der
Mittellinie des Mundes aufweist (§ 12, 2), gehört insofern zu diesen Halbschlusslauten.45
§ 8. Das System der Articulationsstellen.
Die Geräuschlaute entstehen, wie wir oben S.24 und öfter
gesehen haben, dadurch, dass irgendwo im Ansatzrohr eine
Enge oder ein Verschluss gebildet wird, welcher den exspirirten
Luftstrom in Schallschwingungen versetzt. Den Ort
dieser Engen- oder Verschlussbildung nennen wir die Articulationsstelle
des betreffenden Lautes ; wir sagen also
z. B. Dass p, b, m (abgesehn von dem eventuell begleitenden
Stimmton) ihre Articulationsstelle an den beiden Lippen, das
f die seinige zwischen Unterlippe und Oberzähnen habe u. s. f.
Solche Articulationsstellen nun haben alle Sprachlaute,
auch die Sonoren ; das sonore m teilt z. B. den Lippen verschluss
mit p, b, das sonore l die Stellung der Vorderzunge
mit t, d, n. Der Unterschied ist nur dieser, dass bei den Geräuschlauten
die Articulationsstelle schallbildend auftritt ; bei
den Sonoren dagegen bedingt sie nur die Gestalt des Resonanzraumes
und dadurch die specifische Modification des
Stimmtones derselben.
Die Bestimmung der Articulationsstelle eines Lautes gelingt
um so leichter, je prägnanter ausgeführt die Einengung
des Mundcanals, (bis zum völligen Verschluss) ist ; daher bieten
die Laute, welche durch Articulation der mittleren Zungenpartien
gegen den Gaumen gebildet werden, viel erheblichere
Schwierigkeiten für die Bestimmung dar, als die anderen
Laute, zumal man meist auf Tastversuche angewiesen ist. Am
schwierigsten sind im Allgemeinen die Articulationen der
Vocale zu fixiren, weil bei diesen am wenigsten prägnante
Verengungen des Mundcanales auftreten. Es soll daher ihre
Beschreibung bis zu dem die Einzelvocale behandelnden Abschnitt
aufgehoben und hier nur von den schärfer hervortretenden
Articulationsstellen der übrigen Laute gehandelt
werden.
Anm. 1. Einen sehr wesentlichen Fortschritt in der genaueren Bestimmung
der Articulationsstellen bezeichnet die sehr sinnreiche Färbungsmethode
von Oakley-Coles und Grützner (S. 204 u. ö., vgl. auch
Techmer S. 30). Grützner bestreicht die trocken abgewischte Zunge dick
mit Carmin- oder chinesischer Tusche, und articulirt dann möglichst deutlich
und zwanglos die Laute. Hierauf wird der Mund geöffnet gehalten und
bei passendem Licht mit einem grossen Kehlkopfspiegel, der schräg oben
nach dem Gaumen sieht, und einem gewöhnlichen Toilettenspiegel betrachtet.
Grützner bemerkt dass die Bilder desselben Lautes bei verschiedenen
Personen etwas wechseln, bei ein und demselben Individuum aber
46fast constant sind. Abbildungen des l, Zungen-r, s, š giebt Grützner
S. 204. 207. 219. 221 ; anderes bei Tecbmer, Atlas tab. IV.
Es fragt sich hier zuerst, wieviele solcher Articulationsstellen
wir anzunehmen haben, und wie dieselben zu einander
liegen.
Im Anschluss an die Lautsysteme des Griechischen und
Lateinischen pflegte man sonst nur drei verschiedene Articulationsstellen
anzunehmen, deren Produkte als gutturale,
dentale und labiale Laute bezeichnet wurden. Nach der
Kenntnissnahme vom Sanskrit fügte man hierzu noch die sog.
palatalen und cerebralen Laute, die man nach dem indischen
Lautsystem zwischen Gutturalen und Dentalen einschob.
Das so entstehende System ist indessen physiologisch
nicht ohne Weiteres verwendbar. Die Rücksicht auf die bei
der Bildung der einzelnen Laute betheiligten Organe wie auf
die Lautgeschichte fordert vielmehr, wie Winteler gezeigt
hat, zunächst eine Zweitheilung, in Lippenlaute oder Labiale,
die nur vermittelst der Lippen unter gelegentlicher
Zuhülfenahme der Zähne, und Zungengaumenlaute oder
Linguopalatale, die vermittelst der Articulation irgend
eines Zungentheiles gegen irgend einen Theil des weichen
oder harten Gaumens, eventuell auch der Zähne (jedenfalls
also gegen einen Theil des innern Mundraumes) hervorgebracht
werden. Als dritte Gruppe schliessen sich diesen die
velaren Laute an, die durch Articulation des weichen Gaumens
gegen die hintere Rachen wand erzeugt werden.
Es versteht sich übrigens aus der Unabhängigkeit der
Lippen- und Zungenarticulationen von einander von selbst,
dass beide auch gleichzeitig bei der Bildung eines Lautes
mitwirken können. Das Weitere hierüber wird die Combinationslehre
bringen.
An Einzelheiten ist folgendes zu bemerken :
1. Die Lippenlaute.
Die Lippenlaute zerfallen je nach der Nichtbetheiligung
oder Betheiligung der Zähne an der Articulation in bilabiale
(rein labiale, labiolabiale) und labiodentale.
Zu den ersteren gehören unsere gewöhnlichen b, p, das
mitteldeutsche w und der Articulation nach auch das rein
sonore m. Hier sind die beiden Lippen entweder bis zum völligen
Verschluss zusammengebracht (wie bei b, p, m) oder
einander bis auf einen kleinen Spalt genähert (wie beim w).
47Die Labiodentalen entstehen dagegen durch leichtes Anpressen
der Unterlippe an die Oberzähne : die Oberlippe bleibt zwar
in der Ruhelage, doch nimmt sie in den meisten Fällen ebenfalls
an der Lautbildung Antheil.
Die Variationsfähigkeit der Labiale ist (abgesehen natürlich
von ihren Modificationen durch gleichzeitige Zungenarticulationen)
im Ganzen keine sehr grosse ; alles in dieser Richtung
zu Beobachtende ergibt sich leicht durch das S. 13 f. über
die verschiedenen Formen der Lippenarticulation Bemerkte.
2. Die Zungengaumenlaute.
Viel grössere Mannigfaltigkeit und damit erhöhte Schwierigkeiten
für die Classificirung bieten die Linguopalatale.
Die articulirenden Theile sind hier der Gaumen, genauer die
obere Innenfläche des Mundraumes, und die Zunge. Die
letztere allein aber ist eigentlich das bewegliche Instrument
der Articulation. Durch ihre Formveränderungen (unterstützt
durch die Hebung und Senkung des Unterkiefers) werden
hauptsächlich die betreffenden Engen oder Verschlüsse zu
Wege gebracht. Der Gaumen verhält sich dabei mehr passiv,
namentlich der ganze harte Gaumen. An dem festen Dache
des Mundraumes werden daher am besten die Orte zu markiren
sein, an denen die Articulation stattfindet. Ein zweiter
Gesichtspunkt für die Charakteristik der Linguopalatale ist
gegeben in der Frage nach der Form der Theile mit welchen
die Zunge articulirt.
Gehen wir, um die Frage, nach den Orten der Articulation
zu beantworten, von den sog. ‘Gutturalen’ aus. so ist
der äusserste Verschlusslaut dieser Reihe nach rückwärts zu
ein tiefes k, das durch Berührung des hintern Zungenrückens
mit dem äussersten Saume des Gaumensegels (dem hintern
Gaumenbogen) gebildet wird. Es ist nun ohne Weiteres klar,
dass man von hieraus nach vorn fortschreitend nach einander
jeden Theil der Zunge mit einem entsprechend gelegenen
Theile des Gaumens in Berührung bringen, dass man die Berührungsstelle
ganz allmählich und unmerklich von hinten
nach vorn verschieben kann. Jeder der verschiedenen Berührungsstellen
muss natürlich ein eigener Laut entsprechen, und
ganz analog verhalten sich die neben den Verschlüssen einhergehenden
Engenbildungen und ihre Lautprodukte. Man
bekommt also eine continuirlich abgestufte Reihe von Lauten,
48deren Anzahl der Theorie nach unendlich ist. In der
Praxis aber werden jedesmal eine ganze Reihe solcher Laute,
die sich durch einen wesentlich gleichen Klangcharakter auszeichnen,
zu einer Einheit zusammengefasst, sodass für die
Articulation eines jeden Lautes ein gewisser Spielraum innerhalb
bestimmter Grenzen gelassen wird. Unsere Ausdrücke
Palatale, Dentale, Gutturale u. s. w. weisen also wie die meisten
Namen für Sprachlaute oder deren Gruppen nicht auf
eine absolut feststehende Articulation oder einen unabänderlich
fixirten Sprachlaut, sondern sie bezeichnen nur ganze
Lautkategorien, deren Anordnung sich nach der Verwandtschaft
ihrer Articulationsweisen und deren Anzahl sich nach
ihrem Vorkommen in gegensätzlicher Verwendung bestimmt
(s. oben S. 33 f.). Im Allgemeinen aber wird es genügen, zunächst
drei grosse Gebiete, ein vorderes, mittleres und
hinteres aufzustellen, je nachdem die Laute mit der Zungenspitze,
dem mittleren oder hinteren Theile des Zungenrückens
articulirt werden. Das erstere umfasst, wie man sieht,
die Dentale des alten griechischen Systemes (einschliesslich
der sanskritischen Cerebrale), das zweite die sog. Palatale,
das dritte die eigentlichen Gutturale.
Was den zweiten Punkt anlangt, so sind zu unterscheiden :
A. Mediane Articulationen ; die Articulationsstelle
liegt in der Mittellinie des Mundes, und zwar
1. Coronale Articulation ; die Articulation wird
durch den vorderen Zungensaum bewirkt, welcher sich
als eine mehr oder weniger scharfe Kante dem Gaumen entgegenstellt
(z. B. beim Zungenspitzen -r und verschiedenen
der sog. Dentallaute).
2. Dorsale Articulation ; die nothwendigen Engen
resp. Verschlüsse werden durch Emporheben eines Theiles des
Zungenrückens (z. B. beim/des vordem, bei k, ch des
hintern) zum Gaumen gebildet.
B. Laterale Articulation ; hier liegen die charakteristischen
Engen oder Verschlüsse zwischen den Seitenrändern
der Zunge und den Backenzähnen (bei den l-Lauten).
Die Articulationen des hinteren und mittleren Theiles der
Zunge sind aus leicht ersichtlichen Gründen sämmtlich dorsal,
was die Gestalt der Zungenoberfläche anlangt (wodurch laterale
Articulation natürlich nicht ausgeschlossen ist). Die
Zungenspitze aber vermag wegen ihrer grösseren Beweglichkeit
49sowohl coronal als dorsal zu articuliren. So bilden denn
die sog. Dentale im herkömmlichen Sinne des Wortes eine
Vermittelung zwischen den Gruppen coronaler und dentaler
Bildung, indem man zu ihnen sowohl coronal als dorsal gebildete
Laute rechnet. Eine Art Uebergangsstufe scheinen die
gewöhnlichen s-Laute zu bilden. Bei diesen ist nämlich der
äusserste Zungenrand ein wenig nach unten umgeknickt, sodass
die eigentliche Enge mit einem dicht hinter dem Zungensaume
gelegenen Theile des Zungenrückens gebildet wird.
Für diesen Theil der Zungenspitze hat Sweet den Ausdruck
blade ‘Zungenblatt’ eingeführt.
Anm. 1. Ueber die Notwendigkeit der Unterscheidung coronaler und
dorsaler Articulation s. Michaelis, Ueber die Physiologie und Orthographie
der s-Laute, Berlin 1862, und Kuhn's Zeitschr. XXIII, 51S ff.
Nur fasst Michaelis den Begriff ‘dorsal’ enger, indem er ihn nur für die
zwischen dem Zungenrücken und dem vorderen Theile des Gaumens oder
den oberen Schneidezähnen gebildeten Laute anwandte. Statt ‘coronal’
sagt Michaelis ‘apical’, was mir weniger passend erscheint, da man dabei
unwillkürlich zu sehr bloss an die vordere Spitze denkt : jedenfalls aber
hatte Michaelis Recht, den früher von mir gebrauchten missverständlichen
Ausdruck ‘oral’ statt ‘coronal’ zu verwerfen. — Die laterale Articulation
ist wenn man will nur eine Unterabtheilung der allgemeinen Kategorie
der Randarticulationen der Zunge ; die andere Abtheilung derselben
bilden die coronalen.
Hiernach gewinnen wir folgende Gruppen von Zungengaumenlauten :
A. Mediane Articulationen.
1. Vorderes Gebiet.
In der Indifferenzlage ruht die Zungenspitze hinter den
Unterzähnen. Sie kann von dort ausgehend stufenweise gehoben
und mit entsprechenden Theilen der beiden Zahnreihen,
der Alveolen der Oberzähne und des harten Gaumens
in Berührung gebracht oder diesen genähert werden. Hat sie
so die obere Grenze der Alveolen überschritten, so kann sie
selbst etwas nach hinten übergebogen werden. Die Unterfläche
der Zunge wird dabei nach vorn zu convex und berührt
theilweise den harten Gaumen (Brücke S. 36 f.). Die Articulation
selbst kann dabei entweder coronal oder dorsal sein,
vgl. oben S. 49.
Dies ganze Articulationsgebiet pflegt die vergleichende
Grammatik im Anschluss an das indische Lautsystem gewöhnlich
nur in zwei Unterabtheilungen zu zerlegen, die der
50Cerebrale und Dentale. Brücke theilte sodann die letztere
Gruppe wieder in Alveolare, Dorsale und (eigentliche)
Dentale ein, fasst aber selbst innerhalb seiner Dentale
Laute von ganz verschiedenem Mechanismus zusammen, indem
er z. B. lehrt, dass ein ‘dentales’ t gebildet werden könne,
‘indem man die Zahnreihen ein wenig von einander entfernt
und den Spalt mit dem Zungenrande verstopft, oder indem
man den Rand der flach liegenden Zunge ringsum an die
obere Zahnreihe anpresst, oder endlich indem man die Spitze
der flach liegenden Zunge nach abwärts biegt und hart über
derselben durch festes Aufdrücken der Oberzähne den Verschluss
bildet’ (Grundz. 1 37). Nach ihm hat dann namentlich
zuerst Michaelis strenger die Orte und Arten der Articulation
(ob dorsal oder coronal gebildet) zu unterscheiden gelehrt, da
diese namentlich bei der Bildung von Spiranten (s-Lauten)
sehr wesentlich sind. So erhalten wir von oben beginnend :
a. Laute coronaler Articulation.
1. Cerebrale (dies die übliche, wenn auch falsche Übersetzung
des sanskr. mūrdhanya, des indischen Namens dieser
Lautclasse) oder cacuminale (M.Müller), auch höchst unpassend
von einigen als linguale bezeichnet ; deutlicher ist
der englische Name ‘inverted’. Die Zungenspitze ist hier
nach dem Gaumendache auf- und zurückgebogen. Dorsal gebildete
Nebenformen dieser Classe giebt es meines Wissens
nicht, die angegebene Zungenstellung lässt ihre Bildung nicht
wohl als möglich erscheinen. — Es fallen hierher die bekannten
Cerebrallaute der dravidischen Sprachen und des
Sanskrit (t, th, d, dh1 n, s, r, Brücke's t2, d2u. s. w., Sweet's
(t+), (d+) u. s. w.), auch im Schwedischen sind sie häufig ; im
Englischen kommt cerebrales r dialektisch vor.
2. Alveolare, Brücke's tl, d' u. s. w., Sweet's point
consonants, Lundell's Supradentale. Der Zungensaum
wird durch Hebung der Vorderzunge nach den Alveolen
der Oberzähne hingeführt, ohne die Oberzähne selbst zu berühren,
aber auch ohne ersichtliche Rückbiegung der Zunge,
die zu cerebraler Articulation führen würde. Bei der räumlichen
Ausdehnung der Alveolen sind eine ziemliche Anzahl
von Varietäten möglich ; man kann etwa vordere und hintere
Alveolare unterscheiden, je nachdem die eigentliche Articulationsstelle
mehr an der Unterfläche oder der nach innen gewendeten
51Seite der Alveolen stattfindet. Alveolare t, d, n
u. s. w. sind in Deutschland sehr verbreitet.
3. Postdentale (Lundell), Sweet's point-teeth consonants,
von Michaelis noch unterschieden in Superficiale
(nach der superficies interna dentis) und Marginale,
je nachdem die Articulation zwischen Zungensaum
und der Hinterfläche oder dem untern Rande der Oberzähne
stattfindet. Hierher gehören die t, dmancher Sprachen, auch
z. Th. das engl. th. Brücke's t4, d4u. s. w. umfassen auch
noch die folgende Gruppe, die
4. Interdentale (Brücke, Sweet, Lundell). Wir verstehen
hierunter nur diejenigen Laute, bei welchen der Zungensaum
selbst den Spalt zwischen den beiden Zahnreihen
verstopft. Hierhergehören z. B. die t, ddes Armenischen und
anderer orientalischer Sprachen, neugr. #, auch oft engl. th.
Diese Interdentalen halten die neutrale Mitte zwischen
coronaler und dorsaler Articulation, indem die Vorderzunge
flach und ohne Knickung ausgebreitet daliegt. Sobald eine
Hebung derselben stattfindet, gelangen wir zu der Articulationsweise
der Postdentalen, Alveolaren und Cerebralen. Wird
aber die Zungenspitze nach unten gedrückt und ein weiter
rückwärts gelegener Theil der Zunge gehoben, so bekommen
wir die specifische Articulationsfonn der
b. Laute dorsaler Articulation.
Brücke beschreibt nur eine Art dorsaler Laute der Vorderzunge,
die er schlechthin Dorsale nennt (Lundell's Dentipalatale).
Sein dorsales t wird z. B. gebildet, indem man
mit dem vorderen convex gemachten Theile des Zungenrückens
gegen den vorderen Theil des Gaumens schliesst,
während die Zungenspitze nach abwärts gebogen und gegen
die untern Schneidezähne gestemmt wird. Man kann aber
auch z. B. ein s bilden, dessen Enge zwischen dem Zungenrücken
und den Oberzähnen liegt, während der eigentliche
Zungensaum noch immer hinter den Unterzähnen ruht (so
wird z. B. das franz. s, z articulirt). Manche Personen, die
mit der Zunge ‘anstossen’, bilden ein s zwischen dem ‘Zungenblatt’
und der Kante der oberen Schneidezähne. Man
kann also fast alle die Articulationen auch dorsal bilden die
oben bei den coronalen Lauten aufgeführt wurden. Eine
praktische Einschränkung erfährt dieser Satz aber dadurch,
dass die dorsale Wölbung des Zungenblattes die Bildung rein
52postdentaler Verschlusslaute fast unmöglich macht, da gar
leicht bei dem Versuche dazu auch die obern Alveolen mit
berührt werden. Jedenfalls aber ist das dorsal-dentale
franz. s von den dorsal-alveolaren t-Lauten Brücke's
zu trennen.
Anm. 2. Die Scheidung der Laute dorsaler Bildung rührt wieder zunächst
von Michaelis her. — Uebrigens lässt sich der Unterschied der
beiden zuletzt genannten Gruppen deutlich fast nur bei den Spiranten
beobachten. Bei den Verschlusslauten ist die Berührungsfläche von Zungenrücken
und Gaumen meist so breit, dass es schwer ist deren Begrenzung
genügend zu ermitteln.
2. Mittleres Gebiet (Palatale).
Unter Palatalen (Praepalatale Lundell) verstehen
wir die durch Articulation des mittleren Zungenrückens gegen
den harten Gaumen gebildeten £-ähnlichen Verschlusslaute
und die diesen entsprechenden Spiranten. Dieser Art sind
z. B. diejenigen k-Laute, welche die Slaven, aber auch viele
deutsche Mundarten vor den sog. ‘weichen’ oder ‘palatalen’
Vocalen (ä, e, iu. ähnl.) bilden, von Spiranten der deutsche
ich-Laut, u. dgl. Man sieht, dass bei der Ausdehnung des
Articulationsgebietes, das sich von der hintern Grenze der
Alveolen bis zum weichen Gaumen erstreckt, wieder eine
grosse Mannigfaltigkeit von Lauten möglich ist. Man kann
dies leicht verfolgen wenn man der Reihe nach die Verbindungen
kä, ke2 (offenes e), ke1 (geschlossenes e),ki2 (offenes i),
ki1 (geschlossenes i) spricht. Je weiter man sich dem Ende
dieser Reihen nähert, um so mehr wird auch die Articulationsstelle
des k nach vorn verschoben. Man kann die einzelnen
Laute dieser Palatalgruppe nach Massgabe von § 23 etwa
durch einen übergesetzten Vocalexponenten bezeichnen (c*, ce
u. dgl.), oder auch zu genauerer Scheidung noch zunächst die
Unterabtheilungen der hinteren und vorderen Palatale
(c2, c1u. s. w.) verwenden.
Anm.3. Es ist besonders darauf zu achten, dass wir unter dem Namen
Palatalen nicht auch die zusammengesetzten tsch-Laute begreifen, die
man vielfach mit diesem Namen bezeichnet. Diese werden erst im folgenden
Abschnitt, § 21, 1, ihre genauere Besprechung finden.
3. Hinteres Gebiet (Gutturale).
Als Gutturale bleiben hiernach nur diejenigen Zungengaumenlaute
übrig, bei denen der hintere Zungenrücken
gegen den weichen Gaumen articulirt. Viele Sprachen unterscheiden
53hier abermals zwei Gebiete, das der vorderen
und der hinteren Gutturale (k1, g1und k2, g2etc. ; Mediopalatale
und Postpalatale Lundell). Zu der hinteren
Reihe gehören z. B. die tiefen Gutturale der semitischen
und mancher kaukasischen Sprachen (sem. koph, georgisch q),
von Spiranten z. B. das tiefe schweizerische ch und die diesem
entsprechenden tönenden Laute, die man vielfach als Ausartungen
des uvularen r findet (zu ihnen gehört auch das armenische
yit). Hier articulirt überall die Zunge mit dem
unteren Rande des weichen Gaumens. Zur vorderen Reihe
gehören die gewöhnlichen europ. k, gvora, o, uund ähnlichen
Vocalen, der deutsche ach-Laut u. a. m.
Für die Sprachgeschichte ergibt sich aus dem Gesagten
der Satz, dass eine continuirliche Lautreihe und also eine entsprechende
Lautentwickelung von den hinteren Gutturalen
bis zu den dorsalen Lauten der Vorderzunge besteht. Von
diesen gelangen wir zu den alveolaren und cerebralen Lauten
nur durch einen Sprung, insofern nicht etwa im einzelnen
Falle interdentale Laute den Uebergang vermittelt haben. Zu
den Labialen gelangen wir abermals nur durch einen Sprung
in der Articulation.
B. Laterale Articulationen.
Oben S. 49 wurde bereits ausgeführt, dass die specifische
Articulation der Laterallaute darin bestehe, dass ihre Articulationsstelle
zwischen den Seitenrändern der Zunge und den
Backenzähnen liege. Das bekannteste Beispiel derselben
sind die l-Laute, welche meist als Sonorlaute, aber auch spirantisch
und tonlos hervorgebracht werden. Laterale Verschlusslaute
finden sich, soweit bekannt, in den indog. Sprachen
nur vor oder nach l-Lauten als Vertreter von medianen
Verschlusslauten, namentlich Dentalen und Palatalen.
3. Die Velarlaute.
Bezüglich der Definition dieser Laute ist auf S. 47 zu verweisen.
Da nun, wie ebenfalls bereits früher (S. 43) angedeutet
wurde, kein eigenes Reibungsgeräusch zwischen Gaumensegel
und Rachenwand erzeugt wird, wenn das erstere
gesenkt ist, so ergibt sich von selbst, dass velare Reibelaute
einstweilen nicht zu statuiren sind. Dagegen kann
mit der Schliessung oder Oeffnung der Gaumenklappe in ähnlicher
54Weise ein Laut erzeugt werden, wie bei der Schliessung
und Oeffnung z. B.der Lippen einp- oder b-Laut. Wir fassen
diese beiden Akte sammt der Verschlussstellung auch hier zusammen,
und sprechen also von velaren Verschlusslauten.
Es liegt auf der Hand, dass ein Durchgang durch die
Verschlussstellung der Gaumenklappe überall da vorhanden
ist, wo ein reiner Mundlaut neben einem Mundnasenlaute gebildet
wird (vgl. S. 43 f.) ; aber als gesonderte Laute kommen
die Velarverschlüsse nur dann zur Geltung, wenn der Mundcanal
ebenfalls abgesperrt ist und die Schliessung oder Oeffnung
der Gaumenklappe der einzige schallbildende Articulationsakt
des Ansatzrohres ist. Man hört also z. B. den Oeffnungslaut
der Gaumenklappe in Worten wie Aetna, abmachen
beim Uebergang vom t zu n oder b zu. m, auch bei deutlicher
Articulation wohl noch den Uebergang von n zu t, mzu p in
Verbindungen wie Ente, Lampe(man muss aber dazu den
Verschluss ausführen, während die Stimme noch kräftig forttönt ;
bei unserer gewöhnlichen Weise der Silbenbildung,
welche das silbenschliessende n, mverklingen lässt, ehe der
Velarverschluss hergestellt wird, ist der letztere unhörbar) ;
aber kein solcher Velarlaut wird empfunden in Verbindungen
von Spiranten mit Nasalen, wie sna, smaoder ans, amsetc.,
eben so wenig bei Verbindung von beliebigen Mundlauten mit
Nasalvocalen ; in pq, fq etc. erfassen wir nur eben die Lippenlaute p f.
Es sind also die Velarlaute durchaus von den Mundverschlusslauten
abhängig und können daher als Unterabtheilungen
derselben betrachtet werden, die aus ihnen durch den
assimilatorischen Einfuss gewisser Mundnasenlaute hervorgehen.
Sie werden also wie die lateralen Verschlusslaute
hauptsächlich erst in der Combinationslehre weiter behandelt
werden.
§ 9. Die Sprachlaute nach ihrer Intensität und Dauer.
1. Die Intensität der Sprachlaute ist für diese selbst
nicht von so durchgreifender Bedeutung wie die bisher erörterten
Factoren der Lautbildung. Zu einem guten Theile
dient die Unterscheidung von Lauten grösserer oder geringerer
Stärke bloss den Zwecken der Silben- und Wortbildung, insofern
z. B. alle Laute einer exspiratorisch betonten Silbe
(§ 29. 33) durchgehends stärker sind als die einer unbetonten.
Diese Unterschiede dienen also nicht zur Charakteristik der
Sprachlaute an sich. Wohl aber treten in einigen Fällen auch
55Stärkeabstufungen auf, welche vom Accent durchaus unabhängig
und demnach als integrirende Charakteristica der
Sprachlaute zu betrachten sind. Prüft man z. B. mittelst des
oben S. 18 f. beschriebenen kleinen Apparates den Luftdruck
tonloser und tönender Parallellaute wie p und b, oder f und v
(indem man Verbindungen wie paba, oder bapa, fava, vafa
mit möglichst gleicher Intensität aller Silben spricht), so findet
man, dass derselbe bei allen tonlosen grösser ist, als bei den
entsprechenden tönenden. Es thut nichts zur Sache, dass man
ein leises p mit absolut geringerem Luftdruck aussprechen
kann als ein lautes, nachdrückliches tönendes b, es kommt nur
darauf an, dass bei sonst gleicher Sprechstärke die erwähnte
Abstufung vorhanden ist. In Beziehung auf das relative Mass
des Luftdruckes bei der Erzeugung ihres Geräusches sind daher
p und tönendes b, f und tönendes v einander als Fortis
und Lenis entgegenzustellen.
Zweierlei ist hierbei zu beobachten : einmal ist der geringere
Luftdruck im Munde bei den tönenden b. vgegenüber
p, foffenbar an sich nur die Folge der Hemmung des Expirationsstroms,
welche dieser im Kehlkopf durch das Einsetzen
der Stimmbänder zum Tönen erfährt, und zweitens liegt es
auf der Hand, dass die geringere Intensität, mit welcher die
specifischen Geräusche des b, verzeugt werden, nicht nothwendig
als der wesentlichste Unterschied dieser Laute von p,
f betrachtet werden müssen ; im Gegentheil, das Mittönen
der Stimme bei b, vwird immer das am ersten in die Ohren
fallende Merkmal sein. Aber alles dies stösst die Thatsache
nicht um, dass die specifischen Schälle des b, v, soweit sie im
Munde erzeugt werden, mit weniger intensiver Exspiration
gebildet werden als die von p, f, denn für diese Frage ist
es völlig gleichgültig, ob der schwache Luftstrom direkt als
solcher aus den Lungen kommt, oder ob er erst unterwegs aus
einem stärkeren abgeschwächt worden ist.
Ist also anzuerkennen, dass in Sprachen, welche solche
Parallellaute wie p und b etc. durch Nichttönen und Tönen
der Stimme unterscheiden, die geringere Stärke des b etc.
nicht als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal aufgefasst
zu werden braucht, so muss auf der anderen Seite doch auch
wieder zugestanden werden, dass es Sprachen gibt, welche
tonlose Laute verschiedener Stärke einander gegenüberstellen.
Der Schweizer z. B. unterscheidet die Silben
pa und ba, taund da durch stärkeren Druck beim p, t,
56schwächeren beim b, d. aber tonlos sind beide Laute. Ebenso
unterscheidet er z. B. genau ein starkes und ein schwaches
tonloses s.f, chu. s. w. (z. B. in hafe : gaffe, jese, esse, tseche :
tsechche, Winteler 20) unabhängig vom Accent oder der Stellung
in der Silbe. Hier bleibt eben der Stärkeunterschied das
einzige greifbare Unterscheidungsmerkmal, hier müssen die
Ausdrücke Fortis und Lenis angewandt werden, wenn
man den factisch bestehenden Unterschied der Laute charakterisiren
will. Der Unterschied erweist sich aber auch sonst
nützlich. So ist z. B. das deutsche anlautende s (wo es tonlos
gesprochen wird),eine Lenis im Vergleich zu dem gleichstehenden
englischen s.
Auch auf die Sonorlaute kann das Princip der Scheidung
nach der Intensität ausgedehnt werden. Da deren
Schallquelle ausschliesslich im Kehlkopf liegt, so kommt es
bei ihnen natürlich auf grössere oder geringere Stärke des
Stimmtones an ; dieser erfährt aber durch blosse Steigerung
nicht eine wesentliche qualitative Veränderung, während die
Veränderung des Klanges bei den Geräuschlauten eine sehr
wesentliche sein kann. Daher werden sonore Fortes und Lenes
wohl kaum in gegensätzlicher Verwendung gebraucht, ihr
Wechsel hängt hauptsächlich von den verschiedenen Arten
der Silbenbildung und des Accentes ab. Vergleicht man Fälle
wie alle : ahle, Amme : ahme, Amt : ahmtin der gewöhnlichen
nord-, mittel- und süddeutschen Aussprache, oder noch
besser etwa schweizerisches mane mahnen, male mahlen mit
deutschem Manne, falle, so wird man leicht erkennen, dass
das den kurzen Vocal noch während eines Momentes voller
Energie abschneidende ll, mm, nn an der Energie des Vocales
participirt. also Fortis ist im Vergleich mit dem l, m, n nach
langem (in den angeführten mane, male auch kurzem) Vocal
mit schwachem Ausgang (§ 29, 1, 2). Selbst bei tönenden
Geräuschlauten lässt sich gelegentlich eine solche Abstufung
erkennen ; wenigstens scheint mir, dass die tönenden
s in norddeutschem dusseln oder engl.puzzle ein wenig
stärker sind als die von nordd. rieseln, engl. measles u. ä.
Man wird hiernach gut thun, primäre und secundäre
Stärkeunterschiede aufzustellen ; unter den letzteren verstehen
wir alle diejenigen, welche nur vom Accent und ähnlichen
Einflüssen abhängen ; nur die primären gehören in die Lehre
von den Einzellauten, die secundären sind erst in der Silbenbildungslehre
zu betrachten.57
Anm. 1. Man achte darauf dass die schweizerischen Fortes an vielen
Orten als Geminaten gesprochen werden. In den oben angeführten Beispielen
bedeutet aber das ff, ss, chchin gaffe, esse, tsechchedurchaus nur
einen einfachen, nicht geminirten (§ 31) f-, s-, ch-Laut.
Anm. 2. Für diejenigen, welche gewöhnt sind nur die Qualitätsunterschiede
zwischen Tenuis und tönender Media oder tonloser und tönender
Spirans zu erfassen, sind einerseits die Explosivlaute, andererseits die Liquiden
und Nasale zur Veranschaulichung des Gesagten am Besten geeignet.
Man hört in Worten wie Amme im Gegensatz zu ahme oder mahne
die grössere Intensität des m ganz deutlich, sobald man nur gelernt hat
sich von der durch das Schriftbild erzeugten Vorstellung eines durch mm
bezeichneten Doppellautes zu emancipiren. Bei k, t, p : g, d, bachte
man auf das Gefühl in den sich berührenden articulirenden Theilen des
Mundes ; man wird dann ohne Mühe die stärkere Zusammenpressung z. B.
der Lippen bei p im Gegensatz zu b erkennen, und von da aus gelangt man
zu dem sicheren Rückschluss auf die grössere Energie der Exspiration
(vgl. S. 18 f.). Hat man sich an die gesonderte Auffassung der Explosionsgeräusche
gewöhnt, so wird man auch lernen, sich von der geringeren Intensität
des Reibungsgeräusches der tönenden Spiranten gegenüber den
tonlosen zu überzeugen und nun auch das Verhältniss der ohne Beihülfe
des Stimmtons unterschiedenen Fortes und Lenes richtig zu würdigen. —
Auf der anderen Seite empfiehlt sich für diejenigen, welche sämmtliche Geräuschlaute
tonlos zu bilden und also die Beimischung des Stimmtones in
tönenden Geräuschlauten schwer mit dem Gehöre zu erfassen vermögen, die
Anwendung des oben S. 9 näher beschriebenen Auscultationsschlauches.
2. Die Quantität eines Lautes hat an sich keinen Einfluss
auf die Qualität desselben. Sie kann daher auch nicht
zu einem eigentlichen Eintheilungsprincip erhoben werden.
Indessen pflegt man mit Rücksicht auf die Dehnbarkeit oder
Nichtdehnbarkeit der specifischen Schälle der Sprachlaute
zwischen Continuae oder Dauerlauten und momentanen Lauten zu
unterscheiden. Zur letzteren Gruppe gehören
bloss die Verschlusslaute, welche nur eine Dehnung der
zwischen Verschluss und Öffnung liegenden Pause (S. 45)
resp. des während dieser Zeit ertönenden Stimmtons gestatten.
Im übrigen wird über die Quantität der Sprachlaute im dritten
Theile (§ 28) zu handeln sein.
Anm. 3. Es ist jedoch zu beachten, dass die Fortes häufig gegenüber
den correspondirenden Lenes desselben Lautsystemes zugleich eine etwas
grössere Zeitdauer beanspruchen. So wird die Verschlussstellung bei den
Schweiz. p,t,k Winteler's z. B. länger eingehalten als bei seinen b, d, g.
In wie weit dies auf einem natürlichen Zusammenhang zwischen Stärke
und Dauer der Exspiration oder auf willkürlicher Gewohnheit beruht,
mag dahin gestellt bleiben.58
II. Die einzelnen Sprachlaute.
Cap. I. Die Sonoren.
§ 10. Die Sonoren im Allgemeinen.
Wie schon öfter hervorgehoben wurde, beruhen die Sonoren
bei normaler Sprechweise lediglich auf der durch
Resonanzwirkungen des Ansatzrohrs bedingten
Modification des Stimmtons, d. h. der tönende Luftstrom
bringt weder durch seinen Anfall an die Wände des
Ansatzrohres noch durch eine Reibung an den Rändern einer
etwa entgegenstehenden Enge ein eigenes Geräusch hervor.
Es beruht dies darauf, dass die Energie der Exspiration und
der Kehlkopfarticulation derart in Einklang gebracht sind,
dass die fortschreitende Bewegung des tönenden Luftstroms
auf ihr Minimum herabgesetzt wird. Sie ist also etwa zu vergleichen
mit der beim ganz geräuschlosen Athmen stattfindenden.
Wird demnach der Exspirationsdruck gesteigert ohne
gleichzeitige Mehrung des Widerstandes im Kehlkopf, so
kann die fortschreitende Bewegung des ausgeathmeten Luftstroms
soweit verstärkt werden, dass neben dem musikalischen
Klang auch noch ein Geräusch im Ansatzrohr auftritt ;
das gleiche kann geschehn, wenn bei gleichbleibendem Exspirationsdruck
die Articulation im Kehlkopf erschlafft.
Beim gewöhnlichen Sprechen, weniger beim Singen, mögen
vielfach wirklich derartige Nebengeräusche vorhanden
sein, je nach der individuellen Fähigkeit, den Einklang zwischen
Exspiration und Articulation mehr oder weniger vollkommen
und leicht herzustellen. Sie werden aber fast überall
durch den Stimmton völlig überdeckt und nur bei ganz geschärfter
Aufmerksamkeit wahrgenommen (man vgl. z. B. den
Klang eines m, n, loder eines nicht gerollten engl. r mit
dem eines tönenden s (franz. engl. z) oder v u. dgl. Natürlich
59können solche Nebengeräusche um so leichter sich bemerklich
machen, je mehr die Articulation eines Lautes durch Engenbildung
zu stärkerer Reibung des Luftstroms Anlass gibt.
Aber auch in diesem Falle heben sich die Geräusche erst dann
als etwas bestimmt Gesondertes vom Stimmton ab, wenn die
Exspirationsenergie sehr bedeutend die der Kehlkopfarticulation
übersteigt ; hier liegt dann die Möglichkeit des Überganges
zu einem neuen Sprachlaut vor. Steigert man z. B.
während der Bildung eines i den Exspirationsdruck ohne Veränderung
der Kehlkopfarticulation, so entsteht allmählich der
Reibelaut j, wie er in Norddeutschland gesprochen wird ;
beim u gelangt man bei ähnlichem Verfahren indessen nicht
zu einem gebräuchlichen Sprachlaut, sondern nur zu einem
neben dem Vocalklang mehr oder weniger deutlich wahrnehmbaren
Blasen.
Umgekehrt können aber natürlich auch tönende Geräuschdauerlaute
durch Minderung des Exspirationsdruckes im Verhältniss
zur Kehlkopfarticulation und Engenbildung in rein
sonore Laute übergeführt werden. Man kann z. B. neben dem
spirantischen englischen ‘soft’ th, dem franz. engl. v, dem
deutschen 5 (Vertreter von r. § 12, 1, c) auch sonore Formen
bilden (Genaueres s. § 24, 1).
Über die Begrenzung des Gebietes, das wir hier den normalen
Sonoren zuschreiben, s. S. 41. Was ihre Eintheilung
betrifft, so ergeben sich nach § 7 drei Gruppen, je nachdem
der tönende Luftstrom seinen Ausweg durch den Mund oder
durch die Nase oder durch beide nimmt.
Zur ersten Gruppe, den Mundsonoren (s. S. 44), gehören
die Vocale und die Liquidae r, l. Hier ist der Nasenraum
durch, feste Anpressung des Gaumensegels an die hintere
Rachenwand völlig abgesperrt, sodass die Luft nur durch den
Mundcanal entweichen kann. Für die Bildung der einzelnen
Laute dieser Gruppe kommen also nur die verschiedenen
Articulationsstellungen der Mundhöhle und deren Resonanzwirkungen
in Betracht.
Der Unterschied zwischen den beiden Theilen der ersten
Gruppe, den Vocalen und Liquiden, ist sehr gering ; er
beruht (abgesehen von Unterschieden im Grade der Verengung
des Ansatzrohres) lediglich auf einer verschiedenen Articulationsform
der Zunge (s. unten § 12).
Die zweite Gruppe bilden die Nasensonoren oder
Nasale (Brücke's Resonanten). Bei ihnen ist die Mundhöhle
60irgendwo verschlossen. dagegen lässt das schlaff herabhängende
Gaumensegel den Eingang zum Nasenraum frei ;
alle Luft entweicht demnach durch die Nase und es kommen
also hier die Resonanzwirkungen des Nasenraumes und eines
grösseren oder kleineren Theiles der Mundhöhle gemeinschaftlich
zur Geltung (beim m wirkt z. B. die ganze Mundhöhle
mit, da der Verschluss an deren äusserstem Ende. an
den Lippen stattfindet).
Die dritte Gruppe ist die der nasalirten Sonoren,
unter denen besonders die nasalirten Vocale oder Nasalvocale
häufig sind. Durch Lockerung des Gaumensegelverschlusses
wird hier dem tönenden Luftstrom der theilweise Austritt
durch die Nasenhöhle gewährt und ihm damit ein zweiter
Resonanzraum (der der Nasale) gegeben. Im Indogermanischen
sind die nasalirten Sonoren stets aus Mundsonoren
unter dem Einfluss benachbarter Nasale hervorgegangen, sie
sollen deshalb auch hier als Anhänge zu den letzteren behandelt
werden.
Anm. Das Verhalten des Gaumensegels bei der Vocalbildung (und
was für diese gilt, bezieht sich ebenso auf die Liquidae) hat langenden
Gegenstand einer Controverse gebildet, und es sind eine Menge zum Theil
sehr mühsamer Experimente ausgeführt worden, um die Frage nach dem
vollständigen Abschluss der Nasenhöhle bei Bildung der reinen Vocale
objectiv zu entscheiden (vgl. z. B. Brücke, Grundzüge 28 ; Wiener
Sitz.-Ber., math.-naturw. Cl. XXVIII (1858), 90 ff. Czermak, ebenda
XXIV (1857), 4 ff. XXVIII (1858), 575 ff. Merkel 62 ff.). Sehr einfach und
überzeugend ist Czermak's Verfahren : man bringe während der Bildung
des zu untersuchenden Lautes eine kalte polirte Platte, etwa eine Messerklinge,
vorsichtig unter die Nasenöffnung ; ist die Gaumenklappe fest geschlossen,
so bleibt die Platte rein, bei der geringsten Oeffnung aber beschlägt
sie sich mit Wasserbläschen. Fast ebenso empfindlich und für die
Demonstration besser geeignet ist folgende Modification des Brücke'schen
Verfahrens (Grundz. 28), eine brennende Kerze vor die Nasenöffnung zu
bringen. Man befestigt in die Enden zweier Kautschukschläuche kleine
Metall- oder Glasröhren, die in eine feine Spitze auslaufen ; vor den Mündungen
derselben werden zwei kleine Kerzenflammen angebracht. Die
beiden andern Enden führt man möglichst luftdicht in die eine Nasen-,
resp. die Mundöffnung ein (bei der letztern kann man auch zur bequemern
Auffangung des Luftstroms einen kleinen Trichter benutzen). Spricht
man dann einen reinen Vocal aus, so wird nur die vor der Mündung des
Mundschlauches befindliche Flamme umgeblasen, bei einem Nasal nur die
andere, bei einem nasalirten Vocal, auch bei der geringsten Spur von Nasalirung,
gerathen beide in heftiges Flattern. Um die Sache auch durch
das Gehör entscheiden zu können, kann man auch die Enden der Kautschukschläuche
(ohne jene Spitzen) in die Ohren einführen ; man hört
dann das charakteristische Schmettern des Stimmtons je nach der Art des
61untersuchten Lautes nur in je einem oder gleichzeitig in beiden Ohren.
Ein sehr einfaches Experiment ist auch das, während der Aussprache des
betreffenden Lautes die Nase plötzlich zuzuhalten. Ist der Vocal nasalirt,
so verändert er sofort merklich seinen Klang, weil sein bisher offener
Resonanzraum in einen gedackten verwandelt wird. Ganz empfindlich ist
übrigens dieser Versuch nicht, weil auch bei reinen Vocalen mit straff angespanntem
Gaumensegel (namentliche) die Schallschwingungen durch das
letztere in den Nasenraum übertragen werden, so dass auch dieser einen
geringen Einfluss auf den Gesammtklang des Vocales erhält.
§ 11. Die Vocale.
Unter den Sonoren nehmen die Vocale eine bevorzugte
Stellung ein, indem sie vermöge ihrer Articulationsform, welche
den Schallwellen am wenigsten Hindernisse in den Weg
legt, die Eigenschaften des Stimmtons und seine Veränderungen
bei der Lautbildung am reinsten hervortreten lassen. Sie
sind deshalb auch vorzugsweise das Objekt rein akustischer
Analysen seitens der Naturforscher geworden, und da diese
Analysen auch in sprachwissenschaftlichen Werken vielfach
herangezogen worden sind, so soll hier wenigstens die Methode
derselben kurz geschildert werden.
1. Die akustische Analyse.
Zunächst sind alle Unterschiede der Tonhöhe allein, als
allen Vocalen gemeinsam und daher für die Bestimmung
ihrer Unterschiede unwesentlich, aus der Betrachtung auszuschliessen ;
es handelt sich vielmehr bloss um die Bestimmung
der Klangfarbe der zu untersuchenden Laute. Da nun der
Stimmton als das Produkt desselben musikalischen Instrumentes,
des Kehlkopfs, an und für sich immer nur eine und
dieselbe Klangfarbe hat (wie etwa alle Töne einer Violine die
Klangfarbe dieses Instrumentes besitzen), so kann die Verschiedenheit
der Klangfarbe, die wir als Verschiedenheit der
Vocalqualität empfinden, nur auf etwas ausserhalb des Stimmtones
gelegenes, aber auf ihn einwirkendes zurückgeführt
werden. In erster Linie kommt hier wieder die Thätigkeit des
Ansatzrohres in Betracht. Jedermann weiss, dass die Gestalt
desselben bei der Bildung verschiedener Vocallaute wechselt,
dass sie aber bei wiederholter Bildung desselben Lautes stets
dieselbe ist oder wiederkehrt. Einer jeden solchen Articulationsform
des Ansatzrohrs entspricht nun, wie zuerst Grassmann
und nach ihm Donders und Helmholtz gezeigt haben
(die Literatur s. bei Grützner 174 ff., vgl. auch oben § 2, 7)
62ein besonderer Eigenton (bisweilen zwei), dessen Höhe man
auf verschiedene Weise (z. B. durch Vorhalten angeschlagener
Stimmgabeln von verschiedener Höhe vor die Mundöffnung)
objectiv bestimmen kann. Dieser Eigenton der Mundhöhle
verstärkt nach § 2, 7 die mit ihm zusammenfallenden oder
ihm doch nahe liegenden Theiltöne des Stimmtons, während
gleichzeitig andere Theiltöne desselben eventuell (bei enger
Mündung des Ansatzrohrs, wie bei i und u) gedämpft werden
können. Hierdurch bestimmt sich die Klangfarbe des Vocales.
Man kann also einen beliebigen Vocal wenigstens in den mittleren
Stimmlagen für hinlänglich fixirt erachten, wenn man
den Eigenton der ihm zukommenden Mundhöhlenform bestimmt
hat ; denn man kann alsdann z. B. mit Hülfe einer
auf jenen Ton abgestimmten Stimmgabel der Mundhöhle
jederzeit jene Gestalt wiedergeben.
Anm. 1. Viel complicirter, aber für die Demonstration sehr geeignet
sind die Analysen, welche man mit Hülfe des Scott-König'schen Membranphonäutographen
(vgl. darüber z. B. Pisko, Die neueren Apparate der
Akustik, Wien 1865, S. 71 ff. und 239 ; Donders in Poggendorff's Annalen
der Physik und Chemie CXXIII ;1864), 527 f. ; und des noch viel empfindlicheren
Königschen manometrischen Flammenapparates (vgl. R. König in
Poggendorff's Annalen CXLVI 1872), 161 ff.) ausführen kann. Beide Apparate
beruhen auf einer Anwendung des Satzes, dass jedem Klange eine
besondere Schwingungsform entspricht. Die betreffenden Klangschwingungen
werden vermittelst einer feinen Membran bei dem ersteren Apparate
auf einen die entsprechende Schwingungscurve aufzeichnenden Schreibstift,
bei dem zweiten auf eine kleine Gasflamme übertragen, deren einzelne
Phasen ein rotirender Spiegel auseinander löst. Abbildungen der Schwingungsformen
einiger Vocale s. bei Donders, De physiologie der spraakklanken,
Utrecht 1870, S. 15. 19 ; Darstellungen der Flammenbilder des
manometrischen Apparates bei König a. a. O.
Aber so wichtig nun auch solche Analysen, wie sie Donders,
Helmholtz, Merkel u. a. ausgeführt haben (einige Zusammenstellungen
s. bei Merkel, Laletik S. 47, Grützner
177 ff., neuerdings auch bei Trautmann, Anglia I, 592 ff.
III, 207), für die akustische Theorie der Vocalbildung sind,
so können sie doch die Bedürfnisse der Sprachforschung nicht
befriedigen. Denn, selbst vorausgesetzt dass jeder Sprachforscher
die zur Analyse der Vocalklänge nöthigen Apparate
besässe und zu handhaben verstünde, so würden sich doch
absolute, allgemein gültige Feststellungen überhaupt nicht
oder nur unter den allergrössten Schwierigkeiten machen lassen,
weil ja jeder Einzelne seine Untersuchungen nur auf die
wenigen ihm von Haus aus geläufigen Vocalnüancen basirt
63und basiren kann, d. h. auf schliesslich doch auch willkürlich
aus der Gesammtmasse der Vocalunterschiede herausgegriffene
Einzelpunkte, über deren Verhältniss zu den bei andern Inviduen
oder Sprachgenossenschaften üblichen andern Nuancen
noch nicht das Mindeste sich ergibt, die also auch nicht als
unveränderliche Ausgangspunkte für die Classification der
vocalischen Klangfarben zu gebrauchen sind. Es liefern also
auch die subtilsten akustischen Untersuchungen für den
Sprachforscher kein eben brauchbareres Material, als die einfache
subjective Abschätzung nach dem Gehör, welche bei
den deutschen Phonetikern die üblichste Grundlage für die
Anordnung des Vocalsystems gewesen ist.
Anm. 2. Bei dieser Sachlage wird es nicht ungerechtfertigt sein, hier
nur zur allgemeinsten Orientirung der Wirkung der Resonanz der Mundröhre,
als des wichtigsten Momentes der Schallmodificirung bei der Vocalbildung,
in Kürze zu gedenken, die Einflüsse anderer, übrigens auch meist
noch nicht hinlänglich untersuchter Factoren (wie der verschiedenen Stellung
des Kehldeckels, welcher den Kehlkopf mehr oder weniger deckt, oder
der verschiedenen Grade des Mitschwingens fester Schädeltheile beim Aussprechen
verschiedner Vocale u. dgl.) zu übergehen. Wer sich eingehender
orientiren will, findet Genaueres in Helmholtz' grundlegenden Untersuchungen
(Tonempfindungen S. 162—189), sowie einige abweichende und
weiterführende Ansichten in den Ausführungen von E. v. Qvanten in
Poggendorff's Annalen CLIV(1875), 272—294. 522—552 und F. Auerbach,
ebenda N. F. Erg.-Bd. VIII (1876), 177 ff. Grützner 177 ff.
2. Das System der deutschen Phonetiker.
Die indogermanische Ursprache unterschied, wie man
glaubte annehmen zu dürfen (was aber durch die neueren
Untersuchungen über indogermanischen Vocalismus als unrichtig
erwiesen worden ist) nur drei bestimmte Vocalqualitäten,
a, i, u, und auch innerhalb der complicirteren Vocalsysteme
der modernen Sprachen schienen diese drei, als die
entschiedensten und stärksten Gegensätze vocalischer Klangfarbe
darstellend, besonders hervorzutreten. Ihr Verhältniss
und ihre relative Lage musste also zuerst fixirt werden, damit
auch den zwischenliegenden Vocallauten ihre Stellung im
System richtig angewiesen werden konnte.
Zunächst pflegte man diese ‘drei Grundpfeiler’ des Vocalismus
in Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks mit dem a an der
Spitze zu gruppiren, damit andeutend, dass zwischen je zweien
derselben (i—a, a— u,u— i) ein gleicher Abstand vorhanden
sei. Die übrigen Vocale wurden zwischen denjenigen
Lauten eingetragen, zwischen welchen sie eine Art Mittelstufe
zu bilden schienen, also e zwischen a und i o zwischen a
64und u. Durch weitere Ausbildung dieser zuerst von Hellwag
(1780) aufgestellten Pyramide gewann zuletzt Brücke folgendes
Schema :
image
(ae bezeichnet hier ein dem a nahestehendes ä, eadas gewöhnliche
ä oder offene e u. s. w.).
Dieses Schema mag allenfalls gültig sein, wenn man bloss
den subjectiven akustischen Effekt ins Auge fasst. Der Fehler
dieser Eintheilung liegt aber darin, dass sie auf die Articulationsform
so gut wie keine Rücksicht nimmt und damit die
Möglichkeit raubt, die auch für die Sprachgeschichte höchst
wichtigen Beziehungen der einzelnen Vocale unter sich wie
zu einzelnen Geräuschlauten (wie die des i zu Palatalen, die
des u zu Labialen und Gutturalen) klar zu überschauen. Es
war deshalb eine entschiedene Verbesserung, wenn Winteler
vorschlug, jene drei Laute in der Aufeinanderfolge u — a — i
(oder umgekehrt, was dasselbe Resultat gäbe) auf einer geraden
Linie zu verzeichnen. Nach ihm bilden u und i die
äussersten Grenzen des gesammten Vocalsystems, während a
eine mehr neutrale Mitte innehält.
Beim a ist der Mundcanal durchgehends massig geöffnet ;
die Zunge entfernt sich nicht viel aus ihrer Indifferenzlage.
Bei i und u werden dagegen durch kräftigere Articulation bedeutende
Engen im Ansatzrohr hervorgebracht (die Articulation
nähert sich also mehr derjenigen der Consonanten). Da
nun bei stärkerer Engenbildung kleine Differenzen in der Articulation
viel stärkeren Einfluss auf den Charakter der entsprechenden
Laute haben als bei geringerer, so sind auch i
und u viel empfindlicher gegen Veränderungen der Articulation
als a, welches bei sehr verschiedener Mundweite doch
stets mit derselben Klangfarbe hervorgebracht werden kann.
Aus diesem Grunde fand Winteler es rathsam, nicht, wie man
bisher meist zu thun pflegte, von dem a als dem ‘einfachsten
und reinsten’ Vocal auszugehn. sondern (nach einer schon von
du Bois-Reymond, Kadmus 193 gegebenen Vorschrift) von
den beiden mit grösserer Sicherheit zu bestimmenden Endpunkten
der Vocallinie u — i und von da aus erst nach der
Mitte vorzuschreiten.65
Dies Verfahren gewährte zugleich noch den Vortheil, dass
es von Anfang an die Articulationen der beiden verschiedenen
Theile, welche zur Bildung des vocalischen Resonanzraumes
dienen, die der Zunge und die der Lippen, schärfer hervortreten
liess ; denn bei u und i articuliren beide viel energischer
als beim a und den diesem zunächst liegenden Vocalen,
und die Formen ihrer Articulation sind die möglichst entgegengesetzten.
Die Zunge wird beim u in ihrer ganzen Masse nach hinten
gezogen und in ihrem hintern Theile zum Gaumen emporgehoben.
Beim i dagegen ist sie nach vorn gedrängt und mit
ihrem Vordertheile dem harten Gaumen genähert.
Die Lippen ziehen sich bei dem (möglichst voll gesprochenen)
u bis auf eine kleine kreisförmige Oeffnung zusammen
und werden gleichzeitig, das Ansatzrohr verlängernd, etwas
vorgeschoben ; beim (möglichst hellen) i werden die Mundwinkel
auseinandergezogen und es entsteht ein breiter Spalt
an Stelle jener kreisrunden Oeffnung beim u (vgl. oben S. 13 f.).
Beim u wird also im vordem Munde ein ziemlich grosser,
kugelähnlicher Resonanzraum mit kleiner runder Ausflussöffnung
hergestellt ; beim Uebergang zum i wird das Volumen
desselben auf ein Minimum reducirt und dabei zugleich die
Ausflussöffnung möglichst vergrössert. Demgemäss werden
beim u die tieferen Theiltöne des Stimmtons verstärkt und
die höheren gedämpft, beim i umgekehrt.
Anm. 3. Hierauf beruht es, dass das u auch beim gewöhnlichen Sprechen
tiefer klingt als das i, auch wenn die Stimmbänder beidemal dieselbe
Schwingungszahl haben, und dass das u auf sehr hohen Tönen, das i umgekehrt
auf sehr tiefen nicht mehr anspricht.
Anm. 4. Ausser den beiden genannten Factoren zog man übrigens
auch noch die Hebung des Kehlkopfs bei i und seine Senkung bei u in
Betracht (Chladni 190 f. u. ö.). Diese Bewegungen sind aber grossentheils
nicht willkürlich, sondern wesentlich durch das Vorschieben resp. Zurückziehn
der Zunge bedingt (so richtig Thausing S. 15 gegen Brücke, der ein
umgekehrtes Verhältniss annimmt). Man kann sie deshalb bei der Beobachtung
ohne grossen Schaden ausser Acht lassen, weil sie unwillkürlich
eintreten, wenn man die Zungenarticulation richtig ausführt.
Um nun aus der Menge der möglichen Variationen von u
und i die beiden äussersten Grenzpunkte auswählen zu können,
hat man namentlich auf die Engenbildungen bei der Articulation
dieser Laute zu achten. Beim u liegt die grösste
Enge zwischen den Lippen, beim i zwischen der Vorderzunge
und dem harten Gaumen. Beide Engen können nach S. 59 f.
66auch schallbildend auftreten, und zwar um so leichter, je
stärker der Grad der Verengung ist ; damit wird aber die
Existenz des Vocals, welcher doch ein reiner Stimmtonlaut
sein soll, beeinträchtigt. Man erhält also die äussersten Grenzwerthe
von u und i, wenn man bei der eben beschriebenen
Articulationsweise bis zudem äussersten Grade von Verengung
fortschreitet, welcher noch erlaubt, jene Vocale bei normalem
Exspirationsdruck ohne Beimischung jener Geräusche hervorzubringen.
Schwieriger als die Bestimmung dieser äussersten u und i
ist die der ‘neutralen Mitte’, des a, weil hierdie sehr einfache
Geräuschprobe in Wegfall kommen muss. Man geht hier am
Besten von der Indifferenzlage aus. Bringt man nun abwechselnd
ein ‘dunkles’ a und ein ‘breites’ ä hervor, so sieht man,
wie bei ersterem der Zungenkörper nach hinten, beim zweiten
etwas nach vorn geschoben wird (die gleichzeitig wahrnehmbare
Hebung der Zunge ist wesentlich nur eine Folge der
Hebung des Gaumensegels, welches bei der Vocalbildung den
Nasenraum abschliessen muss). Verringert man diese Vorwärts-
und Rückwärtsbewegung allmählich, so müsste man
schliesslich mit der Rückkehr zur Indifferenzlage zu einer
ganz neutralen Mittelstellung gelangen, welche als Articulationsprodukt
das ganz reine, neutrale a lieferte. Bei dieser
Stellung wird aber ein breiter ä-ähnlicher Laut erzeugt, den
man nicht mehr zu den Arten des a rechnen kann ; ein eigentlicher
a-Laut kommt erst bei einer merklichen Rückwärtsbewegung
der Zunge zu Stande, also durch eine positive
Articulation aus der Indifferenzlage heraus. Daher setzte
Winteler an die Stelle der bisher angesetzten Einheit eine
Zweiheit von Lauten, die er nicht unpassend die u- und die
i-Basis nannte, insoferne durch Steigerung der specifischen
Articulationen derselben — Zurückziehung der Zunge aus der
Indifferenzlage bei der u-Basis, Vorschiebung der Zunge bei
der i- Basis — die Zwischenlaute zwischen a und i, a und u
und endlich i und u selbst erreicht werden. Die möglichst
geringe Rück- oder Vorwärtsbewegung der Zunge stellt also
die äussersten Nähepunkte der beiden Basen dar.
Anm. 5. Das man hiernach das a nicht, wie vielfach (seit Kempelen
201) geschehen, als den ‘natürlichen Vocal’ bezeichnen darf, leuchtet von
selbst ein, da auch zu seiner Bildung die einzelnen Theile des Ansatzrohres
Articulationsbewegungen ausführen müssen. Lässt man den Stimmton
ertönen während die Mundorgane sich in der Indifferenzlage befinden, so
erhält man den seiner Klangfarbe nach zwischen ä und ö liegenden nasalirten
67Laut, den wir unwillkürlich beim Stöhnen hervorbringen. Auch
der blosse Abschluss der Nasenhöhle durch Hebung des Gaumensegels
genügt noch nicht um ein a hervorzubringen, man bekommt vielmehr, wie
schon angedeutet, bei Ausführung dieser Articulation (wobei man behutsam
darauf achten muss, die Zunge nicht aus ihrer Ruhelage zu bewegen)
ein ä, den ersten Schreilaut der Kinder, den man mit viel mehr Recht
als das a einen Naturlaut nennen könnte, wenn das Ganze nicht doch auf
eine blosse Spielerei hinausliefe.
Zwischen den drei Vocalen u—a — i unterscheiden die
europäischen Sprachen mindestens noch die zwei Vocalstufen,
o und e. Für diese liessen sich ähnlich fest bestimmte Articulationsstellungen
wie bei u, i, (a) um so weniger ermitteln,
als gerade diese Übergangslaute mit ausserordentlich verschiedener
Klangfarbe gebildet werden. Aber eine Betrachtung
ihrer Articulation im Verhältniss zu der der umgebenden
Laute zeigte doch den Weg zu einer weiteren und ziemlich
exacten Vocaleintheilung.
Geht man vom äussersten u allmählich zu einem im Übrigen
beliebigen o- Laute über, so wird der hintere emporgehobene
Theil der Zunge ebenso stufenweise gesenkt, und die
ganze Zunge etwas vorgeschoben (in der Richtung zur Indifferenzlage) ;
die Mundöffnung erweitert sich in entsprechendem
Verhältniss, ohne ihre gerundete Gestalt zu verlieren.
Verfolgt man diese allmähliche Verschiebung unter gleichzeitiger
Senkung des Unterkiefers weiter, so gelangt man zur
u-Basis des a, bei welcher die Zunge nun bereits der Indifferenzlage
ziemlich nahe flach ausgestreckt im Munde liegt ;
die willkürliche Articulation der Lippen (d. h. ihre kreisförmige
Zusammenziehung) hat aufgehört, die Gestalt der Mundöffnung
ist einfach abhängig von der Senkung des Unterkiefers.
Durchläuft man nun vom a ausgehend die Zwischenstufen
zum i hin, so wird die Vorschiebung der Zunge fortgesetzt
und ihr Vordertheil hebt sich stufenweise zum harten Gaumen
in die Höhe ; der beim Gange von u zu a hin etwas gesenkte
Unterkiefer steigt ebenso allmählich wieder mit empor, und
es kann abermals eine willkürliche Articulation der Lippen
beginnen, indem die Mundwinkel auseinander gezogen
werden.
Man durchläuft also vom u ausgehend sämmtliche mögliche
Vocalnüancen der Reihe u — i, indem man die S. 66 gegebenen
Characteristica der u- Articulation gradweise verringert,
bis sie gleich oder fast gleich 0 werden, dann aber zu
68der ebenda charakterisirten i- Stellung gleichfalls durch gradweise
Steigerung der beiden Articulationsfactoren (Zungen und
Lippenthätigkeit) fortschreitet. Zwischen u und i liegt
also eine lange ganz continuirliche Reihe gleichmässig abgestufter
und in einander übergehender Vocalnüancen. Alle
hier zu machenden Unterschiede sind folglich auf der oben
S. 65 erwähnten Vocallinie u — i einzutragen.
Da man nun doch nicht für jeden einzelnen Punkt dieser
Linie, d. h. für jede mögliche Nuance, ein gesondertes Zeichen
aufstellen kann, so bleibt nichts anderes übrig, als die
Linie in eine gewisse Anzahl von Theilen zu zerlegen, d. h.
statt einzelner Vocalnüancen vielmehr Kategorien (vgl.
schon oben S. 34) von solchen aufzustellen, welche die nach
Articulationsform und akustischem Effekt einander zunächst
liegenden und nicht als gegensätzlich empfundenen Spielarten
in sich vereinigen. Als Repräsentant der Kategorie, als
Normalvocal derselben gilt dann diejenige Nuance, welche
den Klangcharakter der Kategorie am ausgesprochensten
wiedergibt.
Für die Aufstellung dieser Normalvocale sind nun nach
Winteler besonders zwei Gesichtspunkte massgebend : Erstens,
dass der Abstand derselben unter einander gleich sei, d. h.
also, dass wenn z. B. zwischen a und u nur ein Mittellaut (o)
eingeschoben wird, dies Normal-o dann erzeugt wird, wenn
man die Übergangsbewegung der Organe von a zu u genau in
der Mitte unterbricht. Bei zwei Mittellauten hätte diese Unterbrechung
zweimal, beim ersten und beim zweiten Drittel
stattzufinden. Natürlich kann man die so festzusetzenden
Normalvocale nur durch allmähliches, sorgfältiges Durchprobiren
der ganzen Articulationsreihe u — a — i ermitteln.
Hat man dies aber gethan und sich die Articulationsweise
und den Klang der gefundenen Normalwerthe genau eingeprägt,
so wird es leicht sein das Verhältniss derselben zu einer
jeden abweichenden Vocalnüance zu erkennen und auch für
andere zu charakterisiren.
Was sodann die Anzahl der Kategorien betrifft, glaubte
Winteler für die indogermanischen Sprachen mit einer Verdoppelung
der bisher vorgeführten Vocalkategorien u, o, a, e, i
auskommen zu können (zwei i und zwei u waren jedoch schon
vor ihm von den Engländern, in Deutschland auch von
Böhmer aufgestellt worden).
Zu den so erhaltenen zwölf Normalvocalen der Reihe
69u — a — i kommen nun noch die bisher ausser Acht gelassenen
Laute von der Klangfarbe ü, ö, die wir als Vermittelungsvocale
bezeichnen können. Während nämlich bei der Bildung
der Laute u — a — i die beiden die Klangfarbe bedingenden
Factoren (die Articulation der Zunge und die der
Lippen, s. S. 66) auf dasselbe Resultat hinwirken, treten bei
ü, ö diese Factoren in Gegenwirkung, d. h. es verbindet sich
die Zungenarticulation eines hellen Yocales mit der Lippenarticulation
eines dunkeln oder umgekehrt. So ist z. B. beim
deutschen ü die Zunge vorgestreckt und gehoben wie beim i,
die Mundöffnung aber rundlich contrahirt wie beim u. Dieser
Articulation weise entsprechend liegen denn auch die Klangfarben
dieser Vocale in der Mitte zwischen denen der Reihe
u — a und der Reihe a—i.
Die Eintheilung dieser Vermittelungsvocale ergibt sich
nach dem Gesagten leicht.
Es sind ebensoviele Vermittelungsvocale aufzustellen, als
Stufen zwischen a und u vorhanden sind, resp. zwischen a und
i, nur dass eine Vermittelung zwischen den beiden Basen des
a wegfällt, weil beide ohne selbständige Articulation der Lippen
gebildet werden.
Hiernach stellte sich das Winteler'sche Schema folgendermassen
dar :
image
Dabei sind nur die Bezeichnungen durch Zahlenexponenten
an Stelle anderweitiger typographischer Auszeichnungen Winteler's
gesetzt. Der Exponent 1 deutet an, dass der Vocal
unter den beiden dasselbe Grundzeichen tragenden Lauten
die specifische Klangfarbe am deutlichsten habe ; in der Praxis
kommt 1 mit dem üblichen ‘geschlossen’, 2 mit ‘offen’
zusammen.
Zur Vergleichung mögen hierneben die sonst gebräuchlichsten
deutschen Transscriptionssysteine, die von Lepsius,
Brücke und Böhmer Platz finden :70
tableau Lepsius | Brücke | Böhmer
Anm. 6. Es ist unmöglich, für die gegebene Vocalreihe ohne mündliche
Erläuterung genau treffende Beispiele aus den lebenden Sprachen
und Mundarten anzuführen, da die individuelle Sprechgewohnheit des Lesers
fast überall zu Missverständnissen führen würde. Ungefähr treffen
u1, o1, e1, i1, ü1, ö1 mit den Lauten der deutschen langen u, o, e, i, ü ö
überein oder mit franz. ou, au, é. i, u (eu) ; die mittel- und norddeutschen
kurzen u, o, e (ä), i, ü, ö fallen meist in die Sphaere von unseren u2, o2,
e2, i2, ü2, ö2. Das &. ist der breite ä-Laut, welchen die Bewohner der Ostseeprovinzen
in Worten wie Bär, Meer bilden und der auch in süddeutschen
und schweizerischen Mundarten als Umlaut von kurzem und langem
a mehrfach auftritt. Unter a verstehn wir das sog. reine a des Italienischen
und Französischen. Langes o2 ist der auch in Mittel- und Norddeutschland
öfter gehörte Zwischenlaut zwischen a und o im englischen
com, fall u dgl. Auch sein Umlaut ö2 kommt als Länge in Norddeutschland
öfter vor.
Anm. 7. In der ersten Ausgabe dieses Buches waren fälschlich das
russische jery und einige verwandte Laute zu einer zweiten Reihe von
Vermittelungsvocalen zusammengestellt, da ich früher nach Lepsius annahm,
dass diese durch Combination der Zungen articulation des u mit
der Lippenarticulation des i etc. gebildet würden. Ich bemerke ausdrücklich
dass auch ich diese Analyse jetzt durchaus verwerfe ; das richtigere
s. unten S. 79.
Dies Normalsystem bedarf aber noch verschiedener allgemeiner
Modificationen, um den Anforderungen der
Praxis gerecht zu werden, denn es beruht auf willkürlicher
Auswahl bestimmter Momente der Lautcharakterisirung.
Der Satz, dass zur Bildung der Laute
unserer Vocalreihe die Articulation der Zunge und die der
Lippen gleichmässig und in möglichster Energie vorhanden
sein müsse, ist wesentlich deswegen aufgestellt, weil man
doch nun einmal von einer bestimmten Articulationsweise
ausgehn musste, und gerade die gewählte die sicherste Bestimmung
der Endpunkte der Vocalreihe zu ermöglichen
schien. Nun lehrt aber selbst eine oberflächliche Beobachtung,
dass selbständige Lippenthätigkeit (namentlich bei den
Lauten der i- Reihe) vielfach theils nur in sehr geringem
Masse, theils gar nicht vorhanden ist. Was hier an der Lippenthätigkeit
erspart wird, wird oftmals durch gesteigerte
Zungenthätigkeit ersetzt. Die so erzeugten Vocale haben für
das nur an Vocale mit starker Lippenbetheiligung gewöhnte
71Ohr zwar weniger scharf ausgeprägte Klangfarben als die
vorher beschriebenen, aber man kann doch auch bei ihnen
sämmtliche Unterschiede der ganzen Scala durchlaufen (es ist
also z. B. ein ohne Lippenrundung gesprochenes u1 nicht etwa
einem mit Lippenrundung gesprochenen u2 gleichzusetzen ;
denn bei Letzterem findet doch immerhin, wenn auch schwächer
als beim u1, eine Lippenrundung statt). Beim a hört
natürlich der Unterschied der beiden Bildungen auf, da dieses
stets ohne selbständige Lippenarticulation gebildet wird.
Man pflegte seit Brücke (Grundzüge, S. 23 ff.) diese ohne
energische Lippenbetheiligung hervorgebrachten Vocale unvollkommene
zu nennen, weil dabei ‘nicht alle Mittel in
Gebrauch gezogen werden, welche die menschlichen Sprachwerkzeuge
darbieten, um den Vocallaut deutlich unterscheidbar
und klangvoll hervortreten zu lassen’. So bequem dieser
Name war, so war er doch als unpraktisch zu verwerfen, weil
er zu leicht Verwechselungen mit den unter dem Einfluss der
Accentlosigkeit nur mit mangelhafter Articulation gebildeten
reducirten Vocalen (s. unten § 24) zulässt. Man unterschiede
daher besser Vocale mit activer und passiver
(d. h. nur von den Bewegungen des Unterkiefers abhängiger)
Lippenarticulation, und innerhalb der ersten Reihe wieder die
verschiedenen Stufen der Energie der Lippenbetheiligung.
Anm. 8. Es folgt hieraus, dass auch die Stellungen der Vermittelungsvocale,
-welche Winteler's Schema in die Mitte der beiden vermittelten
Laute gestellt hat, im einzelnen Falle näher zu bestimmen sind. Ist z. B.
bei einem Vocale der ü-Reihe die Lippenarticulation geringer, so klingt
dieser mehr dem entsprechenden Vocale der i-Reihe ähnlich und umgekehrt.
Für jeden Einzelfall bedarf es also auch bei dem Wintelerschen
System noch einer genaueren Angabe, ob Zungen und
Lippenstellung den angenommenen Normalstellungen
dieser Organe entsprechen, oder ob und wie weit sie sich davon
entfernen. Unter diesen Voraussetzungen leistet das
System ziemlich viel, wenigstens für die Sprachen, welche
einen dem deutschen ähnlichen Vocalismus haben. Es leidet
aber wie alle deutschen Vocalsysteme an dem Fehler, dass es
einmal den Klangwerth der Laute zu sehr an die Spitze stellt,
sodann dass es die von einander völlig unabhängigen Articulationen
der Zunge und der Lippen nicht genügend aus einander
hält, und dass es in Folge dessen eine ganze Reihe von
Vocalen überhaupt nicht enthält, nämlich diejenigen, welche
72durch Articulation des mittleren Zungenrückens gegen den
Gaumen gebildet werden. Alle diese Uebelstände vermeidet
das System des Engländers A. Melville Bell, welches besonders
nach den Verbesserungen, welche es durch Sweet und
Storm erfahren hat. jedenfalls als das vollkommenste aller
bisher aufgestellten Vocalsysteme gelten darf.
3. Das englische System.
Bell's System 1)3 schliesst das subjective Moment der Abschätzung
nach der akustischen Aehnlichkeit der Vocale vollkommen
aus, welches in den deutschen Systemen so stark
hervortrat und die Quelle mannigfacher Irrthümer geworden
ist ; es baut sich ebenso ausschliesslich wie das Consonantensystem
auf einer Analyse der Articulations stellungen der
Vocale auf. Obschon die Zahl der Vocale in der Gesammtheit
der menschlichen Sprachen eine unendliche ist, lassen sie sich
doch auf einige wenige Hauptformen oder Hauptstellungen
reduciren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten bekannten
Vocallaute entweder mit diesen zusammenfallen oder
Modifikationen, Zwischenstufen davon sind.
Zunächst sind die Articulationen der Zunge und der
Lippen streng zu trennen. Es gibt drei horizontale und
drei vertikale Hauptstellungen der Zunge. In ersterer
Beziehung sind die Vocale entweder hintere (back, gutturale),
wenn die Zunge aus der Indifferenzlage zurückgezogen
und gegen den weichen Gaumen gehoben wird, wie
beim sog. reinen a ; oder vordere (front, palatale), wenn
die Zunge vorgeschoben und gegen den harten Gaumen gehoben
wird, wie beim i ; oder endlich gemischte (mixed,
guttural-palatale), wenn die Zunge eine mittlere Stellung
einnimmt, wie beim engl. err oder deutschen e in Gabe
(es ist nur das ö- ähnlich klingende unbetonte e zu verstehen,
wie es etwa im Bühnendeutsch gesprochen wird ; die
Dialekte haben vielfach auch e- oder ü- oder a-ähnliche Varietäten,
auf die dann das oben Gesagte nicht mehr passt). Zwischenstufen
werden als innere und äussere inner und
outer) bezeichnet. So würde ein Laut, der nach der horizontalen
Lage der Zunge zwischen dem. front e1 und dem mixed e1
73(s. unten) entweder als inneres e1 oder als äusseres e1 zu bezeichnen
sein, je nachdem er dem einen der beiden genannten
Normalvocale näher liegt ; in der Praxis wird aber kaum je
mehr als eine Mittelstufe anzusetzen sein.
Sodann sind die Vocale nach der grösseren oder kleineren
Entfernung der Zunge vom Gaumen hohe (high), mittlere
mid oder niedrige (low). Als Mittelstufen kann man noch
gesenkte lowered) und erhöhte (raised) unterscheiden ;
es liegen z. B. zwischen dem high-front Vocal i und dem
mid-front Vocal e noch der lowered high-front und der raised
mid-front Vocal. In der Praxis wird man aber meist mit
einer einzigen Mittelstufe auskommen (in diesem Falle Sweet's
[ei] oder e1). Jeder der so gewonnenen Vocale kann fernerhin
entweder geschlossen oder eng (narrow Sweet, primary
Bell), oder offen oder weit (wide) sein. Den Unterschied
dieser Gruppen definirt Sweet folgendermassen (S. 9) : ‘Der
Unterschied derselben beruht auf der Gestalt der Zunge.
Bei der Bildung ‘geschlossener’ Vocale hat man ein Gefühl der
Spannung in dem articulirenden Theile der Zunge, die Oberfläche
der Zunge ist stärker convex gemacht als bei ihrer natürlichen
Stellung für ‘offene’ Vocale, in welcher sie schlaffer
ist und mehr abgeflachte Gestalt hat. Die stärkere Wölbung
der Zunge verengert natürlich den Mundcanal, daher der
Name. Die Verengerung wird nicht durch Hebung des ganzen
Zungenkörpers hervorgebracht, sondern durch Hebung
bloss des gerade articulirenden Theiles derselben’. Man fühlt
diesen Unterschied am deutlichsten, wenn man etwa deutsches
geschlossenes (langes) ī und offenes (kurzes) i oder ē und
ĕ nach einander spricht. — Natürlich sind auch hier wieder
verschiedene Grade der Enge und Weite (Geschlossenheit und
Offenheit) möglich (z. B. ist das deutsche geschlossene i enger
als das englische, u. ä.).
Weiterhin kann jeder dieser Vocale gerundet (rounded,
labialisirt) werden durch Verengung der Mundöffnung
:S. 13 f.). Nach Sweet gibt es drei natürliche Hauptabstufungen
der Rundung, welche der Höhe der Zunge entsprechen, dergestalt,
dass hohe Vocale die engste, niedrige Vocale die weiteste,
mittlere Vocale eine mittlere Lippenöffnung haben ;
man vergleiche z. B. die Vocale in engl. who, no, saw, deutsch
du, so, dialektisch ja. Bei dem u sind die Lippen bis auf eine
ganz enge Oeffnung zusammengezogen, bei o ist die Oeffnung
weiter und breiter, und beim d sind nur die Mundwinkel etwas
74zusammengezogen. — Neben diesen Gradunterschieden
der Rundung sind aber auch noch Formunterschiede derselben
zu beachten. Man unterscheide im Einzelnen, ob die
Rundung bloss durch Verticalbewegung der Lippen gegeneinander
erzeugt wird (verticale Rundung), oder durch Einziehung
der Mundwinkel (horizontale Rundung) oder durch
beides zugleich (gemischte Rundung) ; ferner ob die Lippen
ihren natürlichen Abstand von den Zähnen behalten oder an
diese stärker angepresst oder aber vorgestülpt und dadurch
von den Zähnen abgehoben werden.
Anm. 9. Sweet definirt Rundung als ‘a contraction of the mouth
cavity by lateral ;compression of the cheek passage and narrowing of the
lip aperture’. Er unterscheidet daher mit Bell neben der Lippenrundung
auch noch eine innere oder Wangenrundung (inner rounding, cheekrounding,
cheek-narrowing), und bemerkt dass die Rundung immer auf
den Theil des Mundes concentrirt sei, wo der betreffende Vocal gebildet
werde. Bei der Rundung von vorderen Vocalen, wie des franz. u, sei die
Wangencompression hauptsächlich auf die Mundwinkel und die unmittelbar
daran grenzenden Partien der Wangen beschränkt, während bei hinteren
Vocalen, wie dem (deutschen) u, die Hauptcompression in den hinteren
Theilen der Wangen stattfinde. Wenn hintere Vocale bloss mit Lippenverengung,
ohne gleichzeitige innere Rundung, ausgesprochen werden,
erhält man nach ihm nicht die entsprechenden gerundeten Vocale, sondern
nur dumpfe (muffled) Varietäten der gewöhnlichen Laute. Ebenso
ist, wenn ein vorderer Vocal nur mit innerer Rundung ausgesprochen
wird, das Resultat nur ein dumpfer gutturalisirter Vordervocal, nicht ein
gerundeter Vordervocal (Sweet S. 13 ff.). Ich kann über die Richtigkeit
dieser Angaben nicht urtheilen, da ich sie nicht völlig verstehe. Vielleicht
ist mit der inneren Rundung dasselbe gemeint, was oben als die Rundung
durch Anpressung der Lippen an die Zähne bezeichnet wurde ; dabei nehmen
allerdings auch die Wangen z. Th. eine straffere Spannung an, aber
ich vermag nicht dieser eine derartig besondere Bedeutung beizulegen wie
Bell und Sweet es thun, da doch die Wangen auch in schlaffem Zustande
an den Zahnreihen anzuliegen pflegen, und also die Gestalt des Resonanzraumes
auf diese Weise nicht wesentlich verändert werden kann.
Anm. 10. Sweet bemerkt mit Recht, dass obgleich ein gewisser natürlicher
Zusammenhang zwischen der Höhe der Zunge und dem Grade der
Lippenverengung bestehe, es doch auch Fälle von abnormer Rundung
gebe. So hat z. B. im Dänischen und Schwedischen das o dieselbe Lippenrundung
wie das u, etc.
Endlich kann auch noch der Laut eines Vocales durch
spaltförmige Ausdehnung der Lippenöffnung (S. 13)
modificirt werden. Dies geschieht namentlich bei den vorderen
Vocalen, die dadurch einen helleren Klang erhalten,
kann aber auch, wie Sweet bemerkt, auf andere Vocale ausgedehnt
werden. Auch eine Verbindung von verticaler Rundung
und Auseinanderziehen der Mundwinkel ist möglich.75
Was die Bezeichnung dieser Unterschiede betrifft, so
deutet Sweet die weiten Vocale meist durch Cursivdruck an,
die gemischten durch Beifügung eines h. Wir wollen hier
im Anschluss an das oben bei der Darstellung des deutschen
Systemes befolgte Verfahren die engen Vocale durch den Exponenten
1, die weiten durch den Exponenten 2 bezeichnen,
die gemischten Vocale nach dem Vorschlag von Storm durch
einen übergesetzten Punkt (dies ergibt neben dem i die Form
ï), sonst aber die Bezeichnungen von Sweet möglichst beibehalten
(seine eigenen Transcriptionen sind in Klammern beigefügt)
. — Sehen wir von den verschiedenen Unterarten,
deren Bildungsprincipien im vorstehenden angedeutet sind,
ab, so erhalten wir vorläufig 36 Grundvocale : siehe die
Tabelle S. 77.
Anm. 11. Diese Tabelle ist die von Sweet aufgestellte Vocaltafel mit
den Verbesserungen und Zusätzen von Storm. Nur weicht die Anordnung
in so weit ab, als Sweet die engen und weiten Vocale von einander trennt ;
bei ihm lautet also die oberste Vocalreihe y, ih, i ; A, ih, i, während ich
vorgezogen habe, die engen und weiten Formen derselben Laute neben
einander zu stellen.
Um dieses System zu studiren beginnt man nach Storm
am besten mit dem langen (engen) geschlossenen i in ihn, sie
(i1, high-front-narrow). Wenn man aus dieser Stellung den
Zungenrücken allmählich senkt, sonst aber dieselbe Spannung
und Form der Zunge behält, erhält man erst das geschlossene
e in See (e1, mid-front-narrow), dann das breite ü im schwed.
lära (œ1, low-front-narrow), welches Storm im Wesentlichen
mit dem ital. e in hello, spavento identificirt.
Anm. 12. Doch gibt Sweet nachträglich S. 211 zu, dass beim Uebergang von
i1 zu el und œ1 nicht nur die Zunge gesenkt, sondern der Ort der
grössten Enge weiter rückwärts verlegt wird, sodass die Grosse des Resonanzraumes
nach beiden Richtungen hin wächst. Ebenso bemerkt Sweet
richtig, dass man dem e1 denselben Grad der Enge geben kann wie dem
il, ohne die beiden Laute zu vermischen.
Dann spreche man das offene i in Fisch (i2, high-front-wide,
man hüte sich aber dabei in den ü- ähnlichen Laut zu
verfallen mit dem man in Norddeutschland oft das kurze i
spricht). Dabei wird die Vorderzunge loser und schlaffer als
beim geschlossenen i1. Wenn man von dieser Stellung aus
die Zunge senkt, so erhält man zuerst das offene e in Mensch
(e2, mid-front-wide), welches mit ä in Männer identisch ist,
engl. e in men, pen, dann durch noch tiefere Senkung das
engl. a in man (œ2. low-front-wide). Dem i1 entspricht mit76
tableau Gutturale (back) | Geschlossen (narrow) | Offen (wide) | Guttural-palatale (mixed) | Palatale (front) | Niedrig (low) | Mittel (mid) | Hoch (high) | Gerundet (round)77
Rundung der Lippen das deutsche ü in über, Sühne (yl, high-front-narrow-round).
Durch Senkung von diesem reinen ü
entsteht das geschlossene ö in Söhne (a1, mid-front-narrow-round),
daraus durch weitere Senkung das breite schwed. und
ostnorw. ö in för (œ1, low-front-narrow-round), welches im
franz. Nasenlaut un die vocalische Unterlage bildet. Geht
man von ü in sühnen in die ‘weite’ Stellung über, so entsteht
das offene ü in Sünde, schützen (y2, high-front-wide-round),
durch Senkung von diesem das offene ö (a2) in Götter, Stöcke,
frz. peuple, verlängert in peur, beurre. Ebenso verhalten sich
wieder die Uebergänge von deutschem langem u in du (u1,
high-back-narrow-round) zu langem o in so (o1, mid-back-narrow-round)
und zum englischen aw in saw (a1, low-back-narrow-round),
und die von offenem u z. B. in deutschem und.
engl. full (u2, high-back-wide-round) zu deutschem o in Stock
(o2, mid-back-wide-round) und dem engl. kurzen o in not (o2,
low-back-wide-round).
Schwieriger ist für den Deutschen die Reihe der nicht gerundeten
Guttural vocale, d. h. des a und seiner nächsten Verwandtschaft.
Hier ist das a-2 (mid-back-wide) das sog. reine a
des Italienischen und der deutschen Bühnenaussprache (nicht
aber das franz. kurze a in madame, patte, welches wie Storm
zeigt etwas palatalisirt ist, Storm bezeichnet es als d), von
ihm ist das englische u in but (a1, mid-back-narrow ; nur
durch stärkere Wölbung der Hinterzunge nach dem Gaumensegel
zu unterschieden. Storm betont mit Recht nachdrücklich,
dass dieser Laut mit dem deutschen ö gar nichts zu thun
hat, obschon er ein deutsches, skandinavisches oder französisches
Ohr daran gemahnt (namentlich müssen die Lippen
durchaus geöffnet gehalten werden) ; vielmehr geht das u (a1)
im Englischen selbst nahezu in a (d. h.a2) über. Den Laut a1
findet Bell in dem gael. laogh und Sweet in dem armen, e
(Lepsius), z. B. in dem Artikel ez (dieser letztere Laut klingt
auch sehr ö-ähnlich) ; der Laut ^2 erscheint nach Bell in der
Cockney-Aussprache des langen o, z. B. in no gesprochen
w^2ö2, nach Sweet auch vielleicht manchmal im diphthongischen
i, z. B. dem Pronomen I, gesprochen a2ï2 (gewöhnlicher
e2ï2). Das a1 erscheint nach Sweet häufig in der schottischen
und provinziell auch in der englischen Aussprache in
but, cut u. s. w. ; Sweet findet es auch als gewöhnlichen Laut
des kurzen a im Mittel- und Süddeutschen, z. B. in Kaffeekanne.
Das a2 ist nach Sweet das schottische a in man, hat.
78und das schwedische lange a in fader, fara, nach Stornm auch
das süddeutsche etwas dumpfe a in Vater u. s. w., auch das
franz. ä in lâche, pâte.
Am wenigsten leicht verständlich für den Deutschen sind
die Articulationen der gemischten Vocale. An der Spitze
steht das russ. jery (ï1), aus diesem entsteht durch Senkung
der Zunge das deutsche ö- ähnliche unbetonte e in Gabe
u. s. w. (vgl. S. 73), aus diesem durch abermalige Senkung
das e1 in engl. bird. Den offenen Laut, welcher dem russ.
jery entspricht, findet Sweet oft gebraucht in pretty und just
und einigen andern englischen Wörtern ; nach Bell ist der
zweite Vocal in Worten fishes dieses ï2 ; mir scheint sehr
oft unbetontes langes u im Englischen zu ïi2 zu werden (wenn
der Vocal nicht ganz verdrängt wird), z. B. in regulär, natural.
betontes u auch oft in curious (gesprochen k(j)ï2ries oder
k(j)ï2ri'ï2s) :. Die beiden ü kommen nach Sweet oft in nachlässiger
Aussprache für engl. oo vor, z. B. in tü1w oder tü2w
für two ; ö1 in der sogenannten ‘affectirten’ Aussprache des
engl. no u. s. w., 61 ist nach Ellis das lange österreichische a
in ‘Euer Gnaden’, ö nach Bell die Cockney-Aussprache des a
in ask u. s. w.
Anm. 13. Vergleichen wir dies System mit demWinteler's, so springt
sofort die Identität der palatalen Vocale mit der Reihe &. — i1 bei W. in :s
Auge. Bei W. fehlt nur die Unterscheidung zwischen œ1 und œ2 (beide
= W.'s &), und von o ?1 und o ?2 (beide = W.'s ff2). Die Gutturalvoeale
entsprechen der Winteler'sehen Reihe a—u1 ; hier aber ist das englische
System viel reicher und genauer, indem es die zahlreichen nicht gerundeten
Varietäten gesondert aufstellt, wo W. bloss seine u-Basis des a hatte ;
alles übrige würde W. durch Hülfszeichen ausgedrückt haben. — Unbekannt
war den deutschen Phonetikern die ganze Reihe der gemischten
Vocale geblieben. Ein verfehlter Versuch einige dieser Laute in Winteler's
System einzufügen war in der ersten Ausgabe dieses Buches gemacht,
vgl. oben Anm. 7. Das Richtige hat erst Bell gelehrt.
Wie man sieht ermöglicht dies System eine weit genauere
Übersicht über die möglichen Typen der Vocalbildung als das
ältere deutsche System. Gleichwohl verlangt auch dieses
System in seiner praktischen Anwendung noch eine weitere
feinere Ausbildung. Einige der angeführten Kriterien sind
z. Th. noch zweifelhafter und bedenklicher Natur ; z. B. die
stricte Unterscheidung der Articulationen durch welche sich
z. B. offenes i2 und geschlossenes e1 von dem geschlossenen i1
unterscheiden sollen (das erstere durch ‘widening’, das zweite
durch ‘lowering’) ; auf jeden Fall liegt hier die grösste praktische
79Schwierigkeit für die Einübung des Systems. Eine
weitere Schwierigkeit erwächst dem Praktiker daraus, dass
selbst innerhalb einer geschlossenen Mundart vielfache Veränderungen
des Vocalsystems auftreten können je nach den
verschiedenen Stimmungen und Affekten mit denen geredet
wird. Auf der deutschen Bühne ist es z. B. üblich, lyrische
Partien mit stärker geschlossenen Vocalen zu sprechen, wie
denn überhaupt fast jedes Rollenfach — auch abgesehen von
der Stimmlage und Stimmgebung — wieder seinen speciellen
Vocalismus hat. Für die systematische Analyse der Lautsysteme
verwandter Mundarten kommen sodann — was die
Engländer vielleicht nicht genügend hervorgehoben haben —
die oben S. 71 erwähnten Compensationen von Zungen- und
Lippenarticulation u. dgl. noch in Betracht. Hierüber eingehendere
Detailangaben zu liefern ist aber zur Zeit wohl
noch unmöglich ; es muss erst noch genaueres empirisches
Material gesammelt werden.
Die Nasalvocale.
Streng genommen kann jede Vocalnüance mit dem
Nasenton gebildet werden. Dabei sind verschiedene Stärkegrade
der Nasalirung zu beobachten, je nachdem sich das
Graumensegel mehr oder weniger von der hinteren Rachenwand
abhebt und sich der Zunge nähert. Je mehr dies geschieht
um so stärker wird der nasale Klang des Vocals. Da
aber, so viel wir wissen, keine Mundart mehr als eine Stufe
der Nasalirung entwickelt hat, so braucht auch nur ein allgemeines
Zeichen für ihr Vorhandensein festgesetzt zu werden ;
wir wählen dazu ein, an dem Vocal (q, q, i, o, u u. s. w.).
Die Stufe der Nasalirung ist für die Einzelmundart jedesmal
genauer zu bestimmen und eventuell durch ein Hülfszeichen
auszudrücken.
Man darf nicht ohne Weiteres die französischen Nasalvocale
als Repräsentanten dieser Gattung auffassen. Die
Nasalirung derselben ist auf jeden Fall stärker als die der
meisten deutschen Mundarten, welche die Nasalirung überhaupt
kennen. Es ist aber noch zweifelhaft ob diese stärkere
Nasalirung bloss durch stärkere Senkung des Gaumensegels
oder auch durch eine besondere gutturale Engenbildung zwischen
Zungenrücken und Gaumensegel bedingt wird, wie
80Bell und nach ihm Sweet (doch zweifelnd, vgl. Handb. 211)
und Storm annehmen. In einem Falle habe ich sicher eine
stärkere Wölbung der Hinterzunge zum Gaumensegel hin
beim Übergang von a zu a beobachtet. Die französischen Nasale
sollten also, wie Storm S. 36 bemerkt, eigentlich Gutturalnasalvocale
heissen ; die deutschen Nasal vocale aber
scheinen auch ihm rein nasal, d. h. ohne gutturalen Charakter
gebildet zu werden. Dagegen findet Storm im Polnischen
auch noch dentale und labiale Varietäten : ‘Die polnischen
Nasalvocale q, q nehmen vor d, t einen mehr dentalen,
vor b, p einen mehr labialen Charakter an, so dass ein unvollkommenes
n oder m mit dem Vocal verschmilzt, indem bei
Zähnen und Lippen eine ähnliche lose Annäherung stattfindet,
wie sonst beim harten ( ?) Gaumen : pęta, Dąbrowski’
Tonlose Vocale.
Als tonlose Vocale kann man die schwachen Geräusche
bezeichnen, welche entstehen wenn man einen nicht tönenden
Exspirationsstrom durch die Stellungen beliebiger Vocale
führt. In den herkömmlichen Alphabeten werden alle diese
tonlosen Vocale — deren es natürlich so viele gibt als tönende
— durch h wiedergegeben, wie zuerst Whitney (Oriental and
Linguistic StudiesII, 268) bemerkte und nachher Hoffory
(Kuhn's Zeitschr. XXIII, 554 ff.) weiter ausführte. Nach dieser
Auffassung stellt also ha die Lautfolge von tonlosem a + tönendem
a dar. Andere aber fassen das consonantisch fungirende
h selbständig, und sagen demgemäss consequent, in ha
habe das h die a-Stellung oder a-Resonanz, in he die e-Resonanz
u. s. w. (vgl. § 17. 23, 3).
Schlussbemerkungen.
Die ältere Grammatik, welche überhaupt mehr von den
geschriebenen Lautzeichen als von den gesprochenen Lauten
auszugehen pflegte, hatte sich im Anschluss an das consequent
entwickelte Zeichensystem der alten Sprachen die Auffassung
zu eigen gemacht, dass es nur eine beschränkte Anzahl von
Vocalen gäbe, deren Unterschiede durch das traditionelle
Zeichenmaterial hinlänglich bezeichnet wären. Zwar lehrte
die einfachste Beobachtung, dass mehr Verschiedenheiten als
die durch das Zeichensystem wieder gegebenen fast überall
existirten ; allein, da man von Jugend auf daran gewöhnt
81war. nur die innerhalb des engsten Gesichtskreises als ‘gebildet’
bezeichnete Aussprache der Vocale (wie überhaupt aller
Sprachlaute) als massgebend zu betrachten und alle Abweichungen
davon als ‘dialektische Rohheiten’ oder ‘Provincialismen’
zu brandmarken, übertrug ein jeder ohne Weiteres
die ihm geläufige Aussprache seiner Lautzeichen auf die Lautzeichen
anderer Idiome, unbekümmert ob er damit den eigenthümlichen
Charakter derselben verwischte oder nicht. Dass
bei einem solchen Verfahren von einem wirklichen Verständniss
irgend eines Lautsystems keine Rede sein kann, ist ohne
Weiteres klar. Demgegenüber ist folgendes festzuhalten.
1. Da die Sprache natürlicher Weise nicht bloss in den
Kreisen der ‘Gebildeten’, noch weniger auf dem Papier sich
bildet und fortentwickelt, vielmehr im Munde des Volkes ihre
eigentliche Entwickelungsstätte hat, so ist für die Sprach- und
Lautgeschichte (die doch nicht nur Schulzwecken dienen soll ;
ein jeder Unterschied zwischen einer ‘Sprache der Gebildeten’
und den Dialekten ein für allemal aufzuheben. Eine jede factisch
bestehende Mundart, und wäre sie auch auf das allerengste
Gebiet eingeschränkt, ist auf diesem Felde den andern
vollkommen gleichberechtigt und vollkommen gleich wichtig.
Nur stehen die Mundarten der Gebildeten darin hinter denen
der Ungebildeten zurück, dass sie niemals eine ungehinderte
und consequente Entwickelung aufweisen können, sondern
stets willkürlichen Eingriffen von Seiten der Schule und des
abschleifenden und nivellirenden Verkehrslebens ausgesetzt
sind.
2. Es gibt nicht bloss eine kleine Anzahl absolut gültiger
Vocale, sondern eine für den Einzelnen unübersehbare Reihe
von solchen, die durch die unmerkbarsten und ganz continuirlichen
Uebergänge unter einander verbunden sind.
3. Hiernach ist es unmöglich ein Vocalsystem aufzustellen,
das alle wirklichen und möglichen Vocalunterschiede enthielte.
Ein solches System entspricht ausserdem nicht einmal
den praktischen Bedürfnissen. Wir brauchen nicht zu
wissen, wie viel Vocalnüancen es überhaupt gibt, sondern in
welcher Weise das Vocalsystem einer jeden einheitlichen
Sprachgenossenschaft zusammengesetzt ist (d. h. wie viele
Vocale diese unterscheidet und wie dieselben zu einander
liegen), und wie dieses System sich zu andern ebensolchen
Systemen verhält.82
4. Zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse dient ein
mit Rücksicht auf die wirklich innerhalb einzelner Sprachgenossenschaften
vorkommenden Unterschiede entworfenes
Normalzeichensystem. Die Abweichungen der einzelnen
Mundarten von dieser Articulationsweise sind genau anzugeben,
und eventuell durch Hülfszeichen zu bezeichnen.
5. Hierbei kommt es wiederum nicht sowohl auf das Verhältniss
des einzelnen Lautes zum einzelnen Laute an, als auf
das Verhältniss der Systeme. Man unterlasse also nie zu
untersuchen, ob sich die Abweichungen der Einzelvocale
zweier oder mehrerer Systeme nicht auf ein gemeinsames, die
Stellung der Systeme ohne Weiteres charakterisirendes Princip
zurückführen lassen.
Anm. 11. Solche Principien sind beispielsweis die stärkere oder geringere
Betheiligung der Lippen (S. 72 u. ö.), verschiedene Stufen der Nasalirung
(S. 80). Ferner gehört hierher namentlich auch eine durchgehends
bei allen Vocalen des Systems abweichende Lagerung der Zunge, die wahrscheinlich
von Differenzen in der Ruhelage der Organe herrührt. Versuche
ich als Mitteldeutscher z. B. eine prägnant norddeutsche Mundart wie etwa
die holsteinische zu sprechen, so muss ein für allemal die Zunge etwas
zurückgezogen und verbreitert werden ; hat man die richtige Lage, gewissermassen
die Operationsbasis, einmal gefunden und versteht man dieselbe
beim Wechsel verschiedener Laute festzuhalten, so folgen die charakteristischen
Lautnüancen der Mundart alle von selbst. Füge ich zu
dieser Articulationsweise noch die Neigung der Zunge zu cerebraler Articulation
(s. § 8, 2, 1, a) bei passiver Lippenlage, so gewinne ich ohne alle
Mühe die Basis zur Aussprache der Englischen. Aber auch geringere
Unterschiede haben noch sehr merklichen Einfluss auf den Charakter der
Sprache. In der mir geläufigen niederhessischen Mundart articulirt die
Zunge schlaff und mit möglichst geringer Anspannung aller ihrer Theile,
auch die Kehlkopfarticulation ist wenig energisch. Um dagegen den richtigen
Klangcharakter der sächsischen Mundarten (natürlich abgesehn von
den Verschiedenheiten des Lautsystems) zu treffen, muss die ganze Zunge
angestrafft werden und der Kehlkopf bei stärkerem Exspirationsdruck
energischer articuliren. Daher macht auch diese Mundart einen harten,
etwas schreienden Eindruck gegenüber dem dumpfen, fast verdrossen und
theilnahmlos zu nennenden Charakter der hessischen Mundart. — Derartige
Vergleichungen sind höchst lehrreich ; wer irgendwie in der Lage
ist, mehrere Mundarten sich aneignen zu können, versäume ja nicht dies
zu thun und die Abweichungen derselben systematisch zu studiren.
Dabei leistet die oben erwähnte Operationsbasis die besten Dienste.
Was hier an dem Beispiel der Vocale namentlich in Beziehung
auf den Mangel objectiver Grenzen und die Nothwendigkeit
systematischer Gliederung, erläutert worden ist,
gilt mehr oder weniger von allen Sprachlauten und wird daher
im Folgenden stets stillschweigend vorausgesetzt werden.83
§ 12. Die Liquidae.
Unter Liquiden verstehen wir streng genommen nur die
rein sonor gebildeten Arten der r- und l-Laute. Sie sind
streng zu scheiden von den spirantischen r und l, die
zu ihnen in einem ähnlichen Verhältniss stehen wie die Spirans
j (der tönende ich-Laut) zu dem Vocal i. Da nämlich
wie beim i so auch beim sonoren r, l bedeutende Engen im
Ansatzrohr hergestellt werden, so können sich unter den oben
S. 59 f. geschilderten Bedingungen leicht Geräusche als Begleiter
des Stimmtons einstellen. Diese können sodann derartig
gesteigert werden, dass man sie gegenüber dem Stimmton
als das Wesentliche empfindet, ja in gewissen Fällen kann
dieser sogar ganz wegfallen und wir erhalten lediglich auf Geräuschbildung
im Ansatzrohr beruhende tonlose r und l.
Die Laute, welche wir in hergebrachter Weise mit r und l
bezeichnen, gehören also entweder zur Classe der Sonoren
oder zu der der Geräuschlaute. Da sich hiernach ihre eigenen
Schicksale wie auch ihre Einwirkungen auf benachbarte Laute
in durchaus verschiedener Weise regeln, so ist auch für die
Lautgeschichte dieser Unterschied von höchster Bedeutung.
Es sollen deshalb gleich hier beide Arten einander gegenübergestellt
werden. Wir gehen dabei aus von den betreffenden
liquiden Formen, da diese vermuthlich die den indogermanischen
Sprachen ursprünglich eigentümlichen waren.
Wie bei den Vocalen, so haben wir auch bei den Liquiden
Zungen- und Lippenarticulation zu scheiden ; nur tritt die
letztere gegen die erstere noch mehr zurück ; sie richtet sich
gewöhnlich nach der betreffenden Lautumgebung ; der specifische
r- oder l-Klang, auf den allein es zunächst bei der
allgemeinen Charakteristik dieser Laute ankommt, wird durch
die diesen Lauten im Gegensatz zu den Vocalen eigenthümliche
Articulationsweise der Zunge bedingt (vgl. S. 60).
Die Articulation der Vocale ist, wie man sich leicht überzeugen
kann, durchaus dorsal, der liquide r-Laut entsteht
durch coronale, der l-Laut durch laterale Articulation
der Zunge, d. h. für die r-Laute ist die Articulation des vordern
Zungensaumes, für die l-Laute die der beiden Seitenränder
charakteristisch. Denn das Rollen der Zungenspitze
beim r ist, wenigstens wenn wir den historischen Entwickelungsverlauf
der indogermanischen Sprachen in's Auge
84fassen, als unwesentlich und secundär zu betrachten ; desgleichen
sind das sog. gutturale oder uvulare und das Kehlkopf-r
offenbar erst spätere Substitutionen für das ursprünglichere
Zungenspitzen-r.
1. Die r-Laute.
a. Cerebrales r.
Die am wenigsten leicht der Beimischung von Geräuschen
ausgesetzte Art des liquiden r ist die cerebrale oder cacuminale.
Sie ist häufig in den neuindischen Sprachen, kommt
aber auch in Europa vor, z. B. dialektisch im Englischen (nach
Sweet in den westlichen Grafschaften und in Kent, aber auch
im amerikanischen Englisch). Von den im Deutschen üblichen
r-Arten unterscheidet sie sich besonders durch den
gänzlichen Mangel des Rollens.
Der vordere Zungensaum ist bei der Bildung dieses r rings
herum aufgebogen, so dass die Zunge löffelartig ausgehöhlt
erscheint, und dem harten Gaumen hinter den Alveolen der
Oberzähne genähert. In dieser Stellung verharrt der Zungensaum
während der ganzen Dauer des r ohne Schwingungen,
einerlei ob dasselbe als Consonant, wie etwa in der erwähnten
dialektischen Aussprache des Englischen bei Wörtern wie
row, morrow. oder als Sonant gebraucht wird, was z. B. in
Amerika nicht selten der Fall ist bei Wörtern wie sir, bird,
heard (gesprochen sr, brd. hrd ; auch engl. pretty lautet oft
prte11 doch vgl. auch § 23, 3).
b. Alveolare r.
Die Bildung des cerebralen r erfordert eine ziemlich starke
Zurückbiegung der Zungenspitze, damit der Zungensaum
hinter den Alveolen die Enge bilde. Durch einfache Hebung
der Vorderzunge aus der Ruhelage gelangt man zu einer Engenbildung
zwischen dem Zungenrand und den Alveolen. Dies
ist die Stellung aus der im Deutschen und den meisten andern
Sprachen in der Regel die sog. dentalen oder richtiger
alveolaren r articulirt werden.
Der Spielraum der alveolaren r ist ziemlich bedeutend, er
erstreckt sich von der Hinterfläche der Alveolen bis an deren
vorderste Grenze am Rande der Oberzähne. Man kann danach
ein vorderes, mittleres und hinteres Alveolar-r unterscheiden
(Sweet's outer r, medium r und inner r ; Hoffory
85nennt das vordere r1 gingival, das mittlere und hintere r2
alveolar, Kuhn's Zeitschr. XXIII, 531 f.
In diesem Gebiete stehen sich nun zunächst gerollte
und nicht gerollte Varietäten gegenüber. Das Rollen
(trilling) entsteht dadurch, dass der dünn emporgewölbte
Saum der Zunge durch den Exspirationsstrom nach aussen
geworfen wird, um im nächsten Momente vermöge seiner
Elasticität wieder in seine alte Lage zurückzukehren. Die
Anzahl der so gegebenen Schläge ist im Einzelnen verschieden.
Charakteristisch ist für den Klang dieser r, dass bei
jedem Zungenschlag der Stimmton unterbrochen oder geschwächt
wird, da bei jedem Schlage eine Verengung der
Ausflussöffnung stattfindet. Reibungsgeräusche brauchen dabei
nicht erzeugt zu werden. Man kann daher auch die gerollten
Alveolar-r in den meisten Fällen noch zu den Liquiden
rechnen. Die Bildung von Reibungsgeräuschen hängt zum
guten Theile von der Grosse der Ausflussöffnung ab. So lange
wie beim stark gerollten deutschen Bühnen-r nicht nur der
vordere Saum der Zunge, sondern auch ein nicht unbeträchtlicher
Theil der Seitenränder mitschwingt, stehn die Geräusche
hinter dem Stimmton durchaus zurück. Erst dann,
wenn die Seitenränder der Vorderzunge bis fast ganz nach
vorn hin an die Zähne angepresst werden, so dass nur der
vorderste Theil des Zungensaumes in einer sehr verkleinerten
Enge hin- und herschwingen kann, bekommen die Reibungsgeräusche
einen deutlicheren s- oder sch -ähnlichen Klang,
namentlich beim Flüstern (so z. B. in dem vorderen armenischen
r1). Je stärker der Exspirationsdruck und je kleiner
die Oeffnung, um so deutlicher werden dieselben ; ja es kann
sich schliesslich an das r ein vollständiges tönendes sch anschliessen
(wie im czech. r, aber poln. rz ist schon reines z
geworden). So entstehen spirantische gerollte Alveolar-r.
Auch tonlose gerollte Alveolar-r kommen oft vor, namentlich
nach tonlosen Geräuschlauten ; als selbständige Consonanten
auch z. B. im isl. hr (Hoffory, Kuhn's Zeitschr.
XXIII, 533) etc., als Sonanten oft in der Aussprache der Bewohner
der baltischen Provinzen in Wörtern wie Vater, Mutter,
Messer etc. Ob das tonlose r ein blosses Flattergeräusch
ist, oder mehr sibilantischen Charakter annimmt, hängt dabei
wieder von der speciellen Form der Articulation ab.
Das ungerollte Alveolar-r ist im Englischen häufig ;
es ist die normale Aussprache des anlautenden r im Englischen,
86wie jetzt wohl alle Phonetiker annehmen. Gelegentlich
kommt es in Nordwestdeutschland vor (ich habe es von
Ostfriesländern gehört). Man kann dieses r mit ziemlicher
Intensität und lange anhaltend hervorbringen, ohne dass es
deswegen zu einem gerollten wird. Es scheint, dass bei ihm
die vorderen Partien der Zunge massiger geformt sind, also
weniger leicht in jene Flatterbewegung versetzt werden können ;
vielleicht liegt aber auch der Unterschied mit darin,
dass die Oeffnung eine grössere ist als beim gerollten r (das
ungerollte r wäre dann als ein weites, das gerollte als ein
enges zu bezeichnen, da, wie Sweet S. 9 richtig bemerkt,
die Unterscheidung von offen und geschlossen auch auf die
Consonanten Anwendung findet).
Das entsprechende spirantische ungerollte Alveolar-r
findet sich ebenfalls im Englischen sehr häufig. Es hat seine
Hauptstelle in den Lautverbindungen tr und dr wie in try,
street dry u. s. w. Beim t und d sperrt hier nämlich die
Zunge in der r-Lage die Mundhöhle vollkommen ab ; wenn
sich nun beim Uebergang zum r die Zunge nicht schnell genug
vom Gaumen entfernt oder der Exspirations druck nicht
augenblicklich auf das für r gebührende Mass reducirt wird,
so entsteht an der Enge zwischen Zungensaum und Gaumen
ein dem engl. sh ähnliches Reibungsgeräusch, das sich mit
dem Stimmton zu dem spirantischen r verbindet. Nach tonlosen
Lauten wie t, p wird das r vielfach tonlos, wenigstens
in seinem Anfang, erst beim Uebergang zum Vocal tritt der
Stimmton auf.
Anm. 1. Dies ist die gewöhnliche Aussprache des engl. tr, und so erklärt
es sich, dass Wörter wie tried für ein ungeübtes Ohr fast nicht von
solchen wie chide zu unterscheiden sind ; doch hat der Zischlaut im ch
mehr dorsalen, der in tr mehr coronalen Charakter (s. § 15, 2, a.) Tonloses
r mit schwächerem Reibungsgeräusch hat das Englische namentlich
oft in der Verbindung pr wie in pride, als Sonanten hört man es in Lautfolgen
wie I propose (gesprochen aï prpouz, wenn nicht das r ganz übergangen
und nur p'p mit doppelter Explosion gesprochen wird) und ähnlichen.
— Ueber r als tonloses r s. § 24.
Die Substitutionszitterlaute.
An Stelle der den ältesten indogermanischen Sprachen
wahrscheinlich allein eigenen r-Laute der Zungenspitze sind
in den moderneren Idiomen vielfach Laute ähnlichen Klanges,
doch verschiedener Bildungsweise getreten. Indem man nämlich
87das Rollen als das Charakteristische der deshalb als Zitterlaute
bezeichneten r empfand, substituirte man —natürlich
unbewusst — statt des schwingenden Zungensaumes
andere ähnlicher Schwingungen fähige Theile des Sprachorgans,
und gewann auf diese Weise eine Reihe neuer Laute
die wir im Gegensatz zu den älteren Zungenspitzenlauten als
Substitutionszitterlaute bezeichnen können. Dieselben sind :
c. Uvulares r.
Das sog. gutturale oder besser uvularer wird durch
Schwingungen des Zäpfchens gebildet. Dies geschieht in der
Weise, dass man den Zungenrücken zum weichen Gaumen
emporhebt, wie beim gutturalen ch, jedoch in der Mittellinie
der Zunge eine Rinne bildet, in der das Zäpfchen frei nach
vorn und rückwärts schwingen kann. Je tiefer diese Rinne
ist, um so leichter ist das r von auffallenden Reibungsgeräuschen
freizuhalten. In den lebenden Sprachen wird aber
die Rinnenbildung vielfach vernachlässigt, so dass das r einen
sehr kratzenden Charakter bekommt und selbst vollständig in
die tönende gutturale Spirans 5 übergeht ; daher denn auch die
bis auf Brücke, Wiener Sitz.-Ber. II, 202, gangbare Vorstellung,
das ‘Gaumen -r’ werde durch Zittern des weichen Gaumens
erzeugt ; richtig ist, dass bei energischer Aussprache des
kratzenden r ohne genügende Rinnenbildung der Rand des
Gaumensegels etwas in flatternde Bewegung geräth.
Im Auslaut und nach tonlosen Geräuschlauten wird auch
das uvulare r sehr häufig tonlos gebildet und wechselt demgemäss
auch gelegentlich mit der tonlosen gutturalen'Spirans x.
d. Das Kehlkopf -r.
Dieser Laut entsteht nach Brücke, Sitz.-Ber. II, 207.
Grundz. 13 f. (vgl. auch Merkel, Schmidt's Jahrbb. C, 86.
Donders, Phys. 20. Ellis IV, 1099) wenn man zu immer tieferen
Tönen herabsteigend die untere Grenze seines Stimmumfangs
überschreitet, sodass die Stimmbänder nicht mehr in
der gehörigen Weise tönen, sondern in einzeln vernehmbaren
Stössen zittern. Es wäre hiernach das Kehlkopf-r als intermittirender
Stimmton zu charakterisiren (vgl. auch
Grützner 209). Wirklich gelingt es leicht einen solchen intermittirenden
Laut zu erzeugen, namentlich bei Inspiration,
wobei die einzelnen Stösse langsamer und deutlicher getrennt
88vernehmbar einander folgen. Aber seine Bildung ist keineswegs
an die tiefsten Töne des menschlichen Kehlkopfs gebunden,
sondern seine Tonhöhe kann, wie schon Donders
beobachtete, wesentlich erhöht werden. Bei einiger Übung
kann man ihn durch den grössten Theil des Umfanges der
Bruststimme durchführen, jedenfalls ist er innerhalb der Tonlagen
des gewöhnlichen Sprechens durchaus leicht bildbar.
Hieraus folgt, dass er für den gewöhnlichen Stimmton unter
Umständen vicarirend eintreten könne. So bemerkte Donders,
dass Dickhälse die Neigung haben ihn statt des Stimmtones
zu gebrauchen (auch wir reden ja oft von ‘knarrenden’ Stimmen),
und dass er sich bei andern mit der Stimme verbindet
oder mit ihr abwechselt und den Eindruck klagender Sentimentalität
hervorbringt (dies hört man, wie ich hinzufüge,
namentlich oft bei Kindern in weinerlicher Stimmung, und
vielfach bei recht hoher Tonlage), während er bei geschlossenem
Munde als klägliches Stöhnen erscheint. Abgesehen von
diesen Fällen durchgehender Ersetzung des Stimmtons durch
den rasselnden Laut tritt derselbe dialektisch als Vertreter von
Vocal + r auf. Entweder verschmelzen diese beiden Laute
ganz zu intermittirendem Vocal, oder der Vocal wird glatt
eingesetzt und nur der Ausgang wird knarrend gebildet. So
hört man, wie ebenfalls Donders beobachtete, im Londoner
Dialekt z. B. o²s mit knarrendem Vocal für horse ; ähnlich
habe ich von Dänen Worte wie kar, har aussprechen hören.
Aber in den von Brücke angeführten Beispielen ōrt Ort, wūrt
Wort, dürt Dorothea, habe ich, soweit mir ihre Aussprache
überhaupt bekannt ist, nichts anderes zu hören vermocht als
einen dem o, u, ü folgenden, mehr nach der neutralen Mitte
der Vocallinie zu liegenden vocalischen Nachklang von sehr
geringer Energie, obgleich mir die knarrende Bildung des
Stimmtones seit meinen Kinderjahren vollkommen geläufig
ist ; vielleicht also dass die knarrende Aussprache jener
und ähnlicher Wörter nicht so allgemein durch Niederdeutschland
verbreitet ist. — Es ist übrigens zu beachten,
dass da, wo knarrender Vocal für Vocal + r steht, das r oft
durch eine mehr oder weniger starke gutturale Einschnürung
markirt wird ; dadurch wird der Rest des Vocals gedämpft und
so wegen seiner geringeren Schallfülle (vgl. § 26) als Consonant
gegenüber dem als sonantisch empfundenen Eingange
gefühlt.89
e. Das Lippen-r.
Auch mit den Lippen kann man einen Zitterlaut erzeugen.
Dieselben müssen dabei ganz locker auf einander gelegt und
vorgeschoben werden. Man bildet diesen Laut, in Deutschland
wenigstens, tonlos oft beim tiefen Ausathmen bei grosser
Hitze als eine Art Interjection, die Erschöpfung andeutet.
Kürzer herausgestossenes pr (tonlos) und br dient als Interjection
des Abscheus und der Verachtung, lang gedehntes br
findet sich oft bei Kutschern, wenn sie ihren Pferden Halt
gebieten (Brücke2 49] neben br mit alveolarem oder uvularem
r. Als eigentlicher Sprachlaut ist das Lippen-r selten.
Kempelen beobachtete gelegentliche Bildung desselben als
‘Sprachfehler’ einzelner Individuen (S. 331), nach einer Angabe
von Forster bei Chladni S. 213 soll es in der Sprache
einer Insel in der Nähe von Neuguinea vorkommen. In den
finnischen Idiomen findet es sich nach Genetz Einführ. S. 15
in einigen Interjectionen und daraus abgeleiteten Wörtern, wie
pruu, prukottelen.
Nasalirte r. namentlich nicht-gerollte Arten, sind leicht
zu bilden, aber ihr factisches Vorkommen als normale Sprachlaute
scheint noch nicht nachgewiesen zu sein.
2. Die l-Laute.
Das Gemeinsame der l-Laute ist das, dass wie bei d. t die
Zungenspitze die Mundhöhle in ihrer Mittellinie nach vorn zu
zu absperrt, dagegen die mittlere Zunge sich seitlich von den
hintern Backenzähnen abhebt und so zwei zur Mittellinie
symmetrisch gelegene Ausflussöffnungen für den Schall bildet
(daher der englische Name divided für diese Art der Articulation).
Häufig aber wird nur eine solche Ausflussöffnung hergestellt ;
wir erhalten so asymmetrische oder unilaterale
l (ein rechtes und ein linkes).
In der Menge der so erzeugten Laute sind ebensoviele
Species zu unterscheiden als wir oben S. 50 f. Articulationen
der Vorderzunge aufgestellt haben : also cerebrale, palatale,
alveolare, postdentale und interdentale (mit
den Unterabtheilungen von Lauten coronaler oder dorsaler
Articulation). Cerebrale l finden sich wieder im Sanskrit und
den neuindischen Sprachen, palatale in den ital. gl, span. ll,
90port. lh (vgl. § 23, 1), alveolare im Englischen und Norddeutschen
u. s. w.
Die Unterschiede der Klangfarbe dieser Species sind nicht
sehr bedeutend, allenfalls treten die cerebralen l den drei
übrigen Arten gegenüber. Dagegen wechselt der Klang des l
sehr stark je nach dem Verhalten des Zungenkörpers und der
Grosse der dadurch bedingten Ausflussöffnungen. Der dunkelste
l-Laut entsteht, indem man nur die Zungenspitze zum
Abschlüsse verwendet, d. h. den vordem Zungenkörper im
Übrigen möglichst senkt und vom Gaumen entfernt hält, und
dadurch zugleich jene Öffnungen zu ziemlich langen Spalten
ausdehnt. So wird im Vordermunde ein grosser Hohlraum
tiefer Resonanz geschaffen, der dem l seinen eigentümlichen
‘dunklen’ Klang verleiht. Der Klang wird immer heller, je
mehr man den vordem Theil des Zungenkörpers hebt und dadurch
den Resonanzraum und die Ausflussöffnungen verkleinert.
Unser gewöhnliches deutsches l steht etwa in der Mitte,
doch weichen auch die deutschen Mundarten vielfach nach
der einen oder andern Seite ab ; als Beispiel des ‘hellen’ l mag
das slawische mouillirte l genannt werden.
Die meisten Phonetiker setzen seit Purkinje auch ein
gutturales l an und finden dies in dem ‘harten’ russ. l
(li, m) und ähnlich klingenden Lauten. In der Auffassung
dieses Lautes scheint aber noch keine Übereinstimmung zu
bestehen. Nach Bell und Sweet (welche den Laut als back-divided
bezeichnen) muss ein ‘centraler Verschluss’ mit der
ganzen Zungenwurzel ausgeführt werden, wobei die Zunge
stark zurückzuziehen ist. Die Luft entweicht zwischen den
Seiten der Zungenwurzel und den hintern Backenwänden
(Sweet S. 44). Storm gibt dagegen (S. 39) an, dass die hintere
Zunge gehoben und der ganze hintere Mundkanal verengt
(also nicht gespalten) werde, und dass hierdurch der
gutturale Klangcharakter entstehe ; diese Articulation erkläre
auch die häufigen Übergänge des l in u, o (als gutturale Vocale ;
übrigens spricht auch das armen. £2 für griech. /, z. B.
in pavyos = Ilavlog, für eine solche Articulation). Ich kann
in dieser Frage kein bestimmtes Urtheil abgeben, neige mich
aber bezüglich des slawischen harten l der Auffassung Storm's
zu ; das gäl. l in laogh (gesprochen lc1), welches Bell als Beispiel
des back-divided l aufstellt, habe ich nicht gehört.
Zu diesen Unterschieden gesellen sich dann noch die durch
die verschiedenen Lippenstellungen bedingten Abweichungen
91hinzu : das dunkle l wird durch Rundung der Lippen noch
dumpfer, das helle l durch Zurückziehen derselben noch
heller u. s. w. Die Art des Verschlusses ist hierbei überall
ziemlich unwesentlich ; doch begreift man leicht, dass aus
Bequemlichkeitsrücksichten ein cerebrales l vorwiegend mit
dunkler, ein dorsales, bei dem der Zungenrücken schon ziemlich
gehoben ist, vorwiegend mit heller Klangfarbe gebildet
wird. Das palatale l ist selbstverständlich stets hell.
Spirantische l entstehen leicht bei stärkerer Engenbildung
an der Articulationsstelle ; tonlose l sind namentlich
im Auslaut und in der Nachbarschaft tonloser Geräuschlaute
häufig. Das welsche ll und isländische hl sind ebenfalls
einfach tonlose l. Das Reibungsgeräusch derselben kann verschiedene
Stärkegrade haben.
Nasalirte l sind leicht zu bilden und kommen z. B. im
Sanskrit beim Zusammentreffen von Nasal + l vor : yalolokam,
mahālolunāti für yam lokam, mahān lunāti, Hoffory, Kuhn's
Zeitschr. XXIII, 550.
Anm. 2. Wir haben beim l wegen der Beweglichkeit des Zungenkörpers
wie bei den Vocalen eigentlich eine ganze Scala von Lauten. Der
wesentlichste Unterschied beider Lautgruppen liegt nur darin, dass beim
l weit weniger Stufen zu gegensätzlicher Geltung entwickelt sind. In der
Regel werden nämlich vom l höchstens zwei Stufen, helles und dunkles l,
unterschieden. Auch zwischen cerebralem und nicht-cerebralem l hat sich
nur in wenigen Sprachen, wie z. B. im ältesten Sanskrit oder im Schwedischen,
ein Gegensatz herausgebildet ; noch weniger pflegt man sich des
Unterschieds der nicht-cerebralen Species bewusst zu werden.
Anm. 3. Der specifische l-Klang ist bedingt durch einen gewissen
Grad der Enge der Ausflussöffnungen. Man kann alle Vocale, statt in der
gewöhnlichen Weise, auch so bilden, dass man die Zungenspitze an den
Gaumen andrückt, nur muss dann die Zunge ziemlich stark verschmälert
werden. Verbreitert man sie in dieser Stellung allmählich bei tönender
Stimme, so hört man, wie derVocallaut immer mehr verschwindet und
dafür der specifische l-Klang immer klarer hervortritt. Auf diesem Verhältniss
beruhen grossentheils die Berührungen zwischen l-Lauten und
Vocalen.
Anm. 4. Bei dem cerebralen l kommen oft Berührungen mit dem cerebralen
r vor, indem der centrale Verschluss des Mundcanales gelockert, aber
die seitliche Einziehung der Zunge wie bei den l-Lauten beibehalten wird.
Dieser Art ist das sog. ‘dicke’ l des Ostnorwegischen und Schwedischen,
dessen Bildung Storm S. 24 so beschreibt : ‘Die Zungenspitze wird gegen
den mittleren Gaumen ohne ihn zu berühren zurückgezogen und dann
plötzlich, mit einem Schlage den Vordergaumen entlang wieder in ihre
normale Lage versetzt. Dabei wird meistens im letzten Momente der
Vordergaumen von der Zungenspitze flüchtig berührt, aber dies ist unwesentlich ;
wird die Berührung energischer, so entsteht (cerebrales) rd.
Hierdurch entstehen verschiedene Lautnüancen dicht nach einander ; namentlich
92lautet im ersten Moment mehr ein spirantisches cerebrales r, im
nächsten ein cerebrales l, das bisweilen etwas von d hat. Diese Laute,
die eigentlich nach einander folgen, verschmelzen dem Gehör zu einem
einzigen gemischten Laut, der auf uns (Norweger) mehr den Eindruck
von l macht, auf die Ausländer aber mehr den von r. Auch ist dieser
Laut verhältnissmässig momentan und lässt sich nicht verlängern oder
verdoppeln’. Einen andern, aber analogen Mittellaut zwischen ungerolltem
(alveolarem) r und l habe ich von einem Papua von der Insel Pentecoste
(Neu-Hebriden) und einem Kretenser gehört ; vgl. auch Ellis IV, 1133 und
Sweet S. 85 über das Japan, r.
§ 13. Die Nasale.
Der specifische Nasalklang wird, wie wir oben S. 60 f. gesehen
haben, dem Stimmton dadurch mitgetheilt, dass zu
einem mehr oder weniger grossen Theile der Mundhöhle die
Nasenhöhle als Resonanzraum hinzutritt. Die einzelnen Species
der Nasale aber beruhen auf der Verschiedenheit der Orte,
an denen der Mundraum nach Aussen hin abgesperrt wird.
So erhalten wir wieder die Hauptgruppen der labialen (m),
dentalen (n mit allen den Unterabtheilungen die wir S. 49
und 51 f. kennen gelernt haben), palatale (w) und gutturale
[to] Nasale. Cerebrale n finden sich z. B. im Sanskrit, den
neuindischen Sprachen und im Schwedischen (für rn), palatales
n erscheint im span. n z. B. in año. ital. gn in campagna,
auch in der schweizerischen Aussprache des franz. gn, z. B.
in compagnon, Champagne ; das nordfranz. gn ist aber nach
Storm S. 47 vielmehr ein mouillirtes gutturales ra, da seine
Articulationsstelle weiter hinten, an der Grenze des harten
und weichen Gaumens liegt. Jener vordere Palatallaut würde
daher nach S. 53 als n1, der nordfranzösische Laut aber vielleicht
als n² zu bezeichnen sein. Im übrigen muss auch hier
wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass jede Species
wieder zahlreicher Unterabtheilungen fähig ist, je nachdem
die nicht gerade den Verschluss bildenden Theile des Ansatzrohres
verschiedene Lagerung haben. Am deutlichsten ist dies
beim m, denn bei diesem kann nicht nur die an der Nasalbildung
nicht betheiligte Zunge dieselbe Reihe von Articulationsstellungen
durchlaufen wie bei den Vocalen, sondern
auch die verschlussbildenden Lippen können noch durch Vorschiebung
oder Zurückziehung u. s. w. auf den Klang des
Nasals einwirken (Näheres s. § 23). Halbsonore Nasale
können zwar auch erzeugt werden, aber sie kommen so weit
meine Erfahrung reicht nicht vor. Tonlose Nasale aber begegnen
93in vielen Sprachen, z. B. tonloses n im isländ. hn und
kn, z. B. in hniga, knif(Hoffory, Kuhn's Zeitschr. XXIII,
546 ff.), tonloses m in der Interjection hm (worüber unten
§ 17, Anm. 2 Genaueres). Das Reibungsgeräusch dieser Laute
ist wieder von sehr verschiedener Stärke je nach der Intensität
der Exspiration.
Anm. Ich habe früher die Existenz tonloser Nasale geläugnet, weil
ich das was oben als ‘tonloser Nasal’ bezeichnet wurde früher als einen
‘durch die Nase geführten Hauch’ betrachtete. Vergleiche dagegen die
ausführlichen Erörterungen von Hoffory a. a. O. Auch die englischen
Phonetiker erkennen die Existenz tonloser Nasale durchaus an.
Cap. II. Die Geräuschlaute.
§ 14. Die Verschlusslaute.
A. Allgemeineres.
(Tenuis und Media; Aspirata, Affricata).
Das Consonantensystem der griechisch-römischen Grammatiker
umfasst nur zwei Arten von Verschlusslauten, die
wir heutzutage mit den lateinischen Namen der Tenues und
Mediae zu benennen pflegen. Die sog. Aspiraten des
Griechischen φ. ϰ, ϑ oder lat. ph, th, ch waren aber zu der
Zeit wo jene Systeme aufgestellt wurden bereits Spiranten
oder werden doch von uns als Spiranten gesprochen (ausser
in Deutschland das &, welches vom r meist nicht unterschieden
wird). Die Zeichen für die Tenues tt, t, x, lat. p, t, c,
k, q und die Mediae ß, d. y. lat. b, d, g sind in die Schriften
aller abendländischen Nationen übergegangen, und es ist daher
in Deutschland z. B. üblich geworden diejenigen Laute,
welche durch p, t, k, q bezeichnet werden, Tenues zu nennen,
diejenigen aber welche durch b, d, g ausgedrückt werden, als
Mediae zu bezeichnen. Die p, t, k werden aber in verschiedenen
Gegenden ganz verschieden ausgesprochen, bald mit
stärkerem, bald mit schwächerem Hauch, bald vollkommen
hauchlos, und bei b und g ist die Verwirrung erst recht gross
geworden, da diese nicht nur als Verschlusslaute, sondern
auch als tönende oder tonlose Spiranten gesprochen werden,
z. B. in mitteldeutschem (und norddeutschem) lebe, Tage, Tag
94u. s. w. (im Auslaut aber wie in Leib hören wir sogar oft aspirirtes p,
ebenso ein k für auslautendes g, z. B. imschlesischen
und obersächsischen Dialekt).
Gegenüber diesem Wirrsal von Aussprachsweisen musste
eine strengere Lautwissenschaft auf eine bestimmtere Definition
der alten Ausdrücke Tenuis und Media dringen, wenn
dieselben überhaupt aufrecht erhalten werden sollten, und es
schien aus praktischen Gründen unthunlich. ja unmöglich,
dieselben gänzlich zu verdrängen. Nun ist es vollkommen
klar, dass die alten Grammatiker unter ihren Tenues einen
unaspirirten tonlosen Verschlusslaut, unter ihren Medien
einen unaspirirten tönenden Verschlusslaut (mit
Bildung des sog. Blählautes, § 17, 4) verstanden. Es ist aber
eben so klar, dass es noch andere Unterscheidungen von unaspirirten
Verschlusslauten gibt. als diese beiden. In manchen
Sprachen gibt es nämlich neben den tonlosen starken
Verschlusslauten, die durch p, t, k ausgedrückt werden, auch
tonlose schwache Verschlusslaute ; so werden z. B. im
schweizerischen Deutsch die b. d, g gesprochen (s. besonders
Winteler 18 ff.), auch sonst sind im Deutschen diese Laute
nicht selten, ebenso kennt sie das Dänische, auch das Englische
hie und da (regelrecht z. B. im Dialekt von Westmoreland).
Im Armenischen wechselt diese tonlose Aussprache
der b, d, g mit der tönenden Aussprache promiscue ab, ohne
dass deshalb der Unterschied von den unaspirirten p, t, k oder
den aspirirten ph, th, kh verwischt wird, und so erscheinen
auch überhaupt in den Sprachen, welche sonst ihre b d g
tönend aussprechen, in der Nachbarschaft tonloser Laute öfter
auch diese tonlosen schwachen Laute.
Mit Rücksicht auf das was oben S. 55 ff, über die Intensitätsverhältnisse
der Consonanten entwickelt worden ist, wäre somit
die Tenuis der griechisch-römischen Grammatiker als
tonlose Fortis, der eben besprochene tonlose Laut als
tonlose Lenis, die tönende Media als tönende Lenis
zu bezeichnen. Soll aber einmal einer der beiden Ausdrücke
Tenuis und Media auf jene tonlosen Lenes angewendet werden,
so kann es nur der letztere sein, denn es ist zweifellos,
dass in allen Sprachen wo tonlose und tönende b, d, g neben
einander bestehen, die ersteren als nächste Verwandte der
tönenden Mediae, nicht als Abarten der unaspirirten Tenues
empfunden werden. Wir erweitern also den alten Begriff des
Wortes ‘Media’ zu dem einesGesammtnamens für alle schwachen
95Verschlusslaute, einerlei ob sie tönend oder tonlos sind,
oder mit andern Worten, wir statuiren die Existenz einer
tonlosen Media in demselben Sinne wie wir die Existenz
tonloser Liquiden oder Nasale angenommen haben, trotz der
ursprünglichen Definitionen der Liquiden und Nasale als reiner
Sonorlaute.
Anm. Es ist in dem Streit um die Tenuis-Media-Frage viel unnützer
Eifer verschwendet worden. Es ist an sich höchst gleichgültig ob
man von tonloser Fortis und Lenis oder in umgekehrter Reihenfolge von
starkem und schwachem ‘tonlosem Laute’ spricht. Für die Erweiterung
des einen der beiden Begriffe Tenuis und Media kann lediglich der oben
erwähnte praktische Gesichtspunkt massgebend sein, so lange nicht etwa
andere durchschlagendere Gründe in der Articulation oder sonst dagegen
aufgefunden werden können. —Brücke hielt die tonlosen Medien fälschlich
für geflüsterte Laute, was ihm andere gedankenlos nachgeschrieben
haben. Von der Unrichtigkeit dieser Ansicht kann man sich in jedem
Augenblick durch Auscultation des Kehlkopfes (S. 9, Anm. 1) und durch
die Thatsache überzeugen, dass auch beim Flüstern die tonlose Media
von der wirklich geflüsterten Media leicht unterschieden werden kann. —
Genaueres über die tonlosen Medien hat erst Winteler gelehrt, nach ihm
haben besonders Hoffory (in Scherer's Geschichte der deutschen Sprache
2 602 ff. Und Kuhn's Zeitschr.XXV, 419 ff.) und Storm, Engl. Phil. 40 f. zur
Klärung der Sachlage beigetragen. — Ueber die Articulation und historische
Entstehung der tonlosen Medien s. weiteres in § 17, 4 und 24, 3.
Neben den Tenues und Mediae erscheinen in vielen Sprachen
auch noch Aspiratae, die sich durch einen der Explosion
nachfolgenden Hauch unterscheiden. Ueber diese,
wie über die sog. Affricatae, d. h. Verbindungen von Verschlusslaut
mit homorganer Spirans, sowie über die Unterarten
der Tenues (Tenues mit und ohne Kehlkopfverschluss u. ä.)
und sonstige ähnliche Fragen, wird erst in der Combinationslehre
gehandelt werden (§ 17 und 21).
B. Einzelbemerkungen.
1. Labiale. Die Verschlusslaute dieser Reihe sind im
Allgemeinen nur bilabial. Nur in der Verbindung mit den
theilweise homorganen labiodentalen Spiranten (f, v, also pf,
bv, vgl. unten § 22) erfährt auch die Unterlippe in der Regel
die Pressung gegen die Oberzähne, welche diesen Spiranten
eigenthümlich ist. Der Klang der Verschlusslaute wird
dadurch wenig oder gar nicht verändert, die ganze Erscheinung
ist offenbar erst secundär und ohne besondere Wichtigkeit
für die Lautgeschichte.
2. Die Laute der Zungenspitze. Cerebrale t,
d nebst den Aspiraten th, dh sind aus dem Sanskrit und den
96neuindischen Sprachen zuerst bekannt geworden, wo sie
häufig vorkommen. In Europa kennt sie das Schwedische,
wo rt. rd als t, d ausgesprochen werden, auch das sicil. d in
cavaddu für cavallo ist nach Storm S. 25 cerebral. aber ohne
Beimischung eines r-Lautes, während ihm das ind. dzunächst
gleich dem schwed. rd klingt, aber kaum von dem ‘dicken’
l (s. S. 92. Anm. 3) zu unterscheiden ist. Die englischen t, d,
welche von den Indern bekanntlich als cerebrale aufgefasst
werden im Gegensatz zu deren rein interdentalen F T, sind
in Wirklichkeit alveolar. Alveolare t, d herrschen auch in
Deutschland, namentlich im Norden vor, sie sind überhaupt
vielleicht die üblichste Art der sog. Dentalen. Es gibt mancherlei
Abstufungen derselben. je nachdem die bis zu den
Alveolen heraufgezogene Zungenspitze reiner coronale oder
mehr dorsale Articulationsform hat (mir scheinen die norddeutschen
Alveolar -t. -d etwas mehr dorsal gebildet als die
englischen, vielleicht auch etwas weiter nach vorn). Dorsalalveolar
in dem S. 52 f. bestimmten Sinne (Brücke's Dorsale)
sind vielfach die t, d in Mittel-, auch wohl in Süddeutschland,
mouillirt erscheinen sie im russ. mb, db. Postdentale t, d
habe ich im Spanischen beobachtet, gelegentlich auch in
Deutschland. Findet der Verschluss am untern Rande der
Oberzähne statt, so sind die Postdentalen schwer von den
Interdentalen zu unterscheiden. In der letzteren Weise
werden nach dem Zeugniss von Storm S. 42 noch heutzutage
die indischen Dentale gesprochen. Selbst beobachtet habe
ich sie in grösserem Umfange im Serbischen und Armenischen,
wo sie die regelrechten Vertreter der Dentalclasse zu sein
scheinen. Auch im Englischen erscheinen dialektisch interdentale
t und d für hartes und weiches th (z. B. in der Aussprache
der Irländer, tonloses d für weiches th habe ich im
Dialekt von Westmoreland gefunden, wie in brudr. mudr für
brother, mother ; das r ist gerollt, dieMediae und das Schluss-r
sind tonlos). In Deutschland findet man die interdentalen t,
d ebenfalls öfter (individuell ?), namentlich bei Juden. In
den älteren indogermanischen Sprachen scheint diese Lautreihe
weiter verbreitet gewesen zu sein als in den modernen,
wenn man aus dem häufigen Uebergang ‘dentaler’ Verschlusslaute
in interdentale Spiranten (t, f zu 0 ; d. dc zu d) einen
Schluss ziehen darf.
3. Palatale. Das Verbreitungsgebiet der echten Palatale
c, } ist ziemlich beträchtlichen Umfangs (sehr reichliche
97Belege aus den germanischen Sprachen bringt z. B.
H. Möller, Die Palatalreihe der indogerm. Grundsprache im
Germanischen, Leipzig 1875 ; : nur pflegen wir die Existenz
dieser für die Lautgeschichte so wichtigen Classe von Lauten
gewöhnlich deswegen zu übersehn, weil ihre deutschen Vertreter
mit den entsprechenden gutturalen Verschlusslauten
unter denselben Zeichen (k, g) combinirt werden. Wegen
ihrer Articulationsverwandtschaft mit den palatalen Vocalen
erscheinen sie besonders häufig vor diesen (besonders i, e,
vgl. auch § 23, 1), aber auch vor andern Vocalen fehlen sie
nicht (vgl. z. B. lit. kiaúlė, kiaúszis. d. h. caule1, causis).
4. Die zwei Gutturalreihen (S. 53 f.) sind in den semitischen
Sprachen noch zum Theil unterschieden, z. B. im hebr.
kaf und qof ; ein k2 ist auch das georgische q ; k2 x2 hört man
oft von Schweizern, auch wohl k2 allein, wenn dieselben
Schriftdeutsch sprechen ; sonst habe ich k2 im Deutschen nur
gelegentlich als individuelle Eigentümlichkeit einzelner
Sprecher beobachtet. Die deutschen k vor a. o. u sind k1.
vor den palatalen Vocalen wird die Articulation meist weiter
nach vorn verschoben, jedoch bestehen dabei starke dialektische
Unterschiede, ohne dass die Verschiedenheit der Articulation
zum deutlichen Bewusstsein käme. Dagegen waren
in der indogermanischen Grundsprache die beiden Gutturalreihen
k2, k1 : g2. g1 streng geschieden.
5. Laterale Verschlusslaute sind in den indogermanischen
Sprachen regelmässig die sog. Dentale und Palatale vor
l. Ihr Klang richtet sich natürlich nach der sonstigen Stellung
des Zungenkörpers, worüber die Combinationslehre
näheres bringen wird (§ 22). Blosse laterale Explosivlaute
ohne nachfolgendes l kenne ich nur aus der Sprache der Tlinkiten
nach Mittheilungen des Herrn A. Pinart.
6. Ueber die velaren Verschlusslaute s. S. 54 f. und § 22.
2, über den faucalen Verschlusslaut oder Spiritus lenis s.
§ 17, 2.
§ 15. Die Spiranten.
1. Labiale und Labiodentale
1. Labiale und Labiodentale. Den bilabialen Verschlusslauten
(s. oben) entsprechen grossentheils labiodentale
Spiranten, so dem p das f, dem tönenden b das v, wie es in
Norddeutschland, ferner in den romanischen Sprachen und
im Englischen ausgesprochen wird. Bilabiales f ist mir nur
98bei vereinzelten Individuen vorgekommen, während bilabiales
w (oft, wie auch v, reducirt gesprochen, s. § 24, 2) in einem
grossen Theile von Mittel- und Süddeutschland herrscht.
Auch das span. b ist ein bilabialer Spirant, aber zum Theil
mit weiterer Oeffnung als mitteldeutsches w (vgl. dazu Storni,
S. 86. 434).
Da die meisten f und v aus (bilabialen) Verschlusslauten
hervorgegangen sind, so müssen wohl bilabiale f und w als
deren Vorstufen in grösserem Umfange angesetzt werden. Der
Grund für die fast vollständige Aufgabe des bilabialen f mag
in dessen geringer Lautstärke liegen, die es zu leicht unvernehmlich
werden liess. Beim labiodentalen f und v rührt die
grössere Schärfe des Lautes von dem Anblasen der Oberlippe
vermittelst des zwischen Unterlippe und Oberzähnen hervorgetriebenen
Luftstroms her (man erkennt das leicht, wenn man
während der Bildung eines f, v die Oberlippe mit dem Finger
in die Höhe hebt). Beim w, dessen Stimmton den Laut vor
der Unvernehmlichkeit etwas schützt, war eine derartige Verschärfung
des Blasegeräusches nicht so nothwendig.
Die beiden tönenden Spiranten dieser Reihe, v und w,
sind streng von dem Halbvocal u getrennt zu halten, über den
unten § 19, 1, b zu vergleichen ist. Auch das tonlose u in
engl. wh ist nicht mit dem bilabialen f zu identificiren. Die
Scheidung documentirt sich schon äusserlich in der Articulation,
indem bei den Spiranten v, w die Lippenränder mehr
oder weniger gradlinig und parallel einander genähert sind,
während der Halbvocal zi die Rundung und grössere Mundöffnung
des Vocals u theilt, ausserdem aber auch wie dieser eine
Zungenarticulation in Anspruch nimmt.
Anm. 1. Eine eigenthümliche Abart des f findet man bei einzelnen
Individuen (namentlich Juden) als Vertreter für s. Die Unterlippe ist dabei
weit hinaufgezogen, sodass die Schneide der Oberzähne etwa in der
Mitte der inneren Lippenfläche oder noch tiefer aufsetzt. Die Oberlippe
ist ebenfalls dem entsprechend gehoben, und beide Lippen sind nach Aussen
vorgestülpt, sodass sie vor den Zähnen einen kesselförmigen Raum bilden
(vgl. S. 103). Ich bin nicht sicher ob dabei aueh die Zunge eine selbständige
Articulation vornimmt (nämlich die Bildung eines ähnlichen
Kessels hinter den Zähnen), möchte es aber fast glauben.
2. Die Zischlaute
2. Die Zischlaute. Hiermit betreten wir das für die
Beschreibung schwierigste und auch in seiner historischen
Entwickelung noch am wenigsten aufgeklärte Gebiet unseres
Lautsystemes. Dasselbe umfasst eine Reihe von Spiranten,
deren Anfang das interdentale 6, deren Ende das palatale s
99bildet und in deren Mitte die verschiedenen s- und s-Laute
liegen. Wir stellen voran
a. Zischlaute coronaler Bildung. Hier begegnen
zunächst die interdentale oder postdentale tonlose
Spirans 6 nebst dem entsprechenden tönenden d. Die erstere
Species wird durch Vorschieben des flach ausgebreiteten Zungensaumes
zwischen die ein wenig von einander entfernten
Zahnreihen gebildet. Derselbe braucht nicht über die Kante
der Oberzähne hervorzuragen, die Hauptsache ist dass die
Enge zwischen dem Zungensaum und der Kante der Oberzähne
gebildet wird (Michaelis marginales s). Dieser
Art sind neugriech. # und ö und oft englisches ‘hartes’ und
‘weiches’ th nach dem Zeugniss von Storm S. 41 f., dem ich
nur beistimmen kann. Sweet findet dagegen das engl. th gewöhnlich
postdental gebildet. Er unterscheidet nur zwei
Hauptarten. Bei der einen wird der Zungensaum gegen die
Hinterseite der Oberzähne gepresst und die Luft entweicht
durch die Zwischenräume der Zähne (interstitielles 6. ö) :
die Berührung zwischen Zungensaum und Zähnen wird aber
oft gelockert und unter Umständen der Zwischenraum so erweitert,
dass das Reibungsgeräusch ganz verloren geht. Die
zweite Art ist ein ‘inneres th’ bei welchem keine direkte Berührung
der Zähne stattfindet. sondern die Zunge bloss den
Alveolen unmittelbar hinter der obern Grenze der Zähne genähert
ist. Natürlich sind aber wieder noch mehrere Unterabstufungen
möglich. Ein mittleres postdentales d mit sehr
weiter Öffnung ist z. B. das span. d wenigstens in der chilenischen
Aussprache ; tonlos erscheint dasselbe für s + d, z. B.
in ladodientes für las dos dientes (über das span. d s. Storm
S. 86. 426).
Man kann das 6 auch ‘divided’ und einseitig bilden ;
die Engen liegen dann entweder beidseitig oder einseitig an
den Eckzähnen. Dieser Laut scheint als Vertreter des s in
Deutschland nicht ganz selten zu sein : ich glaube ihn öfter
von Berlinern sowie im Judendeutsch gehört zu haben, bin
aber nicht sicher ob er nicht vielmehr mit dem Zungenblatt
gebildet wird. Vom engl. th unterscheidet er sich durch stärkeres
Zischen, vielleicht weil die Lippen mit angeblasen werden
oder doch die Luft sich in dem kleinen Hohlraum zwischen
Zähnen und Lippen fängt.
Anm. 2. Bei dem interstitiellen 0 — welches natürlich nur von Personen
mit auseinanderstehenden Oberzähnen gebildet -werden kann —
100findet auch oft ein Anblasen der Oberlippe statt. Ich habe früher geglaubt,
dass dieses Anblasen dem 0 überhaupt erst seine eigentliche Hörbarkeit
verleihe (wie beim f, v), habe mich aber überzeugt, dass dasselbe
nur etwas secundäres ist.
Anm. 3. Der Articulation nach stehen diese Spiranten den labiodentalen f,
v nahe, daher auch der häufige Uebertritt derselben in die letztere
Classe. Es bedarf dazu nur eines geringen Hebens und Einwärtsbiegens
der Unterlippe, um diese mit den Oberzähnen in Berührung zu bringen,
d. h. sie an der Bildung der Enge für das Blasegeräusch teilnehmen zu
lassen. Durch Rückkehr der beim 0, 8 articulirenden Zunge zur Indifferenzlage
ist dann der vollständige Uebergang zu f, v vollzogen.
Geht man mit dem Zungensaum noch mehr in die Höhe,
sodass die Enge an den Alveolen gebildet wird, so entsteht
das tonlose Alveolar-r des Englischen nebst seinen halbsonoren
und sonoren Nebenformen, bei noch stärkerer Hebung
und Zurückbiegung der Zunge das tonlose Cerebral-r,
die man herkömmlicher Weise nicht zu den Zischlauten
zu rechnen pflegt. Einen tonlosen alveolaren Zischlaut
dieser Art, über dessen Analyse ich aber nicht völlig sicher
bin, glaube ich in der irischen Aussprache von t nach Vocalen,
namentlich nach i gehört zu haben, z. B. in meat, eating :
die Enge muss aber ziemlich weit sein, da das Zischen nicht
sehr stark ist (das Volk substituirt gewöhnlich postdentales
oder interdentales 6 dafür, den entsprechenden alveolar-coronalen
Laut kabe ich nur bei Gebildeten gefunden, welche
noch die Irish brogue sprechen, aber doch bestrebt sind das
gewöhnliche alveolare t zu bilden).
b. Die Zischlaute s und š nebst den entsprechenden
tönenden z und ž. Hier gilt es vor allen Dingen den aus der
Sanskritgrammatik bei vielen Sprachforschern eingewurzelten
Irrthum zu beseitigen, als sei ‘cerebrales s’ ohne Weiteres
identisch mit š, oder ‘palatales s’ mit skr. g, d. h. als verhielten
sich die drei Laute š, g, s so zu einander wie die skr.
Verschlusslaute t, c, t. Vielmehr existiren vollkommen ausgebildete
Parallelreihen von s- und š-Lauten, d. h. es gibt
sowohl cerebrale, palatale als dentale s und š.
Was nun zunächst die eigentlichen s-Laute anlangt, so
ist nach den Untersuchungen von Bell und Sweet für sie
charakteristisch, dass die Engen mit dem Zungenblatt gebildet
werden (S. 50). Nicht minder wichtig ist aber wie es
scheint, dass bei ihrer Bildung die Zunge in ihrer Mittellinie
zu einer schmalen mehr oder weniger tiefen Rinne eingekerbt
wird, durch welche der Luftstrom gegen die obere
101Zahnreihe oder die Alveolen geblasen wird. Dies unterscheidet
die eigentlichen s-Laute wesentlich von den rein
coronalen Zischlauten. Die Enge selbst kann vom untern
Rande der Oberzähne an aufwärts bis zu der Articulationsstelle
der cerebralen gebildet werden. Engenbildung an der
Kante der Zähne bringt ein lispelndes s hervor, das man als
individuelle Eigentümlichkeit bei einzelnen Personen findet.
Beim franz. s, z ruht die Zungenspitze ebenfalls noch hinter
den Unterzähnen, die Enge liegt zwischen dem Zungenblatt
und der Hinterwand der Oberzähne, an welche die
Zunge stark angepresst wird. Aehnlich sind wohl die meisten
mitteldeutschen s gebildet, doch liegt da die Enge bereits am
untern Rande der Alveolen. In Norddeutschland dagegen,
namentlich in den Mundarten, welche das st, sp am zähesten
festhalten, findet man alveolare s, bei welchen auch die
Zungenspitze bis über den untern Rand der Oberzähne hinauf
gehoben ist. Diesem scheint das gewöhnliche englische s
nahezukommen, doch hat dies nach Sweet weitere Öffnung
als der deutsche und französische Laut ; ausserdem scheint
mir beim norddeutschen s die ganze Vorderzunge mehr convex
gewölbt zu sein, während das englische s eine Art Übergang
zur coronalen Articulation darstellen mag. Das palatale
š, das z. B. im Russischen vor palatalen Vocalen (e, i u. s. w.)
vorkommt, unterscheidet sich durch noch weiter rückwärts
liegende Enge und stärkere Wölbung des gesammten Vorderkörpers
der Zunge. Ein wirkliches cerebrales s findet Storm
S. 42 im Ostnorwegischen und Schwedischen in der Verbindung
rs, z. B. börse Büchse, und im baskischen sosa ‘un sou’
(im Dialekt von Bayonne).
Über die eigentliche Articulation der š-Laute gehen die
Ansichten der Forscher noch weit auseinander, weil diese
Laute ausserordentlich viele und stark von einander abweichende
Specialitäten entwickelt haben, die Articulation der
Zunge aber sich noch mehr als bei den s-Lauten der direkten
Beobachtung entzieht. Nur so viel steht fest, dass die Zungenarticulation
der š stets etwas weiter rückwärts liegt als die
der s (s. die sehr instructiven Abbildungen und Beschreibungen
beider Laute bei Grützner 219 ff.) ; wahrscheinlich ist
mir auch dass die Lippen an der Modifikation des specifischen
Geräusches mehr oder weniger betheiligt sind. Diese Mitwirkung
kann auf wesentlich zweifach verschiedene Weise herbeigeführt
werden, nämlich entweder so, dass die beim s vorhandene
102Rinne in der Zunge dergestalt verbreitert oder ganz
in Wegfall gebracht wird, dass auch bei neutraler Lage
die Lippen noch wenigstens in ihren seitlichen Partien von
dem Exspirationsstrom getroffen werden, oder so, dass bei
Beibehaltung jener Rinne die Lippen gerundet und oft
auch mehr oder weniger vorgestülpt werden, sodass sie
eine annähernd rechteckige Öffnung bilden. Auch unilaterale
š finden sich, indem der linke, seltener der rechte Zungenrand
sich gegen den Gaumen anstemmt und nun der Luftstrom
nach der entgegengesetzten Richtung in den Mundwinkel
hinein, gegen die in der Regel etwas seitlich abgehobenen
Lippen geführt wird (diese Art findet sich recht oft
in Norddeutschland, namentlich ist sie bei Berlinern ganz
gewöhnlich. aber auch von Engländern habe ich gelegentlich
diese unilateralen š gehört).
Das Wesentlichste ist vielleicht bei allen š-Articulationen
die Bildung eines grösseren kesselförmigen Raumes im Vordermunde,
in welchen der Exspirationsstrom hineingetrieben
wird. Wenigstens scheinen mir die š sich von den entsprechenden
Species der s stets durch eine dumpfere Kesselresonanz
zu unterscheiden daher auch z. B. die cerebralen s,
bei denen ein ähnlicher Kesselraum gebildet wird, einen š-ähnlicheren
Klang haben) : die Lippenarticulation hilft diese
Kesselbildung nur vervollständigen und modificiren. Ahnlich
sagt auch Storm S. 43 : ‘Wenn ich nur die Zungenspitze
hebe, so entsteht nur supradentales s : erst wenn ich zugleich
einen Theil des Zungenrückens ins Niveau bringe, entsteht š.
indem sich hinter dem Gaumendach ein gewölbter Raum bildet,
der einen tieferen Eigenton und ein mehr zusammengesetztes
Geräusch hervorbringt.’
Anm. 4. Brücke erklärt dagegen das ihm geläufige alveolare s für
einen ‘zusammengesetzten Consonanten’, weil seine Articulation nicht einfach
sei, sondern weil das š die Engenbildung eines alveolaren s mit der
des gutturalen x2 verbinde. Abgesehen davon dass die doppelte Engenbildung
durch Brücke keineswegs ausser Zweifel gestellt ist (vgl. Merkel,
Laletik 202 ff., Grützner 222) ist doch der Laut š durchaus einheitlich
und hat nicht mehr Anspruch auf den Namen ‘zusammengesetzt’, als z. B.
alle mouillirten oder gerundeten Laute, welche durch gleichzeitige Wirkung
verschiedener Articulationen des Ansatzrohres erzeugt werden. —
Sweet S. 39 beschreibt im Anschluss an Bell das š folgendermassen : ‘Das
s ist dem s sehr ähnlich, hat aber mehr von dem point-element (d. h. stärkere
Betheiligung des Zungensaumes) ; dies hat seinen Grund in der
Annäherung an tonloses r ; das š ist in der That ein s das auf dem Wege
zu tonlosem r angehalten ist. Dies geschieht indem man die Zunge aus
103der s-Lage ein wenig zurückzieht und mehr nach oben wendet, was den
Zungensaum mehr in Action bringt’. Ich halte auch diese Beschreibung
nebst den weiteren Angaben Sweet's noch nicht für hinlänglich sicher oder
geeignet eine deutliche Vorstellung von dem š-Mechanismus zu geben.
Varietäten des š ergeben sich namentlich noch durch die
verschiedenen Stellungen der Zungenspitze und die Wölbung
verschiedener Theile der Zungenfläche. Gewöhnlich sind die
š wohl supradental, d. h. auch die Zungenspitze ist bis zu den
Alveolen gehoben, doch kommen auch š mit gesenkter Zungenspitze
vor, z. B. in Mittel- und Süddeutschland und wie
mir scheint auch wohl in den palatalen oder mouillirten š'-Lauten
der slawischen Sprachen. Beim russ. Wh. poln. š
(auch in russ. m. poln. b) und den damit von Storm S. 43
gleichgesetzten norw. sk, sj in skilling, sjœl ist der mittlere
Zungenrücken gehoben. Durch Hebung des hintern Zungenrückens
entsteht nach Sweet und Storm das schwedische š in
skilling, sjül. das besonders im Südschwedischen durch labiale
Modification und Senkung der Vorderzunge verstärkt werden
kann und das wie ein Zwischenlaut zwischen deutschem sch
und ch in ach klingt (Storm S. 43 ;. Auch die franz. ch. j sind
wohl mit gesenkter Zungenspitze gebildet, die norddeutschen
und englischen š aber mit gehobener Zungenspitze, dazu ist.
wie Sweet bemerkt, das engl. sh ‘weiter’ als das deutsche sch
und dadurch liegt zugleich seine Enge etwas weiter rückwärts.
Eigentlich cerebrales s scheint z. B. das Sanskrit besessen
zu haben, gehört habe ich den Laut nicht.
Anm. 5. Die palatalen š' nähern sich oft im Klange den palatalen
ch-Lauten (ich-Laut), mit denen sie oft wechseln (wie denn z. B. dem
russ. m mit palatalem ich-Laut oder tonlosem spirantischem i im pblnic
mit palatalem š entspricht).
3. Die palatalen und gutturalen x-Laute
3. Die palatalen und gutturalen x-Laute. Neben
dem palatalen Zischlaut š, ž steht der palatale Spirant %, den
wir im Deutschen mit dem Namen des ich-Lautes zu bezeichnen
pflegen, nebst seinem tönenden Correspondenten,
der Spirans j, wie sie in Nord- und Mitteldeutschland grossentheils
gesprochen wird (wohl zu unterscheiden von dem Halbvocal
i, der in Süddeutschland z. B. häufig vorkommt, s. § 19,
1). Der physiologische Spielraum dieses x ist natürlich verhältnissmässig
sehr bedeutend (vgl. S. 53) ; unser deutsches
ch nach oder vor i und unser j würden zu der vorderen palatalen
Species [y}\ gehören, während z. B. das holländische g
nach e, i der hinteren Palatalreihe (i/²) zufällt.104
An die palatalen schliessen sich der Articulation nach die
gutturalen x an. Das vordere gutturale x1 ist das gewöhnliche
deutsche ch nach a, o, u (der ach-Laut), das hintere gutturale
x2 das tiefe ch der Schweizer und mancher süddeutscher
Mundarten, das xe der Armenier. Auch russ. x, poln. ch gehören
wohl grossentheils zu den hinteren Gutturalen, sie
unterscheiden sich aber von den deutschen Formen durch eine
auffallende Schwäche des Reibungsgeräusches iso dass anlautendes
russisches x oft geradezu wie ein recht energisches
h klingt). Storm S. 44 bemerkt, dass es ihm zwischen deutschem
ch und h zu liegen scheine, und dass es ein ach-Laut
mit loser Annäherung der Organe sei (also ein ‘weites ch’ nach
der Terminologie Sweets, doch vgl. auch § 24, 1).
Dem x1 entspricht als tönender Correspondent das 51 =
neugriech. /. Es ist der Laut, den man in Norddeutschland
für inlautendes g nach a, o, u z. B. in Tage, Bogen, hört (im
Auslaut spricht man ganz diesem 51 entsprechend tonlos x1,
tqx1, box1) : auch als Vertreter des uvularen r kommt das 51
vor, obwohl diesem genauer das hintere £² = armen, yat)
entspricht.
Die x undx-Laute unterscheiden sich von den Zischlauten
durch eine durchaus dorsale Articulation. Es fehlt
ihnen das scharfe Zischen das die s-Laute durch den Anfall
der Luft an die Zähne erhalten, und die Kesselresonanz der
š-Laute. Ihre Reibungsgeräusche sind daher milder als die
der Zischlaute und sie erfahren daher häufiger als jene eine
Reduction (vgl. § 24, 1).
Hiernach erhält das System der Geräuschlaute mit Anschluss
der Nasale und Liquidae etwa folgende Gestalt, (, bedeutet
dabei tonlose Nebenformen gewöhnlich tönend erscheinender
Laute, s. § 24, 3) :105
Consonantentabelle
tableau Dauerlaute | Momentane Laute | Sonorlaute | Geräuschlaute | Explosiv-laute | tonlos | tönend | Spiranten | Nasale l-Laute | r-Laute | Lippenlaute | Labiale | Labiodentale | Zungengaumenlaute | Coronale | Dorsale | Laterale | Cerebrale | Interdentale | Postdentale | Supradentale | Coronal-alveolare | Dorsal-alveolare | Palatale | Gutturale | Cerebral-palatal (guttural ?) | Velarlaute | Faucallaute106
III. Abschnitt.
Combinationslehre.
§ 16. Allgemeineres.
Wir haben bisher die Sprachlaute gewissermassen nur in
abstracto behandelt. d. h. die Bedingungen erörtert, unter
denen ein Laut von einem gewissen Klang, von einer bestimmten
Intensität zu Stande kommt, oder mit andern Worten,
wir haben uns nur mit der Untersuchung der Eigenschaften
beschäftigt, welche einem isolirt dastehenden Laute
in der mittleren Zeit seines Bestehens zukommen, nachdem
alle die einzelnen Articulationsbewegungen ausgeführt
sind, welche die Hervorbringung jenes Lautes verlangt. Hiernach
bleibt noch zu erörtern, wie sich diese Einzellaute zu
den complicirteren Gebilden der empirischen Sprache, d. h.
Silben, Takten (S.5), Sätzen vereinigen. Die erste Frage die
uns hier beschäftigen muss ist die, wie ein nach vorwärts oder
rückwärts isolirter Laut seinen Anfang resp. sein Ende
findet, d. h. in welcher Folge und Weise die einzelnen Articulationsbewegungen,
die zu seiner Hervorbringung nothwendig
sind, vorgenommen resp. beendigt werden. Diese
Fragen finden ihre Erledigung in der Lehre von den Laut-einsätzen
und -absätzen.
Demnächst sind zu behandeln die Lautübergänge
oder Glides, d. h. diejenigen Laute, welche erzeugt werden,
wenn der Exspirationsstrom fortdauert, während irgend ein
Theil der Sprachorgane aus der festen Stellung für einen Laut
in die feste Stellung für einen andern Laut übergeführt wird.
Spricht man z. B. die Silbe al aus, so tönt die Stimme fort,
während man die Zunge aus der a-Lage in die l-Lage bringt.
Während dieses Uebergangs kann natürlich weder der reine
a-Laut, noch der reine l-Laut existiren, sondern zwischen
dem anfangs intonirten reinen a und dem den Schluss bildenden
107l schiebt sich eine continuirliche Reihe von Uebergangslauten
ein, die wir als den Uebergang oder auch
als Gleitlaut (nach engl. glide) bezeichnen. Da aber die
Dauer dieses Uebergangs gegenüber der der Einhaltung der
a- und l-Stellung meist eine verschwindend geringe ist. so
kommen die Uebergangslaute in der Regel nicht zu gesonderter
Wahrnehmung. Ist dies dennoch der Fall (was namentlich
eintrifft, wenn die Anfangs- oder Endlaute eine bedeutende
Schwächung, Reduction, erleiden, § 24. 2). so wird
der Üebergangslaut entweder als Ausgang des vorangehenden,
oder als Eingang des folgenden Lautes betrachtet. Der
Uebergang von a zu l ist also sowohl der Ausgang des a, als
der Eingang des l.
Anm. Auf die ‘Glides’ und ihre ungemeine Wichtigkeit hat zuerst
Ellis hingewiesen, vgl. dessen Early English Pronunc. I, 51. Unabhängig
von ihm hat dann Merkel Beobachtungen über ‘Ein- und Absätze
der Vocale angestellt (dieser Name rührt von ihm her, s. Schmidt's Jahrbb.
C, 86). Man unterscheide genau die Ausdrücke Einsatz und Eingang.
Absatz und Ausgang ; Einsatz und Absatz, bei den Engländern initial
und final glide, beziehen sich auf Laute die nach vorn oder hinten isolirt
sind ; Ein- und Ausgang, englisch on-glide und off-glide, aber bilden den
Uebergang zweier Nachbar laute.
Hieran haben sich sodann zu schliessen Erwägungen über
die Veränderungen, welche Laute selbst, nicht nur ihre Ein- oder
Ausgänge, beim Zusammentreffen mit andern erfahren
(Mouillirung, Labialisirung, laterale und velare Explosion
und dergleichen). Anhangsweise sind endlich in § 24 eine
Reihe von Erscheinungen zusammengefasst, die ich mit dem
Namen der Reductionen belege.
Von da aufsteigend wird demnächst die Bildung der Silben
zu erörtern sein. Es gilt dabei, die Bedingungen zu ermitteln,
unter denen überhaupt Sprachlaute zu einer Silbe
zusammentreten können. ferner Quantität, Intensität und
musikalisches Verhalten der einzelnen Glieder der Silbe etc.
zu bestimmen. In ähnlicher Weise wird dann über das Zusammentreten
von Silben zu Worten und Sätzen gehandelt
werden müssen (vgl. § 25).
§ 17. Die Lauteinsätze und -absätze.
1. Bei Vocalen.
Die drei Hauptarticulationsfactoren für Vocale sind die
Bildung des Exspirationsstromes, die Einstellung der Stimmbänder
108zum Tönen und die Einstellung des Ansatzrohres für
die specifische Resonanz. Von diesen muss die letztgenannte
Bewegung mindestens in dem Momente bereits vollendet sein,
wo die Stimme ertönt, und die so erreichte Einstellung des
Ansatzrohres muss mindestens bis zu dem Momente des Erlöschens
der Stimme angehalten werden, wenn ein einfacher
Vocal von bestimmter Klangfarbe entstehen soll. Sie kann
aber auch natürlich ohne Schaden für den Vocal bereits vor
dem Beginne der Exspiration eingeführt und über das Ende
derselben hinaus festgehalten werden, da sie ja allein für sich
keinen Laut erzeugt. Dagegen ergeben sich wichtige Differenzen
bezüglich des Anlauts und Auslauts der Vocale je nach
der verschiedenen Weise, in der sich Exspiration und
Kehlkopfarticulation combiniren.
Bezüglich des Vocalanlautes ist zunächst daran zu
erinnern, dass vor dem Beginne eines nach vorn zu isolirten
Vocales die Stimmritze zum Behuf des Athmens geöffnet ist,
dass also jedesmal eine eigene Einstellung der Stimmbänder
erfordert wird. Nach der Art wie diese bewirkt wird, unterscheiden
wir drei Hauptformen :
1. Der leise Vocaleinsatz (clear glottid Ellis, clear beginning
Sweet). Die Stimmbänder werden von vorn herein zum
Tönen eingesetzt : erst nachdem diese Stellung erreicht ist,
setzt die Exspiration ein. Man sollte diesen Einsatz für den
naturgemässesten halten, in Wirklichkeit aber ist er bei isolirten
Vocalen beim gewöhnlichen Sprechen (weniger beim
Singen) in Deutschland nicht gewöhnlich ; desto häufiger findet
er sich nach Consonanten (also auch so gut wie immer bei
wortanlautenden Vocalen im Innern des Satzes). Im Englischen
ist er nach der Aussage der englischen Phonetiker die
üblichste Form des unaspirirten Vocaleinsatzes. Er ist nicht
ganz leicht rein auszuführen, da es unter Umständen Schwierigkeit
macht, namentlich bei rascher und lebhafterer Sprechweise
die Stimmbänderarticulation mit der gerade bei ihrem
Beginne bezüglich der Energie schwerer controlirbaren Exspiration
in den richtigen Einklang zu setzen (vgl. auch oben
S. 59 f.) ; dies ist um so schwieriger, als es einerseits eine in
vielen Sprachen wiederkehrende Neigung ist, den Vocal mit
einem stärkeren Exspirationsstoss anzuheben, andererseits bei
schwacher Exspiration die Stimmbänder leicht für einen Moment
gar nicht ansprechen.
2. Der feste Vocaleinsatz (check glottid Ellis, glottal catch
109Sweet). Die Stimmritze ist in allen ihren Theilen fest geschlossen,
so dass die Stimme erst dann ertönen kann, wenn
dieser Verschluss durch einen besondern Impuls durchbrochen
ist. Hier geht dem eigentlichen Vocallaut ein eigenthümliches
Knacken voraus. das man namentlich beim Flüstern
leicht beobachten kann. Schon Rapp I, 54 machte darauf
aufmerksam, dass man dasselbe als Explosivlaut des
Kehlkopfs betrachten könne (oder wie er sich ausdrückt
als Kehlkopfschlaglaut), worin sich ihm andere angeschlossen
haben. Dieser Einsatz oder Explosivlaut entspricht zweifelsohne
dem aleph der semitischen Sprachen (arab. hamze).
wahrscheinlich auch dem spiritus lenis der Griechen, mit
dessen Zeichen ’ wir ihn im Folgenden ausdrücken werden.
3. Die gehauchten Einsätze : Die Exspiration beginnt
schon bei noch geöffneter Stimmritze, die Stimmbänder werden
erst nachdem der erste Exspirationsstoss vorüber ist. zum
Tönen eingesetzt. Da die Zeit, welche zwischen dem Beginn
der Exspiration und dem Einsetzen der Stimme liegt, sowie
die Energie und die specielle Form der Exspiration während
dieser Zeit, endlich auch die Art der Annäherung der Stimmbänder
selbstverständlich variabel sind, so ergeben sich eine
Reihe von Verschiedenheiten, deren Haupttypen hier noch
hervorgehoben werden sollen. Purkinje unterschied bereits
neben dem gewöhnlichen h einen ‘leisen Hauch’, welchen
er dem griech. Spiritus lenis gleichsetzt ; derselbe ist nach
ihm der Laut ‘der jedem Vocal vorhergeht, der mit anfangs
offener Stimmritze gesprochen wird’ (Brücke 11). Hiernach
ist dieser Laut wohl zu identificiren mit dem was die englischen
Phonetiker gradual glottid nennen und als die gewöhnlichste
Art desVocaleinsatzes bezeichnen (EllisIV, 1129,
Sweet 63). Die Stimmritze durchläuft dabei die Stellungen
für tonlosen Hauch und Flüsterstimme, ehe der Stimmton
beginnt, der eigentliche kräftige Impuls der Exspiration aber
beginnt erst in dem Momente, wo die Stimme selbst anhebt.
Im Deutschen scheint dieser Einsatz kaum vorzukommen,
man hört ihn wohl gelegentlich in Interjectionen, wie dem
bedauernden oh oder dem erstaunten ah u. dgl., aber man
verfällt leicht in denselben, wenn man versucht einen Vocal
kräftig, aber ohne den festen Einsatz, zu singen (vgl. die Bemerkung
von Sweet a. a.O., und die Ausführungen von Storm
52 f., in denen jedoch für ‘leiser Einsatz’, ‘leise gehauchter
Einsatz’ zu setzen ist). — Beginnt der Exspirationsstoss aber
110bereits in voller Kraft vor dem Einsatz der Stimme, so entstehen
die kräftigeren Hauchlaute, die gewöhnlich mit h bezeichnet
werden, und die wir im Folgenden mit c andeuten
wollen (flatus glottid Ellis). Für das deutsche h ist nach den
Untersuchungen von Czermak (Wiener Sitz.-Ber. math.-naturw.
Cl. LII, 2, 623 fT.) und Brücke (Grundz. 9) wesentlich,
dass die Stimmritze auf einem bestimmten Verengungsgrade
eine Zeit lang festgehalten wird, wenn man das h auszuhalten
sucht : einer Verengungsstufe, die zwischen vollkommener
Oeffnung der Stimmritze und deren Verengerung zum Flüstern
die Mitte hält. immerhin aber zur Erzeugung eines leisen
Reibungsgeräusches Anlass geben kann. Das deutsche h
könnte demnach als eine tonlose Kehlkopfspirans angesehen
werden. Beim gewöhnlichen Sprechen aber scheint
dieser Stillstand nicht statt zu finden (vgl. Brücke a. a. O.).
Neben dem flatus glottid unterscheidet Ellis sodann zunächst
noch den jerk (etwa ‘gepuffter Einsatz’), bei welchem der
Hauch mit einem raschen Exspirationsstoss beginnt, dann
schwächer wird, ehe noch die Stimme einsetzt. Nach der Beschreibung
von Ellis IV, 1130 würde ich das englische h, welches
sich deutlich von dem deutschen h unterscheidet, so bezeichnen,
aber aus den Bemerkungen von Sweet, S. 65
scheint es, dass eher ein dem deutschen h ähnlicher Einsatz
gemeint ist. Eine weitere Form ist das heisere h des Arabischen,
das nach den Angaben bei Ellis IV, 1130 a auch von
Irländern oft gesprochen wird ; hier ist, wie Czermak gezeigt
hat, die Bänderglottis geschlossen, der Hauch entströmt nur
durch die geöffnet gehaltene Knorpelglottis.
Anm. 1. Der Theorie nach gäbe es noch mehrere derartige Einsätze ;
z. B. liesse sich ein tönend gehauchter Einsatz denken, bei
dem der Stimme der ‘tönende Reibelaut des Kehlkopfs’ (oben S, 23) voranginge.
Ob diese Form in Wirklichkeit auftritt und ob sie mit dem
Uebergang von den indischen Medialspiraten zu Vocalen (vgl. unten § 20,
2, a, a) im Zusammenhang steht, mag dahin gestellt bleiben. — Uebrigens
gehört auch das Kehlkopf-r hierher, über dasselbe ist aber bereits
oben S. 85 f. das Nötige beigebracht.
Dieselben Erscheinungen wiederholen sich am Ausgang
der Vocale, und wir haben demnach einen leisen, einen
festen und (tonlos) gehauchte Vocalabsätze zu unterscheiden.
Bei dem ersten hört entweder die Exspiration auf,
während die Stimmbänder noch ruhig in ihrer Lage verharren,
oder gleichzeitig mit der Oeffnung der Stimmritze (bei weniger
sorgfältiger Articulation entsteht aber leicht statt des leisen
111Absatzes der leise gehauchte Absatz, der auch im Deutschen
nicht selten ist). Im zweiten Falle dagegen, den wir wie oben
mit dem Spiritus lenis am Schlüsse des Vocals bezeichnen,
wird dem noch kräftig ertönenden Stimmton durch plötzlichen,
energischen Verschluss ein Ende gemacht, an den sich natürlich
wieder eine Explosion anschliesst. Wir gebrauchen diesen
Absatz z. B. wo wir zwei benachbarte, namentlich gleiche
Vocale scharf von einander trennen wollen, ferner in solchen
in ärgerlichem Affekt gesprochenen Wörtchen wie da3 !, no3 !
Den hauchenden Absatz, bei dem nach Öffnung der Stimmritze
die Exspiration noch eine Zeit lang fortdauert (der sanskritische
Visarga), wenden wir ebenfalls oft bei stark betonten
auslautenden kurzen Vocalen an, wie in ja`, da`. Die
Stärke des Hauches ist dabei in den einzelnen Fällen sehr
verschieden und bedarf stets der genaueren Specialisirung.
Nicht ganz selten ist auch die Verbindung zweier Ein- oder
Absätze ; so hört man oft statt des eben angeführten da3
auch da* mit sehr starkem Hauch ; geläufiger aber als im
Deutschen ist diese Verbindung z. B. im Dänischen, welches
auslautende Vocale mit gestossenem Ton (s. unten § 23, 3)
vielfach in dieser Weise ausgehen lässt (z. B. pä3t, nei* neben
pcf. nei* u. dgl.).
2. Liquidae und Nasale.
Auch bei diesen Lauten können die verschiedenen Ein- und
Absätze sämmtlich gebildet werden, doch überwiegt bei
ihnen fast überall der leise Einsatz ; dies ist leicht begreiflich,
da dieselben als Consonanten stets mit schwächerem
Exspirationsdruck als der Sonant (Vocal) ihrer Silbe gesprochen
werden, als Sonanten aber nur in Verbindung mit andern
Lauten auftreten, welche sich auch mit Vocalen durch den
leisen Einsatz zu verbinden pflegen. So findet sich denn z. B.
der gehauchte Ein- oder Absatz (abgesehn von den streng
genommen nicht hierher gehörenden Fällen der Composition
wie anheben, bei denen vielmehr an-1eben. nicht an`-eben abzutheilen
ist) meist nur als Überrest einer früher dem Consonanten
vorausgehenden oder folgenden Spirans, wie im Altgermanischen
kr, hl, hn oder im Armenischen rh (aus
ursprünglichem thr). Heutzutage werden die isländ. hr, hl,
hn als tonlose r, l, n gesprochen (Hoffory, Kuhns Zeitschr.
XXIII. 531 ff.), d. h. die Exspiration beginnt nach der Einstellung
der Mundorgane für r, l, n, aber vor dem Einsatz
112der Stimme. Der gehauchte Einsatz muss sich unter diesen
Umständen in das umsetzen, was man als ‘tonlose’ Liquidae
oder Nasale bezeichnet hat, ebenso wie das h vor Vocalen als
tonloser Vocal gefasst wurde (oben S. 81). Der leise gehauchte
Absatz ist im Wortauslaut in vielen Sprachen sehr
verbreitet, z. B. im Dänischen, aber auch im Deutschen
kommt er vor. Den festen Einsatz habe ich bei isolirt anlautenden
consonantischen Liquiden oder Nasalen nirgends
beobachtet, ausser öfter etwa bei dem ablehnenden. namentlich
im Affekt gesprochenen 'nein ; doch ist es nicht unwahrscheinlich,
dass die Vocalvorschläge mancher Sprachen vor
r, l, m, n durch Annahme einer früheren Aussprache Vr, 3l,
3m, 3n zu erklären sind. (Beispiele aus dem Griechischen z. B.
bei Curtius, Grundzüge4 714 f.). Über inlautende 3n, ’l
u. s. w. in Sprachen mit ‘gestossenem Ton’ vgl. § 29, 2.
Anm. 2. Am deutlichsten lassen sich die verschiedenen Ein- und
Absätze an den Interjectionen erkennen, die wir durch hm zu umschreiben
pflegen und welche offenbar nur durch die Wirkung von Trägheitsgesetzen
aus Wörtern wie so, ja, ach u. s. w. hervorgegangen sind, so nämlich, dass
das Ansatzrohr durchaus in der S. 16 f. beschriebenen Ruhelage verharrt
und nur die Articulationen des Kehlkopfs und die nöthigen Exspirationsbewegungen
ausgeführt werden. Jeder Vocal eines auf diese Weise corrumpirten
Wortes muss nothwendig je nach der Lagerung der Vorderzunge zu
m oder n werden, jeder begleitende Consonant mit merklichem Exspirationsstrom
zum gehauchten Einsatz, nur dass hier der Hauch durch die
Nase statt durch den Mund geführt (also zum ‘tonlosen Nasal') wird. Die
nahe Zusammengehörigkeit mit jenen Worten wird in jedem Falle noch
durch die Uebereinstimmung in der oft sehr charakteristischen Accentuirung
angedeutet. So entspricht das 'm ? mit langgezogenem, fragend
accentuirtem m deutlich einem ebenso betonten so ? , ein anderes, nur durch
den Accent unterschiedenes einem zustimmenden so oder auch ja, während
das kurz gestossene 'm oder 'm' aus dem zweifelnden, gewöhnlich mit
musikalisch hohem Ton gesprochenen ja oder ja' hervorgeht ; 'm' ist'ach
(mit kurzem m), gedehntes 'm oder m entspricht folgerichtig den Formen
'nein oder nein. Man kann auch wieder beide Einsätze in der Folge 'c
combiniren, indem man den Luftstrom des h mit einer Explosion beginnen
lässt ; so hört man oft J'm3 mit ganz kurz abgestossenem Stimmton als
Laut halb weinerlicher ärgerlicher Ungeduld bei Kindern, auch *m mit
circumflectirter oder einfach gedehnter Betonung (§ 29 f.), oder mit offenem
Munde xa für aha (mit Unterdrückung des ersten Vocales) u. dgl. mehr.
3. Spiranten.
Die tönenden Spiranten verhalten sich im Anlaut wie
die Liquiden und Nasale, nur dass, wie es scheint, hier ein
gehauchter Einsatz gar nicht vorkommt. Der feste Einsatz
scheint öfter da vorzukommen, wo auf die Spirans noch ein
113Consonant folgt, also in Verbindungen wie zla, žra u. dgl.,
doch stehn mir hierüber keine sichern Erfahrungen zur Verfügung.
Im Auslaut bekommen die tönenden Spiranten
(soweit sie eben nicht ganz tonlos werden) ebenfalls wohl nur
den leisen Absatz (d. h. die Exspiration muss mindestens
gleichzeitig mit dem Aussetzen der Stimmbänder aufhören)
oder den leise gehauchten, d. h. die Stimme erlischt ehe die
Exspiration gänzlich aufgehört hat. der Rest derselben bildet
dann noch ein tonloses Anhängsel zu dem tönenden Körper
der Spirans (so z. B. im engl. auslautenden v, z, d u. s. w.).
Auch ein stärkerer Hauch würde sich natürlich wieder in die
entsprechende tonlose Spirans umsetzen ; es würden also Verbindungen
von tönender mit tonloser Spirans entstehen, wie
man sie für die Gutturalreihe z. B. in manchen Gegenden
Norddeutschlands bei der Aussprache auslautender rg, rch
(Burg, durch, mit gutturaler tönender Spirans £ statt des r)
hören kann.
Bei den tonlosen Spiranten kehrt sich das oben bei Gelegenheit
der Vocale S. 108 f. besprochene Verhältniss zwischen
Kehlkopf- und Ansatzrohrarticulation natürlich um, insofern
die erstere ja für die Bildung der Spirans selbst gar nicht in
Betracht kommt. So entsteht hier der leise Einsatz überall
da, wo die Exspiration bei offenem Kehlkopf erst nach der
Einstellung des Ansatzrohres in die specifische Articulationsstellung
beginnt, der leise Absatz, wo sie während der Dauer
jener Einstellung erlischt. Die Herstellung eines gehauchten
Einsatzes würde absichtliche Verzögerung, die des gehauchten
Absatzes absichtlich beschleunigte Aufhebung der
Mundeinstellung verlangen, Grund genug dafür, dass dieselben
in der Regel nicht angewandt werden. Bei der Combination
mit folgendem Vocal, welche Fortdauer des Exspirationsstromes
und zugleich Aufgebung der specifischen Mundarticulation
fordert, kommt jedoch z. B. der Fall nicht gerade
selten vor, dass man ts’a, pf’a, kx’a statt des gewöhnlichen
tsa, pfa, kxa spricht (d. h. zwischen dem Erlöschen des specifischen
Reibungsgeräusches des s, f x und dem Eintritt der
Stimme liegt noch ein h resp. tonloser Vocal) ; ähnlich entsteht
ein s, s, f u. dgl. durch Composition in Fällen wie
das heisst, rasch hin, aufheben. Ebenso scheint der feste Absatz
nur bei der Combination mit Vocalen mit festem Einsatz
vorzukommen (in Verbindungen wie es ''ist, auf 3einem, doch
3er. mit prononcirtem festen Vocaleinsatz). Festen Einsatz im
114isolirten Anlaut kenne ich nur in dem aus 3es verkürzten 's
[*scat = es hat) und ähnlichen Fällen. Bei rascher Rede fallen
übrigens, namentlich in unaccentuirten Silben, auch diese
Unterschiede fast alle fort ; man spricht also die letzten Beispiele
wie dasaist, rašin, aufe(b)m, sat u. s. f.
4. Verschlusslaute.
Über den Einsatz anlautender Verschlusslaute ist kaum
etwas Wesentlicheres zu bemerken. Bei den tonlosen Verschlusslauten
besteht er einfach aus der völligen Absperrung
von Mund- und Nasenkanal, und zwar geschieht diese durchaus,
ehe der zur Lautbildung bestimmte Exspirationsstrom
beginnt. Bei den tönenden Verschlusslauten folgt hierauf
das Eintreiben des tönenden Exspirationsstroms in den Blindsack
den die Mundhöhle bildet ; es wird auf diese Weise ein
sog. Blählaut erzeugt, dessen Einsätze wieder alle die bei
den Vocalen auftretenden sein können, doch kommt gewöhnlich
nur der leise, seltener der feste Einsatz desselben vor.
Der Akt des Verschlusses ist selbst völlig geräuschlos ; es ist
also auch z. B. vollkommen gleichgültig, ob bei der Bildung
einer Silbe wie pa, ba die Lippen bereits vorher (wie gewöhnlich
beim Athmen durch die Nase) verschlossen sind
oder ob erst zum Behuf des Sprechens der Verschluss hergestellt
wird. Es liegt ausser allem Zweifel, dass das specifische
Geräusch des Verschlusslautes hier einzig und allein auf der
Explosion beruht, auf welche nun seinerseits der Absatz
unmittelbar folgt ; man bezeichnet hiernach die Verschlusslaute
oft einfach als Explosivlaute, indem man von der Verschlussbildung
ganz absieht.
Der Absatz der Verschlusslaute selbst ist nun ein wesentlich
verschiedener, je nach der Art in welcher die Explosion
herbeigeführt wird, und dies ist für uns die Veranlassung, die
Articulation der Verschlusslaute erst hier genauer zu betrachten,
wobei allerdings, da die Verschlusslaute am allerwenigsten
isolirbar sind, einiges aus der Berührungslehre gleich mit
herangezogen werden muss.
Bei allen Verschlusslauten wird nach der Bildung des
Verschlusses die Luft im Mundraum auf irgend welche Weise
comprimirt, damit bei der Sprengung des Verschlusses ein
deutliches Ausströmen der Luft aus dem Munde erfolgt.
1. Tenues. Bei den Tenues wird in der Regel diese
Compression so erzeugt, dass durch die weit geöffnete Stimmritze
115das nöthige Quantum Luft aus den Lungen in den Mundraum
getrieben wird. Während der Dauer des Verschlusses
ist also auch die noch in den Lungen befindliche Luft unter
dem Drucke der Exspirationsmuskulatur verdichtet. Wird
dieser Druck nun in dem Momente der Explosion oder doch
möglichst schnell hinterher aufgehoben, so erfolgt nur ein
kurzer, rasch abgebrochener Luftstoss ; so entsteht die gewöhnliche
reine Tenuis mit offenem Kehlkopf,
welche jetzt z. B. bei den Slaven und Romanen im Anlaut
und Inlaut allgemein üblich, aber auch in Deutschland nicht
selten ist. Ihre Bildungsweise lässt sich mit dem leisen Absatz
der Vocale vergleichen, und wir können sie daher auch
als Tenuis mit leisem Absatz bezeichnen. Erfolgt dagegen
die Aufhebung des Compressionsdruckes nicht unmittelbar
nach der Sprengung des Verschlusses, so schliesst sich an das
Explosionsgeräusch noch ein Hauch an, und es entsteht die
Tenuis mit gehauchtem Absatz oder die Tenuis aspirata,
deren Laut in Norddeutschland z. B. meistens den Zeichen
k, t, p im Anlaut gegeben wird. Die Stufen der Aspiration
sind im Übrigen sehr mannigfaltig, so dass sich eine
allgemeine und feste Grenze zwischen der Tenuis aspirata und
der Tenuis mit leisem Absatz kaum auffinden lassen wird.
Hier müssen wieder die gegensätzlichen Unterscheidungen in
den Einzelsprachen als Kriterien Berücksichtigung finden.
Anm. 3. Als Beispiele völlig unaspirirter Tenues mit offenem Kehlkopf
kann man die k, t, p der Schweizermundarten im Winteler'schen
Sinne, und die der Romanen und Slaven hinstellen. Die Engländer betrachten
ihre k, t, p auch als unaspirirt, aber für den Beobachter, welcher
an jene erstgenannten Laute gewöhnt ist, sind die engl. Laute deutlich,
wenn auch schwach, aspirirt. Unaspirirtes t habe ich von Schotten
gehört, z. B. in time, tell. Sehr stark ist die Aspiration der dänischen
k, t, p im Anlaute, so dass (wie schon Storm S. 44 bemerkt) t oft beinahe
wie deutsches z klingt. Weiteres s. unten § 20, 2.
Den Dauerlauten mit festem Absatz entspricht endlich eine
dritte Art von Verschlussfortes, die Tenues mit Kehlkopfverschluss
oder, was dasselbe ist, mit festem Absatz.
Bei diesen wird nach der Bildung des Mundverschlusses
die Communication des Mundraumes mit den Lungen durch
festen Verschluss der Stimmritze abgeschnitten. Die Compression
erfolgt dann durch Hebung des Kehlkopfs (theils
vermöge seiner eigenen Hebungsmuskulatur, theils auch vermöge
eines von unten her durch Compression der Luft im
Brustraume auf ihn ausgeübten Druckes). Bei der Explosion
116verpufft dann nur das geringe Quantum Luft, das bisher im
Mundraum eingeschlossen war. Deshalb klingen diese Tenues
stets sehr kurz und scharf abgestossen ; zur Bildung eines
nachfolgenden Hauches ist nie eine Gelegenheit geboten.
Wir bezeichnen sie als k, t, p u. s. w. — In Europa scheinen
sie übrigens im Ganzen nicht häufig zu sein. Bisher habe
ich sie mit Sicherheit selbst nur im Armenischen in der Aussprache
von Tiflis und Erzerum und im Georgischen beobachten
können. Die Hebung des Kehlkopfs ist hier eine sehr
energische, sie beträgt reichlich 1/2 — 3/4 Zoll. Hiervon ist
aber z. B. bei der Aussprache der sächsischen Laute, die man
oft nach den Angaben von Merkel hierher gestellt hat, nichts
wahrzunehmen ; es ist also deren Hierhergehörigkeit einstweilen
in Zweifel zu stellen, obwohl anerkannt werden muss,
dass sie, emphatischer als die süddeutschen ‘tonlosen Mediae’
und doch auch mit den süddeutschen Tenues nicht ganz übereinstimmend,
eine gewisse Klangverwandtschaft mit den arm.
georg. Tenues besitzen.
Anm. 4. Ich glaubte früher noch die Möglichkeit annehmen zu können,
dass bei den sächsischen Lauten der Kehlkopfverschluss erst eintrete,
nachdem die Luft des Mundraumes bereits von den Lungen her
comprimirt sei ; aber ein einfaches (nach meinen Angaben bereits von
Grützner S. 211 beschriebenes) Experiment hat mir seitdem die Unhaltbarkeit
auch dieses Ausweges ergeben. Man stecke ein feines Röhrchen
(eine nicht zu starke, auf beiden Seiten offene Federspule genügt) zwischen
die Lippen und spreche dann mehrmals die Silbenpa oder pa aus : trotz
des Ausströmens der Luft durch das Röhrchen kann man deutlich den
Eindruck eines p oder p erzielen (ebenso gelingt das Experiment bei ba),
zum Beweis dass fortwährend von den Lungen aus mehr Luft zuströmt,
als durch das Röhrchen abfliesst, dergestalt dass die eingeschlossene Luft
immer eine stärkere Compression besitzt als die äussere. Ein pa aber
gelingt nicht, weil selbstverständlich bei Kehlkopfschluss die Luft im
Mundraum sich mit der äusseren Luft ins Gleichgewicht setzt ; man hört
also zunächst nur das kurze Zischen der entweichenden Luft, dann den
Vocal mit festem Einsatz, die Trennung des Lippenverschlusses geht ohne
Explosionsgeräusch vor sich. Schliesst man die äussere Oeffnung des
Röhrchens mit dem Finger, während man ein gewöhnliches p articulirt,
so entweicht die Luft bei der Oeffnung dieses Fingerverschlusses in andauerndem
Strome, dessen Dauer bei dem Ansatz zu aspirirtempnoch
gesteigert wird. Bei wirklichem p aber verpufft das geringe Quantum
comprimirter Luft im Mundraum fast momentan.
2. Mediae. Mediae werden, ihrer ganzen Stellung im
Systeme entsprechend, nur mit leisem Absatz gebildet. Bei
der tönenden Media genügt ja zur Explosion schon die geringe
Luftmenge, welche während der kurzen Dauer des Mund-r
117Verschlusses durch die zum Tönen verengte Stimmritze in die
Mundhöhle eingetrieben wird, und wenig bedeutender ist der
Luftdruck bei der tonlosen Media mit offenem Kehlkopf. Die
Verschiedenheit von der entsprechenden Tenuis mit leisem
Absatz ist also namentlich im isolirten Auslaut keine grosse,
und beide Lautarten können daher von ungeübteren Beobachtern
leicht verwechselt werden.
Anm. 5. Bezüglich des zeitlichen Verhältnisses des Stimmtones der
tönenden Mediae zu Verschluss und Explosion ist übrigens noch zu bemerken,
dass derselbe mindestens den Verschluss um einen Moment überdauern,
d. h. dass überhaupt ein Blählaut (S. 115) gebildet werden muss.
Wir rechnen also auch diejenigen (auslautenden) Mediae noch zu den
tönenden, bei denen die Esplosion selbst erst nach dem Erlöschen des
Blählautes stattfindet. Nur diejenigen Mediae sind als tonlos zu bezeichnen,
bei welchem Verschluss und Explosion vollkommen tonlos erfolgen.
§ 18. Die Berührungen benachbarter Laute im
Allgemeinen.
An die Spitze der Betrachtung aller Lautcombinationen ist
billig der zuerst von Winteler, Kerenzer Mundart 131 ff. genauer
ausgeführte und formulirte Satz zu stellen, dass bei
derBerührungzweier Laute die beiden gemeinschaftlichen
Articulationsbewegungen thunlichst
nur einmal ausgeführt werden. Dies gilt für alle Theile
der Articulation, also Respiration, Kehlkopf- und Mundarticulation.
Für die Lehre von den Uebergängen ergibt sich daraus
der specielle Satz, dass der Regel nach jeder folgende Laut
mit dem Eingange beginnt, welcher dem Ausgang des vorhergehenden
Lautes correspondirt ; so bezeichnen also ka, ka,
ka im Folgenden die Verbindung einer Tenuis mit leisem,
festem, gehauchtem Ausgang, mit einem Vocale mit leisem,
festem, gehauchtem Eingang. Es bedarf daher der Uebergang
auch nur einer einfachen Bezeichnung. Im ersteren
Falle schliessen sich die beiden Nachbarlaute so innig an einander
an, dass nichts Fremdartiges zwischen ihnen wahrgenommen
wird ; wir nennen deshalb diesen Uebergang den
direkten. Solche direkte Uebergänge haben wir z. B. in
den Diphthongen, wie ai, au, oder Verbindungen wie al, ar
etc. Für die sonstigen Verbindungen ergeben sich die Bezeichnungen
der festen und gehauchten Uebergänge von
selbst.118
Unter den sonstigen Fällen verdienen sodann namentlich
die Berührungen ganz oder theilweise homorganer Laute
besondere Berücksichtigung, weil gerade hier jener Satz vielleicht
die weitgreifendste Gültigkeit hat ; ausserdem diejenigen
Fälle, wo nicht nur die nothwendigen, specifischen
Articulationsfactoren, sondern accessorische jenem Gesetze
sich fügen. Dahin gehören insbesondere die Vorausnahmen
specifischer Articulationen folgender Laute bei der Bildung
vorausgehender Laute, wie das z. B. bei der Mouillirung
und Rundung geschieht (§ 23).
§ 19. Die Berührungen von Sonoren.
Allen Sonoren ist als Factor der Articulation der Stimmton
gemeinsam. Dieser tönt in der Regel während der
Bildung der beiden Nachbarlaute ununterbrochen fort, der
Uebergang von dem einen Laut auf den anderen wird also
nur durch einfache Umstellung der Ansatzrohrorgane für eine
andere Resonanz gebildet.
Eine Unterbrechung des Stimmtones findet nur statt, wenn
die beiden Laute absichtlich durch den Spiritus asper oder
lenis geschieden werden.
An Einzelfällen ist noch das Folgende zu bemerken.
1. Verbindung zweier Vocale.
Vocale, welche zwei verschiedenen Silben angehören, werden
dadurch schon hinreichend auseinander gehalten, dass
der zweite durch einen deutlich getrennten neuen Exspirationshub
eingeführt wird. Die Uebergangslaute sind dabei zu
einer niedrigen Stufe der Vernehmbarkeit herabgedrückt, weil
zwischen den beiden Stössen die Exspiration sehr geschwächt
ist. Ausserdem kann aber auch noch fester Kehlkopfverschluss
zur Trennung der beiden Laute verwandt werden (also
entweder 3a-i : 3a-o, 3o-e, oder 3di, 3do, 3de u. s. w.). Gehauchter
Uebergang (di, do etc.) ist in den indogermanischen
Sprachen meist ein Rest eines einst zwischen beiden Lauten
ausgesprochenen oralenConsonanten (imDeutschen z. B.Rest
einer gutturalen Spirans, im Griechischen und anderwärts
Rest eines s u. dgl.). Man unterscheide wieder die verschieden
Stufen der Stärke des Hauches ; einen schwachen Hauch
(leise gehauchten Uebergang) findet man nach Storm und
119Sweet (bei Storm S. 53) oft im Französischen als Aussprache
des aspirirten h, aber auch oft zwischen einfachen Nachbarvocalen,
wie in Baal, fléau etc. Beim schnelleren Sprechen
herrscht indesswohl in den meisten Sprachen die erstgenannte
Art der Aufeinanderfolge mit continuirlichem Stimmton vor,
und dass das auch in den früheren Sprachperioden so gewesen
ist, zeigen die vielen Contractionen von Vocalen an, welche
bei Annahme einer Aussprache mit Kehlkopfverschluss oder
Hauch zwischen beiden Lauten nicht erklärlich sein würden.
Neben diesen lockerem Aufeinanderfolgen kennt die
Sprache aber noch zwei Reihen von engern, einsilbigen
Vocalverbindungen, die herkömmlicher Weise als Diphthonge
und Verbindung von Halbvocalen mit nachfolgenden Vocalen
bezeichnet werden. Beide Ausdrücke bedürfen noch einer
kurzen Erläuterung.
a. Diphthonge.
Unter einem Diphthong versteht man die Verbindung
zweier mit ein und demselben Exspirationsstoss hervorgebrachter,
d. h. nur eine Silbe bildender, einfacher Vocale.
deren erster den stärkeren Accent trägt.
Für die Bestimmung der wahren Geltung eines beliebigen
Diphthongs ist natürlich die genaue Ermittelung seiner Componenten,
d. h. desjenigen Vocallauts, mit welchem der
Diphthong beginnt, und desjenigen, mit dem er schliesst, die
erste Vorbedingung ; die Uebergangslaute ergeben sich dann
von selbst, da der Uebergang selbst auf dem kürzesten Wege
erfolgt. Dieser Aufgabe stellen sich aber in der Regel zunächst
ziemlich grosse subjective Schwierigkeiten entgegen,
weil wir zufolge des Zurückbleibens der Schrift hinter der
Entwickelung der gesprochenen Diphthonge diesen meist
ganz andere Bestandtheile zuzuschreiben pflegen, als ihnen
in Wirklichkeit zukommen. So bieten, wenigstens in vielen
Strichen Deutschlands, die meisten der in der Schrift auf -i, -u
ausgehenden Diphthonge in der Aussprache e (ä), o als zweiten
Componenten ; ai (ei), au, eu (äu), oi werden also z. B. als
ae1, ae2, œe ; ao1, ao2, o2o1, o2u ; o2aI (dö), s2e1 (öW), a91 etc.
etc. gesprochen (wobei natürlich im Einzelnen noch vielfache
Schattirungen in beiden Componenten zu beobachten sind.
Den wahren Endlaut richtig herauszuhören, resp. durch längeres
Verharren in der specifischen Articulationsstellung desselben
zum Gehör zu bringen, erfordert freilich ziemlich viel
120Uebung (namentlich bis man gelernt hat sich vollkommen von
der durch das Schriftbild erweckten und durch die lange Gewohnheit
gefestigten Vorstellung zu emancipiren, als müsse
ein i oder u in jenen Lautmassen enthalten sein), dieselbe ist
aber durchaus unerlässlich.
Anm. 1. Wem es noch an Uebung gebricht, der kann sich durch
ein einfaches Experiment, das Auflegen eines oder zweier Finger auf die
Vorderzunge von der Wahrheit des Gesagten leicht überzeugen ; man kann
dann immer noch vollkommen gute und deutliche Diphthonge (wie ai, au
in der gewöhnlichen mitteldeutschen Aussprache) hervorbringen, nicht
aber i und u : zum besten Beweis dafür, dass dieselben eben in jenen Diphthongen
fehlen.
Ein allgemeineres Abstandsminimum oder -maximum
der Componenten lässt sich nicht angeben. Für Deutschland
trifft im Grossen und Ganzen wohl der Satz zu, dass dieselben
nicht so weit auseinander liegen als die Vocale, welche die
landläufige Schrift als Componenten erscheinen lässt ; doch
fehlen auch Verbindungen wie ai, au, iu, ui, welche wohl
ziemlich die Abstandsmaxima darstellen, keineswegs. Nach
der Minimalseite zu liegen z. B. die sog. langen Vocale des
Englischen (he, who, no, say), welche in Wirklichkeit durchaus
diphthongischen Charakter haben, indem bei ihnen gegen
den Schluss hin stärkere Verengungen eintreten ; so stellt der
Laut in he einen Diphthong aus etwas offnerem und etwas geschlossenerem
i dar, der in who eine ähnliche Verbindung
zweier u (Sweet bezeichnet das zweite Element inconsequent
hier als consonantisch, schreibt also iy, uw, während er sonst
den Endlauten der Diphthonge die Vocalzeichen belässt). no
enthält ein ōu, say ein ēi etc.
Ebensowenig lassen sich bestimmte theoretische Vorschriften
über die Qualität eines, namentlich des letzten Componenten
geben ; doch pflegt man aus praktischen Gründen eine
Zweitheilung, in echte und unechte Diphthonge vorzunehmen.
Zur ersten Gruppe gehören Formen wie ai, ei. au,
ou, d. h. solche, deren zweiter Component stärkere Mundverengung
hat als der erste, zur zweiten Gruppe z. B. die
noch jetzt in verschiedenen Abstufungen in süddeutschen
Mundarten erhaltenen mhd. ie, uo, üe, bei denen das umgekehrte
Verhältniss stattfindet. Historisch erklärt sich diese
Theilung dadurch, dass sämmtliche den altern indogerm.
Sprachen eigenen Diphthonge stets i, u an zweiter Stelle hatten,
während sich die sog. unechten Diphthonge erst später aus.
monophthongischen e, o entwickelt haben ; physiologisch aber
121ist sie insofern zu rechtfertigen, als die engeren Vocallaute
vermöge ihrer Articulation mit weniger Klangfülle begabt
sind (§ 26) als die weiteren, und daher geeigneter erscheinen
können, die schwächer accentuirte Stelle im Diphthongen
einzunehmen. Dass jene Verbindungen wie ie, uo überhaupt
nicht diphthongisch, sondern nur zweisilbig ausgesprochen
werden können, wird wohl nur von solchen behauptet, welchen
die nöthige Hebung in der Hervorbringung dieser Lautgruppen
fehlt. — Uebrigens gebrauchen einige den Namen
‘unechte Diphthonge’ abweichend für Diphthonge, deren
erster Component lang ist.
Endlich ist auch die Quantität beider Componenten
frei gegeben, d. h. jeder von ihnen kann alle Stufen vocalischer
Länge bis herab zu Null (= Reduction, s. § 24, 2)
durchlaufen. Diphthonge mit kurzem ersten Componenten
sind z. B. die gewöhnlichen deutschen ai. au, engl. ai, au in
high, now ; langen ersten Componenten haben z. B. engl. he.
who, say, no, gewiss auch altgriech. a, tj,co,av, r\v, cov (neben
ai. ei, oi, av, ev, ov) und die skr. Vrddhidiphthonge. Genaueres
s. unten unter ‘Quantität’, § 28.
Die Hauptsache bei der Bildung eines Diphthongs ist also
wohl, dass der erste Component so hervorgebracht wird, dass
man ihn als silbenbildend empfindet, und dass vom Augenblicke
des Uebergangs zum zweiten Componenten an eine
derartige Continuität der Exspiration stattfindet, dass der Eindruck
einer einheitlichen Silbe nicht gestört wird : woraus
sich sofort ergibt, dass es Fälle gibt, wo man über die Geltung
der Lautfolge, ob Diphthong (d. h. einsilbig) oder zweisilbige
Folge schwanken kann.
Anm. 2. Sweet definirt die Diphthonge als Verbindungen von Vocal
+ glide, indem er als Grundform etwa des ai annimmt, dass der Laut abgebrochen
werde sobald die Stellung für den Endlaut erreicht ist, ohne dass
dieser selbst eine messbare Zeit hindurch angehalten wird ; er gibt aber zu,
dass der glide auch zum vollen Vocale gemacht werden könne, ohne dass der
diphthongische Character verloren geht. Man kann deswegen eben so gut
vom vollen Voeale ausgehen, und die Sweet'sche Grundform betrachten
als entstanden durch Reduction eines vollen Vocales (§ 24, 2}. Es ist
jedenfalls am besten nur zu sagen, der zweite Component müsse im Verhältniss
zum ersten consonantisch fungiren (oben S. 27 ff.). In dieser
Fassung ist die Regel bereits von dem ältesten Phonetiker der Neuzeit,
dem Dänen Jac. Matthiae in seinem Buche De literis, Basileae 1586, ausführlich
begründet worden, auf den sich die weiteren Ausführungen von
Thom. Gataker (De diphthongis, z. B. in seinen Opera critica, Traiecti
1698 abgedruckt), Wallis, Rask etc. stützen (was freilich Kräuter, Zur
Lautverschiebung S. 119 ff. verborgen blieb).122
Triphthonge.
Was man neben den Diphthongen häufig noch als eine
besondere Kategorie der Triphthonge aufstellt, hat grossentheils
kein Anrecht auf diesen Namen, wenn derselbe eine
Analogie zu dem der Diphthonge in dem oben festgestellten
Sinne bilden soll. Die meisten der hierher gezogenen Verbindungen,
wie die iei, ieu mancher romanischer Sprachen,
sind entweder nicht einsilbig, oder der Accent ruht erst auf
dem zweiten Laut. Wirkliche Triphthonge müssen wie die
Diphthonge mit einem silbenbildenden Vocal beginnen und
diesem die beiden andern Vocallaute consonantisch nachfolgen
lassen. Der Art sind z. B. die schweizerischen üœi in blüœijce
blühen etc. (Winteler 165, Stickelberger, Schaffhauser Mundart
10).
Anm. 3. Wenn ein Diphthong wie ai einer Verbindung wie al parallel
geht (s. unten S. 126), so ist ein Triphthong wie üœi einem einsilbigen
ail, arl etc. analog.
b. Halbvocale.
Unter Halbvocalen verstehen wir die unter dem Einfluss
der Accentlosigkeit zur Function als Consonanten herabgesunkenen
Vocale. Der Ausdruck Halbvocal gehört, wie man
sieht, lediglich der Functionslehre an. und sagt nichts anderes
aus als ‘unsilbisch gebrauchter Vocal’. Der sog. Halbvocal
ist qualitativ ebensogut ein Vocal wie der ‘Vollvocal’, d. h.
beide sind Sonorlaute, aber in verschiedener Function bezüglich
der Silbenbildung.
Nach dem eben über die Diphthonge Erörterten ist es sofort
klar, dass die zweiten Componenten der Diphthonge als
Halbvocale betrachtet werden können. Die Praxis hat aber
diese Auffassung sich nicht angeeignet, da sie eben die ‘Diphthonge’
als etwas für sich Bestehendes, mit sonstigen Lautverbindungen
nicht zu Parallelisirendes betrachtete. Man
pflegt also den Ausdruck Halbvocal nur anzuwenden, um
einen consonantischen Vocal vor einem silbenbildenden Laute
zu bezeichnen. Bezeichnen wir die unsilbischen Vocale durch
untergesetztes ^, so spricht man also nur in Fällen wie ia, ua,
nicht aber bei ai, au von den Halbvocalen j, u.
Anm. 4. Wir gebrauchen, wie man sieht, das Wort Diphthong ausschliesslich
in dem Sinne, wie es in der Terminologie der älteren Grammatik,
namentlich der Inder, Griechen und Lateiner üblich gewesen ist.
123Die neuere Praxis und einige Phonetiker (z. B. auch Sweet) verallgemeinern
aber das Wort zum Theil, indem sie alle einsilbigen Verbindungen
zweier Vocale Diphthonge nennen, also auch z. B. ia. Man unterscheidet
dann wohl fallende Diphthonge, bei denen der accentuirte Vocal voransteht,
wie in ai, au (dies wären unsere eigentlichen Diphthonge ; und
steigende, bei denen der Halbvocal die Gruppe beginnt, wie in ia, ua ;
letztere Verbindungen sind namentlich in den romanischen Sprachen
häufig, vgl. z. B. franz. ie, oi, ital. uo, span. ue etc.
Nach den oben S. 122 gemachten Bemerkungen über die
natürliche Klangfülle der verschiedenen Vocale ist es leicht
erklärlich, dass ein Vocal um so besser zu halbvocalischer
Function sich eignet, je enger seine Öffnung ist, und dass der
Halbvocal vor einem Vocale in der Regel (oder stets' ?) enger
ist als der letztere. Hiermit hängt es auch zusammen, dass
meist nur Verbindungen von der Form (a. ua. {u. ui. aber
nicht solche wie qi, qu üblich sind (vgl. jedoch § 24. 2 und
unten Anm. 6). Soll vor einem Vocale wie i, u u. s. w. Der correspondirende
Halbvocal gebildet werden (also Gruppen wie
ji, wu), so wird der Halbvocal stets etwas geschlossener eingesetzt
als der Vocal, sodass hier zum Theil Engengrade erreicht
werden, welche bei den silbenbildenden Vocalen derselben
Sprachen sonst nicht üblich sind.
Die Analyse der Halbvocale vor Vocalen bietet dieselben
Schwierigkeiten wie die Erkennung des zweiten Componenten
von Diphthongen. Am häufigsten erscheinen als Halbvocale
i und u, weil dieselben an sich wegen ihrer starken Engenbildung
geringe Klangfülle haben. Aber auch andere Vocale.
z. B. e und o. werden genugsam als Consonanten verwendet
(ea, oa), wie man durch das oben in der Anm. 1 bezeichnete
Experiment leicht nachweisen kann.
Steht ein consonantisch verwendbarer Vocal zwischen
zwei andern Vocalen, z. B. aia, aua. so hängt es ganz vom
Accent und von der Vertheilung der Exspiration ab, ob diese
Lautfolge als di-d, du-d oder als ä-iä, d-ud oder endlich als
äi-iä, du-ud empfunden wird. Im ersten Falle wird das i, u
noch mit demselben Exspirationsstoss hervorgebracht, wie
das erste a und schliesst sich mit diesem zum Diphthongen
zusammen : im zweiten Falle tritt die Herabsetzung der Exspiration
schon nach dem ersten a ein und i. u bilden den
consonantischen Vorschlag vor dem zweiten ; im dritten Falle
wird die erste Hälfte des länger ausgehaltenen i, u mit dem
ersten, die zweite mit dem zweiten Exspirationshub gebildet.
124Die Übergänge bleiben überall dieselben, und streng genommen
wird sich in jedem Falle die Existenz eines Halbvocales
nachweisen lassen ; freilich kommt derselbe als solcher eben
nur unter gewissen Accentbedingungen deutlich zum Bewusstsein
(namentlich wenn das zweite a stärker betont ist
als das erste). Mit den spirantischen j und w, die sich
durch stärkere Engenbildungen häufig aus den Halbvocalen
i, u entwickelt haben, dürfen diese ja nicht verwechselt werden
(vgl. S. 98 f. 104).
Anm. 5. Eine Reihe genauerer Bestimmungen über wirklich beobachtete
Diphthonge und Halbvocale findet sich namentlich in Ellis' viertem
Band und den verschieden Analysen von Sweet, besonders auch in dessen
Handb. S. 68 ff., sowie bei Lundell 123 ff. Ungemein reich an Diphthongen
sind in Deutschland die westfälischen Mundarten ; Jellinghaus, Westfäl.
Grammatik, Bremen 1877, S. 23 ff. zählt folgende auf : ai, äi, äi, au,
äu, äü, iu, uü, ui, eo, oe, ie, ia, ua, uo, üö, üa, üe.
Anm. 6. Zur Beurtheilung der Diphthonge und Halbvocale ist es
sehr wesentlich, den Weg zu verfolgen, den die Zunge beim Uebergang
zurücklegt ; ob sie z. B. einfach innerhalb einer Verticalreihe der Vocale
aufsteigt, wie bei ei, oder sich senkt wie bei ie, oder ob sie sich vorwärts
bewegt wie bei ui, oder rückwärts wie bei iu, oder ob die Bewegung eine
combinirte ist ; z. B. steigend und nach vorn bei ai, fallend und nach hinten
wie bei ia ; auch die Engenbildung an den Lippen ist wichtig. Durch
diese beiden Bewegungsmomente und die daraus resultirende Verengung
der Ausflussöffnung wird nämlich die natürliche Schallfülle der betreffenden
Laute bedingt, und von dieser hängt wieder die Leichtigkeit ab mit
der sie sich zu einer einsilbigen Verbindung zusammenschliessen lassen.
Diphthonge mit steigender Zunge sind am leichtesten einsilbig zu halten ;
bei horizontaler Bewegung der Zunge bildet Vorschiebung besser einheitliche
Diphthonge als Rückziehung (vgl. z. B. a2e1 mit e1a2), am wenigsten
eignen sich Verbindungen, bei denen die Zunge sich senken muss, wie ia
u. dgl. Für die Halbvocale vor Vocalen drehen sich diese Regeln natürlich
um ; ein ai bringt, wie schwach man das ce auch nehmen mag, doch
immer den Eindruck eines cei hervor (Sweet S. 70), vgl. die schwäbische
Aussprache der ei, öü, bei denen oft das zweite Element stark überwiegt.
Bei Verbindungen wie ia etc. findet leicht eine Verschiebung des Accentes
auf den zweiten, schallkräftigeren Laut statt, vgl. z. B. die nord. ja, jö,
jo, ju aus ia, iß, io, iii ; Aehnliches findet sich auch im Englischen ; so
wird z. B. ags. ai im Dialekt von Westmoreland durch ia aus ia (aus
[schott.] œ diphthongirt) vertreten. Im Süden hört man nicht selten ia1
für iä (geschrieben -ere, -ear, -ea etc.), meist mit ganz schwachem, nahezu
verschwindendem {-Laut ; z. B. i<e year, ' here ('i tonlos, spirantisch),
auch kl(i)<z clear, tsäfl cheerful, <&&d(i)ä idea u. dgl. habe ich
gehört. Dahin gehören wohl auch die von Storm S. 114 besprochenen
Formen wie sce1 sure, pice1 pure, mit Ausfall des u (durch ü hindurch ?).
Nasalirte Halbvocale erscheinen häufig als zweite
Glieder von nasalirten Diphthongen. z. B. in den süddeutschen
Mundarten. Nasalirtes i neben reinem * findet sich
125nach Böhtlingk im Jakutischen, z. B. in a# Sünde neben a(t
Schöpfung ; nach Sweet S. 47 wird es im Französischen oft
bei nachlässiger Aussprache für gn (mouillirtes n) gebraucht.
Als tonlose Halbvocale dürfen ihrer unsilbischen Function
nach die h bezeichnet werden, die oben ihrer Qualität
nach als tonlose Vocale gefasst wurden. Sie erscheinen am
gewöhnlichsten vor oder nach entsprechendem Vollvocal
(S. 81), aber oft entstehen sie auch unter dem Einflüsse tonloser
Nachbarlaute aus tönenden Halb vocalen, und treten
dann vor beliebigen Vocalen auf. So finden wir tonloses u2
im engl. wh in which, what u. s. w., tonloses i in engl. pure,
cure, franz. pied, pion, tiens u. s. w. und vielen ähnlichen Fällen
in andern Sprachen. Streng genommen sollten diese tonlosen
Halbvocale kein Reibungsgeräusch haben, aber sehr
leicht mischen sich bei stärkerer Engenbildung und stärkerem
Hauch (namentlich beim i) solche bei, und es vollzieht sich
ein Uebergang zum Geräuschlaut (/, in. dgl. vgl. z. B. die
landläufige englische Aussprache von Wörtern wie nature,
creature etc. mit t% oder ts).
2. Verbindungen von Vocalen mit Liquiden und Nasalen.
Auch hier haben wir es hauptsächlich nur mit den einsilbigen
Verbindungen zu thun. Diese sind den Verbindungen
zweier Vocale vollkommen analog, nur mit der Einschränkung,
dass nach den Gesetzen über die Abstufung der
Schallfulle (§ 2 6) die Liquidae und Nasale in fast allen Fällen die
unbetonten, consonantischen Glieder der Verbindung
sind. Dass wir Gruppen wie al, ar, am, an, aid (genauer geschrieben
a\, ar, am, an, um die unsilbische Geltung des an
zweiter Stelle stehenden Sonorlauts zu bezeichnen) nicht auch
als ‘Diphthonge’ auffassen, liegt grossentheils bloss an der
Gewohnheit, l, r, m, n, w als ‘Consonanten’ zu bezeichnen,
die mit einem ‘Vocale’ nicht eine derartig homogene Verbindung
eingehen können wie zwei ‘Vocale’ unter einander. Eine
gewisse praktische Berechtigung hat allerdings die Abtrennung
dieser Verbindungen von den vocalischen Diphthongen, weil
die Liquidae und Nasale ihrer Articulation und ihrem Klange
nach von den Vocalen allerdings so weit abstehen, dass sie
mit denselben für unsere Empfindung nicht zu einer so homogenen
Lautmasse zusammenschmelzen, als das bei reinen
Vocalverbindungen möglich ist. Am besten verschmilzt noch
126das l, namentlich wenn es starke Öffnung hat (darum gehen
al, ol so häufig geradezu in au, ou, anderwärts in ai, oi etc.
über). Auch die ungerollten r geben sehr einheitlich klingende
Verbindungen, bei den gerollten bringt das Rollen, bei den
Nasalen der Nasalklang etwas dem Vocale nicht Homogenes,
und deshalb mehr als getrennt Empfundenes in die Verbindung.
Aber Nasalvocal + Nasal klingen wieder gut einheitlich.
Zweisilbige Verbindungen von Vocal + Liquida oder
Nasal bedürfen hier keiner weiteren Erörterung.
3. Verbindungen von Liquiden und Nasalen untereinander.
Ueber diese Verbindungen ist an dieser Stelle kaum etwas
zu bemerken, da Erörterungen über ihre relativen Functionen
als Sonanten und Consonanten erst weiter unten angestellt
werden können. Ebenso wird über die sogenannte Gemination
erst in § 31 das Nöthige zur Sprache gebracht werden.
§ 20. Berührung eines sonoren Lautes mit
Geräuschlauten.
1. Sonore und Spiranten.
a. Tönende spiranten.
a. Tönende Spiranten. Diese verhalten sich bezüglich
des ihnen mit den Sonoren gemeinschaftlichen Factors,
des Stimmtons, durchaus den Halbvocalen, Liquiden und
Nasalen analog, d. h. der Stimmton wird in der Regel continuirlich
durch die Lautverbindung durchgeführt, und während
seiner Dauer die Umstellung der Mundorgane vollzogen ;
also auch hier herrscht der directe Uebergang vor. Der einzige
Unterschied zwischen unserer Gruppe und den Gruppen mit
Liquida oder Nasal besteht darin, dass bei den Spirantenverbindungen
schallbildende Engen im Ansatzrohr hergestellt
werden müssen an Stelle der nicht schallbildenden Engen
bei den erstgenannten Lauten. Da übrigens manche Sonorlaute,
namentlich die r und manche Halbvocale mit starker
Engenbildung, leicht accessorische Nebengeräusche entwickeln,
andererseits die specifischen Geräusche der Spiranten
durch Reduction sehr geschwächt werden können, so ergibt
sich leicht, dass die beiden Gruppen sich vielfach berühren,
können.
b. Tonlose spiranten.
b. Tonlose Spiranten. Bei diesen muss neben der
127Aufhebung resp. Bildung der spirantischen Enge sa — as)
auch noch der Einsatz resp. Absatz des Stimmtons ausgeführt
werden. Im Deutschen ist es üblich, den Stimmton plötzlich
ein- resp. abzusetzen, und genau gleichzeitig mit der ebenfalls
rasch ausgeführten Umstellung der Mundorgane, wenn
der Sonorlaut Sonant ist, z. B. also in Verbindungen wie sa,
as. Die Verbindung geschieht also mittelst des direkten
Uebergangs. Gehauchter Uebergang ist seltener : abgesehen
von Fällen der Composition von Grenzlauten ursprünglich
getrennter Silben, wie sat für es hat (S. 114), finden sich
im Deutschen gelegentlich Typen wie ds mit schwachem
Hauch zwischen a und s ; sie entstehen dadurch, dass die
spirantische Enge für das s etwas später gebildet wird, als der
Stimmton abgesetzt wird. Auch die armenischen ‘aspirirten
Affricatae’ § 21, 1 haben bisweilen einen deutlichen Hauch
zwischen der Spirans und dem folgenden Vocal. isa, isa etc.
Festen Uebergang, as, finden wir natürlich wieder in Sprachen
mit ‘gestossenem Ton’ § 29, 2).
Ist der Sonorlaut aber ein Consonant, so wird derselbe
häufig durch den tonlosen Nachbarlaut ebenfalls tonlos gemacht,
wenigstens setzt bei Verbindungen wie sla, sna der
Stimmton oft erst nach der Einstellung des Mundes für l, n
etc. ein. so dass der Eingang des l, n noch tonlos gebildet
wird ; in Gruppen wie als, ans findet dann das umgekehrte
Verhältniss statt, der Stimmton erlischt, ehe die Einstellung
für l, n aufgehoben wird, wir erhalten dann l, n mit tonlosem
Ausgang. Ob diese tonlosen Ein- und Ausgänge spirantische
Reibegeräusche entwickeln, hängt von der Energie derExspiration
und dem Grade der Engenbildung ab ; nothwendig ist
es nicht, und dies ist wohl der Grund, warum diese tonlosen
Theile der Sonoren so leicht übersehen werden.
Anm. 1. Ueber tonlose (reducirte : Halbvoeale an dieser Stelle vgl.
oben S. 126.
2. Sonore und Verschlusslaute.
a. Der Verschlusslaut vor dem Sonoren.
a. Der Verschlusslaut vor dem Sonoren. Mit
demselben Exspirationshub, welcher den Verschluss des vorausgehenden
Explosivlautes durchbricht, muss auch der folgende
Sonorlaut erzeugt werden, sobald sich beide Laute vollkommen
einheitlich zu einer Silbe verbinden sollen. Die
betreffenden Verbindungen lauten ganz anders bei der Vertheilung
auf verschiedene Silben, und es treten in dem letzteren
128Falle Combinationen verschiedener Ein- und Absätze entgegen
der S ; 118 erwähnten allgemeinen Regel auf. So ist z. B.
einsilbiges ka (d. h.k + a mit festem Uebergang, S.116 u. ö.)
zu unterscheiden von deutschem k-a oder ke - a etwa in hack-ab,
d. h. 'ak-ap oder 'ak-ap, in denen das k leisen resp.
gehauchten Absatz hat : allerdings spricht man gewöhnlich
bei rascherer Rede nicht so, sondern *a-kap, kaum auch
' a-kap. Nicht gleich pa ist deutsches p-a oder p-a in ab-halten,
d. h. ap-altn oder ap-altn bei deutlicher Markirung der
Silben, obwohl man in schneller Rede auch hier wieder gewöhnlich
a-pdl-tn abtheilt. Wir haben es hier wieder nur mit
den durch einen einheitlichen, continuirlichen Exspirationsstoss
hervorgebrachten Verbindungen zu thun.
α. Tönende Explosivlaute (tönende Mediae)
α. Tönende Explosivlaute (tönende Mediae).
Da bei der Verbindung tönender Mediae mit nachfolgenden
Sonoren der Stimmton als gemeinschaftlicher Factor ununterbrochen
forttönen muss (vgl. oben S. 119. 127), so verbietet sich
die Anwendung des festen Uebergangs meist von selbst
(ausser im Falle der Composition, z. B. in gib-im neben vielleicht
ebenso häufigem oder häufigerem gi-bim). Durchaus
die gewöhnlichste Form ist die des direkten Uebergangs,
d. h. der Blählaut und der folgende sonore Laut verschmelzen
zu einer continuirlichen Einheit. Nur ist dabei wohl zu beachten,
dass der Blählaut um so schwächer wird, je mehr er
sich seinem Ende, d. h. der Explosion nähert, weil mit der
zunehmenden Verdichtung der Luft im Mundraum die Stimmbänder
immer weniger energisch ansprechen. Mit der Explosion
setzt dann der Stimmton wieder voll ein ; der Contrast
zwischen beiden Momenten führt dabei wohl leicht zu der
Annahme, dass der Blählaut noch vor der Explosion erlösche
und die Stimme dann ganz von Neuem einsetzen müsse ; die
Auscultation des Kehlkopfs zeigt aber, dass in Wirklichkeit
nur eine Schwächung und eine nachfolgende Verstärkung des
Tones eintritt.
Auf dieser Schwächung des Stimmtons scheint nun auch
die Bildung der sog. Mediae aspiratae zu beruhen, d. h.
die Bildung von tönenden Medien mit einem dem tonlosen
gehauchten Absatze der Tenuisaspiraten analogen Absatz, den
man als tönenden gehauchten Absatz bezeichnen kann.
Wie die Beobachtung der Tenues aspiratae lehrt (s. unter ß),
besteht nämlich das wichtigste Merkmal der Aspiratae darin,
dass ohne Rücksicht auf den folgenden Laut die Stimmritze
129noch einen Moment nach der Explosion in der Stellung verhleibt,
welche sie während des Verschlusses hatte, und dass
während dieses Momentes eine nach der Articulationsenergie
des vorausgehenden Explosivlautes sich regelnde Exspiration
stattfindet. Hiernach ergibt sich für die Mediae aspiratae
der specielle Fall, dass jener geschwächte Stimmton (den wir
bei der einfachen Media nur während der Dauer des Verschlusses
als Blählaut auftreten sahen) noch über die Explosion
hinaus festgehalten wird, ehe für den folgenden sonoren
Laut die Stimme mit voller Exspirationsstärke einsetzt. Da
nun ausserdem. wie es scheint, bei der Bildung des Blählautes
die Stimmbänder nicht so fest zum Tönen eingesetzt sind,
wie bei der Bildung von Sonoren (vielleicht ist die Knorpelglottis
geöffnet, vgl. obenS.23). so können sich dem schwachen
Stimmton leicht noch Reibungsgeräusche des Kehlkopfs beimischen
(wie wir sie oben S. 111 als gelegentliche Ingredienzien
des h kennen gelernt haben). und so kann man jenen flüchtigen,
energielosen Zwischenlaut zwischen der Media und dem
folgenden sonoren Laute wohl als einen tönenden Hauch auffassen.
Aus dieser Bildungsweise der Medialaspiraten folgt, wenn
die gegebene Definition richtig ist. übrigens mit Nothwendigkeit,
dass dieselben nur vor Sonoren erzeugt werden können ;
denn sowohl im Auslaut wie vor nicht oder nur halb
sonoren Lauten würde der ‘tönende Hauch’ nach dem unten
in § 26 entwickelten Silbenbildungsgesetz nothwendig als
Vocal aufgefasst werden, d. h. eine eigene Silbe für sich
bilden.
Anm. 2. Ueber die Natur der Medialaspiraten ist sehr viel gestritten
worden. Aus der älteren einschlägigen Literatur seien hervorgehoben
die Aufsätze von C. Arendt, Beiträge II, 283 ff. und E. Brücke,
Sitz.-Ber. d. Wiener Ak., phil.-hist. Cl. XXXI, 219 ff. Das nqiäxov tpevdog,
dem man sich bei der Entscheidungsfrage hingab, war die Transeription
der einheitlichen Devanagarizeichen ^, ^, 'X\ durch gha, dha, bha
oder ga, da, ba, und der aus dieser Transcription gezogene Schluss, dass
die Medialaspiraten aus tönender Media und tonlosem Hauche (unserm
h) zusammengesetzt seien. Diese Aussprache existirt zwar nach den
Angaben von Brücke a. a. O., die ich durch mündliche Mittheilungen von
Kielhorn bestätigt finde, in verschiedenen neuindischen Idiomen (z. B. im
Mahrathi) ; die alte Aussprache aber kann sie schwerlich gewesen sein,
da die Sanskritgrammatiker sonst die betreffenden Laute wohl zu den tonlosen
gerechnet hätten. Mir hatte sich die oben ausgesprochene Ansicht
über die Natur der Medialaspiraten aus rein theoretischen Gründen ergeben,
als ich die praktische Bestätigung durch den Aufsatz von
130Ellis in der Academy 1874, V, 68 f. empfing (womit jetzt die weiteren
Ausführungen in desselben Early Engl. Pron. IV. 1134 ff. zu vergleichen
sind, freilich auch wieder die contrastirenden Angaben von Sweet bei
Storm S. 430). Es heisst am erstgenannten Orte auf Grund der Angaben
zweier Bengalesen ausdrücklich : ‘In this case we have not a lengthened
sonant and then a jerked flatus, as Germans pronounce Sanscrit. This was
entirely repudiated by both Mr. Gupta and Mr. Mookerjey, who, each of
his own accord, mentioned the pronunciation to warn me against it. No
trace of flatus (in dem von Ellis festgestellten Sinne eines tonlosen Hauches)
occurs after the sonants in (bHa), but there is a momentary energising
of the following vowel’. Diese momentane Verstärkung des
Vocals ist eben offenbar das volle Einsetzen der Stimme. Uebrigens scheint
nach der Verschiedenheit der Quellen für die beiden entgegengesetzten
Angaben zu urtheilen, in Indien selbst eine doppelte Aussprache zu bestehen
(im Westen mit tonlosem, im Osten mit tönendem Hauche ?).
β. Tonlose Verschlusslaute (Tenues, Tenues
aspiratae, tonlose Mediae)
β. Tonlose Verschlusslaute (Tenues, Tenues
aspiratae, tonlose Mediae). Es handelt sich hier um
die genaueren Feststellungen über die Lautwerthe und die
Articulationen von Gruppen wie ka, ka, ka und ga. wobei g
die ‘tonlose Media’ g bezeichnen möge.
Am einfachsten sind die Gruppen ka und ka. Im ersteren
Falle, wo die Gruppe mit einer Tenuis mit geschlossenem
Kehlkopf beginnt (S. 116}. erfolgt der Einsatz des
Stimmtons gleichzeitig oder unmittelbar nach der Explosion
des Verschlusslautes. Die Exspiration muss dabei so regulirt
sein, dass die beiden Explosionen, die des k im Mundraum
und die des Kehlkopfschlusses als einheitlich empfunden werden.
So werden z. B. die armenischen Tenues gesprochen ;
gelegentlich aber kommt die Kehlkopfexplosion etwas verspätet,
und wird als selbständig empfunden ; der Vocal erscheint
dann von seinem Consonanten durch eine kleine Pause
getrennt.
Bei der Tenuis aspirata oder der Gruppe ka mit gehauchtem
Üebergang setzt wie bemerkt der Stimmton erst
eine merkbare Zeit nach der Mundexplosion ein, die Zwischenzeit
wird durch einen Hauch von verschiedener Stärke und
Dauer ausgefüllt. Solche Aspiraten sind z. B. die bühnendeutschen
k, t, p im Anlaut ; der Hauch ist hier von mittlerer
Stärke und Dauer ; weit stärker ist er in den dänischen ka,
ta, pa (S. 116), von denen Sweet S. 77 angibt, dass sie (wie
die irischen ka. ta, pa) durch einen selbständigen Exspirationsstoss
nach der Explosion gebildet werden. Als schwache
Aspiraten muss ich im Gegensatz zu Sweet etc. auch die englischen p),
t, k im Anlaut betrachten, s. obenS. 116, Anm. und
131hiermit verbindet sich ein Zweifel an der völligen Richtigkeit
von Sweet's Auffassung der tonlosen Mediae im Gegensatz
zu den unaspirirten Tenues. Er definirt die ersteren
als half-voiced stops. d. h. nach ihm befindet sich die Glottis
während des Verschlusses in der Stellung zum Tönen, aber
ohne dass Luft hindurchgepresst wird. Die Stimme beginnt
in demselben Momente, in welchem der Verschluss gelöst
wird, und der Glide zum folgenden Vocal ist deshalb tönend.
Dies mag vielleicht richtig sein, jedenfalls ist zwischen Consonant
und Vocal nicht die geringste Spur von Hauch wahrzunehmen,
aber es gilt dann dasselbe auch für die reinen
Tenues, welche Sweet, wie gesagt, nicht von den schwach
aspirirten Tenues des Englischen unterscheidet. Auch bei
diesen Tenues, wie sie namentlich der Süddeutsche und
Schweizer spricht, schliesst der Vocal unmittelbar an die Explosion
an. Ich würde demnach ga und ka beide als tonlose
Verschlusslaute mit direktem Uebergang bezeichnen ; ihr
Unterschied beruht dann in dem grösseren Exspirationsdruck
des k und der dadurch bedingten grösseren Intensität des Explosionsgeräusches
und des Uebergangs zum Vocal hin.
Anm. 3. Ueber die Frage ob die tonlosen Medien als reducirte Medien
zu bezeichnen seien, s. unten § 24, 3.
Aus dem über die Uebergänge von den Verschlusslauten
zu Sonoren im Allgemeinen Bemerkten ergibt sich als einfache
Consequenz, dass sonore Consonanten nach tonlosen
Medien und reinen Tenues tönend bleiben ; der gehauchte
Uebergang von den Aspiraten aber bedingt meist Tonloswerden
des ganzen Consonanten ; vgl. Verbindungen wie kla, pla,
tna etc., indem die Stimme erst einsetzt, nachdem die specifische
Stellung für den sonoren Consonanten bereits wieder
verlassen ist. Dass es auch Mittelstufen mit halb tonlosem,
halb tönendem Consonanten geben kann, versteht sich von
selbst.
b. Der Verschlusslaut folgt dem Sonoren.
b. Der Verschlusslaut folgt dem Sonoren. Bei
einer Lautfolge wie apa, aba u. s. f. gehört, wie ohne Weiteres
zugestanden werden wird, die Explosion des Verschlusslautes
zur zweiten Silbe, und ebenso wird zugegeben
werden, dass auch bei ap, ab das Explosionsgeräusch als etwas
der Silbe nachklappendes, nicht eigentlich zu ihr gehörendes
empfunden wird. Die Silbe findet also mit dem Verschlüsse
des Explosivlautes ihr Ende, und muss es finden, wenn wir
an der unten § 26 gegebenen Definition der Silbe festhalten ;
132denn mit dem Verschluss wird der Exspirationsstrom, wenn
auch auf noch so kurze Zeit, unterbrochen.
Spricht man nun eine derartige Lautreihe wie apa, aba
oder auch nur ap, ab so aus, dass man nach dem Verschlüsse
eine längere Pause macht oder dass man die Explosion ganz
unterdrückt, so genügt schon der blosse Verschluss, um jeden
Zweifel über den folgenden Laut zu heben ; man wird z. B.
ein a mit p-Verschluss deutlich von einem mit t- oder k-Verschluss
gebildeten unterscheiden, und ebenso ist es bei a-b,
a-d, a-g. Man hat hieraus geschlossen, dass neben den explosiven
auch implosive (prohibitive, occlusive)
Verschlusslaute existiren, die durch das Geräusch des Zusammenklappens
der Mundorgane erzeugt werden. Bei Verbindungen
wie ampa. anta, aidha müsste der Verschluss der
Gaumenklappe das Geräusch erzeugen. Aber man wird
bei einiger Aufmerksamkeit finden, dass ein derartiges Geräusch
beim gewöhnlichen Sprechen durchaus nicht existirt.
Vielmehr erleidet nur der Vocal eine eigenthümliche Modification
am Schlüsse, die wir als den specifischen Uebergang
zum folgenden Verschlusslaut bezeichnen können. Denn da
die Uebergangsbewegung für homorgane Verschlusslaute stets
dieselbe ist. so erscheint ein Vocal etc. vor denselben stets mit
derselben Modincation seines Ausgangs, und nach diesem Glide
schliessen wir, falls die Explosion nicht alsbald folgt, auf
das Organ des folgenden Explosivlautes. Bei den tönenden
Medien kommt dazu noch die Klangfarbe des Blählautes als
Unterscheidungsmittel in Betracht, da dieselbe natürlich nach
der Grosse des durch die Mundabsperrung gebildeten Blindsacks
wechselt. — Die grössere oder geringere Deutlichkeit
jener Schlussmodification richtet sich aber wesentlich nach
der Energie des Vocallautes in dem Uebergangsmoment (man
hört dieselbe also z. B. deutlicher in apa als in āpa, weil im
letztern Falle der Schluss des langen Vocals geringere Energie
hat ; deutlicher bei folgender Fortis als vor Lenis, weil bei
ersterer noch stärkere Exspiration dem Verschlüsse vorangehn
muss, u. s. w.).
In den meisten Sprachen dürfte dieser direkte Uebergang
(mit durchaus tönendem Sonorlaut) der häufigste sein ;
die Sprachen mit gestossenem Accent brauchen natürlich auch
hier wieder unter Umständen den festen Uebergang (d pa,
a ta, a ba, a da etc.). Gehauchter Uebergang nach Vocalen
ist selten, findet sich aber z. B. regelmässig im Isländischen
133vor tt, kk, pp, z. B. in dóttir, gesprochen dotir, nach
Sweet S. 76 auch bisweilen im Schottischen, z. B. in W^=
what. Er entspricht dem skr. Visarga vor Verschlusslauten.
Sonorer Consonant wird consequenter Weise oft ganz tonlos,
oft nur der letzte Theil desselben ; vgl. z. B. engl. built mit
build, felt mit felled, tent mit tend u. dgl.
§ 21. Berührungen von Geräuschlauten.
Es ist nicht nöthig. hier alle überhaupt möglichen Combinationen
der Besprechung zu unterziehen, da nach dem bisher
Erörterten eine Menge derselben ohne Weiteres verständlich
sein wird. Selbstverständlich gilt auch hier das Gesetz,
dass tönende Geräuschlaute stets ohne Aussetzen des Stimmtons
combinirt werden. Für die Combination eines tönenden
Geräuschlautes mit einem tonlosen gibt es keine absolut gültigen
Gesetze, wenn beide Laute verschiedenen Silben zufallen.
Sollen beide den Anlaut einer Silbe bilden, so tritt
wohl fast ausnahmslos Assimilation ein, d. h. beide werden
tönend oder tonlos. Weniger streng wird dies Gesetz im
Silbenauslaut gehandhabt. Zur Bildung von Ausnahmen ist
das als Substitut für uvulares r fimgirende 5 am meisten geeignet,
da es bei geringem Exspirationsdruck und geringem
Reibungsgeräusch den Sonoren noch am nächsten steht. Hier
ist wenigstens der Anfang des ersten Lautes oft noch tönend,
der Ausgang aber wird dem tonlosen Folgelaute assimilirt.
Nicht homorgane Spiranten können sich ebenso
ohne Weiteres unter einander verbinden wie nicht homorgane
Verschlusslaute ; bei letzteren können sich also
sämmtliche Ein- und Absätze wiederholen, z. B. abda mit
tönender oder tonloser Media, apta mit leisem, apta mit festem,
apta mit gehauchtem Einsatz ; aber auch apta mit verschiedenen
Einsätzen ; auch apda, selbst adbta u. s. w. sind möglich,
vgl. z. B. Worte wie engl. trap-door, lap-dog, oder big talk,
dog-trot u. dgl. Es gilt hier für jede einzelne Sprache die
speciellen Neigungen genauer zu untersuchen.
Anm. 1. Als Beispiel seien hier die Untersuchungen von Kräuter
über nhd. Aspiraten und Tenues, Kuhn's Zeitschr. XXI, 30 ff., angeführt ;
diese haben z. B. ergeben, dass auch diejenigen deutschen Mundarten,
welche anlautende Tenues aspiriren (ha,ta,pa) doch beim Zusammentreffen
zweier Tenues die doppelte Aspiration vermeiden u. dgl. mehr. Ich
bemerke aber, dass anderwärts, z. B. im Armenischen, diese Abneigung
134nicht besteht und man wirklich zwei nicht homorgane Aspiraten neben
einander spricht.
Ueber die Verbindungen von Spiranten und Verschlusslauten
ist nichts zu bemerken, was sich nicht ebenfalls
von selbst verstünde.
Ausser diesen allgemeinen gelten noch einige speciellere
Bestimmungen über Lautfolgen, die bisher nicht zur Sprache
gebracht worden sind.
1. Affricatae.
Bei der Verbindung eines einfachen Verschlusslautes mit
einem nachfolgenden Sonoren (seltner Geräuschlaut) geschieht
die Oeffnung des Mundes zu der vollen Weite, die für den
Sonoren erforderlich ist. durchaus momentan. Geschieht dies
nicht, sondern wird zunächst. wenn auch nur für einen kurzen
Moment, der Verschluss nur soweit geöffnet, dass die exspirirte
Luft an den Rändern der so gebildeten Enge sich
reibt so schiebt sich zwischen den Explosivlaut und den Sonoren
ein dem ersteren homorganes Reibungsgeräusch ein.
So entstehn Verbindungen wie die deutschen pfa, tsa, hxa
u. s. w. Wir nennen dieselben Affricatae, sobald beide
Laute, Explosivlaut und Spirans, im Silbenanlaute stehn,
d. h. mit demselben Exspirationshube hervorgebracht werden.
Sie dürfen durchaus nicht verwechselt werden mit den auf
zwei Silben vertheilten, componirten p-f, t-s u. dgl. wie
wir sie bei deutlich accentuirter Aussprache etwa in abfahren,
hat-sich hören (vgl. das obenS. 129 über die Aspiraten
bemerkte ;.
Je nach der Verschiedenheit des Absatzes der Explosion
wird auch die Qualität und Quantität (Energie) der Spirans
verschieden sein. Aus den tönenden Medien entwickeln sich
so tönende (dz, dž. < ?£ u. s. f.) aus den tonlosen Medien tonlose
Affricaten. Am vollständigsten ist die Reihe wieder bei
den Fortes (Tenues) entwickelt, weil diese die vielfachsten
Absätze haben. Den Tenues mit leisem Absatz entsprechen
also pfa, tsa, tša, wie sie etwa der Schweizer oder auch der
Mitteldeutsche, vielfach auch der Norddeutsche spricht, den
Aspiraten die Formen pfa, tsa, tsa, u. s. w., in denen
das f, s, š mehr oder weniger als Fortis erscheint, jedesmal
entsprechend der Energie des Hauches bei der correspondirenden
Aspirata. Sie kommen öfter in Norddeutschland vor,
aber ohne von den nichtaspirirten principiell geschieden zu
135sein. Besonders deutlich unterschieden werden beide Reihen
z. B. im Armenischen und andern asiatischen Sprachen mit
ähnlichem Lautsystem (so ist es mir keinem Zweifel unterworfen,
dass das skr. ch, wenn es wirklich bereits als palatale
Affricata gesprochen wird, dem armenischen t š [vgl.
Hübschmann. Z.D.M.G.XXX. 53 f. 57 f. Lepsius' c] gleichzustellen
ist). Ganz eigenthümlich klingen die Affricaten
mit festem Absatz, von denen das Tifliser Armenisch
z. B. die Laute ts und tš aufweist (Hübschmann's ts und c.
Lepsius’ t und c). Hier kann eben nur das im Munde eingeschlossene
Luftquantum zur Bildung der Spirans verwendet
werden ; daher klingt dieselbe ganz kurz abgestossen, kürzer
als sonst etwa eine Lenis s oder š. aber doch durch die Anlehnung
an den vorhergehenden starken Verschlusslaut ziemlich
energisch.
Anm. 2. Eine feste Grenze zwischen Affricaten und einfachen Tenues
ist vielfach nicht vorhanden. Hinteres gutturales k wird oft mit einem Ansatz
von Spirans gesprochen, weil die Oeffnung des Verschlusses wegen der
grossen zu bewegenden Massen etwas langsam geschieht ;man vgl. das kx
der Schweizer), Sodann stellt sich eine Spirans besonders leicht vor Vocalen
mit starker Verengerung des Ansatzrohres ein, insbesondere vor i
vgl. z. B. russ. mb etwa njimb, u. dgl. Daher erklärt sich der Uebergang
so vieler ‘mouillirter’ Laute in Affricaten vgl. unten § 23. l ;.
2. Oeffnung von Verschlusslauten ohne Exspiration.
Die Verbindung zweier Verschlusslaute kann so erfolgen,
dass der Verschluss für den zweiten erst nach der Explosion
des ersten hergestellt wird. Die Explosion des ersteren kommt
in diesem Falle deutlich zu Gehör. So spricht man derartige
Gruppen beim langsamen Syllabiren wohl im Deutschen,
auch im Bühnendeutsch bei getragener Declamation : für das
Schwedische ist diese Aussprachsweise nach Sweet S. 83 Regel :
akta klingt z. B. deutlich wie ak + ta (mit leisem Absatz des
k). In der gewöhnlichen deutschen Verkehrssprache aber, im
Englischen und wahrscheinlich in den meisten Sprachen
(Sweet a. a. O.) ist eine andere Bildungsweise gewöhnlicher :
der Verschluss für den zweiten Laut wird während
der Dauer des Verschlusses des ersten hergestellt,
z. B. der t-Verschluss in lebte, während noch die Lippen für
das b geschlossen sind. Die Oeffnung der Lippen erfolgt also
erst, nachdem durch den t-Verschluss die Communication mit
der Lunge abgesperrt ist. d. h. sie erfolgt ohne alle Compression
136der Luft hinter der Articulationsstelle (S. 115).
Immerhin aber erzeugt die Oeffnung der Lippen ein ganz
leises Geräusch ; noch schwerer wahrnehmbar ist dasselbe bei
der Oeffnung eines t-Verschlusses vor k, z. B. in hat-hein. Liegt
die zweite Verschlussstelle aber vor der ersten, wie z. B. in
Akte, Deckbett, so verliert sich das Oeffnungsgeräusch noch gar
in dem Blindsack, der durch den vorderen Schluss hergestellt
ist. Treten mehr als zwei Verschlusslaute in dieser Weise zusammen,
so wird der mittelste ganz wirkungslos, auch wenn
man die Articulation desselben ausführt ; vgl. z. B. Bildungen
wie Hauptkunststück, er trinkt kein Wasser : diese werden
denn sehr oft geradezu wie haup-k-, trink-k- (mit gedehntem
p, k) gesprochen. Man hört eben hier überall, wie Sweet
richtig bemerkt, eigentlich nur den Eingang des ersten und
den Ausgang des letzten Verschlusslautes.
Anm. 3. Ueber Verbindungen wie p—b t—d, k—g oder umgekehrt
b—p, d—t, g—k s. unten § 31 unter ‘Gemination’ ; überpn in engl. open
u. ä. s. S. 139, Anm. 3.
Anm. 4. Ganz nahe stehen diesen Verbindungen solche von Verschlusslauten
mit beliebigen Consonanten, wenn die Silbengrenze zwischen
beide gelegt wird, also die Oeffnung in einem Augenblicke stattfindet wo
höchstens minimaler Exspirationsdruck vorhanden ist ; wir sprechen oft
so ab-lassen, absagen, auch geradezu vor Vocalen, hat aber etc. (nicht in
Süddeutschland und der Schweiz, wo der Consonant stets zum Folgenden
gezogen wird).
§ 22. Berührungen homorganer Laute.
Für die Combination eines Dauerlautes mit einem ganz
oder theilweise homorganen Verschlusslaut gilt wohl ausnahmslos
die Regel, dass die Verschlussbildung von der
homorganen Engenbildung ausgeht, nicht erst durch einen
Rückgang der Organe durch die Indifferenzlage vermittelt
wird. So schliessen sich fp, st, št, rt, xk unmittelbar an einander ;
ähnlich lt. indem die Zungenspitze in der l-Lage bleibt
und nur die Seitenöffnungen geschlossen werden ; bei mp, nt,
Tdk findet demgemäss nur die Schliessung der Gaumenklappe
statt.
Geht aber der Verschlusslaut dem Dauerlaut voran, so
gilt das Gesetz ohne Einschränkung nur dann, wenn der
Dauerlaut die Explosion in der Richtung der Mittellinie des
Mundes gestattet, also für pf, ts, tš, tr, kx u. s. w. Liegt
aber die Enge des Dauerlautes nicht in der Mittellinie der
137Mundhöhle, so ist das Gesetz nur von beschränkter Gültigkeit,
offenbar weil durch die veränderte Explosionsweise der
Charakter des Explosivlautes selbst stärkeren Veränderungen
unterliegt. Von solchen kommen hierbei vornehmlich in Betracht :
1. Die lateraleExplosion der vorder-linguopalatalen
Laute vor l also dl, tl (in allen Species) und kl (bei palatalem
c). Hier bleibt die Zunge in der Verschlussstellung, die Explosion
erfolgt seitwärts. indem die Ränder der Mittelzunge
sich für das l von den Zähnen abheben. Wegen der Aehnlichkeit
der Articulation schliesst sich auch nl hier an.
Anm. 1. Die Verbindung cl mit lateraler Explosion hört man oft in
Sachsen, z. B. in glauben, gesprochen clau-m oder clo-m u. dgl. Sie geht
übrigens sehr oft in tl über ; man spricht also auch geradezu tlg-m.
Anm. 2. Auch bei andern Consonanten kann die specifische l-Articulation
vorausgenommen werden, aber die eigentliche Articulation dieser
Consonanten wird nicht so sehr dadurch afficirt. Bei einer Verbindung
wie pl, bl findet zwar bei Vorausnahme der l-Articulation eine Explosion
durch die Seitenöffnungen zwischen Zunge und Zähnen statt, da der Mittelweg
durch die Anpressung der Vorderzunge an Vorderzähne oder Gaumen
versperrt ist. Aber die specifisehe Lippenexplosion der Labiale bleibt bestehen.
Auch die eigentlichen Gutturale scheinen keine wesentliche
Umlagerung ihrer Explosionsstelle zu erfahren, es sei denn dass sie mit
dem gutturalen l (S. 91) verbunden werden.
2. Die nasale Explosion der Verschlusslaute vor homorganem
Nasal, also pm, tn, kid u. s. w., wie in abmachen.
Aetna u. dgl. Hier wird der gewöhnlichen Explosion eine
plötzliche Oeffnung der Gaumenklappe substituirt. So entstehen
also Nasenexplosive (S. 54 f.), die freilich einander sehr
ähnlich sind, weil die Explosion für alle an derselben Stelle
stattfindet. Trotzdem wird man dieselben nicht mit ihrem
Entdecker Kudelka (der mit Uebersehung der betr. Medialformen
von einem einzigen Nasenstosslaut spricht) u. A. zusammenwerfen
dürfen, weil doch der akustische Effekt nicht
unbeträchtlich von der Grosse des explodirenden Luftraumes
modificirt wird. Namentlich unterscheiden sich die nasalen
Degenerationsformen der tönenden Mediae b, d, g deutlich
von einander durch den ganz verschiedenen Klang ihres Blählautes.
Anm. 3. In den meisten Sprachen sind sowohl die laterale wie die nasale
Explosion in den angegebenen Fällen Regel, sobald es sich um reine
Tenuis oder Media handelt. Dagegen kommt die Aspirata der Tenuis öfter
ohne diese Assimilation vor ; doch auch für die reine Tenuis sind mir hier
und da (z. B. im Magyarischen) Fälle des Unterbleibens der nasalen Degeneration
138bekannt geworden. — Bei uns haben beide Arten von Degeneration
sehr stark um sich gegriffen, indem auch die unbetonten Endsilben
-el, -en mit Aufgebung ihres Vocales und z. Th. nachheriger Assimilation
an den vorhergehenden Verschlusslaut sich hier angeschlossen haben.
So spricht man mit silbenbildendem l, n fast überall ta-dl, ki-tl, la-dn,
há-tn, auch blai-bm, lá-pm, kná-kn (in Sachsen auch mit doppelter
Assimilation kná-kn oder tná-kto) für Tadel, Kittel, laden, hatten, bleiben,
Lappen, knacken ; doch gehen hierin die verschiedenen Mundarten öfter
auseinander. — Uebrigens täuscht man sich über das Vorkommen oder
Fehlen dieser letzteren Art von Assimilation selbst in der eigenen Mundart
sehr gewöhnlich. Recht schlagend tritt aber z. B. der Unterschied
zwischen assimilirenden und nichtassimilirenden Sprachen hervor, wenn
wir etwa unsere heimische Articulationsweise auf das Englische übertragen
und tei-krs (e = e1) ōu-p für tēi-kn, ōu-pn (taken, open) aussprechen (im
letzteren Falle wird übrigens der Zungenverschluss des n, wie Sweet S. 213
zuerst bemerkte, schon vor der Explosion des p gebildet, sodass das p hier
nach S. 136 f. zu beurtheilen ist.
Anm. 4. Selbst bei Brücke u. A. findet man noch die nasalen Explosivlaute
als einen Beweis dafür angeführt, dass auch rein implosive (prohibitive)
Verschlusslaute existiren, da hier die gewöhnliche Mundexplosion
allerdings nicht existirt. In Wirklichkeit aber ist diese nicht ohne Ersatz
fortgefallen, sondern durch die nasale Explosion ersetzt. — Für die
Unterscheidung der einzelnen ‘Nasenstosslaute’ kommt uns übrigens
selbstverständlich wieder der specifische Vocalausgang nebst dem folgenden
Nasal zu Hülfe ; vgl. oben S. 133.
Ausser den zuletzt geschilderten wesentlicheren Assimilationen
kommen gelegentlich noch andere, weniger belangreiche
vor. namentlich wenn Verschlusslaut und Spirans nicht
ganz homorgan sind. So pflegen wir bei fp und pf das p labiodental
zu bilden ; beim t von tš legt sich die Zunge oft seitlich
stärker an den Gaumen an als beim isolirten t, und bekommt
überhaupt eine stärkere dorsale Wölbung u. dgl. mehr.
Ueberall zeigt sich dasselbe Bestreben, möglichst vollkommene
Homorganität herzustellen, welches so vielfache Assimilationen
hervorgerufen hat.
Auch beim Zusammentreffen zweier Dauerlaute kommt
das Gesetz von der nur einmaligen Ausführung gemeinschaftlicher
Articulationsfactoren wieder zur Geltung ; man vgl. also
Lautfolgen wie mw, mf,ns, nš, &x und umgekehrt. Die einzelnen
Fälle bedürfen keiner weiteren Ausführung.139
§ 23. Gleichzeitige Bildung verschiedener specifischer
Articulationen.
(Einwirkungen von Vocalen auf Consonanten etc.)
Die Verbindung eines beliebigen Consonanten mit einem
folgenden Vocale kann im Wesentlichen auf zweierlei Weise
geschehen : entweder articulirt man von der Indifferenzlage
ausgehend den Consonanten unbekümmert um den Vocal.
d. h. so, dass eben nur die Theile des Sprachorgans aus der
Indifferenzlage entfernt werden welche an der Bildung der
specifischen Articulation des Consonanten nothwendig betheiligt
sind ; oder man nimmt von Anfang an dergestalt auf
den Vocal Rücksicht, dass die bei der Articulation des Consonanten
nicht beschäftigten Theile des Sprachorgans so eingestellt
werden, wie es der Vocal verlangt. Ein Beispiel mag
dies erläutern.
Die Silbe mi wird nach der ersten Weise so hervorgebracht,
dass die Lippen sich schliessen, das Gaumensegel gesenkt und
dann der Stimmton eingesetzt wird ; das Produkt dieser Articulation
ist ein m ; hierbei befindet sich die Zunge unthätig
in ihrer Ruhelage, die Lippen sind höchstens ein wenig vorgestreckt.
Der Uebergang zum i wird dann so bewerkstelligt,
dass möglichst gleichzeitig die Gaumenklappe geschlossen,
die Lippen geöffnet und die Zunge in die i-Stellung geführt
wird ; soll das i mit stark activen Lippen gebildet werden, so
müssen auch die Lippen noch in demselben Momente spaltformig
erweitert werden.
Hierbei drängen sich in den einen Uebergangsmoment
drei oder vier Articulationsbewegungen zusammen. Um dies
zu vermeiden, kann man die Zunge bereits während der
Dauer des m, gleichzeitig mit dessen Einsatz, zur i-Stellung
erheben und auch die Lippen können sich neben dem Verschlüsse
auch spaltformig erweitern, ohne dass dem m seine
Eigenschaft als labialer Nasal genommen wird ; dann bleiben
für den Uebergangsmoment nur zwei Articulationsbewegungen
übrig.
Aehnlich kann man z. B. bei ku die Vorstülpung und ringförmige
Contraction der Lippen, welche das u erfordert, je
nach Willkür erst im Uebergangsmomente oder bereits bei
oder vor dem Einsatze des k vornehmen.
Hier ist also die specifische Organstellung für das i oder u
140bereits gleichzeitig mit der specinschen Articulationsstellung
des m oder k gebildet worden, oder, mit andern Worten, es
hat eine Vorausnahme einer specifischen Articulation
stattgefunden. Wäre die Lautfolge eine umgekehrte,
so würde von einer Beibehaltung der specifischen Articulation
zu reden sein.
Es ist klar, dass durch die Vorausnähme der specifischen
i- und u-Articulation ein engerer Anschluss der beiden Laute
(m und i. k und u) erzeugt wird, weil dabei die Reihe der
Uebergangslaute möglichst abgekürzt erscheint. Am meisten
wird natürlich der Unterschied der beiden Bildungsweisen bei
den Vocalen mit energischer Lippen- und Zungenthätigkeit
hervortreten müssen, denn bei diesen sind die sonst erst im
Uebergangsmomente auszuführenden Bewegungen so gross
und so zeitraubend, auch so schwer ganz isochron zu halten,
dass nothwendig die Zwischenlaute sich störend bemerkbar
machen müssten. Natürlich stehn unter diesen ‘möglichst
vollkommenen’ Vocalen die äussersten i1 und u1 unserer Vocaltafel
voran. Weniger empfindlich sind die weiteren und die
ohne energische Lippenbetheiligung gebildeten Vocale.
Was nun die Einwirkung der Vorausnahme der Vocalarticulation
auf den vorhergehenden Consonanten betrifft,
so wird zunächst der specifische Klang desselben jedesmal eine
kleine Modification erfahren, welche das Resultat der Resonanzwirkung
des dem folgenden Vocale eigenthümlichen Resonanzraumes
ist. Dieser Unterschied tritt nach Massgabe
von § 4. Anm. 7 bei tönenden (sei es Sonoren oder Halbsonoren)
am deutlichsten hervor, aber auch die tonlosen Spiranten
und selbst die Explosionsgeräusche werden mehr oder weniger
afficirt. Es gibt also streng genommen eben soviel verschiedene
Consonantnüancen als Vocalnüancen in einer Sprache
vorhanden sind (man spreche sich zur Verdeutlichung ama,
eme, imi u. s. f. mit lang ausgehaltenem m, oder pa, pe, pi
u. dgl., die letzten am besten flüsternd vor). Wir bezeichnen
diese Nuancen durch einen übergesetzten kleinen Vocalexponenten
bei isolirtem, durch ein - bei dem mit dem entsprechenden
Vocal verbundenen Consonanten ; ru, ri bedeuten
also ein mit Vorausnahme der u-, resp. i-Articulation gebildetes
r, wie es auch in den Verbindungen ru, ri gesprochen
wird.
Unter den hierher fallenden Erscheinungen treten namentlich
zwei, die Wirkungen i- und u-ähnlicher Vocale hervor,
141die man mit dem Namen der Mouillirung und der Labialisirung
oder Rundung zu bezeichnen pflegt.
1. Die Mouillirung (Palatalisirung).
Unter Mouillirung oder Palatalisirung versteht
man gemeinhin die Veränderung, welche ein beliebiger Consonant
durch die Vorausnahme der Mundarticulation eines i
oder j (s. unten) erfährt, d. h. durch eine dem i entsprechende
dorsale Erhebung der Vorderzunge und eventuell
spaltförmige Erweiterung der Lippen, mögen nun die letzteren
geöffnet oder geschlossen sein.
Ein solcher mouillirter Consonant ist selbstverständlich
ein ebenso einheitlicher Laut als jeder beliebige nicht mouillirte.
Als sichere Beispiele können namentlich die Consonanten
vieler slavischen Sprachen vor (ursprünglichem) i, j
dienen, z. B. russ. Jtumb lit, hukwio nikto, poln. n, s ; aus dem
Gebiet der romanischen Sprachen fallen hierher das franz. gn
(S. 93), ital. gl, gn, span. ll, ñ. portug. lh, nh (deren Mouillirung
ich früher fälschlich bezweifelte, vgl. Stonn S. 47) ;
unter den deutschen Mundarten sind namentlich die siebenbürgischen
reich an mouillirten Lauten. Dauerlaute dieser
Art lassen sich selbstverständlich beliebig lange aushalten,
ohne dass man in ein j übergeht oder die Mouillirung des
Consonanten aufgibt (Brücke tS. 71) : bei den zahlreichen auslautenden
Hb, Ah, cb des Russischen, oder den n, l, s des Polnischen
ist denn auch nicht die geringste Veränderung der
Articulation während der Dauer des Lautes wahrzunehmen.
Ebensowenig ist etwa bei russ. poln. pi, ti, ki oder bi, di, gi
von einem j zwischen dem Verschlusslaut und dem i die Rede
(doch vgl. gleich unten), und doch unterscheiden sich diese
p, t, k ganz deutlich schon durch die Farbe ihres Explosionsgeräusches
von denen in pa, ta, ka.
Treten mouillirte Laute vor einen andern Vocal als i, so
macht sich natürlich der Uebergang von der i-Stellung des
Consonanten zu der des folgenden Vocales mehr oder weniger
für das Gehör geltend, und dieser Uebergang macht uns Deutschen,
die wir grossentheils nur indifferente Consonantenverbindungen
oder doch nur Verbindungen mit Vocalen gleicher
Articulation kennen, den Eindruck eines eingeschobenen j,
und in unserer Schulaussprache pflegen wir auch gewöhnlich
ein wirkliches i dem mouillirten Consonanten anzuhängen.
142Dies ist aber durchaus falsch ; der Mangel eines solchen i-ähnlichen
Uebergangslautes im Auslaut beweist deutlich, dass
derselbe kein integrirender Bestandtheil eines mouillirten
Lautes an sich ist. Da es sich nur um einen momentanen
Uebergang von der i-Stellung aus handelt, könnte man höchstens
von einem reducirten i reden (§ 24, 2). — Dass irgendwo
wirkliche Verbindungen von mouillirtem Laut und i vorkommen
können, ist damit natürlich nicht geläugnet.
Steht ein anderer Vocal als i vor einem mouillirten Consonanten.
so kann der Uebergang zu der i-Stellung des letzteren
in ähnlicher Weise den Eindruck hervorrufen, als klinge
dem Consonanten ein leises i vor, das sich mit dem vorausgehenden
Vocale diphthongisch verbinden kann. Natürlich
kann aber ein wirkliches i von messbarer Dauer erst dann entstehen,
wenn die specifische Articulation des Consonanten
nicht gleichzeitig mit der i-Einstellung desselben, sondern
erst nach dieser gebildet wird (vgl. unten § 43 über die Epenthesen).
Anm. 1. Ob man die Mouillirung genauer als Vorausnahme einer i-oder
einer i-Articulation bezeichnen müsse ist schwer zu entscheiden.
Mir scheint es als ob die mouillirten Laute oft enger gebildet würden als
die i, ich glaube z. B. in Verbindungen wie ung. nyilik bisweilen auch den
i-ähnlichen Uebergang zu hören, was stärkere Engenbildung voraussetzt
(vgl. die Bemerkung S. 124 über ji).
Was die Einwirkung der Mouillirung auf die
specifischen Articulationen der Consonanten betrifft,
so findet bei Labialen eine Störung derselben nicht statt, da
hier die specifische Articulation durch die Lippen, die Mouillirung
durch die Zunge ausgeführt wird. Bei allen Zungengaumenlauten
aber muss ein Compromiss zwischen den beiden
sich kreuzenden Articulationen eintreten, welcher bei Lauten,
deren Zungenarticulation der des i conträr ist, mehr oder weniger
eine Veränderung der Articulationsweise, namentlich
oft die Verlegung der Articulationsstelle involvirt. So sind
z. B. die eigentlichen Gutturale (S. 53 f.) der Mouillirung
nicht fähig, weil bei ihnen die Hinterzunge so nach hinten
und oben gezogen ist, dass die Vorderzunge sich nicht mehr
genügend der i-Stellung nähern kann. Soll also Mouillirung
eintreten, so muss ihre Articulationsstelle nach dem harten
Gaumen vorgeschoben werden, d. h. an die Stelle des eigentlichen
Gutturals muss ein Palatal (s. S. 53) treten. Von den
sog. Dentalen widerstreben die cerebralen und coronal-alveolaren
143einigermassen der Mouillirung (wenigstens was die
Zungenstellung betrifft), dagegen sind die dorsalen ganz besonders
für sie geeignet (so namentlich auch das dorsale helle
l, s. S. 91 f.). Uebrigens ergeben sich die einzelnen Abweichungen
der Articulation mouillirter Consonanten von der der
indifferenten leicht durch einfaches Probiren.
Charakteristisch ist für alle mouillirten Laute die Engenbildung
zwischen der Vorderzunge und dem harten Gaumen.
Sprachgeschichtlich gewinnt dieselbe noch eine besondere Bedeutung
dadurch, dass sie bei Verschlusslauten auch als
Schallerzeugerin auftreten kann, und zwar geschieht dies um
so eher, je grösser die Exspirationsstärke und die exspirirte
Luftmenge ist. Wenn nämlich der Uebergang vom Verschluss
zum folgenden Vocal nicht ganz schnell und mit vollkommen
genauer Regulirung der Exspiration vorgenommen
wird, so heftet sich an das Explosionsgeräusch noch ein entsprechendes
Reibungsgeräusch an, das nach tönenden Explosivlauten
natürlich tönend, nach tonlosen tonlos ist ; man vgl.
Worte wie russ. öpaTt = brati, iiät-b = piüti oder lit. reik für
reikia u. s. w. Diese Reibungsgeräusche ähneln wohl einem
palatalen x (d. h. dem tonlosen Correspondenten unseres spirantischen
j), doch sind sie keineswegs ohne Weiteres mit
ihm identisch. In den angeführten Beispielen ist das Geräusch
bei k ein ganz anderes, weiter rückwärts gebildetes als bei t,
ausserdem haben die Geräusche meist stärkere Engenbildung
als die / (s.Anm.), und weichen vielfach nach der Seite mouillirter
s und š-Laute ab (z. B. im poln. wird c aus altem und russ.
tl = ti. dz aus ab = di). Es ist hier sehr schwer eine Grenze
zu ziehen, bei der einfacher mouillirter Explosivlaut aufhört
und mouillirte Affricata beginnt. Jedenfalls ist aber zu beachten,
dass die einfache mouillirte ‘Affricata’ dieser Axt ursprünglich
nicht Position bildet, wie etwa unsere aus Geminaten
entsprungenen inlautenden pf, ts u. dgl., dass sie vielmehr
den Aspiraten p, t, k zu coordiniren ist.
2. Die Labialisirung oder Rundung.
Beim u ist die Thätigkeit der Lippen von grösserer Bedeutung
als beim i, und die Einwirkung des u auf vorhergehende
Consonanten besteht denn auch wesentlich in der Vorausnahme
der Rundung (und Vorstülpung) der Lippen. Man
kann daher diesen Vorgang wohl mit dem Namen der Labialisirung
144oder Rundung bezeichnen. Nur die Gutturale
zeigen auch bezüglich der Zungenstellung eine natürliche
Verwandtschaft mit dem u, wie die Palatale und dorsalen
cf-Laute mit dem i. Bei den Labialen ist auch die Zungenarticulation
ganz freigegeben.
Im Ganzen verhält sich die Labialisirung der Mouillirung
analog. Weil aber die Engenbildungen an den Lippen hier
nicht so beträchtlich sind, so kommen auffallendere Reibungsgeräusche
nicht so leicht zu Stande, oder sie werden von uns
nicht als besondere Consonanten empfunden, zumal wir keine
rein labialen Spiranten (ausser dem gewöhnlich reducirt gesprochenen
w) zu kennen pflegen : doch vgl. man z. B. dän.
kun, pund, tunge ; bei ihnen erfährt der Hauch der anlautenden
Aspirata deutlich eine Modification durch die Reibung an
den Lippenrändern.
Dass Labialisirung nicht gerade oft vor andern Vocalen
als u vorkommt, liegt wohl nur daran, dass Lautfolgen wie
ua in den indogerm. Sprachen von Anfang an viel seltner als
ia u. dgl. vorhanden gewesen sind. Am ehesten ist sie noch
bei Gutturalen vorauszusetzen, welche oft durch zeitliche
Verschiebung der Uebergangsbewegung geradezu einen wirklichen
Halbvocal u aus sich entwickelt haben (lat. qu, germ.
hv aus indogerm. k).
Auch eine Verbindung von Labialisirung mit
Mouillirung kommt gelegentlich vor ü vor, z. B. in dän.
tyve, pynte, kyst ; doch ist die Mouillirung, d. h. die Hebung
der Vorderzunge, eine nicht so ausgesprochene wie bei folgendem
reinem i.
Historisch betrachtet ist der Eintritt der Mouillirung oder
Labialisirung in weitaus den meisten Fällen, so wie wir im
vorhergehenden auch angenommen haben, durch die Nachfolge
eines i, resp. u bedingt gewesen, weil wirklich isolirt
auslautende Verbindungen von i, u + Consonant nur sehr
spärlich vorkommen konnten, bei inlautenden Verbindungen
der Art der Consonant in der Regel als Anlaut zur folgenden
Silbe gezogen und damit dem Einflüsse von deren Vocal unterworfen
wurde. So treten denn beide Erscheinungen nach
einem i, u erst verhältnissmässig spät und vereinzelt auf.
Einigermassen verbreitet sind fast nur die Uebergänge von
Gutturalen nach einem i in Palatale (und weiterhin in Affricaten ;
145so z. B. altenglisch ich aus ags. ic, which aus hwylc
für hwi-lic u. dgl.).
Ausserdem ist noch folgendes zu bemerken :
1. Es ist die Möglichkeit der Mouillirung, resp. Labialisirung
durchaus nicht auf einen einzigen Consonanten beschränkt ;
vielmehr nehmen in der Regel sämmtliche dem i. u
silbenanlautend vorausgehende Consonanten daran Theil, und
durch zeitliche Verschiebung können auch Consonanten, welche
die vorhergehende Silbe auslauten, davon ergriffen werden
(Näheres s. z. B. bei Böhtlingk in den Melanges russes II.
26 ff.).
2. Man kann die Ausdrücke Mouillirung und Labialisirung
nicht wohl auf die von i, u ausgehenden Veränderungen allein
beschränken ; denn auch andere diesen Lauten nahestehende
Vocale bringen oft ganz analoge Wirkungen hervor (man vgl.
die häufigen Palatalisirungen von Gutturalen vor e. die Labialisirungen
vor o, ö etc. im Dänischen u. dgl.). Je näher aber
ein Vocal dem äussersten i oder u liegt, um so charakteristischer
tritt natürlich sein Einfluss auf den Klang des Consonanten
hervor und um so eher kann er auch (durch die Engenbildung)
zerstörend auf denselben einwirken.
3. Vorausnahme anderer Articulationen.
Ausser den Articulationen der Vocale können auch die von
andern Sprachlauten in ähnlicher Weise vorausgenommen
werden, wenn eine Combination derselben mit den Articulationen
der Nachbarlaute möglich ist. Dies geschieht namentlich
oft bei der Verbindung von labialen und gutturalen
Verschlusslauten (seltenerSpiranten) mit l, wie pl, bl, (fl),kl,
gl, über die bereits S. 138, Anm. 2 gehandelt ist. Die Verschlusslaute
der Vorderzunge entziehen sich einer solchen
Combination natürlich, an die Stelle derselben tritt die ebenfalls
oben bereits besprochene Verlegung der Explosionsstelle
an die Seitenränder der Zunge. — Andere Fälle der Art sind
die Vorausnahme einer r-Articulation (namentlich der eines
ungerollten), ebenfalls nach labialen und gutturalen Verschlusslauten,
also in Fällen wie pr, br, kr, gr (im Englischen
wie mir scheint ganz gewöhnlich). Vocale können in dieser
Weise modificirt werden durch Hebung der Zungenspitze zur
r-Stellung hin. Nach Sweet S. 53 wird so z. B. das kentische
‘ retracted r’ in sparrow etc. dem vorausgehenden Vocal einr
verleibt,
146also (spai r 4-) d. h. spa} mit Mischung von a mit cerebralem
r. Auch das engl. re in pretty ist oft ein solcher Vocal
mit r-Modification. auch die Verbindungen er, ir, ur in der
amerikanischen Aussprache, wenn ich nicht irre (vgl. oben
S. 85,1, a. (Natürlich ist diese Bezeichnung ‘a mit r-Modification’
a potiori gegeben ; überwöge das r-Element, so wäre vielmehr
von ‘r mit Vorausnahme der a-Stellung’ zu reden). —
Gleichzeitige Bildung eines n und p ist S. 139 berührt worden.
§ 24. Reduction.
Als Reductionen bezeichne ich zusammenfassend eine
Reihe von Veränderungen, welche gewisse Sprachlaute erleiden
können, dergestalt, dass sie wesentliche Eigenthümlichkeiten,
die für ihre Definition mit massgebend waren, in
grösserem oder geringerem Umfange einbüssen, und dadurch
Modificationen erfahren, die in dem Lautsystem selbst noch
nicht vorgesehen waren.
Anm. 1. Nicht alle Schwächungen, Kürzungen etc. von Lauten werden
als Reduction bezeichnet ; z. B. nicht die Kürzung eines langen l zu
kurzem l, weil dem letzteren immer noch die Eigenschaften eines Dauerlautes
bleiben. Wir sprechen erst von einem reducirten l wenn es die
Eigenschaften eines Dauer lautes verliert, s. unten unter 2, von einem reducirten
s, wenn es die Haupteigenschaften eines Spiranten, d. h. das
Reibungsgeräusch verliert, u. dgl. mehr.
Da es sich hierbei um Veränderungen gegebener Laute
handelt, nämlich um Veränderungen der oben im Einzelnen
aufgestellten Normalformen der Einzellaute, so sollten die Reductionen,
streng genommen, erst in dem Abschnitt über
Lautwandel besprochen werden. Indessen liegen doch in den
verschiedensten Sprachen Aussprachsweisen vor, die wir bei
historischer Betrachtung zwar als ‘reducirt’ zu bezeichnen
haben, die aber doch immerhin auch ein empirisch gegebenes
Material sind, dessen Verhältniss zu den aufgestellten Normalformen
bereits hier erläutert werden muss.
Es kommen folgende Hauptformen der Reduction in Betracht :
1. Reduction des Reibungsgeräusches von Spiranten.
Diese Geräuschreduction kann auf zweierlei Weise
geschehen, entweder durch Erweiterung der Enge bei Beibehaltung
147der Exspirationsstärke, oder durch Herabsetzung der
letzteren unter Beibehaltung der Normalenge. Da beide Formen
in praxi schwer auseinander zu halten sind und das Resultat
das gleiche ist, so bezeichnen wir beide durch untergesetztes
. Am gewöhnlichsten ist aber bei tonlosen Spiranten
die Reduction durch Erweiterung der Enge. Aus ihnen
entstehen auf diese Weise Nebenformen, die einen mehr
hauchartigen Charakter haben, indem das eigentliche spirantische
Geräusch so gut wie ganz wegfällt. Man könnte diese
Formen wohl als modificirte h bezeichnen ; so wäre also ein
derart reducirtes s ein h mit s-Modification. Ein solches la-
biodentales f habe ich von einem Papua z. B. in der Ausspräche
des malayischen Zahlworts fueli 8 gehört. Ein postdentales
0 dieser Bildung ist das S. 100 besprochene chilenische
6 ; und das englische 6 in der nachlässigen Aussprache von
I think als I hink (Sweet S. 39) ; ein s habe ich ebenfalls im
chilenischen Spanisch gefunden, z. B. in esto, welches fast
wie eeto klingt (nach Storm S. 426 ist dies auch die andalusische
Aussprache). Ein stärker supradentales s ist manchmal
der S. 111 erwähnte irische Zischlaut für nachvocalisches t
und das tonlose engl. r nach p, k, z. B. In pride, crow (aber
nach t ist das r wegen der stärkeren Engenbildung deutlicher
spirantisch, s. S. 87). Auch das russ. x (S. 105) gehört vielleicht
als x hierher.
Aus tönenden Spiranten entwickeln sich in ähnlicher
Weise sonore Nebenformen, da bei Wegfall des Reibungsgeräusches
bloss der Stimmton als Lautbildner übrig bleibt.
Hier ist es noch schwerer zu unterscheiden, ob Erweiterung
der Enge, oder Herabsetzung der Exspiration durch vollkommenere
Hemmung im Kehlkopf die Ursache der Reduction
ist. Die Reduction tönender Spiranten ist aber viel häufiger
als die tonloser, vermuthlich weil in denselben das Reibungsgeräusch
an sich durch die Hemmung im Kehlkopf schwächer
ist als das der tonlosen ; denn es lässt sich überhaupt beobachten,
dass, je schwächer das Reibungsgeräusch eines Spiranten
ist, um so öfter derselbe reducirt wird. So ist das mitteldeutsche
bilabiale w wohl stets geräuschlos, also w, so lange
man es auch aushält. Eben so leicht ist labiodentales v zu
148bilden : ð ist im Englischen gewöhnlich statt ð (man vergleiche
des Contrastes halber z. B. das deutlich spirantische
neugriech. δ), und auch das gehauchte span. d ist wohl sicher
als ð anzusetzen. Sehr verbreitet ist endlich Ʒ, z. B. als Vertreter
des deutschen uvularen r (S. 88), auch als Sonant, z. B.
in Formen wie Diener, lieferte, Lieferung, oft gesprochen
di-nz, li-fz-te, li-fz-zun (das z im letzten Worte halb Sonant,
halb Consonant). Seltener sind reducirte s, š, offenbar weil
diese unter allen Spiranten die schärfsten Reibungsgeräusche
haben ; ein Beispiel eines dorsalen z ist das dänische ‘weiche
d’ z. B. in lade, gade.
Anm. 2. Es ist klar, dass man bei schematischer Darstellung z. B.
auch die sonoren r, l, ja selbst Vocale wie i, u als Reductionen spirantischer
r, l, j, w auffassen kann (vgl. die Ausführungen von Hoffory über die
sonoren l als ‘unvollkommen gebildete Spiranten’, Zeitschr. f. vgl. Sprachf.
XXIII, 537 ff. und Sweet S. 51.) Die reducirte Spirans j fällt selbstverständlich
mit dem Halbvocal i zusammen, da sie ja im Wesentlichen nur
durch den spirantischen Charakter des j geschieden werden. Man kann
ebenso auch ð, z etc., sobald sie sonantisch gebraucht werden, unter die
‘Vocale’ einrechnen, namentlich kommen die verschiedenen Modificationen
der gutturalen und palatalen Spiranten den Vocalen sehr nahe und können
durch noch stärkere Erweiterung geradezu in diese übergehen. Sweet
S. 53 stellt nach Bell's und eigenen Beobachtungen folgende Entsprechungstabelle
auf (durch 1 bezeichne ich seine ‘innere’, durch 3 die ‘äussere’
Varietät, durch 2 die mittlere Normalarticulation :
tableau ungerundet | gerundet
Reducirtes 5 hat nach Sweet den Klang eines dentalen r-Vocals, z den
eines stark vorgeschobenen el, z den eines eben solchen e1 mit einer Beimischung
von r-Klang, etc.
Anm. 3. Wäre es sicher, dass überall nur Engenerweiterung bei dem
Verluste der Reibegeräusche im Spiele wäre, so könnte man im Anschluss an
die zuerst von Sweet auch auf die Consonanten angewandte Unterscheidung
von ‘eng’ und ‘weit’ die reducirten Spiranten als überweite bezeichnen.
In ähnlicher Weise bemerkt Genetz, Einführ. 6 ff., dass man
an jeder Articulationsstelle erzeugen könne einen Verschlusslaut, eine
Spirans und einen Halbvocal ; unter den letzteren versteht er eben das,
was wir oben als Spiranten mit Geräuschreduction bezeichnet haben. Nach
ihm fallen lapp, gh (oder durchstrichenes g), et und finn. d hierher.
Anm. 4. Reductionen der Geräusche von Verschlusslauten im
eigentlichen Sinne können nicht stattfinden, da sonst der Charakter dieser
Laute als Verschlusslaute verloren ginge. Doch findet sich bei den tönen-
149den Medien eine Erscheinung, welche der Geräuschreduction tönender
Spiranten durch starke Kehlkopfhemmung analog ist. Es kann nämlich
der Exspirationsdruck der Medien so herabgesetzt werden, dass gegenüber
dem gleichzeitigen Stimmton der Einsatz oder Absatz des Verschlusses
wenig zur Geltung kommt ; man hört hauptsächlich nur den tönenden
Gleitlaut zur Media hin oder von ihr zum folgenden Laute. Dies ist der
Punkt wo sich tönende Spirans und tönender Verschlusslaut berühren.
Die Gleitlaute zu oder von ihnen sind ja so gut wie identisch, z. B. bei
postdentalem 8 oder d, oder 5 und g. Es kommt nur auf den kurzen Moment
der Einhaltung der Stellung an. Wird die tönende Spirans zum
Gleitlaut reducirt, s. unten unter 2, und kommt der Akt des Verschlusses
und der Oeffnung der Media nicht zu deutlicher Wahrnehmung, so bleibt es
oft zweifelhaft, ob in dem Culminationspunkt der Articulation nur eine
starke Engenbildung oder eine völlige Berührung stattgefunden hat.
2. Reduction von Dauerlauten zu Gleitlauten.
Diese trifft am häufigsten sonore Consonanten vor
andern sonoren Lauten. Wir bezeichnen sie durch untergesetztes
o ; z. B. ia, ua, la, ra, ma, na. Sie entsteht dadurch,
dass der Stimmton erst in dem Momente einsetzt, wo
der Uebergang zum folgenden Laut bereits beginnt, also bei
ia, la z B. erst dann, wenn sich die Zunge aus der specifischen
i- oder l-Stellung zu entfernen beginnt. Es entstehen
dann also nicht volle i, l etc. sondern nur die Gleitlaute der
Uebergangsbewegung von i, l zum folgenden Vocal, die man
bei dauernder Aussprache von i, l überhörte, die aber jetzt,
wo sie isolirt dem Vocale vorausgehn, deutlich vernommen
werden und den Eindruck eines dem Anfang der Uebergangslaute
entsprechenden Lautes, also hier i, l hervorrufen.
Mit den sonoren Consonanten stehen natürlich auf einer
Stufe die durch Geräuschreduction entstandenen Nebenformen
der tönenden Spiranten (oben unter 1). Wir bezeichnen
deren zeitliche Reduction durch Verbindung der beiden Zeichen ,
und o zu s. So ist z. B. w die in Mitteldeutschland
übliche Aussprache des anlautenden bilabialen w. Entsprechendes
labiodentales v findet sich öfter in Oberdeutschland
und der Schweiz, s. Winteler S. 30 f., auch wohl in Norddeutschland,
aber z. B. wohl nicht im Anlaut des Englischen.
Das Japan, v scheint mir ebenfalls hierher zu gehören, es ist
besonders schwach und sehr weit gebildet. Als 6 fasse ich
auch die so oft besprochene Aussprache des anlautenden engl.
weichen th, bei deren Auffassung das ungeübte Ohr leicht
zwischen Spirans und Verschlusslaut schwankt. Das deutsehe
1505 für uvulares r wird im Anlaut auch meist als £ gesprochen.
Sonore Gleitlaute können auch sonantisch auftreten
(Sweet's einfacher voice-glide). Derartig sind viele der unbetonten
deutschen e, namentlich aber auch oft die unbetonten
englischen Vocale, z. B. das a von against, das o und er von
together. Hier tönt die Stimme während des Uebergangs von
der Indifferenzlage zum g, resp. von dem t zum g u. s. w.,
eine bestimmte Vocalstellung wird gar nicht eingehalten,
daher denn auch das entstehende Lautproduct keine besondere
Verwandtschaft mit einem bestimmten Vocale hat. am
meisten ähnelt es noch dem e1 oder œ (Sweet S. 66). Wir
bezeichnen diesen Laut im Anschluss an Sweet's a (umgekehrtes
v, für voice) durch a. d. h. unbestimmter Gleitvocal ;
die specielle Qualität wird durch die Nachbarschaft bestimmt.
Auch Diphthonge können in ähnlicher Weise reducirt
werden, indem nur der Gleitlaut zwischen beiden Componenten
erzeugt wird. Reducirte Diphthonge haben in Folge
dessen nur die Zeitdauer gewöhnlicher kurzer Vocale. Sie
treten oft in Folge von Accentschwächungen statt ‘langer’
Diphthonge auf, aber sie erscheinen auch als ‘kurze Diphthonge’
oder ‘Brechungen’ an Stelle betonter kurzer
Vocale, z. B. in den westfälischen Mundarten (wahrscheinlich
gehören auch die ags. kurzen ea, eo, altn. ia, iq hierher).
Anm. 5. Es ist im Englischen oft schwer zu unterscheiden, ob wirklich
noch ein voice-glide als selbständiger Laut gesprochen wird, also ob
nicht z. B. in together die Stimme erst mit oder nach dem g Verschluss
einsetzt. Auch im Deutschen schwankt die Aussprache zwischen Typen
wie hataman und hatman mit silbenbildendem m (= hatte man).
Auch nach andern Lauten erscheinen die Sonorlaute (sowohl
ursprüngliche als durch Geräuschreduction entstandene)
oft als blosse Gleitlaute, vgl. z. B. was oben S. 122 über die
Diphthonge bemerkt ist ; ja man kann vielleicht geradezu behaupten,
dass die gewöhnlich als kurz bezeichneten sonoren
Consonanten gewöhnlich nur Gleitlaute sind, indem
die eigentliche Stellung für den Consonanten gar nicht eine
messbare Zeit hindurch eingehalten wird. Die Grenze ist
hier, wie Sweet S. 62 richtig bemerkt, sehr schwer festzustellen.
Ob die Reduction zu Gleitlauten auch bei Geräuschlauten,
namentlich auch bei tonlosen Spiranten vorkomme,
151ist schwer auszumachen. Sweet bemerkt S. 63, dass
überhaupt anlautende Consonanten dazu neigen zu blossen
Gleitlauten zu werden, z. B. auch s in sa, wo die Stellung
für den Consonanten auch nur momentan ist. Indessen ist
hier die Sachlage doch etwas abweichend, da man auf jeden
Fall ein spirantisches Geräusch von messbarer Länge hört.
Eher liesse sich von einer deutlichen Reduction zu Gleitlauten
bei den Spiranten mit Geräuschreduction reden. Auch das h
schwankt zwischen Dauerlaut mit fester Position und Gleitlaut
(Sweet a. a. O.).
3. Reduction tönender Laute zu tonlosen
(Stimmreduction).
Da wir in dem oben vorgeführten Lautsystem bereits eine
besondere Gruppe tonloser Laute neben den tönenden aufgestellt
haben, so wäre hier von einer Reduction tönender Laute
zu tonlosen nicht weiter zu reden, vielmehr handelte es sich
dabei um den Uebergang aus einer Lautclasse in eine andere
bereits im System vorgesehene. Indessen lässt sich, wenn
man die historischen Verhältnisse zwischen gewissen tönenden
und tonlosen Lauten ins Auge fasst, doch nicht läugnen,
dass der Verlust des Stimmtones auch als eine Art Reduction
betrachtet werden kann. Statt dass nämlich der Stimmton
während der Einhaltung der specifischen Articulation eines
Lautes erzeugt würde, setzt er erst mit dem Momente ein,
wo der Rückgang von der Articulationsstellung beginnt, oder
er setzt aus in dem Momente, wo dieselbe erreicht wird. Der
Stimmton ist also durch das Aussetzen während der Einhaltung
der Articulationsstellung reducirt zu einem Gleitlaut, der
entweder dem tonlos gewordenen Consonanten folgt, oder
ihm vorausgeht, oder beides. Steht gar kein tönender Laut
in der Nachbarschaft, so kann der Stimmton sogar ganz fortfallen.
So ist z. B. der Uebergang von dem tonlosen n in isl.
hniga, vatna tönend,, ebenso der Uebergang von i zu tonlosem
l in engl. felt, dagegen entbehrt das isl. tonlose n in vatn
gänzlich des Stimmtones. Wir wollen diese Art der Reduction
durch untergesetztes v bezeichnen. So wären die tonlosen
Nasale, falls sie als Entwickelungsproducte tönender Nasale gefasst
werden, als m, n, td zu bezeichnen, tonlose l, r als l. r,
die h endlich, die wir S. 81 als tonlose Vocale fassten, je152nach dem Nachbarvocal als aa, ee, ii etc. Ist der so reducirte
Laut zugleich nur Gleitlaut, so ergibt sich zur Bezeichnung
einfach die Combination s ; also wäre ha meist streng genommen
gleich aa etc.
Wahrscheinlich sind, wenn wir den historischen Verlauf
der Entwickelung betonen wollen, unter anderm auch die sog.
tonlosen Mediae durch eine Stimmtonreduction aus tönenden
hervorgegangen, wie unabhängig von einander Storm
S. 40 f. und Hoffory, Zs. f. vgl. Sprachf.XXV, 419 ff. erkannt
haben (doch hätte Hoffory, der sonst historischen Erwägungen
keinen Einfluss auf die Gestaltung des Lautsystems einräumen
will, gerade den Ausdruck ‘reducirte Medien’ vermeiden
müssen ; gerade von seinem absoluten Standpunkte aus
dürfte er, da er die ‘tonlosen Medien’ als Nebenart der Medien,
nicht der Tenues anerkennt, die erstgenannten eben
nur mit dem Namen ‘tonloser Medien’ belegen). Diese Auffassung
stimmt gut zu der von Sweet, welcher die tonlosen
Mediae als Mediae mit tönendem Absatz (half-voiced stops,
d. h. stops mit voiced glide) bezeichnet (oben S. 132). Eigenthümlich
ist diesen tonlosen oder reducirten Medien, wie bereits
öfter hervorgehoben, der geringere Explosionsdruck der
tönenden Mediae im Gegensatz zu den Tenues ; es ist eben
keine andere Veränderung eingetreten als der Wegfall des
Stimmtones während der Dauer des Verschlusses. Wenn sich
also hier der Charakter des b, d etc. als tonloser Lenes durch
ihren Ursprung aus Reduction erklärt, so darf man dieselbe
Erklärung auch vielleicht zum Theil auf tonlose spirantische
Lenes anwenden ; es ergäbe sich also folgende
Reihe : z tönende Lenis (Lenis wegen der Hemmung im
Kehlkopf, falls nicht eine besondere Verstärkung etwa dazutritt),
z tonlose Lenis (durch Reduction), s tonlose Fortis.
Natürlich ist damit nicht gesagt, dass nicht auch andere tonlose
Lenes durch Verminderung der Intensität aus Fortes
hervorgegangen sein könnten.
4. Von einer Reduction der Intensität können wir
nach der oben S. 147 gegebenen Definition des Begriffes der
Reduction nicht wohl reden. Intensitätsreduction wäre gleich
Aufhören der Intensität überhaupt. Ueber die Schwankungen
in der Intensität wird die Accentlehre Näheres bringen.153
Vom Bau der Silben, Worte und Sätze.
§ 25. Allgemeineres.
Die bisher geschilderten Vorbedingungen genügen noch
durchaus nicht, um eine Reihe neben einander gestellter Laute
zu einer Silbe ; eine solche Reihe von Silben zu einem Worte,
oder eine Reihe von Worten zu einem Satze zu machen. Der
Unterschied einer blossen Laut-, Silben- oder Wortreihe von
einer wirklichen Silbe, einem Worte oder Satze wird demjenigen
sofort klarwerden, der etwa Gelegenheit hat. eine
Sprechmaschine zu beobachten, die im Grossen und Ganzen
wohl nur Producte der ersteren Art zu liefern vermag. Man
erkennt auch sonst leicht, dass Producte der zweiten Art erst
entstehen durch die Unterordnung eines oder mehrerer Glieder
der Reihe untere andere Glieder und durch das ganz bestimmte
Verhältniss der verschiedenen Stufen der Unterordnung
unter einander. So ordnen sich, wir wir schon oben
S. 2 7 ff. sahen, die etwaigen Consonanten der Silbe ihrem Sonanten
unter ; jedes mehrsilbige Wort hat mindestens eine
höher oder stärker betonte Silbe (Tonsilbe) : den Satz endlich
charakterisirt der eigenthümliche Rhythmus, den er durch
die Unterordnung der zum Ausdrucke weniger gewichtiger
Begriffe dienenden Wörter unter die gewichtigeren erhält.
Bis zu einem gewissen Grade sind also die Verhältnisse der
Einzeltheile in den drei hier aufgeführten verschiedenen Arten
von Lautcomplexen einander analog : sie bilden die Grundlage
der Lehre von der Bildung der Silben, Worte und Sätze.
In der Lehre von der Silbenbildung wird, wie bereits
angedeutet, zunächst nach den Bedingungen zu fragen sein,
unter denen Laute zu einer Silbe zusammentreten können.
Es ergibt sich dabei als massgebend das Princip der Abstufung
der natürlichen Schallfülle (§ 26). Demnächst
wird die von dem Gange der Exspiration abhängige relative
Intensität der einzelnen Silbenglieder (§ 27) und die Quantität
derselben (§ 28) zu erörtern sein. § 29 handelt sodann
über die verschiedenen Formen der Exspirationsbewegung in
den Silben oder den exspiratorischen Silbenaccent,
woran sich in § 30 eine Erörterung über die Tonverhältnisse
der Silbe oder den tonischen Silbenaccent anschliesst.
154Einen Uebergang zur Wort- und Satzbildung enthält endlich
§ 31, der über die Silbentrennung handelt.
Wort- und Satzbildung sind vom phonetischen Standpunkte
aus kaum, wenn überhaupt, zu trennen. Die Aufgabe
dieses Abschnittes ist es, Wort und Satz und die Abstufung
ihrer einzelnen Theile (Silben, Takte) nach Intensität (§ 33),
Quantität (§ 35) und tonischen Verhältnissen (§ 34)
zu untersuchen.
Die Abstufung eines Satzes nach Intensität und Tonhöhe
seiner Glieder pflegt die Praxis als Accentuirung zusammenzufassen ;
erst die neueren Phonetiker (namentlich die
englischer Forscher) haben auf strenge Scheidung dieser
beiden Elemente hingewiesen. Man muss lernen genau zu
unterscheiden zwischen den willkürlich wechselnden Intensitätsverhältnissen
der einzelnen Theile der Silbe (exspiratorischer
Silbenaccent) und denen der einzelnen Silben
des Wortes oder Satzes (exspiratorischer oder emphatischer
Wort- und Satzaccent), und ebenso zwischen
den Tonverhältnissen der Einzelsilbe (musikalischer Silbenaccent)
und den Tonabstufungen des Wortes oder Satzes
(musikalischer Wort- und Satzaccent). Es ist namentlich
auch darauf zu dringen, dass diese Arten der Accentuirung
auch graphisch genauer unterschieden werden als das
in den überlieferten Accentuationssystemen z. B. des Sanskrit
und des Griechischen nebst den an das letztere sich anschliessenden
Systemen der modernen Sprachen der Fall ist.
Das Sanskrit bezeichnet mit seinem udätta im Allgemeinen
den Wortaccent. d. h. es hebt die höchstbetonte Silbe des
Wortes vor den übrigen hervor, ohne sich um die Art der
Hervorhebung (die Art des Silbenaccentes) zu kümmern (ich
sehe natürlich hier. wo ich von der Bezeichnung spreche,
gänzlich von den Theorien der Grammatiker ab), und doch
versuchtes auch den Satzaccent auszudrücken, indem es
dem Verbum finitum des einfachen erzählenden Satzes den
udätta raubt, ohne dass es glaublich erscheint, dass nun das
Wort überhaupt keine Tonsilbe mehr gehabt habe. Im Griechischen
finden wir Ansätze zur Unterscheidung der Arten
des Silbenaccents in dem Gebrauch des Acut und des
Circumflex ; dieselben Zeichen aber dienen zugleich dazu, im
einzelnen Falle den Wortaccent anzuzeigen, und der Gravis
ist eine Concession an die Forderungen des Satzaccentes !
155Dass bei einer verbesserten Bezeichnung die Zeichen
der drei verschiedenen Accente in der Regel auf denselben
Laut zu stehen kommen würden, darf dabei nicht irren, denn
es liegt in der Natur der Sache selbst, dass der Laut, der an
und für sich am meisten in seiner Silbe hervortritt, auch in
der Tonsilbe des mehrsilbigen Wortes, namentlich wenn
dieses auch noch den Satzaccent trägt, ganz besonders hervortreten
muss.
§ 26. Der Bau der Silbe im Allgemeinen und die relative
Schallfülle ihrer einzelnen Laute.
Unter den vielen verschiedenen Definitionen des Begriffes
‘Silbe’ halte ich mit einigen Einschränkungen immer noch
diejenige für die praktisch am besten verwerthbare, welche
sagt, dass unter ‘Silbe’ eine Lautmasse zu verstehn
sei, welche mit einem selbständigen, continuirlichen
Exspirationshub hervorgebracht werde. Damit
diese Laute aber wirklich als eine Einheit wahrgenommen
werden, müssen, sobald die Silbe aus mehr als einem Laute
besteht, sämmtliche übrige Laute in einem von ihrer natürlichen
Klangfülle wie von der natürlichen Art der Exspirationsbewegung
(s. § 27) abhängigen Verhältnisse einem einzigen
Laute untergeordnet werden. Dieser letztere Laut heisst
der Sonant der Silbe, die übrigen die Consonanten derselben
(s. S. 27 ff.).
Hieraus lassen sich bereits die beiden wesentlichsten Gesetze
des Silbenbaues ableiten :
1. Die Fähigkeit, Sonant zu werden, hängt bei jedem Laute
von seiner natürlichen Schallfülle ab, so dass beim Zusammentreffen
mehrerer Laute jedesmal derjenige als Sonant fungiren
muss, welcher an und für sich die grösste Schallfülle besitzt.
Nur Laute, welche auf gleicher Stufe der Schallfülle stehen.
können abwechselnd Sonanten oder Consonanten sein.
2. Ein ähnliches Verhältniss gilt für die Consonanten unter
einander : je näher dem Sonanten, um so grösser muss die
natürliche Schallfülle sein. Daher kehrt sich die Reihenfolge
der Consonantclassen, welche einem Sonanten vorausgehen
können, für diejenigen, welche ihm folgen können, einfach
um ; nur dass die Gesetze für den Silbenauslaut strenger als
die für den Anlaut sind.156
Die Schallfülle stuft sich nun im Wesentlichen ab
nach dem Grade, in welchem das musikalische Element der
Sprache, der Stimmton, zur Geltung kommt. Es gehn also
sämmtliche tönende Laute den tonlosen vor.
Voran stehn überall die Vocale, und unter diesen das a,
weil hier bei trichterförmiger Gestalt des Ansatzrohres die
Stimme am ungehindertsten ertönt ; die Schallfülle nimmt ab,
je mehr der Mund geschlossen, d. h. je enger der Vocal gebildet
oder je stärker er gerundet wird. (Beispiele hierzu s.
im Einzelnen bereits S. 122 ff.).
Nächst den Vocalen kommen die Liquiden und Nasale,
die einander gleichwerthig sind, sobald einer der Laute
Sonant, der andere Consonant sein soll (mn, nm, rl, lr, ml,
lm etc.). Sollen beide Consonanten sein, so scheinen die Liquiden
an Schallfülle den Nasalen vorauszustehn, d. h. es
sind Silben wie mlä, mrä und älm, arm möglich, aber nicht
wohl lmä, rmä oder aml, ämr.
Anm. 1. Vocale können vor Liquiden oder Nasalen nur ausnahmsweise
als Consonanten (Halbvocale) erscheinen, nämlich wenn sie besonders
starke Verengungsgrade aufweisen, z. B. i oder stark gerundetes u u. dgl.
(also il, ul, ila, ula etc.) Sie sind ausserdem dann wohl stets zu Gleitlauten
reducirt. Nach Liquiden und Nasalen ist es uns noch schwerer,
Vocale zu Halbvocalen herabzudrücken, da die Reduction zum Gleitlaut
in dieser Stellung nicht so gewöhnlich ist. Am besten gelingen noch Bildungen
mit u, wie alu, einsilbig.
Anm. 2. Unter den Liquiden scheint consonantisches r schallkräftiger
als consonantisches l, daher wohl einsilbig árl, aber nicht álr. Für den
isolirten Silbenanlaut werden sowohl rl wie lr vermieden. — Das relative
Gewicht der Nasale untereinander scheint ziemlich gleich zu sein ; im Ganzen
ist der Zusammenstoss zweier consonantischer Nasale innerhalb einer
Silbe selten, und es scheint dabei nicht sowohl auf ihre Stellung vor oder
nach dem Sonanten anzukommen, als darauf, dass die Uebergangsbewegung
vom ersten auf den zweiten möglichst leicht auszuführen sei ; so sprechen
sich mná, tzná leichter als nmá etc., weil die leicht bewegliche Zungenspitze
rascher zum n einsetzen kann, als die Lippen zum m.
Anm. 3. Die sonoren Nebenformen tönender Spiranten (s. S. 148 f.)
stehen etwa auf gleicher Stufe mit den Liquiden, also 5 parallel mit r etc.
A
Unter den Geräuschlauten gehen die Spiranten den
Explosivlauten vor ; es bilden ebenso tsá, psá einfache
Silben wie ast, asp, wenn wir von der Explosion des
Schlussconsonanten absehen. Denn da mit dem Verschlüsse
der Explosiva nothwendigerweise der Exspirationsstrom
unterbrochen wird, so muss die Explosion mit einem
zweiten Exspirationsstoss erfolgen, d. h. zu einer andern Silbe
157gehören. Kommen also irgendwie Verschlusslaute bei der
Silbenbildung ins Spiel, so kann die Silbe höchstens von der
Explosion des dem Sonanten zunächst vorangehenden bis zum
Verschluss des zunächst folgenden Verschlusslautes dauern.
Noch weniger sind Verbindungen zweier Verschlusslaute im
Silbenanlaut oder -auslaut möglich, ebensowenig wie Verbindungen
von Spirans + Verschlusslaut im Silbenanlaut oder
die umgekehrte Reihenfolge im Silbenauslaut. Wenn wir
trotzdem ptá, ktá. ápt, ákt, spá, stá, áps. áts. ja selbst átst,
átšt, štšá áštš als einfache Silben betrachten, so ignoriren
wir einfach die Existenz der hier von den anlautenden oder
auslautendenConsonantverbindungen gebildeten kleinen Nebensilben,
wegen der geringen Schallfülle der hier auftretenden
tonlosen Geräuschlaute, denen gegenüber die Hauptsilbe
mit ihrem klangvollen Sonanten durchaus dominirt.
Wie viel wir von solchen Nebensilben als Begleiter der
eigentlichen Hauptsilbe dulden, hängt sehr von der Gewohnheit
ab, namentlich entscheidet wieder die grössere oder
geringere Leichtigkeit in der Aufeinanderfolge der Uebergangsbewegungen.
Leicht geduldet werden z. B. Verbindungen,
deren zweites Glied ein Dental ist, wie ptá. ktá, ápt,
ákt, während tpá, tká, átp, átk auffallen. Von auslautenden
Verbindungen von Explosivlaut + Spirans erscheinen die
Affricatae natürlich am leichtesten. Tönende Geräuschlaute
eignen sich wegen ihrer grösseren Schallfülle noch weniger :
man vgl. z. B. zbá, ábz mit spá, áps u. dgl. — Ausführliche
Verzeichnisse von möglichen oder besser gesagt üblichen Combinationen
für Silbenanlaut und -auslaut s. z. B. bei Merkel.
Laletik 266. 274.
Anm. 4. Derartige complicirte Silbenlaute und -auslaute erscheinen
übrigens grossentheils erst in moderneren Sprachperioden durch Ausstossung
von Sonanten (Vocalen) u. dgl., welche ihrerseits die Folge der
energischeren Concentration des ganzen Wortgewichts in der einen Tonsilbe
zu sein pflegt. Je stärker aber diese hervortritt, um so eher können
jene schwach accentuirten Anhängsel angefügt werden, ohne den einheitlichen
Eindruck des Ganzen zu stören. —Für die Sprachgeschichte bleibt
zu erwägen, ob vielleicht die Umstellungen von ursprünglichem sk ; zu ksh
im Sanskrit, zu £ im Griechischen oder von sp zu griech. ip, oder auch der
Vorschlag eines Vocals vor anlautendem s + Consonant (s impurum) in
den romanischen Sprachen etc. mit diesen Silbenanlautsgesetzen in Beziehung
stehn, u. dgl. mehr.158
§ 27. Die relative Intensität der einzelnen Glieder
der Silbe.
Wir haben oben in § 9, 1 Verschiedenheiten der Intensität
als charakteristische Unterscheidungsmerkmale gewisser Lautclassen
(Fortes und Lenes) kennen gelernt. Ausserdem bilden
aber Abstufungen der Intensität auch ein wichtiges Glied in der
Silbenbildung. Denn da die Intensität eines jeden Sprachlautes
von der Kraft abhängt, mit welcher während seiner Bildung
die Luft aus den Lungen ausgetrieben wird, so liegt es auf der
Hand dass die Intensitäten der Laute in den Silben durch die
Art der Gesammtexspiration der Silbe bis zu einem gewissen
Grade bedingt werden. Dies bezieht sich nicht nur
auf die Verhältnisse correspondirender Laute in Silben die
mit verschiedener Stärke gesprochen werden (man vergleiche
z. B. die Verschiedenheit der beiden l und der beiden a in
Silbenfolgen wie lala oder lala ; — übrigens gehört diese Unterscheidung
erst in das Kapitel von der Wort- und Satzbildung),
sondern namentlich auch auf die Exspirationsbewegung
in der Einzelsilbe, d. h. z. B. auf das Verhältniss
der Intensitäten der Laute l und a in Silben wie la
oder al.
Ein jeder Exspirationshub beginnt entweder mit einem
plötzlichen Stoss oder mit allmählich anschwellender Stärke ;
im Ausgang scheint stets ein mehr oder weniger allmähliches
Sinken der Stärke stattzufinden, da die Thätigkeit der Musculatur,
welche die Exspiration bewirkt, nicht so plötzlich
und vollständig aufgehoben werden kann, dass ein ganz plötzlicher
momentaner Abschluss nach Art jenes Eingangsstosses
zu Stande käme. Man kann also sagen, ein jeder Exspirationsstoss
bestehe entweder aus einem Decrescendo, oder aus
einem Crescendo-Eingang und Decrescendo-Ausgang,
also aus (—)> oder <(—)>, wobei der wagrechte Strich die
Zeit andeuten möge, während welcher der Druck ein gleichmassiger
ist.
Da nun, wie sich leicht beobachten lässt, der Sonant der
Silbe stets den Augenblick stärksten Druckes in sich enthalten
muss, so ergiebt sich leicht für die relative Intensität
der einzelnen Laute der Silbe folgender Satz : Auch abgesehen
von der natürlichen Schallfülle der Einzellaute darf die Intensität
eines jeden Consonanten nicht grösser
sein als die des Sonanten der Silbe. Dies lässt sich
159namentlich leicht an den Verbindungen zweier Vocale illustriren :
ui, iu als ‘Diphthonge’ (deren erstes Glied Sonant
ist. § 19, 1, a) und ui, iu als ‘Halbvocal’ + Vocal’ (mit consonantischem
erstem Gliede).
Anm. 1. Dass man nicht alle Lautfolgen derart umkehren kann ohne
die Einsilbigkeit zu stören, dass man also z. B. al, la als einsilbig, aber
al, la eher als zweisilbig auffasst, liegt darin dass die natürliche Schallfülle
des l so viel geringer ist als die des a.
Für die Einzellaute ergiebt sich weiter, dass jeder entweder
mit gleichmässiger oder zunehmender oder
abnehmender Stärke hervorgebracht werden kann, oder
mit Combinationen dieser drei Grundformen, die wir nach
Sweet mit a, a, a bezeichnen wollen.
Anm. 2. Am deutlichsten sind diese Abstufungen beim Flüstern
wahrzunehmen, weil man dadurch die störenden Einwirkungen etwaiger
Tonhöhenänderungen entfernt (Sweet S. 58).
Anm. 3. Steht ein Laut wie a am Ende einer Silbe, so wird er nach
dem zu Eingang bemerkten stets einen, wenn auch noch so kurzen De-
crescendo - Abschluss haben, also a ; folgt aber ein anderer Laut, so kann
natürlich auch ein reines a gebildet werden.
Die Consonanten vor dem Sonanten der Silbe werden
wie leicht begreiflich in der Regel crescendo gebildet, die
nach dem Sonanten decrescendo, soweit sie eben Dauerlaute
sind, in denen eine Abstufung der Intensität stattfinden
kann ; also z. B. na, an, nan. Bei den Sonanten herrscht
decrescendo vor, und zwar um so mehr, je länger der Sonant
ist (man vergleiche z. B. die Stärke der t in satt und Saat,
welche sich nach derjenigen des Ausganges des a richtet,
S. 133 etc.). Doch hört man auch bisweilen a, z. B. wie Sweet
bemerkt in der freudiges Erstaunen ausdrückenden Inter-
jection ah ! , welche als a oder a zu bezeichnen ist (wie
namentlich die Flüsterprobe deutlich zeigt).
Für den einheitlichen Charakter der Silbe ist, wie sich
aus dem Vorstehenden ergiebt und wie auch schon oben S. 156
in der Definition der Silbe angedeutet wurde, Continuität
der Exspirationsstärke wesentlich massgebend ; d. h.
sowohl a, wie a, a, a, a und a rufen den Eindruck
der Einheit hervor, aber a oder a u. s. w. (genauer a u. s. w.)
160klingen zweitheilig, auch wenn nicht die geringste Pause zwischen
den beiden Theilen liegt (Sweet S. 59).
§ 28. Die Quantität der einzelnen Silbenglieder.
Die herkömmliche Zweitheilung der Vocale bezüglich ihrer
Quantität in Längen und Kürzen beruht auf dem Princip
der gegensätzlichen Verwendung in den einzelnen Sprachen.
An und für sich aber giebt es weder ein allgemeines Gesetz,
das nur eine Zweitheilung geböte, noch lässt sich irgend ein
Grund absehen, warum nicht Quantitätsunterschiede auch bei
Consonanten vorhanden sein sollten, noch lässt sich endlich
ein bestimmtes Mass für das zeitliche Verhältniss von
Längen und Kürzen aufstellen. Nach Brücke (Die physiol.
Grundlagen der neuhochd. Verskunst S. 67) soll die Dauer
gewöhnlicher langer Vocale nie ganz doppelt so gross gefunden
werden als die der kurzen, vielmehr soll sich ihr Verhältniss
im Allgemeinen dem von 5 zu 3 nähern. Diese Angaben
mögen für die deklamatorische Aussprache der neuhochdeutschen
Schriftsprache mit gewissen Einschränkungen
zutreffen, aber anderwärts sind die Verhältnisszahlen vielfach
ganz andere, und vor allem gehen vielleicht die meisten Sprachen
über die blosse Zweistufigkeit der Quantität hinaus.
Man wird demnach statt jener einfachen Kürzen und Längen
vielmehr mindestens überlange (a), lange (a), halblange
(a) und kurze (a) Laute unterscheiden müssen,
denen sich vielleicht die reducirten (a) als noch weitere
Kürzungsstufe anreihen lassen (§ 24, 2).
Ueber die Dauer der kurzen Laute kann praktisch kein
Zweifel sein ; kurz sind z. B. im Deutschen die Vocale in
hatte, Kamm, Ross u. s. w. Als Normaldauer der Längen
nehme ich die der sog. langen Vocale in mehrsilbigen deutschen
Wörtern wie Bote, kamen, lose, als überlang bezeichne
ich die Vocale in einsilbigen Worten wie bot, bat,
sass, welche deutlich länger sind als die Vocale der entsprechenden
Plurale boten, baten, sassen.
Unter halblangen Vocalen verstehe ich Zwischenstufen
zwischen meinen Kürzen und Längen, wie ich sie in verschiedenen
deutschen Mundarten namentlich vor einer Verbindung
von Liquida, Nasal oder Spirans + Consonant zu hören glaube
161(vgl. Winteler S. 113 ff. und namentlich 115 f.). Auch das
Englische scheint mir an solchen halblangen Vocalen reich zu
sein : hier erfahren oft kurze Vocale einsilbiger auf einen
tönenden Consonanten ausgehender Wörter eine gewisse Dehnung,
ohne jedoch mit den eigentlichen Längen (auch abgesehen
von Qualitätsunterschieden) zusammenzufallen. Man
vergleiche z. B. Reihen wie goddess, god (gelegentlich). gaudy,
gawk, gaud oder madden, mad, mate, made u. s.w.
Anm. Sehr deutlieh, viel deutlicher als im Deutschen, ist im Englischen
der Unterschied zwischen langen und überlangen Vocalen ausgeprägt.
Alle betonten auslautenden oder von einem tönenden Consonanten
gefolgten ‘langen’ Vocale in Pause sind dort überlang, z. B. see, seize,
broad, während tonlose Consonanten nur eigentliche Länge vor sich dulden :
seed und seat, pease und piece, brogue und broke (Sweet S. 59 : übrigens
bezeichnet Sweet die Ueberlängen als eigentliche Längen, und meine
‘Längen’ als ‘Halblängen’, was ich deswegen nicht für praktisch finde,
weil die letzteren doch die bei weitem häufigeren Laute sind, da auch die
Vocale jener ‘überlangen’ Monosyllaba im Zusammenhange der Rede oft
zu einfachen ‘Längen’ verkürzt werden). — Die Existenz der ‘halblangen’
Vocale im Englischen scheint Sweet nicht anzuerkennen, auch ist mir
selbst die Sache etwas zweifelhaft geworden. Es ist oft sehr schwer zu
sagen ob bloss der Consonant lang ist oder auch der Vocal eine Dehnung
erfahren hat. Im übrigen vergleiche hierzu § 35, 3, 1.
Lange Consonanten sind im Deutschen in Einzelwörtern
nicht gerade häufig, am ehesten werden noch Dauerlaute
gedehnt, wenn sie in den zweiten Gipfel einer zweigipfligen
Silbe (§ 29, 2) zu stehen kommen, vgl. z. B. thüring. man,
wol, walt, mäxt = Mann, wohl, Wald, Macht u. dgl. (man
halte namentlich die zweisilbigen Formen mit kürzerem Consonanten
dagegen : mener, wälde, mexte, Männer, Walde,
möchte). Im Bühnendeutschen sind die Consonanten überhaupt,
speciell die auslautenden, der Regel nach kurz, es
kommen aber sehr oft Dehnungen bei getragener Declamation
vor (die Intensität des Vocales wird herabgesetzt, dafür aber
die ganze Silbe, bei kurzem Vocal hauptsächlich der folgende
Consonant, gedehnt ; so lesen wir namentlich im Verse Wörter
mit ‘schwebender Betonung’). Sehr deutlich ist dagegen der
Unterschied zwischen kurzen und langen Consonanten wieder
im Englischen. Nach den Bestimmungen von Sweet (Handb.
S. 60, The Acad. ¾ 8O, vgl. Storm S. 434) sind alle Endconsonanten
betonter Monosyllaba mit kurzem Vocal lang, vgl.
z. B. hil ‘hill’ und hil ‘heel’, oder bœd ‘bad’ und beid ‘bade’,
mœn ‘man’ und mein ‘mane’ : ferner sind l und die Nasale
162lang vor tönenden, kurz vor tonlosen Consonanten : bild ‘build’
und bilt ‘built’ etc. Dem Deutschen klingen diese langen
Consonanten im Munde des deutschredenden Engländers ungemein
schleppend (sie sind beiläufig eine der Eigenthümlichkeiten,
welche die Engländer am schwersten ablegen), während
umgekehrt die deutschen (und mehr noch die dänischen)
kurzen Schlussconsonanten, z. B. in Mann, hat, verglichen
mit engl. man, hat nach dem Zeugniss von Sweet englischen
Ohren sehr ‘abrupt’ klingen.
Ueber den Unterschied von langen Consonanten und Geminaten
s. § 31 zu Schluss.
§ 29. Der exspiratorische Silbenaccent.
Wir haben oben in § 2 7 die allgemeine Regel kennen gelernt,
wonach die Consonanten einer Silbe nicht mit stärkerer
Exspiration hervorgebracht werden dürfen, als die Sonanten.
Für den Gesammteindruck der Silbe kommt aber zweierlei
noch sehr in Betracht : einmal ob der Exspirationsstoss ganz
einfach und regelmässig verläuft, oder ob in ihm Schwächungen
und abermalige geringe Verstärkungen vorkommen ; sodann
die Frage, bei welcher Stärke der Exspiration der auf
den Sonanten folgende Consonant einsetzt. Da diese Fragen
sich beide auf die specifische Exspirationsbewegung innerhalb
der Silbe beziehen, so wollen wir sie unter dem Namen des
‘exspiratorischen Silbenaccentes’ zusammenfassen.
Bezeichnen wir den Moment stärkster Exspiration als Exspirations-
oder Silbengipfel, so wird ein einfach verlaufender
Exspirationshub nur einen solchen Gipfel enthalten.
Kommen dagegen in einem solchen Hube Schwankungen der
eben bezeichneten Art vor, so werden sich neben dem Hauptgipfel
eventuell secundäre Nebengipfel bemerklich machen,
die aber doch wegen ihrer geringeren Stärke als dem Hauptgipfel
untergeordnet empfunden werden. Da übrigens in
einer Silbe kaum mehr als ein Nebengipfel geduldet wird
(mehr würde den einheitlichen Charakter der Silbe zu sehr
stören), so genügt es. eingipflige und zweigipflige
Silben zu unterscheiden.163
1. Eingipflige Silben.
Hierunter sind solche Silben zu verstehen, wie man sie
z, B. im Bühnendeutschen und vielen deutschen Mundarten
in beliebigen Wörtern wie Knappe, hatte, Wasser, halte,
Knabe, Bote, lasen, holte etc. etc. allgemein zu sprechen pflegt.
In ihnen erreicht die Exsprration schon zu Anfang des Vocales
ihre grösste Stärke, die entweder durch den Vocal hindurch
festgehalten oder gleichmässig, wenn auch zum Theil
nur sehr wenig, verringert wird. In dem Vocale selbst ist in
Folge dessen keine Spur von Discontinuität zu entdecken
(auch nicht in Bezug auf den musikalischen Ton, welcher
entweder eben oder einfach steigend oder einfach fallend ist,
s. unten § 30). Auch zwischen dem Vocal und dem folgenden
Consonanten ist ein Sprung oder eine sonstige Discontinuität
der Exspiration nicht bemerkbar, der Sonant wird
einfach von dem folgenden Consonanten abgelöst durch Umstellung
der Articulationsorgane, oder wie sich Kudelka ausdrückt,
durch denselben abgeschnitten. Dies ist namentlich
deutlich bei Silben mit einem Verschlusslaut nach dem
Vocal wie ap, ak, at, aber auch bei andern Consonanten, wie
in den Silben as, an, ar, gut merkbar. Wir nennen hiernach
Silben, deren Sonant bei regelmässig abnehmender, eingipfliger
Exspiration durch den folgenden Consonanten abgeschnitten
wird, Silben mit geschnittenem Silbenaccent.
Der Eindruck, den dieser Accent auf das Ohr macht, ist
sehr verschieden, je nach der Intensität des Sonanten im Momente
der Abschneidung. Wir unterscheiden zunächst zwei
Unterabtheilungen.
1. Der energisch oder stark geschnittene Accent,
den wir mit ' bezeichnen, hat im Bühnendeutschen seinen
Sitz auf den meisten kurzen Vocalen, z. B. in hátte, hálte.
Hier wird der Vocal durch den folgenden Consonanten noch
in dem Momente seiner grössten Stärke abgeschnitten. Dies
hat zur Folge, dass der Consonant selbst mit etwas verstärktem
Exspirationsdruck gesprochen wird. Dies macht sich
namentlich in Fällen wie ébbe, égge mit tönender Media geltend,
die im Vergleich zu der Media in eben etc. eine so deutliche
Verstärkung empfängt, dass man sie wohl als tönende
Fortis bezeichnen könnte. Ueberhaupt findet sich der stark
geschnittene Accent aus demselben Grunde besonders vor
Fortes. Auf langen Vocalen ist er im Deutschen seltener,
164weil es nicht üblich ist, den Vocal mit voller Energie längere
Zeit auszuhalten. Er hat aber seinen Platz z. B. öfter auf
langen Vocalen vor folgender (Schrift-) Geminata, vgl. etwa
eine Combination wie noth thun mit so thun (das so nachdrücklich ;
doch spricht man allerdings auch in rascher Rede
oft nur no-thun, dem so-thun ganz gleich).
Mit dem ‘stark geschnittenen Silbenaccent’ steht eine zuerst
von Winteler (Kerenzer Mundart 142 ff.) beobachtete
Erscheinung im innigsten Zusammenhange, die ich als
das Winteler'sche Silbenaccentgesetz bezeichnen
möchte. Dasselbe lautet : Ein jeder Dauerlaut (Liquida,
Nasal, Spirans) erscheint in allen einigermassen nachdrücklichen
Silben nach kurzem Vocal stets als Fortis, sobald
noch ein demselben Wort angehöriger Consonant darauf folgt.
In nachdruckslosen Silben findet dies Gesetz keine Anwendung,
sondern es erscheint dort einfach die entsprechende
Lenis. Man spricht also ált, lánt, kámpf, máxt, ást, ebenso
álte, lánde, kämpfe, mäxte, äste mit Fortis ; aber z. B. ganz
neú mit Lenis, wenn das zweite Wort stärker betont ist ; dagegen
bei nachdrücklicher Hervorhebung des ersten wieder
gánz neu mit Fortis. Uebrigens gilt diese Regel nicht ebenso
durchgängig für alle Sprachen wie für das Deutsche. Die
Häufigkeit der Erscheinung in dieser Sprache beruht eben
darauf, dass unsere kurzen Vocale in Silben von der oben bezeichneten
Beschaffenheit fast durchaus den stark geschnittenen
Accent haben.
Anm. 1. ‘Die nach diesen Gesetzen entstehenden Fortes sind übrigens
nicht gänzlich mit denjenigen zu identificiren, welche vor folgendem Vocal
stehen. Denn bei letztern hebt die neue Silbe noch innerhalb der Fortis
an, wenn dieser ein kurzer Vocal unmittelbar vorhergeht ; ganz zur neuen
Silbe gehört sie nach langem Vocal, Diphthong oder Liquida. Erstere dagegen
sind bloss des kräftigen Exspirationsstosses, der dem vorhergehenden
kurzen Vocale zukommt, theilhaftig und lassen denselben in sich ablaufen.
Die nächste Silbe beginnt dagegen mit dem folgenden Laute.’
(Winteler a. a. O. S. 143).
Anm. 2. Bei der Mannigfaltigkeit der Accentabstufung ist es oft schwer
zu entscheiden, ob im einzelnen Falle Lenis oder Fortis vorhanden ist ; es
gibt auch hier Zwischenstufen wie bei der vocalischen Quantität (s. § 28).
Der Wechsel zwischen Lenis und Fortis innerhalb desselben Wortes hängt
aber wesentlich von der Betonung des ganzen Satzes ab, dem das Wort angehört
(vgl. Winteler a. a. O. S. 143. 145 und dessen Textproben S. 192 ff.).
2. Der schwachgeschnittene Accent, den wir durch
` bezeichnen, ist den meisten unserer langen Vocale und
Diphthonge wie in hàbe, schlàfe etc., sowie den Vocalen
165unbetonter Silben eigen. Hier tritt die Abschneidung des
Vocals erst in einem Momente ein, wo dessen Intensität bereits
sehr geschwächt ist ; in Folge davon kommt auch der
geschnittene Absatz nur schwach oder gar nicht zur Wahrnehmung
(vgl. etwa Rabe mit Rappe). Am besten verbindet
sich dieser Accent mit folgender Lenis, auch wo er einen
kurzen Vocal trifft (wie etwa in schweizerischem gĕbe, lĕse),
während eine Fortis sich im letzteren Falle schwieriger anschliesst,
weil für das Ende des Vocals der Exspirationsdruck
stark herabgesetzt, im nächsten Moment aber für den Consonanten
wieder erheblich verstärkt werden muss. Am leichtesten
erreicht man diesen Accent bei kurzem Vocal, wenn
man überhaupt die Intensität des Vocales von vorn herein
ziemlich gering nimmt, oder indem man den Vocal ein wenig
dehnt, damit sich in seinem Verlauf die Intensität auf das
nöthige Mass verringern kann. Auf diese Weise entstehn
sehr oft Vocalquantitäten, die zwischen der entschiedenen
Kürze und Länge mitten inne liegen, sich aber in der Regel
allmählich zur vollen Länge entwickeln ; vgl. hierzu die Ausführungen
in § 28.
Anm. 3. Dieselbe Abstufung des Sonantenausgangs findet sich auch
bei Silben die auf den Sonanten endigen. In dem kurzen rasch gesprochenen
dă setzt auch der Vocal noch im Momente grösster Stärke ab, während
er in dem langen dā mehr allmählich verklingt. Wir wenden also auch
auf solche Fälle die Zeichen ´ und ` an, unterscheiden also jene Wörter
als dá und dà.
Anm. 4. Es ist besonders zu betonen, dass es bei der Unterscheidung
dieser beiden Formen des Silbenaccents lediglich auf die mehr oder weniger
deutlich in's Ohr fallende Abschneidung des Sonanten ankommt. Alle
übrigen Unterscheidungen des ‘Accentes’, wie Stärke- oder Tonhöhenunterschiede
verschiedener Silben, haben hiermit wenigstens primär nichts
zu schaffen.
Ueber das Verhältniss der beiden Arten geschnittener
Silbenaccente in der Silbentheilung ist auf § 31 zu verweisen.
2. Zweigipflige Silben.
Als Eigentümlichkeit der zweigipfligen Silben wurde
bereits oben bezeichnet, dass, nachdem der Sonant der Silbe
den Moment seiner grössten Intensität passirt hat, eine abermalige
Verstärkung der Silbenexspiration eintritt, ohne dass
jedoch das Mass jenes ersten, die Silbe beherrschenden Gipfels
erreicht wird. Dieser zweite Gipfel kann entweder noch in
166den Sonanten selbst fallen oder einem folgenden Consonanten
zu Gute kommen. Die Erkenntniss der Bildung eines Doppelgipfels
in der Exspiration wird oft dadurch erschwert, dass
mit derselben sehr oft ein mannigfach variirter Wechsel der
Tonhöhe verbunden ist (vgl. § 30), welcher natürlich stärker
ins Ohr fällt und dadurch die Aufmerksamkeit des Beobachters
von der Exspirationsbewegung ablenkt (daher empfiehlt
sich hier wieder sehr die Flüsterprobe, S. 160). Wir bezeichnen
diese Art der Silbenbildung als zweigipfligen Silbenaccent
und deuten sie durch ~ über denjenigen Lauten
an in welche die beiden Gipfel entfallen.
Lange Vocale nehmen oft beide Gipfel der Silbe in sich
auf ; so hört man oft im Deutschen gedehntes da, ja, so
u. dgl. aussprechen (meist zerfällt dabei der Vocal in einen
Diphthongen mit geringer Distanz der Componenten, vgl.
S. 121). Indessen kann auch bei langen Vocalen der zweite
Gipfel zu einem folgenden Consonanten fortrücken, namentlich
wenn dieser ein tönender, besonders ein sonorer Laut
ist. So sprechen wir bei nachdrücklicher Betonung oft (isolirt)
kam, nam neben kam, nam u. s. w. Nach kurzem Vocal fällt
der zweite Gipfel wohl stets dem folgenden Consonanten zu,
bei Diphthongen also dem zweiten Componenten ; vgl. z. B.
nachdrückliches hod Heu (in Pausa) mit ho's-r heuer u. dgl.
Ähnlich bei folgender Liquida oder Nasal, vgl. z. B. thüringisches
man, kam, hults Mann, Kamm, Holz mit méner,
kéme, héltsern. Selbst bei Verbindungen von Vocal + tonloser
Spirans + Consonant findet sich die Bildung des Doppelgipfels,
z. B. in der thüringischen Aussprache pausaler
lacht, fasst im Vergleich etwa zu unemphatischem lachte,
fasste.
Die Bildung von Silben mit Doppelgipfel der Exspiration
ist weit verbreitet, namentlich in den Sprachen oder Mundarten
die wir als ‘singend’ zu bezeichnen pflegen. Sie tritt
wiederum besonders deutlich in den langsamer und nachdrücklicher
gesprochenen einsilbigen Wörtern am Satzschluss
auf, während sie z. B. im Bühnendeutschen wie im Englischen
im Innern des Satzes zu verschwinden pflegt.
Im Einzelnen ist es oft schwer zu sagen ob man eine einsilbige
Lautgruppe mit Doppelgipfeln oder eine zweisilbige
Gruppe mit zwei selbständigen Gipfeln vor sich hat ; es hängt
dabei viel davon ab, in wie weit der zweite Gipfel als dem
167ersten absolut untergeordnet empfunden wird ; ausserdem
kommt in Betracht, dass der Begriff der Silbe bei uns ein
conventionell fixirter und in der Praxis sehr dehnbarer ist.
Gewiss ist, dass aus einsilbigen Gruppen mit Doppelgipfel oft
deutlich zweisilbige Verbindungen hervorgehen, z. B. in manchen
thüringischen Mundarten Bildungen wie fu-es, gu-et
aus fu s, gu t u. dgl.
Anhangsweise ist endlich hier noch eine Art der Silbenbildung
zu besprechen, die man gewöhnlich unter den ‘Accenten’
aufzuzählen pflegt. Es ist dies der sogen, ‘gestossene
Accent’.
Gestossener Accent.
Derselbe findet sich z. B. im Lettischen und Dänischen
in weiter Verbreitung (zuerst wurde er in der letzteren
Sprache von Höysgaard beobachtet). Es ist aber schwer durch
Beschreibung eine deutliche Vorstellung von demselben zu
geben. Die Hauptsache ist dabei, dass inmitten der Silbe
ein ganz momentaner, fester Verschluss der
Stimmritze gebildet wird (vgl. § 30, Anm. 2). Die
Silbe zerfällt dadurch in zwei Theile, die sich den beiden
Gipfeln des geschliffenen Accentes vergleichen lassen, nur
dass hier durch den Glottisschluss getrennt ist, was beim geschliffenen
Accent durch continuirliche Übergänge verbunden
war. Wir bezeichnen den Stosston mit J, dem Zeichen des
Glottisschlusses, nach dem Sonanten, also a, e u. s. w.
Der Stosston kann sowohl lange wie kurze Vocale treffen.
Ist der Vocal nach dem Ende zu isolirt. so äussert sich im
Dänischen wenigstens der zweite Exspirationshub in einem
dem Vocal nachstürzenden (tonlosen) Hauch von grösserer
oder geringerer Stärke, vgl. z. B. dän. pä, fœ. ti u. dgl.
Nach langem Vocal wird ein folgender Consonant mit dem
Exspirationsstoss des zweien Gipfels hervorgebracht. Folgt
aber auf einen kurzen Vocal ein tönender Dauerlaut, so fällt
der ‘Stoss’, d. h. der Glottisschluss in diesen, nicht in den
Vocal, vgl. etwa die dän. and, vild ; die genauere Beschreibung
s. § 30, Anm. 2.
Anm. 5. Streng genommen haben wir es übrigens hier stets mit einer
Verbindung einer ‘Vollsilbe’ mit einer ‘Nebensilbe’ in dem S. 158 festgestellten
Sinne zu thun, da der Glottisschluss dieExspiration völlig hemmt ;
indess ist doch der Gesammteindruck ein sehr einheitlicher, daher man
denn wohl ‘Silben’ mit Stosston in Beziehung auf ihre Exspirationsbewegung
168zu den zweigipfligen rechnen darf. — Man hüte sich übrigens den Stosston
zu verwechseln mit dem festen Uebergang von Vocalen zu Verschlusslauten
mit Glottisschluss, wie arm. k, t, p. In arm. ak, ap etc.
wird zwar der Sonant gleichzeitig mit dem Verschluss auch noch durch
den Glottisschluss abgeschnitten, aber die Explosion der Glottis fällt nicht
mehr derselben Silbe zu. Man kann natürlich auch ak, ap etc. mit wirklichem
Stosston sprechen, dann muss aber eben der Glottisschluss
vor den Mundverschluss fallen.
Anm. 6. Es versteht sich natürlich von selbst dass der sog. Stosston
nur rücksichtlich der durch den Glottisschluss bedingten Spaltung der
Exspirationsbewegung in zwei Theile als besondere Form des ‘Silbenaccents’
aufzufassen ist. Bezüglich des Glottisschlusses selbst fällt er
unter die Lehre von den Lautabsätzen resp. -übergängen und ist als solcher
an betreffender Stelle bereits behandelt. Auch für den, welcher den
Glottisschluss als besondern Consonanten betrachtet, bleibt immerhin jene
Spaltung des Exspirationsstosses als Charakteristicum der Silbe bestehen.
§ 30. Der musikalische oder tonische Silbenaccent.
'Beim Singen verweilt die Stimme ohne Wechsel der Tonhöhe
auf jeder Note und springt dann so rasch wie möglich
zu der folgenden Note über, so dass der verbindende ‘Gleitton’
nicht wahrgenommen wird, wenn auch keine wirkliche
Unterbrechung des Tones stattfindet. Beim Sprechen dagegen
verweilt die Stimme nur gelegentlich auf einer Note ;
sie bewegt sich vielmehr fortwährend auf und ab, von einer
Note zur andern, sodass die verschiedenen Noten, die wir zur
Bezeichnung der Tonhöhe einer Silbe ansetzen, einfach,
Punkte sind zwischen denen die Stimme beständig gleitet
(Sweet S. 93 f., vgl. auch Storm, Om Tonef. 4 [287]).
Insoferne nun diese Tonbewegung innerhalb der einzelnen
Silbe sich abspielt, ist sie als musikalischer oder
chromatischer (Verner) oder kürzer als tonischer Silbenaccent
zu bezeichnen. Für den tonischen Silbenaccent
kommen alle Unterschiede der absoluten Tonhöhe der einzelnen
Silben im Worte oder Satze nicht in Betracht ; diese und
ähnliche Fragen sind vielmehr erst in der Lehre vom tonischen
Wort- oder Satzaccent (§ 34) zu besprechen. Unter
tonischem Silbenaccent verstehen wir einzig und allein die
Art wie während der Bildung einer Silbe die Tonhöhe der
Stimme behandelt wird.
Wie leicht ersichtlich, giebt es drei Hauptformen dieses
Accentes : den ebenen —, den steigenden / und den
169fallenden \ ; ausserdem können Combinationen dieser
Grundformen eintreten, von denen der fallend-steigende
V (compound rise Sweet) und der steigend-fallende A
(compound fall Sweet) die häufigsten sind. Doppelt steigender
oder doppelt fallender Ton, bei dem die Silbe
zwei steigende oder zwei fallende Töne enthält, lässt sich zwar
bilden, ist mir aber nicht aus der Erfahrung bekannt. Im
allgemeinen scheint es eben üblich zu sein bei der Vereinigung
zweier Töne in einer Silbe dieselben in entgegengesetzter
Richtung sich verändern zu lassen, damit der Grenzpunkt
beider deutlicher hervortrete.
Am feinsten sind die tonischen Silbenaccente in Sprachen
wie dem Chinesischen ausgebildet, in denen die Bedeutung
derselben Silbe je nach dem tonischen Accent mit dem sie
ausgesprochen wird eine sehr verschiedene sein kann. Aber
auch in uns näher liegenden Sprachen finden sich zum Theil
gut ausgebildete Systeme des tonischen Silbenaccents vor.
Als Beispiele nenne ich das Serbische und Litauische (vgl.
Masing, Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents,
Petersburg 1876) und das Schwedische (vgl. z. B. die in der
Bibliographie citirten Arbeiten von Noreen und Kock). Zweitönige
Silbenaccente finden sich überhaupt in den als ‘singend’
bezeichneten Mundarten, gewöhnlich Hand in Hand
gehend mit zweigipfliger Exspiration (S. 167). In den
monotoneren Sprachen aber, wie der deutschen und englischen
höheren Verkehrssprache, dienen die verschiedenen
tonischen Silbenaccente fast nur mit zur Charakterisirung der
verschiedenen Satzarten (vgl. darüber § 34). Daher lassen sie
sich in solchen Sprachen am besten bei isolirten Monosyllabis
beobachten, welche begrifflich einen ganzen Satz vertreten.
So haben wir den ebenen Ton in dem (oft etwas gedehnten)
nachdenklichen, halb unentschiedenen ja, so ( ;ja, wenn das
so gemeint ist', ‘ja, ich weiss eigentlich nicht…’ u. dgl.),
ähnlich auch engl. well. Den fallenden Ton haben wir im
einfach bejahenden ja, den steigenden im fragenden ja ? ,
so ? , nun ? (vgl. wieder etwa engl. 'well, lets go then' und
'well, are you ready ?'). Den fallend-steigenden Ton
findet Sweet auf der Silbe care in dem warnend gesprochenen
take care, den steigend-fallenden in dem ironischen
oh ! , oh really ! Ähnliches kann man auch für diese Fälle im
Deutschen beobachten, vergleiche etwa das ironische so mit A
und das zornige so mit V, u. ä. mehr.170
Bezüglich der Vertheilung der Tonhöhe auf die einzelnen
Glieder der Silbe ist zu bemerken, dass das Steigen und Fallen
keineswegs auf den Sonanten der Silbe beschränkt ist,
sondern sich auf alle tönenden Laute der Silbe erstreckt.
Beim fragenden soll er steigt die Stimme vom o bis zum Ende
des l und ebenso vom e bis zum Ende des r. Bei zweitönigen
Accenten trifft der zweite Ton sehr oft einen oder mehrere
Consonanten die auf den Sonanten der Silbe folgen. Fast
Alles was oben S. 167 über die Vertheilungen der einzelnen
Glieder der Silbe auf die Exspirationsstösse zweigipfliger
Silben dargelegt worden ist, trifft mutatis mutandis auch auf
die zweitönigen Silben zu.
Für den Gesammteffect der verschiedenen Silbentöne ist
das beim Steigen oder Fallen durchlaufene Intervall sehr
wesentlich. So giebt ein Steigen durch das Intervall etwa
eines halben Tones der Sprache etwas klagendes, weinerliches ;
das Steigen durch ein etwas grösseres Intervall, etwa
eine Secunde ( ?), drückt eine einfache Frage, ein noch stärkeres
Steigen, durch etwa eine Sexte, Erstaunen aus. u. dgl.
mehr (Sweet S. 95).
Für die Doppeltöne muss nächstdem auch noch das Intervall
zwischen den beiden Tönen bestimmt werden. Hierfür
lassen sich bestimmte Regeln nicht geben. Noreen a. a. O.
unterscheidet beispielsweise in der Mundart von Fryksdal den
‘eigentlichen Circumflex’ aus Quinte + Grundton, den ‘niedrigen
Circumflex’ aus Grundton + Terz, und den ‘hohen
Circumflex’ aus der übermässigen Quarte + Quinte.
Als Namen für alle doppeltönigen Silbenaccente gebraucht
man jetzt am häufigsten wohl den Ausdruck Circumflex
(obwohl das Wort als Uebersetzung des griech. περισπωμένι
ursprünglich nur einen bestimmten zweitönigen Accent, nämlich
wohl * mit bestimmtem Intervall, bezeichnete), oder auch
geschliffener Accent, im Anschluss an eine zuerst von
Kurschat für das Litauische aufgestellte Terminologie.
Anm. 1. Der litauische ‘geschliffene Accent’ Kurschat's ist allerdings
nach den Untersuchungen von Masing, Serb.-chorw. Accent S. 46 ff.
vielleicht in tonischer Beziehung als ein einfach steigender Accent aufzufassen,
wenn nicht als eine Combination von steigendem und ebenem
Ton /¯. Aber in exspiratorischer Beziehung scheinen mir die litauischen
‘geschliffenen Silben’ trotz des Einspruches von Masing noch immer zweigipflig.
Anm. 2. Auch der dänische ‘gestossene Accent’ (S.168 f.) gehört nach
den Angaben von Verner, Anz. f. deutsches Alterth. VII (1880), 6 f. in
171musikalischer Beziehung zu den zweitönigen Accenten : ‘Beim Articuliren
des Wortes maler ‘mahlt’ setzt die Stimme auf der mit exspiratorischem
Drucke versehenen ersten Silhe in tiefem Tone an, —… mindestens
einen Ton unter der Schlusssilbe des [nicht gestossenen] Accents nr. 2
[zweisilbiger Wörter] —, sie bleibt eine Weile auf derselben Stufe stehn,
um sich gegen den Schluss des langen a durch ein jähes Portament ungefähr
eine Quinte hinaufzuschwingen : auf der höchsten Stufe klappen die
Stimmbänder plötzlich zusammen, alle Stimmbildung hört während der
dadurch entstehenden ganz kleinen Pause auf ; nach einem Moment öffnen
sich die Stimmbänder wieder, und die Schlusssilbe ler folgt noch auf derselben
tiefen Stufe wie die Anfangssilbe. Auf Wörtern, die in der Tonsilbe
kurzen Vocal mit nachfolgendem tönend-continuirlichen Consonanten
(8, w, j, r u. s. w.) haben, ist die Modulation dieselbe, nur fällt das aufsteigende
Portament sowie der Glottisschluss auf den tönenden Consonanten.’—
Storm hält indess (nach brieflicher Mittheilung) die musikalische
Modulation für freier als Verner angiebt.
§ 31. Die Silbentrennung.
Ein Hauptmerkmal der Silbe besteht nach S. 156 in der
Continuität der Exspiration während ihrer Dauer. Die Grenzen
benachbarter Silben werden danach durch eine Discontinuität
in der Exspiration markirt, genauer gesagt durch
Schwächung und nachfolgende Verstärkung der Exspiration.
In der Mitte, im Momente schwächster Exspiration, liegt die
Silbengrenze, die wir durch - bezeichnen wollen.
Stehen zwischen den Sonanten zweier Nachbarsilben mehrere
Consonanten, so liegt die Silbengrenze in der Regel zwischen
zweien von den letzteren und ist meist ohne Schwierigkeit
zu bestimmen ; in hal-me. ach-te liegt sie zwischen l und
m, ch und t. Mit dem m, dem t beginnt deutlich ein neuer
Impuls der Exspiration.
Schwieriger ist es unter Umständen die Silbengrenze zu
bestimmen, wenn nur ein Consonant oder eine Consonantgruppe.
welche leicht zum Anlaut der Folgesilbe gezogen werden
kann (z. B. Muta cum Liquida), die Sonanten der Nachbarsilben
trennt. In vielen Sprachen wird in solchem Falle der
Consonant zur zweiten Silbe gezogen, z. B. im Französischen,
Spanischen, Neugriechischen und den slawischen
Sprachen, auch in manchen deutschen, speciell schweizerischen
Mundarten. Im Bühnendeutschen, im Englischen etc.
geschieht dies meist nur in zwei Fällen, nämlich beim Uebergang
von einer schwächeren auf eine stärkere Silbe (be-fin-den,
ge-la-den, engl. a-lone, a-ppear etc.) oder, bei umgekehrtem
Verhältniss der Stärke, nach langem Vocal : bo-te, ha-be,
172see-le, lo-se, engl. ha-ting, lo-sing, sea-ling etc. Ebenso spricht
aber der Schweizer auch lĕ-se, gĕ-be, bŏ-te u. dgl., der Spanier
ca-za, le-tra, der Russe vo-du, u-gol, go-rod etc. Den Deutschen
und Engländern wird die Erlernung dieser Art der Silbentrennung
nach kurzem Vocal meist sehr schwer, da sie die
Neigung haben, in solchen Fällen den trennenden Consonanten
auch zur ersten Silbe zu ziehen ; man vergleiche deutsche
Wörter wie fasse, Kammer, alle, engl. hissing, hammer, hilly.
Hier liegt zweifelsohne die Grenze der Silben in dem Consonanten,
d. h. weder vor noch nach demselben ; aber die Intensität
in beiden Silben ist derartig abgestuft, dass der Consonant
gleichmässig auf beide Silben vertheilt zu
sein scheint, dass ein Punkt schwächster Exspiration nicht
wahrzunehmen ist, vielleicht auch in Wirklichkeit an dieser
Stelle nicht existirt : denn nach § 26 genügt der Durchgang
durch einen Laut von geringerer natürlicher Schallfülle bereits,
um hier den Eindruck der Mehrsilbigkeit hervorzurufen.
Diese Art der Verbindung zweier Silben wird wiederum nur
mit Mühe von denen erlernt, welche gewohnt sind, in solchen
Fällen vor den Consonanten abzutheilen ; der Romane, Slawe,
Grieche wird stets geneigt sein fáse, Kă-mer, ă-le zu sprechen
(falls er nicht etwa geminirt, s. unten).
Man kann ferner in ähnlicher Stellung die Silbengrenze
auch so legen, dass der Consonant als nur zur vorausgehenden
Silbe gehörig empfunden wird. Dies geschieht im
Deutschen oft da, wo wir consonantisch ausgehende Endsilben
mit vocalisch anlautenden Folgesilben combiniren, z. B. war-er,
hat-er, hält-er (auch gibt-er etc.) ; die beiden Sätze hat
érs gethan ? und hat dér's gethan ? unterscheiden wir z. B. so
oft als hat-es… und ha-ters… ; freilich verschiebt sich
auch oft, ja meist, die Silbengrenze in geläufiger Rede, sobald
die strenge begriffliche Scheidung der einzelnen Worte
ignorirt wird, und es treten die allgemeinen Trennungsregeln
in Kraft.
Anm. 1. Die einzelnen Akte der Articulation der silbentrennenden
Verschlusslaute bedürfen noch einer kurzen Erläuterung. Wird ein solcher
Laut zur folgenden Silbe gezogen, so wird der Verschluss im Momente
schwächster Exspiration hergestellt ; der neue Impuls beginnt erst während
der Verschlussstellung, oder, mit andern Worten, der Laut wird
wesentlich zum Explosivlaut, da der Verschluss selbst wegen geringer
Intensität nicht wahrgenommen wird. Im entgegengesetzten Falle,
in dem zuletzt erwähnten hat-er ist der Laut vielmehr Verschluss- oder
Occlusivlaut, da hier die Explosion bei minimaler Intensität des Luftdruckes
173stattfindet. Bei der gleichmässigen Vertheilung auf beide Silben
ist der Laut vorwiegend Occlusiv-, demnächst Explosivlaut, beide Theile
liegen aber so nahe dass sie als einheitlich empfunden werden.
Anm. 2. Diese verschiedenen Arten der Silbentrennung berühren
sich zum Theil mit dem was S. 164 ff. über den stark und schwach geschnittenen
Silbenaccent dargelegt worden ist. Es gehen einerseits zusammen
Formen mit gleichmässiger Consonantenvertheilung und stark
geschnittenem Accent, wie háte, ále, kámer, und solche mit Silbentrennung
vor dem Consonanten und schwach geschnittenem Accent, wie Schweiz.
lèse, gè-be, russ. vò-du etc. Formen wie hát-er haben natürlich auch den
stark geschnittenen Accent.
Man kann endlich auch einen Consonanten dergestalt auf
zwei Silben vertheilen, dass er selbst nicht mehr als einheitlich
empfunden wird. Es entsteht auf diese Weise die sogenannte
Gemination.
Um den Begriff der Gemination richtig feststellen zu können,
müssen wir zunächst daran erinnern, dass die Mehrzahl
der deutschen Mundarten die durch Verdoppelung des
Zeichens ausgedrückten Laute nicht mehr als Geminaten,
sondern als einfache Fortes ausspricht :
Amme, alle, Wasser, hoffe, Hacke, Knüppel, gesprochen ame,
ale, wäser ü. s. f. (vgl. Oben). Ebenso kennen das Englische
ausser bei der Composition. das Französische ausser bei gelehrten
Wörtern (wie grammaire etc.), sowie die slawischen
Sprachen im Allgemeinen keine Gemination mehr. Dagegen
sind z. B. das Italienische, auf germanischem Boden das
Schwedische, das Deutsch der baltischen Provinzen, sowie
einige Schweizermundarten von nicht - indogermanischen
Sprachen das Magyarische und sämmtliche finnische Sprachen
reich an derartigen Lautverbindungen, welche man mit einem
gewissen Rechte als Geminaten bezeichnen kann. Man vgl.
zur Orientirung etwa ital. anno, balla, basso, atto,. occhio ; ebbe,
faccia, legge, pozzo, mezzo.
Es ist nun ebenso deutlich, dass das Ohr hier wirklich
zwei getrennte Laute (einen am Schlüsse der ersten, einen am
Anfang der zweiten Silbe) zu vernehmen glaubt, als dass eine
wirkliche Doppelsetzung des betreffenden Consonanten nicht
stattfindet. Das letztere zeigen am deutlichsten die Verschlusslaute
(und Affricatae). bei denen zwischen den beiden Silben
keine Oeffnung des Verschlusses eintritt. Der Name
Gemination kann daher auch nur auf jenen scheinbaren
Doppeleindruck, den das Ohr empfängt, bezogen werden, und
174durch diesen allein ist auch die Beibehaltung der alten Bezeichnung
durch Doppelschreibung gerechtfertigt.
Dieser Doppeleindruck wird aber bei den Verschlusslauten
dadurch hervorgerufen, dass Verschluss und Explosion
mit deutlich verschiedenen Exspirationsstössen gebildet
werden, wozu als secundäres Moment eine etwas längere Pause
zwischen Verschluss und Oeffnung hinzutritt. Dann erweckt,
etwa bei atto, der deutlich von der Explosion getrennt zum
Bewusstsein kommende Uebergang von a zu t die Vorstellung
eines silbenschliessenden occlusiven t, und diesem reiht sich
dann das Explosions-t einfach an. Bei unserer Aussprache der
einfachen Fortes dagegen fallen diese Momente zeitlich so nahe
zusammen und herrscht eine solche Continuität in der Exspiration,
dass nur eine einheitliche Vorstellung in uns wachgerufen
wird (s. Anm. 1).
Eher könnte man bei den Dauerlauten — und dies gilt
auch von dem Blählaut geminirter tönender Mediae — von
einer wirklichen Zerlegung des Consonanten in zwei Hälften
reden, obwohl auch diese durch continuirliche Uebergänge
verbunden sind. In asso z. B. wird nämlich wiederum der
erste Theil des ohne Unterbrechung fortgesetzten s mit dem
Exspirationsstoss der ersten, der zweite Theil mit dem der
zweiten Silbe hervorgebracht. Zwischen beiden Stössen findet
aber die für die Silbengrenze charakteristische Herabsetzung
des Exspirationsdruckes statt, und diese markirt sich dem
Ohre durch die geringere Intensität des in diesem Momente
hervorgebrachten Lautes. Man kann also in den Geminaten
der Dauerlaute eine Abschwächung und Wiederverstärkung
deutlich wahrnehmen, die bei tönenden ausserdem noch häufig
mit einer Senkung und Erhöhung des Tones verbunden ist.
Bei den einfachen Fortes bleibt dagegen auch hier wieder die
Schallintensität während der ganzen Dauer des Lautes sich
gleich oder sie stuft sich wenigstens continuirlich ab.
Die Natur des der Geminata vorausgehenden Lautes ist
im Allgemeinen gleichgültig ; nur muss derselbe im Moment
der. Verschluss- oder Engenbildung noch mit kräftiger Exspiration
gebildet werden, damit, vor Verschlusslauten, der
uebergang deutlich in's Gehör fällt, bei Dauerlauten aber
noch eine deutliche Verminderung der Exspirationsstärke
während der erwähnten Silbenpause (s. oben) stattfinden
kann. Aus diesem Grunde sind kurze Vocale als Vorläufer
von Geminaten am geeignetsten, Verschlusslaute am
175ungeeignetsten, weil hier das kurze Explosionsgeräusch selbst
noch durch einen raschen Uebergang abgeschnitten werden
muss.
Anm. 3. Sogar für den letztgenannten Fall lassen sich auch aus dem
Deutschen Beispiele bei Composition beibringen ; man unterscheidet wenigstens
bei langsamer deutlicher Aussprache gibt Trost von gib Trost ; ähnlich
vgl. Lärm machen und lärme, Moos-sitz und Māsse u. dgl. Nur pflegt
man hier nicht an Gemination zu denken, weil man die einzelnen Wörter
begrifflich von einander zu trennen gewohnt ist. — Dass uns die Gemination
nach Längen oder Diphthongen schwieriger zu bilden scheint als
nach Kürzen, liegt nur an unserer Betonung derselben mit absteigendem
Accent (s. oben § 27) ; dass sie aber auch uns nicht unmöglich ist, zeigen
Fälle wie noth thun u. dgl. In geläufigerer Rede lassen wir indess auch
bei der Composition fast überall die Gemination fallen, sprechen also giptròst,
lârmaxen, mòsits, nòtun u. s. w.
Analog der Gemination sind endlich noch die Verbindungen
eines tönenden Lautes mit dem entsprechenden tonlosen.
Bei diesen setzt der Stimm ton in der Silbenscheide
ein, resp. aus, die übrigen Articulationen werden gemeinschaftlich
ausgeführt. So spricht man wohl in Norddeutschland
hat dich, lass sie mit tönendem d und z oder mit umgekehrter
Lautfolge in England had to do, has seen. Sehr gewöhnlich
aber treten in diesen Fällen Assimilationen ein, so
dass vollkommen tonlose oder tönende Geminaten entstehen.
Die Ausdehnung der Assimilationen unterliegt in den einzelnen
Sprachen wieder besonderen Gesetzen.
Anm. 4. Nur selten habe ich gefunden, dass bei der Composition
zweier gleicher Verschlusslaute wirklich doppelte Explosion angewandt
wird (nimmt-Theil, hat-dich), und ich glaube diese Aussprache auf den
Einfluss des Schulunterrichtes zurückführen zu sollen. Abgesehn von
individuellen Gewohnheiten, scheint sie z. B. in Ostpreussen allgemeiner
üblich zu sein. Für das Sanskrit und Griechische galt sicher die Gemination
mit nur einer Explosion ; denn Aspiraten können nicht verdoppelt
werden (im Skr. gilt nur kkh, tth, pph, im Griech. nur xx, t#, ncp), eben
weil der Hauch in der Verschlusspause zu Grunde gehn muss. Für das
Indogermanische aber ist (wie Heinzel, Gesch. der niederfränk. Geschäftssprache
S. 128 bemerkte), wirklich doppelte Explosion anzusetzen, da an
Stelle von tt etc. in einigen Sprachen st, ss tritt.
Es muss zum Schluss hier noch nachdrücklich darauf aufmerksam
gemacht werden, dass Geminata und langer
Consonant streng von einander zu scheiden sind. Man
kann einen Dauerlaut bei continuirlicher Exspiration beliebig
lange aushalten ohne dass er zur Geminata wird. Zur Gemination
gehört eben als wesentlichstes Moment die Discontinuität
der Exspiration, welche allein im Stande ist den Eindruck
176jener Spaltung des Lautes in zwei Theile hervorzurufen,
die wir als das Wesentlichste der Aussprachsweise betrachten
müssen, die wir mit dem alten Namen der geminirten bezeichnen.
§ 32. Der Wort- und Satzaccent im Allgemeinen.
Mit der Behandlung des Wort- und Satzaccentes betreten
wir ein Gebiet das auch die alltägliche Praxis zur ‘Accentuation’
zu rechnen pflegt. Sagte man auch zunächst wohl nur.
in einem Worte wie avt)q habe die letzte Silbe, in einem Satze
wie ‘er sagt es, nicht sie’ haben die Wörter er und sie ‘den
Accent’, d. h. verstand man zunächst unter ‘Accent’ nur die
Hervorhebung einer bestimmten Silbe im Worte oder die
eines bestimmten Wortes im Satze, so hat man sich doch allmählich
daran gewöhnt, auch die übrigen Theile des Wortes
oder des Satzes in die Lehre von der Accentuation hineinzuziehen.
Wir verstehen jetzt unter der Accentuirung eines
Wortes die relative Charakteristik aller seiner Silben, unter
Satzaccentuirung die relative Charakteristik aller Theile
eines Satzes. Denn zur vollständigen phonetischen Charakteristik
eines Wortes oder Satzes gehört ausser dem was bisher
über Einzellaute, Lautverbindungen und Silbenbildung erörtert
ist, nicht nur dass man wisse, es sei eine Silbe oder ein
Wort vor den andern in irgend welcher Weise hervorgehoben,
sondern man muss auch wissen, wie und wodurch diese Hervorhebung
geschieht, und wie die minder hervorgehobenen
Silben oder Wörter sich unter einander und zu den mehr hervorgehobenen
verhalten.
Die Bestimmung dessen was in dem Worte oder dem
Satze hervorgehoben ist oder werden soll und wie dies im
einzelnen Falle geschieht, fällt wie man leicht erkennt aus
dem Gebiete der Phonetik heraus und der beschreibenden
Grammatik resp. Rhetorik anheim. Die Grammatik hat zu
bestimmen, welche Silbe eines Wortes etwa die ‘Tonsilbe’
(d. h. die am meisten hervorgehobene) ist oder welche Silben
einen ‘Nebenaccent’ (d. h. eine weniger ausgeprägte Hervorhebung)
erhalten. Sie lehrt ferner welche Wortklassen etwa
im Satze ihren ‘selbständigen Accent’ (d. h. eine eigene
merkbare Hervorhebung) verlieren (vgl. die Lehre von den
Encliticis und Prokliticis, die von der Betonung des Verbum
finitum im Sanskrit) u. dgl. mehr. Die Rhetorik aber lehrt
177dem Wechsel des begrifflichen Gewichtes, welches die einzelnen
Wörter im Satze haben können, jedesmal den richtigen
Ausdruck zu verleihen, sei es dass sie an den Verstand des
Hörers appellirt oder dass sie sich mehr den Ausdruck der
Gemüthsbewegungen und Affekte angelegen sein lässt. Die
Phonetik hat es einerseits nur mit den allgemeinen Mitteln
der Charakterisirung zu thun, andererseits hat sie den allgemeinen
Tendenzen in der Anwendung dieser Mittel nachzuspüren,
die sich etwa unabhängig von grammatisch-rhetorischen
Einzelbestimmungen in den Sprachen beobachten lassen.
Jene allgemeinen Mittel sind aber wieder die bekannten drei :
Abstufung nach Stärke, musikalischer Höhe und Dauer. Wir
haben demgemäss getrennt den emphatischen und den tonischen
Wort- und Satzaccent und die Quantität im Worte und
Satze zu betrachten ; über das Verhältniss von Wort und Satz
aber wird der Eingang des folgenden Paragraphen handeln.
§ 33. Der emphatische Wort- und Satzaccent.
1. Die Theile des Satzes (Worte und Sprachtakte)
1. Die Theile des Satzes (Worte und Sprachtakte) 1)4.
Der gesprochene Satz in der naiven Sprache ist
unleugbar eine geschlossene phonetische Einheit, wie er denn
auch in begrifflicher Beziehung gar oft als ein Ganzes gefasst
und verstanden wird, ohne dass sich Sprecher und Hörer
deutlich der einzelnen Theile bewusst werden aus denen der
Gesammtinhalt des Gesagten sich begrifflich zusammensetzt.
In der hessischen Mundart werden z. B. die drei Wörter
‘wollen wir gehn ?’ zusammengezogen zu wómegèn ? . die vier
Wörter ‘wollen wir denn gehn ?’ zu wömgèn ? (mit langem
syllabischem m). Die verschiedene Bedeutung dieser beiden
Sätze ist jedem Sprecher und Hörer sofort klar, auch ohne
dass er den Versuch einer begrifflichen Analyse macht. Erst
eine weitgreifende Speculation lehrt uns den Satz in seine
begrifflichen Elemente zu zerlegen, und diese nennen wir
Wörter. Je naiver, je weniger grammatisch gebildet Sprecher
und Hörer sind, um so weniger werden sie bei ihrer
sprachlichen Thätigkeit von einer begrifflichen Auflösung des
178Satzes Gebrauch machen, da sie ihre Sätze weder nach
einem logisch-grammatischen Schema bilden noch sie danach
verstehen, vielmehr in Nachbildung und Nachempfindung
gewisser durch den Gebrauch ihnen verständlich gewordener
Satztypen. Je naiver eine Sprache, um so ungestörter ist daher
auch die phonetische Einheit der Sätze. Aber auch selbst
beim grammatisch geschulten Sprecher treten in der Praxis
des täglichen Lebens die begrifflichen Elemente des Satzes
hinter den phonetischen oft zurück.
Welches nun die phonetischen Elemente des Satzes sind,
wird ein Beispiel rasch erläutern. Der Satz gipmirdasbuxer
zerfällt begrifflich ein für allemal in die Wörter gip, mir, das,
bux, 'er = ‘gieb mir das Buch her’ ; phonetisch aber hat er
zunächst nur zwei Theile, gipmirdas und buxer. wenn ich gip
und bux ‘betone’ ; er kann aber auch zerlegt werden in gipmir|
das|buxer, gipmirdas(|)bu|xer. gipmirdasbu|xer wenn ich das,
bux oder endlich cer ‘betone’. Die phonetischen Theile des
Satzes sind hier Gruppen von Silben, deren Anfang
jedesmal durch eine ‘betonte’, d. h. hier stärker
gesprochene, Silbe markirt wird. Solche Gruppen
kann man als Sprachtakte bezeichnen (Sweet nennt sie
stress-groups). Von den musikalischen Takten unterscheiden
sie sich durch grössere Freiheit des Baues ; sie haben weder
eine gleiche, fest bestimmte Dauer, noch ist ihre innere Gliederung
stets ein und dieselbe : unser obiges Beispiel lieferte
ein-, zwei- und dreitheilige Gruppen, die einander an Selbständigkeit
vollkommen coordinirt waren.
In den obigen Beispielen zeigten alle Takte fallenden
Rhythmus, d. h. sie begannen mit der stärksten Silbe der
Gruppe. An sich sind auch Takte mit steigendem Rhythmus
möglich, z. B. giper, (altan = gieb her, halt an, ja
man kann selbst den Satz gipmirdasbuxer als einen einzigen
steigenden Takt sprechen, wenn man über die ersten vier
Silben ganz rasch hinweggleitet und der letzten einen besonders
starken Nachdruck giebt. Aber im Allgemeinen sind
steigende Takte seltener üblich, am ersten noch wenn sie
isolirt stehen, wenigstens nach ihrem Ende zu. Denn sobald
an die starke Schlusssilbe des Taktes sich noch andere Silben
anreihen, so verschiebt sich oft unwillkürlich die Takttheilung
so, dass die starke Silbe zur Anfangssilbe eines fallenden
Taktes wird. Die schwächeren Silben des steigenden Taktes
erscheinen dann als eine Art Auftakt. Wir sprechen z. B.
179den Satz ergip(t)mirdasbux nicht mit iambisch-anapästischem
Rhythmus ergip(t) | mirdasbux |, sondern mit Auftakt und
trochaisch-dactylischem Rhythmus er|gip(t)mirdas|bux. Im
Verse aber gestatten wir gleich gern steigende wie fallende
Takte, die selbstverständlich mit den Verstakten zusammenfallen,
so zwar, dass die ‘stärkste Silbe’ des Sprachtaktes die
Ictussilbe des Verses bildet.
Anm. 1. Man kann die Sprachtakte in der Schrift mit Sweet durch
Spatien zwischen denselben andeuten. Auch die Auftakte schreibt Sweet
getrennt ; ihren Charakter als unbetonte Silben markirt er durch vorgesetztes- ;
der obige Satz würde danach zu schreiben sein -er gip(t)mirdas
bux. — Es ist mir übrigens zweifelhaft ob Sweet Recht hat, durchaus nur
fallende Takte zu statuiren. Mir scheint es dass wir im Deutschen,
namentlich bei erregterer Sprechweise, auch in entschieden iambisch-anapästischen
Rhythmus verfallen, der durch grössere Lebhaftigkeit von
dem ruhigeren trochaisch-daktylischen Gange verschieden ist. Man denke
sich z. B. den Satz ‘er gibt mir das Buch und geht weg’ in aufgeregt
ärgerlichem Ton, mit dem Nachdruck auf dem Ende, gesprochen, so wird
glaube ich dem unbefangenen Hörer die Abtheilung ergip(t)| mirdasbu. |
xungetwex als die natürlichere erscheinen. Die grössere Häufigkeit der
fallenden Takte in den germanischen Sprachen mag wohl im Zusammenhang
stehen mit der dort vorherrschenden Stammsilbenbetonung, die der
Hauptmasse der Wörter fallenden Rhythmus verleiht. In wie weit etwa
Sprachen mit freiem Accent den steigenden Sprachtakten grösseres Gebiet
gewähren, wird noch zu untersuchen sein.
In sehr vielen Fällen werden sich in Sprachen wie der
deutschen Worte und Sprachtakte decken ; nämlich stets da,
wo ein Satz aus einer Reihe von im Allgemeinen nicht mehr
als zwei- oder dreisilbigen Wörtern besteht, die sämmtlich
mit ihrer ‘betonten Stammsilbe’ beginnen, z. B. die feindlichen
Reiter kamen gestern wieder. Aber eben so oft kommt
es auch vor, dass einzelne Wörter auf verschiedene Takte vertheilt
werden, ohne dass dadurch die Sprache das Geringste
an Deutlichkeit einbüsst : in dem Satze -wo zindige fatenen
= ‘wo sind die Gefangenen’ gehört das ge- von ‘Gefangenen’
phonetisch ebensogut zum Vorhergehenden, wie die letzte
Silbe von ‘feindlichen’ im vorigen Beispiel. Auch das begrifflich
selbständige di steht phonetisch nicht anders da als die
Mittelsilbe li des genannten Wortes : wieder ein Beweis dafür
dass eine begriffliche Analyse des Satzes nicht stattfindet,
welche nothwendig auch eine phonetische Bindung des begrifflich
Zusammengehörigen und eine phonetische Trennung
des begrifflich Unverbundenen hätte hervorrufen müssen.
Anm. 2. Dieser Gesichtspunkt ist für die Lehre von den ‘unbetonten’
Wörtern, wie Enkliticae und Prokliticae etc., von grösster Bedeutung,
180aber sehr oft zu Gunsten theoretischer Erwägungen über die Nothwendigkeit
phonetischer Selbständigkeit begrifflich selbständiger Satztheile
hintangesetzt worden ; beispielsweise in der Lachmann'schen Formulirung
der mittelhochdeutschen Metrik, welche lehrt dass nicht ein selbständiges
Wort zu Gunsten einer Endsilbe eines andern in die Senkung gesetzt werden
dürfe (in Fällen wie mhd. wagen den lip), weil es als selbständiges
Wort Anspruch auf grössere Hervorhebung habe.
Allerdings ist die Takttheilung einer gegebenen Wortreihe
nicht ohne Weiteres gegeben ; sie kann in jedem
Augenblicke absichtlich und willkürlich vom begrifflichen
Standpunkt aus verändert werden ; die Wörter er hat das Buch
können gesprochen werden als er’ atas bux (ér hat das Buch),
-er 'atas bux (er hát das Buch), -era tasbux (oder tas bux, er
hat dás Buch) und als -eratas bux (er hat das Búch). Aber
man kann wohl behaupten, dass jede begrifflich fixirte Wortreihe,
d. h. jeder Satz als Ausdruck eines bestimmten Gedankens
auch einen unveränderlichen phonetischen Ausdruck
habe, namentlich auch in Bezug auf die Takttheilung. Form
und Inhalt gehen hier untrennbar zusammen, mit jeder Veränderung
der Form wechselt auch der Inhalt, wie das eben
gegebene Beispiel lehren mag.
2. Die Abstufung der einzelnen Theile (Silben)
der Sprachtakte.
2. Die Abstufung der einzelnen Theile (Silben)
der Sprachtakte. Ein Sprachtakt kann unter Umständen
durch eine einzige Silbe gebildet werden, gewöhnlich aber
reihen sich ihrer mehrere zu einem Takte zusammen ; am
häufigsten sind zwei- und dreitheilige oder -silbige Takte,
aber auch viersilbige sind nicht selten. Die einzelnen Silben
unterscheiden sich durch verschiedene Intensität oder Stärke,
und zwar hat im fallenden Takt die erste, im steigenden Takt
die letzte Silbe die grösste Stärke. Man bezeichnet diese Silbe
grösster Stärke herkömmlich als die Tonsilbe der betreffenden
Gruppe, oder sagt, dass sie betont sei, den Ton oder
Accent schlechthin habe. Mit Rücksicht darauf aber, dass
die Hervorhebung der Silbe hier lediglich durch eine Verstärkung
geschieht, die Verstärkung aber wieder von der Exspiration
abhängig ist, so spricht man genauer von exspiratorischem
Accent (Brücke, Verner), oder da es sich um
grösseren oder geringeren Nachdruck bei der Hervorbringung
handelt, kürzer und bequemer von emphatischem Accent
(emphasis Ellis, stress Sweet).
Die Charakteristik eines Sprachtaktes in exspiratorischer
Hinsicht wird bedingt einerseits durch die absolute Stärke
(Nachdruck, Lautheit), mit der seine einzelnen Theile hervorgebracht
181werden, dann aber wesentlich durch das Verhältniss
in dem seine einzelnen Theile zu einander stehen. Das
letztere ist von der absoluten Stärke unabhängig ; es ist für
die Abstufung der Stärke in den beiden Silben des Taktes
habe gleichgültig, ob derselbe lauter oder leiser gesprochen
wird, da mit zunehmender Stärke der ersten Silbe auch die
Stärke der zweiten wächst und umgekehrt beim Abnehmen.
Der Abstand der starken Silben von den schwächeren kann
ein sehr verschiedener sein. Im Deutschen ist er z. B. ein
sehr grosser, und so pflegt er es überhaupt gern in solchen
Sprachen zu sein, welche wie das Deutsche so gut wie rein
emphatischen Accent haben, d. h. eben die einzelnen Silben
des Taktes oder Satzes nur nach ihrer Stärke abstufen. In
andern Sprachen, wie den romanischen, den slawischen, dem
Schwedischen etc. ist der Stärkeunterschied ein geringerer,
so dass die schwachen Silben jener Sprachen von den Deutschen
meist als halbstark oder einen Nebenaccent tragend
empfunden werden.
Es gibt nämlich nicht nur eine zweifache Abstufung der
Silbenstärke — starke und schwache Silben —, sondern es
sind sehr häufig Mittelstufen entwickelt. In einem Takte wie
redete sind die beiden Schlusssilben schwächer als die erste,
zugleich aber ist die letzte etwas stärker als die zweite, und
man pflegt daher zu sagen, dass sie einen (emphatischen) Nebenaccent
trage. Einfacher ist es, direct starke, mittelstarke
(oder halbstarke) und schwache Silben zu
unterscheiden. Zur Bezeichnung verwenden wir im Anschluss
an den Gebrauch der englischen Phonetiker · nach
dem Sonanten der starken, : nach dem Sonanten der mittelstarken
Silben, die schwachen Silben bleiben unbezeichnet.
Das Beispiel von S. 179 würde hiernach gi·pmirda :s bu·xe :r
zu schreiben sein.
Anm. 3. Die Unterscheidung dieser drei Stufen deckt sich mit der
Lachmannischen Unterscheidung von Hochton, Tiefton, Unbetontheit.
Diese Namen aber sind phonetisch nicht verwendbar, da es
sich nicht um Höhe und Tiefe, überhaupt nicht um Töne (d. h. Tonhöhen)
handelt, sondern ausschliesslich um Stärke und Schwäche der betreffenden
Silben. Man müsste also jene Ausdrücke, um sie verwendbar zu machen,
mindestens in (emphatischer oder exspiratorischer) Hauptaccent, Nebenaccent
und Unaccentuirtheit verwandeln, da wir das Wort
‘Accent’ einmal als neutralen Ausdruck sowohl für Stärke- wie für Tonhervorhebungen
verwenden.
Ueber die Lagerung der Silben mittlerer Stärke zu den starken
182Silben lassen sich feste Regeln nicht geben. Im Deutschen
folgt im zweisilbigen Takt auf die starke Silbe in der
Regel eine schwache, wie in gà·be, 'á·tn, 'á·ndl Gabe, hatten,
Handel ; mittelstarke meist nur, wenn die zweite Silbe einen
‘vollen Vocal’ enthält, wie in á·na :, ö·to :, wí·rkli :% Anna,
Otto, wirklich. In mehrsilbigen Takten macht sich meist das
Bestreben geltend, schwache Silben mit stärkeren regelmässig
abwechseln zu lassen, d. h. es folgt auf die starke Anfangssilbe
eine schwache, dann eine mittelstarke, wieder eine
schwache, mittelstarke u. s. w.
Was das Verhältniss der Taktabstufung zur Wortaccentuirung,
d. h. zur Abstufung der Silben im Worte anlangt,
so sind selbstverständlich die stärksten Silben der Wörter, die
starken Silben der Takte, und diese pflegen in den meisten
Fällen festzustehn. Auch die mittelstarken Silben der Wörter
geben im Allgemeinen mittelstarke Silben im Takte ab. Aber
die Vertheilung der mittelstarken Silben im Worte ist, wenigstens
im Deutschen, nicht immer eine feststehende, sondern
sie richtet sich oft auch nach der Zusammensetzung des Taktes
oder der Takte, welche das Wort füllt, namentlich bei
mehr getragener Recitation, insbesondere im Verse. Bei
raschem Sprechen von mehrtaktigen Sätzen aber lassen wir
oft eine an sich mittelstarke Silbe durch eine folgende stärkere
zur schwachen Silbe herabdrücken ; wir sagen z. B.
mu-tige : in Pausa (mu·ti :ge ist meines Wissens nicht volksthümlich),
aber mu·tie me·ner u. dgl.
Anm. 4. Diese Variabilität der schwächeren Silben erstreckt sich
auch auf die eines eigenen Nachdrucks entbehrenden Wörter, namentlich
wieder die Enkliticae u. dgl. Wir sagen z. B. -wo zai·tirge( :) we·zn, wo
seid ihr gewesen, d. h. das ir hat die schwächste Stelle im Takt, wenn
auch das ge kaum merkbar stärker ist ; aber bei der Vermehrung des
Taktes um eine Silbe, z. B. in wo·zaiti :rge wezn (Nachdruck auf wo) wird
tir mittelstark und zai schwach (man beachte, dass nicht die ebenfalls
häufige Aussprachsweise wo·zai :tirge wezn mit gedehntem starkem wo
und übermittelstarkem, fast einen neuen Takt einführenden zai gemeint
ist). — Man vergleiche auch häufige Betonungen wie 'a·ndarbai :tn Handarbeiten,
u·nfolšte :ndix unvollständig, oder wie -di au·sfy ru·mender ‘e·ren
die Ausführungen der Herren, etc.
Anm. 5. Es ist oft sehr schwer über die Stärkeverhältnisse der
schwächeren Silben in's Klare zu kommen, zumal man gewöhnlich bestimmte
Vorstellungen darüber mitbringt, namentlich wie die oben Anm. 1.
erwähnten Ansichten über die Stärke ‘selbständiger Wörter’. Man darf
auch nicht einzelne Silbengruppen aus dem Satze herausnehmen, weil sich
dabei gar zu leicht die Takttheilung und damit die relative Stärke der
einzelnen Silben verschiebt- Sweet empfiehlt daher S. 92 nur die zu untersuchenden
183Silben des Satzes mit lauter Stimme auszusprechen, die andern
sich nur gesprochen zu denken oder sie zu flüstern.
3. Die Abstufungen der Satztakte.
3. Die Abstufungen der Satztakte. Auch die einzelnen
Takte des Satzes können unter einander mannigfach
abgestuft sein. Man muss hier zweierlei unterscheiden : die
bis zu einem gewissen Grade feststehende, natürliche Abstufung
benachbarter Takte, und die willkührlich wechselnde
Abstufung von Takten beliebiger Stellung zum Behufe von
Modifikationen des Satzinhaltes.
Die erstere Art der Abstufung vergleicht sich der Abstufung
der einzelnen Silben im Takte ; sie dient dazu, den Eindruck
der Monotonie im gesprochenen Satze zu verhüten.
Am deutlichsten tritt sie für uns hervor, wo die Nachbartakte
sich über ein einziges Wort erstrecken, das ja in der Regel
eine feste Abstufung der einzelnen Silben zeigt. In ko·nstanti :
no·pl : enthalten beide Takte eine starke Silbe ; functionell
steht die Silbe kon der Silbe no völlig gleich ; aber ihre absolute
Stärke ist verschieden, da der Takt nopl an sich stärker
ist als der vorausgehende. Im Deutschen, das einfache Wörter
von bedeutender Länge kaum kennt, tritt diese Erscheinung
am häufigsten in Compositis auf, z. B. a·ltertu :ms ku·nde ;
der Anfangstakt ist hier meist der stärkere.
Anm. 6. Nach Lachmann's Auffassungsweise hat die Stammsilbe des
zweiten Gliedes von Compositis im Deutschen bekanntlich einen ‘Tieften’,
d. h. nur Mittelstärke ; dies ist vom phonetischen Standpunkt aus unrichtig,
wenn es als allgemeine Regel gelten soll. Zwar kann im Compositum
die Stammsilbe eines zweiten Gliedes zu blosser Mittelstärke und noch
weiter herabgedrückt werden, ursprünglich aber bezeichnet die Stammsilbe
des zweiten Gliedes den Eintritt eines neuen Hauptacc
entes (Lachmann's
Hochton), der nur nicht ganz die Stärke des vorausgegangenen erreicht,
mithin als ein Hauptaccent zweiten Grades zu bezeichnen wäre.
Bei diesen natürlichen Abstufungen ist der Stärkeunterschied
der benachbarten Takte im Ganzen kein sehr bedeutender.
Dagegen treten bei jenen willkührlichen Abstufungen
auch grössere Differenzen auf, und zwar wächst die absolute
wie relative Stärke eines Taktes um so mehr, je mehr Gewicht,
‘Nachdruck’ auf seinen Begriffsinhalt gelegt wird.
Durch solche Veränderungen des Nachdrucks der auf einzelne
Satztheile (von der einfachen Silbe bis zum vielsilbigen
Worte hinauf) gelegt wird, verschiebt sich oft auch die
ganze Takteintheilung des Satzes, nämlich stets da, wo eine
bei gewöhnlicher Sprechweise schwächere Silbe zur Nachdruckssilbe
gemacht wird : denn dadurch wird sie zur Anfangssilbe
184eines neuen Taktes. Man vergleiche z. B. die Variationen
des oben Anm. 4 analysirten Satzes ‘wo seid ihr
gewesen’ als wo·zaithi :rgewezn, -wo zai·tirge : wezn, wo·zai ti·rge
wezn (oder -wozai ti·rge wezn) etc. mit ‘Nachdruck’ auf wo,
seid, ihr etc.
Es ist oft schwer, zwischen einem langen Takte mit gewichtiger
mittelstarker Silbe und zwei vollen Takten mit fallender
Stärke zu unterscheiden. Man kann das Wort 'Alterthumskunde
(S. 184) sowohl als a-·ltertu :ms ku·nde, wie als
a·ltertumsku :nde sprechen und auffassen. Es hängt das wesentlich
von der Stellung im Satze und den Nachdrucksverhältnissen
der benachbarten Takte ab, auch die Quantität spielt
eine Rolle dabei. Steht eine solche Silbenreihe wie altertumskunde
am Ende eines Satzes, wo die Quantität der einzelnen
Silben überhaupt gesteigert zu werden pflegt (s. § 35),
so spaltet sie sich leicht in zwei Takte, d. h. die zweitstärkste
Silbe erhält einen emphatischen Accent ersten Grades ; z. B.
in dem Satze -erbe zu·xtedi fo·rle :zuneny :ber (oder fo·rlezu :tdeny :ber)
gri·yiše a·ltertu. :ms ku·nde ‘er besuchte die Vorlesungen
über griechische Alterthumskunde’. Steht aber eine
solche Reihe nachdrucksloser im Innern des Satzes, und liegt
insbesondere der Nachdruck auf einem späteren Takte, so
wird zugleich mit einer Minderung der Quantität auch der
Nachdruck der ganzen Reihe geschwächt, und die zweitstärkste
Silbe dadurch zum Range einer bloss mittelstarken
Silbe herabgedrückt, z. B. in dem Satze -di a·ltertumsku·ndeistai·ne
wi·snšaftwe :l%e… ‘die Alterthumskunde ist eine Wissenschaft
welche…’ Man könnte hier auch abtheilen -di
altertums kundeist aine wisnšaft wel/e, man müsste dann aber
dabei noch ausdrücklich anmerken und bezeichnen, dass der
zweite und dritte Takt zum ersten, der fünfte Takt zum vierten
in einem durchaus untergeordneten Verhältniss stehen.
Zieht man es aber vor, die untergeordneten Takte mit den
dominirenden zusammenzuziehen, so muss man in ähnlicher
Weise doch auch den Accentabstufungen der Einzelsilben
noch Rechnung tragen. In dem oben gegebenen Takte a·ltertumsku :ndeistai :ne
haben wir zwar zwei mittelstarke Silben,
aber dieselben sind doch nicht absolut gleich an Stärke, ferner
ist die dritte hier als ‘schwach’ bezeichnete Silbe tums stärker
als die ebenfalls ‘schwache’ zweite ter, ebenso die Silbe ist
stärker als de, und wiederum stehen weder diese beiden stärkeren
185Silben tums und ist einander an Stärke völlig gleich,
noch die beiden schwächsten ter und de.
Die Schwierigkeit der Bezeichnung wächst natürlich mit
der Anzahl der Glieder, deren Abstufung zu bezeichnen ist.
Es empfiehlt sich daher vielleicht aus praktischen Gründen,
so viele Takte auszusondern als möglich, und die relative
Stärke dieser Takte durch vorgesetzte Ziffern anzugeben, dergestalt,
dass 1 einen Takt grösster Stärke, 2, 3, 4 etc. Takte
von continuirlich geringer werdender Stärke andeuten ; dann
erspart man sich die Bezeichnung der Abstufung der einzelnen
Silben, da dieselbe sich in den so gewonnenen kürzeren Takten
leicht von selbst regelt ; also etwa 5erbe 2zuxtedi 1 fo·rle :zune
4nyber 2griyiše 1altertums 3kunde.
§ 34. Der tonische Wort- und Satzaccent.
1. Vorbemerkungen.
1. Vorbemerkungen. Wie in der Musik der Wechsel
von Tönen verschiedener Höhe (hoch und tief) nichts mit dem
Wechsel der Stärke derselben (forte und piano) zu thun hat,
so ist auch die chromatische Tonbewegung in der Sprache
unabhängig von der Exspirationsbewegung welche die Stärkeabstufungen
der einzelnen Laute, Silben, Takte u. s. w. regulirt.
Man kann einen lauten Ton tief und einen leisen Ton
hoch singen, man kann ebenso eine starke Silbe mit tiefem,
eine schwache Silbe mit hohem Ton sprechen, und es beruht
auf einem vollständigen Verkennen nicht nur der theoretischen
Möglichkeiten, sondern auch der thatsächlichen Verhältnisse,
wenn man behauptet hat, die stärkste Silbe des
Wortes müsse auch den höchsten musikalischen Ton haben.
Man pflegt zur Begründung dieser Behauptung wohl zu sagen,
dass das stärkere Anblasen der Stimmbänder in starken Silben
den Ton derselben in die Höhe treiben müsse, wie das bei
jedem andern Zungenwerk geschieht, aber man lässt dabei
ausser Acht, dass die Stimmbänder nicht eine ein für allemal
fixirte Stimmung haben, wie die Zunge eines Zungenwerks,
sondern dass die Wirkung des stärkeren Anblasens
durch den Mechanismus des Kehlkopfs vollkommen compensirt
werden kann. Wenn demnach im Deutschen z. B. in
einem beliebigen zweisilbigen Worte wie morgen die erste
Silbe nicht nur stärker als die zweite ist, sondern auch musikalisch
186etwas höher liegt, so ist dies keineswegs die nothwendige
Folge der stärkeren Aussprache der ersten Silbe, sondern
nur eine dieselbe gewohnheitsmässig begleitende Erscheinung.
Dass dieselbe aber nicht einmal im Deutschen stets mit den
starken Silben verknüpft ist, lehrt sofort die Vergleichung
der verschiedenen Tonstufen, welche dasselbe Wort etwa am
Schlüsse eines Aussage- und eines Fragesatzes annimmt. In
dem Satze ich komme morgen ist die Silbe mor stärker und
höher als die Silbe gen, aber in der Frage kommst du morgen ?
ist mor zwar stärker als gen, aber es liegt musikalisch tiefer :
die Stärke nimmt durch das Wort morgen hindurch ab, aber
die Tonhöhe steigt. Dasselbe Resultat bezüglich der Unabhängigkeit
der Tonhöhe von der Stärke eines Lautes, einer
Silbe u. s. w. folgt übrigens auch aus der Erwägung, dass
innerhalb der Einzelsilbe verschiedene Arten der Tonbewegung
möglich sind, vgl. § 30.
Allerdings wird die Freiheit der Tonbewegung in manchen
Sprachen, wie dem Deutschen und Englischen, gewohnheitsmässig
sehr eingeschränkt, d. h. die Tonbewegung dient
hauptsächlich nur zur Charakterisirung der verschiedenen
Satzarten u. dgl. (wie in dem gegebenen Beispiel von Aussage und
Fragesatz). Im einfachen Aussagesatz aber geht sie hier
gemeiniglich mit den Stärkeabstufungen parallel, d. h. die
Tonhöhe richtet sich mehr oder weniger nach der Stärke und
wird deshalb nur selten als etwas selbständiges empfunden.
Solche Sprachen besitzen demnach einen wesentlich emphatischen
Wortaccent, der tonische Wortaccent ist an diesen
gebunden (und meist sind seine Abstufungen nicht sehr merklich),
nur der tonische Satzaccent ist frei. In andern
Sprachen dagegen giebt es ebenso freie Wortmodulationen,
wie im Deutschen oder Englischen Satzmodulationen : Modulationen,
die dem einzelnen Worte an sich inhäriren, unabhängig
von dessen Stellung im Satze und von der Modulation
des Satzes, nur mit der letztern sich eventuell kreuzend oder
cumulirend. Solche Sprachen besitzen dann, um es in Kürze
auszudrücken, auch einen freien tonischen Wortaccent.
Beispiele solcher Sprachen sind die S. 170 aufgezählten, die
sich zugleich durch eine gute Ausbildung der verschiedenen
Arten des tonischen Silbenaccents auszeichneten.
Anm. 1. Am deutlichsten zeigt sich die Wichtigkeit des tonischen
Wortaccentes in Parallelen wie norw. Vesten ‘der West’ und ‘die Weste’,
Bònner ‘Bauern’ und ‘Bohnen’, Taget ‘das Dach’ und ‘genommen’ etc.
187(Storm, Om Tonef. 3 f. [286 f.]), die sich wesentlich durch ihre musikalische
Modulirung unterscheiden.
2. Der tonische Wortaccent.
2. Der tonische Wortaccent. Dreierlei ist in der
tonischen Charakteristik des Wortes hauptsächlich zu beachten :
a) Die Tonhöhen der einzelnen Silben und ihre
Intervalle überhaupt
a) Die Tonhöhen der einzelnen Silben und ihre
Intervalle überhaupt. Man geht hier am besten von
dem tiefsten Tone aus, den ein Wort in irgend einer Silbe
aufweist ; man kann diesen als Grundton bezeichnen (die
Schweden nennen ihn Gravis). Von ihm aus werden die
Intervalle gemessen um die sich die übrigen Silben von ihm
entfernen. Wie viele Abstufungen der Tonhöhe anzusetzen
seien, lässt sich nicht allgemein bestimmen, auch die Grosse
der Intervalle ist eine sehr verschiedene. Noreen findet z. B.
in der Mundart von Fårö drei Stufen, die er als Gravis, hohen
Gravis und Acut bezeichnet ; der zweite liegt eine Secunde
über dem Gravis, der dritte eine Terz ; ausserdem giebt es
einen doppeltönigen Circumflex aus Terz + Grundton ; in der
Mundart von Dalby bestehen die drei ersten Töne aus Grundton,
kleiner Terz und Quinte, dazu kommt ein Circumflex aus
der kleinen Terz + Quinte ; die Mundart von Fryksdal dagegen
kennt nach Noreen vier einfache Tonabstufungen, den
tiefen Gravis = Grundton, den hohen Gravis = Terz, den
tiefen Acut = übermässiger Quart, und den hohen Acut =
Quinte ; dazu drei Circumflexe, s. S. 171.
b. Die Anordnung in der die einzelnen Töne
oder Intervalle auf einander folgen
b. Die Anordnung in der die einzelnen Töne
oder Intervalle auf einander folgen. Auch hier verdanken
wir die genauesten Beobachtungen wieder Noreen.
In dem Dialekt von Fårö ist nach seinen Untersuchungen die
Reihenfolge hoher Gravis, Akut, Gravis, Gravis, in dem von
Fryksdal tiefer Akut, tiefer Akut, Akut, Gravis, hoher Gravis,
Akut. Diese Regel erstreckt sich auch auf die zweitönigen
Circumflexe ; jede circumflectirte Silbe gilt gleich zwei auf
einander folgenden Silben, welche die im Circumflex vereinigten
Töne einzeln enthalten. Dagegen findet in diesen
Mundarten, wie nochmals ausdrücklich bemerkt werden muss,
keine feste Beziehung zwischen Stärke und Tonhöhe der
Silben statt.
c. Die Richtung der Stimmbewegung in den
einzelnen Silben
c. Die Richtung der Stimmbewegung in den
einzelnen Silben. Im Deutschen und Englischen haben
meist alle Silben eines Wortes gleichmässig fallenden Silbenaccent
(S. 170), z. B. in dem Satze ich komme morgen ; in dem
Fragesatz kommst du morgen ? haben dagegen beide Silben von
188morgen steigenden Silbenaccent. Die Richtung der Stimmbewegung
innerhalb desselben Wortes ist in beiden Fällen
die nämliche, man kann also hiervon einem gleichlaufenden
Tonfall reden. In anderen Sprachen ist es dagegen
üblich, Silben mit entgegengesetzter Richtung des Silbenaccents
zu verbinden. Im Norwegischen und Schwedischen
herrscht z. B. nach den Untersuchungen von Storm, Sweet,
Kock u. A. in ursprünglich zweisilbigen Wörtern die Verbindung
von fallendem mit steigendem Accent (v. s. S. 170) ;
die stärkere Stammsilbe hat den tieferen und fallenden, die
schwächere Endsilbe den höheren und steigenden Ton. Im
Serbischen dagegen existirt nach Masing die umgekehrte Verbindung
von hohem steigendem mit hohem fallendem Ton (a)
in alten zweisilbigen Oxytonis u. s.w., z. B. in voda Wasser,
im Gegensatz zu dem ursprünglich barytonirten Accusativ
vodu mit gleichlaufendem Tonfall und emphatischem Accent
auf der ersten Silbe bei tieferer Stimmlage. Wir können diesen
zweiten Tonfall als den gebrochenen bezeichnen.
Der gebrochene Tonfall ist übrigens auch in deutschen
Mundarten hie und da anzutreffen. Irre ich nicht, so ist das
Charakteristicum des sog. ‘rheinischen Accents’ der steigend-fallende
Wortaccent, während mir manche Schweizermundarten
den fallend-steigenden Tonfall zu haben scheinen. Aber
die Intervalle des Steigens und Fallens der Stimme sind hier
nicht so gross als etwa im Schwedischen und Serbischen, und
das macht die Sache weniger leicht wahrnehmbar.
Anm. 2. Der gebrochene Tonfall eines zweisilbigen Wortes ist vollständig
zu parallelisiren mit den doppeltönigen Silbenaccenten, S. 170 ;
sprachgeschichtlich sind auch gar häufig Monosyllaba mit Circumflex durch
Verkürzung von mehrsilbigen Wörtern entstanden, deren Dauer, Exspirationsbewegung
und musikalische Modulation sammt und sonders in die
eine Silbe zusammengerückt sind (vgl. auch § 35, 3, a.). Einzelne Beispiele
hierfür gewähren namentlich wieder die Arbeiten von Noreen über schwedische
Dialekte.
3. Der tonische Satzaccent.
3. Der tonische Satzaccent. Auch bezüglich der
tonischen Charakteristik des Satzes hat der Beobachter sein
Augenmerk auf verschiedene Punkte zu richten. Namentlich
lerne man zunächst diejenigen Eigenheiten, welche dem ganzen
Satz zukommen, von denjenigen scheiden, welche einzelne
Theile derselben betreffen. Zu den ersteren gehört insbesondere :
a. Das Sprechen in einer gewissen Stimmlage
a. Das Sprechen in einer gewissen Stimmlage
189(vgl. Sweet S. 95). Für gewöhnliche Zwecke genügt es mit
Sweet drei Stufen derselben anzusetzen, eine hohe, mittlere
und niedere. Die erste bezeichnet Sweet durch vorgesetztes
f~, die letzte durch vorgesetztes L, die mittlere
Stimmlage bleibt unbezeichnet. Die eigentliche Modulation
des Satzes wird durch die verschiedenen Stimmlagen nicht
beeinflusst. Diese selbst richten sich theils nach der natürlichen
Beschaffenheit des Stimmapparates (wonach z. B. Kinder
und Frauen in einer höheren Stimmlage sprechen als
Männer), theils dienen sie in willkürlichem Wechsel zum
Ausdruck verschiedener Stimmungen oder logischer Verhältnisse.
Hohe Stimmlage ist den Ausdrücken starker und freudiger
Erregungen eigen, tiefe Stimmlage denen der Trauer
oder der Feierlichkeit ; wiederum werden Fragen mit höherer
Stimmlage, und parenthetische Schaltsätze mit tieferer Stimmlage
gesprochen als einfache Aussagesätze u. s. w.
Man kann auch während des Sprechens aus einer Stimmlage
in die andere übergehen, entweder sprungweise oder
allmählich. Allmähliche Steigerung der Stimmhöhe — wie
man sie z. B. beim Ausdruck steigender Aufregung und Leidenschaft
hört — bezeichnet Sweet durch vorgesetztes /(~,
allmähliches Sinken durch \l
Anm. 3. Eine andere hierher gehörige Eigenheit ist das Tremuliren
oder Beben der Stimme, welches im Wesentlichen auf einem Zittern
im Kehlkopf beruht, das geringe Schwankungen in der Stärke und Tonhöhe
der Stimme hervorruft. Ferner kann man hierher rechnen die
gleichmässige Anwendung eines bestimmten Silbenaccentes
durch den ganzen Satz hindurch, um diesem einen bestimmten Ausdruck
zu verleihen ; z. B. die Anwendung eines nur um ein sehr geringes
Intervall steigenden Silbenaccents bei relativ hoher Stimmlage zum Ausdruck
klagender, weinerlicher Stimmung (Sweet S. 95) etc.
Zur zweiten Abtheilung fällt :
b. Die eigentlicheModulirung des Satzes
b. Die eigentlicheModulirung des Satzes. Auch
hier muss man wieder lernen zu unterscheiden zwischen gewissen
allgemeinen Tendenzen der Satzmodulirung und dem
Wechsel der Tonhöhen im einzelnen Falle. Es lässt sich z. B.
gar keine Auskunft darüber geben, welche Intervalle überhaupt
die Stimme in einem Satze durchlaufen könne ; denn
es kommen da je nach den Umständen und der Stimmung des
Sprechenden die allergewaltsamsten Sprünge vor, während
anderwärts der ganze Satz monoton heruntergeleiert wird.
Wohl aber scheint durch die meisten Sprachen z. B. die Tendenz
durchzugehn den Satzschluss in bestimmter Weise
190zu moduliren. Im Schlüsse des Aussagesatzes beispielsweise
fällt die Stimme, im Schlüsse des Fragesatzes steigt sie zu
grösserer Tonhöhe empor.
Anm. 4. Für fast alle diese Fragen, wie auch die weiteren nach der
Einwirkung des emphatischen Satzaccentes auf den tonischen, oder die
Kreuzungen des tonischen Wort- und Satzaccentes fehlt es noch sehr an
eingehenden Einzeluntersuchungen. Beispiele von musikalischen Satznotirungen
gibt z. B. Merkel, Laletik S. 412—428. Auch die vorhergehenden
Untersuchungen über Accent im Allgemeinen, S. 330 ff. enthalten
sehr viele richtige und feine, dabei durchaus noch nicht genügend gewürdigte
Beobachtungen, die nur leider wegen des zu wenig ausgedehnten
sprachlichen Gesichtskreises des Verfassers in einer den speciellen Zwecken
der Sprachwissenschaft wenig entsprechenden Form niedergelegt sind.
Anhang.
Die verschiedenen Qualitäten der Stimme.
In erster Linie kommen hier die verschiedenen Arten der
Rauhheit oder Glätte des Stimmtons in Betracht. Solche Abstufungen
dienen ebenfalls wieder zum Ausdrucke verschiedener
Stimmungen. Die Scala derselben ist sehr umfänglich.
Sie erstreckt sich von den sanftesten flötenartigen Tönen der
lyrischen Declamation bis zu den heiseren Tönen der verbissenen
Wuth und des Hasses. Einige Angaben hierüber
s. bei Merkel, Laletik S. 356 ff.
Andere Eigentümlichkeiten die auf den Gesammtklang
der Sprache einwirken können, wie das helle oder dunkle
Timbre, Verengung der Bänderglottis, geringere oder stärkere
Mundöffnung etc. (Sweet S. 97 ff.) können kaum noch zu den
musikalischen Charakteristicis des Satzes gerechnet werden.
§ 35. Die Quantität der einzelnen Satztheile.
1. Die Quantitäten der Silben an sich.
1. Die Quantitäten der Silben an sich. Für die
Silben gelten dieselben Abstufungen der Dauer, wie wir sie
oben S. 161 für die einzelnen Laute festgestellt haben. Es
fragt sich nur, wann eine Silbe für kurz oder lang angesehen
werden muss. Die landläufige Gewohnheit bezeichnet Silben
wie ai, au, uo als lang, solche wie ar, al, am, at, as aber als
kurz, obwohl sie sämmtlich aus einem kurzen Vocal und
einem Consonanten bestehen (vgl. § 20, 2), folglich dieselbe
Quantität haben müssen. In Wirklichkeit können nur solche
Silben für kurz gelten, welche auf einen kurzen Sonanten
191ausgehn, also solche wie ra, la, pra, fra etc. Alle
geschlossenen Silben aber sind lang, ebenso wie diejenigen,
welche einen langen Sonanten enthalten. Man
nennt die letzteren bekanntlich natura, die ersteren positione
lang. Zu den Positionslängen gehören, wie man sieht, auch
alle sog. Diphthonge mit kurzem ersten Componenten.
Anm. 1. Die übliche Definition der positionslangen Silben spricht
allerdings von mehr als einem Consonanten hinter dem Sonanten ; in Wirklichkeit
aber genügt der Ausgang der Silbe auf einen Consonanten um sie
lang zu machen. Gewöhnlich gibt es nämlich silbenschliessende Consonanten
nur in dem Falle dass mehrere Consonanten zusammenstehen, vgl.
S. 172. Folgt auf den kurzen Sonanten im Satzinnern nur ein Consonant,
so wird dieser meist zur folgenden Silbe gezogen (S. 172) ausser etwa in
den Sprachen die sich des stark geschnittenen Accentes bedienen. Zu
diesen gehörten im Allgemeinen die classischen Sprachen nicht. Daher
begreift es sich, dass die antike Metrik einen Diphthongen wie ai, av vor
Consonanten stets als Länge messen musste wie jede andere Silbe aus kurzem
Vocal + Consonant, vor Vocalen aber ihn entweder als Kürze oder
als Länge behandelte ; im ersteren Fall geht das i, v als Consonant i,u
zur folgenden Silbe (um so leichter, je schwächer der vorausgehende Vocal
ist, also im Verse in der Senkung), im zweiten Falle wird es zur ersten
Silbe gezogen, wie der Consonant in deutsch Kammer etc. (S. 173, in der
Hebung des Verses, wegen der grösseren Intensität des Vocals}, wenn nicht
gar geminirte Aussprache eintrat (vgl. S. 124 f. und 174 ff.). Aus genau dem
gleichen Gesichtspunkt ist die verschiedenartige Behandlung der Gruppen
von Muta plus Liquida zu erklären.
Anm. 2. Diphthonge können hiernach nur kurz sein wenn sie zu
reinen Gleitlauten reducirt sind, d. h. nicht mehr in einen trennbaren sonantischen
und consonantischen Theil zerfallen ; vgl. § 24, 2.
Die relativen Unterschiede des Zeitmasses kurzer, langer
und überlanger Silben lassen sich nicht durch eine allgemeine
Formel ausdrücken, vielmehr gelten hier allein die Gewohnheiten
der einzelnen Idiome. Doch lassen sich allerdings
einige mehr oder weniger allgemeine Verknüpfungen der
Quantitätsabstufung mit andern sprachlichen Erscheinungen
auffinden. Namentlich scheint die Quantitätsabstufung in
einem gewissen Zusammenhang mit der Stärkeabstufung zu
stehen, dergestalt, dass Sprachen mit bedeutenden Unterschieden
in der Stärke einzelner Silben, wie das Deutsche und
Englische, auch bedeutendere Unterschiede in der Zeitdauer
der Silben besitzen als Sprachen, welche wie die romanischen
und slawischen, das Neugriechische und andere, die Silben
mit weniger verschiedener Stärke bilden. Ueberlange Silben
wiederum finden sich vielleicht am häufigsten und deutlichsten
192in Sprachen mit der Neigung zur Bildung zweigipfliger
Silben (S. 166 ff.) entwickelt, als Beispiel kann wieder besonders
das Englische, auch das Deutsche dienen. Ferner scheint
es, dass Sprachen mit Stammbetonung, d. h. mit trochaischem
Rhythmus des Einzelwortes, wie die germanischen, die Bildung
resp. Erhaltung von starken Längegraden begünstigen.
Für diese Sprachen ist es weiterhin charakteristisch, dass sie,
ausser in unemphatischen Silben, wenig entschiedene Kürzen
haben. Im Deutschen und Englischen macht z. B. die Anwendung
des stark geschnittenen Silbenaccentes alle Stammsilben
mit kurzem Vocal und einfachem Consonanten vor Vocal
zu halben Längen (in Fällen wie deutsch háte, ále, wáser, im
Gegensatz zu solchen wie Schweiz, bŏ-te, gĕ-be, lĕse, oben
S. 172 f.). Es ist deshalb vollkommen richtig zu sagen, das
Neuhochdeutsche kenne nur lange Stammsilben, nach mittelhochdeutschen
Begriffen sind nhd. bleter, šnite, Blätter,
Schnitte, nicht mehr verschleifbar (die mhd. Aussprache war
blè-ter, snì-te).
Wirklich kurze Silben der oben gegebenen Definition lassen
sich nur durch Verlängerung des kurzen Sonanten dehnen ;
sie sind deshalb in Sprachen, welche in den Vocalen genaue
Quantitätsunterschiede machen, überhaupt nicht leicht dehnbar.
Aus diesem Grunde gestattet z. B. die mhd. Metrik
nicht die Syncope der Senkung nach einer wirklich kurzen
Silbe, richtiger ausgedrückt die Dehnung einer kurzen Silbe
über einen ganzen Verstakt hin (die scheinbaren Ausnahmen
bei ‘kurzen’ Monosyllabis auf einen Consonanten erklären
sich von selbst ; diese ziehen im Ictus den Consonanten zur
vorausgehenden Silbe und werden dadurch lang).
Lange Silben dagegen sind unbedingt dehnungsfähig.
Haben sie langen Sonanten, so wird hauptsächlich dieser gedehnt ;
ist der Sonant kurz, so erfährt der folgende Consonant
die Dehnung. Man kann dies sehr deutlich bei der Declamation
oder dem Singen von Versen ‘mit Synkope von Senkungen’
beobachten ; vgl. z. B. die Silben rai, freu, šwim, šnai,
blit mit der Silbe mu in den beiden Zeilen des Blücherliedes
er reitet so freudig sein muthiges Pferd, er schwinget so schneidig
sein blitzendes Schwert. Hier erfahren die Consonanten i,.
u, J9, t die Dehnung, das letztere durch Einschiebung einer
Pause zwischen den durch stark geschnittenen Silbenaccent
markirten Verschluss und die zur Folgesilbe gezogene Oeffnung.
Genau dasselbe gilt aber auch von den Dehnungen
193langer Silben beim gewöhnlichen Sprechen, wie man leicht
erproben kann.
2. Das Tempo des Satzes und seiner Takte.
2. Das Tempo des Satzes und seiner Takte.
Hängt, wie wir gesehen, das relative Zeitmass der kurzen,
langen und überlangen Silben von den Gewohnheiten der
Einzelidiome ab, so richtet sich das absolute Mass derselben
in erster Linie nach dem Tempo des Taktes oder Satzes in
dem die Silbe steht. Man unterscheide aber wieder beim
Tempo die mittlere oder allgemeine Sprechgeschwindigkeit
der einzelnen Sprecher oder der einzelnen Idiome,
und das willkürlich wechselnde Tempo verschiedener
Satztheile. Das letztere geht wieder vielfach Hand in Hand
mit den Stärkeabstufungen der betreffenden Satzglieder, d. h.
nachdrückliche Silben oder Takte empfangen gewöhnlich zu
weiterer Hervorhebung langsameres Tempo, während über
nachdruckslose Silben oder Takte der Sprecher in raschem
Tempo hinweggleitet. Es gilt hier in ausgedehntem Masse
die Regel, dass, was man dem einen Theile des Satzes an
Stärke oder Dauer zulegt, den übrigen Theilen entzogen wird.
Als Beispiele mögen die oben S. 183, Anm. 4 angeführten
Sätze genügen.
3. Wechsel der Quantität einzelner Silben
unter dem Einfluss des Tempos und Nachdrucks.
3. Wechsel der Quantität einzelner Silben
unter dem Einfluss des Tempos und Nachdrucks.
Man unterscheidet naturgemäss Steigerungen und Minderungen
der Quantität.
a. Steigerungen.
Kurze Silben können bei der Steigerung zu Längen auf
doppelte Weise verändert werden, nämlich theils durch Dehnung
des Sonanten (dies geschieht hauptsächlich wohl bei
einfacher Verlangsamung des Tempos, jedenfalls ist eine
Steigerung der Intensität eher hinderlich als förderlich, vgl.
§ 38, 2), theils durch Uebergang zum stark geschnittenen Accent,
welcher Positionslängen schafft. Den ersteren Fall haben
wir z. B. in nhd. bò-te aus mhd. bò-te, den zweiten in nhd.
bláte aus mhd. blà-te. Was hier als historischer Wechsel vorliegt,
findet sich in den modernen Sprachen vielfach als lebendiger
Wechsel.
Lange Silben werden zu überlangen auf die S. 194 beschriebenen
beiden Weisen. Für die Praxis ist hier wieder
auf die schon S. 189 berührte Neigung mancher Sprachen
hinzuweisen, lange Monosyllaba in Pausa (d. h. am Satzende)
oder bei starkem Nachdruck zu überlangen Silben zu machen.
194In dem einsilbigen tot ist nicht nur der Vocal länger als in
dem zweisilbigen tote, sondern auch die Pause zwischen Verschluss
und Oeffnung des t wird gedehnt ; in einem Worte wie
grau fällt die Dehnung natürlich dem consonantischen u zu.
Anm. 3. Diese Quantitätsverschiedenheit ist im Deutschen, so häufig sie
auch vorkommt, eigentlich fast überall ignorirt worden, während sie z. B. von
den dänischen Grammatikern seit Rask (Dansk Retskrivningslaere, Kabenhavn
1826, S.36 ff.) mit Recht aufgeführt zu werden pflegt. Für das Englische
vergleiche die Citate auf S. 162 f. —Ihre Erklärung findet diese Erscheinung
vermuthlich in der Vorliebe dieser Sprachen für ‘trochaischen’,
d. h. zweitheilig fallenden Rhythmus, die sich besonders bei den Schlusstakten
geltend machen musste, deren Tempo überhaupt ein etwas langsameres zu
sein pflegt. So wird denn der einsilbige Schlusstakt in Quantität und Exspiration
(und häufig auch in der musikalischen Modulirung) dem zweisilbigen
Normaltakt gleich oder analog behandelt. In Wirklichkeit ist ja
ein Wort wie tot auch noch zweisilbig (S. 157 f. ;, nur die Vertheilung der
Gesammtquantität auf die einzelnen Sprachlaute ist eine andere als in tote.
Man wird in der Regel als Durchgangsstufe vom zweisilbigen Takt zum
‘einsilbigen’ im gewöhnlichen Sinne des Wortes (S. 158 ; die Bildung zweigipfliger
Silben anzusetzen haben (vgl. S. 167), wie sie namentlich im Englischen
noch deutlich vorliegen, vgl. Beispiele wie man, land, dog, bid,
lame, whole etc. Treten solche Monosyllaba aus ihrer Isolirtheit heraus
in einen mehrtheiligen Takt, so verlieren sie regelrecht die Ueberlänge,
vgl. z. B. englisch man und manly und die übrigen Beispiele S. 162, oder
auch im Satze, -iæzegud dŏg ‘he has a good dog’ und -ðe dogiz gŭd ‘the
dog is good’ etc. Die beste Bestätigung findet diese Erklärung in der
Thatsache, dass bei historisch nachweisbarer Verkürzung von zweisilbigen
Worten zu einsilbigen auch der tonische Accent beider Silben in der einen
übrig bleibenden concentrirt wird, vgl. S. 189, Anm. 2.
b. Minderungen.
b. Minderungen. Hierher fallen zunächst die eben
erwähnten Kürzungen von überlangen Silben zu einfachen
Längen, sodann die Kürzungen einfacher Längen zu Kürzen.
Dies geschieht entweder durch Kürzung des langen Sonanten,
oder durch Herüberziehen des silbenauslautenden Consonanten
zur Folgesilbe, oder durch beides zugleich, worüber hier
nichts weiter zu bemerken ist. Mit der Ausstossung von Silbengliedern,
insbesondere Sonanten und dem völligen Verschwinden
ganzer Silben, welches namentlich Kürzen betrifft,
haben wir es aber hier nicht zu thun, da diese Erscheinungen
vielmehr in den Bereich des historischen Lautwandels fallen.195
IV. Abschnitt.
Vom Lautwandel.
§ 36. Allgemeineres.
Man begegnet noch, jetzt in sprachwissenschaftlichen
Schriften oft dem Satze, dass aller Lautwandel aus einem
Streben nach Erleichterung der Aussprache, nach Vereinfachung
der Articulation hervorgehe ; dass mit anderen Worten
der Lautwandel stets in einer Lautschwächung, nie in
einer Lautverstärkung bestehe. Man kann zugeben, dass viele
sprachgeschichtliche Erscheinungen unter diese Rubrik gebracht
werden dürfen, aber in der Allgemeinheit, mit der der
Satz ausgesprochen wird, ist er entschieden falsch. Seine
Fehlerhaftigkeit tritt klar zu Tage, wenn man auch nur eine
ganz flüchtige Umschau über die verschiedenen historisch bezeugten
Richtungen der Lautentwickelung hält. Dass aus
ursprünglicher Tenuis eine Media, d. h. aus der Fortis eine
Lenis wird, wie etwa im ital. padre gegenüber lat. patrem,
und dass diese Lenis ganz verschwindet, wie in dem entsprechenden
prov. paire, franz.père, ist gewiss als eine Schwächung
zu bezeichnen. Aber auch genau die umgekehrte Entwickelungsreihe
findet sich, z. B. auf germanischem Boden,
wo wir ein ddj aus einfachem j hervorgehen (got. tvaddje aus
*tvaije etc.) und sämmtliche ursprüngliche Mediae zu Tenues
oder Aflricaten umgestalten sehen (gr. <5exa, lat. decem, got.
taihun, ahd. zëhan). Analog steht es auf vocalischem Gebiet.
Dieselben Sprachen zeigen uns häufig genug, wenn auch theilweise
in verschiedenen Perioden, z. B. Vereinfachung von
Diphthongen zu langen Vocalen, und Diphthongirungen ursprünglich
einfacher Vocale (ahd. mér, lón gegenüber got.
máis, láun und ahd. hiar, fuor gegenüber got. hér, fór ; oder
ital. oro neben lat. aurum und buono, pietro neben lat. bonum,
196Petrum u. dgl.). Besonders interessante Erscheinungen bieten,
in dieser Hinsicht Sprachen wie das Dänische, welches seine
anlautenden Tenues sehr energisch und mit starker Aspiration
bildet, während es sie im In- und Auslaut nach einem Vocal
zu sehr wenig energischen Spiranten hat herabsinken oder gar
ganz verloren gehen lassen.
Schon diese wenigen Beispiele genügen um zu zeigen,
dass der Begriff der Erleichterung der Aussprache, wenn
er überhaupt weiter bewahrt werden soll, sehr relativ gefasst
werden muss. Ueberhaupt muss stricte festgehalten werden,
dass an und für sich die Unterschiede in der Schwierigkeit
der Hervorbringung von Sprachlauten ausserordentlich gering
sind, und dass wirkliche Schwierigkeiten bezüglich der Nachbildung
in der Regel nur gegenüber fremden Lauten bestehen.
Denn wie überhaupt jeder Theil des menschlichen Körpers
durch einseitige Uebung zwar für den einen Dienst, den er
täglich versieht, besonders ausgebildet, für andere Zwecke
aber weniger tauglich oder geradezu unbrauchbar gemacht
wird, so erlangt auch das menschliche Sprachorgan durch die
von Jugend auf unausgesetzt fortdauernde Uebung in der Hervorbringung
der Laute der Muttersprache eine unbedingte
Gewalt über alle Articulationsbewegungen, welche diese erfordert.
Aber auch nur über diese. Haben einmal die Sprachwerkzeuge
durch und für ihren bestimmten Dienst eine einseitige
Ausbildung erhalten, so wird alles, was aus dem
Rahmen der geläufigen Articulationsbewegungen heraustritt,
als schwierig empfunden. Natürlich gilt dies gegenüber den
Lauten der einen Sprache eben so wie gegenüber denen der
anderen : dieselbe Schwierigkeit, die der Deutsche bei der
Nachbildung des engl. th oder der cerebralen r oder cerebralen
d, t empfindet, hat auch der Engländer etwa bei der Aussprache
des deutschen ch oder des alveolaren resp. uvularen
gerollten r oder der dorsalen d, t zu. überwinden u. s. f. Kurz,
wirkliche Schwierigkeiten der Aussprache einer gewissen
Sprache stellen sich eigentlich niemals den Angehörigen gerade
dieser Sprachgenossenschaft entgegen, von denen allein
doch nur eine Entwickelung der Sprache ausgehen kann.
Innerhalb einer Sprachgenossenschaft wird die Sprache
der einen Generation von der folgenden, wie die Erfahrung
lehrt, ohne all zu grosse Veränderungen des lautlichen Habitus
übernommen. Auch die Veränderungen, welche innerhalb
derselben Generation von Sprechenden vorgenommen werden,
197können selbstverständlich nur ganz allmählich und schrittweise
vollzogen werden, und doch sind in diesen ganz unscheinbaren
und sich grossentheils unserer Beobachtung noch
entziehenden Veränderungen die beiden Hauptkeime lautlicher
Entwickelung zu suchen. Es bedarf aber nur einer hinreichend
lange fortgesetzten Addition dieser kleinsten Differenzen,
um auch für unser Ohr wahrnehmbare Unterscheidungen
und schliesslich vollständige Verschiebungen ganzer
Lautsysteme bis zur Unkenntlichmachung des Ursprünglichen
herbeizuführen.
Anm. 1. Die spontane Bildung neuer Lautformen geht selbstverständlich
vom einzelnen Individuum oder von einer Reihe von Individuen aus, und
erst durch Nachahmung werden diese Neuerungen allmählich auf die gesammte
Sprachgenossenschaft übertragen, der diese Individuen angehören.
Die vollständige Auseinandersetzung zwischen den alten und den neuen
Formen, die in Collision treten, kann unter Umständen lange Zeit in Anspruch
nehmen. Eine Zeit lang werden beide Formen wohl promiscue gebraucht,
auch werden sie wohl je nach der Stellung des Lautes in verschiedener
Weise verwendet, bis schliesslich die neue Lautform die ältere ganz
verdrängt. Beispiele für das Schwanken zwischen zwei Formen bieten
z. B. viele norddeutsche Mundarten, welche tönende und tonlose Mediae
ohne Unterschied (aber doch meist nach der Stellung, d. h. den benachbarten
Lauten geregelt) verwenden (ebenso z. B. auch das Armenische in
verschiedenen Dialekten). Die mittel- und süddeutschen Mundarten sind
dagegen schon längst in die Periode der Alleinherrschaft der tonlosen Mediae
eingetreten. Genaueres über die Theorie des allmählichen Lautwandels
s. bei Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium S. 120 ff. und besonders
Paul, Principien der Sprachgeschichte, Halle 1880.
Aller Lautwandel im eigentlichen Sinne des Wortes beruht
also auf einer allmählich fortschreitenden und unbewusst sich
vollziehenden Verschiebung, welche theils das Ganze, theils
nur bestimmte Partien eines Lautsystems betrifft, je nachdem
die speciell der Veränderung unterliegenden Factoren der
Lautbildung für einen grösseren oder geringeren Theil desselben
mit massgebend sind. — Neben solchen regelmässigeren
Veränderungen liegen nun freilich auch oft genug gewaltsamere
Sprünge vor (z. B. bei vielen Metathesen, oder den
Vertretungen ursprünglicher k(u) durch p, wie im Griechischen.
Umbrischen, Oskischen u. a.), wenigstens sind wir bei
einer Reihe ziemlich tief eingreifender Lautumgestaltungen
bis jetzt noch nicht im Stande gewesen, erklärende Mittelglieder
und Uebergangsstufen nachzuweisen, und auch in
Zukunft werden wir einen gewissen Rest derartiger Erscheinungen
anerkennen müssen, die sich nicht unter allgemeinere
198Gesichtspunkte subsumiren lassen. In solchen Fällen wird
die historische Phonetik wenig mehr thun können, als den
Gründen nachgehen, welche etwa im Einzelfall die Wahl des
neuen Lautes oder der neuen Lautfolge an Stelle des alten
bedingt haben ; ihr eigenstes Thätigkeitsgebiet ist aber die
Aufhellung der Gesetze und Principien, die sich in dem regelmässigen,
d. h. dem eben skizzirten allmählichen Lautwandel
kund geben.
Innerhalb dieses grossen Gebietes lassen sich nun zunächst
zwei Arten des Lautwandels unterscheiden, spontaner und
abhängiger oder combinatorischer. Die erste Abtheilung
umfasst alle diejenigen Wandlungen, welche beliebige
Systemtheile ohne Rücksicht auf ihre Lautumgebung erfahren
(z. B. der grösste Theil der deutschen Lautverschiebung), die
zweite dagegen diejenigen Fälle, in welchen der Eintritt der
Wandlung an die Stellung des betreffenden Lautes in einer
gewissen Umgebung gebunden erscheint, also namentlich alle
sogen. Assimilationserscheinungen, die Veränderungen des
Wortauslautes u. dgl.
Fast noch wichtiger als dieses Eintheilungsprincip ist aber
ein zweites, nämlich das nach den Veränderungen in den
Articulationsfactoren, welche die Veränderungen der
Laute bedingen, denn nur so lassen sich die einzelnen
Wandlungen nach ihrer physiologischen Verwandtschaft richtig
gruppiren. Wir haben also mit Rücksicht auf die Hauptfactoren
der Lautbildung (S. 26 u. ö.) zu unterscheiden :
Lautwandel 1. durch Veränderung der Ansatzrohrarticulation
(z. B. die allmähliche Verschiebung der Vocalreihen.
Uebergang von tönenden Medien in tönende Spiranten
und umgekehrt), 2. durch Veränderung der Kehlkopfarticulation
(z. B. Uebergänge tönender Laute in tonlose
und umgekehrt), und 3. durch Veränderung der Exspiration
(z. B. Uebergang von Lenis in Fortis [Media in Tenuis]
und umgekehrt, ferner alle vom exspiratorischen Accent abhängigen
Lautwandlungen).
Diese drei Arten finden sich natürlich sowohl auf dem
Gebiete des spontanen wie dem des abhängigen Lautwandels.
Auch können sie sich unter einander wieder mehrfach combiniren.
Anm. 2. Namentlich tritt eine solche Combination uns vielfach entgegen,
wenn wir nur das Schlussresultat eines Lautwandels in Vergleich mit
seinem Ausgangspunkt betrachten. Im altn. módir gegenüber indog. *mäter
199liegt eine Verschiebung nach allen drei Richtungen vor, nämlich ad 1.
Uebergang vom Versehlusslaut zur Spirans, ad 2. vom tonlosen Laut zum
tönenden, ad 3. von der Fortis t zur Lenis đ, aber diese Uebergänge fallen
ganz verschiedenen Sprachperioden zu. Im deutschen mutter haben sich
gegenüber urgermanischem *móđér genau die umgekehrten Processe vollzogen,
aber auch wieder in getrennten Zeiträumen. In der Regel wird
gleichzeitiger Eintritt von Veränderungen zweier und mehrerer Articulationsfactoren
nicht anzunehmen sein.
Von den hierdurch zunächst im Allgemeinen skizzirten
Arten des Lautwandels sollen zum Schlüsse eine Anzahl einzelner
Fälle noch in Kürze erläutert werden. Die etwaigen
Fälle spontanen Lautwandels durch Veränderung im Kehlkopf
sollen dabei der Kürze halber mit unter den combinatorischen
behandelt werden. Alle Einzelheiten hat die Specialgrammatik
und Speciallautlehre auszuführen.
Cap. I. Spontaner Lautwandel.
§ 37. Spontaner Lautwandel durch Veränderungen im
Ansatzrohr.
1. Verschiebung der Vocalreihen. Hier kommen
sehr mannigfaltige Erscheinungen in Betracht, aber sie sind
in ihrer Art meistens einfach. Als die einfachste von allen ist
wohl der Uebergang von Vocalen mit starker Lippenthätigkeit
in solche mit passiver Lippe (und umgekehrt)
voranzustellen, wie er sich z. B. im Englischen und in vielen
mitteldeutschen Mundarten vollzogen hat. Hier haben wir
es wirklich mit einer Trägheitserscheinung zu thun, indem
eine für die Unterscheidung der gegensätzlich verwandten
Vocalqualitäten nicht gerade nothwendige Action allmählich
in Wegfall gebracht wird.
Mit dieser Veränderung hängt der Wegfall der Vermittelungsvocale
ü, ö (s. S. 70) zusammen. Wird diesen
die das in ihnen liegende u- Element bedingende Lippenrundung
genommen, so bleiben einfach die restirenden Produkte
der Articulation der Zunge, d. h. i, e übrig. — Das
Fehlen der Vermittelungsvocale giebt also, falls deren frühere
Existenz in einer bestimmten Sprache überhaupt nachweisbar
200ist, einen sicheren Anhaltspunkt für die Beurtheilung des gesammten
Vocalismus derselben.
Als Gegensatz zu dieser Entrundung der gerundeten Vocale
kann man den Uebergang zu abnorm starker Rundung
bezeichnen, welcher namentlich im Norwegischen und Schwedischen
sehr um sich gegriffen hat (Storm S. 70 f.).
Hieran reihen sich die den Charakter eines Vocalsystems
weit stärker modificirenden Veränderungen in der Zungenarticulation ;
solche können theils in vertikaler theils in
horizontaler Verschiebung der Zunge bestehen (S. 73) ; d. h.
es finden Uebergänge von höhern zu niedern, von engen zu
weiten, von gutturalen zu palatogutturalen und palatalen Vocalen
statt und umgekehrt. Für den ersten Fall denke man
z. B. an die Ueberführung der europ. e, o in got. i, u, und
die entgegengesetzte der latein. ĭ, ŭ in roman. e, o. Wollte
man für den zweiten Fall auch noch eine Wirkung des Trägheitsgesetzes
annehmen, insofern die Zungenarticulation
der e, o geringer ist als die der i, u, so genügt diese doch
nicht für den umgekehrten ersten Fall. Man wird also besser
thun, beide und überhaupt alle ähnlichen Erscheinungen auf
ganz allmähliche unbewusste Verschiebung der Zungenarticulation
zurückzuführen und im gegebenen Einzelfall eine
Anknüpfung derselben an andere charakteristische Lautwandlungen
zu versuchen.
Anm. Seit Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache1 S. 121 ff.,
ist es sehr Mode geworden, den Uebergang ‘dunklerer’ Vocale in ‘hellere’,
namentlich den von a in ä etc. mit dem Namen der Tonerhöhung zu
belegen, weil an die Stelle des einen Vocals ein anderer mit höherem Eigenton
(s. oben S. 63} tritt. Es wird dann der Vorgang mit dem altgermanischen
musikalischen Accent in Verbindung gebracht, indem ‘die Höhe
oder Tiefe des Tons, welche einer bestimmten Silbe in der Rede beiwohnt,
den Vocal mit entsprechendem höherem oder tieferem Eigenton attrahirt’.
Ich halte diese Erklärung für noch nicht erwiesen, namentlich in ihren
weiteren Consequenzen, z. B. dass sich die Vermischung der ursprünglichen
Vermittelungsvocale ö, ü mit e, i im Angelsächsischen aus denselben
Gründen erkläre, denn in diesem Falle haben wir es klärlich nur mit
einer Entrundung ursprünglicher gerundeter Vocale zu thun. Man hat
dem Eigenton der Vocale überhaupt eine viel zu grosse Bedeutsamkeit
beigelegt. Es ist gar nicht abzusehen, in welchem akustischen Zusammenhange
ein musikalisch höherer Stimmton mit dem höheren Eigenton
der Mundhöhle bei einer bestimmten Vocalstellung stehen soll. Wenn
ein Zusammenhang zwischen höherem Accent und Palatalisirung der Vocale
besteht, so ist es zweifellos ein rein mechanischer ; denn es ist allerdings
wohl denkbar, dass das zur Hervorbringung eines hohen Tones nothwendige
Steigen des Kehlkopfs auch eine Verschiebung der Zunge im Gefolge
201haben kann, welche die Palatalisirung des Vocals bedingt. — Es ist aber
durchaus anzurathen dass man alle ‘bildlichen’ Ausdrucksweisen vermeide,
und die betreffenden Vorgänge stets nur nach den wirklich vorgegangenen
Veränderungen charakterisire : Uebergang vor ö, ü zu e, i als Entrundung
eines gerundeten Vocales, etc.
Kurze und langeVocale schlagen bekanntlich bei derartigen
Verschiebungen häufig entgegengesetzte Wege ein.
Unsere meisten kurzen i, e, o, u sind i2 u. s. w., unsere Längen
i1 u. s. w. ; oder die Kürzen werden in ursprünglicher
Qualität erhalten, wie im Englischen e, o, ü, während die
Längen zu i, u, i— geworden sind. Hierfür liegt der Grund
wohl in dem auch sonst vielfach zur Anwendung kommenden
Gesetze, dass die Articulationen eines Lautes um so energischer
und sicherer vollzogen werden, je stärker derselbe zum
Bewusstsein kommt, d. h. je grösser seine Intensität oder
seine Quantität ist. Dies erklärt beim langen Vocal sowohl
eine Steigerung der specifischen Zungenarticulation wie der
Rundung, falls solche vorhanden ist. Beim kurzen Vocal dagegen,
der nur einen momentanen Zungenschlag erfordert,
wird gar leicht das eigentliche Mass der Entfernung von der
Indifferenzlage nicht erreicht, d. h. es wird eine Wandelung
der Vocale mit stärkeren specifischen Articulationen zu Lauten
von neutralerer Articulation angebahnt (sowohl was Zungen-als
was Lippenthätigkeit betrifft).
2. Diphthongirungen einfacher Vocale fallen zum
Theile auch unter die dritte Rubrik der Lautwandlungen, indem
die Verschiebung der Ansatzrohrarticulation wahrscheinlich
von zweigipfliger Silbenbildung (s. S. 166 ff.) abhängig
ist. Durch diese zerfällt die einfache Länge in zwei deutlicher
getrennte Moren, während deren zweiter je nach den
Umständen die Zunge zur Indifferenzlage ein wenig zurückweicht
oder die specifische Articulation des Vocales noch etwas
verstärkt ausführt. Auf die erstere Weise entstehen Diphthonge
wie ea, ie aus e ; uo, ua aus o, auf die andere ei, ai etc.
aus i, e ; ou, au aus u, o ; öü aus ü u. dgl. Derartige Diphthonge
wie die angeführten bedürfen indessen schon einer
langen Entwickelungszeit, denn ursprünglich sind die Articulationsdifferenzen
der beiden Moren natürlich viel geringer
(vgl. auch S. 121).— Ob die Wahl der speciellen Art der Diphthongirung
mit aufsteigender oder absteigender Betonung zusammenhängt,
bleibt noch zu untersuchen (vgl. oben Anm.).
202— Contraction von Diphthongen zu einfachen Vocalen s. unten
§ 41, a.
3. Verschiebungen im Consonantensystem. Diese
können sich theils auf die Lagerung der Articulationsstellen,
theils auf die Arten der Articulation (S. 42) beziehen. Zu den
ersteren gehören beispielsweise die vielen Schwankungen innerhalb
der verschiedenen Arten der Dentale (vgl. S. 50 ff.),
ferner die Uebergänge von z in r, die von r in l oder (durch
uvulares r vermittelt) in £ (s. S. S8), namentlich aber die von
Gutturalen zu Palatalen und Dentalen, soweit sie
nicht durch Assimilationen herbeigeführt werden. Da sich
bei diesen Uebergängen fast regelmässig nur ein Vorrücken
der Articulationsstellen, höchst ausnahmsweise ein Rückwärtsschreiten
derselben bemerken lässt, so ist die Erscheinung
vielleicht auf ein Bestreben zurückzuführen, leichter bewegliche
Theile der Zunge an Stelle schwerer beweglicher articuliren
zu lassen. Auch hier wird die Verschiebung eine allmähliche
gewesen sein. Uebergänge wie die von indog. k2 in
p (gr. πότερος aus indog. k2otero-s etc. ; Curtius, Grundzüge
S. 448 ff.) dagegen sind nur erklärlich durch Annahme eines
Sprunges in der Articulation, der hier in Folge einer Assimilationsneigung
durch das aus k2 zunächst entwickelte k²u (lat.
qu) mit starker Lippen enge veranlasst sein wird.
Bezüglich der zweiten Art von Veränderungen kommt der
Wechsel von Verschlusslauten und Spiranten oder
sonoren Dauerlauten (z. B. d und r, l) in Betracht. Ganz directe
Berührung dieser beiden Lautgruppen wird sich wohl
nur da finden. wo sehr geringe Exspirationsstärke vorhanden
ist, d. h. wo weder das Reibungsgeräusch der Spirans noch
der geschnittene Ausgang eines etwa vorangehenden Lautes
sich dem Bewusstsein stark einprägt und dadurch den Charakter
des Lautes schützt, also namentlich bei tönenden
Lauten, und hier vorzugsweise bei denjenigen Reihen, deren
Spiranten leicht der Geräuschreduction fähig sind (vgl. S.147 ff.
150). Die Richtung der Bewegung vom Verschluss zur Engenbildung
und umgekehrt hängt wieder von besonderen Neigungen
und Verhältnissen ab. Tonlose Spiranten gehen
aus tonlosen Verschlusslauten wohl nie direct hervor, sondern
vermittelt durch Aspiraten und Affricaten (S. 135). Wandlung
tonloser Spiranten in tonlose Verschlusslaute ist selten. Beispiele
sind der Uebergang des germ. anlautenden p in t im
Dänischen, Schwedischen, Färöischen und der irischen Ausspräche
203des Englischen ; ferner der von x in k oder k (z. B.
im armen, kh aus s(u) durch x hindurch, wie etwa in khuir
Schwester aus *sueser).
§ 38. Spontaner Lautwandel durch Veränderungen in der
Exspiration.
Die Fälle dieser Art kann man in zwei Gruppen bringen,
nämlich solche. in denen die veränderte Exspiration nur einzelne
Theile der Silbe und solche, in denen sie die ganze Silbe
beeinflusst.
1. Zur ersten Gruppe fallen z. B. die nicht vom Accent
abhängigen Steigerungen von Lenes zu Fortes, wie sie etwa
die deutsche Lautverschiebung in der Verwandlung der ursprünglichen
Mediae g, d, b in k. t. p aufweist, nebst der
ebenfalls nicht selten spontan auftretenden Verschiebung in
umgekehrter Richtung. Ferner gehört vielleicht auch der
Uebergang einfacher Tenues (doch wahrscheinlich zunächst
nur solcher ohne Kehlkopfverschluss) in Tenues aspiratae
insofern hierher, als zwar nicht die Energie des Exspirationsdruckes
vermehrt zu sein braucht, wohl aber die Dauer des
Exspixationsstromes vom Momente des Verschlusses bis zum
Einsetzen des folgenden Lautes. Die Energie des Mundverschlusses
ist dabei wohl meist geringer als bei den einfachen
Tenues.
Anm. 1. Das Wesentlichste bei diesem Vorgang ist übrigens möglicherweise
nicht in der Veränderung der Exspiration, sondern in der Beschleunigung
der Explosion zu finden. Namentlich bei anlautender Tenuis
pflegt die Dauer des Verschlusses beträchtlich grösser zu sein als bei anlautender
Aspirate, offenbar damit durch die allmähliche Stauung des Exspirationsstromes
die Luft im Mundraume den nöthigen Grad von Compression
erhalte. Wird aber, noch ehe dieser völlig erreicht ist, die
Explosion hergestellt, so fahren die mit der Comprimirung der Luft beschäftigten
Muskeln unwillkürlich noch einen Moment in ihrer Thätigkeit
fort, d. h. sie erzeugen einen nachfolgenden Hauch, da nun der Sprachkanal
durchgehends geöffnet ist. — Dass die Compression der Luft bei den
Aspiraten in der That erheblich geringer ist als bei den einfachen Tenues,
habe ich durch zahlreiche manometrische Messungen (namentlich z. B.
auch bei Armeniern, denen die Unterscheidung beider Reihen von Lauten
ja ganz geläufig ist) vielfach constatiren können.
2. Die zweite Gruppe umfasst alle diejenigen Veränderungen,
welche emphatische Silben gegenüber unemphatischen
204Silben und umgekehrt treffen, wenn man
hier nicht etwa von combinatorischem Wandel sprechen will,
weil doch in der Regel das Zusammentreffen mehrerer Silben
Vorbedingung für die Unterscheidung verschiedener Stufen
des Nachdrucks ist.
Dem emphatischen Accente fallen auf diese Weise die
schon öfter berührten Intensitätssteigerungen von Consonanten
zu, welche auf den Sonanten einer emphatischen Silbe
folgen, also die Entstehung der Fortes continuae nach dem
Wintelerschen Gesetz, oder die Steigerung der tönenden Lenes
in der Gemination (vgl. S. 164). Der Mangel an Emphase
führt im Gegensatz hierzu oft Schwächung von Fortes zu Lenes,
und völligen Ausfall der letzteren herbei.
Anm. 2. Einen sehr interessanten Beleg für die letztere Erscheinung
hat C. Verner in Kuhn's Zeitschrift XXIII, 97 ff. geliefert, indem er zeigte,
wie der sog. grammatische Wechsel in den germanischen Sprachen von der
ursprünglichen Lagerung des emphatischen Accentes abhängig ist. Der
Gang der Entwickelung ist offenbar der gewesen, dass die der Tonsilbe
vorausgehenden ursprünglichen Fortes (weil aus Verschlussfortes entstanden)
x, 6, f zu tonlosen Lenes geschwächt wurden, denen sich in
einer weiteren Entwickelungsperiode der Stimmton zugesellte.
Was den Einfluss des emphatischen Accentes auf die Vocale
betrifft, so pflegt von uns die grosse Intensität der Vocale
der Tonsilben gar leicht übersehn oder als etwas selbstverständliches
betrachtet zu werden ; ja man bringt wohl gar
diesen Accent ohne Weiteres mit den Vocaldehnungen betonter
Silben zusammen, aber mit Unrecht. Stark exspiratorischer
Accent auf kurzem Vocale schützt vor der Dehnung, ja er
veranlasst sogar oft die Kürzung ursprünglicher Längen. Dies
geschieht z. B. oft vor Geminata oder überhaupt vor silbenauslautender
Fortis. Daher sind uns Deutschen z. B. vor t eine
Anzahl von Kürzen in Stammsilben geblieben, wie in gotte,
blätter, weiter, geschnitten, gesotten, weil die Fortis den Eintritt
des stark exspiratorisehen Accents an Stelle des ursprünglichen
schwach geschnittenen Accents begünstigte. Es kommt
hierbei, wie es scheint, wesentlich auf die Einhaltung des
stark geschnittenen Absatzes an, welche eben bei langem Vocale
Schwierigkeiten macht (vgl. S. 166, 176). Man entgeht
diesen in dem Falle von Länge + Geminata entweder durch
Kürzung des Vocals oder durch Aufgebung dieses Absatzes, d. h.
der Gemination (also aus átta wird entweder átta oder àta).
Mangel an emphatischem Accent führt vielfach zur Verstümmelung
205von Vocalen. Wie bei nachdrucksloser Aussprache
die Exspiration kraftlos gehandhabt wird, so wird
unter Umständen auch die Articulation im Kehlkopf und Ansatzrohr
lässig ausgeführt. Unemphatische Vocale haben daher
selten starke Zungen- oder Lippenarticulationen, wenn
sie nicht durch Nachbarlaute geschützt sind. An die Stelle
volltönender Vocale treten häufig einfache Stimmübergangslaute
ohne prägnante Articulationsstellung (S. 151), und
schliesslich kann der Vocal ganz ausfallen oder durch zeitliche
Verschiebung (§ 43, 4, b) von einem benachbarten Laute absorbirt
werden, der dadurch zum Sonanten der Silbe wird.
Beispiele hierfür liefern reichlich die modernen Sprachen ; sehr
ausgebildet war dies Syncopirungs- oder Absorptionssystem
in der indogermanischen Grundsprache ; wie die neueren Untersuchungen
über Vocalabstufung dargethan haben.
Es sei schliesslich hier noch bemerkt, dass Dehnungen
von Vocalen in ‘betonten’ Silben den Mangel eines energischen
Ausganges des Vocales voraussetzen. Solche Dehnungen erscheinen
daher häufig in Sprachen mit ausgebildeten tonischen
Accenten, weil diese gewöhnlich keine stark geschnittenen
Silbenaccente kennen. Sie treten ferner namentlich vor Lenes
oder doch überhaupt im Silbenauslaut auf, d. h. da, wo nicht
noch ein starken Exspirationsdruck verlangender, derselben
Silbe zugehöriger Consonant vorhanden ist (weil nämlich dieser
auch bei dem vorhergehenden Vocal den Acut bedingen
würde). Vor Consonantengruppen erscheinen die Dehnungen
nur da, wo alle Consonanten zur folgenden Silbe gezogen
werden können, sei es dass dieses eine nach unsern gewöhnlichen
Begriffen volle oder eine der oben S. 158 f. besprochenen
Nebensilben ist.
Anm. 3. Hierher fallen auch zum einen Theile die Dehnungen vor
Liquida, Nasal oder Spirans + Consonant, insofern sie zweigipfligen
Accent voraussetzen. Der dem Vocal folgende Dauerlaut wird in diesem
Falle mit dem zur Bildung des zweiten Accentgipfels verwandten schwächeren
Exspirationshub hervorgebracht und steht also gewissermassen im
Anlaut einer dem Vocal folgenden Nebensilbe. Weiteres hierüber s. unten
§ 43, 6.206
Cap. II. Combinatorischer lautwandel.
§ 39. Die Arten des combinatorischen Lautwandels.
Um zu einer einigermassen übersichtlichen Eintheilung der
mannigfaltigen Arten der Veränderung, welchen Sprachlaute
unter dem Einflüsse von Nachbarlauten unterliegen, zu
gelangen, hat man ausser dem oben S. 199 aufgestellten Eintheilungsprincip
noch namentlich auf zwei Prinzipien, das der
räumlichen und das der zeitlichen Verschiebung
zu achten.
Wenn aus einem Diphthonge ai allmählich ein e hervorgeht,
so ist dieser Vorgang ein reines Beispiel einer räumlichen
Verschiebung oder einer Ausgleichung einer
Articulationsdifferenz (d. h. des Masses für die Bewegungen,
welche beim Uebergang von einem Laute zu einem
andern zu machen sind). Die Exspiration ist in dem neuen
Laute e dieselbe, wie in dem alten Diphthong ai. ebenso die
Zeitdauer ; nur ist der Abstand, der ursprünglich zwischen der
Zungenstellung im ersten Momente und der im letzten Momente
bestand (a—i), auf 0 reducirt.
Wenn dagegen etwa aus einer Lautgruppe agna die Form
aŋna erwächst (wie z. B. in der sehr gewöhnlichen Aussprache
des lat. gn als ŋn), so liegt das Wesentliche des Uebergangs
darin, dass die Senkung des Gaumensegels, die in agna erst
nach der Bildung des g-Verschlusses zwischen Hinterzunge
und weichem Gaumen eintrat, jetzt schon gleichzeitig mit
der Bildung dieses Verschlusses vorgenommen wird. Dass
hiermit auch eine kleine Aenderung in der räumlichen Lage
der Organe verbunden ist, ist mehr nebensächlich. Wir können
also diesen Vorgang als einen wesentlich durch zeitliche
Verschiebung bedingten charakterisiren.
Ebenso beruht es auf zeitlicher Verschiebung, wenn z. B.
aus einer Form wie àmma allmählich àma hervorgeht ; denn
hier ist der m-Verschluss der Lippen nebst der gleichzeitig
erfolgenden Senkung des Gaumensegels erst vorgenommen,
nachdem die der ersten Hälfte der ursprünglichen Geminata
mm zukommende Mora bereits verflossen und zwar dem Vocal
zu Gute gekommen ist. Doch ist dieser Wandel dem in den
beiden vorigen Fällen charakterisirten nicht ganz analog, denn
hier ist die Qualität der benachbarten Laute nicht verändert,
207während dort eine Annäherung der beiden Elemente, eine
Assimilation stattfand.
Hiernach haben wir den combinatorischen Lautwandel
einzutheilen in die Fälle der Assimilation, welche theils auf
räumlicher, theils auf zeitlicher Verschiebung beruhen, und
in die Fälle der zeitlichen Verschiebung, welche ; nicht zu
Assimilationen führen. Zu den letzteren gehören z. B. die
Epenthesen, viele Fälle der sog. Ersatzdehnung und der Dehnungen
vor Dauerlaut + Consonant, die Einschiebung gewisser
reducirter Vocale (Svarabhakti) u. dgl. — Für alle
Fälle sind aber noch folgende Sätze zu beobachten :
1. Räumliche Verschiebung kann nur die Articulationen
des Ansatzrohres treffen ; das Ein- und Aussetzen des Stimmtons
(d. h. die Bildung tönender oder tonloser Laute) und die
Regulirang der Exspiration (namentlich bezüglich der Silbenabtheilung)
unterliegt nur der zeitlichen Verschiebung, welche
sich ihrerseits auch auf die Articulationen des Ansatzrohres
erstreckt.
2. Mag das Resultat der Verschiebung eine Assimilation
sein oder nicht, das Zeitmass der veränderten Lautgruppe
bleibt unverändert. Historisch nachweisbare Veränderungen
desselben, beruhen stets auf spontanem Lautwandel, welcher
den Wirkungen des combinatorischen Lautwandels nachgefolgt
ist.
§ 40. Die Arten der Assimilation.
Man pflegt die Assimilationen je nach der Richtung ihrer
Entwickelung in regressive und in progressive einzutheilen,
je nachdem ein Laut einen vorhergehenden oder einen
folgenden Nachbarlaut sich assimilirt ; als dritte Unterart kann
man dazu noch eine reciproke Assimilation aufstellen, bei
der beide Theile sich gleichmässig beeinflussen (wie oben beim
Uebergang von ai zu e).
In den indogermanischen Sprachen ist die regressive
Assimilation durchaus überwiegend an Häufigkeit, während
die ural-altaischen Sprachen die progressive Assimilation begünstigen.
Nähere Bestimmungen lassen sich aber nicht wohl
in Kürze geben, weil die einzelnen Sprachen zu sehr differiren.208
Anm. Ein Beispiel bietet der germanische Umlaut für regressive, die
finnisch-türkische Vocalharmonie für progressive Assimilation. Hierüber
bemerkt Böhtlingk (Jenaer Lit.-Ztg. 1874, S. 767) treffend : ‘Ein indogermanisches
Wort ist in dem Masse eine wirkliche Einheit, dass der Sprechende
schon beim Hervorbringen der ersten Silbe das ganze Wort sozusagen im
Geiste ausgesprochen hat. Nur auf diese Weise ist es zu erklären, dass
zur Erleichterung der Aussprache einer nachfolgenden Silbe [resp. Lautes]
schon die vorangehende [Silbe resp. LautJ modificirt wird. Ein Individuum
der ural - altaischen Völkergruppe stösst, unbekümmert um das
Schicksal des Wortes, die erste Silbe desselben, den Träger des Hauptbegriffes,
ohne Weiteres heraus ; an diese reiht er dann die weniger bedeutsamen
Silben in etwas roher Weise an, indem er gleichsam erst in dem
Augenblicke an Abhilfe denkt, wenn er nicht mehr weiter kann.’ —
Hierzu möchte ich nur bemerken, dass von einem Bestreben nach Erleichterung
wohl nicht gesprochen werden darf, denn willkürlich und bewusst
pflegen auch die Assimilationen nicht zu sein ; vielmehr wird die
Sache wohl so aufzufassen sein, dass dem Sprecher die besonders charakteristischen
Theile der Articulation folgender Laute (z. B. um bei aŋna aus
agna stehen zu bleiben, die Senkung des Gaumensegels für das n) besonders
lebhaft vorschweben, und dass demzufolge die Auslösung derjenigen
Nerventhätigkeit, welche zur Erzeugung dieser Articulationsbewegung
dient, vor der ihr eigentlich zustehenden Zeit erfolgt. — Uebrigens ist
noch zu erwägen, ob nicht ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Assimilationsrichtungen und der Wortaccentuirung besteht. Die Betonung
der ersten Silbe des Wortes in vielen ural-altaischen Sprachen
würde dazu wenigstens stimmen.
Endlich hat man auch noch zwischen partieller und
totaler Assimilation unterschieden. Letztere tritt um so
leichter ein, je mehr Factoren die beiden Nachbarlaute bereits
mit einander gemeinsam haben. Es wird z. B. adna unter
denselben Bedingungen zu anna mit totaler Assimilation, wie
agna zu aŋna oder abna zu amna mit partieller, weil d und n
neben dem Stimmton auch noch den dentalen Verschluss gemeinsam
haben, sodass nur die verschiedene Stellung des
Gaumensegels sie überhaupt unterscheidet.— Wo weiter auseinander
liegende Laute vollkommen assimilirt werden, sind
nach dem allgemeinen Gesetz von der Allmählichkeit des
Lautwandels verschiedene Entwickelungsperioden anzusetzen
(also für lat. summus aus *supmus z. B. die Mittelstufen *submus
mit tonloser und *submus mit tönender Media).
§ 41. Assimilation durch räumliche Verschiebung.
a. Bei Vocalen.
a. Bei Vocalen. Hierher gehören vor allem die schon
S. 207 besprochenen Contractionen von Diphthongen oder
209überhaupt von zwei ungleichen, nicht durch Kehlkopfverschluss
getrennten Vocalen zu einfacher Länge. Uebergänge
wie der von ursprünglichem ai zu e zeigen reciproke, zu a
(wie z. B. im Angelsächsischen) progressive, zu i (wie im altgerm.
î aus indog. ei) regressive Assimilation. Ferner fallen
hierher die Einwirkungen von l, r, x sowie anderer Consonanten
auf vorausgehende Vocale (Brechung des i, u vor r,
x, h u. s. w. zu e, o, wie im Gotischen, Nordischen u. s.w.),
zu denen auch der sog. Umlaut zu rechnen ist.
Anm. Man muss hierbei noch verschiedene Stufen der Beeinflussung
unterscheiden, z. B. ob der ganze Vocal der Assimilation unterliegt oder
nur der Glide zum folgenden Consonanten. Letzteres ist z. B. der Fall in
in den der Quantität den Kürzen gleichstehenden ‘Brechungen', wie ags. ea,
eo, altn.ia, iöaus(ä), e. Wahrscheinlich sind aber die Formen mit völliger
Assimilation des Vocals auch erst allmählich aus solchen gevrissermassen
reducirten Diphthongen (S. 151) durch Ausgleich der beiden Componenten
hervorgegangen. Aehnlich verhält es sich auch mit den sog. Umlauten,
welche, wie von Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache 142 ff.
und Verf. in den Verh. der Leipziger Philol.-Vers. 1872, 189 ff. ausgeführt
ist, Mouillirung oder Labialisirung des oder der zwischen dem umzulautenden
Vocal und dem i, i,u,u der Endung liegenden Consonanten voraussetzen.
In diesem Falle tritt nämlich der Vocal der Stammsilbe in
unmittelbaren Contact mit den ihm widerstreitenden Elementen der i- und
u-Stellung, die in dem Consonanten enthalten sind, und damit beginnt
wieder die reciproke Ausgleichung.
b. Bei Consonanten.
b. Bei Consonanten. Beispiele für die Berührung von
Consonanten mit Vocalen sind der Eintritt der Mouillirung
und Labialisirung, soweit diese auf Ausgleichung der
Zungenarticulation beruhen ; also namentlich die Verlegung
der Articulationsstellen der k-Laute je nach dem folgenden
(seltner dem vorhergehenden) Vocale, z. B. ihre Palatalisirung
vor den palatalen Vocalen e, i, ö, ü. Die Mitwirkung der
Lippenarticulation bei der Berührung mit Palatolingualen
oder der Zungenarticulation bei der Berührung mit Labialen
ist dagegen eine auf zeitlicher Verschiebung dieser Accidentia
beruhende Zugabe.
Stärkere Veränderungen erfahren die Consonanten bei
der Berührung unter einander, indem hier das Resultat
der Assimilation häufig die Herstellung vollkommener Homorganität,
Homogeneität oder gleicher Intensität
ist. Erstere kann nur dadurch erreicht werden, dass die
specifische Articulation des unterliegenden Lautes überhaupt
ganz wegfällt, z. B. der dentale Verschluss in ampa aus anpa
oder der gutturale in atto aus acto. Im letzteren Falle ist von
210dem c nichts geblieben als’ der Zeittheil, welchen seine Hervorbringung
erforderte und der nun als Silbenpause zwischen
den vorgerückten Dentalverschluss und die Explosion tritt,
d. h. die Gemination bedingt. Uebrigens kann man hier auch
wohl von zeitlicher Verschiebung sprechen. Ebenfalls hierher
gehören die lateralen und nasalen Degenerationen und Aehnliches.
über das oben S. 137 ff. bereits berichtet ist. — Wandlungen
zur Homogeneität erleiden vielfach die Affricaten
(ff, ss, xx aus pf, ts, kx, abermals mit Beibehaltung des Zeitantheils
desp, t, k) u. dgl. — Bezüglich des Intensitätswechsels
ist nur auf die Gleichmachung benachbarter, namentlich
derselben Silbe zugehöriger Lenes und Fortes hinzuweisen
(z. B. griech. γραπτός — γράβδην).
§ 42. Assimilation durch zeitliche Verschiebung.
a. Im Ansatzrohr. Als Fall reciproker Assimilation ist
hier der Eintritt von Nasalvocalen für die Verbindung von
Vocal + Nasal anzuführen ; diesem steht zur Seite die Umwandlung
eines Verschlusslautes vor einem Nasal in den homorganen Nasal
(pm, bm zu mm ; tn, dn zu nn ; kn, gn zu ŋn).
Beide haben vorzeitige Senkung des Gaumensegels gemein.
Für den zweiten Fall wird übrigens stets wieder vorheriger
Uebergang einer etwa vorausgehenden Tenuis zur tönenden
Media angenommen werden müssen.
b. Im Kehlkopf. Hierauf beruhen zum grössten Theile
die zahllosen Schwankungen zwischen tonlosen und tönenden
Lauten, in der Regel Consonanten, für die oben bereits gelegentlich
Beispiele beigebracht sind (vgl. z. B. die tonlosen
Nasale und Liquidae in der Nachbarschaft tonloser Laute,
u. dgl.). Von einem spontanen Wechsel tonloser und tönender
Laute könnte man nämlich höchstens da sprechen, wo der betreffende
Laut frei im Anlaut des Wortes oder der Silbe steht.
Hierher fällt der Uebergang tönender Mediae oder Spiranten
in tonlose (wie in oberdeutschem und mitteldeutschem baden
gegenüber norddeutschem), und umgekehrt die Erweichung
anlautender tonloser Spiranten zu tönenden (wie in norddeutschem
sausen, d. i. zau-zn gegenüber süddeutschem sau-sn
u. dgl.). Meist aber beruht jener Wechsel eben auf Assimilation,
d. h. tönende Laute lieben tönende, tonlose wieder
tonlose Laute in ihrer Umgebung. Die Neigung zur Assimilation
211ist um so stärker, je mehr die Nachbarlaute homogen
sind ; am meisten beeinflussen sich also die Geräuschlaute
unter einander, demnächst folgen die sonoren Consonanten,
zuletzt die Vocale (vgl. etwa die Sandhigesetze des Sanskrit,
S. 41, Anm. 2). Beim Zusammenstoss hat bald der eine Laut,
bald der andere das Uebergewicht (so spricht man ein Wort
wie furchtbar bald furxpar, bald furjbar aus u. dgl.). Dass
übrigens der Eintritt der Assimilation durchaus nicht nothwendig
ist, versteht sich von selbst. — Die Neigung, im
Auslaute tönende Geräuschlaute durch tonlose zu ersetzen,
beruht auf der Schwierigkeit, Stimmton und Geräusch genau
gleichzeitig abzubrechen ; zur Erleichterung bietet das frühere
Erlöschen das einfachste Mittel (vgl. S. 118).
c. Dass durch zeitliche Verschiebung der Exspiration
eine Assimilation hervorgerufen würde, ist mir nicht bekannt ;
nur insoweit durch andere Behandlung der Exspiration die
Vertheilung von Consonantgruppen auf verschiedene Silben
beeinflusst wird und von der Silbentheilung wieder z. Th. die
Assimilationen bedingt werden können, muss auch dieser
Factor in Rechnung gezogen werden.
§ 43. Nicht-assimilatorische Veränderungen durch zeitliche
Verschiebung.
1. Das eclatanteste Beispiel dieser Art von Veränderungen
sind die Metathesen, die eine vollkommene Störung der
ursprünglichen zeitlichen Folge zeigen. Für die hierbei auftretenden
grossen Abnormitäten ist noch kein bestimmtes Gesetz
gefunden (vgl. S. 198). Nur soviel lässt sich vielleicht
sagen, dass die meisten Stellentauschungen unter den Sonoren
stattfinden, und dass die Häufigkeit der Metathesen bei sonoren
Consonanten mit dem Grade ihrer Verwandtschaft mit
den Vocalen wächst. Voran stehen also r, l, dann die Nasale.
2. Einschiebung und Ausstossung von Consonanten.
Hiermit betreten wir wieder das Gebiet des regelrechten
Lautwandels. Es sind hier gemeint Fälle wie an(t)sa,
amf(p)fa, aŋ(k)xa, alf(t)sa, al(d)ra, an(d)ra udgl. Es erscheint
hierin ein Verschlusslaut eingeschoben resp. ausgestossen
zwischen zwei Dauerlauten, von denen der erste an derselben
Stelle einen Verschluss hat, wo der zweite eine spirantische
Enge erfordert ; also z. B. bei an(t)sa, al(d)ra liegt der Verschluss
212für n, l, t, d zwischen Vorderzunge und Alveolen, und
dort liegen auch die Engen für s, r. Beim Uebergang von
n, l zu s, r muss gleichzeitig das Gaumensegel gehoben resp.
müssen die seitlichen Oeffnungen des l geschlossen und die
Zungenspitze gesenkt werden. Eilt die erstere Bewegung der
zweiten voraus, wird der Nasenraum eher abgesperrt resp.
werden die Seitenöffnungen geschlossen. ehe die Zunge sich
vom Gaumen entfernt, so bleibt, wenn auch nur für einen
Moment, der Mundraum vollkommen abgeschlossen, d. h. es
schiebt sich, wenn nicht die Exspiration willkürlich unterbrochen
wird, ein Explosivlaut zwischen die beiden Laute
ein. — Durch Voreilen der Senkungsbewegung der Zunge
kann natürlich auf ganz analoge Weise ein vorhandener Explosivlaut
getilgt werden. — Hieran schliesst sich zunächst
3. Der Process der Affrication, über den S. 135 f. das
Nöthigste bereits mitgetheilt ist. Die wesentlichste Vorbedingung
ist das Zögern der Mundorgane in einer engenbildenden
Stellung vor dem Uebergang zum folgenden Vocal. Was
die ersten Ursachen des Eintrittes der Affrication betrifft, so
gehen die Affricaten am häufigsten theils aus Aspiraten hervor
(bei denen der zwischen Explosion und dem folgenden Vocal
liegende Hauch die Bildung der homorganen Spirans begünstigt),
theils aus Tenues, bei denen die Verschlussstellung der
Lage der Organe beim folgenden Vocale sehr nahe liegt : hier
kann der Uebergang langsamer bewerkstelligt werden als bei
grösseren Articulationsdifferenzen ; namentlich gilt das bei den
Palatalen. Hierzu kommt noch, dass bei diesen die Zunge auf
eine ziemlich geraume Strecke hin dem harten Gaumen angeschmiegt
ist, sodass eine bedeutende Anstrengung erfordert
wird, um sie im Moment in allen ihren Theilen vom Gaumen
zu entfernen. — Man beachte übrigens, dass bei der Bildung
tonloser Affricaten auch der Stimm ton zum verspäteten Einsatz
gezwungen wird.
4. Die Einschiebung und Absorption irrationaler
Vocale.
a. Die Svarabhakti. Mit diesem Namen bezeichnet
man neuerdings das Hervorgehen eines ursprünglich kurzen,
oder reducirten Vocales aus einem sonoren Consonanten vor
oder nach einem andern Consonanten, z. B. in ahd. aram,
berac, falah aus arm, berc, falh franz. canif aus nd. knif.
Damit Svarabhakti nach einem Consonanten eintreten könne,
muss die Silbe mit zweigipfligem Accent gesprochen werden,
213jedenfalls darf sie nicht den Acut besitzen. Dann steht nämlich
der betreffende sonore Consonant wieder gewissermassen
im Anlaut einer Nebensilbe. Er wird ganz oder theilweise als
Consonant empfunden, das erstere z. B. in a-rm, d. h. in
Fällen wo noch ein Sonant folgt, der syllabisch fungiren kann,
das letztere z. B. in be-rc u. dgl. Bei correctem Uebergang
vom ersten zum zweiten Consonanten muss eine complicirte
Bewegung ganz momentan ausgeführt werden, damit die
Uebergangslaute möglichst verschwinden. Verlangsamt sich
aber die Umstellung der specifischen Articulationen, so tritt
der dem betreffenden Sonorlaut inhärirende Stimmton zunächst
als einfacher Stimmgleitlaut (S. 151) auf, da bei dem
Umsatz der Articulationsstellung sich naturgemäss ein Moment
einstellt, in dem der Mundcanal in seiner Mittellinie nach
vorn zu geöffnet ist. Aus diesem Gleitlaut kann dann weiterhin
ein deutlich ausgeprägter Vocal entwickelt werden. In
Fällen wie canif ist ebenso eine Zwischenstufe knif mit silbenbildendem
n anzusetzen ; wird hier die n- Stellung später eingesetzt
als der Stimmton, so erscheint wieder der bekannte
einfache Stimmgleitlaut.
Svarabhakti tritt um so leichter ein, je grössere Schwierigkeiten
sich einer raschen Umsetzung der Articulationsstellung
darbieten, d. h. je grösser die Articulationsdifferenz der
Nachbarlaute ist. Zwischen nahezu homorganen Lauten,
wie ld, lt, rd, rt, tritt sie daher äusserst selten auf, wohl nie
zwischen einem Nasal und dessen homorganem Verschlusslaut.
— Ueber die ebenfalls hierher gehörige Prothese von
Vocalen vor anlautenden Sonoren s. S. 113.
b. Genau der umgekehrte Process, die Beschleunigung
des Uebergangs zu einem auf einen unbetonten Vocal folgenden
sonoren Laute, führt zur Absorption des Vocales, an
dessen Stelle der frühere Consonant Sonant wird. Beispiele
hierfür s. S. 29 ff.
Anm. 1. Winteler bezeichnet S. 117 u. ö. den Ausfall eines Vocales
nicht mit Unrecht als eine noch weitergehende Stufe der Reduction ; aber
den Ausdruck ‘Absorption’, den Winteler für diesen Vorgang gebraucht,
wird man besser auf den eben skizzirten Fall beschränken, in dem eine
Aenderung der ursprünglichen Silbenzahl nicht eintritt.
5. Epenthesen entstehen unter ganz ähnlichen Verhältnissen
wie die Umlaute (S. 210). Ein aili, aulu aus ali, alu
setzt zunächst Mouillirung resp. Labialisirung des l voraus
und demnächst ein Vorgreifen der specifischen i- und u- Articulation
214über die specifische l-Articulation hinaus. Es muss
sich dann an das a von dem Momente an, wo der Uebergang
zu dieser i-, u- Stellung gemacht wird, bis zu dem Momente,
wo auch die nachhinkende l-Articulirung perfect wird, ein
i, u anschieben. — Am meisten begünstigt werden die Epenthesen
wieder durch sonore Laute ; schwerere Consonantgruppen
hindern sie. Ausserdem ist die Grosse der Articulationsdifferenz
vielfach massgebend. Je stärker sich Lippe und
Zunge an der Bildung des beeinflussenden Vocals betheiligen,
je mehr dessen Articulation von der Ruhelage abweicht, um
so kräftiger ist die Wirkung.
6. Vocaldehnungen vor Consonantgruppen.
a. Vor Liquida, Nasal oder Spirans + Consonant.
Diese Erscheinung steht offenbar mit dem S. 165 besprochenen
Silbenaccentgesetz in engster Beziehung. Es folgen
sich danach in dieser Stellung Vocal + Fortis des Dauerlautes
+ Consonant (ald, art, ast u. s. w.). Trägt der Vocal einer
solchen Lautfolge den Acut, so bleibt dieselbe zu Folge der
starken Markirung der Kürze des Vocales für alle Zeit unversehrt
bestehen ; nicht so beim Gravis oder den zweigipfligen
Accenten ; hier bedarf es nur einer Verspätung des Ueberganges
zum folgenden Consonanten, um die Quantität des
Vocales ganz allmählich zu vergrössern, die des Consonanten
selbst aber zu mindern. So fällt bei zweigipfligem Accent der
Haupttheil des zweiten Gipfels schliesslich noch in den Vocal
selbst hinein, wir erhalten also eine Form wie ald für früheres
àld, die sich wohl im Laufe der Zeit auch zu eingipfligem
àld umgestalten kann. — Am einfachsten ist, wie man leicht
bemerkt, der Vorgang vor sonorem Dauerlaut ; daher tritt die
Dehnung vor Spiranten, namentlich tonlosen, auch viel seltener
auf, weil dabei auch noch eine zeitliche Verschiebung
des Stimmtons stattfinden muss.
Anm. 1. Dass wirklich die Accente die Hauptrolle bei diesen Dehnungen
spielen, lässt sich aus den Mundarten vielfach direkt constatiren. Hinlänglich
beweisend ist das Zeugniss des Englischen, das z. B. tint, hilt mit
Acut gewahrt, dagegen kind, mild, d. h. kaind, maild (aus älterem kind,
mild) mit zweigipfligem Accent gedehnt hat (zu beachten ist freilich auch,
dass das n, l in tint, hilt tonlos ist, aber auch das wird mit dem Accente
zusammenhängen).
b. Vor ursprünglicher Gemination (àma, àta, àsa
aus amma, atta u. s.w.). Eine Form wie amma verhält sich
einer solchen wie ampa ganz analog, denn es muss doch ganz.
215einerlei sein, ob sich an die Fortis m noch eine Lenis m oder
ein beliebiger anderer Consonant anschliesst. Es kann also
auch hier durch einfache Verzögerung der Uebergangsbewegung
vom Vocal zum Consonanten eine Dehnung des ersteren
erzeugt werden, und genau dasselbe gilt für die übrigen Fälle.
Von folgender Spirans geminata wird die erste Hälfte in den
Vocal hineingezogen, von einer Explosiva geminata aber die
Silbenpause, die zwischen Verschluss und Explosion liegt,
sodass diese beiden Momente nun unmittelbar aneinander
rücken, d. h. einfache Explosiva eintritt. Dass bei tonloser
Geminata auch eine Verschiebung der Dauer des Stimmtons
mit der der Ansatzrohrarticulation zusammenkommen muss,
ist von selbst klar.
Anm. 2. Man pflegt Erscheinungen wie die zuletzt besprochene mit
dem Namen der Ersatzdehnung zu bezeichnen, welcher doch nichts
weiter ausdrücken kann als das Factum, dass ein Laut an die Stelle eines
andern getreten ist. Man wird besser thun, diesen Ausdruck zu vermeiden,
zumal ganz verschiedenartige Dinge unter ihm vereinigt zu werden pflegen.
Man zählt z. B. dazu den Eintritt eines langen Vocals an Stelle einer Kürze
+ Nasal vor Consonanten, z. B. in altsächs. ûs für uns. Hier ist aber zunächst
durch Voraufnahme der Gaumensegelsenkung ein Nasalvocal entstanden,
der natürlich die Zeitdauer des ursprünglichen u + n besitzt
(d. h. lang ist, S. 208 und 191), und dieser hat in einer spätem Periode
seine Nasalirung wieder eingebüsst.216
11 Aber consequent ist man darin auch nicht immer gewesen, wenn man
z. B. ein schwaches, consonantisch gebrauchtes i, u vor einem stärkeren,
sonantischen Vocale (ia, ua, s. § 19) als Halbvocal j, w bezeichnet, und
von den semantischen i, u losreisst, obwohl da nur ein Unterschied der
Stärke und Dauer vorliegt, der lediglich für die Silbenbildung in Betracht
kommt.
21 Ich führe als Beispiel eine Reihe von Lauten aus nordamerikanischen
Indianersprachen an, die ich kürzlich durch die Güte des bekannten Reisenden,
Herr A. Pinart, kennen zu lernen Gelegenheit hatte; ich bin freilich
nicht im Stande dieselben nachzuahmen oder sie auch nur annähernd
richtig zu beschreiben, weiss aber wenigstens soviel dass bei ihrer
Hervorbringung Theile des Sprachorgans gleichzeitig in Thätigkeit versetzt
werden, an deren Combinirbarkeit Niemand von uns gedacht haben
würde.
31 Ich gebe, da ich. dieses System selbst nur aus schriftlichen Darstellungen
kenne, die Beschreibung desselben in möglichst wörtlichem Anschluss
an die Darstellung von Sweet, Handbook 8 ff. und die vortrefflichen
Ausführungen von Storm, Englische Philologie 56 ff. 63 ff.
41 Vgl. hierzu namentlich die Abhandlung von Sweet, Words, Logic
and Grammar, in den Transactions of the Philol. Society, London 1875—
76, S. 470—503.